|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg
Kochendorf mit
Jagstfeld (Stadt Bad Friedrichshall,
Landkreis Heilbronn)
Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Kochendorf,
wo bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts mehrere weltliche und geistliche
Herrschaften Besitzrechte hatten, bestand eine jüdische Gemeinde bis 1925. Ihre
Entstehung geht in die Zeit des 16./18. Jahrhunderts zurück. Erstmals
werden 1535, dann wieder 1556 Juden am Ort genannt. Der erste namentlich
bekannte Kochendorfer Jude war Isaak von Kochendorf (1588 erwähnt). Weitere
namentlich in Kochendorf genannte Juden waren Isaak (1592), Esaias (1594),
Lazarus (1617/20), Witwe des Joseph (1639). Nachdem seit 1670/72 der Ort zwei
Herrschaften gehörten (bislang schon die Herren von Greck, nun auch die Herren
von Saint André), lebten unter beiden Ortsherrschaften Juden.
Um 1735/40 kann eine jüdische Gemeinde am Ort vorausgesetzt werden.
Damals lebten die Kochendorfer Juden u.a. vom Geldverleih. Ein Erlass der
Deutschordens-Regierung von 1739 ordnete an, dass die Kochendorfer Juden an
Sonn- und Feiertagen bei den Ordensuntertanen kein Geld einziehen durften, und
drohte allen, die diesem Gebot zuwiderhandelten, Arreststrafen an.
Als Kochendorf 1806 an Württemberg fiel, lebten 78 jüdische Personen am
Ort. 1828 erscheinen bei der Annahme erblicher Familiennamen folgende Namen):
Neumann, Herz, Baruch, Däfele, Salomon, Kahn, Gutmann, Weissburger, Kalmann,
Levi, Moses, Eisig, Oppenheimer, Löw. Die meisten verdienten den
Lebensunterhalt als Handelsleute, mehrere jedoch auch als Metzger, einer als Bäcker.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1808 88 jüdische Einwohner, 1822 92, 1826 102, 1829 113, 1833 125,
1838 131, 1841 132, 1846 Höchstzahl mit 155 Personen, 1858 136, 1864
124, 1871 94, 1875 86, 1880 71, 1885 56, 1890 54, 1895 50, 1900 40, 1905 48,
1910 30. Von 1828 bzw. 1832 an gehörte
Neckarsulm als Filiale zur jüdischen Gemeinde in Kochendorf, die
Filialgemeinde wurde 1875 aufgelöst. Die in Neckarsulm lebenden jüdischen
Personen gehörten weiterhin zur Gemeinde in Kochendorf (nennt sich 1892
israelitische Gemeinde Kochendorf-Neckarsulm). 1847 gehörten zur Gemeinde
Kochendorf neben den in Neckarsulm lebenden jüdischen Personen auch diejenigen
in Oedheim und Gundelsheim (Allgemeine
Zeitung des Judentums 29.11.1847 S. 725).
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine
Religionsschule, ein rituelles Bad und einen Friedhof.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer
angestellt, der auch als Vorbeter und Schochet tätig war (siehe Ausschreibungen
der Stelle unten). Im 19. Jahrhundert genoss besondere Anerkennung am Ort Lehrer Isac Weil, der 1860 in Kochendorf sein 25-jähriges Dienstjubiläum feiern konnte
(siehe Berichte unten) und hier noch bis 1865 blieb. Ihm folgte 1865/66 für einige
Monate vertretungsweise Samuel Rödelsheimer (zuvor Lehrer in Buchau,
ab Januar 1867 in Pflaumloch). Weitere
Lehrer waren: um 1887 Lehrer Jakob Rosenthal (unklar, ob Lehrer in der
israelitischen Gemeinde, da als "Religionslehrer an der Großherzoglichen
Realschule [in Bad Wimpfen] zur Zeit in Kochendorf" genannt, siehe unten), um 1889/91 Lehrer
G. Ledermann, um 1892 Adolph
Mayer (unterrichtete auch in Oedheim, 1892
dort neun Kinder), 1893/94 Lehrer Max Marx (aus
Hohebach, ab 1894 in Rexingen, ab 1898
in Buchau), um 1896/1898 Siegfried Erlebacher (aus
Baisingen, ab 1901 in
Nordstetten, ab 1906 in
Oberdorf; unter ihm waren 1898 in
Kochendorf 12 Kinder zu unterrichten, in Oedheim neun Kinder), 1899
Moritz Kulb (um 1899/1903; aus Hösbach, ab 1901 Lehrer
in Sontheim, ab 1926 in
Öhringen), A. Adler (unterrichtete 1903
in Kochendorf elf, in Oedheim neun Kinder).
Die Gemeinde wurde
1832 dem Bezirksrabbinat Lehrensteinsfeld
zugeteilt.
An Vereinen gab es in der Gemeinde: um 1892 (Israelitische Gemeinde
Kochendorf-Neckarsulm) ein Talmud-Tora-Verein (1892 unter Leitung von D.
Kahn) und ein Israelitischer Frauenverein (1892 unter Leitung der Frau
von M. Herz, Frau Marie Herz, Frau von Th. Kahn), um 1898 ein Wohltätigkeitsverein
Gemilus Chessed. Dazu werden 1892/1903 vier Stiftungen genannt: die Süßkind'sche Stiftung, die Baruch'sche Stiftung, die Maromstiftung und die
Tefelestiftung. Um 1903 wird der Israelitische Frauenverein und ein Leseverein genannt.
Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1892 (Israelitische
Gemeinde Kochendorf-Neckarsulm) L. Levi, D. Kahn, L. Herz und R. Reinganum
(letzterer aus Neckarsulm); um 1898/1903 D. Kahn, L. Herz
und L. Weißburger.
Im Ersten Weltkrieg wurden von den jüdischen Kriegsteilnehmern für ihren
Kriegseinsatz ausgezeichnet: 1915 Leo Weißburger sowie 1917 Wilhelm Weißburger
(Sohn von L. Weißburger), jeweils mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse.
Die jüdischen Familien lebten überwiegend vom Handel mit Vieh und
Landesprodukten. An ehemaligen, bis nach 1933 bestehenden Handelsbetrieben
im Besitz jüdischer Familien sind bekannt: Viehhandlung Emanuel und Julius Herz
(Hauptstraße 29), Kurz-, Weiß- und Wollwarengeschäft Hannchen Herz
(Kirchbrunnenstraße 4), Mehlhandlung Jakob Herz (Hauptstraße 30).
1933 lebten noch sieben jüdische Personen in Kochendorf. In
den folgenden Jahren ist ein Teil der
jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,
der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert.
Von den in Kochendorf geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"; im "Gedenkbuch"
teilweise Eintragungen nicht unter "Kochendorf", sondern unter
"Bad Friedrichshall"): Karoline Grünstein geb. Herz (1857), Hannchen Herz (1872), Julie Herz (1870), Julius Jakob Herz (1871), Nathan
Seligmann Herz (1856), Hans Jaffé (1885), Jakob Jaffé (1884), Elise Kahn geb.
Weissburger (1892), Mina Maier (1869), Lina Salomon (1859), Hedwig Stern geb.
Herz (1869), Hedwig Weissburger (1880), Ludwig Weissburger (1905), Wilhelm
Weissburger (1902).
KZ-Außenkommando: Von September 1944 bis April 1945 bestand in Kochendorf ein Außenkommando des Konzentrationslagers Natzweiler/Elsaß. Die Zahl der Häftlinge betrug zwischen 1200 und 1700
Personen, darunter ein großer Teil Juden. Die Häftlinge arbeiteten vor allem im Salzbergwerk Kochendorf und in zwei Industriebetrieben. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen waren katastrophal. Obwohl mehrere
sogenannte Krankentransporte Kochendorf verließen (u.a. nach Dachau und Vaihingen an der Enz), starben hier
mindestens 389 Zwangsarbeiter. Sie wurden später auf den KZ-Friedhof am Reichertsberg in Kochendorf umgebettet. Eine Gedenkstätte mit Gedenktafel wurde hier eingerichtet.
In einer abgebauten Salzhalle des Besucherbergwerkes Bad Friedrichshall (Bergrat-Bilfinger-Straße) wurde 1999 eine Gedenkstätte und Ausstellung zur Geschichte des KZ-Außenkommandos Kochendorf eingerichtet. Träger der Gedenkstätte ist die Miklos-Klein-Stiftung Bad Friedrichshall.
In Jagstfeld bestand von ca. 1879 bis 1893
die jüdische Speisewirtschaft von Hermann Herz aus Kochendorf
(Deutschordensstraße 17; zwischen 1879 und 1892 gab es nahezu 30 Trauungen
jüdischer Paare in Jagstfeld).
Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1872 /
1876 / 1887 / 1891 / 1893
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Dezember 1872:
"Religionslehrer- und Vorsänger-Gesuch. Die Gemeinde
Kochendorf sucht per 1. Januar 1873 einen Religionslehrer und Vorsänger,
welcher auch den Religionsunterricht in Oedheim und Neckarsulm
wöchentlich 2 Mal mit je 2 Stunden zu erteilen hat. Gehalt 475 fl. pro
Jahr nebst freier Wohnung und Emolumenten. Qualifizierte, unverheiratete
Bewerber wollen ihre Zeugnisse franko dem Unterzeichneten einsenden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Dezember 1872:
"Religionslehrer- und Vorsänger-Gesuch. Die Gemeinde
Kochendorf sucht per 1. Januar 1873 einen Religionslehrer und Vorsänger,
welcher auch den Religionsunterricht in Oedheim und Neckarsulm
wöchentlich 2 Mal mit je 2 Stunden zu erteilen hat. Gehalt 475 fl. pro
Jahr nebst freier Wohnung und Emolumenten. Qualifizierte, unverheiratete
Bewerber wollen ihre Zeugnisse franko dem Unterzeichneten einsenden.
Heilbronn am Neckar, 19. November 1872. Das Königlich Württembergisch
Bezirks-Rabbiner: Dr. M. Engelbert." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1876:
"Die Religionslehrer- und Vorsängerstelle in Kochendorf, welche
Mitte Juli dieses Jahres vakant wird, soll alsbald wieder besetzt werden.
Der Gehalt für diese Stelle, mit welcher der Religionsunterricht in
Oedheim und Neckarsulm verbunden ist, beträgt 8.0 (?) Mark pro Jahr
nebst freier Wohnung und Emolumenten. Qualifizierte Bewerber wollen ihre
Meldungen und Zeugnisse innerhalb 3 Wochen dem Unterzeichneten
einsehen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1876:
"Die Religionslehrer- und Vorsängerstelle in Kochendorf, welche
Mitte Juli dieses Jahres vakant wird, soll alsbald wieder besetzt werden.
Der Gehalt für diese Stelle, mit welcher der Religionsunterricht in
Oedheim und Neckarsulm verbunden ist, beträgt 8.0 (?) Mark pro Jahr
nebst freier Wohnung und Emolumenten. Qualifizierte Bewerber wollen ihre
Meldungen und Zeugnisse innerhalb 3 Wochen dem Unterzeichneten
einsehen.
Heilbronn am Neckar, 12. Juni 1876. Das Königliche Bezirksrabbiner. Dr.
M. Engelbert." |
| |
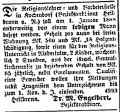 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Oktober 1887:
"Die Religionslehrer- und Vorbeterstelle in Kochendorf
(Bezirksrabbinat Heilbronn am Neckar) soll am 1. Januar 1888 anderweitig
von einem ledigen Mann besetzt werden. Gehalt pro anno bei freier
Wohnung Mark 560 und Mark 18 Holzentschädigung, sowie einen für den
Religionsunterricht in Neckarsulm, 2 Kinder, wöchentlich 2 Stunden, aus
der israelitischen Zentralkirchenkasse zu beziehenden Gehalte von Mark 85
jährlich, nebst Emolumenten. Qualifizierte Bewerber wollen ihre Meldungen
nebst Zeugnissen dem Unterzeichneten bis zum 1. November dieses Jahres
einsenden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Oktober 1887:
"Die Religionslehrer- und Vorbeterstelle in Kochendorf
(Bezirksrabbinat Heilbronn am Neckar) soll am 1. Januar 1888 anderweitig
von einem ledigen Mann besetzt werden. Gehalt pro anno bei freier
Wohnung Mark 560 und Mark 18 Holzentschädigung, sowie einen für den
Religionsunterricht in Neckarsulm, 2 Kinder, wöchentlich 2 Stunden, aus
der israelitischen Zentralkirchenkasse zu beziehenden Gehalte von Mark 85
jährlich, nebst Emolumenten. Qualifizierte Bewerber wollen ihre Meldungen
nebst Zeugnissen dem Unterzeichneten bis zum 1. November dieses Jahres
einsenden.
Heilbronn. Dr. M. Engelbert, Bezirksrabbiner." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. August 1891:
"Kochendorf. Die Stelle als Religionslehrer und Vorbeter
in hiesiger Gemeinde ist per sofort oder längstens innerhalb drei Monaten
zu besetzen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. August 1891:
"Kochendorf. Die Stelle als Religionslehrer und Vorbeter
in hiesiger Gemeinde ist per sofort oder längstens innerhalb drei Monaten
zu besetzen.
Jährliches Einkommen, bei freier Wohnung, Mark 560,
Holzgeldentschädigung Mark 18, für die Filiale Neckarsulm Mark 85 und
nicht unbedeutende Nebenverdienste.
Ledige, seminaristisch gebildete Lehrer wollen sich melden und Zeugnisse beifügen.
Kochendorf bei Heilbronn, 9. August 1891. Vorsteheramt: Levi." |
| |
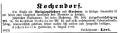 Anzeige in "Der Israelit" vom 13. August 1891: "Kochendorf. Die Stelle als Religionslehrer und Vorbeter
in hiesiger Gemeinde ist per sofort oder längstens innerhalb drei Monaten
zu besetzen. Anzeige in "Der Israelit" vom 13. August 1891: "Kochendorf. Die Stelle als Religionslehrer und Vorbeter
in hiesiger Gemeinde ist per sofort oder längstens innerhalb drei Monaten
zu besetzen.
Jährliches Einkommen, bei freier Wohnung, Mark 560,
Holzgeldentschädigung Mark 18, für die Filiale
Neckarsulm Mark 85 und
nicht unbedeutende Nebenverdienste.
Ledige, seminaristisch gebildete Lehrer wollen sich melden und Zeugnisse beifügen.
Kochendorf bei Heilbronn, 9. August 1891. Vorsteheramt: Levi."
|
| |
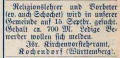 Anzeige in "Jeschurun" vom 28. Juli 1893: "Religionslehrer
und Vorbeter (eventuell auch Schochet) wird in unserer Gemeinde auf 15.
September gesucht. Gehalt circa 700 Mark. Ledige Bewerber wollen sich melden.
Israelitisches Kirchenvorsteheramt, Kochendorf (Württemberg)." Anzeige in "Jeschurun" vom 28. Juli 1893: "Religionslehrer
und Vorbeter (eventuell auch Schochet) wird in unserer Gemeinde auf 15.
September gesucht. Gehalt circa 700 Mark. Ledige Bewerber wollen sich melden.
Israelitisches Kirchenvorsteheramt, Kochendorf (Württemberg)."
|
| |
 Anzeige in "Der Israelit" vom 3. August 1893: "Religionslehrer
und Vorbeter Anzeige in "Der Israelit" vom 3. August 1893: "Religionslehrer
und Vorbeter
auch Schochet, wird in unserer Gemeinde auf 15. September gesucht. Gehalt
715 Mark, sowie Erträgnisse der Schechita.
Ledige Bewerber wollen sich melden beim
Israelitischen Kirchenvorsteheramt, Kochendorf (Württemberg)." |
25-jähriges Dienstjubiläum von Lehrer Isac Weil (1860)
Anmerkung: Lehrer Isak Aron Weil ist am 30. November 1808
in Rexingen geboren als Sohn von Aron Moses Weil und seiner Frau Guta geb. Levi.
Er war seit 1837 verheiratet mit der aus Sontheim stammenden Johanna geb.
Güldenstein. Aron Weil war bis 1865 Lehrer in Kochendorf, danach in Freudental. Zuletzt lebte er in Stuttgart als Privatier, wo er am 1. März 1883
gestorben ist. Seine Frau starb am 15. Juni 1894 in Stuttgart. Beide sind im
israelitischen Teil des Pragfriedhofes beigesetzt (Hahn Pragfriedhof S.
220).
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Juni 1860:
"Aus Württemberg, im März (1860; Privatmitteilung). Wenn
Personen in hoher amtlicher Stellung fetiert werden, so ist dieses nicht
zu bewundern, wenn aber stilles Verdienst anerkannt wird, in einem
länglichen Kreise, wo das Jubiläisieren noch nicht zur herrschenden
Tagesmode geworden ist, so verdient es auch in weiteren Kreisen bekannt zu
werden. der schwäbische Merkur vom 2. dieses Monats berichtet: Am 28.
vorigen Monats (sc. Januar) beging die israelitische Gemeinde Kochendorf
am Sabbat das 25-jährige Dienstjubiläum ihres Schulmeisters und
Vorsängers Weil, der dort ein Vierteljahrhundert treu an Synagoge und
Schule wirkt. Der Jubilar sprach in der festlich geschmückten Synagoge in
der Sabbatpredigt über seine Wirksamkeit in tief gefühlter frommer Rede.
Die Gemeindeältesten überreichten ihm im Namen der Gemeinde einen
kostbaren silbernen Pokal mit sinnreichen Inschriften..." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Juni 1860:
"Aus Württemberg, im März (1860; Privatmitteilung). Wenn
Personen in hoher amtlicher Stellung fetiert werden, so ist dieses nicht
zu bewundern, wenn aber stilles Verdienst anerkannt wird, in einem
länglichen Kreise, wo das Jubiläisieren noch nicht zur herrschenden
Tagesmode geworden ist, so verdient es auch in weiteren Kreisen bekannt zu
werden. der schwäbische Merkur vom 2. dieses Monats berichtet: Am 28.
vorigen Monats (sc. Januar) beging die israelitische Gemeinde Kochendorf
am Sabbat das 25-jährige Dienstjubiläum ihres Schulmeisters und
Vorsängers Weil, der dort ein Vierteljahrhundert treu an Synagoge und
Schule wirkt. Der Jubilar sprach in der festlich geschmückten Synagoge in
der Sabbatpredigt über seine Wirksamkeit in tief gefühlter frommer Rede.
Die Gemeindeältesten überreichten ihm im Namen der Gemeinde einen
kostbaren silbernen Pokal mit sinnreichen Inschriften..." |
| |
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Juli 1860:
"Aus Württemberg, Ende Mai (1860; Privatmitteilung). Die
israelitische Gemeinde Kochendorf feierte am 28. Januar dieses
Jahres das 25-jährige Dienstjubiläum ihres Schullehrers und
Vorsängers Isac Weil. Schon am frühen Morgen gingen von einzelnen
Gemeindegenossen und ehemaligen und abwesenden Schülern Glückwünsche
unter Anschluss von Festgeschenken ein. Um 8 1/2 Uhr begann der
Gottesdienst in der festlich geschmückten Synagoge, wo sich neben
sämtlichen israelitischen Gemeindegenossen auch viele christliche Einwohner
einfanden. In der Predigt sprach der Jubilar in tief gefühlter Rede über
seine Wirksamkeit. Es war nicht ein einziger unter den zahlreichen
Zuhörern, welcher nicht sichtlich ergriffen war. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Juli 1860:
"Aus Württemberg, Ende Mai (1860; Privatmitteilung). Die
israelitische Gemeinde Kochendorf feierte am 28. Januar dieses
Jahres das 25-jährige Dienstjubiläum ihres Schullehrers und
Vorsängers Isac Weil. Schon am frühen Morgen gingen von einzelnen
Gemeindegenossen und ehemaligen und abwesenden Schülern Glückwünsche
unter Anschluss von Festgeschenken ein. Um 8 1/2 Uhr begann der
Gottesdienst in der festlich geschmückten Synagoge, wo sich neben
sämtlichen israelitischen Gemeindegenossen auch viele christliche Einwohner
einfanden. In der Predigt sprach der Jubilar in tief gefühlter Rede über
seine Wirksamkeit. Es war nicht ein einziger unter den zahlreichen
Zuhörern, welcher nicht sichtlich ergriffen war.
Nach der Predigt begaben sich die Gemeindeältesten vor die heilige Lade,
sprachen dem Jubilar ihre Anerkennung über seine Wirksamkeit in Synagoge
und Schule aus und überreichten ihm im Namen der Gemeinde einen sehr
kostbaren silbernen Pokal mit entsprechenden sinnreichen Inschriften.
Hierauf trat die israelitische Schuljugend vor, sprach durch eine
Abordnung ihre Dankbarkeit und Glückwünsche aus, und überreichte
ebenfalls ein sehr schönes Andenken.
Nach dem Gottesdienste begaben sich sämtliche Familiengenossen, Männer
und Frauen, in die Wohnung des Gefeierten, brachten ihm dort ihre besonderen
Glückwünsche dar, und an der Heiterkeit, die in dieser Versammlung
herrschte, konnte man deutlich sehen, wie sich's jeder Einzelne angelegen
sein ließ, das Fest zu seinem eigenen zu machen. Abends brachte der
christliche Gesangverein dem Jubilar ein Ständchen. Von vielen seiner
Kollegen, um die er sich teils durch Beiträge für die pädagogischen
Journale, teils und besonders in letzter Zeit durch Anregung zu
Versammlungen und Einreichung von Bittschriften behufs der
Besoldungs-Aufbesserung der israelitischen Konfessions-Schullehrer
Württembergs verdient gemacht hat, trafen Glückwünsche
ein." |
Lehrer Isac Weil verkauft zwei Torarollen
(1862)
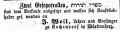 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. April 1862:
"Zwei Gesetzesrollen, Sifrei HaTora Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. April 1862:
"Zwei Gesetzesrollen, Sifrei HaTora
sind dem Verkaufe ausgesetzt und wollen sich Kaufsliebhaber gefälligst
wenden an
J. Weil, Lehrer und Vorsänger zu Kochendorf in
Württemberg." |
Lehrer Isac Weil ist
Vertrauensmann der Regierung in der Regelung der neuen Schulgesetzgebung (1863)
Anmerkung: die Berufung von Lehrer Weil scheint nicht unumstritten gewesen zu
sein, da Lehrer Leopold Liebmann in Esslingen damals eine herausragende Rolle in
der jüdischen Lehrerschaft Württembergs innehatte. Auch gerät die Berufung Weils in die
damalige starke Auseinandersetzung zwischen den liberal gesinnten und den
orthodox geprägten jüdischen Gemeindegliedern Württembergs, das heißt - im Blick
auf die unten stehenden Artikel - zwischen der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
(liberal) und der Zeitschrift "Der Israelit" (orthodox).
 Artikel
in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 24. November 1863: "Aus
Württemberg, im November (Privatmitteilung). Der neue Gesetzentwurf zur
Regelung der bürgerlichen Stellung der Israeliten ist erschienen. Der
Judeneid soll fallen, die Zivilehe gestattet und die
Armenunterhaltung den bürgerlichen Gemeinden zugewiesen werden. Auch die
neue Schulgesetzgebung liegt im Entwurf vor. Nicht Herr Lehrer Liebmann
aus Esslingen sondern Herr Lehrer
Weil aus Kochendorf war als Vertrauensmann einberufen. Die Gehalte der
Lehrer werden erhöht, alle Leistungen beim Gottesdienste von Seiten der
Lehrer müssen besonders honoriert werden. Die israelitischen Lehrer und
Schulen bleiben den königlichen Oberschulbehörden untergeordnet, nur
der Religionsunterricht bleibt den Rabbinern unterstellt. Das
Kultministerium beruhigt die israelitischen Lehrer wegen der gefürchteten
Aufhebung der Konfessionsschulen; deren Auflösung kann nur stattgegeben
werden, wenn die derweiligen Inhaber anderweitig versorgt sind. Das System
der Oberlehrer wird eingeführt und den Gemeinden wird eine
Mitbeaufsichtigung der Schulen gestattet. Die Schulinspektoren, sowohl die
örtlichen als die Bezirksschulinspektoren, müssen eine Prüfung in Pädagogik
und Didaktik bestehen. - In Stuttgart
und Buchau wurde der 18. Oktober in den
Synagogen festlich begangen und haben beide Redner ihre Aufgabe musterhaft
gelöst. Artikel
in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 24. November 1863: "Aus
Württemberg, im November (Privatmitteilung). Der neue Gesetzentwurf zur
Regelung der bürgerlichen Stellung der Israeliten ist erschienen. Der
Judeneid soll fallen, die Zivilehe gestattet und die
Armenunterhaltung den bürgerlichen Gemeinden zugewiesen werden. Auch die
neue Schulgesetzgebung liegt im Entwurf vor. Nicht Herr Lehrer Liebmann
aus Esslingen sondern Herr Lehrer
Weil aus Kochendorf war als Vertrauensmann einberufen. Die Gehalte der
Lehrer werden erhöht, alle Leistungen beim Gottesdienste von Seiten der
Lehrer müssen besonders honoriert werden. Die israelitischen Lehrer und
Schulen bleiben den königlichen Oberschulbehörden untergeordnet, nur
der Religionsunterricht bleibt den Rabbinern unterstellt. Das
Kultministerium beruhigt die israelitischen Lehrer wegen der gefürchteten
Aufhebung der Konfessionsschulen; deren Auflösung kann nur stattgegeben
werden, wenn die derweiligen Inhaber anderweitig versorgt sind. Das System
der Oberlehrer wird eingeführt und den Gemeinden wird eine
Mitbeaufsichtigung der Schulen gestattet. Die Schulinspektoren, sowohl die
örtlichen als die Bezirksschulinspektoren, müssen eine Prüfung in Pädagogik
und Didaktik bestehen. - In Stuttgart
und Buchau wurde der 18. Oktober in den
Synagogen festlich begangen und haben beide Redner ihre Aufgabe musterhaft
gelöst.
Es entsteht jetzt Mangel an musikalisch gebildeten Kantoren und es wäre sehr
wünschenswert, wenn bei der Bildung der Lehrer die Musik und der Gesang mehr
berücksichtigt würden. Drei Gemeinden in Württemberg sind jetzt mit Orgeln
beim Gottesdienst versehen; sie werden aber wohl länger vereinzelt stehen,
denn die Stuttgarter Liturgie ist sonst nirgends eingeführt. In
Ulm wird bald ein Synagogenbau zum
Bedürfnis werden und Heilbronn muss
auch folgen. Das Judentum blüht in den guten Städten. " |
| |
 Artikel
in "Der Israelit" vom 25. November 1863: "Aus Württemberg,
12. November. Der von der württembergischen Regierung seinerzeit dem
ständigen Ausschüsse zugestellte Gesetzesentwurf über die die
Gleichstellung der Israeliten in Absicht auf die bürgerlichen
Verhältnisse - wie dies in staatsrechtlicher Hinsicht bereits der Fall ist -
soll von der ständigen Kommission beraten und auf Annahme des Entwurfs
angetragen sein. Als ein neuer Beweis, wie sehr es der königlichen Regierung
um diese Gleichstellung in allen Zweigen der Verwaltung ernst ist, mag
indessen auch der Umstand gelten, dass in die neulich zur Beratung über
Revision des allgemeinen Schulgesetzes zusammengetretene Kommission -
bestehend aus dem Referenten beider Oberschulbehörden (?), den
Seminarrektoren, vier Bezirksbeamten und einigen Geistlichen und Lehrern der
evangelischen und katholischen Konfession - auch ein Mitglied des
israelitischen Schulvorstandes, nämlich Lehrer Weil in Kochendorf,
von dem königlichen Kultusministerium berufen wurde. Es sollen die
Beratungen gedachter Kommission, welche stets unter der unmittelbaren sehr
umsichtigen Leitung des Herrn Kultusministers gefördert wurden, circa zwei
Wochen in Anspruch genommen haben und durch dieselben sowohl der Stand der
Schulen wesentlich gehoben, als die ökonomischen Verhältnisse der Lehrer
verbessert werden." Artikel
in "Der Israelit" vom 25. November 1863: "Aus Württemberg,
12. November. Der von der württembergischen Regierung seinerzeit dem
ständigen Ausschüsse zugestellte Gesetzesentwurf über die die
Gleichstellung der Israeliten in Absicht auf die bürgerlichen
Verhältnisse - wie dies in staatsrechtlicher Hinsicht bereits der Fall ist -
soll von der ständigen Kommission beraten und auf Annahme des Entwurfs
angetragen sein. Als ein neuer Beweis, wie sehr es der königlichen Regierung
um diese Gleichstellung in allen Zweigen der Verwaltung ernst ist, mag
indessen auch der Umstand gelten, dass in die neulich zur Beratung über
Revision des allgemeinen Schulgesetzes zusammengetretene Kommission -
bestehend aus dem Referenten beider Oberschulbehörden (?), den
Seminarrektoren, vier Bezirksbeamten und einigen Geistlichen und Lehrern der
evangelischen und katholischen Konfession - auch ein Mitglied des
israelitischen Schulvorstandes, nämlich Lehrer Weil in Kochendorf,
von dem königlichen Kultusministerium berufen wurde. Es sollen die
Beratungen gedachter Kommission, welche stets unter der unmittelbaren sehr
umsichtigen Leitung des Herrn Kultusministers gefördert wurden, circa zwei
Wochen in Anspruch genommen haben und durch dieselben sowohl der Stand der
Schulen wesentlich gehoben, als die ökonomischen Verhältnisse der Lehrer
verbessert werden." |
| |
 Artikel
in "Der Israelit" vom 9. Dezember 1863: "Vom Neckar.
Herr Rabbiner Dr. Engelbert in
Lehrensteinsfeld berichtet in Nummer 47 der 'Allgemeinen Zeitung des
Judentums' über die Berufung des Herrn Lehrers Weil in Kochendorf in
die Schulkommission; auch wir kennen Herrn Weil als gebildeten und tüchtigen
Lehrer, weshalb wir bedauern müssen, dass der erwähnte Berichterstatter
demselben sein verdientes Lob nicht spenden konnte, ohne uns den Pferdefuß
sehen zu lassen. Würde es etwa der Würdigkeit des Herrn Weil Eintrag tun,
wenn es neben ihm, was sicherlich der Fall ist, noch andere ebenso würdige
Lehrer gebe, die aber umgangen werden mussten, weil die Behörde eben nur
einen berufen konnte? Hat nicht dieselbe 'Allgemeine Zeitung des Judentums'
unlängst fälschlich berichtet, Herr Lehrer Liebmann aus
Esslingen wäre in die Kommission
berufen und diesen bei dieser Gelegenheit mit noch mehr Lobspendungen
übergossen, nun ist Herr Weil auf einmal vor Allen der Würdigste. Wir kennen
das hier zu Lande wohl; Herr Dr. Engelbert wollte eben im Vorübergehen einem
gewissen Lehrer Eins versetzen, darum ist er Herrn Weil ... Wir möchten uns
auch die bescheidene Frage erlauben, woher denn Herr Dr. Engelbert in der
kurzen Zeit seines Aufenthalts in Württemberg alle Lehrer schon so genau
kenne, dass er den würdigsten schon herausgefunden. Uns will das als
Arroganz erscheinen, die aber die Lehrer Württembergs darum nicht in
Harnisch bringen wird, weil sie wissen, dass gewisse Leute nicht eher
Zeitungsartikel schreiben, bis sie ihren Gönnern schmeicheln oder auf
ehrliche Weise unangreifbare Feinde beleidigen wollen; dann finden Sie in
der Zeitung des Judentums einen geräumigen Tummelplatz. Artikel
in "Der Israelit" vom 9. Dezember 1863: "Vom Neckar.
Herr Rabbiner Dr. Engelbert in
Lehrensteinsfeld berichtet in Nummer 47 der 'Allgemeinen Zeitung des
Judentums' über die Berufung des Herrn Lehrers Weil in Kochendorf in
die Schulkommission; auch wir kennen Herrn Weil als gebildeten und tüchtigen
Lehrer, weshalb wir bedauern müssen, dass der erwähnte Berichterstatter
demselben sein verdientes Lob nicht spenden konnte, ohne uns den Pferdefuß
sehen zu lassen. Würde es etwa der Würdigkeit des Herrn Weil Eintrag tun,
wenn es neben ihm, was sicherlich der Fall ist, noch andere ebenso würdige
Lehrer gebe, die aber umgangen werden mussten, weil die Behörde eben nur
einen berufen konnte? Hat nicht dieselbe 'Allgemeine Zeitung des Judentums'
unlängst fälschlich berichtet, Herr Lehrer Liebmann aus
Esslingen wäre in die Kommission
berufen und diesen bei dieser Gelegenheit mit noch mehr Lobspendungen
übergossen, nun ist Herr Weil auf einmal vor Allen der Würdigste. Wir kennen
das hier zu Lande wohl; Herr Dr. Engelbert wollte eben im Vorübergehen einem
gewissen Lehrer Eins versetzen, darum ist er Herrn Weil ... Wir möchten uns
auch die bescheidene Frage erlauben, woher denn Herr Dr. Engelbert in der
kurzen Zeit seines Aufenthalts in Württemberg alle Lehrer schon so genau
kenne, dass er den würdigsten schon herausgefunden. Uns will das als
Arroganz erscheinen, die aber die Lehrer Württembergs darum nicht in
Harnisch bringen wird, weil sie wissen, dass gewisse Leute nicht eher
Zeitungsartikel schreiben, bis sie ihren Gönnern schmeicheln oder auf
ehrliche Weise unangreifbare Feinde beleidigen wollen; dann finden Sie in
der Zeitung des Judentums einen geräumigen Tummelplatz.
Über die sonstigen Behauptungen des Herrn Doktors müssen wir einige Zweifel
aussprechen. Wir stimmen mit ihm überein, dass viele unserer Gemeinden
religiös sind; es ist aber unwahr, dass das von der Tätigkeit der
Oberkirchenbehörde herrührt. Es kann unmöglich wahr sein, dass man in
den Duodezgemeinden des Lehrener
Bezirks täglich zweimal Gottesdienst hält, weil es nicht Minjan geben
würde; wir wollen Herrn Dr. Engelbert mehrere Haushaltungen nennen, die
nicht koscher sind; in Heilbronn allein sind sieben Geschäfte
offen und mehrere lassen durch Kommissionäre arbeiten. Zwei Lehrer des
Bezirks, die Schochetim (Schächter) sind, lassen unter ihren Augen
ihre Kinder am Schabbat arbeiten.
Wir vermissen in der Liste der von Herrn Dr. Engelbert aufgezählten Bezirke
manchen Ortsnamen; sind diese nicht auch auf der Karte von Württemberg zu
finden? Wenn er Laupheim nennt, so
müssen wir ihn an Ulm erinnern, wo das
Unjudentum (aus Sicht des 'Israelit': das liberale Judentum) so dick
wie die dortigen Festungsmauern ist; bei der Erwähnung von
Braunsbach müssen wir in
Crailsheim denken, wo man erst
neuerdings die Stuttgarter Liturgie eingeführt hat; steht dieses auch auf
dem Boden des Schulchan Aruch (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schulchan_Aruch) ? Was Herr Dr.
Engelbert über unsere religiösen Zustände sagt ist unverkennbar tendenziöse
Übertreibung, die es mit der Wahrheit nicht sehr genau zu nehmen scheint." |
Lehrer Isac Weil wird nach
Freudental versetzt (1865)
 Artikel
in "Der israelitische Lehrer" vom 2. März 1865: "Württemberg.
Herr Lehrer Rosenthal in Crailsheim
hat den Synodalpreis erhalten, Weil von Kochendorf ist nach
Freudental an die Stelle des Ludwig
Stern ... befördert worden. Nach dem neuesten Etat werden 28
israelitische Lehrer 400 fl.; 4 weitere 425 fl.; zwei andere 500 fl. und
einer 600 fl. Gehalt jährlich erhalten. Ein Unterlehrer 42 fl., ein anderer
260 fl. und ein Hilfslehrer 170 fl." Artikel
in "Der israelitische Lehrer" vom 2. März 1865: "Württemberg.
Herr Lehrer Rosenthal in Crailsheim
hat den Synodalpreis erhalten, Weil von Kochendorf ist nach
Freudental an die Stelle des Ludwig
Stern ... befördert worden. Nach dem neuesten Etat werden 28
israelitische Lehrer 400 fl.; 4 weitere 425 fl.; zwei andere 500 fl. und
einer 600 fl. Gehalt jährlich erhalten. Ein Unterlehrer 42 fl., ein anderer
260 fl. und ein Hilfslehrer 170 fl." |
Lehrer Samuel Rödelsheimer wird von
Buchau nach Kochendorf versetzt (1866)
 Artikel
in "Der Israelit" vom 30. Mai 1866: "Aus Württemberg.
Schulstatistik p.2 1865. Im Jahre 1865 sind folgende israelitische
Schulstellen ausgeschrieben und nachbenannten Lehrern übertragen worden: am
30. Juni die zu Kochendorf Herrn Rödelsheimer, bisher
Unterlehrer in Buchau; am 25. August die
zu Hohebach Herrn Sänger, bisher
Schulmeister zu Braunsbach, mit je 300
fl. fixem Einkommen neben freier Wohnung; am 24. November die zu
Ernsbach Herrn Rothschild, bisher
Amtsverweser daselbst, mit 400 fl. Gehalt und freier Wohnung. (Das neueste
Schulgesetz hat auch die beiden ersteren Gehalte auf das jetzige Minimum von
400 fl. erhöht und Herr Rödelsheimer hat die Stelle in Kochendorf
nicht angetreten, sondern ist auf seine Bitte nach
Pflaumloch versetzt worden.)
Pensioniert wurden die Lehrer Löwenstein in
Pflaumloch und Wassermann in
Lauchheim." Artikel
in "Der Israelit" vom 30. Mai 1866: "Aus Württemberg.
Schulstatistik p.2 1865. Im Jahre 1865 sind folgende israelitische
Schulstellen ausgeschrieben und nachbenannten Lehrern übertragen worden: am
30. Juni die zu Kochendorf Herrn Rödelsheimer, bisher
Unterlehrer in Buchau; am 25. August die
zu Hohebach Herrn Sänger, bisher
Schulmeister zu Braunsbach, mit je 300
fl. fixem Einkommen neben freier Wohnung; am 24. November die zu
Ernsbach Herrn Rothschild, bisher
Amtsverweser daselbst, mit 400 fl. Gehalt und freier Wohnung. (Das neueste
Schulgesetz hat auch die beiden ersteren Gehalte auf das jetzige Minimum von
400 fl. erhöht und Herr Rödelsheimer hat die Stelle in Kochendorf
nicht angetreten, sondern ist auf seine Bitte nach
Pflaumloch versetzt worden.)
Pensioniert wurden die Lehrer Löwenstein in
Pflaumloch und Wassermann in
Lauchheim." |
Lehrer Jakob Rosenthal eröffnet ein Israelitischen
Knaben-Pensionat in Wimpfen (1887)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juli 1887: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juli 1887:
"Israelitisches Knaben-Pensionat
Wimpfen am Neckar.
Für auswärtige Israeliten, welche die Großherzogliche Realschule
besuchen wollen, um an derselben die Einjährigenberechtigung*) zu
erlangen, errichtet der Unterzeichnete zum Herbst dieses Jahres dahier ein
Pensionat. Streng religiöses Leben, Sabbat-Gottesdienst, - auf
Wunsch der Eltern Dispensation von den schriftlichen Arbeiten am
Samstag - gewissenhafte Aufsicht, vorzügliche Pflege. Gute
Referenzen. Baldige Meldungen erwünscht. Beginn des Wintersemesters Mitte
September 1887. Näheres durch die Prospekte. Jakob Rosenthal,
Religionslehrer an der Großherzoglichen Realschule zur Zeit in
Kochendorf.
*) wird nach den gesetzlichen Bestimmungen Demjenigen, der die oberste
Klasse zur Zufriedenheit des Lehrer-Kollegiums absolviert hat, ohne
besonderes Examen erteilt." |
Zum Tod von Adolf Mayer (in den 1890er-Jahren Lehrer in Kochendorf) (1930)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juli
1930: "Adolf Mayer, Niederhochstadt. Am 4. Juni machte ein Herzschlag
seinem arbeitsfreudigen Leben ein Ende. Die Munterkeit und Frische, die
wir 8 Tage zuvor auf der Jahresversammlung in
Landau an dem seit längerer
Zeit leidenden Kollegen feststellen durften, war nur das Aufblühen
gewesen vor dem Verwelken. Adolf Mayer hat zuerst in Kochendorf
(Württemberg) und Rockenhausen
einige Jahre gewirkt, aber fast die ganze Kraft - 34 Jahre - seines Lebens
gehörte der Gemeinde Niederhochstadt. Die Trauerrede des Bezirksrabbiners
Herrn Dr. Einstein, die Abschiedsworte des Gemeindevorstandes Herrn M.
Dreifuß, des Pfälzer Verbandsvorsitzenden Herrn Kommerzienrat Joseph,
eines christlichen Ortskollegen und des Schreibers dieser Zeilen
zeichneten noch einmal voll Dankbarkeit und Verehrung das Bild dieses
Lehrerlebens, in seiner Lauterkeit, Berufshingebung, in seiner Treue und
Gewissenhaftigkeit im Kleinen wie im Großen, - das Bild einer
Persönlichkeit, die alle Kraft des Herzens und Geistes in den Dienst
ihres heiligen Amtes gestellt. Die Gemeinde
Niederhochstadt verliert - o
Schicksal der Landgemeinden! - ihren geistigen Mittelpunkt, wir aber
verlieren einen braven Freund und Kollegen. Wir werden ihm ein ehrendes
Gedenken bewahren. Schottland." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juli
1930: "Adolf Mayer, Niederhochstadt. Am 4. Juni machte ein Herzschlag
seinem arbeitsfreudigen Leben ein Ende. Die Munterkeit und Frische, die
wir 8 Tage zuvor auf der Jahresversammlung in
Landau an dem seit längerer
Zeit leidenden Kollegen feststellen durften, war nur das Aufblühen
gewesen vor dem Verwelken. Adolf Mayer hat zuerst in Kochendorf
(Württemberg) und Rockenhausen
einige Jahre gewirkt, aber fast die ganze Kraft - 34 Jahre - seines Lebens
gehörte der Gemeinde Niederhochstadt. Die Trauerrede des Bezirksrabbiners
Herrn Dr. Einstein, die Abschiedsworte des Gemeindevorstandes Herrn M.
Dreifuß, des Pfälzer Verbandsvorsitzenden Herrn Kommerzienrat Joseph,
eines christlichen Ortskollegen und des Schreibers dieser Zeilen
zeichneten noch einmal voll Dankbarkeit und Verehrung das Bild dieses
Lehrerlebens, in seiner Lauterkeit, Berufshingebung, in seiner Treue und
Gewissenhaftigkeit im Kleinen wie im Großen, - das Bild einer
Persönlichkeit, die alle Kraft des Herzens und Geistes in den Dienst
ihres heiligen Amtes gestellt. Die Gemeinde
Niederhochstadt verliert - o
Schicksal der Landgemeinden! - ihren geistigen Mittelpunkt, wir aber
verlieren einen braven Freund und Kollegen. Wir werden ihm ein ehrendes
Gedenken bewahren. Schottland." |
Berichte aus dem jüdischen
Gemeindeleben
Die jüdische Gemeinde in Kochendorf
innerhalb des Rabbinates Lehrensteinsfeld (1847)
 Artikel in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 29. November 1847
(die Zahlen beziehen sich auf die Zahl der jeweiligen jüdischen Einwohner
in den Orten): Artikel in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 29. November 1847
(die Zahlen beziehen sich auf die Zahl der jeweiligen jüdischen Einwohner
in den Orten):
"VIII. Lehrensteinsfeld 1)
Lehrensteinsfeld Oberamt Weinsberg 133
(Rabbiner Löwengardt)
2) Affaltrach mit den Israeliten daselbst und in
Eschenau 180/108
3)
Kochendorf Oberamt Neckarsulm mit den Israeliten daselbst und in Gundelsheim,
Neckarsulm und
Oedheim 129/6/50/3 und 90.
4) Massenbachhausen Oberamt
Brackenheim mit den Israeliten daselbst
und in Bonfeld 89/124
5) Sontheim Oberamt Heilbronn mit den Israeliten daselbst und in
Heilbronn,
Horkheim und
Talheim 103/115/66/81. " |
Hinweise auf das Memorbuch der
jüdischen Gemeinde Kochendorf von 1732 (1887)
 Aus
einem Artikel in "Jahrbücher für jüdische Geschichte und Literatur" 1887 S.
50: "In dem Memorbuche von Kochendorf (geschrieben 1732 von
Israel ben Ahron aus Dürkheim an der
Haardt), dass mir jüngsthin zur Einsicht vorlag, fand ich in dem
Verzeichnisse von Gemeinden und Persönlichkeiten, die von den Verfolgungen
des ersten Kreuzzuges (1096) betroffen wurden, auch Ephraim ben Tamar,
Rabbiner in Frankfurt am Main, genannt (siehe Adolf Brüll
populär-wissenschaftliche Monatsblätter VI,132). Die betreffende Stelle
lautet Kehilat Frankfurt wejoschwiah we haraw ras Ephraim bar tamar ...
ubeni jeschiwto (die jüdische Gemeinde Frankfurt und seine Mitglieder
und Rabbiner Ephraim ben Tamar und die Schüler seine Jeschiwa). Nach einer
Mitteilung Neubauers ist die Quelle Zunz's (Literaturgeschichte S. 618
No.26, 20) ebenfalls ein Memorbuch, in welchem jedoch nicht erwähnt wird,
dass Ephraim ben Tamara Rabbiner in Frankfurt war." Aus
einem Artikel in "Jahrbücher für jüdische Geschichte und Literatur" 1887 S.
50: "In dem Memorbuche von Kochendorf (geschrieben 1732 von
Israel ben Ahron aus Dürkheim an der
Haardt), dass mir jüngsthin zur Einsicht vorlag, fand ich in dem
Verzeichnisse von Gemeinden und Persönlichkeiten, die von den Verfolgungen
des ersten Kreuzzuges (1096) betroffen wurden, auch Ephraim ben Tamar,
Rabbiner in Frankfurt am Main, genannt (siehe Adolf Brüll
populär-wissenschaftliche Monatsblätter VI,132). Die betreffende Stelle
lautet Kehilat Frankfurt wejoschwiah we haraw ras Ephraim bar tamar ...
ubeni jeschiwto (die jüdische Gemeinde Frankfurt und seine Mitglieder
und Rabbiner Ephraim ben Tamar und die Schüler seine Jeschiwa). Nach einer
Mitteilung Neubauers ist die Quelle Zunz's (Literaturgeschichte S. 618
No.26, 20) ebenfalls ein Memorbuch, in welchem jedoch nicht erwähnt wird,
dass Ephraim ben Tamara Rabbiner in Frankfurt war." |
| |
 Mitteilung
in "Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland" 1888 S. 396: "Der
8. Jahrgang der von N. Brüll herausgegebenen 'Jahrbücher für jüdische
Geschichte und Literatur' (Frankfurt am Main, Reitz und Köhler 1877, IV und
188 Seiten) enthält unter den Misszellen auch einiges auf Juden in
Deutschland Bezügliche. S. 49-51: Auszug aus Büchers Werk (vgl. Zeitschrift
I, S. 291f) mit Hinweis auf ein Memorbuch von Kochendorf 1732. S.
60-62 werden zum Teil aus Responsen, Synoden der deutschen Juden im
Mittelalter nachgewiesen, zum Beispiel in Nürnberg (13. Jahrhundert), Mainz
(1307). S. 44-48 über ein 'Sendschreiben Saul Lewins über den in Altona über
ihn verhängten Bann' (1790), ein bisher nur teilweise bekanntes
interessantes Aktenstück mitgeteilt. Auch die Rezensionen behandeln einzelne
gleichfalls von uns besprochene Schriften." Mitteilung
in "Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland" 1888 S. 396: "Der
8. Jahrgang der von N. Brüll herausgegebenen 'Jahrbücher für jüdische
Geschichte und Literatur' (Frankfurt am Main, Reitz und Köhler 1877, IV und
188 Seiten) enthält unter den Misszellen auch einiges auf Juden in
Deutschland Bezügliche. S. 49-51: Auszug aus Büchers Werk (vgl. Zeitschrift
I, S. 291f) mit Hinweis auf ein Memorbuch von Kochendorf 1732. S.
60-62 werden zum Teil aus Responsen, Synoden der deutschen Juden im
Mittelalter nachgewiesen, zum Beispiel in Nürnberg (13. Jahrhundert), Mainz
(1307). S. 44-48 über ein 'Sendschreiben Saul Lewins über den in Altona über
ihn verhängten Bann' (1790), ein bisher nur teilweise bekanntes
interessantes Aktenstück mitgeteilt. Auch die Rezensionen behandeln einzelne
gleichfalls von uns besprochene Schriften."
|
Ergebnisse von Kollekten in der
Gemeinde (1898/1899)
 Mitteilung in "Der Israelit" vom 2. Juni 1898: "Kochendorf. Durch Lehrer S. Erlebacher, A. Challah-Geld von
nachgenannten Frauen daselbst: Therese Kahn 1.70, Ricka Herz 1.20, Emma
Weißburger 1, Fanny Salomon 1.40, Karoline Jaffé 1.50. Bertha Maier 1.20,
Frl. Hannchen Herz 0.80. Mitteilung in "Der Israelit" vom 2. Juni 1898: "Kochendorf. Durch Lehrer S. Erlebacher, A. Challah-Geld von
nachgenannten Frauen daselbst: Therese Kahn 1.70, Ricka Herz 1.20, Emma
Weißburger 1, Fanny Salomon 1.40, Karoline Jaffé 1.50. Bertha Maier 1.20,
Frl. Hannchen Herz 0.80.
- Aus Oedheim von den Frauen: Sophie Rosenstein 3, Fanny Rosenstein
2.30, Fanny Strauß 2, Fanny Mannheimer 1.20, Fanny Mergentheimer 1.30, Jette
Strauß 1, Emma Kaufmann 3 Mark.
B. Synagogenspenden aus Kochendorf von: Kirchenrat Dr. Kroner aus
Stuttgart 1, Rabbiner L. Kahn aus Heilbronn 1, Lehrer Erlebacher
5, David Kahn 0.30, Leopold Herz 0.50, Louis Herz 0.90, Louis Maier 1.50,
Max Maier 1, Lippmann Herz, Aron Herz und A. Bodenheimer à 0.50 = 1.50,
Lehmann aus Heilbronn 0.50 M. -
C. Rest vom M"HSch in Kochendorf 1.24 M.
D. Aus der Gemeindekasse Kochendorf 20, aus der in
Oedheim 10
M. Zusammen abzüglich Porto und Einzugsgebühren 66.24 M., wovon 30 M.
Mazzot und 5.24 M. für R. VIII." |
| |
 Mitteilung
in "Der Israelit" vom 26. Oktober 1899: "Kochendorf.
Durch Lehrer M. Kulb, Challah-Geld, A. aus Kochendorf von den
Frauen: Emma Weißburger 1, Sara Herz 2, Therese Kahn 1.60, Bertha Maier
1.10, Friedericke Herz 1, Karoline Jaffe 0.80, Frl. Hannchen Herz 0.60 M. —
B. Aus Oedheim von: Emma Kaufmann 3,
Adelheid Mannheimer 1, Fanni Mannheimer 1, Fanni Strauß 1, Witwe Kaufmann 1,
Frl. Mergentheimer 1 M. Zusammen abzüglich Porto 15.80 Mark." Mitteilung
in "Der Israelit" vom 26. Oktober 1899: "Kochendorf.
Durch Lehrer M. Kulb, Challah-Geld, A. aus Kochendorf von den
Frauen: Emma Weißburger 1, Sara Herz 2, Therese Kahn 1.60, Bertha Maier
1.10, Friedericke Herz 1, Karoline Jaffe 0.80, Frl. Hannchen Herz 0.60 M. —
B. Aus Oedheim von: Emma Kaufmann 3,
Adelheid Mannheimer 1, Fanni Mannheimer 1, Fanni Strauß 1, Witwe Kaufmann 1,
Frl. Mergentheimer 1 M. Zusammen abzüglich Porto 15.80 Mark." |
Die jüdische Gemeinde Kochendorf
wird aufgelöst, die hier und in Neckarsulm noch
lebenden jüdischen Personen werden der jüdischen Gemeinde Heilbronn zugeteilt
(1925)
 Artikel in "Der Israelit" vom 19. November 1925: "Stuttgart,
1. Nov. Wie die Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs mitteilt, sind mit Zustimmung der Israelitischen
Landesversammlung durch Anordnung des Oberrats der Israelitischen
Religionsgemeinschaft Württembergs die Israelitischen Religionsgemeinden:
1. Aufhausen, OA. Neresheim, 2.
Ernsbach OA. Öhringen, 3. Kochendorf
OA. Neckarsulm, 4. Nordstetten OA.
Horb aufgelöst worden. Das Vermögen der aufgelösten Gemeinden geht auf die
Israelitische Zentralkasse über. Artikel in "Der Israelit" vom 19. November 1925: "Stuttgart,
1. Nov. Wie die Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs mitteilt, sind mit Zustimmung der Israelitischen
Landesversammlung durch Anordnung des Oberrats der Israelitischen
Religionsgemeinschaft Württembergs die Israelitischen Religionsgemeinden:
1. Aufhausen, OA. Neresheim, 2.
Ernsbach OA. Öhringen, 3. Kochendorf
OA. Neckarsulm, 4. Nordstetten OA.
Horb aufgelöst worden. Das Vermögen der aufgelösten Gemeinden geht auf die
Israelitische Zentralkasse über.
Die in Aufhausen ansässigen Israeliten
sind der israelitischen Religionsgemeinde
Oberdorf, die in Ernsbach der
israelitischen Religionsgemeinde
Berlichingen, Rabbinat Heilbronn, die in Kochendorf und
Neckarsulm der israelitischen
Religionsgemeinde Heilbronn, die in
Nordstetten der israelitischen
Religionsgemeinde Horb zugeteilt worden." |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der Gemeinde
Jahrzeittag des Rabbiners Kallmann aus Kochendorf (gest.
1865)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. November 1866: "Neckarsulm.
Am 6. Tage der Selichot-Tage, dem 24. Elul war es ein Jahr, dass
der selige, fromme Rabbiner Kallmann aus Kochendorf in die ewige
Ruhe eingegangen ist. Auf Anordnung seiner Witwe wurde am
Jahrgedächtnistage beim Setzen der sehr schönen Mazebah (Grabstein)
Minjan (gottesdienstliche Versammlung) auf seinem Grabe
gemacht und vom Rabbiner Dr. Engelbert ein deutsches und ein hebräisches
Gebet verrichtet, und dann Kaddisch gesagt. Es fanden sie viele auf dem
Friedhofe ein, um dem würdigen Seelensorger die letzte Ehre zu erweisen.
In der Synagoge zu Kochendorf wurde am darauf folgenden Sonntag ein
Hesped (Trauerrede) für den selig Verblichenen gleichfalls von
Rabbiner Engelbert abgehalten; den Anfang, sowie den Schluss des
Trauervortrags, in welchem er die vielen guten Eigenschaften des
Dahingeschiedenen hervorhob, bildeten die schönen Worte, (hebräisch und
deutsch:) das Andenken des wahrhaft Frommen gereicht zum Segen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. November 1866: "Neckarsulm.
Am 6. Tage der Selichot-Tage, dem 24. Elul war es ein Jahr, dass
der selige, fromme Rabbiner Kallmann aus Kochendorf in die ewige
Ruhe eingegangen ist. Auf Anordnung seiner Witwe wurde am
Jahrgedächtnistage beim Setzen der sehr schönen Mazebah (Grabstein)
Minjan (gottesdienstliche Versammlung) auf seinem Grabe
gemacht und vom Rabbiner Dr. Engelbert ein deutsches und ein hebräisches
Gebet verrichtet, und dann Kaddisch gesagt. Es fanden sie viele auf dem
Friedhofe ein, um dem würdigen Seelensorger die letzte Ehre zu erweisen.
In der Synagoge zu Kochendorf wurde am darauf folgenden Sonntag ein
Hesped (Trauerrede) für den selig Verblichenen gleichfalls von
Rabbiner Engelbert abgehalten; den Anfang, sowie den Schluss des
Trauervortrags, in welchem er die vielen guten Eigenschaften des
Dahingeschiedenen hervorhob, bildeten die schönen Worte, (hebräisch und
deutsch:) das Andenken des wahrhaft Frommen gereicht zum Segen." |
Zum Tod des Gemeindevorstehers Daniel Levi
(1879)
Anmerkung: Der Tuchmacher, Schürzenfabrikant (im Schloß) und
Zigarrenfabrikant Daniel Levi (geb. 1824, gest. 1879) war in erster Ehe seit
1849 mit Marie geb. Herz aus Kuppenheim bei Rastatt (geb. 1828, gest. 1855)
verheiratet. Die beide hatten vier Kinder. In zweiter Ehe war er seit 1856
verheiratet mit der Witwe Caroline geb. Oppenheimer (geb. 1836) aus
Michelfeld,
mit der fünf Kinder hatte.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Januar 1879: "Nachruf! Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Januar 1879: "Nachruf!
Kochendorf, 25. Januar (1879). Die hiesige israelitische Gemeinde
hat einen großen unersetzlichen Verlust erlitten. Sie hat heute ihren
ersten Vorsteher und Leiter, den edelsten und geachtetsten Mann ihrer
Gemeinde zu Grabe getragen. Herr Daniel Levi, der jüngere Bruder
der Firma Gebr. Levi, weilt nicht mehr unter den Lebenden. Der bittere Tod
hat ihn, in seinem 54. Lebensalter, im noch besten und kräftigsten
Mannesalter, aus viel liebenden Armen und ausgedehnter Erwerbs- wie
Berufstätigkeit gerissen. 25 Jahre bereits hat er alle Gemeindesachen und
Angelegenheiten mit Treue und aufs Pünktlichste verwaltet. Ihm hat die
Gemeinde gar vieles zu verdanken, so auch unter anderem, dass sie im
Besitze eines eigenen, gut gelegenen und schön umzäunten Friedhofs
ist. Und ein schöneres und zärtlicheres Familien-Verhältnis, als das
der Familie des Verewigten kann ich mir kaum denken. Der Heimgegangene
hinterließ eine edle Gattin und 7 tugendhafte, wohl erzogene Kinder. An
seinem Grabe sprach Herr Bezirksrabbiner Dr. Engelberth vor einer großen
Menschenzahl, herangeströmt von Nah und Fern. Redner schilderte in
treffenden Worten den Verlust der Familie und Gemeinde. Auch Einsender
dieser Zeilen widmete aus reinem Herzensdrang dem Verstorbenen kurze
Worte, anknüpfend an die Worte unserer Weisen...
Schaue ich nun die große unausfüllbare Lücke, die im engen und weiteren
Familienkreise, sowie in der ganzen Gemeinde durch das Ableben des Daniel
Levi entstanden ist, und die tiefe Trauer und den herben Schmerz der
Hinterbliebenen, sind finde ich für all dies keine anderen Worte als mit
dem Psalmisten anzustimmen:
'Ich erhebe meine Augen zu den Bergen, von wo wird mir Beistand
kommen? Mein Beistand kommt vom Ewigen, dem Schöpfer des Himmels und der
Erde' (Psalm 121,1).
Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
| |
 Anmerkung:
Der ältere Bruder von Daniel Levi (vgl. Text oben) war Lämmlein Levi
(geb. 1823, gest. 1892). Dieser war seit 1845 verheiratet mit Mina geb.
Kahn, mit der er elf Kinder hatte. Lämmlein und Daniel Levi hatten um
die Mitte des 19. Jahrhunderts im oberen Teil des 1829/30 in Privathand
übergegangenen Grekkenschlosses in Kochendorf (vgl. Abbildung links)
zunächst eine Zigarren-, später eine Likörfabrik der Gebr. Levi
eingerichtet, laut Rechnung links von 1867 handelt es sich bei der "Cigarren-Fabrik"
der Gebr. Levi um eine "Fabrik von feinen & ordinären Cigarren" sowie um
eine "Handlung in verschiedenen Landesprodukten". Anmerkung:
Der ältere Bruder von Daniel Levi (vgl. Text oben) war Lämmlein Levi
(geb. 1823, gest. 1892). Dieser war seit 1845 verheiratet mit Mina geb.
Kahn, mit der er elf Kinder hatte. Lämmlein und Daniel Levi hatten um
die Mitte des 19. Jahrhunderts im oberen Teil des 1829/30 in Privathand
übergegangenen Grekkenschlosses in Kochendorf (vgl. Abbildung links)
zunächst eine Zigarren-, später eine Likörfabrik der Gebr. Levi
eingerichtet, laut Rechnung links von 1867 handelt es sich bei der "Cigarren-Fabrik"
der Gebr. Levi um eine "Fabrik von feinen & ordinären Cigarren" sowie um
eine "Handlung in verschiedenen Landesprodukten".
(Abbildung des Briefkopfes aus W. Angerbauer/H.G. Frank: Jüdische Gemeinden
in Stadt und Kreis Heilbronn. S. 132). |
 Ein Sohn von Lämmlein Levi war der spätere Stuttgarter Likörfabrikant
Max Levi (geb. 6. Februar 1850 in Kochendorf, gest. 8. Juni 1894 in
Stuttgart). Er war seit 1874 verheiratet mit Jeanette geb. Heimann
(geb. 2. April 1854 in Oberdorf, gest.
25. Mai 1938 in Oberdorf). Die beiden hatten drei Kinder: Martha (geb. 1875,
verh. Michelbacher, gest. 1956 Boston/USA), Carl David (1878-1879) und
Alfred Ludwig (geb. 1882, im Ersten Weltkrieg gefallen).
Ein Sohn von Lämmlein Levi war der spätere Stuttgarter Likörfabrikant
Max Levi (geb. 6. Februar 1850 in Kochendorf, gest. 8. Juni 1894 in
Stuttgart). Er war seit 1874 verheiratet mit Jeanette geb. Heimann
(geb. 2. April 1854 in Oberdorf, gest.
25. Mai 1938 in Oberdorf). Die beiden hatten drei Kinder: Martha (geb. 1875,
verh. Michelbacher, gest. 1956 Boston/USA), Carl David (1878-1879) und
Alfred Ludwig (geb. 1882, im Ersten Weltkrieg gefallen).
vgl. von Rolf Hofmann:
Family Sheet Max
Levi of Kochendorf + Stuttgart.
Links Abbildung einer Medaille / Auszeichnung für die "Stuttgarter
Liqueurfabrik Max Levi von den "Grand Concours International Alimentaire -
Paris 1885" (aus der Sammlung von Rolf Hofmann/Stuttgart).
|
Zum Tod des aus Kochendorf gebürtigen Rabbiners
Max Herz (gestorben in
Göppingen 1904)
Anmerkung: Rabbiner Max Herz ist am 24. November 1815 in
Kochendorf geboren als Sohn des Metzgers Bär(le) Herz und der Hanna geb. Kahn.
Er studierte seit 1836 in Tübingen, wo er 1841 die Erste Dienstprüfung
ablegte. Danach war er Vikar des Stadtrabbiners Joseph Maier in Stuttgart. Seit
1844 war er Rabbinatsverweser, seit 1846 Bezirksrabbiner in Jebenhausen. 1868
verlegte er seinen Wohnsitz nach Göppingen; seit 1874 war auch der
Rabbinatssitz in Göppingen. Er trat 1895 in den Ruhestand.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. August 1904: "Aus Württemberg.
4. August (1904). Heute wurde in Göppingen der älteste württembergische
Rabbiner, der im Jahre 1916 in Kochendorf geborene Kirchenrat a.D.
M. Herz unter größerem Geleite zu Grabe getragen. Nach vollendetem
Studium übernahm Herz 1840 die Stelle eines Hauslehrers im Hofrat
Pfeifferschen Hause und erhielt 1845 das Rabbinat Jebenhausen,
das später nach Göppingen verlegt
wurde. Diese Stelle verwaltete er bis zu seiner 1895 erfolgten
Pensionierung. Anlässlich seines 70. Geburtstages erhielt er den
Friedrichsorden und 1895 den Titel eines Kirchenrats. Mehrere Jahrzehnte
lang war Herz Mitglied der Königlichen Prüfungskommission für die württembergischen
Rabbinen. In der Synagoge gab Rabbiner Straßburger den Gefühlen der
Teilnahme beredten Ausdruck; am Grabe widmeten Rabbiner Katz – Heilbronn
und Kirchenvorsteher Fleischer dem Verstorbenen einen warmen Nachruf." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. August 1904: "Aus Württemberg.
4. August (1904). Heute wurde in Göppingen der älteste württembergische
Rabbiner, der im Jahre 1916 in Kochendorf geborene Kirchenrat a.D.
M. Herz unter größerem Geleite zu Grabe getragen. Nach vollendetem
Studium übernahm Herz 1840 die Stelle eines Hauslehrers im Hofrat
Pfeifferschen Hause und erhielt 1845 das Rabbinat Jebenhausen,
das später nach Göppingen verlegt
wurde. Diese Stelle verwaltete er bis zu seiner 1895 erfolgten
Pensionierung. Anlässlich seines 70. Geburtstages erhielt er den
Friedrichsorden und 1895 den Titel eines Kirchenrats. Mehrere Jahrzehnte
lang war Herz Mitglied der Königlichen Prüfungskommission für die württembergischen
Rabbinen. In der Synagoge gab Rabbiner Straßburger den Gefühlen der
Teilnahme beredten Ausdruck; am Grabe widmeten Rabbiner Katz – Heilbronn
und Kirchenvorsteher Fleischer dem Verstorbenen einen warmen Nachruf."
|
| |
 Artikel
in "Neue jüdische Presse" vom 12. August 1904: "Göppingen.
3. August. Nach kurzem Krankenlager starb gestern Abend im Alter von 89
Jahren der Kirchenrat und Rabbiner a. D. Max Herz. Der Verstorbene
stand ein halbes Jahrhundert — von 1815 bis 1895 — dem Rabbinat
Jebenhausen -
Göppingen vor. Bei Gelegenheit seines
50-jährigen Rabbinerjubiläums im Jahre 1891 verlieh ihm der König den Titel
eines Kirchenrats: anlässlich seines 70.Geburtstages im Jahre 1886 erhielt
er den Friedrichsorden 2. Klasse. Herz stammte aus Kochendorf, wo er
1810 als Sohn eines Metzgermeisters geboren wurde. Nach absolviertem Studium
übernahm er 1810 die Stelle eines Hauslehrers in der bekannten Hofrat
Pfeifferschen Familie in Stuttgart: 1815 kam er als Rabbinatsverweser nach
Jebenhausen, welche Stelle ihm 1816
definitiv übertragen wurde. Mit der Verlegung des Rabbinats nach Göppingen
siedelte er nach dort über. Herz entfaltete neben seiner beruflichen
Wirksamkeit eine reiche literarische Tätigkeit auf dem Gebiete der
israelitischen Theologie. Mit ihm ist der älteste inaktive jüdische
Geistliche des Landes aus dem Leben geschieden." Artikel
in "Neue jüdische Presse" vom 12. August 1904: "Göppingen.
3. August. Nach kurzem Krankenlager starb gestern Abend im Alter von 89
Jahren der Kirchenrat und Rabbiner a. D. Max Herz. Der Verstorbene
stand ein halbes Jahrhundert — von 1815 bis 1895 — dem Rabbinat
Jebenhausen -
Göppingen vor. Bei Gelegenheit seines
50-jährigen Rabbinerjubiläums im Jahre 1891 verlieh ihm der König den Titel
eines Kirchenrats: anlässlich seines 70.Geburtstages im Jahre 1886 erhielt
er den Friedrichsorden 2. Klasse. Herz stammte aus Kochendorf, wo er
1810 als Sohn eines Metzgermeisters geboren wurde. Nach absolviertem Studium
übernahm er 1810 die Stelle eines Hauslehrers in der bekannten Hofrat
Pfeifferschen Familie in Stuttgart: 1815 kam er als Rabbinatsverweser nach
Jebenhausen, welche Stelle ihm 1816
definitiv übertragen wurde. Mit der Verlegung des Rabbinats nach Göppingen
siedelte er nach dort über. Herz entfaltete neben seiner beruflichen
Wirksamkeit eine reiche literarische Tätigkeit auf dem Gebiete der
israelitischen Theologie. Mit ihm ist der älteste inaktive jüdische
Geistliche des Landes aus dem Leben geschieden."
|
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeigen des Eisen- und Baumaterialiengeschäftes L. Weißburger (1900/1903)
Anmerkung: Louis Weißburger (geb. 1856, gest. 21. Dezember 1921)
betrieb eine Eisenwarenhandlung in Kochendorf (bis 1921/22), seit 1885 auch in
Heilbronn. Er war verheiratet mit Emma geb. Stiefel aus
Menzingen (geb. 1857,
gest. 12. Dezember 1930). Ihr Grab ist im israelitischen Teil des Pragfriedhofes
in Stuttgart (Hahn, Pragfriedhof S. 225).
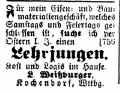 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Januar 1900: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Januar 1900:
"Für mein Eisen- und Baumaterialiengeschäft, welches Samstags und
Feiertags geschlossen ist, suche ich per Ostern laufenden Jahres
einen
Lehrjungen.
Kost und Logis im Hause.
L. Weißburger, Kochendorf, Württemberg". |
| |
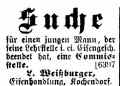 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. August 1900: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. August 1900:
Suche
für einen jungen Mann, der seine Lehrstelle in einem Eisengeschäfte beendet
hat, eine Kommisstelle.
L. Weißburger, Eisenhandlung, Kochendorf". |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Januar 1903: "Jungen
Mann, Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Januar 1903: "Jungen
Mann,
mit guter Schulbildung, nehme ich bis Ostern in die Lehre. Kost und Logis
im Hause. Offerten sehe entgegen
L. Weißburger, Kochendorf,
Eisen- und Baumaterialienwarenhandlung". |
| |
 Anzeige in "Der Israelit" vom 18. Januar 1906: "Kochendorf.
Ostern dieses Jahres ist eine Anzeige in "Der Israelit" vom 18. Januar 1906: "Kochendorf.
Ostern dieses Jahres ist eine
Lehrstelle bei mir vakant, bei freier Pension.
Sehe Offerten entgegen L. Weißburger, Eisen- und
Baumaterialienhandlung."
|
Anzeige der Landesprodukten- und
Mühlenfabrikatenhandlung Herz (1907)
 Anzeige in "Der Israelit" vom 7. November 1907: "Lehrling
oder jüngerer Kommis gesucht. Anzeige in "Der Israelit" vom 7. November 1907: "Lehrling
oder jüngerer Kommis gesucht.
Geschäft samstags geschlossen. Kost und Wohnung im Hause,
Herz, Landesprodukte und Mühlenfabrikate, Kochendorf
(Württemberg)." |
Sonstiges
Erinnerungen an die Auswanderungen im 19. Jahrhundert:
Grabstein in New York für Max Neumann aus Kochendorf (gest. 1914)
Anmerkung: das Grab befindet sich in einem jüdischen Friedhof in NY-Brooklyn.
 |
Grabstein für
"my beloved husband
Max Neumann
Born in Kochendorf Ger.
Died Jan 9, 1914
Aged 73 years" |
| Anmerkung: Bei der Annahme
erblicher Familiennamen 1828 hat der Handelsmann Lazarus Abraham
(1785-1852) den Familiennamen Neumann angenommen. In welcher Beziehung Max
Neumann (geb. ca. 1841; vermutlich ein Enkel) zu ihm stand, ist nicht
bekannt, da in dem erhaltenen Familienregister Kochendorf (Link)
nur die zwischen 1818 und 1829 geborenen Kinder eingetragen
sind. |
Zur Geschichte des Betsaals/der Synagoge
Ende des 17. Jahrhundert
besuchten die Kochendorfer Juden die Synagoge in Oedheim.
Diese Beziehung kam daher, dass der Deutsche Orden 1697 mit dem
"wohlbemittelten" Moses aus Kochendorf einen Juden in Oedheim
ansiedelte, dem sogleich die Einrichtung einer Synagoge in seinem Oedheimer Haus
gestattet wurde. Diese wurde einige Jahre lang auch von Juden aus Kochendorf
besucht. Solange er in Kochendorf lebte, hatte Moses noch nicht die Erlaubnis
zur Einrichtung eines Betsaales erhalten. Enge Beziehungen gab es auch zwischen
den Kochendorfer und den Neckarsulmer
Juden. Zu einen war dort lange Zeit der zentrale Friedhof
der Region, zum anderen gab es dort einen Rabbiner, den man im Falle von
Streitigkeiten und zur Regelung anderer Fragen konsultieren konnte.
Nachdem einige Zeit die Synagoge in Oedheim besucht wurde, liegen spätestens um
1740 Hinweise vor, dass auch in Kochendorf ein Betsaal vorhanden war. Das
schon Ende des 17. Jahrhunderts bezeugte "Judenhaus" nannte man 1738
Synagoge, und nach einem Vertrag aus dem Jahre 1744 gestattete Mayer Jacob der
Kochendorfer Judengemeinde, in seinem Haus "Schule" zu halten. Das
Abkommen wurde jedoch 1745 gekündigt, was zu einem Streitfall führte, in den
auch die Grundherrschaften des Ortes einbezogen waren. 1766 wird als
Judenschulmeister Mordachay Abraham genannt. Der Standort dieser ersten Synagoge
ist nicht bekannt. Vielleicht befand sie sich (das "Judenhaus") am
Platz der späteren Synagoge.
Die neue Synagoge ist 1806 erbaut worden, als es fast 80 jüdische
Einwohner in Kochendorf gab. Das Haus befand sich im Eigentum der Gemeinde.
Damals hatte man sogar in Callman Löw einen eigenen Rabbiner. Im Keller der
Synagoge befand sich wahrscheinlich auch das rituelle Bad (Nähe zum Mühlkanal);
der Betsaal selbst lag im 1. Stock mit dem Toraschrein zwischen den beiden
Fenster des östlichen Giebels.
Von einem feierlichen Gottesdienst in der festlich geschmückten Kochendorfer
Synagoge am 28. Januar 1860 berichtet einmal die "Allgemeine Zeitung des
Judentums". Damals konnte der Vorsänger Isac Weil sein 25-jähriges
Dienstjubiläum feiern. Sämtliche israelitischen Gemeindeglieder als auch viele
christliche Einwohner fanden sich zum Gottesdienst ein. Nach der von Weil
gehaltenen Predigt begaben sich die Gemeindeältesten und Schüler der
israelitischen Schule vor den Toraschrein und sprachen dem Jubilar ihre
Anerkennung über seine Wirksamkeit in Synagoge und Schule der Gemeinde aus.
Weil erhielt einen kostbaren silbernen Pokal mit entsprechenden Inschriften.
1872 wurde das Synagogengebäude renoviert. Nachdem die Zahl jüdischer
Einwohner 1925 auf sieben zurückgegangen und die jüdische Gemeinde
aufgelöst worden war, wurde das Gebäude an die evangelische Kirchengemeinde
verkauft. Diese hat das Gebäude später veräußert. Es wurde zu einem Wohnhaus
umgebaut und dabei um einen weiteren Stock erhöht (Gebäude Mühlstrasse 12).
Ein früher vorhandener Hochzeitsstein ist nicht mehr sichtbar und liegt möglicherweise
unter dem Verputz. Eine Hinweistafel zur Geschichte des Hauses ist angebracht.
Fotos
Historische Fotos:
(Quellen: obere Fotos Stadtarchiv Bad Friedrichshall; untere Fotos aus
Jüdische Gotteshäuser und Friedhöfe in Württemberg. 1932 S. 90-91; die
Innenaufnahme ist aus dem Photo Archive von Yad Vashem Jerusalem)
 |
 |
 |
Hochwasser 1919 mit der
Synagoge in Kochendorf
|
Das Synagogengebäude um 1928:
die Fenster an der Südseite
waren nur
aufgemalt |
Innenaufnahme des
Betraumes;
der Frauenbereich ist rechts hinter den
Bankreihen für die Männer erkennbar |
| |
|
|
 |
 |
|
|
Eingang in die Synagoge |
Der Hochzeitsstein |
|
Fotos nach 1945/Gegenwart:
| Foto nach 1945: |
 |
|
| |
Die ehemalige Synagoge
wird umgebaut |
|
| |
|
|
Fotos um 1985:
(Fotos: Hahn) |
 |
 |
| |
Das ehemalige Synagogengebäude in
ungefähr derselben Perspektive wie
die
historischen Ansichten oben |
Das Gebäude aus
südöstlicher Richtung |
| |
| |
|
|
| |
|
|
Fotos 2003:
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 2.9.2003) |
|
 |
 |
 |
Das ehemalige
Synagogengebäude
wie oben |
Das Gebäude aus
südöstlicher Richtung |
Hinweistafel |
| |
| |
|
|
Links und Literatur
Links:
Quellen:
Literatur:
 | Paul Sauer: Die jüdischen Gemeinden in Württemberg und
Hohenzollern. 1966. S. 36-37. |
 | Wolfram Angerbauer/Hans Georg Frank: Jüdische Gemeinde in
Kreis und Stadt Heilbronn. 1986. S. 126-133. |
 | Egon Fieß: Beiträge zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in
Kochendorf, und Lothar Hantsch: Juden in Kochendorf, in: Stadtbuch
Bad Friedrichshall. 1983. S. 405-436. |
 | Lothar Hantsch: Von den Kochendorfer Juden. Heimatgeschichtliche
Beilage zum Friedrichshaller Rundblick Nr. 48. September 1982. |
 | ders.: Der jüdische Speisewirt Hermann Herz in Jagstfeld.
Heimatgeschichtliche Beilage zum Friedrichshaller Rundblick Nr. 79/80.
1985. |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|