|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg
Neckarsulm (Landkreis Heilbronn)
Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In dem vom Ende des 15. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts
dem Deutschen Orden gehörenden Neckarsulm bestand eine jüdische Gemeinde im Mittelalter, die durch die Judenverfolgungen 1298 und 1349 vernichtet wurde. In
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts kamen nach der Ausweisung der
Heilbronner Juden einige von ihnen nach Neckarsulm. Seitdem lebten vermutlich
ununterbrochen bis zum 20. Jahrhundert Juden in der Stadt (vgl. Beitrag des
Lehrers Moritz Kulb s.u.).
Die Entstehung der
neuzeitlichen Gemeinde geht in die Zeit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
zurück. 1625 lebten 45 jüdische Einwohner in der Stadt, 1639 waren es acht jüdische
Familien, dazu kamen einige auswärtige Juden, die auf Grund des Krieges in die
Stadt geflohen waren. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts lebten jeweils
fünf bis acht jüdische Familien in der Stadt.
Die höchste Zahl jüdischer
Einwohner wurde um 1752 mit 13 Familien (ca. 90 Personen) erreicht, danach ging
die Zahl zurück (1802 sieben Familien).
Im 19. Jahrhundert wurde die Höchstzahl
um 1869 mit 54 Personen erreicht, danach ging die Zahl zurück: 1888 noch
20 jüdische Einwohner.
1828 oder 1832 wurde Neckarsulm Filialgemeinde zu
Kochendorf und gehörte zum Bezirksrabbinat Lehrersteinsfeld.
Von Kochendorf kam der dortige Religionslehrer fortan regelmäßig zum
Religionsunterricht nach Neckarsulm (siehe unten Ausschreibungen der Stelle).
1887 waren es zwei schulpflichtige jüdische Kinder, denen der Kochendorfer
Lehrer wöchentlich zwei Stunden Religionsunterricht erteilte (siehe unten
Ausschreibung 1887).
Bereits im Oktober
1874 wurde auf Grund der schnellen Abwanderung der Juden insbesondere nach
Heilbronn die Gemeinde aufgelöst. Seitdem gehörten die noch in Neckarsulm
lebenden Juden der Kochendorfer Gemeinde an. 1898 waren dies noch 12 Personen in
drei Haushaltungen. Nach der Auflösung der Kochendorfer Gemeinde 1925 gehörten die
in den beiden Orten lebenden jüdischen Personen zur Heilbronner Gemeinde.
Im Ersten Weltkrieg ist Richard Reinganum aus Neckarsulm 1918 in den
Argonnen gefallen.
1933 wurden noch 17 jüdische Einwohner in der Stadt
gezählt.
Von den in Neckarsulm geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Amalie Bodenheimer
(1875), Alice Harburger geb. Rheinganum (1906), Werner Römmele (1914).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Allgemeine Berichte
Zur Geschichte der Juden in Neckarsulm (Artikel von 1925)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 15. Januar 1925: "Geschichte der Juden zu Neckarsulm.
Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 15. Januar 1925: "Geschichte der Juden zu Neckarsulm.
Die älteste Nennung eines Neckarsulmer Juden enthält die Märtyrerliste von
Heilbronn. Am 19. Oktober 1298 (statt 1289!) wurde hier während der
Verfolgung durch den Ritter Rindfleisch Rabbi Vives von Sulmen, seine Frau
Meitin und seine gleichnamige Enkelin ermordet.
In der Stadt selbst fand ein grausiges Judenmorden im Jahre 1349 statt'.
(Salfeld, Memorbuch in Quellen III. 254).
In einer besonderen Vertrauensstellung stand Sampson zu Sulm bei Graf
Eberhard von Württemberg. Der Graf wandte sich am 26. Juni 1474 für ihn an
den Heilbronner Rat, und Sampson (Samson) schrieb selbst zur Vertretung
seiner Angelegenheiten einen noch erhaltenen interessanten Brief an den Rat
am 25. Februar 1483 (Württembergische Geschichtsquellen V. 523, XV.117, 287
f). Dass er nicht der einzige Jude damals in Neckarsulm gewesen, beweist das
Vorkommen eines Juden Jakob von Sulm (12. Oktober 1477, Württembergische
Geschichtsquellen XV. 117).
Diese Juden waren Flüchtlinge aus Heilbronn. Ihnen teilte der Rat im Jahre
1483 einen Ratsbeschluss mit, dass fortan kein Heilbronner Bürger
verpflichtet sei, einem Juden seine Schuld zurückzuzahlen. Sie sollten sich
also danach richten (Carl Jäger, Geschichte von Heilbronn I. 260 f).
|
 Allerdings
fanden die Juden in Neckarsulm in dem Deutschmeister Reinhard von Neipperg
einen tatkräftigen Sachwalter (Württembergische Geschichtsquellen XX. 846). Allerdings
fanden die Juden in Neckarsulm in dem Deutschmeister Reinhard von Neipperg
einen tatkräftigen Sachwalter (Württembergische Geschichtsquellen XX. 846).
Zwei besonders hervorragende Großkaufleute sind in dieser Zeit die Juden
Hirsch und Michel gewesen. Hirsch wird in Prozessakten vom 23. September
1529 bis zum 6. August 1532 wiederholt, Michel nur am 24. Dezember 1529 und
am 5. Januar 1530 genannt. Am 18. Mai 1530 hatte Kaiser Karl V. der 'Jüdischheit'
alle ihre im Reich verliehenen Privilegien bestätigt. Diesen Anlass
benutzten Michel und Hirsch sich am 26. Juli 1530 namens 'gemeiner
jüdischheit' an den Heilbronner Rat zu wenden. Sie hatten durch einen
kaiserlichen Boten dem Heilbronner Rat ihre von Kaiser Maximilian
verliehenen und von Kaiser Karl bestätigten Privilegien verlesen lassen und
in Abschrift zugesandt. Sie baten um schriftliche Antwort durch den Boten,
ob der Rat diesen
kaiserlichen Mandaten Nachkommen werde lWürttembergische Geschichtsquellen
XX. 397). Der Rat geriet durch dieses tatkräftige Vorgehen in große
Verlegenheit. Am 28. Juli 1530 schrieb der Syndikus Doktor Jakob Ehinger aus
Schwaigern an den Bürgermeister Hans Wysspronn, dass er es für richtig
erachtete, wenn der Rat zur Vermeidung von Weiterungen den Neckarsulmer
Juden sofort einen Tag ansetzte, an dem sie die Antwort des Rates empfangen
sollten.
Statt einer Antwort legte der Rat Beschwerde beim Kaiser ein 'wegen
unverschämt und gräulich Jüdischheit'. Auf dem Städtetag zu Donauwörth
wurden von den betroffenen Städten gemeinsame Vorschriften gegen die Juden
vereinbart, und schließlich erlangte Heilbronn am 4. Februar 1543 von Kaiser
Ferdinand ein eigenes Privileg, das es von der Verpflichtung befreite, Juden
aufzunehmen. Das Privileg wurde den Juden von Neckarsulm direkt bekannt
gegeben (Carl Jäger, Heil- |
 bronn
II. 155-160). Das war schon deshalb notwendig, weil der Rat von Heilbronn
1523 alle Juden aus dem Stadtgebiet und seinen Dörfern Neckargartach,
Frankenbach und Böckingen ausgewiesen hatte, die sich eine neue Heimat in
Neckarsulm suchten. bronn
II. 155-160). Das war schon deshalb notwendig, weil der Rat von Heilbronn
1523 alle Juden aus dem Stadtgebiet und seinen Dörfern Neckargartach,
Frankenbach und Böckingen ausgewiesen hatte, die sich eine neue Heimat in
Neckarsulm suchten.
Im 18. Jahrhundert trieben die Neckarsulmer Juden zumeist Pferdehandel.
Wenigstens beklagten sie sich bei der Deutschordensregierung, deren Schutz
sie gegen ein jährliches Kopfgeld von zwölf Reichstalern genossen, darüber,
dass sie beim Amtsritt die Pferde stellen mussten. 1742 erneuerte der
Deutschmeister ihren Schutzbrief.
In dieser Zeit spielt der erbitterte Kampf der Brüder Abraham und Nathan
Maron (auch Marum oder Maron Levi genannt) um die Erweiterung ihrer Rechte.
Im Jahre 1750 setzte Abraham Maron Levi den seit Jahren erstrebten Erwerb
eines größeren Anwesens durch. Ebenso hartnäckig war ihr Kampf, den
Getreide- und Weinhandel an sich zu ziehen (1760-61). Ein Jahrzehnt später
war der Kurbayerische Hoffaktor Moyses Mändle der angesehenste Jude der
Stadt.
Als Neckarsulm an Württemberg kam, lebten dort noch elf jüdische Familien
mit etwa vierzig Seelen. Ihre Zahl ist unablässig zurückgegangen, bis ihr
Gotteshaus geschlossen werden musste.
Die Neckarsulmer Juden wurden in die Gemeinde Kochendorf eingemeindet, bis
auch die dortige Lehrerstelle aufgehoben werden musste. Heute leben noch
zehn Juden im Orte.
Ihre bescheidene Synagoge (Judenschule) in der Lammgasse, in der Nähe des
Benediktinerklosters ist jetzt in eine Scheune (Besitzer Heinrich Krämer)
umgewandelt. Auch das rituelle Frauenbad ist noch vorhanden. Der wertvollste
Rest der einst so bedeutenden Gemeinde ist aber ihr Friedhof am Fuße der
Westseite des Scheuerberges. Auf ihm ruhen neben den Neckarsulmern die Juden
von Sontheim, Frankenbach, Böckingen,
Neckargartach, Kochendorf und
Oedheim. Er gehört neben dem Friedhof in
Affaltrach zu den ältesten und
ehrwürdigsten israelitischen Begräbnisstätten der Oberämter Heilbronn und
Weinsberg." |
Zur Geschichte der Juden in Neckarsulm (Beitrag von
Oberlehrer Kulb in Öhringen von 1931)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Juli 1931: "Zur Geschichte der Juden in
Neckarsulm. Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Juli 1931: "Zur Geschichte der Juden in
Neckarsulm.
Von Oberlehrer Kulb-Oehringen.
Die erste Erwähnung von Juden in Neckarsulm bietet die Märtyrerliste von
Heilbronn. Am gleichen Tage, an welchem Hunderte unschuldiger Juden ihr
Leben unter der Mordgier 'Rindfleischs' und seiner Horden in Heilbronn 1298
lassen mussten, fielen der fromme Rabbi Vives von Sulmen, seine Frau Meitin
und seine gleichnamige Enkelin den Mördern zum Opfer. Nach Salfeld, Das
Nürnberger Memorbuch Quellen III. 254. fand im Jahre 1349 wie in vielen
Städten Deutschlands auch in Neckarsulm ein grausames Judengemetzel statt.
Außer dem Juden Jakob von Sulm wohnte ein Jahrhundert später ein Jude
Sampson in der Sulmstadt. welcher es verstand, sich in die Gunst des Grafen
Eberhard von Württemberg zu setzen. Der Graf verwendete sich für Sampson am
26. Juni 1474 bei dem Heilbronner Rat, und Sampson schrieb selbst zur
Vertretung seiner Angelegenheit einen noch erhaltenen interessanten Brief an
den Rat am 25. Februar 1483. Diese wie die meisten der aus Heilbronn 1476
und später 1520-29 vertriebenen Juden haben sich nach Neckarsulm geflüchtet,
und der Deutschorden nahm sie gegen Entrichtung bedeutender Aufnahmegelder
und Bezahlung jährlicher Schutzgelder gern auf.
Der Heilbronner 'Rat' teilte den Flüchtlingen im Jahre 1485 einen
Ratsbeschluss mit, dass fortan kein Heilbronner Bürger verpflichtet sei,
einem Juden seine Schuld zurückzubezahlen: sie könnten sich danach richten
(Carl Jäger, Geschichte von Heilbronn I, 260 ff). Die Juden von Neckarsulm
ließen nichts unversucht, dagegen Einsprache zu erheben, und fanden in dem
Deutschmeister Reinhard von Neipperg einen tatkräftigen und gerechten
Sachwalter.
In jener Zeit sind ganz besonders zwei hervorragende jüdische Großkaufleute,
Hirsch und Michel, in den Vordergrund der jüdischen Gemeinde von Neckarsulm
getreten. Hirsch wird in Prozessakten vom 25. September 1529 bis zum 6.
August 1532 wiederholt. Michel nur am 24. Dezember 1529 und am 5. Januar
1530 genannt.
Am 18. Mai 1530 hatte Kaiser Karl V. der 'Jüdischheit' alle ihre im Reich
verliehenen Privi- |
 legien
bestätigt. Diesen Anlass benützten Michel und Hirsch, sich am 26. Juli 1530
namens 'gemeiner jüdischheit' an den Heilbronner Rat zu wenden. Sie hatten
durch einen kaiserlichen Boten dem Heilbronner Rat ihre vom Kaiser
Maximilian verliehenen und vom Kaiser Karl V. bestätigten Privilegien
vorlesen lassen und in Abschrift zugesandt. Sie baten um schriftliche
Antwort durch den Boten, ob der Rat diesen kaiserlichen Mandaten nachkommen
werde. Der Rat geriet durch dieses tatkräftige Vorgehen in große
Verlegenheit. Am 28. Juli 1530 schrieb der Syndikus Doktor Jakob Ehinger aus
Schwaigern, dass er es für richtig erachtete, wenn der Rat zur Vermeidung
von Weiterungen für die Neckarsulmer Juden sofort einen Tag ansetzte, an dem
sie die Antwort des Rates empfangen sollten. legien
bestätigt. Diesen Anlass benützten Michel und Hirsch, sich am 26. Juli 1530
namens 'gemeiner jüdischheit' an den Heilbronner Rat zu wenden. Sie hatten
durch einen kaiserlichen Boten dem Heilbronner Rat ihre vom Kaiser
Maximilian verliehenen und vom Kaiser Karl V. bestätigten Privilegien
vorlesen lassen und in Abschrift zugesandt. Sie baten um schriftliche
Antwort durch den Boten, ob der Rat diesen kaiserlichen Mandaten nachkommen
werde. Der Rat geriet durch dieses tatkräftige Vorgehen in große
Verlegenheit. Am 28. Juli 1530 schrieb der Syndikus Doktor Jakob Ehinger aus
Schwaigern, dass er es für richtig erachtete, wenn der Rat zur Vermeidung
von Weiterungen für die Neckarsulmer Juden sofort einen Tag ansetzte, an dem
sie die Antwort des Rates empfangen sollten.
Statt einer Antwort legte der Rat Beschwerde beim Kaiser ein 'wegen
unverschämt und gräulich Jüdischheit'.
Auf dem Städtetag zu Donauwörth wurden von den betreffenden Städten
gemeinsame Vorschriften gegen die Juden vereinbart, und schließlich
verlangte Heilbronn am 4. Februar 1543 vom Kaiser Ferdinand ein eigenes
Privileg, das es von der Verpflichtung befreite. Juden aufzunehmen. Das
Privileg wurde den Juden von Neckarsulm direkt bekannt gegeben (Carl Jäger,
Heilbronn II, 155—160). Das war schon deshalb notwendig, weil der Rat von
Heilbronn 1523 alle Juden aus dem Stadtgebiet und seinen Dörfern
Neckargartach, Frankenbach und Böckingen ausgewiesen hatte, die sich eine
neue Heimat in Neckarsulm suchten.
Im Jahre 1650 führten die Bürger Neckarsulms Klage über die vielen Juden in
der Stadt bei der Regierung des Deutschordens. Ihr Antrag ging dahin: 'Die
fremden (frisch zugezogenen) Juden sollen ausgewiesen werden, die
berechtigten jeder sein eigenes Haus haben und nicht mehrere beisammen
wohnen, das Land sei jetzt sicher genug, um auch dort wohnen zu können. Im
Geschäftsverkehr soll jeder Handel genau schriftlich aufgesetzt, und es
sollen bei Geldanleihen jederzeit auch die dazu gegebenen Waren spezifiziert
werden."
Hatten die Bürger im Jahre 1650 Klage gegen die Juden geführt, so
beschwerten sich hingegen anno 1690 die Juden darüber bei der Regierung
gegen die Stadt, 'dass sie beim Amtsritt die Pferde stellen müssen'. Die
Beschwerde ist insofern von einigem Interesse, als sie erkennen lässt, dass
die Judenschaft wohl schon damals den Pferdehandel betrieben habe. -
Wenn Neckarsulm bzw. der hohe Deutschorden die aus Heilbronn ausgewiesenen
Juden aufgenommen hat, so waren sie damit nichts weniger als Bürger oder
Vollbürger der Stadt, sondern einfache Hintersaßen (accubae) und Schutzleute
des Deutschmeisters, der ihnen, natürlich gegen Übernahme gewisser
Verbindlichkeiten. Verpflichtungen und Einschränkungen, einen Schutzbrief
ausgestellt hatte. Dahin gehörte, dass jeder Jude ein jährliches Schutzgeld
von 12 Reichstalern an die Herrschaft zu entrichten hatte: eine für die
damaligen Geldverhältnisse nicht unerhebliche Besteuerung. Den Juden war
sodann von Anfang an, wie früher in allen Städten, ein besonderer Distrikt
in der Stadt zur Bewohnung angewiesen, das so genannte Judenviertel - über
das sie nicht hinausgreifen durften. Nur ausnahmsweise und nur mit hoher
Genehmigung wurde ihnen gestattet, Häuser, die im Besitze von Christen
waren, käuflich zu erwerben.
Die rührige Judenschaft, die anfangs, wie schon angedeutet, ziemlich
zahlreich war, fühlte sich innerhalb dieser und anderer Einschränkungen
gehemmt, was zur Folge hatte, dass gar manche bald anderwärts ein bessres
Unterkommen suchten. Die Zurückgebliebenen aber vielfach über die ihnen
lästigen Schranken hinausstrebten und es an Versuchen nicht fehlen ließen,
sie zu durchbrechen, was öfters Einschreiten und wiederholte Gegenmaßregeln
von Seiten der Deutschherrlichen Regierung und Obrigkeit veranlasste. Das
tritt besonders in zahlreichen Regierungserlassen aus dem vorigen
Jahrhundert deutlich zutage. Diese hatte ihnen zwar im Jahre 1742 den
Schutzbrief erneuert und bestätigt, aber schon im Jahre 1745 hatte sie
Anlass, durch Dekret den in- und ausländischen Juden zu verbieten, zu
Geldvorschüssen noch Waren, Branntwein usw. abzugeben und den viel zu hoch
angesetzten Preis zur Kapitalschuld zu schlagen. -
Ganz besonders war es ein israelitisches Brüderpaar, Abraham und Nathan
Maron (auch Maron Levi genannt), die um die Mitte des 18. Jahrhunderts durch
ihre Widerspenstigkeit gegen die alte Ordnung der Deutschordensbehörde und
der Bürgerschaft viel zu schaffen machten, die mit großer Energie und. wie
es scheint, mit allen Mitteln - einer derselben wird darum in einer
städtischen Urkunde Maron der Falsche tituliert - Erweiterungen ihrer Rechte
durchzusetzen suchten. Dabei handelte es sich in erster Linie um
Häusererwerb (wahrscheinlich um beabsichtigten Häuserhandel) und den Betrieb
des Weingeschäftes.
So wird durch Regierungserlass vom Jahre 1748 dem Neckarsulmer Schutzjuden
Nathan Maron sein wiederholtes Gesuch, sein kleines Haus mit einem großen an
der Hauptstraße und in der Nähe der Kirche vertauschen zu dürfen, abschlägig
beschieden mit dein Vermerk: ''er solle in einer Nebengasse seine Wohnung
haben'. Nach ihm trat sein Bruder Abraham mit dem gleichen Gesuch hervor und
hatte das gleiche Schicksal erfahren. Doch das entmutigte die unverzagten
Brüder nicht, sie wagten im Jahre 1749 ein neues Gesuch, wurden aber aufs
Neue dahin beschieden : 'Amtmann Klamm in Stocksberg, dem das betreffende
Haus gehörte, solle einen christlichen Käufer suchen, die Juden sollen es
nicht bekommen'. Allein was geschah? Im Jahre 1750 hatte Abraham Maron seine
Absicht dennoch durchgesetzt und das Haus erworben. Und nun ist er schon
wieder im Zug, ein anderes - eine Gartenwegs-Behausung - an sich zu bringen:
es wurde ihm jedoch abgeschlagen. Aber schon im Jahre 1758 wurde durch einen
neuen Erlass dem Schutzjuden Abraham Maron Levi untersagt: 'neben seinen
schon zwei besitzenden Christenhäusern, noch ein drittes, das
Freudenberger'sche Haus, zu erwerben'.
Auch den Wein- und Getreidehandel im großen zu betreiben, schienen die
Gebrüder Maron versucht zu haben. Ersteres wäre vielleicht für die
Neckarsulmer damals, wo sie noch keinen Weinmarkt hatten, gar nicht so
unvorteilhaft gewesen. Allein die Bürgerschaft schien eine Schädigung ihres
Interesses darin erblickt zu haben: darum die obrigkeitliche Verfügung:
'Keine jüdische Haushaltung darf mehr als 5 Fuder Wein zum Koschern und
Einlegen sich erwerben — die Gebrüder Nathan und Abraham Maron aber gar
keinen - wegen ihrer respekt- und gehorsamwidrigen Art, weil sie ihren
Bedarf gar nicht anzeigen wollen.' |
| |
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. August 1931: "Zur Geschichte der
Juden in Neckarsulm. Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. August 1931: "Zur Geschichte der
Juden in Neckarsulm.
Von Oberlehrer Kulb - Öhringen.
Ebenso wurde auch im Jahre 1760 auf Klagen der Bürgerschaft den Juden das
viele Aufkäufen und 'Koschern' von Most im Herbste verboten, im Jahre 1761
der Verkauf von Getreide ins Ausland untersagt, damit es nicht daheim
verteuert werde.
Doch nicht nur gegen die Juden, sondern auch für dieselben, als ihre
'jüdischen Schutzleute", zugleich auch für ihre christlichen Untertanen,
trat die hohe Deutschordens-Regierung mit ihren Erlassen ein. So verfügte
ein solcher vom Jahre 1738, dass den vom Freiherrn v. Bauz in
Oedheim aufgenommenen Judenfamilien aller
Handelsverkehr mit den Ordensuntertanen - Juden wie Christen - unter Strafe
der Vermögenskonfiszierung verboten, die Untertanen selbst im Falle des
Zuwiderhandelns mit 5 fl. Strafe angesehen werden sollen. Und ein anderer
vom Jahre 1739 gibt zu erkennen, dass die Kochendorfer Juden bei Strafe
nicht an Sonn- und Feiertagen bei den Ordensuntertanen Geld einziehen
dürfen, dass gegen Zuwiderhandelnde mit Arreststrafen vorgegangen werden,
und dass dem Hebräer Jakob Mayer in
Kochendorf bei Strafe verboten sein solle, mehr als 5 Prozent zu nehmen.
Doch sind auch die Neckarsulmer Juden hinwiederum mit einbezogen, ja
hauptsächlich gemeint, wenn ein Erlass vom Jahre 1752 verordnet, dass wegen
Betrugs, Wuchers, Übervorteilung der Juden jeder Kontrakt, Handel usw. bei
über 20 fl. Wert obrigkeitlich untersucht werden sollte: wo nicht, sollten
die Juden ohne weiteres von den Gerichten abgewiesen werden.
Im allgemeinen scheinen die Juden während ihres 400jährigen Aufenthalts
stets in gutem, friedlichen Einvernehmen mit der christlichen Bevölkerung
gelebt zu haben, und weder die pfarrlichen noch die städtisch-bürgerlichen
Akten wissen Ungünstiges über sie zu berichten. Ihre besonders anfänglich
größere Anzahl erforderte eine Art von eigenem Gemeindeleben und von
GemeindeInstitutionen. So hatte die jüdische Gemeinde in Neckarsulm bis etwa
zur Mitte des vorigen Jahrhunderts ihre eigene, freilich höchst bescheidene
Synagoge. im Volksmund heute poch 'die Judenschul" genannt,
die noch steht und nunmehr in eine Scheune umgewandelt ist (Eigentum des
Landwirts Heinrich Krämer in der Nähe des Benediktinerklosters in der
Lammgasse).
Die Innenwände zeigen heute noch in Quadratschrift geschriebene, zum Teil
noch gut erhaltene hebräische Verse auf. Außer der Synagoge hatte die
jüdische Gemeinde ihr eigenes rituelles Frauenbad und ihren eigenen
Friedhof in Waldesnähe - am Fuße der
Westseite (des Scheuerbergs. Er weist eine ansehnliche Zahl von alten,
interessanten Grabsteinen auf. Man wird wohl in der Annahme nicht irre
gehen, dass dieser Friedhof bald von den im Jahre 1529 aus Heil- |
 bronn
ausgewiesenen und in Neckarsulm angesiedelten Juden angelegt wurde. Die
Juden der damaligen Zeit wurden mit denen von
Sontheim, Frankenbach. Böckingen und
Neckargartach anfangs auf dem noch älteren Friedhof von
Affaltrach und später auf dem Friedhof
von Neckarsulm zur letzten Ruhe bestattet. Außer den genannten Ortschaften
hatten auch die jüdischen Gemeinden
Kochendorf und Oedheim ihre Toten in
Neckarsulm beerdigt. Dank dem eingreifen des Oberrats ist der Zerfall dieses
alten und idyllisch gelegenen Friedhofs durch Hebung der Grabsteine und
Anbringung einer guten Einfriedigung verhütet. bronn
ausgewiesenen und in Neckarsulm angesiedelten Juden angelegt wurde. Die
Juden der damaligen Zeit wurden mit denen von
Sontheim, Frankenbach. Böckingen und
Neckargartach anfangs auf dem noch älteren Friedhof von
Affaltrach und später auf dem Friedhof
von Neckarsulm zur letzten Ruhe bestattet. Außer den genannten Ortschaften
hatten auch die jüdischen Gemeinden
Kochendorf und Oedheim ihre Toten in
Neckarsulm beerdigt. Dank dem eingreifen des Oberrats ist der Zerfall dieses
alten und idyllisch gelegenen Friedhofs durch Hebung der Grabsteine und
Anbringung einer guten Einfriedigung verhütet.
Die Neckarsulmer Juden gehörten lange Zeit zum Rabbinat
Kochendorf, später nach
Lehrensteinsfeld. Im Laufe der
Zeit ist die jüdische Gemeinde in Neckarsulm mehr und mehr
zusammengeschmolzen. Am Anfänge des vorigen Jahrhunderts, als Neckarsulm
unter Württembergs Szepter kam, umfasste die Judengemeinde nur noch elf
Familien mit etwa 40 Seelen. Ihre Zahl ist in der Neuzeit noch mehr
zurückgegangen: ihre Synagoge und Schule ist längst geschlossen und einer
profanen Bestimmung überwiesen. Die Standesbücher führte vom Jahre 1805 an
das katholische Stadtpfarramt, seit dem Jahre 1876 das neue Standesamt. Das
Freizügigkeitsgesetz der Neuzeit hat die meisten Söhne der alten Familien in
die Ferne und auf größere Plätze gezogen, wo sie blieben und zum Teil, wie
die Rosenfeld in Zürich und Rheinganum in
Göppingen, sich zu Großindustriellen emporgeschwungen hatten. Auch
Heilbronn, das sie einst ausgetrieben, hat ihnen seine Tore wieder öffnen
müssen. Heute zählt Neckarsulm vier jüdische Familien mit etwa 10 Seelen,
die der jüdischen Gemeinde Heilbronn angegliedert sind." |
Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1872 /
1876 / 1887 / 1891 für Kochendorf mit Neckarsulm (und
Oedheim)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Dezember 1872:
"Religionslehrer- und Vorsänger-Gesuch. Die Gemeinde
Kochendorf sucht per 1. Januar 1873 einen Religionslehrer und Vorsänger,
welcher auch den Religionsunterricht in Oedheim und Neckarsulm
wöchentlich 2 Mal mit je 2 Stunden zu erteilen hat. Gehalt 475 Gulden pro
Jahr nebst freier Wohnung und Emolumenten. Qualifizierte, unverheiratete
Bewerber wollen ihre Zeugnisse franko dem Unterzeichneten einsenden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Dezember 1872:
"Religionslehrer- und Vorsänger-Gesuch. Die Gemeinde
Kochendorf sucht per 1. Januar 1873 einen Religionslehrer und Vorsänger,
welcher auch den Religionsunterricht in Oedheim und Neckarsulm
wöchentlich 2 Mal mit je 2 Stunden zu erteilen hat. Gehalt 475 Gulden pro
Jahr nebst freier Wohnung und Emolumenten. Qualifizierte, unverheiratete
Bewerber wollen ihre Zeugnisse franko dem Unterzeichneten einsenden.
Heilbronn am Neckar, 19. November 1872. Das Königlich Württembergisch
Bezirks-Rabbiner: Dr. M. Engelbert." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1876:
"Die Religionslehrer- und Vorsängerstelle in Kochendorf, welche
Mitte Juli dieses Jahres vakant wird, soll alsbald wieder besetzt werden.
Der Gehalt für diese Stelle, mit welcher der Religionsunterricht in
Oedheim und Neckarsulm verbunden ist, beträgt 8.0 (?) Mark
pro Jahr nebst freier Wohnung und Emolumenten. Qualifizierte Bewerber
wollen ihre Meldungen und Zeugnisse innerhalb 3 Wochen dem Unterzeichneten
einsehen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1876:
"Die Religionslehrer- und Vorsängerstelle in Kochendorf, welche
Mitte Juli dieses Jahres vakant wird, soll alsbald wieder besetzt werden.
Der Gehalt für diese Stelle, mit welcher der Religionsunterricht in
Oedheim und Neckarsulm verbunden ist, beträgt 8.0 (?) Mark
pro Jahr nebst freier Wohnung und Emolumenten. Qualifizierte Bewerber
wollen ihre Meldungen und Zeugnisse innerhalb 3 Wochen dem Unterzeichneten
einsehen.
Heilbronn am Neckar, 12. Juni 1876. Das Königliche Bezirksrabbiner. Dr.
M. Engelbert." |
| |
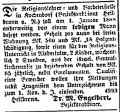 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Oktober 1887:
"Die Religionslehrer- und Vorbeterstelle in Kochendorf
(Bezirksrabbinat Heilbronn am Neckar) soll am 1. Januar 1888 anderweitig
von einem ledigen Mann besetzt werden. Gehalt pro anno bei freier
Wohnung Mark 560 und Mark 18 Holzentschädigung, sowie einen für den
Religionsunterricht in Neckarsulm, 2 Kinder, wöchentlich 2
Stunden, aus der israelitischen Zentralkirchenkasse zu beziehenden Gehalte
von Mark 85 jährlich, nebst Emolumenten. Qualifizierte Bewerber wollen
ihre Meldungen nebst Zeugnissen dem Unterzeichneten bis zum 1. November
dieses Jahres einsenden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Oktober 1887:
"Die Religionslehrer- und Vorbeterstelle in Kochendorf
(Bezirksrabbinat Heilbronn am Neckar) soll am 1. Januar 1888 anderweitig
von einem ledigen Mann besetzt werden. Gehalt pro anno bei freier
Wohnung Mark 560 und Mark 18 Holzentschädigung, sowie einen für den
Religionsunterricht in Neckarsulm, 2 Kinder, wöchentlich 2
Stunden, aus der israelitischen Zentralkirchenkasse zu beziehenden Gehalte
von Mark 85 jährlich, nebst Emolumenten. Qualifizierte Bewerber wollen
ihre Meldungen nebst Zeugnissen dem Unterzeichneten bis zum 1. November
dieses Jahres einsenden.
Heilbronn. Dr. M. Engelbert, Bezirksrabbiner." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. August 1891:
"Kochendorf. Die Stelle als Religionslehrer und Vorbeter
in hiesiger Gemeinde ist per sofort oder längstens innerhalb drei Monaten
zu besetzen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. August 1891:
"Kochendorf. Die Stelle als Religionslehrer und Vorbeter
in hiesiger Gemeinde ist per sofort oder längstens innerhalb drei Monaten
zu besetzen.
Jährliches Einkommen, bei freier Wohnung, Mark 560,
Holzgeldentschädigung Mark 18, für die Filiale Neckarsulm Mark 85
und nicht unbedeutende Nebenverdienste.
Ledige, seminaristisch gebildete Lehrer wollen sich melden und Zeugnisse beifügen.
Kochendorf bei Heilbronn, 9. August 1891. Vorsteheramt: Levi." |
Aus dem jüdischen
Gemeinde- und Vereinsleben
Rabbi Sekel Wormser aus Michelstadt hilft der Gemeinde
Neckarsulm um 1830 in einer Notlage (1931)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. September 1931:
Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. September 1931:
"Der Rabbi als Arzt. Von Oberlehrer Kulb, Öhringen.
Es dürften etwa hundert Jahre her sein, als der in weiten Kreisen und
über seine engere Heimat hinaus berühmte Rabbi Sekel Wormser
seligen Angedenkens - genannt Baal Schem von Michelstadt
- geehrt und geachtet und in hohem Ansehen stehend, segensreich wirkte.
Nicht nur in religiösen Fragen wandte man sich an den gelehrten und
frommen Mann, sondern auch in Dingen, deren Beurteilung man von Ärzten
erhoffte. So geschah es, dass in der Gemeinde Neckarsulm die Knaben
- und es waren deren mehrere - nacheinander in den besten Kindesjahren vom
Tode hinweggerafft wurden, während die Mädchen am Leben blieben. Man
wusste lange Zeit keinen Rat, um so mehr die befragten Ärzte vor einem
Rätsel standen. In ihrer Not wandte sich eine Familie an den berühmten
Rabbi in Michelstadt im Odenwald mit der Frage, was zu tun sei, um ein
inzwischen geborenes Knäblein am Leben zu erhalten.
Man bat nicht vergebens: die Antwort des großen Rabbi lautete, dass man
den Knaben bis zu seiner Barmizwah nur in weiße Gewänder kleiden solle.
Die Eltern freuten sich über den Bescheid, befolgten den Rat des weisen
Rabbi und waren ihrem Gotte und dem gelehrten Manne überaus
dankbar.
Der Knabe wuchs zur Freude seiner Eltern zum Manne heran. Er übte als
wahrer Menschenfreund viel Gutes und segnete nach Beendigung des
Weltkrieges, geachtet und geehrt als langjähriger Vorsteher, das
Zeitliche. Sein Name - Julius Reinganum - lebt in der Geschichte Göppingens
in ehrendem Andenken
weiter." |
Berichte
zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Über der Lehrer und Vorsänger Aaron
Hilberth (geb. 1815 in Neckarsulm, gest. 1864 in Niederstetten)
finden sich ausführliche Informationen in der
Seite zu Niederstetten.
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Lehrlingssuche des Kaufhauses Stern (1912)
 Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 26. April
1912: "Lehrling Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 26. April
1912: "Lehrling
gesucht bei freier Station. Sohn achtbarer Eltern. Selbstgeschriebene
Offerten an
Kaufhaus Stern
Neckarsulm." |
Verlobungs- und Heiratsanzeigen von Stefan Strauss
(Neckarsulm/Heilbronn) und Gretel Nussbaum (Köln) (1935)
 Anzeige in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1935: Anzeige in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1935:
"Gretel Nußbaum - Stefan Strauss
Verlobte
Köln Spichernstraße 57 - Neckarsulm /
Heilbronn". |
| |
 Anzeige in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1935: Anzeige in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1935:
"Stefan Strauss - Gretel Strauss geb. Nussbaum
Vermählte.
Neckarsulm / Heilbronn 24. März 18935 Hochzeit
in Köln Spichernstraße 57". |
Zur Geschichte des Betsaales / der Synagoge
Die ehemalige "Judengasse"
(parallel zu einem Teil der Marktstraße und zu einem Teil der Kolpingstraße;
gegenüber der Pfarrkirche St. Dionysius) könnte Hinweis auf ein
mittelalterliches Wohngebiet sein. Durch die Bebauung nach 1945 ist diese
Judengasse aus dem Stadtbild völlig verschwunden.
Seit dem 17. Jahrhundert konzentrierte sich das jüdische
Wohngebiet auf den östlichen Teil der Rathausstraße bis zur Neutorgasse. Hier
wurde auch ein Betsaal beziehungsweise eine Synagoge eingerichtet. Eine
erste Nennung stammt aus dem Jahr 1625. Der wegen den Kriegsunruhen von
Erlenbach nach Neckarsulm gezogene Jude Hirtz hatte in Neckarsulm ein Haus
gekauft, worin eine Synagoge eingerichtet werden konnte ("darin sie ihre Synagog
erbaut"). 1639 starb Hirtz. In diesem Jahr wird in Neckarsulm Aaron, Männlins
Sohn genannt, der in dem damals erstellten Judenverzeichnis als "einfältiger
Rabbiner" bezeichnet wird.
Mehrfach wird in den 1690er-Jahren der Betsaal genannt,
vermutlich noch derselbe wie ein halbes Jahrhundert zuvor in einem Gebäude am
Ende der Rathausgasse unweit des Amorbacher Hofes. Da ein Teil der jüdischen
Familien verstreut in der Stadt lebte, stellte sich für den damaligen
deutschordischen Amtmann das Problem, dass beispielsweise "Benedict der Rabbi"
über den Markt und durch mehrere Gassen zur Synagoge gehen musste. Der Amtmann
überlegte, ob die Juden der Stadt "nicht näher zusammengezogen" werden könnten.
Mit welchem Erfolg, wird nicht berichtet.
1736 wurde ein Vertrag der Judenschaft mit der Stadt
Neckarsulm abgeschlossen "das Haus der Judenschaft betreffend".
Gemeint war damit das Gebäude der "Judenschul" oder die
"sogenannte Männer- und Weiber-Synagoge in der Rathausgassen". Die
Judenschaft hatte das Haus für 300 Gulden gekauft, wobei es sich um die alte
Synagoge handelte, die vermutlich nun aus privatem Besitz in das Eigentum der
Gemeinde überging. Nach dem mit der Stadt ausgehandelten Vertrag sollten alle
Anlieger freien Aus- und Eingang zu dem Grundstück haben. Bei dem Gebäude
handelte es sich nach der damaligen Zählung um das Gebäude Nr. 205a an der
Rathausgasse.
Nachdem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die
Zahl der jüdischen Einwohner schnell zurück ging und die Gemeinde 1874 aufgelöst
wurde, wurde auch die Synagoge geschlossen. Letztmals hatte man 1852 an
dem Gebäude eine bauliche Veränderung vorgenommen, wobei für die Besucher "eine
besondere Tür angebracht" wurde. 1861 wird berichtet, dass die Neckarsulmer
Juden die Synagoge in Kochendorf besuchten. Möglicherweise wurde damals nur
noch an Festtagen Gottesdienst in der Neckarsulmer Synagoge gefeiert.
Über die Auflösung der Gemeinde und den anstehenden Verkauf von Synagoge und
Synagogeninventar berichtet die Zeitschrift "Der Israelit" am 24.
März 1875:
 "Neckarsulm. Unsere israelitische
Gemeinde, vor Jahrhunderten zahlreich und wohlausgestattet, seit 1828 ein Filial
der israelitischen Gemeinde in Kochendorf, hat sich, herabgesunken auf etliche
Mitglieder, nun völlig aufgelöst. Unser Kirchengut, bestehend aus dem
Synagogengebäude, Torarollen, wertvollen Vorhängen, silbernem Toraschmuck,
Leuchtern und dergleichen wird nach dem Erkenntnis der Königlichen
Oberkirchenbehörde meistbietend verkauft(!) und der Erlös zunächst der
Zentralkirchenkasse zugewiesen, aus welcher der Betrag seiner Zeit zu Gunsten
israelitischer Gemeinden verwendet wird*. Es ist dies vielleicht der erste Fall,
dass in unserem Lande in solcher Weise über das Gemeindevermögen verfügt
wird, und diese Verfügung gibt ein Präjudiz für künftige Fälle der
Auflösung jüdischer Gemeinden infolge ihrer Entvölkerung und der Übersiedelung
in andere Orte. Bei der jetzigen starken Wanderung der Israeliten vom Lande in
die Städte dürfte das Eingehen der Landgemeinden bald öfters vorkommen und
den Grundstock vermehren, aus welchem bedürftigen Gemeinden Subsidien
zugewendet werden können."
"Neckarsulm. Unsere israelitische
Gemeinde, vor Jahrhunderten zahlreich und wohlausgestattet, seit 1828 ein Filial
der israelitischen Gemeinde in Kochendorf, hat sich, herabgesunken auf etliche
Mitglieder, nun völlig aufgelöst. Unser Kirchengut, bestehend aus dem
Synagogengebäude, Torarollen, wertvollen Vorhängen, silbernem Toraschmuck,
Leuchtern und dergleichen wird nach dem Erkenntnis der Königlichen
Oberkirchenbehörde meistbietend verkauft(!) und der Erlös zunächst der
Zentralkirchenkasse zugewiesen, aus welcher der Betrag seiner Zeit zu Gunsten
israelitischer Gemeinden verwendet wird*. Es ist dies vielleicht der erste Fall,
dass in unserem Lande in solcher Weise über das Gemeindevermögen verfügt
wird, und diese Verfügung gibt ein Präjudiz für künftige Fälle der
Auflösung jüdischer Gemeinden infolge ihrer Entvölkerung und der Übersiedelung
in andere Orte. Bei der jetzigen starken Wanderung der Israeliten vom Lande in
die Städte dürfte das Eingehen der Landgemeinden bald öfters vorkommen und
den Grundstock vermehren, aus welchem bedürftigen Gemeinden Subsidien
zugewendet werden können."
* Anmerkung der Redaktion: Es wäre uns lieb, wenn der geehrte
Korrespondent den Wortlaut jenes 'Erkenntnisses' einsenden möchte. So, wie
es in Vorstehendem mitgeteilt wurde, ist es mit den Vorschriften unserer
heiligen Religion (Schulchan Aruch, Orach-Chajim, C. 153) nicht
übereinstimmend." |
Die Versteigerung des Synagogeninventars am 16. Mai 1875
auf dem Rathaus in Heilbronn erbrachte den Betrag von 335 Gulden.
 Anzeige
in der Zeitschrift der Israelit vom 12. Mai 1875: "Heilbronn.
Versteigerung. Von dem Kirchengut der Israeliten in Neckarsulm werden in
höherem Auftrag am Mittwoch den 16. Mai 1875, vormittags 9 Uhr, auf dem
Rathause in Heilbronn, Zimmer Nr. 19, folgende Gegenstände gegen bare Bezahlung
im Aufstreich verkauft: Anzeige
in der Zeitschrift der Israelit vom 12. Mai 1875: "Heilbronn.
Versteigerung. Von dem Kirchengut der Israeliten in Neckarsulm werden in
höherem Auftrag am Mittwoch den 16. Mai 1875, vormittags 9 Uhr, auf dem
Rathause in Heilbronn, Zimmer Nr. 19, folgende Gegenstände gegen bare Bezahlung
im Aufstreich verkauft:
Mehrere auf Pergament geschriebene, gut erhaltene Gesetzrollen (Siphre Tora und
Megilla). 1 prächtiger, reichlich goldgestickter Vorhand mit silbernen Glocken
(Paroches), 1 dto. und gewöhnliche Vorhänge, 4 Stück goldgestickte
Tora-Mäntelchen. Weiße Vorhänge, Mäntelchen, Decken, Sargenes etc. 1 Stock
silbernes Taß (Toraschmuck) nebst 2 Handdeuter (Jad), zusammen über 3 Pfund
schwer. Wand-, Kron-, Arm-, Hänge- und Chanukka-Leuchter und 1 Handfass von
Messing. Ferner: Bücher, Schofroth von Widderhorn und andere Utensilien. Viele
dieser Gegenstände sind noch zur Ausstattung von Synagogen geeignet.
Israelitisches Kirchenvorsteheramt. A. A. Löwenstein, Vors." |
Auch das Synagogengebäude wurde verkauft und spätestens um 1900 in eine Scheune umgebaut, die am 1. März 1945
kriegszerstört wurde. Noch um 1930 waren an den Innenwänden der ehemaligen
Synagoge in Quadratschrift geschriebene, zum Teil gut erhaltene hebräische
Inschriften zu sehen.
Fotos
Historische Fotos:
Historische Fotos finden
sich in der Publikation von Ansbert Baummann, siehe Literatur |
Plan:
 |
 |
Flurkarten-Ausschnitt: Neckarsulm 1892;
links eingetragen die ehemalige
"Judengasse";
rechts unten die ehemalige Synagoge
Nr. 205 und
das Badhaus 205a |
Karte: Neckarsulm 1834 nach dem Plan der
ersten württembergischen
Landesvermessung
mit eingetragener "Judengasse" und
der
ehemaligen Synagoge |
Fotos nach 1945/Gegenwart:
| |
Fotos sind keine vorhanden |
|
| |
|
|
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| April 2012:
In Neckarsulm wurde ein "Stolperstein"
verlegt |
Artikel von Helmut Buchholz in der
"Heilbronner Stimme" vom 17. April 2012: "Stolperstein-Verlegung
in Heilbronn und Neckarsulm..."
Link
zum Artikel |
Weiterer Artikel in der
"Rhein-Neckar-Zeitung" vom 23. April 2012: "Schüler
setzen Zeichen gegen das Vergessen. 'Stolperstein' zum Gedenken an
Amalie Bodenheimer aus Neckarsulm verlegt..."
Link zum
Artikel (eingestellt als pdf-Datei)
Anmerkung: der Gedenkstein für Amalie Bodenheimer (1875-1942) wurde in
der Wilhelmstraße 14 verlegt. |
| |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Germania Judaica II,2 S. 571-572. |
 | Paul Sauer: Die jüdischen Gemeinden in Württemberg und
Hohenzollern. 1966. S. 132-143. |
 | Wolfram Angerbauer/Hans Georg Frank: Jüdische Gemeinden in
Kreis und Stadt Heilbronn. 1986. S. 165-176. |
 | Lothar Hantsch: Von den Juden in Neckarsulm, in: Historische Blätter
des Heimatvereins Neckarsulm. Sept./Okt. 1985.
|
 | Ansbert Baumann:
"...das wir sie nie so lang gehalten hetten". Die Vertreibung der
Heilbronner Juden im 15. Jahrhundert und ihre Niederlassung in Neckarsulm.
In: Aschkenas. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Juden. 16 Jg.,
Heft 2. 2006. S. 439-460.
|
 | Ansbert Baumann: Die Neckarsulmer Juden. eine Minderheit im
geschichtlichen Wandel 1298-1945. Thorbecke-Verlag. Ostfildern 2008. ISBN
978-3-7994-0819-1.
|



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|