|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge
in Mainz
Mainz (Landeshauptstadt
von Rheinland-Pfalz)
Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte der Stadt im 19./20. Jahrhundert
Hier: Berichte zu den Rabbinern, Lehrer
und weiteren Kultusbeamten der Gemeinde (bis zur NS-Zeit)
Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit
Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Mainz wurden in jüdischen Periodika
gefunden.
Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.
Hinweis:
Die Texte wurden dankenswerterweise von Susanne Reber, Mannheim,
abgeschrieben und mit Anmerkungen versehen.
Übersicht:
Übersicht: Rabbiner in Mainz
im 19./20. Jahrhundert:
Anmerkung: nicht ausführlicher genannt werden die nach 1800 noch einige Zeit tätigen
Dajanim, Unter- und Lehrhausrabbiner (= Talmudlehrer an der Jeschiwa) wie Leser
Lonnerstadt (gest. 1802 als Lehrhausrabbiner), Nathan-Neta Ellinger (um 1808 in Mainz genannt), Moses Kanstadt (um 1808, gest.
nach 1811), Hirsch Kanstadt (gest. 1823 in Mainz), Mendele Kastel (um 1820/30,
stammte aus Kastel). Um 1808 sollen fünf Rabbiner in Mainz tätig gewesen
sein.
 | 1783 bis 1800: Rabbiner Noah-Haium Hirsch (Noach
Chaim Zwi) Berlin (geb. 1734 in Fürth, gest. 1902 in Altona): war
seit 1764 Dajan in Fürth, seit 1772 Landesrabbiner des Fürstentums
Bayreuth in Baiersdorf; seit 1783
Landesrabbiner in Mainz und von 1800 bis zu seinem Tod 1902 Oberrabbiner von
Altona, Hamburg und Wandsbek. |
 | 1799 bis 1810 / 1822: Rabbiner Herz Scheuer (Abraham-Naftali
Herz ben David; geb. 1753, gest. 1822 in Mainz): war in Mainz zunächst als
Unterrabbiner und Lehrer tätig; seit 1799 Oberrabbiner in Mainz; 1810
Amtsniederlegung auf Grund der Reformen des Konsistoriums; 1814 in das Amt
zurückgekehrt; war Leiter der Jeschiwa in Mainz. |
 | 1809 bis 1813: Rabbiner Samuel Levi (geb. 1751 in
Pfersee bei Augsburg, gest. 1813 in Mainz): war seit 1783 Rabbiner in Worms;
wurde am 1. Mai 1809 eingesetzt als Konsistorial-Oberrabbiner für das
Departement Donnersberg mit Sitz in Main ("Grand Rabbin du Consistoire
du Département du Mont-Tonnerre"). Zur Biographie vgl.
https://www.lagis-hessen.de/pnd/1041787413 |
 | 1822 bis 1830: Rabbiner Abraham Moch (geb. 1746
vermutl. in Haguenau, gest. 1830 in Mainz): war seit 1822
"provisorischer Rabbiner" in Mainz gemeinsam mit Rabbiner Leo Ellinger. |
 | 1822 bis 1847: Rabbiner Leo Ellinger (genannt Löb
Schnadig [Schnaittach], geb. 1772 in Mainz, gest. 1847 in Mainz): war seit
1808 Dajan in Mainz und Talmudlehrer an der Jeschiwa; nach dem Tod des
Mainzer Oberrabbiners Herz Scheuer übernimmt er dessen Amt, zunächst
gemeinsam mit dem o.g. Rabbiner Abraham Moch als
"provisorischer Rabbiner" beziehungsweise Rabbinatsverweser. Bis
1830 teilte er das Amt mit Abraham Moch. Nach 1841 wird ihm ein Prediger zur
Seite gestellt. |
 | 1852 bis 1866: Rabbiner Dr. Joseph Aub (geb. 1804 in
Baiersdorf, gest. 1880 in Berlin):
studierte an der Fürther Jeschiwa, seit 1822 in Erlangen und München; war
von 1829 bis 1852 Rabbiner in Bayreuth, seit Dezember 1852 in Mainz
(Einweihung der neuen Synagoge mit Orgel 1853); von 1866 bis 1879 Rabbiner
in Berlin, zugleich Dozent an der Veitel-Heine-Ephraimschen Lehranstalt und
Religionslehrer an der Lehrerbildungsanstalt (1866 Einweihungspredigt in der
Neuen Synagogen Oranienburger Straße). |
 | 1846 / 1851 / 1866 bis 1880: Rabbiner Dr. Elias Cahn
(geb. 1808 in Mainz, gest. 1888 in Mainz): studierte an der Jeschiwa in
Mannheim, seit 1833 in Gießen und Bonn; ab 1838 Religionslehrer in Mainz,
Reformanhänger (am 11. Juli 1840 die erste Konfirmation), seit 1843 auch
Prediger; 1846 Rabbinatsverweser in Mainz, 1851 zweiter Rabbiner in Mainz,
behält nach dem Amtsantritt von Joseph Aub die Rabbinatswürde für die
Gemeinde Kastel; 1866 bis 1880 erster
Rabbiner der Israelitischen Religionsgemeinde. |
 | 1880 bis 1918: Rabbiner Prof. Dr. Sigmund Salfeld
(geb. 1843 in Stadthagen, gest. 1926 in Mainz): studierte in Berlin und
Breslau; seit 1870 Rabbiner in Dessau, seit 1880 Rabbiner in Mainz; trat
1918 in den Ruhestand. |
 | 1918 bis 1941: Rabbiner Dr. Sali Levi (geb. 1883 in
Walldorf, gest. 1941 in Berlin): studierte in Breslau; 1910 bis 1914 zweiter
liberaler Rabbiner in Breslau, 1915 bis 1918 Feldrabbiner in Wilna; 1918 bis
März 1941 Rabbiner in Mainz; war Vorsitzender des 1925 gegründeten Vereins
zur Pflege jüdischer Altertümer in Mainz; ging im März 1941 nach Berlin,
um in die USA zu emigrieren, verstarb jedoch zuvor. |
 | 1941: Rabbiner Bernhard Baer (geb. 1917 in Berlin,
1942 verschollen bei Riga): studierte 1938 bis 1941 in Berlin; war von der
jüdischen Gemeinde Mainz zum Rabbiner gewählt, doch wurde ihm die
Zuzugsgenehmigung verweigert; deportiert nach Riga am 19. Januar 1942. |
Rabbiner der Israelitischen Religionsgesellschaft waren:
 | Rabbiner Samuel Bondi (geb. 1794 in Mainz als
Sohn von Rabbiner Moses-Jona Bondi, der an der Jeschiwa von Herz Scheuer in
Mainz unterrichtete; gest. 1877 in Mainz): war als Kaufmann tätig;
begründete die Israelitische Religionsgesellschaft als Prediger und
Talmudlehrer an der Jeschiwa von Rabbiner Markus Lehmann.
Auch sein Enkel Rabbiner Jonas Bondi (geb. 1862, gest. 1929) übte in
Mainz rabbinische Tätigkeiten aus. |
 | 1854 bis 1890: Rabbiner Dr. Markus Lehmann (geb.
1831 in Verden, gest. 1890 in Mainz): studierte in Prag, Berlin und Halle;
war seit 1854 Rabbiner der Israelitischen Religionsgesellschaft in Mainz,
heiratete eine Tochter des o.g. Rabbiners Samuel Bondi; gründete im Mai
1860 die Zeitschrift "Der Israelit". |
 | 1890 bis 1929: Rabbiner Dr. Jonas Marcus Bondi (geb.
1862 in Mainz als Sohn von Markus Bondi und Enkel von Samuel Bondi, gest.
1929 ebd.): studierte in Berlin und Halle; war seit 1890 Rabbiner der
Israelitischen Religionsgesellschaft. |
 | 1929 bis 1938: Rabbiner Dr. Moses Löb Bamberger
(geb. 1902 in Bad Kissingen, gest. 1960 in Gateshead GB), studierte in
Würzburg, Berlin und Gießen; war seit 1929 Rabbiner der Israelitischen
Religionsgesellschaft in Mainz; November 1938 in das KZ Dachau verschleppt;
1939 nach England emigriert: Rabbiner in Nottingham; 1944 Gründer und
Leiter der Jewish Boarding School (Jeschiwa) in Gateshead. |
Aus der Geschichte der Rabbiner in Mainz (später der
Israelitischen Religionsgemeinde)
Zum 100. Todestag von Rabbiner Noach Chaim Zwi Berlin
(1734-1802, Artikel von 1902)
Hinweis: Inschrift des Grabsteins für Noach Chajim Zwi ben Awraham Meir
Berlin mit Erläuterungen siehe http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=hha-1252
Foto des Grabsteines mit Inschrift:
https://www.wo-sie-ruhen.de/friedhoefe?stadt=5&friedhof=22
Weitere Informationen englisch:
https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/berlin-noah-hayyim-zevi-hirsch
Der Verfasser des Artikels ist Eduard Ezechiel Duckeß (Duckesz), geb. 1868 in
Szeleocsény, Ungarn, ermordet 6. März 1944 im Z Auschwitz.
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
10. März 1902: "Rabbi Noach Chaim Zwi Berlin, Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
10. März 1902: "Rabbi Noach Chaim Zwi Berlin,
Rabbiner in Mainz und zuletzt in den drei Gemeinden A.H.W. (Altona, Hamburg,
Wandsbeck) - Gedenkblatt zu seinem 100. Todestage 4. Adar Scheni 1802 (nach
jüdischer Zählung: 5562).
Wenn im Allgemeinen der Grundsatz lautet, ein Volk, dass seine Großen ehrt,
ehrt sich selbst, so ist dies im Judentum eine besondere Pflicht, der großen
Männer, die zum Wohle und zur geistigen Hebung unseres Volkes beigetragen
haben, an besonderen Gedenktagen pietätvoll zu erwähnen. - Ein solch Großer
in Israel war Noach Chaim Zwi, der Verfasser der Werke Ma'yan
ha-Chochmah [Lehrgedicht über die 613 Gebote], Aze Beschamim, Azei
Almuggim, Azei Arasim.
Er wurde im Jahr (5494) 1734 in
Fürth
geboren. Sein Vater Maier Berlin war Privatgelehrter, dessen Vater
Samuel Sanwil war Rabbinatsassessor in Berlin. Mütterlicherseits stammte
er von R. Jehoschua Heschel in Krakau, dessen Tochter der Ersteren
Mutter war. (Siehe Fürst, gemeint wohl ein Werk von Rabbiner Dr. Salomon
Fürst oder Rabbiner Dr. Julius Fürst). Er erhielt gemeinsam mit seinem
einzigen Bruder Löb Berlin, der Rabbiner in
Bamberg
und zuletzt in
Kassel
war, eine sorgfältige Erziehung. Sein Vater, der sehr reich war und keinem
Broterwerb nachzugehen brauchte, widmete sich ausschließlich der Erziehung
seiner beiden Söhne und war ihr Lehrer im Talmud. Chaim Zwi besaß eine
seltene Auffassungsgabe, die gepaart war mit immensem Fleiße, was ihm
frühzeitig großes Ansehen verschaffte. Er verheiratete sich nach damaliger
Sitte mit 18 Jahren mit Ela (Eli), der Tochter des Vorstehers
Elija Dow Schwabach, welcher ein Enkel des
Frankfurter Rabbiner Abraham Broda, wie auch ein Enkel der
ebenfalls berühmten Glückl Hammeln war. Nach seiner Hochzeit wurde er Dajan
in seiner Geburtsstadt Fürth, wo er die Fürther Ausgabe des Rambam Jad
hachasoko edierte. (Gedruckt 5525) 1765 Fürth). Später wurde er
Rabbiner in Breit (=
Bayreuth)
und Peiersdorf (= Baiersdorf). Dort
verfasste er sein erstes Werk Aze Almoigim (bzw. Azei Almuggim),
Erläuterungen zu oreach chajim auf Hilchaus ...
Im Jahre (5542) 1782 wurde er in Mainz als Oberrabbiner erwählt. Dort
gründete er eine Jeschiwo; wo sich alsbald eine zahlreiche Jüngerschar um
ihn sammelte. Er fand dort, wie er in der Vorrede zu Aze Arosim
berichtet. Den geeigneten Wirkungskreis, zu lernen und zu lehren, und eine
wahre Pflanzstätte des Thorastudiums blühte unter seiner kundigen Leitung
empor. Er verfasste in Mainz sein scharfsinniges und berühmtes Werk Azei
Arasim (1789, 5549), gedruckt in Fürth. Als im Jahr 1799 (5559)
der hochbetagte Rafael Kohn s(eligen) A(ngedenkens), Rabbiner der drei
Gemeinden Altona, Hamburg und Wandsbeck, aus verschiedenen triftigen Gründen
freiwillig sein Amt unwiderruflich niederlegte, richtete er zuletzt noch
eine Bitte an den Vorstand der Drei-Gemeinden, dass derselbe den
hervorragendsten Rabbiner, der für diesen verantwortungsvollen Posten zu
gewinnen sei, als seinen Nachfolger erwählen möge. Auf der engeren Wahl
standen nun: Noach Chaim Zwi – Mainz, Zwi Hirsch Samuscht – Glogau, Salomon
Cohn – Fürth, Löb Berlin -
Kassel,
R. Esriel aus Lublin, Meschulam Tusminiz - Preßburg und R. Löb – Rotterdam.
Fast einstimmig wurde nun Chaim Zwi im Jahre 1800 (oder 1799?)
gewählt. Am 22. Cheschwan (20. November 1799) trat er sein Amt an. Mit
großen Ehrenbezeugungen wurde er hier empfangen. Seine größte Ehre und
Freude war es aber, als vormittags |
 den
24. Cheschwan, der greise Rafael Cohn, der inzwischen nach Hamburg gezogen
war, zu ihm kam, um ihn zu begrüßen. Mit strahlendem Antlitz und inniger
Herzlichkeit begrüßte Rafael seinen Nachfolger, mit Tränen in den Augen
sprach er: 'Ich preise die gütige Vorsehung Gottes, die mich das Glück
schauen lässt, einen solch würdigen Vertreter und Lehrer der von mir so
geliebten Gemeinde als meinen Nachfolger sehen zu dürfen.' (S. sechor
lezadik = gedenke an den Gerechten). den
24. Cheschwan, der greise Rafael Cohn, der inzwischen nach Hamburg gezogen
war, zu ihm kam, um ihn zu begrüßen. Mit strahlendem Antlitz und inniger
Herzlichkeit begrüßte Rafael seinen Nachfolger, mit Tränen in den Augen
sprach er: 'Ich preise die gütige Vorsehung Gottes, die mich das Glück
schauen lässt, einen solch würdigen Vertreter und Lehrer der von mir so
geliebten Gemeinde als meinen Nachfolger sehen zu dürfen.' (S. sechor
lezadik = gedenke an den Gerechten).
Bald nach seinem Antritte bestätigte und hielt er aufrecht alle Tikunim
Anordnungen und Einrichtungen der Gemeinde, die er musterhaft vorfand. Mit
Eifer widmete er sich jetzt dem Studium der Choschen Hamischpot, da ja
damals das jüdische Bes din die Rechte und Autorität eines staatlichen
Gerichtshofes besaß, und von der ganzen Umgebung die Juden sich mit Vorliebe
an das jüdische Gericht zu Altona wandten, weil das Verfahren selbstredend
streng rechtlich, vereinfacht und rasch erledigt war. Durch seine
Gerechtigkeit, seine Gelehrsamkeit, zugleich aber seine Milde, war er bald
als Richter von Nah und Fern in Prozessen gesucht. In
Segeberg bei Lübeck war ein heftiger Streit wegen eines Lehrers Sußmann
ausgebrochen und der Zwiespalt teilte das Jischuw Segeberg (jüdische
Gemeinde Segeberg) in zwei feindliche Lager. Seiner Energie und Umsicht
gelang es bald, vollständigen Frieden und Ruhe dortselbst zu stiften. Er war
besonders dadurch beliebt, weil er es verstand, in den meisten Fällen die
streitenden Parteien auszugleichen. Oftmals ließ er den Verurteilten
Geldspenden zukommen, damit sie ihren Verpflichtungen nachkommen konnten, er
handelte, wie es beim König David heißt er sorgte für Frieden und
Gerechtigkeit erklärt in Sanhedrin 6. ... Er verschaffte Recht dem
Kläger, und wenn der Angeklagte nicht bezahlen konnte, dann ... bezahlte
für ihn.
Noach Chaim Zwi war auch als Grammatiker bekannt, wie dies sein
Lieblingsschüler Wolf Heidenheim mehrfach in seinem Werke erwähnt. Hier in
Altona verfasste er das herrliche Werk Ma'yan ha-Chochma auf ...,
worin wir sein umfassendes Wissen auf jedem Gebiete der Halacha bewundern
müssen. Er schrieb auch viele Erklärungen auf Piutim, siehe in den
Rödelheimer
Machsorim, wo bei dem zweiten Abend Pesuch auf den Pssut Or Jom
Honef in seinem Namen die Erklärung beigedruckt. Da ihm Kindersegen versagt
war, pflanzte er, wie er in seiner Vorrede zu Aze Arosim bemerkt, fünf
Zedern in Israel, nämlich seine fünf Werke. In welch hohem Ansehen er stand,
dürfte aus folgendem Brief hervorgehen. Rabbi Chajim Malasim, der
hervorragendste Schüler des Gaon R. Elija Wilna, wandte sich in einer
Anfrage Schaala an Noach Chaim Zwi am 5. Tamus 5561. Er spricht in
diesem Schreiben seine Freude darüber aus, dass Friede und gutes
Einvernehmen zwischen ihnen und Rafael Kohn herrsche. 'Früher', schreibt er
ferner, 'wenn ich Fragen hatte, die ich mir nicht selbst beantworten konnte,
schrieb ich meinem Lehrer R. Elija Wilna. Jetzt aber, wo ihn das Zeitliche
gesegnet hat, habe ich keinen Lehrer mehr und zu wem der Großen und Heiligen
in Israel soll ich mich wenden? Da bist Du ja, mein Freund und Lehrer, der
hellleuchtende Stern des Wissens am Firmamente des Judentums. Daher richte
ich an dich in der weiten Ferne meine Frage. (Siehe Alias Elija, Seite 36).
Interessant dürfte auch sein, dass der Chacham Isaak Bernays , später
Rabbiner in Hamburg mit Noach Chaim Zwi in Mainz in Berührung kam. Als Isaak
Bernays sieben Jahre alt war, so erzählt seine Ehrwürden Dr. S.P. Nathan, in
Hamburg - sein Licht leuchte - wurde er in ... von ihm verhört, das
er so vorzüglich für sein Alter kannte und verstand, dass er ihm den
Chower-Titel dafür verlieh. Doch nur kurze Zeit war es ihm vergönnt, hier zu
wirken. Am 17. Schwat 5562 (1802) schrieb er noch ein Gutachten für die
großen Altonaer Machsorim (siehe dort abgedruckt). Er erkrankte und am 4.
Adar Scheni 5562 (8. März 1802) schloss er sein ruhmvolles und
arbeitsreiches Leben. Sein Werk Ma'yan ha-Chochmah war zu seinen
Lebzeiten schon zur Hälfte gedruckt, und hatte Wolf Heidenheim seinem
verehrten Lehrer die Druckbogen zur Korrektur bereits eingesandt. Der zweite
Teil wurde von seinem Bruder Arje Löb Berlin in
Kassel
herausgegeben. Gedruckt in Rödelheim
1804, unter besonderer Aufsicht Wolf Heidenheimers. Ein gut erhaltener
Grabstein in der Königstraße in Altona ziert sein Grab.
Zadikim maaseihem hem toldotam usecharinam. E. Duckeß,
Klausrabbiner in Altona."
Anmerkungen: - Halachah:
https://de.wikipedia.org/wiki/Halacha
- Adar:
https://de.wikipedia.org/wiki/Adar_(Monat)
- Israel: (Hier) jüdische Gemeinschaft
- Dajan:
https://de.wikipedia.org/wiki/Dajan
- Glückl Hammeln:
https://www.dasjuedischehamburg.de/inhalt/glückel-von-hameln
- Rambam: Maimonides
https://de.wikipedia.org/wiki/Maimonides
- Jeschiwo:
https://de.wikipedia.org/wiki/Jeschiwa
- Cheschwan:
https://de.wikipedia.org/wiki/Cheschwan
- Choschen Hamischpot:
https://de.wikipedia.org/wiki/Choschen
- Bes din:
https://de.wikipedia.org/wiki/Beth-Din
- Gaon:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaon_von_Wilna
https://www.nzz.ch/feuilleton/eines-menschen-herrlichkeit-der-gaon-von-wilna
- Isaak Bernays:
https://de.wikipedia.org/wiki/Isaak_Bernays
- Jischuw:
https://de.wikipedia.org/wiki/Jischuv
- Machsorim, Plural von Machsor:https://de.wikipedia.org/wiki/Machsor
- Tamus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tammus
- Chacham Isaak Bernasis:
https://de.wikipedia.org./wiki/Isaak_Bernays. |
Aus
der Zeit von Rabbiner Leo Ellinger
- Siehe Bericht
über seine Predigt beim Geburtstagsfest für den Großherzog 1841 (interner
LInk)
Bewerbungen um das Rabbinat in Mainz - die neue Synagoge ist
alsbald fertig (1850)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 7. Oktober 1850: "Mainz, im September
(Privatmitteilung). Die Konkurrenz um das hiesige Rabbinat ist
eröffnet und sehr tüchtige Männer wie Dr. Aub zu
Bayreuth,
Dr. Adler zu
Alzey,
Dr. Adler zu
Kissingen,
Dr. Formstecher zu
Offenbach
und mehrere andere haben sich teils angemeldet, teils werden sie in der
Gemeinde gewünscht und die in baldiger Aussicht stehende Wahl beschäftigt
alle Gemüter. Es ist auch nicht zu leugnen, dass die Besetzung dieser Stelle
von großem Einflusse auf die Gestaltung der religiösen Verhältnisse hier und
in der Umgegend sein wird und ist von unserem Gemeindevorstande zu erwarten
, dass er umsichtig seine Wahl treffe, und im Interesse unserer Jugend, und
um der Zukunft des Judentums willen, einen Mann anstellen werde, welcher die
Anforderungen der Zeit begreift und den Mut hat, sie geltend zu machen. -
Auch unsere neue Synagoge schreitet rasch ihrer Vollendung entgegen
und wird in jeder Beziehung ein sehr herrliches Gotteshaus werden. Möchte
dieser würdige Tempel in die Hände eines recht würdigen Volkslehrers
kommen!" Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 7. Oktober 1850: "Mainz, im September
(Privatmitteilung). Die Konkurrenz um das hiesige Rabbinat ist
eröffnet und sehr tüchtige Männer wie Dr. Aub zu
Bayreuth,
Dr. Adler zu
Alzey,
Dr. Adler zu
Kissingen,
Dr. Formstecher zu
Offenbach
und mehrere andere haben sich teils angemeldet, teils werden sie in der
Gemeinde gewünscht und die in baldiger Aussicht stehende Wahl beschäftigt
alle Gemüter. Es ist auch nicht zu leugnen, dass die Besetzung dieser Stelle
von großem Einflusse auf die Gestaltung der religiösen Verhältnisse hier und
in der Umgegend sein wird und ist von unserem Gemeindevorstande zu erwarten
, dass er umsichtig seine Wahl treffe, und im Interesse unserer Jugend, und
um der Zukunft des Judentums willen, einen Mann anstellen werde, welcher die
Anforderungen der Zeit begreift und den Mut hat, sie geltend zu machen. -
Auch unsere neue Synagoge schreitet rasch ihrer Vollendung entgegen
und wird in jeder Beziehung ein sehr herrliches Gotteshaus werden. Möchte
dieser würdige Tempel in die Hände eines recht würdigen Volkslehrers
kommen!"
Anmerkungen: - Dr. Aub:
https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Aub
- Dr. Adler, Alzey:
https://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Adler_(Rabbiner)
- Dr. Adler, Kissingen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lazarus_Adler
- Dr. Formstecher:
https://de.wikipedia.org/wiki/Salomon_Formstecher und
http://steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/bhr?gnd=118988433 |
Dr. Adler soll erster Rabbiner in Mainz werden, der bisherige
Prediger und Religionslehrer Dr. Cohn zweiter Rabbiner ebd. (1852)
Anmerkung: es kam doch nicht so, wie hier gemeldet wurde, da Dr. Lazarus
Adler aus Bad Kissingen 1852 Rabbiner in Kassel geworden ist. Dafür kam Dr.
Joseph Aub nach Mainz. Über den genannten Dr. Cohn liegen dem Webmaster noch
keine weiteren Angaben vor.
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 2. Februar 1852: "Schließlich benachrichtige ich Sie, dass im
benachbarten Mainz vor kurzem Herr Dr. Adler, bisher Rabbiner zu
Kissingen,
zum ersten und der bisherige Prediger und Religionslehrer Dr. Cohn in Mainz
zum zweiten Rabbiner von Mainz von Seiner königlichen Hoheit dem Großherzog
ernannt worden sind." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 2. Februar 1852: "Schließlich benachrichtige ich Sie, dass im
benachbarten Mainz vor kurzem Herr Dr. Adler, bisher Rabbiner zu
Kissingen,
zum ersten und der bisherige Prediger und Religionslehrer Dr. Cohn in Mainz
zum zweiten Rabbiner von Mainz von Seiner königlichen Hoheit dem Großherzog
ernannt worden sind."
Anmerkung: - Dr. Adler:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lazarus_Adler |
Rabbiner Dr. Joseph Aub wechselt nach Berlin
(1866)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März
1866: "Mainz, den 25. März. Die israelitische Gemeinde zu
Berlin hat dem ersten Rabbiner der bisherigen (Reform-) Gemeinde, Herrn
Dr. Joseph Aub, die dort erledigte Predigerstelle übertragen. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März
1866: "Mainz, den 25. März. Die israelitische Gemeinde zu
Berlin hat dem ersten Rabbiner der bisherigen (Reform-) Gemeinde, Herrn
Dr. Joseph Aub, die dort erledigte Predigerstelle übertragen.
Herr Dr. Aub, der vor seinem Amtsantritte in Mainz bereits 23 Jahre in dem
bayerischen Städtchen
Bayreuth
fungiert hat, ist einer der ältesten Reformrabbinen. Schon im Jahre 1836
wollte er, wie ein in Altona herausgegebenes Blatt berichtete, bei
Gelegenheit einer Synode das Sabbatgesetz bedeutend modifiziert wissen, und
den Staatsangestellten erlauben, am Sabbat zu schreiben. In den wenigen von
ihm edierten Schriften und Aufsätzen, spielt die Verhöhnung und Verspottung
des Talmuds und der Talmudisten eine Hauptrolle." |
Zum Tod des früheren Mainzer Rabbiners Dr. Joseph Aub (1880 in Berlin)
Anmerkung: im Unterschied zu der oben aus dem konservativ-orthodoxen "Israelit"
zitierten Meldung mit einer grundsätzlichen Kritik an Rabbiner Dr. Aub, ist die
Mitteilung aus der liberal geprägten "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
freundlich gegenüber Rabbiner Dr. Aub geschrieben.
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. Juni 1880:
"Berlin, 25. Mai (1880). So ist abermals ein Veteran des
zeitgenössischen Rabbinismus heimgegangen! Am 22. verschied sanft
Rabbiner Dr. Joseph Aub im 76. Lebensjahre. Geboren 1805 in Baiersdorf
bei Erlangen, fungierte er zuerst als Rabbiner in Bayreuth
(1829-1852),
dann in Mainz und seit 1866 in Berlin, wo er vor einigen Jahren in den Ruhestand
trat. Seine literarischen Arbeiten sind nicht umfänglich, zeugen aber von
der Gesinnungstüchtigkeit und Sachkenntnis ihres Verfassers. Sie sind,
wie seine 'Betrachtungen und Widerlegungen', 2 Hefte (1839) und spätere
Broschüren polemischen Inhalts auf theologischem und staatsrechtlichem
Gebiete. Im Jahre 1846 gab er eine Wochenschrift 'Sinai' heraus, die er
jedoch bald wieder aufgab. Seine letzte Schrift, eine Religionslehre auf
wissenschaftlichem Grunde, hat Wert. Aub gehörte zu der Schule der
Reformer, welche bei aller Selbständigkeit doch die Reformen an das
Herkommen und an Aussprüche der Talmudisten anzuknüpfen suchen. Er nahm
an den Rabbinerversammelungen keinen Anteil, desto lebhafteren an den
beiden Synoden, wo er als Referent tätig war. Bei allem Ernst seines
Strebens hatte er einen humoristischen Zug, der ihm im geselligen Verkehre
sehr liebenswürdig machte. - Gestern Vormittag fand die Beerdigung statt.
In der großen Synagoge unter Teilnahme einer die weiten Räume dicht
füllenden Menge, des gesamten Gemeindevorstandes, Deputationen aus
Leipzig und Mainz sowie Mitglieder beider städtischen Behörden, hielt
Dr. Frankl die Leichenrede, während Dr. Ungerleider das Gebet auf dem
Friedhof vortrug." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. Juni 1880:
"Berlin, 25. Mai (1880). So ist abermals ein Veteran des
zeitgenössischen Rabbinismus heimgegangen! Am 22. verschied sanft
Rabbiner Dr. Joseph Aub im 76. Lebensjahre. Geboren 1805 in Baiersdorf
bei Erlangen, fungierte er zuerst als Rabbiner in Bayreuth
(1829-1852),
dann in Mainz und seit 1866 in Berlin, wo er vor einigen Jahren in den Ruhestand
trat. Seine literarischen Arbeiten sind nicht umfänglich, zeugen aber von
der Gesinnungstüchtigkeit und Sachkenntnis ihres Verfassers. Sie sind,
wie seine 'Betrachtungen und Widerlegungen', 2 Hefte (1839) und spätere
Broschüren polemischen Inhalts auf theologischem und staatsrechtlichem
Gebiete. Im Jahre 1846 gab er eine Wochenschrift 'Sinai' heraus, die er
jedoch bald wieder aufgab. Seine letzte Schrift, eine Religionslehre auf
wissenschaftlichem Grunde, hat Wert. Aub gehörte zu der Schule der
Reformer, welche bei aller Selbständigkeit doch die Reformen an das
Herkommen und an Aussprüche der Talmudisten anzuknüpfen suchen. Er nahm
an den Rabbinerversammelungen keinen Anteil, desto lebhafteren an den
beiden Synoden, wo er als Referent tätig war. Bei allem Ernst seines
Strebens hatte er einen humoristischen Zug, der ihm im geselligen Verkehre
sehr liebenswürdig machte. - Gestern Vormittag fand die Beerdigung statt.
In der großen Synagoge unter Teilnahme einer die weiten Räume dicht
füllenden Menge, des gesamten Gemeindevorstandes, Deputationen aus
Leipzig und Mainz sowie Mitglieder beider städtischen Behörden, hielt
Dr. Frankl die Leichenrede, während Dr. Ungerleider das Gebet auf dem
Friedhof vortrug." |
25-jähriges
Jubiläum von Rabbiner Dr. Sigmund Salfeld als Rabbiner der Mainzer
Religionsgemeinde (1905)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 5. Mai 1905: "In Mainz feierte am 2. d. M. Herr
Rabbiner Dr. Salfeld unter allgemeiner Teilnahme weiter Kreise das
25jährige Jubiläum seiner Wirksamkeit als Rabbiner in Mainz und des Mainzer
Bezirks. Für den 5. d. J. ist ein Festgottesdienst und für den 6. ein
Bankett geplant. Bericht folgt." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 5. Mai 1905: "In Mainz feierte am 2. d. M. Herr
Rabbiner Dr. Salfeld unter allgemeiner Teilnahme weiter Kreise das
25jährige Jubiläum seiner Wirksamkeit als Rabbiner in Mainz und des Mainzer
Bezirks. Für den 5. d. J. ist ein Festgottesdienst und für den 6. ein
Bankett geplant. Bericht folgt." |
| |
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. Mai 1905: "Mainz, 11. Mai. Wie wir bereits
berichteten, feierte am 2. d. M. Herr Rabbiner Dr. Salfeld das
Jubiläum seiner 25jährigen Tätigkeit als Rabbiner der Mainzer
Religionsgemeinde. Die Beteiligung an der Feier war eine allgemeine. Dem
Jubilar wurden von allen Seiten, von Privaten, Behörden und Vereinen teils
mündliche, teils schriftlich zahlreiche Glückwünsche dargebracht. Den Reigen
der Gratulationen eröffnete der in corpore erschienene Vorstand der
israelitischen Religionsgemeinde. Ihr Präzes, Justizrat Dr. F. Ph. Mayer,
gab einen Rückblick auf das segensreiche Wirken des Jubilars und überreichte
ein Ehrengeschenk der Gemeinde. Es folgten dann die Ansprachen der
Deputationen von Vereinen. Für den großen Krankenpflegeverein d. ä. sprach
Herr Karl Heidenheimer, für die Rhenus-Loge Herr Martin Mayer-Ganz, für den
Verein zur Beschränkung des Wanderbettels und den Hospitalverein Herr Eduard
Simon. Herr Karl Marx aus
Alsheim,
der Rektor der hessischen Lehrerschaft, schilderte die Verdienste des
Jubilars um die Verbesserung der Lage der israelitischen Lehrer des Landes
und sein erfolgreiches Wirken als Vorstandsmitglied des Vereins zur
Heranbildung und Unterstützung jüdischer Seminaristen im Großherzogtum. Für
das Lehrerkollegium der Religionsschule gab Kantor Nußbaum der Verehrung und
Anhänglichkeit beredten Ausdruck. Nachdem noch mündlich und schriftlich von
den Behörden, den Direktoren der höheren Lehranstalten, der christlichen
Geistlichkeit, dem Kaufmännischen Verein, der Großloge für Deutschland, der
Nassauloge in
Wiesbaden
und andere, dem Journalisten- und Schriftstellerverein, dem Mainzer
Männergesangsverein, dem deutsch-israelitischen Gemeindebund, von
wissenschaftlichen Vereinigungen, dem Verband der Literaturverein und von
anderen Wünsche dargebracht und die Wohnung des Jubilars durch Geschenk und
Blumenspenden überreich geschmückt war, erschienen am Nachmittag die
Amtsbrüder Dr. Salfelds, in deren Namen Dr. Stein -
Worms eine
meisterhafte Ansprache hielt und ein kostbares Kunstwerk, eine silberne
Hawdalabüchse, deren Zweck er geistreich gedeutet hatte, dem Gefeierten
überreichte. Nach ihm sprach Dr. Lewit –
Alzey im
Namen des heutigen Rabbinerverbands. Auch die auswärtigen Religionsgemeinden
fehlten nicht unter den Gratulanten. Dass die Ehrungen wohlverdiente sind,
bezeugt folgendes Schreiben, aus dem wir einen Auszug mitteilen: 'Herr
Oberbürgermeister Dr. Gaßner schreibt:‘Am heutigen Tage sind es 25 Jahre,
daß Sie das Rabbinat der Mainzer israelitischen Religionsgemeinde inne
haben. Mit Stolz und Genugtuung dürfen Sie auf diese lange, stets der
ernsten Arbeit und treuesten Pflichterfüllung gewidmete Dienstzeit
zurückblicken, die zwar reich an Mühen und Sorgen gewesen, der aber auch der
Erfolg und die Anerkennung nicht gefehlt haben. Nicht allein haben Sie in
der Ausübung Ihres geistlichen Amtes die segensreiche Wirksamkeit entfaltet,
Ihr milder und versöhnlicher Sinn hat auch wesentlich zur Erhaltung von
Frieden und Eintracht unter den Bekennern der verschiedenen Konfessionen
beigetragen. Dem Bedrängten und Notleidenden waren Sie jederzeit ein warmer
Freund und Berater. Eine Reihe von Vereinen schätzten in Ihnen ihren Gründer
und werktätigen Mitarbeiter. Der städtischen Verwaltung haben Sie als
Mitglied des Schulvorstandes und Erziehungsbeirates besonders nahegestanden,
beide Körperschaften haben auf Ihre Mitarbeit jederzeit den größten Wert
gelegt und wir geben uns gern der Hoffnung hin, daß Sie uns mit Ihren
reichen Erfahrungen auf dem schwierigen Gebiete der Jugenderziehung und
Jugendfürsorge auch fernerhin zur Seite stehen werden.' Am Abend des
Jubiläumstages fand eine würdige, schliche Feier in der Rhenus-Loge und am
5. d(es) M.(onats), ein Festgottesdienst in der Synagoge statt. Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. Mai 1905: "Mainz, 11. Mai. Wie wir bereits
berichteten, feierte am 2. d. M. Herr Rabbiner Dr. Salfeld das
Jubiläum seiner 25jährigen Tätigkeit als Rabbiner der Mainzer
Religionsgemeinde. Die Beteiligung an der Feier war eine allgemeine. Dem
Jubilar wurden von allen Seiten, von Privaten, Behörden und Vereinen teils
mündliche, teils schriftlich zahlreiche Glückwünsche dargebracht. Den Reigen
der Gratulationen eröffnete der in corpore erschienene Vorstand der
israelitischen Religionsgemeinde. Ihr Präzes, Justizrat Dr. F. Ph. Mayer,
gab einen Rückblick auf das segensreiche Wirken des Jubilars und überreichte
ein Ehrengeschenk der Gemeinde. Es folgten dann die Ansprachen der
Deputationen von Vereinen. Für den großen Krankenpflegeverein d. ä. sprach
Herr Karl Heidenheimer, für die Rhenus-Loge Herr Martin Mayer-Ganz, für den
Verein zur Beschränkung des Wanderbettels und den Hospitalverein Herr Eduard
Simon. Herr Karl Marx aus
Alsheim,
der Rektor der hessischen Lehrerschaft, schilderte die Verdienste des
Jubilars um die Verbesserung der Lage der israelitischen Lehrer des Landes
und sein erfolgreiches Wirken als Vorstandsmitglied des Vereins zur
Heranbildung und Unterstützung jüdischer Seminaristen im Großherzogtum. Für
das Lehrerkollegium der Religionsschule gab Kantor Nußbaum der Verehrung und
Anhänglichkeit beredten Ausdruck. Nachdem noch mündlich und schriftlich von
den Behörden, den Direktoren der höheren Lehranstalten, der christlichen
Geistlichkeit, dem Kaufmännischen Verein, der Großloge für Deutschland, der
Nassauloge in
Wiesbaden
und andere, dem Journalisten- und Schriftstellerverein, dem Mainzer
Männergesangsverein, dem deutsch-israelitischen Gemeindebund, von
wissenschaftlichen Vereinigungen, dem Verband der Literaturverein und von
anderen Wünsche dargebracht und die Wohnung des Jubilars durch Geschenk und
Blumenspenden überreich geschmückt war, erschienen am Nachmittag die
Amtsbrüder Dr. Salfelds, in deren Namen Dr. Stein -
Worms eine
meisterhafte Ansprache hielt und ein kostbares Kunstwerk, eine silberne
Hawdalabüchse, deren Zweck er geistreich gedeutet hatte, dem Gefeierten
überreichte. Nach ihm sprach Dr. Lewit –
Alzey im
Namen des heutigen Rabbinerverbands. Auch die auswärtigen Religionsgemeinden
fehlten nicht unter den Gratulanten. Dass die Ehrungen wohlverdiente sind,
bezeugt folgendes Schreiben, aus dem wir einen Auszug mitteilen: 'Herr
Oberbürgermeister Dr. Gaßner schreibt:‘Am heutigen Tage sind es 25 Jahre,
daß Sie das Rabbinat der Mainzer israelitischen Religionsgemeinde inne
haben. Mit Stolz und Genugtuung dürfen Sie auf diese lange, stets der
ernsten Arbeit und treuesten Pflichterfüllung gewidmete Dienstzeit
zurückblicken, die zwar reich an Mühen und Sorgen gewesen, der aber auch der
Erfolg und die Anerkennung nicht gefehlt haben. Nicht allein haben Sie in
der Ausübung Ihres geistlichen Amtes die segensreiche Wirksamkeit entfaltet,
Ihr milder und versöhnlicher Sinn hat auch wesentlich zur Erhaltung von
Frieden und Eintracht unter den Bekennern der verschiedenen Konfessionen
beigetragen. Dem Bedrängten und Notleidenden waren Sie jederzeit ein warmer
Freund und Berater. Eine Reihe von Vereinen schätzten in Ihnen ihren Gründer
und werktätigen Mitarbeiter. Der städtischen Verwaltung haben Sie als
Mitglied des Schulvorstandes und Erziehungsbeirates besonders nahegestanden,
beide Körperschaften haben auf Ihre Mitarbeit jederzeit den größten Wert
gelegt und wir geben uns gern der Hoffnung hin, daß Sie uns mit Ihren
reichen Erfahrungen auf dem schwierigen Gebiete der Jugenderziehung und
Jugendfürsorge auch fernerhin zur Seite stehen werden.' Am Abend des
Jubiläumstages fand eine würdige, schliche Feier in der Rhenus-Loge und am
5. d(es) M.(onats), ein Festgottesdienst in der Synagoge statt.
Anmerkungen: - Rabbiner Dr. Salfeld:
https://de.wikipedia.org/wiki/Siegmund_Salfeld
http://steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/bhr?id=1537
- Justizrat Dr. F.Ph. Mayer:
Link zu Artikel zur Wahl Mayers zum Beigeordneten in Mainz
- Karl Heidenheimer:
Link zu
einem Bericht zum Tod von Karl Heidenheimer
- Großloge für Deutschland:
https://archives.cjh.org/repositories/5/resources/16181
- Dr. Stein:
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Stein_(Rabbiner)
- Rabbiner Dr. Sali Levi:
https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/biographien/levi-sali.html |
70.
Geburtstag von Rabbiner Prof. Dr. Sigmund Salfeld (1913)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21.
März 1913: "Herr Rabbiner Professor Dr. Salfeld in Mainz
begeht am 24. dieses Monats seinen siebzigsten Geburtstag. Der Jubeltag
wird, wie uns mitgeteilt wird, von der dankbaren Gemeinde in feierlicher
Weise begangen werden."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21.
März 1913: "Herr Rabbiner Professor Dr. Salfeld in Mainz
begeht am 24. dieses Monats seinen siebzigsten Geburtstag. Der Jubeltag
wird, wie uns mitgeteilt wird, von der dankbaren Gemeinde in feierlicher
Weise begangen werden." |
Einführung von Rabbiner Dr.
Sali Levi als Nachfolger von Rabbiner
Prof. Dr. Salfeld (1918)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. August
1918: "Mainz, 26. Juli. Am vergangenen Freitagabend fand in
der Hauptsynagoge die feierliche Einführung des für den in Ruhe getretenen
Prof. Dr. Salfeld neugewählten Rabbiners Prof. Dr. Levy statt.
Nach dem feierlichen Einzug in das Gotteshaus gruppierte sich der
Gemeindevorstand und die Vorbeter um den Rabbiner. Der erste Vorsteher der
Gemeinde, Herr Kommerzienrat Bernh. Albert Mayer, begrüßte den neuen
Seelsorger im Namen des Vorstandes und der altehrwürdigen Gemeinde Mainz,
indem er auf ihre tausendjährige Geschichte und die berühmten Gelehrten
hinwies, die in der Gemeinde gewirkt haben. Er sprach die Hoffnung aus, dass
es dem neuen Rabbiner gelingen möge, sich die Liebe und Verehrung der
Gemeindemitglieder in demselben Maße zu erringen, wie dies bei seinem
Vorgänger, dem allgemein hochgeschätzten und verehrten Herrn Prof. Dr.
Salfeld in so überaus reichem Maße der Fall gewesen wäre. Möchten sich
alle Hoffnungen erfüllen, die die Gemeinde auf ihn setze! Herr Dr. Levy
antwortete, er sei sich bewusst, welch schweres Amt er in einer Gemeinde
übernehme, in der vor ihm Geistliche gewirkt, deren Ruhm und Ansehen in der
ganzen Welt leuchteten. Wenn Gott ihm die Kraft verleihe, wolle er sie
anwenden zum Wohle dieser Gemeinde und ihrer Mitglieder. Das gelobe er an
dieser Stelle und in dieser Stunde in die Hand der Vorstandsmitglieder vor
versammelter Gemeinde. Hierauf hielt der neue Rabbiner seine erste Predigt,
die nach Form und Inhalt, wie in rhetorischer Beziehung gleich vollendet war
und die Gemeindemitglieder überaus befriedigte. Der neue Seelsorger der
'israelitischen Gemeinde' besitzt ein sehr sympathisches, volltönendes
Organ, ist von großer repräsentabler Erscheinung und besitzt alle
Eigenschaften, die eine ideale Führung seines Amtes voraussetzt." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. August
1918: "Mainz, 26. Juli. Am vergangenen Freitagabend fand in
der Hauptsynagoge die feierliche Einführung des für den in Ruhe getretenen
Prof. Dr. Salfeld neugewählten Rabbiners Prof. Dr. Levy statt.
Nach dem feierlichen Einzug in das Gotteshaus gruppierte sich der
Gemeindevorstand und die Vorbeter um den Rabbiner. Der erste Vorsteher der
Gemeinde, Herr Kommerzienrat Bernh. Albert Mayer, begrüßte den neuen
Seelsorger im Namen des Vorstandes und der altehrwürdigen Gemeinde Mainz,
indem er auf ihre tausendjährige Geschichte und die berühmten Gelehrten
hinwies, die in der Gemeinde gewirkt haben. Er sprach die Hoffnung aus, dass
es dem neuen Rabbiner gelingen möge, sich die Liebe und Verehrung der
Gemeindemitglieder in demselben Maße zu erringen, wie dies bei seinem
Vorgänger, dem allgemein hochgeschätzten und verehrten Herrn Prof. Dr.
Salfeld in so überaus reichem Maße der Fall gewesen wäre. Möchten sich
alle Hoffnungen erfüllen, die die Gemeinde auf ihn setze! Herr Dr. Levy
antwortete, er sei sich bewusst, welch schweres Amt er in einer Gemeinde
übernehme, in der vor ihm Geistliche gewirkt, deren Ruhm und Ansehen in der
ganzen Welt leuchteten. Wenn Gott ihm die Kraft verleihe, wolle er sie
anwenden zum Wohle dieser Gemeinde und ihrer Mitglieder. Das gelobe er an
dieser Stelle und in dieser Stunde in die Hand der Vorstandsmitglieder vor
versammelter Gemeinde. Hierauf hielt der neue Rabbiner seine erste Predigt,
die nach Form und Inhalt, wie in rhetorischer Beziehung gleich vollendet war
und die Gemeindemitglieder überaus befriedigte. Der neue Seelsorger der
'israelitischen Gemeinde' besitzt ein sehr sympathisches, volltönendes
Organ, ist von großer repräsentabler Erscheinung und besitzt alle
Eigenschaften, die eine ideale Führung seines Amtes voraussetzt."
Anmerkungen: - Rabbiner Dr. Salfeld:
https://de.wikipedia.org/wiki/Siegmund_Salfeld
- Rabbiner Dr. Sali Levi:
https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/biographien/levi-sali.html
- Bernhard Albert Mayer:
https://www.geni.com/people/Bernhard-Mayer/6000000031492887587 |
Goldene Hochzeit von Prof. Dr. S. Salfeld und seiner Frau
(1920)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Januar
1920: "Mainz, 28. Januar. Wie bereits mitgeteilt, beginnen am
Sonntag, den 18. dieses Monats Herr und Frau Professor Dr. S. Salfeld das Fest der goldenen Hochzeit, nachdem am 4. bereits das goldene
Doktorjubiläum des Herrn Salfeld vorausgegangen war. Viele Ehrungen häuften
sich bei diesen Gelegenheiten auf das ehrwürdige Haupt des Jubilars sowie
der Jubilarin. Am Samstag, den 17. Januar, fand in der Synagoge eine
religiöse Feier statt. Unter dem Chorgesang 'Gesegnet sei, der da kommt'
wurde das Jubelpaar begrüßt und zu ihren mit Girlanden geschmückten Sitzen
geleitet. Nach dem Vortrag eines Psalms durch Herrn Kantor London,
sprach Herr Rabbiner Dr. Levi ein Gebet für das Paar und hielt darauf
eine Rede über den Namen Gottes. Anknüpfend an diese formvollendete und
tiefeindringliche Rede wandte er sich mit herzlichen Worten an das
Jubelpaar, das daraufhin näher trat und mit dem alten Priestersegen 'Der
Herr segne dich' eingesegnet wurde. Schon am Freitag und Samstag zeigte sich
die treue Anhänglichkeit der Gemeindemitglieder, die durch Besuche,
Blumenspenden und Geschenke aller Art ihrer unentwegten Treue Ausdruck
gaben. Ein ganz besonders feierlicher Akt stand am Sonntagnachmittag in der
Wohnung des Jubelpaares statt. Die Wohnung konnte die Gäste nicht fassen.
Seitens des Vorstandes der Israelitischen Religionsgemeinde begrüßte Herr
Kommerzienrat Bernhard Albert Mayer in herzlicher Weise die Jubilare,
worauf Herr Dr. Salfeld in längerer Rede erwiderte. Herr Rabbiner Dr. Levi,
begleitet von den Lehrern und Gemeindevorständen des Rabbinatsbezirkes Mainz
-
Oppenheim überreichte nach warmherziger Ansprache eine Urkunde über eine
reiche Siegmund-und-Zippora-Salfeld-Stiftung, die den Zweck hat, die Namen
des Jubelpaares dauernd ehrend zu erhalten. Die Zinsen dieser Stiftung,
welche den Betrag von 12.000 Mark bereits übersteigt, sollen alljährlich am
18. Januar zur Förderung des jüdischen Religionsunterrichts des
Lehrverstandes oder des geistigen Lebens im Rabbinatsbezirk Mainz-Oppenheim
Verwendung finden.Vertreter sämtlicher Vereine der Israelitischen
Religionsgemeinde gratulierten persönlich. Von auswärts kamen
Glückwunschschreiben von den großen Vereinen der deutschen Judenheit, des
Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, des Verbandes
Deutscher Juden, des Hilfsvereins, des Gemeindebundes, des
Rabbinerverbandes, des hessischen Lehrervereins, der
Wormser Gemeinde, der Großloge von
Deutschland, des Mainzer Journalisten- und Schriftstellervereins und vieler
anderer. Auch die Nachbargemeinden
Frankfurt und
Wiesbaden
u.a. sandten Glückwünsche. Die Zahl der Depeschen und brieflichen
Glückwünsche hat bereits die Zahl Tausend überschritten. Die überaus
reichlichen Ehrungen legen beredtes Zeugnis ab von der Verehrung, welche
sich das Jubelpaar im Verlaufe von nahezu 40 Jahren allerseits hier erworben
hat. Die Universität Tübingen bestätigte in einem überaus herzlichen
Schreiben die Doktorwürde des Jubilars. Herr Staatsrat Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Januar
1920: "Mainz, 28. Januar. Wie bereits mitgeteilt, beginnen am
Sonntag, den 18. dieses Monats Herr und Frau Professor Dr. S. Salfeld das Fest der goldenen Hochzeit, nachdem am 4. bereits das goldene
Doktorjubiläum des Herrn Salfeld vorausgegangen war. Viele Ehrungen häuften
sich bei diesen Gelegenheiten auf das ehrwürdige Haupt des Jubilars sowie
der Jubilarin. Am Samstag, den 17. Januar, fand in der Synagoge eine
religiöse Feier statt. Unter dem Chorgesang 'Gesegnet sei, der da kommt'
wurde das Jubelpaar begrüßt und zu ihren mit Girlanden geschmückten Sitzen
geleitet. Nach dem Vortrag eines Psalms durch Herrn Kantor London,
sprach Herr Rabbiner Dr. Levi ein Gebet für das Paar und hielt darauf
eine Rede über den Namen Gottes. Anknüpfend an diese formvollendete und
tiefeindringliche Rede wandte er sich mit herzlichen Worten an das
Jubelpaar, das daraufhin näher trat und mit dem alten Priestersegen 'Der
Herr segne dich' eingesegnet wurde. Schon am Freitag und Samstag zeigte sich
die treue Anhänglichkeit der Gemeindemitglieder, die durch Besuche,
Blumenspenden und Geschenke aller Art ihrer unentwegten Treue Ausdruck
gaben. Ein ganz besonders feierlicher Akt stand am Sonntagnachmittag in der
Wohnung des Jubelpaares statt. Die Wohnung konnte die Gäste nicht fassen.
Seitens des Vorstandes der Israelitischen Religionsgemeinde begrüßte Herr
Kommerzienrat Bernhard Albert Mayer in herzlicher Weise die Jubilare,
worauf Herr Dr. Salfeld in längerer Rede erwiderte. Herr Rabbiner Dr. Levi,
begleitet von den Lehrern und Gemeindevorständen des Rabbinatsbezirkes Mainz
-
Oppenheim überreichte nach warmherziger Ansprache eine Urkunde über eine
reiche Siegmund-und-Zippora-Salfeld-Stiftung, die den Zweck hat, die Namen
des Jubelpaares dauernd ehrend zu erhalten. Die Zinsen dieser Stiftung,
welche den Betrag von 12.000 Mark bereits übersteigt, sollen alljährlich am
18. Januar zur Förderung des jüdischen Religionsunterrichts des
Lehrverstandes oder des geistigen Lebens im Rabbinatsbezirk Mainz-Oppenheim
Verwendung finden.Vertreter sämtlicher Vereine der Israelitischen
Religionsgemeinde gratulierten persönlich. Von auswärts kamen
Glückwunschschreiben von den großen Vereinen der deutschen Judenheit, des
Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, des Verbandes
Deutscher Juden, des Hilfsvereins, des Gemeindebundes, des
Rabbinerverbandes, des hessischen Lehrervereins, der
Wormser Gemeinde, der Großloge von
Deutschland, des Mainzer Journalisten- und Schriftstellervereins und vieler
anderer. Auch die Nachbargemeinden
Frankfurt und
Wiesbaden
u.a. sandten Glückwünsche. Die Zahl der Depeschen und brieflichen
Glückwünsche hat bereits die Zahl Tausend überschritten. Die überaus
reichlichen Ehrungen legen beredtes Zeugnis ab von der Verehrung, welche
sich das Jubelpaar im Verlaufe von nahezu 40 Jahren allerseits hier erworben
hat. Die Universität Tübingen bestätigte in einem überaus herzlichen
Schreiben die Doktorwürde des Jubilars. Herr Staatsrat |
 Dr.
Hermann Cohn aus Dessau sandte ein Glückwunschschreiben, dem wir,
nach einer Einleitung über das Leben des jungen Ehepaares Salfeld, Folgendes
entnehmen: 'Keiner Ihrer Amtsnachfolger wurde wie Sie Stadtverordneter; die
Gemeinde verlor mit Ihnen die Verbindung mit dem öffentlichen, dem geistigen
Leben der Stadt, eine Lücke, die sich lange nicht schließen sollte. Denn
leider für uns, zum Glücke für Sie, bald nahm die altberühmte Mainzer
Gemeinde Sie aus unserem Kreise, und in Mainz nahm Ihre Tätigkeit in Praxis
und Wissenschaft, als Redner, Seelsorger, Religionslehrer, Historiker, den
Aufstieg, der Sie zu einer der bewundertsten und populärsten Kanzelgrößen
des deutschen Judentums gemacht hat. Unter den Geistesgrößen der alten
Dessauer 'Kehillah' steht Ihr Name auf eherner Tafel eingegraben, als Ihr
Vorsteher danke ich Ihnen für die Treue, die Sie uns jederzeit bewahrt
haben. Als Mensch und Freund danke ich Ihnen für all die Anregungen, die ich
in Ihrem Hause und bei Ihren Kindern finden durfte, für alle Beweise von
Anhänglichkeit und Freundschaft, die Sie und die Ihren mir stets
entgegengebracht haben. Gott verleihe Ihnen und Ihrer Gattin noch lange
Jahre der Gesundheit, des Glückes und der Ehre im Kreise der lieben Ihren,
das ist der meinen und mein innigster Wunsch!' Nicht minder herzlich und
ehrenvoll lautet das Schreiben, welches der Vorstand der Israelitischen
Religionsgemeinde zugehen ließ, und in welchem der großen Verdienste
aufgezählt werden, welche sich der Herr Dr. Salfeld um die Gemeinde erworben
hat. Wir schließen uns mit vollem Herzen dem Glückwunsch an den Hofrat
Professor A. Börckel zugleich im Namen seiner Gattin dem Jubelpaare
gewidmet hat: Dr.
Hermann Cohn aus Dessau sandte ein Glückwunschschreiben, dem wir,
nach einer Einleitung über das Leben des jungen Ehepaares Salfeld, Folgendes
entnehmen: 'Keiner Ihrer Amtsnachfolger wurde wie Sie Stadtverordneter; die
Gemeinde verlor mit Ihnen die Verbindung mit dem öffentlichen, dem geistigen
Leben der Stadt, eine Lücke, die sich lange nicht schließen sollte. Denn
leider für uns, zum Glücke für Sie, bald nahm die altberühmte Mainzer
Gemeinde Sie aus unserem Kreise, und in Mainz nahm Ihre Tätigkeit in Praxis
und Wissenschaft, als Redner, Seelsorger, Religionslehrer, Historiker, den
Aufstieg, der Sie zu einer der bewundertsten und populärsten Kanzelgrößen
des deutschen Judentums gemacht hat. Unter den Geistesgrößen der alten
Dessauer 'Kehillah' steht Ihr Name auf eherner Tafel eingegraben, als Ihr
Vorsteher danke ich Ihnen für die Treue, die Sie uns jederzeit bewahrt
haben. Als Mensch und Freund danke ich Ihnen für all die Anregungen, die ich
in Ihrem Hause und bei Ihren Kindern finden durfte, für alle Beweise von
Anhänglichkeit und Freundschaft, die Sie und die Ihren mir stets
entgegengebracht haben. Gott verleihe Ihnen und Ihrer Gattin noch lange
Jahre der Gesundheit, des Glückes und der Ehre im Kreise der lieben Ihren,
das ist der meinen und mein innigster Wunsch!' Nicht minder herzlich und
ehrenvoll lautet das Schreiben, welches der Vorstand der Israelitischen
Religionsgemeinde zugehen ließ, und in welchem der großen Verdienste
aufgezählt werden, welche sich der Herr Dr. Salfeld um die Gemeinde erworben
hat. Wir schließen uns mit vollem Herzen dem Glückwunsch an den Hofrat
Professor A. Börckel zugleich im Namen seiner Gattin dem Jubelpaare
gewidmet hat:
'Wohl jeder, der wie wir Euch kennt,
Denn immer fiel in sie hinein,
Der Nächstenliebe goldner Schein,
Und stiegen manchmal Wolken auf,
Gleich schien die goldene Sonne drauf.
Und golden war, was Ihr erdacht
An edlen Werken und vollbracht.
Drum blieb Euch auch der Himmel hold.
Und wird Euch Lob und Dank gezollt,
An Eurem goldnen Jubeltage,
Denn 'golden' seid Ihr ohne Frage.'"
Anmerkung: - Prof. Dr. Salfeld:
https://de.wikipedia.org/wiki/Siegmund_Salfeld
- Kantor London: Max London
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de918271
- Rabbiner Dr. Sali Levi:
https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/biographien/levi-sali.html
- Priestersegen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Aaronitischer_Segen
- Bernhard Albert Mayer:
https://www.geni.com/people/Bernhard-Mayer/6000000031492887587
- Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens:
https://de.wikipedia.org/wiki/Verband_nationaldeutscher_Juden
- Verband Deutscher Juden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Verband_nationaldeutscher_Juden
- Professor A. Börckel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Börckel |
| |
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 6. Februar
1920: "Mainz. Rabbiner a. D. Prof. Dr. Siegmund
Salfeld und Frau waren anlässlich ihrer goldenen Hochzeit der Gegenstand
überaus großer Ehrungen." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 6. Februar
1920: "Mainz. Rabbiner a. D. Prof. Dr. Siegmund
Salfeld und Frau waren anlässlich ihrer goldenen Hochzeit der Gegenstand
überaus großer Ehrungen." |
Beitrag von Rabbiner Dr.
Sali Levi zum Heimatrecht der
deutschen Juden auf Grund zahlreicher Belege (1926)
 Artikel in der "CV-Zeitung" (Monatsschrift) vom Oktober
1926: "Die Steine reden. Artikel in der "CV-Zeitung" (Monatsschrift) vom Oktober
1926: "Die Steine reden.
Tausendjährige Belege für das Heimatrecht der deutschen Juden – Die
Grabinschriften der ituräischen Kohorten – Um 1000 schon jüdische Gelehrte
auf deutscher Erde – In Mainz die durch Unruhen in früheren Jahrhunderten
verlorenen Grabsteine aufgefunden – Am 3. Oktober auf dem 'Judensand' neu
aufgestellt – Zahlreiche Denkmäler von 1000 bis 1420 – Sarlin und Merlin –
Neue Zeugen für unser Recht
Urkunden sind die wichtigsten Quellen für geschichtliche Forschungen. Über
die Frühzeit jüdischer Siedlung auf deutschem Boden sind uns aber
urkundliche Belege kaum erhalten geblieben. Zwar verdienen die zahlreichen
Grabinschriften römischer Soldaten und Veteranen, welche in den ersten
nachchristlichen Jahrhunderten im römischen Kolonialgebiet Galliens und
Germaniens beigesetzt wurden, noch die Durchprüfung unter diesem
Gesichtspunkt und man fände hierbei vielleicht – besonders bei den
ituräischen Kohorten – manchen Träger eines jüdischen Namens.
Immerhin bleibt weit über ein halbes Jahrtausend nach dem Ende der
Römerherrschaft für die Geschichte der Juden in Deutschland vollkommen
dunkel und was wir über die Zeit des neunten und zehnten Jahrhunderts
erfahren, ist zum Teil als unhaltbar erwiesen oder doch zweifelhaft.
Um die Mitte des zehnten Jahrhunderts beginnt das Dunkel sich zu
lichten; in den Rheingegenden, wo das Deutschtum sich zuerst
herausgebildet hat, treten jüdische Gelehrte und Führer hervor, von deren
umfassendem Wissen und überragender Bedeutung die Tatsache Zeugnis ablegt,
dass man ihre Arbeiten und Entscheidungen in den folgenden Jahrhunderten
immer wieder zitiert und bis auf den heutigen Tag als maßgeblich betrachtet.
Namen, wie die der Kalonymiden, eines Rabbenu Gerschom, eines Simon ben
Isaak, eines Jacob bar Jakar, dieses Raschilehrers, um nur einige wenige zu
nennen braucht der Kenner nur zu hören, um sofort die ganze fruchtbare und
unabsehbar einflussreiche Zeit jüdischer Hochschulen auf deutschem Boden und
das Jahr 1000 vor Augen zu sehen. Diese Männer und ihre großen Zeitgenossen,
die wir hier nicht alle aufzählen können, strömten die Tiefe des Wissens und
die Kraft des Glaubens in die nahe und ferne Umgebung aus, sodass die
Heimsuchung der Kreuzzugszeit bei aller Vernichtung der Gemeinden am Rhein
die jüdische Gemeinschaft nicht wankend fand.
Die Schriften dieser ältesten, geschichtlichen jüdischen Persönlichkeiten
auf deutschem Boden kennen wir nur aus zitierten Bruchstücken, wie Häuser,
in welchen sie lehrten, die Synagogen, in welchen sie beteten, sind
verschwunden, aber die Grabsteine einer Anzahl dieser Größen sind uns
erhalten. Die Schwestergemeinde
Worms
zeigte schon immer den alten Friedhof, in dessen Erde große Führer Israels
schlummern; aber in unserer Gemeinde Mainz waren um die Mitte des 15.
Jahrhunderts bei einem Kampf um die Kurfürstenwürde zwischen Diether von
Isenburg und Adolf von Nassau nach der Ausweisung der Juden aus der Stadt
die uralten Grabsteine verschleppt und beim Bau von Festungswerken verwendet
wurden. In den letzten Jahrzehnten kamen sie bei der Niederlegung
verschiedener Bauten und bei Ausschachtungen wieder zum Vorschein und seit
dem denkwürdigen 3. Oktober dieses Jahres künden diese alten Steine, nachdem
wir sie von der Stadtverwaltung zurückerhalten und auf dem alten 'Judensand'
wieder aufgestellt hatten, in aller Öffentlichkeit von unseren alten Vätern
auf deutscher Erde.
Die ältesten Steindokumente über deutsche Juden befinden sich
darunter, Dokumente, die bis in die Zeit vor dem ersten Kreuzzug
zurückreichen. Stark in ihrer Schlichtheit sprechen diese Felsstücke mit
kurzen Worten zu uns; so heißt es auf dem Stein jenes Enkels des Mose
Hasaken: 'Hier ward begraben unser Meister, der Lehrer Meschullam, der Sohn
unseres Meisters, der Lehrer Kalonymos, seine Seele sei eingeflochten in den
Bund des Lebens.' Und auf dem gedrungenen Steine, den ich als Denkstein für
Rabbenu Gerschom bar Jehudah ansehen möchte, finden sich die Worte. 'Ein
Fels wurde gebrochen zum Gedenken an Rabbi Gerschom, Sohn des … (die Leuchte
des Exils?)'. 'Dies ist das Grab unseres Meisters, des Lehrers Simon bar
Isak, seine Seele gehört dem ewigen Leben', so lesen wir auf dem dritten
Steine. Meschullam lebte wohl vor dem Jahre 1000. Die erste
Judenverfolgung in Deutschland im Jahr 1012. Rabbi Simon beschwichtigte
durch seinen Einfluss die furchtbare seelische und körperliche Not seiner
Leidensgenossen, Rabbenu Gerschoms Sohn ward geraubt und zwangsweise
getauft. Erschütternde Klagelieder dieser beiden Männer über diese Zeit sind
uns erhalten.
So reiht sich Stein an Stein aus der Zeit von etwa 1000 bis 1420.
Durch ihre kurzen hebräischen Inschriften sind sie wuchtige, zu jedem Herzen
sprechende Zeugen alter Zeit. Die ältesten Steine stammen aus der Zeit, wo
man begann, den alten Mainzer Dom zu bauen und sind so auch Denkmäler
allgemein deutschen Kulturlebens für eine Zeit, aus der uns nicht viele
Originale erhalten geblieben sind. In diesen hebräischen Inschriften steckt
tiefes jüdisches Empfinden, das in deutschen Formen Ausdruck
sucht. Wenn wir da, besonders im dreizehnten Jahrhundert, Frauennamen wie
Sarlin und Merlin, das ist Saralein und Mirjamlein, das
letztere vielleicht auch vom mittelhochdeutschen 'Merl '= Amsel oder
Amselein) finden, so sehen wir, jedenfalls aus den Koseendungen, wie die
deutsche Sprache in den jüdischen Häusern lebte und die innige Verbundenheit
zwischen Mann und Weib und zwischen Eltern und Kindern zum Ausdruck brachte.
Namen wie Bruna (die Braune) oder Schona (die Schöne), wie
Meitin (die Maid, Jungfrau) und Edlin (die Edle) sind
mittelhochdeutsche Frauennamen, die – obwohl noch das Judentum seinen Mangel
an schönen biblischen und nachbiblischen Eigennamen hatte- aus eigenem
Entschluss, von jüdischen Eltern für ihre Kinder gewählt waren und so die
Verbundenheit des deutschen Juden im frühen Mittelalter mit dem Deutschtum
dokumentieren. Denn Juden war das Namengeben nie eine leere Formsache, in
dne Namen, welche jüdische Eltern ihren Kindern gaben, legten sie von den
ältesten Zeiten an ihr ganzes Empfinden, Glauben, Hoffen und Sehnen.
Wenn sich während des Krieges tief in Litauen drin noch Familien
fanden, welche Namen wie 'Magenza' (alte Form von Moguntia = Mainz)
und 'Bacharach' trugen, so war dies nicht etwa eine willkürliche
Namensgebung oder eine Namenserhaltung aus stumpfer Trägheit, sondern diese
Familien wussten und bekannten, dass ihre Vorfahren in schwerer
Verfolgungszeit aus den rheinischen Gegenden hatten flüchten müssen und
erhielten in ihren Namen das treue Gedenken an die alte Heimat.
'Saxa loquuntur', 'diese Steine reden' können wir darum von den in
der Öffentlichkeit wieder aufgestellten Grabsteinen sagen. Sie redeten nicht
nur vom Tode der Männer und Frauen, deren Namen sie enthalten, sie reden
auch von ihrem Leben. Neue Zeugen sind uns erstanden für unser Recht in
unserem beklagenswerten Kampf, in unserem Kampf um unser Recht auf unsere
deutsche Heimat. Rabbiner Dr. S. Levi (Mainz).
Anmerkungen: - Ituräische Kohorten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ituräa
- Arabische Auxiliareinheiten
https://de.wikipedia.org/wiki/Itura
- Kalonymiden:https://de.wikipedia.org/wiki/Kalonymiden
- Rabbenu Gerschom:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerschom_ben_Jehuda
https://schumstaedte.de/entdecken/memorstein-fuer-gerschom-ben-jehuda/
- Jacob bar Jakar:
https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_ben_Jakar
- Raschi:
https://de.wikipedia.org/wiki/Raschi
- Diether von Isenburg:
https://de.wikipedia.org/wiki/Diether_von_Isenburg
- Adolf von Nassau:
https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_II._von_Nassau
- Meschullam:https://de.wikipedia.org/wiki/Meschullam_ben_Kalonymos
- Kalonymos:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalonymos_ben_Meschullam
- über den Verfasser des Artikels: Sali Levi:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sali_Levi
https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/biographien/levi-sali.html
http://steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/bhr?id=2350
https://www.lbi.org/griffinger/record/242021 |
Aus der Geschichte der Rabbiner der Israelitischen
Religionsgesellschaft
Zum Tod von Sophie Bondi geb. Epstein, Gattin von Rabbiner
Samuel Bondi (1871)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Mai
1871: "Nekrolog Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Mai
1871: "Nekrolog
Mainz, 21. April. Mit tiefbewegtem Herzen sind wir heute in die
traurige Lage versetzt, den geehrten Lesern eine höchst schmerzliche
Nachricht mitzuteilen. Frau Sophie Bondi, die Gattin des weitberühmten Rabbi
Samuel Bondi sein Licht leuchte, die Schwiegermutter des Herausgebers
dieser Blätter ist nicht mehr; wir haben sie gestern zur letzten Ruhestätte
geleitet. Was namentlich unsere Familie in dieser edlen, frommen Frau, einer
wahrhaften Eschet Chajil (sc. 'wackere Frau' nach Sprüche 31)
verloren, weiß ein Jeder zu beurteilen, der die Dahingeschieden kannte.
Frau Sophie Bondi sie ruhe in Frieden, die Tochter des in seiner Zeit
rühmlichst bekannten Rabbi Meyer Epstein das Gedenken an den Gerechten
sei zum Segen von
Fulda
wurde schon als achtzehnjähriges Mädchen mit ihrem um wenige Jahre älteren,
edlen Gatten vermählt, mit dem sie fünfundfünfzig Jahre in ungetrübtem
ehelichen Glücke, in aufopferungsvoller, hingebender Liebe gelebt hat. Wie
sie im Vereine mit ihrem unvergleichlichen Gatten G'tt vermehre seine
Tage und seine Jahre ihre Söhne und Töchter erzogen, wie sie mit der
größten Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt, den Pflichten unserer heiligen
Religion nachgekommen, in wie hohem Maße sie die großen Tugenden von
Wohltätigkeit, Gastfreundschaft usw. übte, das entzieht sich jeder
Schilderung, jeder Beschreibung.
Auf die Trauerstunde hin waren Söhne, Töchter, Schwiegersöhne, Enkel und
Enkelinnen, sowie zahlreiche andere Verwandte aus der Nähe und Ferne
herbeigeeilt, um der so Tiefbetrauerten das Geleit zum letzten Gange zu
geben und so wurde sie denn, selbstverständlich auch unter Beteiligung fast
der ganzen hiesigen Gemeinde, unter heißen Tränen zur Ruhe bestattet.
Der Schmerz der Hinterbliebenen ist um so größer, da eine vor wenige Wochen
von der Hand des Allgütigen geschlagene Wunde noch nicht vernarbt ist;
Sonntag, den 26. März, verschied nämlich die Gattin unseres Schwagers
Bertram Bondi, Frau Rosalie Bondi seligen Andenkens geborene
Hechinger, aus Harburg in Bayern nach nur
kurzem Krankenlager an einem typhösen Fieber. Die Tiefbetrauerte wurde nach
nur sechsjähriger, überaus glücklicher Ehe in noch jugendlichem Alter, man
kann sagen, in der Fülle der Gesundheit und Kraft, dahingerafft. Drei kleine
Kinder, von denen das jüngste erst wenige Monate zählt, haben in ihr die
zärtliche Mutter verloren, auch sie war eine Eschet Chajil, die
Freude und das Glück ihrer erst vor Jahresfrist verwitweten Mutter.
Möge der allgütige Gott - gepriesen sei er - alle Betrübten trösten
und die Tränen trocknen von jeglicher Wange. Ihre Seele sei eingebunden
in den Bund des Lebens." |
Zum Tod von Rabbi Samuel Bondi
(1877)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. November
1877: "Mainz, 25. Nov. Wir haben heute eine höchst betrübende
Mitteilung zu machen. Rabbi Samuel Bondi sein Licht leuchte, durch
seine tiefe und ausgebreitete talmudische Gelehrsamkeit wie durch seine
innige Frömmigkeit in den weitesten Kreisen rühmlichst bekannt, ist nicht
mehr. Gestern Abend 9 Uhr, am Ausgang des Schabbat mit der Paraschah
wajischlach, hauchte er seine reine Seele aus, in einem Alter von 83
Jahren und 8 Monate. Seine Kinder, Enkel und Urenkel beweinen den Verlust
ihres unvergesslichen geliebten Vaters, der Herausgeber dieser Blätter, den
Heimgang ihres teuren Schwiegervaters und verehrten Lehrers, die
israelitische Religionsgesellschaft zu Mainz den Tod ihres Begründers und
ersten Vorstehers, der mit wahrhafter Aufopferung und unermüdlicher
Hingebung seit einem Vierteljahrhundert ihre Interessen vertreten, die Stadt
Mainz den Heimgang eines ihres geachteten Bürger, und ganz Israel den
Verlust eines Mannes, welcher der Gesamtheit zur Zierde gereichte.
(hebräisch und deutsch:) wehe, es ist gefallen, die Krone unseres Hauptes!
Es ist uns nicht möglich, heute mehr zu schreiben. Wir werden in den
nächsten Nummern ausführlich von dem reichen Leben des teuren Verblichenen
erzählen. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. November
1877: "Mainz, 25. Nov. Wir haben heute eine höchst betrübende
Mitteilung zu machen. Rabbi Samuel Bondi sein Licht leuchte, durch
seine tiefe und ausgebreitete talmudische Gelehrsamkeit wie durch seine
innige Frömmigkeit in den weitesten Kreisen rühmlichst bekannt, ist nicht
mehr. Gestern Abend 9 Uhr, am Ausgang des Schabbat mit der Paraschah
wajischlach, hauchte er seine reine Seele aus, in einem Alter von 83
Jahren und 8 Monate. Seine Kinder, Enkel und Urenkel beweinen den Verlust
ihres unvergesslichen geliebten Vaters, der Herausgeber dieser Blätter, den
Heimgang ihres teuren Schwiegervaters und verehrten Lehrers, die
israelitische Religionsgesellschaft zu Mainz den Tod ihres Begründers und
ersten Vorstehers, der mit wahrhafter Aufopferung und unermüdlicher
Hingebung seit einem Vierteljahrhundert ihre Interessen vertreten, die Stadt
Mainz den Heimgang eines ihres geachteten Bürger, und ganz Israel den
Verlust eines Mannes, welcher der Gesamtheit zur Zierde gereichte.
(hebräisch und deutsch:) wehe, es ist gefallen, die Krone unseres Hauptes!
Es ist uns nicht möglich, heute mehr zu schreiben. Wir werden in den
nächsten Nummern ausführlich von dem reichen Leben des teuren Verblichenen
erzählen. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens."
Anmerkung: - Rabbi Samuel Bondi:
https://www.geni.com/people/Samuel-Bondi/6000000003639961105 |
Beisetzung von Rabbi Samuel Bondi (1877)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. November
1877: "Mainz, 26. November. Heute fand unter überaus
zahlreicher Beteiligung das Leichenbegängnis unseres verehrten,
unvergesslichen Schwiegervaters - seine Seele leuchte - statt – es
war ein Conduct, wie er hier noch nicht gesehen worden; circa 2.000 Menschen
aus allen Ständen und Konfessionen folgten der Leiche. Die vornehmsten
Bürger unserer Stadt, der Bürgermeister an der Spitze, die Rabbinen und
Vorsteher der Gemeinde sowohl wie auch der Religionsgesellschaft, die Lehrer
und Schüler des Gymnasiums und der Realschule, die Israeliten von Mainz fast
ohne Ausnahme, sowie zahlreiche Fremde: Von Berlin,
Frankfurt a. M.,
Karlsruhe,
Halberstadt,
Darmstadt,
Wiesbaden,
Bingen,
Fulda,
Marburg,
Biebrich,
Biblis,
Mosbach
sowie von den in der Nähe befindlichen kleineren Ortschaften bildeten das
zahlreiche Gefolge, welches dem allverehrten Manne die letzte Ehre erweisen
wollte. Heute Vormittag eröffnete Herr Rabbiner Dr. Hildesheimer aus
Berlin die traurige Feier mit tief ergreifendem Hesped (Traueransprache).
Im Trauerhause sprachen noch Herr Moritz Lewin aus Frankfurt a. M., Herr Leo
Leser von hier und ein Sohn des Betrauerten, Herr Hugo Bondi.
Punkt 11 Uhr setzte sich der imposante Zug in Bewegung. Auf dem Friedhofe
entrollte der Herausgeber dieser Blätter ein Lebensbild des Betrauerten
oftmals von dem lauten Schluchzen der zahlreichen Menge unterbrochen. Dann
sprach Herr Dr. M. Hirsch aus Frankfurt, der Sohn des Rabbiner Hirsch, der
leider durch Unwohlsein verhindert war, selbst zu kommen, verhindert war.
Darauf sprach Herr Rabbiner Dr. Auerbach aus Halberstadt. Noch viele der
Anwesenden hätten gerne ihrem Schmerze Ausdruck gegeben, wenn nicht die Zeit
zu weit wäre vorgerückt gewese. Außer den Genannten waren noch folgende
Rabbinen und Rabbinatassessoren anwesend: Dr. Cahn –
Wiesbaden, Dr. Fromm –
Frankfurt a. M., Dr. Sänger –
Bingen, Dr. Munk –
Marburg, Dr. Cahn –
Fulda, Bamberger –
Frankfurt a. M., Weil und Thalmann
– Karlsruhe, Sulzbach –
Darmstadt; auch waren fast sämtliche
Vorsteher der israelitischen Religionsgesellschaften zu Frankfurt a. M.,
Darmstadt, Wiesbaden und
Bingen erschienen. Heute Abend brachten
alle hier erscheinenden Zeitungen Nekrologe, welche der allgemeinen
Wertschätzung Ausdruck verliehen. Wir behalten uns vor, eine ausführliche
Biographie des teuren Heimgegangenen in den nächsten Nummern zu
veröffentlichen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. November
1877: "Mainz, 26. November. Heute fand unter überaus
zahlreicher Beteiligung das Leichenbegängnis unseres verehrten,
unvergesslichen Schwiegervaters - seine Seele leuchte - statt – es
war ein Conduct, wie er hier noch nicht gesehen worden; circa 2.000 Menschen
aus allen Ständen und Konfessionen folgten der Leiche. Die vornehmsten
Bürger unserer Stadt, der Bürgermeister an der Spitze, die Rabbinen und
Vorsteher der Gemeinde sowohl wie auch der Religionsgesellschaft, die Lehrer
und Schüler des Gymnasiums und der Realschule, die Israeliten von Mainz fast
ohne Ausnahme, sowie zahlreiche Fremde: Von Berlin,
Frankfurt a. M.,
Karlsruhe,
Halberstadt,
Darmstadt,
Wiesbaden,
Bingen,
Fulda,
Marburg,
Biebrich,
Biblis,
Mosbach
sowie von den in der Nähe befindlichen kleineren Ortschaften bildeten das
zahlreiche Gefolge, welches dem allverehrten Manne die letzte Ehre erweisen
wollte. Heute Vormittag eröffnete Herr Rabbiner Dr. Hildesheimer aus
Berlin die traurige Feier mit tief ergreifendem Hesped (Traueransprache).
Im Trauerhause sprachen noch Herr Moritz Lewin aus Frankfurt a. M., Herr Leo
Leser von hier und ein Sohn des Betrauerten, Herr Hugo Bondi.
Punkt 11 Uhr setzte sich der imposante Zug in Bewegung. Auf dem Friedhofe
entrollte der Herausgeber dieser Blätter ein Lebensbild des Betrauerten
oftmals von dem lauten Schluchzen der zahlreichen Menge unterbrochen. Dann
sprach Herr Dr. M. Hirsch aus Frankfurt, der Sohn des Rabbiner Hirsch, der
leider durch Unwohlsein verhindert war, selbst zu kommen, verhindert war.
Darauf sprach Herr Rabbiner Dr. Auerbach aus Halberstadt. Noch viele der
Anwesenden hätten gerne ihrem Schmerze Ausdruck gegeben, wenn nicht die Zeit
zu weit wäre vorgerückt gewese. Außer den Genannten waren noch folgende
Rabbinen und Rabbinatassessoren anwesend: Dr. Cahn –
Wiesbaden, Dr. Fromm –
Frankfurt a. M., Dr. Sänger –
Bingen, Dr. Munk –
Marburg, Dr. Cahn –
Fulda, Bamberger –
Frankfurt a. M., Weil und Thalmann
– Karlsruhe, Sulzbach –
Darmstadt; auch waren fast sämtliche
Vorsteher der israelitischen Religionsgesellschaften zu Frankfurt a. M.,
Darmstadt, Wiesbaden und
Bingen erschienen. Heute Abend brachten
alle hier erscheinenden Zeitungen Nekrologe, welche der allgemeinen
Wertschätzung Ausdruck verliehen. Wir behalten uns vor, eine ausführliche
Biographie des teuren Heimgegangenen in den nächsten Nummern zu
veröffentlichen."
Anmerkungen: - Religionsgesellschaft:
https://de.wikipedia.org/wiki/Orthodoxe_Synagoge_Mainz
Rabbiner Dr. Hildesheimer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Esriel_Hildesheimer
Hugo Bondi: https://www.geni.com/people/Hugo-Bondi/6000000002954027226
Rabbiner Dr. Fromm:
https://www.lagis-hessen.de/pnd/1140052071
Rabbiner Dr. Sänger: Rabbiner Dr. Hirsch Naphthtali Zwi Sänger, 1843
Buttenwiesen – 1909
Mergentheim
Rabbiner Dr. Munk:
https://www.alemannia-judaica.de/marburg_texte.htm#Nachruf zum Tod von
Rabbiner Dr. Leo Munk (1917)
Rabbiner Dr. Auerbach: Rabbiner Dr. Siegmund Auerbach, 1840 - 1901. |
Zum Tod von Rabbi Samuel Bondi (I, 1877)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
5. Dezember 1877: "Rabbi Samuel Bondi - er ruhe in Frieden.
Mainz, 27. November Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
5. Dezember 1877: "Rabbi Samuel Bondi - er ruhe in Frieden.
Mainz, 27. November
Der große und bedeutende Mann, den unsre Überschrift nennt, wurde am
Purimfeste des Jahres 5554 (d.h. 14. Adar II 5554 = 16. März 1794),
geboren. Sein Vater, Rabbi Jonah Bondi, war aus Dresden, wohin dessen Vater,
Rabbi Wolf Bondi, von Prag gezogen war. Rabbi Jonah war ein geborener
Prager, ein hervorragender Schüler des berühmten Rabbi Jecheskel Landau;
noch ist in unserem Besitze der erste Teil des Noda bi-Jehuda, den
der Verfasser seinem Lieblingsschüler verehrt und mit einer eigenhändigen
Widmung versehen hat. Rabbi Jonah war nicht nur ein großer Lamdan, sondern
im wahrhaftesten Sinn des Wortes ein großer Heiliger; zu seinen Ahnen
zählte er die hervorragendsten Männer unserer Nation. Den Verfasser des
kikion diunah (???), den Maharschal (Rabbi Schelomo Lurja),
Raschi (Rabbi Schelomo Jizchaki) und eine Familientradition führt den
Stammbaum der Familie auf König David zurück. Die Mutter der teuren
Dahingeschiedenen, Bella, war eine Tochter des weltberühmten Mainzer
Oberrabbinen Rabbi Herz Scheuer, dessen Vater Rabbi Tewele Scheuer,
ebenfalls daselbst Oberrabbiner gewesen. Rabbi Tewele war ein geborener
Frankfurter, einer der bedeutendsten Schüler des Maharich (???);
er wurde später als der große Verfasser des Penei Jehoschua
Frankfurter Rabbiner war, Dajan in seiner Vaterstadt und ward dann zum
Nachfolger seines Schwiegervaters, Rabbi Nathan Utitz, als Rabbiner nach
Bamberg
berufen. Von Rabbi Nathan Utitz möge hier ein Charakterzug erzählt werden.
Derselbe hatte außer seiner, später mit Rabbi Tewele vermählten Tochter,
einen einzigen Sohn, einen hoffnungsvollen Knaben von acht Jahren. Als
dieser einst mit seinem Lehrer spazieren ging, begegnete ihm ein Priester,
welcher die Embleme der katholischen Religion trug. Die den Priester
begleitende Menge wollte die beiden Juden zwingen, niederzuknien. Der Lehrer
gehorchte, der Knabe erlitt lieber den Tod. Als man die |
 Leiche
des Kindes nach Hause brachte, saß der Rabbiner in seinem Studierzimmer, in
dem sich auch ein heiliger Schrein mit einer Torarolle befand. Als der Vater
die verstümmelte Leiche seines einzigen Sohnes erblickte, riss er die Türe
des Aron hakodesch auf und rief: 'Allmächtiger Gott, ich danke Dir, dass Du
mich so hoch beglückst, dass mein Sohn hat hingegeben sein Leben zur
Heiligung Deines großen Namens.' Leiche
des Kindes nach Hause brachte, saß der Rabbiner in seinem Studierzimmer, in
dem sich auch ein heiliger Schrein mit einer Torarolle befand. Als der Vater
die verstümmelte Leiche seines einzigen Sohnes erblickte, riss er die Türe
des Aron hakodesch auf und rief: 'Allmächtiger Gott, ich danke Dir, dass Du
mich so hoch beglückst, dass mein Sohn hat hingegeben sein Leben zur
Heiligung Deines großen Namens.'
Rabbi Tewele hatte in
Bamberg
einen großen und schönen Wirkungskreis; Bamberg war damals eine namentlich
durch Torakenntnis ausgezeichnete Gemeinde, allein die Verfolgungen eines
Apostaten (Meschumar - getaufter Jude) verbitterten ihm das Leben.
Der Apostat wurde nicht müde, bei der fürstbischöflichen Regierung den
Rabbiner zu verleumden, damals ereignete sich die weltberühmt gewordene
Geschichte, dass der Apostat es als ein Verbrechen dargestellt hatte, dass
der Rabbiner am Weihnachtsabend mit seinen Schülern Karten spiele. Die
heilige Hermandad überfiel wirklich den Rabbiner, aber es war gerade eine
religiöse Anfrage (Sche'ela) gekommen, der Rabbiner und seine Schüler
waren in der Erörterung der Sche'ela vertieft; die Karten waren vom
Tisch verschwunden und Gemara, Alphaßi, Rambam, Tur und Schulchan Aruch
lagen aufgeschlagen auf demselben.
Wir haben diese einzelnen Züge nur erwähnt, um zu zeigen, in welchen
Familientraditionen Rabbi Samuel Bondi - er ruhe in Frieden -
heranwuchs. Es war eine stürmische Zeit, in welcher er geboren wurde, Mainz
hatte soeben (1793) jene schreckliche Belagerung überstanden, die Mainz von
der Republik Frankreich lostrennte, und den entflohenen Kurfürsten wieder
zurückrief. Allein schon 1795 wurde Mainz wieder französisch und beinahe
hätte Rabbi Samuel in die Armee eintreten müssen. Er war schon eingekleidet
als der Sturz des Imperators erfolgte.
Als zwölfjähriger Knabe verlor Rabbi Samuel seinen ebenso gerechten wie
frommen Vater; seine Mutter, eine noch jugendliche Witwe, verschmähte es,
einen zweiten Ehebund einzugehen und wies die glänzenden Anträge zurück; sie
lebte nur der Erziehung ihrer drei Kinder, einer Tochter, die sich nach
Bingen https://www.alemannia-judaica.de/bingen_synagoge.htm verheiratete und
zweier Söhne, von denen der jüngere, der durch seine Gelehrsamkeit und
Frömmigkeit rühmlichst bekannte Rabbi Tewele Bondi - sein Licht leuchte
- seit mehr als sechzig Jahren in
Frankfurt wohnt.
Der eigentliche Erzieher unseres Samuel war sein Großvater Herz Scheuer.
Unter den zahlreichen bedeutenden Schülern der damals in Mainz blühenden
Jeschibah – ich nenne nur Rabbi Mendel Karge, Rabbi Mosche Merzig, Rabbi
Mosche Reis, Rabbi Bär Scheuer – war Rabbi Samuel Bondi der hervorragendste,
der Lieblingsschüler seines Großvaters. - Als zwanzigjähriger Jüngling
schloss er den Ehebund mit seiner edlen, frommen Gattin Sophie*), einer
geborenen Epstein aus
Fulda, mit
der er 56 Jahre lang in glücklichster Ehe gelebt hat. Als sein Großvater im
Jahre 5583 (1822) starb, übernahm Rabbi Samuel eine Zeit lang die Leitung
der Jeschibah; aber die Ungunst der Zeiten versprengte die Schüler und so
widmete er sich Rabbi Samuel den Geschäften – er gründete eine Weinhandlung
– , aber immerwährend das Geschäft als Nebensache, das Talmudstudium als
Hauptsache betrachtend. Sein öffentliches Wirken begann erst im Anfange der
dreißiger Jahre. Es war im Jahre 5591 (1830), als am Versöhnungstage während
des Neilah-Gebetes in der großen, alten Synagoge die Sifrei Kodesch
(= Torarollen) aus dem heiligen Schreine, dessen Türen geöffnet
waren, heraus auf die Erde fielen. Welcher Schrecken, welche Angst sich der
Gemüter bemächtigte, kann man sich leicht vorstellen. In demselben Jahre
wurde von der Regierung, die den sogenannten Fortschritt begünstigte, der
damalige Gemeindevorstand seines Amtes entsetzt, statt seiner wurden Männer
in die Verwaltung berufen, die genügsam charakterisiert sind, wenn wir
mitteilen, dass der Präses des neuen Vorstandes später zum Christentum
übertrat. 'Reform' auf allen Gebieten war nun das Losungswort, der alte
Rabbiner, Rabbi Löb Ellinger, sollte als 'Lungenbesichtiger' beibehalten
werden; dagegen sollte das Rabbineramt einem Jünger der damals aufstrebenden
'Reform' übertragen werden. Dagegen trat Rabbi Samuel Bondi mit aller Kraft
und Energie auf, und seine Bemühungen waren von Erfolg gekrönt, der neue
Vorstand musste abtreten, und er selbst wurde mit seinen Freunden Rabbi
Mosche Reis und Rabbi Jakob Levi, an die Spitze der Gemeinde berufen.
Fünfzehn Jahre lang vermochte er mit seinen Freunden die Gemeinde in ihrem
alten Bestande erhalten. Da traten neue Momente ein, die das unmöglich
machten.
Der Rabbiner Löb Ellinger starb, und es sollte ein moderner Rabbiner berufen
werden, die alte Synagoge war baufällig geworden und sollte durch einen
Reform-Tempel ersetzt werden. Sieben Jahre währten die Kämpfe; da wurde im
Jahre 1853 der mit Orgel etc. versehene Tempel eingeweiht und Dr. Aub von
Bayreuth
(jetzt in Berlin) als Rabbiner berufen. Als Rabbi Samuel sah,
*) Sie hieß eigentlich Süßchen, musste aber nach hierländischen Gesetzen
ihren Namen ändern.
|
 dass
all seine Kämpfe vergeblich gewesen, da tat er wie unser Vater Jakob getan
(hebräisch und deutsch aus 1. Mose 32,8-9): 'Und er teilte das Volk in zwei
Lager und sprach: 'Wenn der religionsfeindliche, herrschende Zeitgeist das
eine Lager vernichten sollte, so möge wenigstens das übriggebliebene Lager
errettet werden.' dass
all seine Kämpfe vergeblich gewesen, da tat er wie unser Vater Jakob getan
(hebräisch und deutsch aus 1. Mose 32,8-9): 'Und er teilte das Volk in zwei
Lager und sprach: 'Wenn der religionsfeindliche, herrschende Zeitgeist das
eine Lager vernichten sollte, so möge wenigstens das übriggebliebene Lager
errettet werden.'
Rabbi Samuel Bondi gründete nunmehr in Verbindung mit seinen Freunden Rabbi
Mosche Reis und Rabbi Jizchak Fulda*) die israelitische
Religionsgesellschaft.
(Fortsetzung folgt)
Anmerkungen: - Lamdan:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lamdan
- Rabbi Herz Scheuer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Herz_Scheuer: Rabbi Herz Scheuer war
Vorgänger und Nachfolger von Rabbi Samuel Levi, dem Großvater des Dirigenten
Hermann Levi (1839 -1900). Vgl. in der Seite zu den Rabbinern und Lehrern in
Worms einen
Artikel von 1900 und einen
Artikel von 1912 sowie einen
Artikel von 1933.
- Rabbi Tewele Scheuer:
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Tebele_Scheuer
- Dajan: Richter am Beth Din
https://de.wikipedia.org/wiki/Beth_Din
- Aron hakodesch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Toraschrein
- Hermandad:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermandad
- Gemara:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemara
- Alphaßi:
https://de.wikipedia.org/wiki/Isaak_Alfasi
- Rambam:https://de.wikipedia.org/wiki/Maimonides
- Tur:
https://de.wikipedia.org/wiki/Naftali_Herz_Tur-Sinai
- Schulchan Aruch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schulchan_Aruch
- Jeschibah:
https://de.wikipedia.org/wiki/Jeschiwa
- Rabbi Mosche Merzig:
https://www.merzig.de/tourismus-kultur/erinnerungskultur/reb-mosche-merzig/
- Rabbi Mosche Reis:
https://de.wikipedia.org/wiki/Moses_Rei%C3%9F
- Versöhnungstag:
https://de.wikipedia.org/wiki/Jom_Kippur
- Rabbi Löb Ellinger: Lebte von 1772 bis 1847. |
Zum Tod von Rabbi Samuel Bondi (II,
1877)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12.
Dezember 1877: "Rabbi Samuel Bondi - er ruhe in Frieden - II. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12.
Dezember 1877: "Rabbi Samuel Bondi - er ruhe in Frieden - II.
Die Gründung der israel(itischen) Religionsgesellschaft zu Mainz war mit den
allergrößten Schwierigkeiten, sowohl äußern wie inneren, verknüpft. Zwar war
Frankfurt a. M. mit gutem Beispiele vorangegangen; allein dort lagen die
Verhältnisse wesentlich günstiger. Zunächst hatte sich der Senat der damals
freien Stadt zu der Gründung der Religionsgesellschaft entgegenkommend
verhalten, während die Großherzoglich Hessische Regierung sich vollständig
ablehnend verhielt. Der Ministerialrat W., der damals das Referat in
judaicis hatte, wollte nicht einmal die Erlaubnis zur Abhaltung eines 'Minjan'
außer der Orgel-Synagoge gestatten. Da galt es nun mit Energie, mit
Klugheit, mit Ausdauer vorzugehen. Damals gab es noch keine direkte
Eisenbahnverbindung zwischen Mainz und Darmstadt, die Reise in die Residenz
war eine sehr umständliche. Nichtdestoweniger reisten Rabbi Samuel Bondi und
Rabbi Jakob Levi allwöchentlich einige Male dahin und hörten nicht auf, bei
den einflussreichsten Persönlichkeiten so lange zu petitionieren, bis ihnen
die Erlaubnis zur Errichtung eines besonderen Gottesdienstes erteilt wurde –
aber auch nichts als das; die Erlaubnis, einen Rabbiner anzustellen und von
diesem die rabbinischen Funktionen vollziehen zu lassen, musste erst noch –
schrittweise – erlangt werden.
Nicht minder groß waren die Schwierigkeiten im Innern der
Religionsgesellschaft. Anfangs waren es nur sechzehn Familien und unter
diesen nur wenig Begüterte. Es fehlte geradezu an Allem, namentlich an Geld.
Trotzdem gelang es dem rastlosen, unermüdlichen Eifer der beiden oben
genannten Männer, eine Synagoge zu erbauen, die circa 36.000 fl. kostete.
Am Rüsttage des Hüttenfestes des Jahres 5615 (1854) trat der Herausgeber
dieser Blätter seiner Stellung an der israel(itischen) Religionsgesellschaft
an. Das Synagogengebäude war fertig, aber zur Vollendung der innern
Ausstattung fehlte das Geld; so währte es noch zwei Jahre bis zur
Einweihung. Wir wollen von dem Zustande, wie wir hier angetroffen,
schweigen. Liegt es uns ja heute nicht ob, eine Geschichte der
israel(itischen) Religions-Gesellschaft zu Mainz zu schreiben, sondern nur
den hervorragenden Anteil hervorzuheben, den der Edle, welchen unsre
Überschrift nennt, an der Bessergestaltung der religiösen Zustände in
unserer Stadt genommen. Er war der geistige Mittelpunkt des Ganzen. Sein
religiöser Ernst, sein Feuereifer, seine große talmudische Gelehrsamkeit,
seine Strenge gegen sich selbst und seine Milde gegen andere, seine
grenzenlose Bescheidenheit – all’ diese erhabenen Eigenschaften des Geistes
und Charakters verliehen der Religionsgesellschaft einen ideale Höhe, die
über die Kleinlichkeit der materiellen Zustände hinweghalf, Rabbi Samuel
Bondi verstand es, die Begeisterung, die sein edles Herz durchleuchtete,
seiner ganzen Umgebung mitzuteilen. So ruhte denn Gottes Segen sichtlich auf |
 seinem
Werke. Die im Jahre 5616 (1856) eingeweihte Synagoge, anfangs viel zu groß,
ward bald zu klein Im Jahre 5619 (1859) gelang es uns, eine
Unterrichtsanstalt zu gründen, die mit 53 Kindern eröffnet wurde, und die
jetzt über 150 Schüler und Schülerinnen zählt. Im Jahre 5618 (1858) hatte
die Religionsgesellschaft nach vielen Mühen und Kämpfen Korporationsrechte
erlangt. Im Jahre 5633 (1873) gelang es, eine Haus nebst Garten neben der
Synagoge zu erwerben, um die notwendige Vergrößerung vorzunehmen, die denn
auch im verflossenen Frühjahre in Angriff genommen wurde. Unsere neue
Synagoge wird mehr als noch einmal so groß als die vorige werden. Ach, Rabbi
Samuel Bondi sollte die Vollendung derselben nicht erleben! seinem
Werke. Die im Jahre 5616 (1856) eingeweihte Synagoge, anfangs viel zu groß,
ward bald zu klein Im Jahre 5619 (1859) gelang es uns, eine
Unterrichtsanstalt zu gründen, die mit 53 Kindern eröffnet wurde, und die
jetzt über 150 Schüler und Schülerinnen zählt. Im Jahre 5618 (1858) hatte
die Religionsgesellschaft nach vielen Mühen und Kämpfen Korporationsrechte
erlangt. Im Jahre 5633 (1873) gelang es, eine Haus nebst Garten neben der
Synagoge zu erwerben, um die notwendige Vergrößerung vorzunehmen, die denn
auch im verflossenen Frühjahre in Angriff genommen wurde. Unsere neue
Synagoge wird mehr als noch einmal so groß als die vorige werden. Ach, Rabbi
Samuel Bondi sollte die Vollendung derselben nicht erleben!
Nachdem wir nun in Kürze den Lebenslauf und einen Teil der Wirksamkeit des
verehrten Mannes den Lesern vorgeführt, wollen wir zu einer Charakteristik
seiner Persönlichkeit schreiten, damit sie beispielgebend weiter wirke.
Der Lebensnerv, der Lebensquell des teuren Dahingeschiedenen war unsre
heilige Gotteslehre. Vom Allgütigen mit großen geistigen Fähigkeiten
ausgestattet, hatte er von frühester Jugend an seine ganze Kraft dem Studium
der Tora gewidmet. Inmitten einer blühenden Jeschiba, in Verbindung mit
Genossen, von denen einige später hochberühmte Männer wurden – wir nennen
nur Rabbi Mendel Karge, den Verfasser des Gidulei Taharah, dem er ein
Talmid Chawer war, wurde er der Talmid muwhak seines
Großvaters Rabbi Herz Scheuer. Dass all diese Faktoren ein großes Resultat
hervorbrachten, braucht nicht erst gesagt zu werden. Rabbi Samuel Bondi ward
nicht nur ein großer Charif, er war auch Baki bechol Chidrei
HaSchass (Kundiger in allen Ordnungen der Tora), sein Wissen war ein
ausgebreitetes, sein 'Lernen' von einer ungewöhnlichen Tiefe und
Gründlichkeit. Seit mehr als dreißig Jahren von allen weltlichen Geschäften
zurückgezogen, war außer seinem Wirken für die Religionsgesellschaft die
Tora seine einzige Beschäftigung bei Tag und Nacht. Selten suchte er vor 12
Uhr nachts sein Lager auf, das er nach wenigen Stunden der Ruhe wieder
verließ, um aufs Neue in der Tora zu forschen. Er 'lernte' mit jedem, der es
wünschte. Seine Liebe zum Tora-Studium, sein Verlangen nach demselben war
unbegrenzt. Als in den letzten Wochen seines Lebens seine Augen schwach
wurden, da lernte er 'auswendig' bis zu seinem letzten Atemzug. Täglich
hielt er Vorträge in der Chebra Gemiluth Chassadim über Tenach
und Menorath Hamaor. Jährlich zweimal, am Rosch Chodesch Schebath und
am Simchat Thora, hielt er pilpulistische Vorträge, am letzteren Tage
in der |
 Synagoge.
Seine Festreden bei Beschneidungen – er war Mohel – waren außerordentlich
anregend und begeisterten stets die Hörer. Synagoge.
Seine Festreden bei Beschneidungen – er war Mohel – waren außerordentlich
anregend und begeisterten stets die Hörer.
Wie er nun die Gottesgebote, deren Studium er seine große, geistige Kraft
widmete, praktisch ausführte, das zu schildern ist unsere Feder zu schwach.
Seine simchah schäl mizwah (deutsch:), seine Freude an der Erfüllung der
göttlichen Gebote, war unbeschreiblich. Mit dieser herzinnigen Freude an
der Erfüllung der göttlichen Gebote wusste er auch seine Umgebung, seine
Kinder und Enkel zu erfüllen. Man musste ihn an einem Sabbate oder an einem
Festtage sehen! Die ganze Woche hindurch führte er ein asketisches Leben; er
aß kein Fleisch, trank weder Wein noch Bier, noch andere derartige Getränke,
fastete sehr viel; nicht allein an jedem Erew Rosch Chodesch (=
Vorabend zum ersten Tag des Monats) und andern derartigen Tagen, sondern
auch in den acht Wochen von Paraschath Schemoth bis Paraschath
Ki-tissa an jedem Montag und Donnerstag, - an den Sabbaten und Festtagen
aber, da freute er sich mit jeder Mahlzeit. Wie streng er es mit der
Beobachtung jeder einzelnen Mitzwa nahm, ist gar nicht darzustellen. Zum
Pessach-Feste mahlte er den Schemurah-Weizen für seine Mazzot vermittels
einer Handmühle; auch buk er die Mazzot, er selbst, am Ereb Pessach mit der
minuziösesten Sorgfalt. Am Seder-Abend glich er einem alkim malach.
In der liebenswürdigsten Weise suchte er die Hagadah den an seinem Tische
anwesenden Frauen und Kindern verständlich zu machen, daran die schönsten
Erzählungen und Erklärungen aus Talmud und Midrasch knüpfend. Während des
Essens aber sprach er an diesen Abenden nur Hebräisch, damit kein unheiliges
Wort die Heiligkeit des Festes störte. (Schluß folgt.)
Anmerkungen: - Minjan:
https://de.wikipedia.org/wiki/Minjan
- Orgel-Synagoge:
http://www.alemannia-judaica.de/mainz_synagoge.htm#In der Synagoge befindet
sich eine Orgel (1849)
- Rüsttag:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rüsttag
- Hüttenfest:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sukkot
- Korporation:
https://de.wikipedia.org/wiki/Korporation
- Tenach:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tanach
- Menorath Hamaor: 'Licht verbreitender Leuchter', Erbauungsbuch von
Rabbi Isaac Abuhab
- Mohel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mohel
- Rosch Chodesch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosch_Chodesch
- Simchat Thora:
https://de.wikipedia.org/wiki/Simchat_Tora
- Paraschath Schemoth:
https://judentum.online/unsere-grossen-anfuehrer-machten-sich-die-probleme-des-volkes-zu-eigen-parascha-schmot/
- Paraschath Ki-ßißa:
https://judentum.online/die-zwei-steinernen-tafeln-parascha-ki-tisa/
- Mitzwa:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mitzwa
- Pessach:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pessach
- Pilpulistische Vorträge: vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pilpul
- Schemurah:
https://de.chabad.org/holidays/passover/pesach_cdo/aid/1487011/jewish/Der-Unterschied-zwischen-Schmura-Mazza-und-gewhnlicher-Mazza.htm
- Mazzot: Matzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Matze
- Ereb Pessach: Vorabend (Erev) von Pessach
- Hagadah:
https://de.wikipedia.org/wiki/Haggada . |
Zum Tod von Rabbi Samuel Bondi (III,
1877)
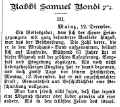 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Dezember
1877: "Rabbi Samuel Bondi - er ruhe in Frieden - Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Dezember
1877: "Rabbi Samuel Bondi - er ruhe in Frieden -
III. Mainz, 12. Dezember. Ein Gottesgebot, dem sich der teure Heimgegangene
mit ganz besonderer Vorliebe hingab, war das der Beschneidung. Die Zahl
derer, die er in den Abrahams-Bund aufgenommen, beläuft sich auf Tausende.
Während 67 Jahre hat er dieser Mitzwa mit der größten Aufopferung, Sorgfalt
und Hingebung obgelegen. Als noch nicht siebzehnjähriger Jüngling hat er
damit begonnen, und noch zwölf Tage vor seinem Hinscheiden, Montag, 12.
November, hat er mit ungeschwächter Kraft, Gewandtheit und Geschicklichkeit
eine Beschneidung vollzogen. Man kann jedoch nicht sagen, dass ihm irgend
eine Mitzwa teurer oder lieber gewesen als eine andere. Als in den trübsten
Zeiten des israel(itischen) |
 Gemeindelebens
zu Mainz die Chebrah Gemiluth Chaßadim, die Beerdigungs-Bruderschaft ihrer
Auflösung entgegenzugehen drohte, da war er es, der sie in Verbindung mit
seinen obengenannten Freunden reorganisierte. Bis dahin hatten die lomdei
Tora (die Toralernenden) sich davon zurückgehalten. Eine Mitzwa, die oft
Nachtwachen und andere große Zeitopfer erforderte, konnte auch durch
Ungelehrte besorgt werden. Als aber Rabbi Samuel sah, dass diese große und
heilige Aufgabe der Vernachlässigung anheim fiel, da nahm er sich ihrer mit
aller Energie an! Und mit welcher Sorgfalt hat er diese heiligen Pflichten
geübt! Wie manche Nacht hat er wachend am Krankenlager verbracht, wie hat er
noch als hochbetagter Greis, in Wind und Wetter, bei Kälte und Schnee oder
im glühenden Sonnenbrand den ziemlich entfernten Weg nach dem Friedhof nicht
gescheut, um Jedem – ohne Unterschied der religiösen Richtung oder
bürgerlichen Stellung – die letzten Liebesdienste zu erweisen! Gemeindelebens
zu Mainz die Chebrah Gemiluth Chaßadim, die Beerdigungs-Bruderschaft ihrer
Auflösung entgegenzugehen drohte, da war er es, der sie in Verbindung mit
seinen obengenannten Freunden reorganisierte. Bis dahin hatten die lomdei
Tora (die Toralernenden) sich davon zurückgehalten. Eine Mitzwa, die oft
Nachtwachen und andere große Zeitopfer erforderte, konnte auch durch
Ungelehrte besorgt werden. Als aber Rabbi Samuel sah, dass diese große und
heilige Aufgabe der Vernachlässigung anheim fiel, da nahm er sich ihrer mit
aller Energie an! Und mit welcher Sorgfalt hat er diese heiligen Pflichten
geübt! Wie manche Nacht hat er wachend am Krankenlager verbracht, wie hat er
noch als hochbetagter Greis, in Wind und Wetter, bei Kälte und Schnee oder
im glühenden Sonnenbrand den ziemlich entfernten Weg nach dem Friedhof nicht
gescheut, um Jedem – ohne Unterschied der religiösen Richtung oder
bürgerlichen Stellung – die letzten Liebesdienste zu erweisen!
Mehr als vierzig Jahre lang war er als Gabai des Heiligen Landes
für die Armen des Heiligen Landes ein eifriger Sammler; bei jedem
Beschneidungsfeste sammelte er; bei jeder Beerdigung gab er Staub des
Heiligen Landes*, um nachher für einen Beitrag für die Armen zu erheben;
auch bezog er von vielen hiesigen Israeliten bestimmte Beiträge zu dem
genannten Zweck und zog von den Frauen die sogenannte Challah-Büchsen ein.
* Gemeint ist der Brauch, dass man einem Verstorbenen, da er nicht im
Heiligen Land beigesetzt werden konnte, wenigstens etwas Erde aus dem
Heiligen Land unter seinen Kopf legt.
Wer aber die Größe und Heiligkeit des Unvergesslichen so ganz erkennen und
bewundern wollte, der musste ihn im Gebete sehen, namentlich an den heiligen
Tagen am Neujahrs- und Versöhnungsfeste!
Dass ein solcher Mann als Sohn, Gatte und Vater musterhaft war, braucht wohl
nicht erst gesagt zu werden. Welch’ eine glückliche Ehe er mit seiner edlen,
frommen Gattin führte, die ihm um 6 ½ Jahre vorausgegangen, haben wir
bereits früher erwähnt. Welche Ehrfurcht, Ehrerbietung und aufopfernde Liebe
er aber seiner Mutter gegenüber entfaltete, das entzieht sich jeder
Beschreibung. Dieselbe erreichte ein Alter von 95 Jahren; wiewohl bis zu
ihren letzten Tagen im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte, hatte sie doch im
höchsten Alter das Augenlicht fast verloren; auch waren die Sprachorgane
nicht mehr ganz wie sie gewesen. Während sie, seitdem die Augen schwach
geworden waren, stets auswendig gebetet hatte, war ihr das in den letzten
Jahren ihres Lebens nicht mehr möglich. Nichtsdestoweniger bestand sie
darauf, alles zu beten, wie sie es gewohnt war. Da war es nun rührend zu
sehen, wie Rabbi Samuel, selbst schon ein siebzigjähriger Greis, wie er, der
große Talmudgelehrte, viele Stunden täglich in himmlischer Geduld und
unermüdlicher Ausdauer der Mutter Wort für Wort sämtliche Gebete vorsagte
und noch an ihrem letzten Lebenstage – es war an einem Rosch Chodesch
Schachrith und Hallel und Musaph!
Wie er seine Kinder erzog in der Gotteslehre, der Gottesfurcht und der Liebe
zu Gott, braucht wohl nicht erst erwähnt zu werden. Mit gleicher Liebe und
Hingebung war er den Kindern seiner früh verstorbenen Schwester zugetan die
ihn wiederum wie ihren Vater ehrten, auch seinen Schwiegersöhnen,
Schwiegertöchtern und Enkeln war er der liebreichste Vater, ein jedes durfte
sich für seinen besondern Liebling halten, so war sein Benehmen gegen jeden
Einzelnen voll Zärtlichkeit und Fürsorge. Aber nicht allein für die
Mitglieder seiner Familie hatte er die hingebendste Liebe, sein großes Herz
umfasste die ganze Menschheit, wo immer nur er unterstützen, helfen, retten
konnte, war er stets und gern zu tatkräftiger Hilfe bereit, für Juden und
Nichtjuden, für alle, alle. Seine Milde und Strenge, wo er fürchtete, dass
irgendwie die Religion bedroht wäre.
Und wenn wir nun das Gesamtbild des reichen Lebens des teuren Mannes
überblicken, so mussten wir noch eine Eigenschaft hervorheben, welche die
Krone all’ seiner unzähligen Vorzüge war: Unbegrenzte Bescheidenheit und
Demut. Der Verfasser des Chobath Halebaboth macht darauf aufmerksam, dass es
zweierlei Bescheidenheit gibt; eine echte und eine gemachte. Es gibt viele
Leute, die höchst bescheiden reden, aber voll Anmaßung und voller Ansprüche
sind. Die echte Bescheidenheit bewährt sich in den Taten und in Benehmen des
Menschen, sie ist durchaus anspruchslos und selbstlos. So war die Demut
Rabbi Samuels. Wir wollen nur Weniges anführen. Solange der obenerwähnte
Rabbiner, Rabbi Löb Ellinger, lebte, passkente er kein Schaaloh, selbst
nicht in seinem eigenen Hause. Als die Gemeindeverwaltung einen neologen
Rabbiner berief und er gezwungen war, die Horaah (Unterricht) zu
übernehmen, tat er dies nicht eher, bis er sich von den Rabbinern Dr.
Auerbach in
Darmstadt und Bamberger in
Worms
Hatarat Torah (rabbinische Erlaubnis zur Lehrtätigkeit)
verschafft hatte. Der letztere schrieb: 'Ein in den weitesten Kreisen als
großer Gelehrter berühmter Mann verlangt von mir, dass ich ihm seine Fähig- |
 keit
zum Lehren bezeuge. Bedarf es eines Zeugnisses, dass die Sonne am Himmel
steht und die Welt erleuchtet? Da er er aber wünscht, so fühle ich mich
verpflichtet, seinem Wunsche zu willfahren etc.' ..." keit
zum Lehren bezeuge. Bedarf es eines Zeugnisses, dass die Sonne am Himmel
steht und die Welt erleuchtet? Da er er aber wünscht, so fühle ich mich
verpflichtet, seinem Wunsche zu willfahren etc.' ..."
Anmerkungen: - Abrahams-Bund: Gemeint ist die Beschneidung von männlichen
Säuglingen als Aufnahme ins Judentum
- Mitzwa:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mitzwa
- Chebrah Gemiluth Chaßadim: gemeint der Verein in der jüdischen Gemeinde,
übersetzt: 'Bruderschaft der Wohltätigkeit'
- Challah:
https://de.wikipedia.org/wiki/Challa
- Neujahrsfest:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosch_ha-Schana
- Versöhnungfest:
https://de.wikipedia.org/wiki/Jom_Kippur
- Rosch Chodesch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosch_Chodesch
- Schachrith:
https://www.hagalil.com/2013/08/morgengebet/
- Hallel:
https://fremdworterbuchbung.de-academic.com/31657/Hallel
- Musaph:
https://de.wikipedia.org/wiki/Musaf
- passkenen: Urteil sprechen
- Rabbiner Dr. Auerbach:
https://de.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Hirsch_Auerbach
- Rabbiner Bamberger: Vgl.
Bericht zum Tod von Rabbiner Jacob Koppel Bamberger von 1864 (auf Seite
zu Worms). |
Zum Tod von Rabbiner Samuel Bondi und seine Beisetzung (50 Jahre danach: 1927)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. November
1927: "Ím Wandel der Zeiten. Rabbi Samuel Bondi - das Gedenken
an den Gerechten ist zum Segen - in Mainz. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. November
1927: "Ím Wandel der Zeiten. Rabbi Samuel Bondi - das Gedenken
an den Gerechten ist zum Segen - in Mainz.
(Aus Nr. 48 des Israelit vom 24. November 1877)
Mainz, 25. November. Wir haben heute eine höchst betrübende
Mitteilung zu machen. Rabbi Samuel Bondi durch seine tiefe und ausgebreitete
talmudische Gelehrsamkeit wie durch seine innige Frömmigkeit in den
weitesten Kreisen rühmlichst bekannt, ist nicht mehr. Gestern Abend 9 Uhr,
am Ausgang des Heiligen Schabbat mit der Parascha wajischlach hauchte
er seine reine Seele aus, in einem Alter von 83 Jahren und 8 Monaten. Seine
Kinder, Enkel und Urenkel, beweinen den Verlust ihres unvergesslichen,
geliebten Vaters, der Herausgeber dieser Blätter, den Heimgang seines teuren
Schwiegervaters und verehrten Lehrers, die israelitische
Religionsgesellschaft zu Mainz den Tod ihres Begründers und ersten
Vorstehers, der mit wahrhafter Aufopferung und unermüdlicher Hingebung seit
einem Vierteljahrhundert ihre Interessen vertreten, die Stadt Mainz den
Heimgang eines ihrer geachteten Bürger, und ganz Israel den Verlust eines
Mannes, welcher der Gesamtheit zur Zierde gereichte. Die Krone unseres
Hauptes - wehe, es ist gefallen, die Krone unseres Hauptes!
Es ist uns nicht möglich, heute mehr zu schreiben. Wir werden in den
nächsten Nummern ausführlich von dem reichen Leben des teuren Verblichenen
erzählen. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens."
Mainz, 26. November. Heute fand unter überaus zahlreicher Beteiligung
das Leichenbegängnis unseres verehrten, unvergesslichen Schwiegervaters
er ruhe in Frieden statt – es war ein Kondukt, wie er hier noch nicht
war gesehen worden: circa 2.000 Menschen aus allen Städten und Konfessionen
folgten der Leiche. Die vornehmsten Bürger unserer Stadt, der Bürgermeister
an der Spitze, die Rabbinen und Vorsteher der Gemeinde sowohl wie der
Religionsgesellschaft, die Lehrer und Schüler unserer Unterrichtsanstalt,
die israelitischen Schüler des Gymnasiums und der Realschule, die Israeliten
von Mainz fast ohne Ausnahme, sowie zahlreiche Fremde: Von Berlin,
Frankfurt a. M.,
Karlsruhe, Halberstadt,
Darmstadt,
Wiesbaden,
Bingen, Fulda,
Marburg,
Biebrich, Biblis,
Mosbach, sowie von den in der Nähe
befindlichen kleineren Ortschaften bildeten das zahlreiche Gefolge, welches
dem allverehrten Mann die letzte Ehre erweisen wollte. Heute Vormittag 10
Uhr eröffnete Herr Rabbiner Dr. Hildesheimer aus Berlin die traurige
Feier mit einem ergreifenden Hesped - Trauerrede. Im Trauerhause
sprachen noch Herr Moritz Lewin aus Frankfurt a. M., Herr Leo
Leser von hier und ein Sohn des Betrauerten, Herr Hugo Bondi.
Punkt 11 legte sich der imposante Zug in Bewegung. Auf dem Friedhofe
entrollte der Herausgeber dieser Blätter ein Lebensbild des Betrauerten,
oftmals von dem lauten Schluchzen der zahlreichen Menge unterbrochen. Dann
sprach Herr Dr. M. Hirsch aus Frankfurt a. M., der Sohn des Herrn
Rabbiner Hirsch, der leider durch Unwohlsein selbst zu kommen, verhindert
war. Darauf sprach Herr Rabbiner Dr. Auerbach aus Halberstadt. Noch
viele der Anwesenden hätten gerne ihrem Schmerze Ausdruck gegeben, wenn
nicht die Zeit zu weit vorgerückt gewesen wäre. Außer den Genannten, waren
noch folgende Rabbinen und Rabbinatsassessoren anwesend: Dr. Fromm –
Frankfurt a. M., Dr. Cahn - Wiesbaden,
Dr. Sänger – Bingen, Dr. Munk
– Marburg, Dr. Cahn –
Fulda, Bamberger - Frankfurt a. M.,
Weil und Thalmann –
Karlsruhe , Sulzbach –
Darmstadt, auch waren sämtliche Vorsteher der israelischen
Religionsgesellschaften zu Frankfurt a. M., Darmstadt, Wiesbaden und Bingen
erschienen. Heute abend brachten alle hier erscheinenden Zeitungen
Nekrologe, welche der allgemeinen Wertschätzung Ausdruck verliehen. Wir
behalten uns vor, eine ausführliche Biografie des teuren Heimgegangenen in
der nächsten Nummer zu veröffentlichen.
Anmerkungen: Kondukt: Trauerzug
Herausgeber dieser Blätter: Rabbiner Dr. Markus Lehmann
Rabbiner Dr. Hildesheimer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Esriel_Hildesheimer
Rabbiner Dr. Auerbach:
https://de.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Hirsch_Auerbach
Rabbiner Dr. Fromm:
https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/bio/id/3264
Rabbiner Dr. Munk:
https://www.deutsche-biographie.de/sfz67330.html
Rabbiner Dr. Cahn:
https://www.alemannia-judaica.de/fulda_rabbinat.htm#Über die Arbeit von
Provinzialrabbiner Dr. Cahn (1901) |
Rabbiner Dr. Markus Lehmann tritt sein Amt zum Sukkot-Fest an
(1854)
 Artikel
in der Zeitschrift "Jeschurun" im November
1854: "Mainz, im Nov. Am Erev Sukkot (Vorabend zu Sukkot)
trat Herr Dr. Lehmann, der Rabbiner, der nach dem von
Frankfurt gegebenen Beispiele
hier gebildeten Religionsgesellschaft, die jedoch schon als Gemeinde von der
Regierung anerkannt ist, sein Amt an. - An der Synagoge wird rüstig
gearbeitet und hofft man sie auf Pessach zu vollenden." Artikel
in der Zeitschrift "Jeschurun" im November
1854: "Mainz, im Nov. Am Erev Sukkot (Vorabend zu Sukkot)
trat Herr Dr. Lehmann, der Rabbiner, der nach dem von
Frankfurt gegebenen Beispiele
hier gebildeten Religionsgesellschaft, die jedoch schon als Gemeinde von der
Regierung anerkannt ist, sein Amt an. - An der Synagoge wird rüstig
gearbeitet und hofft man sie auf Pessach zu vollenden." |
Zum Tod von Rabbiner Dr. Markus Lehmann (zugleich Chefredakteur des
"Israelit", 1890)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. April
1890: "Dr. Markus Lehmann - er ruhe in Frieden. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. April
1890: "Dr. Markus Lehmann - er ruhe in Frieden.
Rabbiner der isr(aelitischen) Religionsgesellschaft, Begründer und
Chefredakteur des 'Israelit'
Mainz, 14. April. Wenn die dieswöchentliche Doppelnummer des 'Israelit und
Jeschurun' in die Hände unserer geehrten Leser gelangt gelangt sein wird,
werden die meisten derselben schon durch den Telegraph, die erschütternde
Nachricht empfangen haben, dass (hebräisch und deutsch) unser
hochgeschätzter und hochverehrter Herr Rabbiner Dr. Markus Lehmann,
Begründer und Chefredakteur dieser Blätter nach dreimonatlichen schweren
Leiden heute Morgen 10 Uhr von seiner tatenreichen irdischen Laufbahn
abberufen worden ist.
Mit Angst und Zitern ergreifen wir die Feder in dem Bewusstsein der überaus
schweren Pflicht, das Leben, die großartige, in unserer Zeit fast
beispiellose Wirksamkeit des teuern Dahingeschiedenen und den unermesslichen
Verlust, den wir und die Welt durch seinen Tod erlitten, zu schildern.
Werden wir die in uns aufsteigenden Gedanken der Wehmut und der tiefen
Trauer in die richtigen und passenden Worte zu kleiden im Stande sein,
angesichts eines solchen herben Schlages, der uns nach Gottes weisen
Ratschlusses getroffen? Haben wir doch die Aufgabe nicht allein dem
unendlichen Schmerz von dem seine Hinterbliebenen, seine Gemeinde und wir,
sondern auch das ganze Judentum und insbesondere das orthodoxe ergriffen
sind; beredten Ausdruck zu verleihen!
Dr. Lehmann! Wo auf dem weiten Erdenrund, im Norden und Süden, im
Osten und Westen, ist dieser Name in jüdischen Kreisen nicht bekannt? Seit
drei Jahrzehnten, während welcher der Dahingeschiedene mit aller Kraft und
mit seinem ganzen Sein, mit seiner großen Gelehrsamkeit und seinen
umfassenden Kenntnissen für die Interessen unserer heiligen Religion
eingetreten, ist sein Ruf und sein Ruhm bei allen unseren Glaubensgenossen
der Diaspora, welcher religiösen Richtung sie auch angehören, immer mehr
gestiegen und immer mehr zur Anerkennung gelangt, und darum wird auch die
Trauer um ihn keine familiäre, keine örtliche, vielmehr eine allgemeine
sein, und gleich unserem großen Lehrer m sch h können wir, ohne
Übertreibung, die in der dieswöchentlichen Sidre (Wochenabschnitt) zu
verlesenden Worte ausrufen: (hebräisch und deutsch) 'Ganz Israel
betrauert und beweint diesen Geistesfürsten und Großen in Israel'. Wir
glauben nicht zu viel zu sagen, wenn wir behaupten, dass das Judentum in dem
letzten Vierteljahrhundert keinen größeren und tatkräftigeren, in seiner
Wirksamkeit innerhalb des Judentums erfolgreicheren Mann aufzuweisen hat als
Dr. Lehmann, dessen Taten ein großes Blatt in der jüdischen Geschichte
dieses Zeitraumes einnehmen werden.
Werfen wir einen kurzen Rückblick auf die letztverflossenen drei Dezennien
und auf die religiösen Zustände, wie sie damals im jüdischen Lager
herrschten. Kühn erhob die Reform ihr Haupt, die neologen Rabbiner berleihen
in Rabbinerversammlungen und Synoden, wie sie das Erbe unserer Väter, die
heilige, alte Zeiten und Verhältnisse überdauernde, von Gott auf dem Sinai
uns überkommene schriftliche und mündliche Lehre umzugestalten vermöchten.
Kein Wunder, wenn der Abfall von der h(eiligen) Religion immer größere
Dimensionen annahm und ein großer Teil des irregeleiteten Vol- |
 kes
diesen himmelaufstrebenden Reformhelden entgegenjubelnd an den Abgrund der
Irreligiosität und des Indifferentismus anlangte. Tapfer und unerschrocken,
mit der Macht der Überzeugungstreue und der Wissenschaft traten die
Bamberger, Napthali Hirsch, Dr. N. Adler und Dr. Hildesheimer um zu
scheiden zwischen den Lebendigen und den Toten wider sie auf und
stellten der um sich greifenden Reformwut einen festen Damm entgegen. Allein
die Orthodoxie war mundtot; ein Organ, das ihre Interessen vor der
öffentlichen Meinung nach jeder Richtung wirksam vertreten hätte, existierte
nicht. Die jüdische Journalistik befand sich ausschließlich in den Händen
der Reform; die von dem verstorbenen Dr. Philippson herausgegebene
'Allgemeine Zeitung des Judentums' war in allen Kreisen der deutschen Juden
stark verbreitet, und durch anerkannt gute und populär geschriebene
Abhandlungen verstand es Philippson, seine Reformideen dem Volke zugänglich
zu machen und so den Reformrabbinern in die Hand arbeitend, einen
fruchtbaren Boden für deren Umgestaltung von Haus und Synagoge
vorzubereiten. kes
diesen himmelaufstrebenden Reformhelden entgegenjubelnd an den Abgrund der
Irreligiosität und des Indifferentismus anlangte. Tapfer und unerschrocken,
mit der Macht der Überzeugungstreue und der Wissenschaft traten die
Bamberger, Napthali Hirsch, Dr. N. Adler und Dr. Hildesheimer um zu
scheiden zwischen den Lebendigen und den Toten wider sie auf und
stellten der um sich greifenden Reformwut einen festen Damm entgegen. Allein
die Orthodoxie war mundtot; ein Organ, das ihre Interessen vor der
öffentlichen Meinung nach jeder Richtung wirksam vertreten hätte, existierte
nicht. Die jüdische Journalistik befand sich ausschließlich in den Händen
der Reform; die von dem verstorbenen Dr. Philippson herausgegebene
'Allgemeine Zeitung des Judentums' war in allen Kreisen der deutschen Juden
stark verbreitet, und durch anerkannt gute und populär geschriebene
Abhandlungen verstand es Philippson, seine Reformideen dem Volke zugänglich
zu machen und so den Reformrabbinern in die Hand arbeitend, einen
fruchtbaren Boden für deren Umgestaltung von Haus und Synagoge
vorzubereiten.
Da war es Dr. Lehmann, der im Mai 1860 den 'Israelit', 'ein Centralorgan für
das orthodoxe Judentum' begründete und wöchentlich in einem
bewunderungswürdgen, nie ermüdenden Feuereifer und unerschrockenem Mute
gegen die Allmacht der Reform ankämpfte, für die Unantastbarkeit der uns
überlieferten göttlichen Religion mit allen Waffen des Geistes unentwegt
seine Stimme erhob, welche in allen Schichten des jüdischen Volkes ihren
tiefen Eindruck nicht verfehlte, die treuen Anhänger ermutigte und die
Neologen in ihre Schranken zurückwies. Und mit der Hilfe Gottes ist es ihm
gelungen, eine dauernde Wendung zum Besseren herbeizuführen. Während vordem
die Orthodoxen von ihren anders gesinnten Stammesgenossen verlacht und
verspottet wurden, die Orthodoxen selbst jeden Mut eines offenen Kampfes
verloren hatten und im Innern ihres Hauses durch Seufzen und Jammern ihrem
Unmut gegen die Verderbtheit der Zeit Luft verschafften, scharte sich nach
dem ersten öffentlichen Auftreten Dr. Lehmanns die damals noch kleine Zahl
gesetzestreuer Männer um den großen Mann, und kaum ein Jahrzehnt war
verflossen, als innerhalb der Judenheit ein anderes und zwar erfreulicheres
Bild wahrzunehmen war. Die Orthodoxie gelangte zur Anerkennung; der
sogenannte 'neue Jude' bekam nun Achtung vor dem gesetzestreuen Kämpfer,
welcher unter Hintansetzung seiner materiellen Interessen und unter den
größten Entbehrungen in Gesellschaft und im Geschäftsverkehr seinem
väterlichen Glauben bis auf die kleinste Nuance treu bleibt. Noch ein
weiteres Jahrzehnt – und das orthodoxe Judentum stand in den Augen selbst
der nichtjüdischen Welt und bei den Regierungen die Gleichberechtigung mit
dem bisher dominierenden Reformjudentum; das Austrittsgesetz ermöglichte den
Orthodoxen in besonderen Gemeinden, in denen der öffentliche Gottesdienst
und alle jüdischen Institutionen nach dem Schulchan Aruch eingerichtet und
gehandhabt werden, sich zu vereinigen und so ihrer Überzeugung gemäß zu
leben und zu wirken.
Als nach der glücklichen Bekämpfung des inneren Feindes ein äußerer, der
Antisemitismus auf die Bildfläche trat, da war es wieder der teure
verstorbene Herr Dr. Lehmann das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen,
der den Kampf mit der widersinnigsten aller Feindseligkeiten, dem
Rassenhasse, der 'Schmach des neunzehnten Jahrhunderts' aufnahm und im
Bewusstsein, einer von allen vorurteilslosen Männern anerkannt gerechten
Sache zu dienen, maßvoll für die politischen Rechte seiner Glaubensgenossen
die Feder fort und fort ergriffen, wenn auch noch so viele und heftige
Angriffe seitens der antisemitischen Presse gegen ihn losgelassen wurden.
Das ist ein kurzes Bild von der allgemeinen Tätigkeit unseres Dr. Lehmann
das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen für die Judenheit im Ganzen
und die orthodoxen Juden im Besondern.
Auch seine Gegner in Schrift und religiöser Gesinnung – Feinde hatte dieser
so überaus liebenswürdige und gerechte Mann weder hier noch anderwärts –
werden ihm das Zeugnis nicht verweigern, dass er seiner Überzeugung gemäß,
das Böse zu beseitigen und das Gute zu tun ehrlich und redlich sich bemüht
hat, und dass auf ihn wie selten auf jemanden die Worte des Dichters
Anwendung finden: 'Er war ein Man, nehmt alles nur in allem, Ihr werdet
nimmer seinesgleichen finden.'
Seine Leitartikel, in populär verständlicher Sprache geschrieben,
behandelten alle das Judentum berührenden Zeitfragen, brachten aber auch oft
für den Leser des 'Israelit' die schönsten Abhandlungen und Erklärungen
unser h(eiligen) Tora zur Belehrung für Haus und Schule; in den
Korrespondenzen bemühte er sich stets auf das Schnellste aller wissenswerten
jüdischen Neuigkeiten mitzuteilen – und in seinen berühmt gewordenen
Feuilletons aus 'Vergangenheit und Gegenwart' hat er dem Lesepublikum nicht
bloß eine angenehme Unterhaltung, sondern auch die erhabensten, oft aus dem
vollen Leben gegriffene Schilderungen, welche |
 die
Erstarkung des gesetzestreuen Judentums bezweckten. die
Erstarkung des gesetzestreuen Judentums bezweckten.
Uns ist nunmehr die Aufgabe geworden, sein Geisteskind, 'den Israelit und
Jeschurun' in der gleichen Tendenz und in seinem Sinne
fortzusetzen, eine Aufgabe, der wir mit der Hilfe Gottes wie schon seit drei
Monaten freudig und mit bestem Wollen und Können auch fernerhin zum Nutzen
und Frommen unser heiligen Religion gerecht zu werden und bemühen werden, um
so auch beizutragen, dass sich an dem Begründer unseres Blattes das Wort
bewähre 'Zum ewigen Gedenken...'. Er aber, unser Lehrer, unser
Freund, an dessen Seite wir seit 23 Jahren am 'Israelit' als Mitarbeiter
tätig gewesen, dessen große und edle Geistesanlagen, hohe Eigenschaften und
Charakterfestigkeit wir täglich zu bewundern Gelegenheit hatten, mein
Lehrer, unser großer Lehrer, R. Meir Sohn des Chawer R. Ascher, die
'Leuchte Israels', mein Vater, mein Vater! Israels Wagen und seine Reiter
(2. Könige 2,12) ist nicht mehr; verstummt ist seine belehrende und
mahnende Stimme, erlahmt seine nie ermüdende Hand; (hebräisch und deutsch) 'Wehe
uns, dass wir diesen großen Mann verloren', ruft mit uns seine in einer
34jährigen glücklichen Ehe ihm zur Seite gestandene Gattin, welche ihn in
seiner langen Krankheit in der aufopferungsvollsten Weise ununterbrochen Tag
und Nacht gepflegt und seine Kinder, die ganz in seinem Sinne leben, seine
Verwandten und seine Gemeinde: (hebräisch und deutsch) 'gefallen ist die
Krone unseres Hauptes' bricht knesset Jisrael (ganz Israel)
klagend aus.
Und Ihr (hebräisch und deutsch) 'Ihr Armen im h(eiligen) Lande,
weinet, weinet! Ihr habt einen Euerer treuesten und wohlwollendsten Freunde
verloren, ein für Euer Wohlergehen warm fühlendes Herz hat zu schlagen
aufgehört, Ihr habt so oft und so andächtig an geheiligter Stätte für seine
Genesung gebetet, Gottes weiser Ratschluss hatte es anders bestimmt.
Dr. Markus Lehmann wurde am 25. Tewet 5591 (1831) in Verden (Prov.
Hannover) am Tage der Silberhochzeit seiner Eltern geboren. Sein Vater,
Rabbi Lemuel Aaron Lehmann das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen,
ein hervorragender Schüler des Rabbi Jecheskiel Landau (Verfasser der
Responsensammlung Noda biJehuda) war der erste Jude, der sich in diesem
Städtchen niederlassen durfte. Selbst ein Talmudist hielt er den jungen Meir
(Markus) frühzeitig zum Torastudium an. Nachdem dieser daselbst das damals
fast ausschließlich nur von Söhnen adeliger Familien und höherer Beamten
besuchte Gymnasium mit großem Erfolge absolvierte, setzte er seine
hebräischen Studien in Halberstadt zu Füßen seines berühmten und von ihm
stets hochverehrten Lehrers Dr. Israel Hildesheimer - sein Licht leuchte
an seinen (künftigen) Tagen und Jahren -, jetzt Rabbiner der Adass
Jisroel und Rektor des Rabbinerseminars in Berlin, fort. Er bezog hierauf
die Universität Berlin, wo er nebst seinen philosophischen Studien bei Rabbi
Michael Landsberger das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen seine
talmudischen Kenntnisse erweiterte. Mächtig zog es ihn alsdann nach Prag,
der Stätte, an der sein Vater einen großen Teil seiner Jugendjahre verbracht
hatte und dessen Lebenserfahrungen in dieser Stadt einen besonderen Reiz auf
ihn ausgeübt hatten. Hier vollendete er seine profanen und jüdischen
Studien, letztere unter Leitung des als scharfsinniger Talmudist in den
weitesten Kreisen bekannten Rabbi Samuel Freund - sein Licht leuchte,
worauf er in Halle promovierte. Ein Talmud-Tora-Verein, den er in Prag
während seines dortigen Aufenthaltes in Verbindung mit mehreren
gleichgesinnten jungen Leuten gründete, besteht unseres Wissens noch heute,
auch in Berlin war er bei der Gründung einer heute noch blühenden Schas-Chewra
beteiligt.
Als im Jahre 1853 in der neuerbauten Synagoge der hiesigen
Religionsgemeinden eine Orgel aufgestellt wurde, separierte sich eine kleine
Anzahl Orthodoxer und gründete die jetzige Religionsgesellschaft, an deren
Spitze der durch seine tiefe talmudische Gelehrsamkeit in den weitesten
Kreisen bekannte Rabbi Samuel Bondi das Gedenken an den Gerechten ist zum
Segen, Enkel von Rabbi Herz Scheuer das Gedenken an den Gerechten ist
zum Segen und Schwiegervater unseres teueren Verstorbenen, Rabbi Jakob
Levi das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen, Rabbi Moses Reis
das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen, und Rabbi Isak Fulda das
Gedenken an den Gerechten ist zum Segen, standen. Winzig und klein war
damals die Gesellschaft; das erste, was sie unternommen, war, dass sie Herrn
Dr. Lehmann, der gerade seien Studien vollendet hatte, an ihre Spitze als
Rabbiner berief, welcher 1854 am ersten Tag von Sukkot (Laubhüttenfest)
in einem engen Betlokale seine Antrittsrede hielt. Mit dem Beginne
seiner Rabbinatsfunktionen brachte Dr. Lehmann neues Leben in die hiesigen
religiösen Verhältnisse. Seine von echt religiösem Geiste durchdrungenen
Predigten, seine in Wort und Sinn formvollendete Rhetorik, die durch ein
angemessenes Organ erhöht wurde, seine (deutsch, danach hebräisch) von
Herzen kommenden und zu Herzen dringenden Worte erregten nicht nur die
Begeisterung seiner Gemeindemitglieder, sondern fanden auch bei Besuchern
der Reformsynagoge, welche zahlreich erschienen, um den hervorragenden
Kanzelredner zu bewundern, den größten Beifall. Wissend, dass die Erhaltung
des jüdischen Glaubens von der religiösen Erziehung der Jugend abhängt,
welche damals ganz verwahrlost war – konnten doch selbst Kinder von
talmudisch gebildeten Vätern nicht ein-. |
 mal
richtig hebräisch lesen - errichtete er alsbald eine Religionsschule, in
welcher die Schüler in der zur Verfügung stehenden ziemlich karg
zugemessenen Stundenzahl einen den Verhältnissen und vorhandenen Kräften
entsprechenden gediegenen hebräischen Unterricht in echt jüdischem Geiste
empfingen. Die Neuheit dieser religiösen Bestrebungen in hiesiger Gemeinde
hatte auch viele Anfeindungen und Kämpfe zur Folge; in Wort und Schrift
hatte Herr Dr. Lehmann der Angriffe des damaligen Gemeinderabbiners, Herrn
Dr. Aub, gar oft sich zu erwehren. mal
richtig hebräisch lesen - errichtete er alsbald eine Religionsschule, in
welcher die Schüler in der zur Verfügung stehenden ziemlich karg
zugemessenen Stundenzahl einen den Verhältnissen und vorhandenen Kräften
entsprechenden gediegenen hebräischen Unterricht in echt jüdischem Geiste
empfingen. Die Neuheit dieser religiösen Bestrebungen in hiesiger Gemeinde
hatte auch viele Anfeindungen und Kämpfe zur Folge; in Wort und Schrift
hatte Herr Dr. Lehmann der Angriffe des damaligen Gemeinderabbiners, Herrn
Dr. Aub, gar oft sich zu erwehren.
Durch seine Energie, seinen rastlosen Eifer für den Glauben, seine von aller
Welt bewunderte Liebenswürdigkeit - er liebte den Frieden und strebte dem
Frieden nach ...verstand er alle in den Weg gelegte Hindernisse zu
überwinden; von Jahr zu Jahr vermehrten sich seine Anhänger, wuchs die Zahl
der Mitglieder der Religionsgesellschaft und rang seinen Gegners Bewunderung
und die Anerkennung der Lebensfähigkeit der Religionsgesellschaft ab. Auch
die finanzielle Kraft der Religionsgesellschaft, welche die Besoldung ihrer
Beamten und die Kosten ihrer Institutionen aus nur freiwilligen Beiträgen
bestreiten musste, nahm zu, und es konnte die 1855 zur Erbauung einer
Synagoge schreiten, welche am 24. September 1856 feierlich eingeweiht wurde.
Im November 1859 gründete Dr. Lehmann eine Unterrichtsanstalt (Knaben- und
Mädchenschule) für den Unterricht in den religiösen und profanen
Disziplinen, die er in ihrer großen Wichtigkeit für die jüdische Religion
und den Bestand der Religionsgesellschaft stets sein 'liebstes Kind' zu
nennen pflegte. (Wir können es uns nicht versagen, bei dieser Gelegenheit an
den löblichen Vorstand und die geehrten Mitglieder das Ersuchen zu richten,
die Unterrichtsanstalt, die nach 1856 durch das Institut der einjährigen
freiwilligen Militärberechtigung einen schweren Standpunkt hatte, jetzt, wo
nach der offiziellen Rede des preußischen Kultusministers im preußischen
Abgeordnetenhause diese Einrichtung der einjährigen Militärberechtigung aus
den höheren Unterrichtsanstalten zu beseitigen beabsichtigt wird, dieses
§liebste Kind' ihres nunmehr heimgegangenen Rabbiners mit aller Kraft und
Aufbietung aller Mittel zu heben. Das wird das schönste und beste Denkmal
sein, das die Religionsgesellschaft ihrem hochverehrten dahingeschiedenen
Führer setzen kann. In Folge einer im Jahre 1857 stattgehabten
Pulverexplosion bekam die Synagoge starke Risse, die mit den Jahren Gefahr
drohend wurden, und da auch im Laufe der Zeit die Synagoge die zahlreichen
Mitglieder nicht mehr fassen konnte, wurde 1878/79 auf der Stelle der
abgerissenen Synagoge ein prachtvolles größeres Gotteshaus errichtet,
So war das epochemachende Wirken unseres unvergesslichen Rabbiners nach
Innen und Außen ein segensreiches, das ihm die ungeteilte Liebe und
Anerkennung aller Glaubensbrüder und die Hochachtung seiner Mitbürger
erwarb. Seine eminente, tief eindringende Gelehrsamkeit in dem weiten Meere
des Talmuds, in dem er viele Jahre hindurch Rabbinatskandidaten einführte,
erregten die Bewunderung der Fachmänner; trotz seiner vielseitigen
Beschäftigungen, die seine Zeit sehr in Anspruch genommen, unterzog er sich
der Mühe, die einen in Jerusalem im Manuskript aufgefunden, seither noch
nicht veröffentlichten Kommentar des Rabbi Joseph Syrileio zu Jeruschalmi
Berachoth nicht nur zu edieren, sondern auch dem Titel Meir nativ mit
Erläuterungen aus eigener Feder zu versehen.
Sein frühzeitiger Tod machte auch mehrere ihm seit Jahren vorschwebende
Pläne zunichte; so beabsichtigte er eine populär geschriebenen Kommentar
über den Pentateuch, eine leicht fassliche jüdische Geschichte, die das
tendenziöse Grätz’sche Geschichtswerk desavouieren sollte, zu verfassen.
Seine Wohltätigkeit gegen Arme ging weit über seine Vermögensverhältnisse,
seine Herzensgüte und sein Wohlwollen erstreckte sich über alle Menschen
ohne Unterschiede der Konfession; dabei war der große Mann von einer
unbeschreiblichen Demut beseelt, stets wich er jeder ihm zugedachten Ovation
aus, er duldete es nicht, dass man sein 25jähriges Amtsjubiläum feierte.
Wir könnten noch lange mit der Aufzählung seiner edlen Eigenschaften
fortfahren; wir müssen aber, um die Geduld unserer geehrten Leser nicht auf
die Probe zu stellen, zum Schlusse eilen und wollen nur noch den Wunsch
aussprechen, dass Gott in Seiner Gnade und Güte den Schmerz der trauernden
Hinterbliebenen mildern und ihnen Seinen heilsamen Trost verleihen möge!
er tröste euch inmitten des Restes der Trauernden Zions und Jerusalems.
Unser mit ewigem Ruhm bedeckte Rabbiner, Herr Dr. Lehmann das Gedenken an
den Gerechten ist zum Segen, weilet nun in den lichten Höhen, began
Eden (im Garten Eden) wo ihm der reichliche Lohn für seine vielen
verdienstvollen Taten zu teil werden wird, welcher von Gott, dem Allgütigen,
für die Frommen bestimmt ist. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens. |
 Rabbiner
Dr. Lehmann - er ruhe in Frieden. Rabbiner
Dr. Lehmann - er ruhe in Frieden.
Ein anderes Mitglied unserer Redaktion widmet, dem teuren Dahingeschiedenen
den folgenden Nachruf:
Mainz, 15. April. Was wir, und Tausende mit uns, seit Monaten in heißem
Gebete von Gottes Gnade zu hoffen wagten, ist uns seit gestern für immer
versagt worden.
Herr Rabbiner Dr. Lehmann ist nicht mehr! In der Blüte seines Lebens, im
59. Lebensjahre, hat er seine reine Seele ausgehaucht, nachdem seit längerer
Zeit ein hartnäckiges Herzübel seine Gesundheit so sehr gefährdet hatte,
dass er nur von einer ganz ungewöhnlichen Gnade Gottes eine Wendung zum
Besseren zu erhoffen war.
Gottes Ratschluss hat es anders beschlossen; und wohin die Kunde von dem
schweren, schweren Schlag, der uns und die ganze Judenheit betroffen hat,
gelangen wird, überall wird sie das Wort verwirklichen, mit dem unser
Wochenabschnitt den Tod der Söhne Aarons begleitet (hebräisch und deutsch):
'Euere Brüder, das ganze Haus Israels, werden den Brand beweinen, den
Gott angezündet.' (Hebräisch und deutsch): Wahrlich, wenn das Leid
der Talmide Chachamim betrifft, alle in Trauer versetzt, wer sollte dann
das Weh in seiner ganzen Tiefe ermessen welches diese Trauerbotschaft in die
großen, durch einen mehr dreißigjährigen Verkehr verbundenen,
gleichgesinnten Kreise tragen wird! War doch der Verblichene der geistige
Mittelpunkt aller dieser Kreise, er hatte sie geschaffen, ohne ihn vermag
man kaum, sie sich zu denken, und wir selber vermögen, obwohl auf die
Katastrophe vorbereitet, kaum die Tatsache zu fassen, die wir in Worte
kleiden möchten. Die Feder zittert, wenn sie diejenigen feiern möchte, der
sie an dieser Stelle, mit solcher eigenartigen Begabung und Hingebung, mit
solchem Geist und solchem Erfolg drei Jahrzehnte lang geführt hat!
Wenn unsere Weisen einen Geisteshelden und seine Aussprüche feiern wollen,
so verglichen sie ihn mit Moscheh. Moscheh schafir kamart (?). Und
wenn einer derselben die Bedeutsamkeit unseres großen Lehrers in einem
einzigen Zug zusammenfassen möchte, so knüpft er an die Worte: (hebräisch
und deutsch), da starb Moscheh, die drei Worte: (hebräisch und
deutsch): der große Wortführer Israels!
Auch in dem Heimgegangenen war das Wort und die Meisterschaft, in welcher er
es geführt, das mächtige, geistige Band, wodurch er zahllose Tausende
jüdischer Geister und Gemüter unauflöslich mit sich und der großen, heiligen
Sache verbunden hat, für welche er ein langes, reiches Leben lang gelebt und
gekämpft hat.
Wie das Wort aus seinem hohen Geiste und seinem edlen Herzen quillte, wie er
die Gediegenheit des Inhalts mit der ansprechenden, volkstümlichen, zu
Herzen sprechenden Form des Ausdrucks zu verbinden wusste, mochte er
belehren oder erzählen, verurteilen oder anerkennen, mochte er über
spezifisch jüdische oder allgemein wissenschaftliche Gegenstände sich äußern
dess(en) sind die Zeugnisse seiner Feder an dieser Stelle, laute,
wohlbekannte Zeugen. Wo gab es auch nur eine, der vielen Judentum und
Judenheit betreffenden Fragen, Anliegen und Bestrebungen, die nicht von ihm
mit unerreichbarer Meisterschaft behandelt und so weit dies möglich ist, mit
beispielloser Ruhe, Klarheit und Entschiedenheit auch erledigt wurden!
Was Rabbiner Dr. Lehmann seiner Zeit war, das wird keine Feder noch heute an
seiner warmen Leiche zu schildern, auch nur zu versuchen wagen. Dazu müsste
man dreißig Jahre zurückblicken, wo der Abfall im jüdischen Kreise seinen
Höhepunkt erreicht hatte, wo die Reform und ihre Presse die jüdische
öffentliche Meinung beherrschten, und er mit der Begründung des 'Israelit'
eine rettende Tat unternahm, deren bedeutsame Tragweite gar nicht hoch genug
angeschlagen werden kann. Mit welcher Wut, mit welcher Rücksichtslosigkeit
die Gegner des orthodoxen Judentums über diesen feinen, jugendlichen
Verfechter herfielen, wie sie ihn durch Schmähungen, Verleumdungen und
Entstellungen unmöglich zu machen suchten, und wie er mit kühn entflammter
Begeisterung allen Stürmen und Angriffen gegenüber nicht nur Stand hielt,
sondern dem geächteten und verlästerten orthodoxen Judentum und seinem
Zentralorgan, dem 'Israelit' , über- |
 all,
auch den erbittertsten Gegnern gegenüber die endliche Anerkennung abrang,
jedes dieser Momente erforderte eine besondere Darstellung, die einer
späteren Zeit vorbehalten bleiben muss. all,
auch den erbittertsten Gegnern gegenüber die endliche Anerkennung abrang,
jedes dieser Momente erforderte eine besondere Darstellung, die einer
späteren Zeit vorbehalten bleiben muss.
Was der 'Israelit' für die Sammlung und Erstarkung des gesetzestreuen
Judentums in allen fünf Erdteilen gewirkt hat, seine beispiellose
Wirksamkeit für das Heilige Land und seine Bewohner, die Tränen der
zahllosen Armen und Unglücklichen, die er durch seine Sammlung getrocknet,
sein mannhaftes Eintreten gegen alle Angriffe von judenfeindlicher Seite,
diese und hundert andere Momente in dem Leben und Streben des teueren und
unersetzlichen Verblichenen leben in dem Bewusstsein aller Brüder und
Schwestern auf weitem Erdenrund, denn sie haben ja eben das innige Band
freundschaftlicher und verehrungsvoller Anhänglichkeit zwischen den Lesern
des 'Israelit' und seinem Begründer gewoben, dass jetzt so plötzlich
zerrissen wurde.
Und doch kennt die Welt nur den Mann, wie er eben vor der großen Welt
erschien und erscheinen musste. Seine entschiedene, strenge, ernst
Vertretung dessen, was er als wahr erkannte, ließ diejenigen, die das Glück
hatten, ihm persönlich nahe zu stehen, kaum ahnen, welche reiche Fülle von
Güte und Milde, von Leutseligkeit und Menschenliebe in dem edlen Herzen
lebten und aus den treuen Augen leuchteten, die jetzt gebrochen sind! Der
Mann, der den Bannerträgern des Abfalls [den Anhängern des
Reformjudentums, Anm. S. R.] mit blanker Waffe und eherner Stirn
jederzeit kampfbereit entgegentrat, war die personifizierte Nachsicht und
Versöhnlichkeit den Gliedern seiner Gemeinde, seiner Familie, ja, jedem
Menschen gegenüber, ohne irgend welche Rücksicht auf das religiöse
Bekenntnis.
Sein Arbeitszimmer war unablässig ein Sammelplatz der Armen und die
Sanftmut, die wunderbare Geduld, die er ihnen mitten in seinen dringenden
zahlreichen Beschäftigungen zuwandte, waren geradezu ergreifend. Ein
einziges Mal hatte er einen Armen, dessen Zudringlichkeit selbst seine
Geduld zu Schanden machte, die Türe gewiesen. Aber wenige Stunden nachdem es
geschehen war, bereute er das Geschehene aus so vollem Herzen, dass er
überall umher schickte, um den Armen wieder rufen zu lassen um das Geschehen
wieder gutzumachen. Der Arme war aber nirgends zu finden. Nach vielen Jahren
kam derselbe wieder nach Mainz zu Herrn Dr. Lehmann. Dieser erkannte ihm
sofort und war ganz glücklich, ihn endlich um Verzeihung bitten zu können,
die ihm auch gewährt wurde. Lange Zeit kam dieser Mann dann alljährlich nach
Mainz und lebte dann jedes mal Wochen lang im Hause des Verblichenen, der
glücklich war, sein Unrecht auf diese Weise wiedergutgemacht zu haben.
Welch’ ein liebender Gatte er seiner Gattin, welch’ zärtlicher Vater er
seinen Kindern, welch’ besorgter Vater und Helfer er jedem einzelnen
Mitgliede seiner Gemeinde war, mit welcher väterlichen Innigkeit er vor
allem an seinen Schülern hing, das zu schildern versagt die zitternde Feder
den Dienst.
Von den Söhnen Aarons erzählt unser Wochenabschnitt: (hebräisch und
deutsch): 'Es ging ein Feuer von Gott aus und verzehrte sie, so dass sie
starben vor Gott.'
Das göttliche Feuer, das in dem Entschlafenen gelodert, an der er die Fackel
der Wahrheit entzündet und hineingeleuchtet hat in die Reihen seines Volkes,
dieses Feuer, das von Gott ausgeht, hat auch diesen seinen treuen Priester
verzehrt. Der aufregende, aufreibende Beruf, der Wortführer seines Volkes zu
sein, er war es, dem er zum Opfer gefallen ist. Die von diesem seinem Beruf
unvermeidlichen Aufregungen haben nach Versicherung der ihm näher Stehenden
die Krankheit gezeitigt und verschlimmert, dass sein großes Herz, das so
sehr in Liebe und heiliger Begeisterung zu unserer Tora schlug, den
Anstrengungen nicht länger Stand zu halten vermochte und gestern früh 10 Uhr
zu schlagen aufhörte.
Er ist im Dienst Gottes, vor Gott gestorben. Möge er die Ruhe und den
Frieden finden, für die er gerungen und gekämpft, möge sein Verdienst uns
beistehen, in seinem Geiste und seinem Sinne weiter zu leben und zu wirken,
bis Gott den Tod von dem Angesicht seines Volkes nehmen wird, wie es sein
Wort verheißen hat. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens."
Anmerkungen: - Bamberger:
https://de.wikipedia.org/wiki/Seligmann_B%C3%A4r_Bamberger
https://de.wikipedia.org/wiki/Moses_L%C3%B6b_Bamberger
https://de.wikipedia.org/wiki/Nathan_Bamberger
- Rabbiner Bamberger: Vgl.
Bericht zum Tod von Rabbiner Jacob Koppel Bamberger von 1864 (auf Seite
zu Worms).
- Rabbiner Naphtali Hirsch:
https://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Hirsch%2C%20Naphtali%2C%201844%2D1904
- Rabbiner Dr. N. Adler:
https://de.wikipedia.org/wiki/Nathan_Marcus_Adler
- Rabbiner Dr. Hildesheimer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Esriel_Hildesheimer
- Rabbiner Dr. Philippson:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Philippson
- Allgemeine Zeitung des Judentums:
https://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Zeitung_des_Judentums
- Schulchan Aruch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schulchan_Aruch
- Jeschurun:
https://de.wikipedia.org/wiki/Jeschurun
- Tewet:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tevet
- Rabbi Jecheskiel Landau:
https://de.wikibrief.org/wiki/Yechezkel_Landau bzw.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ezechiel_Landau
- Rabbi Dr. Israel Hildesheimer:https://de.wikipedia.org/wiki/Esriel_Hildesheimer
- Adass Jisroel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Israelitische_Synagogen-Gemeinde_Adass_Jisroel_zu_Berlin
- Rabbi Samuel Freund:
https://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Freund
- Rabbi Samuel Bondi: siehe
Berichte oben von 1877 zum Tod von Rabbiner Samuel Bondi
- Rabbi Herz Scheuer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Herz_Scheuer
- Rabbi Moses Reis:
https://de.wikipedia.org/wiki/Moses_Rei%C3%9F
- Rabbiner Dr. Aub:
https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Aub
- Pulverexplosion:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pulverturm_(Mainz) )
- Grätz:
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Graetz
- Moscheh:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mose
- Aaron:
https://de.wikipedia.org/wiki/Aaron_(biblische_Person)
- Pinchas:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pinchas_(Sohn_Eleasars)
- Elijahu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elija |
| |
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 18. April 1890: "Berlin, 15. April. Wie man aus Mainz
meldet, ist dort am 14. d(ieses) M(onats) nach längerem Leiden der Rabbiner
der orthodoxen Religionsgesellschaft Dr. Meir Lehmann im 59.
Lebensjahre gestorben. Dieser Todesfall wird nicht verfehlen, in den
Kreisen, denen der Verstorbene angehörte, tiefe Trauer hervorzurufen.
Lehmann war seit mehr als 30 Jahren der journalistische Vorkämpfer der
neuorthodoxen Richtung im Judentum. Sein Organ, 'Der Israelit', das er seit
1861 herausgab, hat in diesem Sinne gewirkt. Außerdem war Lehmann auch auf
belletristischem Gebiet tätig. Es existieren von ihm sechs Bände Novellen
und mehrere historische Romane. Innerhalb der Grenzen seiner religiösen
Weltanschauung hat er auf diesem Gebiete, unstrittig Begabung und Geschick
entwickelt. Der Verstorbene war ein eifervoller Mann, er hatte viel mehr von
Pinchas als von Elijahu an sich, aber sein Eifer entsprang doch frommem
Glauben, und darum mag auch ihn der Bund des Friedens umschließen. Uns
geziemt es nur, den Tod des in der Vollkraft seiner Mannesjahre so jäh
Dahingerafften zu melden; das Urteil über sein öffentliches Wirken lässt der
unerbittlich richtenden Geschichte zu. Möge dem Dahingeschiedenen die Erde
leicht sein." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 18. April 1890: "Berlin, 15. April. Wie man aus Mainz
meldet, ist dort am 14. d(ieses) M(onats) nach längerem Leiden der Rabbiner
der orthodoxen Religionsgesellschaft Dr. Meir Lehmann im 59.
Lebensjahre gestorben. Dieser Todesfall wird nicht verfehlen, in den
Kreisen, denen der Verstorbene angehörte, tiefe Trauer hervorzurufen.
Lehmann war seit mehr als 30 Jahren der journalistische Vorkämpfer der
neuorthodoxen Richtung im Judentum. Sein Organ, 'Der Israelit', das er seit
1861 herausgab, hat in diesem Sinne gewirkt. Außerdem war Lehmann auch auf
belletristischem Gebiet tätig. Es existieren von ihm sechs Bände Novellen
und mehrere historische Romane. Innerhalb der Grenzen seiner religiösen
Weltanschauung hat er auf diesem Gebiete, unstrittig Begabung und Geschick
entwickelt. Der Verstorbene war ein eifervoller Mann, er hatte viel mehr von
Pinchas als von Elijahu an sich, aber sein Eifer entsprang doch frommem
Glauben, und darum mag auch ihn der Bund des Friedens umschließen. Uns
geziemt es nur, den Tod des in der Vollkraft seiner Mannesjahre so jäh
Dahingerafften zu melden; das Urteil über sein öffentliches Wirken lässt der
unerbittlich richtenden Geschichte zu. Möge dem Dahingeschiedenen die Erde
leicht sein."
Anmerkung: in der liberalen "Allgemeinen Zeitung" fiel der Nachruf auf Dr.
Lehmann wesentlich kürzer aus als oben in der orthodoxen Zeitschrift "Der
Israelit". |
Beisetzung von Rabbiner Dr. Markus Lehmann
(1890)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. April
1890: "Das Leichenbegängnis Dr. Lehmann's. Das Gedenken an den
Gerechten ist zum Segen. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. April
1890: "Das Leichenbegängnis Dr. Lehmann's. Das Gedenken an den
Gerechten ist zum Segen.
Mainz, 16. April. 'Habt Ihr Tränen, so bereitet Euch, sei jetzo zu
vergießen'.
Wir mussten ihn der Erde übergeben, ihn, der unser Führer und Leiter, ihn,
der Euer Freund gewesen.
Für uns, seine langjährigen Mitarbeiter und Genossen, die wir so herzlich an
ihm gehangen, gibt es kaum einen Trost und doch, mitten in unserm höchsten
Gram, grade da, wo wir auf ewig von seiner irdischen Hülle Abschied nehmen
mussten, gesellte sich zu unserem Schmerze ein Gefühl des Stolzes und der
Genugtuung hinzu, dass wir diesen Mann zum Führer hatten, dass es uns
vergönnt war, unter seiner Fahne zu dienen, dass unsere Bestrebungen nicht
umsonst gewesen sein Leichenbegängnis war der Spiegel seiner Größe, in
welchem das Abbild seiner Erfolge sich kundgab. Unsere Weisen erzählen, dass
auch die Tora trauert, wenn der Gottesgelehrte scheiden muss; ja, hier stand
sie selbst, die Tora, in allen ihren großen Vertretern, geschart hatten sich
die Geistesheroen des Judentums um die Bahre liegende 'Krone Israels' zu
betrauern, um ihrem tapferen, mutigen, siegreichen Vorkämpfer die letzte
Ehre zu erweisen. Die zehnte Stunde des sechsundzwanzigsten Nissans war
ausersehen zu dem erschütternden Werke; doch schon bei Tagesanbruch füllte
sich das Trauerhaus mit Wehklagenden, die die Zeit nicht erwarten konnten,
noch einmal in der Nähe des teuren Dahingeschiedenen zu weilen.
Kurz vor 9 Uhr wurde mit den Leichenreden begonnen, und widmete die Herren
Jonas Bondi, ältester Schwager des Verstorbenen, Löwin aus
Frankfurt a. M., Lehrer Steckelmacher, Lipmann Prins aus Frankfurt a.
M., Rabbiner Bamberger aus
Aschaffenburg und Rabbiner Dr. Schiffer aus
Karlsruhe tiefempfundene Worte der Liebe und Anerkennung und Ausrufe des
herben Schmerzes dem im Sarge Ruhenden. Punkt zehn Uhr wurde die Bahre
erhoben. 'Da blieb kein Auge tränenleer'. Straßenweit erschollen die
markerschütternden Wehrufe und Verzweiflungsschreie derer, die ihn so heiß
geliebt.
Eine unabsehbare Menschenmenge wogte auf der Mittelstaße, der 'großen
Bleiche', während das Volk, Kopf an Kopf, in dichtem Gedränge auf dem langen
Wege Spalier bildete. In meisterhafter Ordnung mit entblößtem Haupte,
standen sie zu beiden Seiten da und machten der Polizei und der Gendarmerie,
die vollzählig aufgeboten war, die Arbeit leicht. |
 Dr.
Hildesheimer, Berlin, M. Bamberger,
Kissingen,
R. Bamberger,
Würzburg,
S. Bamberger, Aschaffenburg, D. J. M. Bondi, Wien, Dr. Breuer, Frankfurt a.
M., Dr. Buttenwieser, Straßburg i. E., Dr. Cahn,
Fulda ,
Dr. Deutsch,
Burgpreppach, Fromm, Frankfurt a. M., Dr. Jung,
Mannheim,
Dr. Kahn, Wiesbaden, Dr. Koref,
Hanau, Dr. Kottek,
Homburg, Dr. Marx,
Darmstadt, Dr. Munk,
Marburg, Dr. Plaut, Frankfurt a. M., Dr. Salfeld, Mainz, Dr. Salvendi,
Dürkheim, Dr. Sänger,
Bingen,
Dr. Schiffer,
Karlsruhe, Dr. Thein, Prag, Dr. Tawrogi,
Kreuznach, Dr. Weingarten,
Ems, die
Herren Schuldirektoren Dr. Barnaß,
Pfungstadt, Dr. Heinemann, Frankfurt a. M., Dr. Hirsch, Frankfurt a. M.
und Professor Leser,
Heidelberg. Diesen schlossen sich Geistliche der christlichen
Konfessionen, die Zivil- und Militärbehörden, die Direktoren, Professoren
und Lehrer der hiesigen Schulen, Direktoren der Eisenbahn und anderer
Verkehrsanstalten unserer Gegend an. Die Bürgermeisterei Mainz entschuldigte
in einem offiziellen Schreiben ihr Nichterscheinen damit, dass
Oberbürgermeister Dr. Oechsner verreist, der Beigeordnete Herr Reinach
erkrankt, die beiden anderen Beigeordneten Herren Dr. Gaßner und Dr. Geier
mit Dienstgeschäften stark belastet waren. Ebenso war Professor Roquette,
Darmstadt, einem Schreiben zufolge, wegen Unwohlsein zu erscheinen
verhindert.*) Dr.
Hildesheimer, Berlin, M. Bamberger,
Kissingen,
R. Bamberger,
Würzburg,
S. Bamberger, Aschaffenburg, D. J. M. Bondi, Wien, Dr. Breuer, Frankfurt a.
M., Dr. Buttenwieser, Straßburg i. E., Dr. Cahn,
Fulda ,
Dr. Deutsch,
Burgpreppach, Fromm, Frankfurt a. M., Dr. Jung,
Mannheim,
Dr. Kahn, Wiesbaden, Dr. Koref,
Hanau, Dr. Kottek,
Homburg, Dr. Marx,
Darmstadt, Dr. Munk,
Marburg, Dr. Plaut, Frankfurt a. M., Dr. Salfeld, Mainz, Dr. Salvendi,
Dürkheim, Dr. Sänger,
Bingen,
Dr. Schiffer,
Karlsruhe, Dr. Thein, Prag, Dr. Tawrogi,
Kreuznach, Dr. Weingarten,
Ems, die
Herren Schuldirektoren Dr. Barnaß,
Pfungstadt, Dr. Heinemann, Frankfurt a. M., Dr. Hirsch, Frankfurt a. M.
und Professor Leser,
Heidelberg. Diesen schlossen sich Geistliche der christlichen
Konfessionen, die Zivil- und Militärbehörden, die Direktoren, Professoren
und Lehrer der hiesigen Schulen, Direktoren der Eisenbahn und anderer
Verkehrsanstalten unserer Gegend an. Die Bürgermeisterei Mainz entschuldigte
in einem offiziellen Schreiben ihr Nichterscheinen damit, dass
Oberbürgermeister Dr. Oechsner verreist, der Beigeordnete Herr Reinach
erkrankt, die beiden anderen Beigeordneten Herren Dr. Gaßner und Dr. Geier
mit Dienstgeschäften stark belastet waren. Ebenso war Professor Roquette,
Darmstadt, einem Schreiben zufolge, wegen Unwohlsein zu erscheinen
verhindert.*)
Der Vorstand der israelitischen Religionsgemeinde Mainz war vollzählig
erschienen.
Unter den von auswärts entsandten Deputationen der Gemeinden bemerkten wir
die Vorstände der israelitischen Religionsgesellschaften
Bingen, Karlsruhe,
Köln, Darmstadt, Frankfurt a. M. und
Wiesbaden, einen Deputierten der
Gemeinde
Halberstadt sowie Vorstände vieler israelitischer Landgemeinden. Eine
große Anzahl israelitischer Lehrer aus der Nähe und Ferne war
herbeigeströmt. Die Herren Goldsmid und Jakob Roos zu Amsterdam vertraten
die Pekidim und Amarkalim der israelitischen Gemeinden im Heiligen Lande.
Ihnen folgte der Vorstand und Ausschuss der Religionsgesellschaft und eine
unabsehbare Menge, welche nicht nur aus den Mitgliedern der
Religionsgesellschaft bestand, sondern in welcher auch ein ansehnlicher Teil der hiesigen christlichen Einwohner
beider Konfessionen vertreten war. Nach einer halben Stunde gelangte die Tête des Zuges an den Friedhof, der sich bald füllte. Da die Leichenhalle
die Menge nicht fassen konnte, wurden die Reden am Sarge unter freiem Himmel
gehalten. Es sprachen die Herren Oscar Lehmann, der älteste Sohn des
Verstorbenen, Dr. J. H. Bondi, Neffe des Verstorbenen, im Namen der
israelitischen Religionsgesellschaft, Rabb. Dr. Salfeld aus Mainz, im
Namen des Vorstandes der israelitischen Religionsgesellschaft, Rabb. Dr.
J. Hildesheimer aus Berlin, Rabb. Dr. Salfeld aus Mainz, im Namen des
Vorstandes der israelitischen Religionsgemeinde, Rabb. Dr. Breuer aus
Frankfurt a. M., Rabb. Dr. Marx aus Darmstadt, Direktor Dr. M. Hirsch aus
Frankfurt a. M., Rabb. Dr. Horowitz aus Frankfurt a. M. und zum Schluss Dr.
Jonas Lehmann, zweiter Sohn des Dahingeschiedenen. Wegen eintretenden
Regenwetters konnten die noch vorgemerkten Herren Dr. Sänger, Bingen, Dr.
Koref, Hanau, der Talmudgelehrte Malina, Bensheim
nicht mehr zum Worte kommen, von denen, wie wir hören, einige im Laufe der
Trauerwoche im Trauerhaus dem Verstorbenen einen Nachruf widmen werden.**)
Es gebricht uns hier an Raum, den Inhalt, der am Grabe gehaltenen Reden auch
nur auszugsweise zu geben, wenn uns auch das Bedenken, durch einen Auszug
den Eindruck derselben abzuschwächen, von einem solchen Vorhaben nicht
zurückhalten würde. Wir werden deshalb dieselben, die stenografisch
aufgenommen sind, in möglichst kurzer Zeit in Extra-Beilagen zu unserem
Blatte ebenso die im Hause gesprochenen Reden, insofern sie uns druckfertig
eingesandt werden, veröffentlichen, um unseren Lesern ein bleibendes
Andenken an den Moment in die Hand u geben, in welchem sich so recht
deutlich offenbarte, wie viel Liebe der Verstorbenen gesät und wie viel Dank
und Anerkennung er geerntet.
'Und es gehen dir voran deine Frömmigkeit, und die Herrlichkeit des Ewigen
schließt deinen Zug' (Jesaja 58,8).
*) Von Rabbinen, Lehrern und Vorständen von Gemeinden und Vereinen, Freunden
und Anhängern des Verstorbenen, die zum Leichenbegräbins zu erscheinen
verhindert waren, gingen Hunderte von Beileidstelegrammen ein.
**) Bis Schluss der Redaktion haben die Rabbinen, Herren Dr. Thein, Dr.
Buttenwieser und Dr. Kahn Wiesbaden, Trauerreden gehalten.
Wie wir hören, werden bei dem Dienstag, den 22. bis nachmittags 6 Uhr, in
der Synagoge der israelitischen Religionsgesellschaft stattfindenden
Trauergottesdienst die Herren Dr. Sänger, Bingen, und Dr. Bondi, Wien,
Trauerreden halten. |
 Die
ungemein starke Beteiligung an den Leichenbegängnis, wie sie Mainz seit
Jahren nicht gesehen, die innige Teilnahme, die sich auf den Gesichtern
aller Teilnehmer ausdrückte, die Tränen, die über die Wangen selbst greiser
Männer rollten, legten ein lautes Zeugnis ab, dass alle empfanden, und es
tief fühlten, dass nicht nur ein bedeutender, dass auch ein edler Mensch
dahingegangen, dass nicht nur die Familie, dass die Gesamtheit einen
schweren Verlust erlitten. Das aber möge der trauernden Witwe, die so treu
ihm sein Leben hindurch zur Seite gestanden und sein Haus zu einem
gemütlichen Heim geschaffen und den hinterbliebenen Kindern zum größten
Troste dienen, denn ... Die
ungemein starke Beteiligung an den Leichenbegängnis, wie sie Mainz seit
Jahren nicht gesehen, die innige Teilnahme, die sich auf den Gesichtern
aller Teilnehmer ausdrückte, die Tränen, die über die Wangen selbst greiser
Männer rollten, legten ein lautes Zeugnis ab, dass alle empfanden, und es
tief fühlten, dass nicht nur ein bedeutender, dass auch ein edler Mensch
dahingegangen, dass nicht nur die Familie, dass die Gesamtheit einen
schweren Verlust erlitten. Das aber möge der trauernden Witwe, die so treu
ihm sein Leben hindurch zur Seite gestanden und sein Haus zu einem
gemütlichen Heim geschaffen und den hinterbliebenen Kindern zum größten
Troste dienen, denn ...
Anmerkungen: - Israel (hier): jüdische Gemeinschaft
- Nissan:
https://de.wikipedia.org/wiki/Nisan_(Monat)
- Lipmann Prins:
https://en.wikipedia.org/wiki/Eliezer_Liepman_Philip_Prins
- Rabbiner Bamberger: Rabbiner Simon Bamberger
http://www.alemannia-judaica.de/aschaffenburg_texte.htm#Anerkennung für
Rabbiner Bamberger (1893)
- Rabbiner Dr. Schiffer:
https://stadtlexikon.karlsruhe.de/index.php/De:Lexikon:bio-0617
- Rabbiner Dr. Hildesheimer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Esriel_Hildesheimer
- Rabbiner Dr. Breuer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Salomon_Breuer
- Rabbiner Dr. Buttenwieser:
https://www.marchivum.de/de/juedischer-friedhof/f1-a-07-01-buttenwieser-josef
- Rabbiner Fromm:
https://freilandmuseum.de/entdecken/neuigkeiten-und-blogs/einzeleintrag/seligmann-pinchas-fromm
- Rabbiner Dr. Kottek:
https://www.alemannia-judaica.de/bad_homburg_rabbinat.htm#Zum Tod von
Rabbiner Dr. Heymann Kotteck (1912)
- Rabbiner Dr. Munk:
https://www.alemannia-judaica.de/marburg_texte.htm#Nachruf zum Tod von
Rabbiner Dr. Leo Munk (1917)
- Rabbiner Dr. Plaut:
https://frankfurter-personenlexikon.de/node/8483
- Rabbiner Dr. Salfeld:
https://de.wikipedia.org/wiki/Siegmund_Salfeld
- Rabbiner Dr. Salvendi:
https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Salvendi
- Rabbiner Dr. Sänger: Rabbiner Dr. Hirsch Napthali Zwi Sänger, geb.
1843 in Buttenwiesen, gest. 1909)
http://steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/bhr?id=2542&suchename=Sänger
- Rabbiner Dr. Schiffer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sinai_Schiffer
- Rabbiner Dr. Tawrogi:
https://www.jewiki.net/wiki/Abraham_Tawrogi
- Oberbürgermeister Dr. Oechsner:
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Oechsner
- Professor Roquette:
https://www.darmstadt-stadtlexikon.de/r/roquette-otto.html und
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Roquette
- Rabb. Dr. M. Hirsch:
- Rabb. Dr. Horowitz: |
 Stenografischer
Bericht der an der Bahre Dr. Lehmanns - das Gedenken an den Gerechten
ist zum Segen - gehaltene Reden Stenografischer
Bericht der an der Bahre Dr. Lehmanns - das Gedenken an den Gerechten
ist zum Segen - gehaltene Reden
I. Herr Oscar Lehmann, der älteste Sohn des Verblichen und
langjähriger Mitarbeiter aus 'Israelit', eröffnete die Reihen der
Trauerreden mit folgenden Worten:
Mein geliebter, teurer Vater! So ist es denn wirklich wahr, dass ich Deine
weisen Worte nicht mehr hören darf? Darf ich Dich in wichtigen
Angelegenheiten nicht mehr um Rat fragen? Wirst Du Deine Hände nicht mehr
auf mein Haupt legen? Du guter Vater! Bist Du wirklich fortgenommen von mir?
Ich kann es nicht fassen, nicht tragen, ich möchte weinen, bis dass das Herz
mir bricht!
Geehrte Trauer-Versammlung!
Was mein dahingegangener Vater für das Judentum geleistet, besonders für das
gesetzestreue, das ist nicht meine Aufgabe, hier zu schildern. Es ist auch
nicht meine Aufgabe, seine umfassende Tätigkeit in Gemeinde, in Schule, im
Bezug auf Wohltätigkeit und andere hohe Dinge darzulegen. Sein Wirken wird
der Geschichte angehören. Er wird nicht vergessen werden, so lange Juden auf
dem Erdenboden leben. Der Name Dr. Lehmann wird immer bekannt sein. Was ich
hier sagen will, ist nur das, was er uns gewesen ist, seiner Familie, meiner
teueren Mutter, meinen geliebten Geschwistern und mir..."
zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken. Der stenographische
Bericht umfasst weitere Nachrufe, die hier nicht alle wiedergegeben werden
können." |
Trauergottesdienst für Rabbiner Dr. Lehmann
(1890)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. April
1890: "Mainz, 23. April. Gestern Nachmittag 6 Uhr fand
in der Synagoge der israelitischen Religionsgemeinschaft der bereits in
voriger Nummer von uns angezeigte Trauergottesdienst (Hesped -
Trauerrede) für Herrn Rabbiner Dr. Lehmann – das Andenken an
den Gerechten ist zum Segen – statt. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. April
1890: "Mainz, 23. April. Gestern Nachmittag 6 Uhr fand
in der Synagoge der israelitischen Religionsgemeinschaft der bereits in
voriger Nummer von uns angezeigte Trauergottesdienst (Hesped -
Trauerrede) für Herrn Rabbiner Dr. Lehmann – das Andenken an
den Gerechten ist zum Segen – statt.
Voll Wehmut und tiefsinniger Trauer betraten wir das schwarz drapierte und
in all seinen Räumen von Mitgliedern der Religionsgesellschaft (Männern und
Frauen), der Religionsgemeinde, nichtjüdischen Mitbürgern und Fremden und
Verehrern des Verstorbenen aus den Nachbarstädten gefüllte Gotteshaus, um
von der Stätte, wo wir so oft den geistreichen und begeisternden Worten
unseres Rabbiners - sein Verdienst komme uns zugute -, seinen ernsten
Ermahnungen gelauscht, einen Nachruf über sein Leben und Wirken zu
vernehmen.
Die beiden Redner, die Herren Dr. Sänger, Rabbiner der israelitischen
Religionsgesellschaft
Bingen,
einer der ältesten Schüler des Dahingeschiedenen und langjähriger treuer
Mitarbeiter am 'Israelit' und Rabbiner Dr. J. M. Bondi, Wien, Neffe
Dr. Lehmanns – das Andenken an den Gerechten ist zum Segen – waren
durch ihre persönlichen Beziehungen zu dem Verstorbenen in der Lage, nicht
nur von Dr. Lehmanns großer Wirksamkeit für das Gesamtjudentum, sondern auch
von seinen bedeutenden Leistungen in der Religionsgesellschaft ein treues
Bild zu geben, und dieser Aufgabe wurden beide Herren in einer Weise
gerecht, welche ihres tiefsten Eindrucks nicht verfehlte. Man merkte es den
Rednern an, dass ihre tief empfundenenen Werte der Begeisterung und der
Trauer das Resultat ihrer eigenen Anschauungen und eigenen
Erlebnissen und sie sich auch bewusst waren, vor einer Zuhörerschaft zu
sprechen, die kompetent ist, diese Worte auf ihren wahren Grund zu prüfen
und zu beurteilen, weil auch sie das von den Rednern Geschilderte miterlebt
und mitangesehen hat. Und wahrlich, die Herren DDr. Sänger und Bondi haben
nicht zu viel gesagt; sie haben mit ihren Reden den Mitgliedern der
Religionsgesellschaft, welche von den überaus großen und schmerzlichen
Verlust ihres Rabbiners durchdrungen sind, aus dem Herzen gesprochen, dass
bezeugten die Tränen, die so reichlich flossen, davon gaben der Ernst und
die Trauer der Anwesenden Kunde.
Wir versagen uns, die Reden der beiden Herren Rabbiner auch nur im Auszuge
zu geben, weil dieselben demnächst in Extra-Beilagen zu diesen Blättern
veröffentlicht werden.*)
Beide Redner drückten zum Schlusse den Wunsch aus, dem auch wir uns voll und
ganz anschließen, dass die Religionsgesellschaft bald einen dem großen
Verstorbenen würdigen Nachfolger an ihre Spitze stelle, der tatkräftig die
Gemeinde nach den Intentionen Dr. Lehmanns – das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen – auch fernerhin leite und führe (als einer,)
der hinauszieht vor ihnen her und der kommt vor ihnen her.
Herr Kantor Oppenheimer brachte zwischen den beiden Reden das el
male rachamim mit seiner wundervollen Stimme in tief empfundenem Vortrag
zum vollen Ausdruck."
Anmerkung: - El male rachamim siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/El_male_rachamim |
Zum
Tod von Therese Lehmann geb. Bondi, Witwe von Rabbiner Dr. Markus Lehmann (1899)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 13. Januar 1899: "In Mainz ist am 2. des Monats die Witwe
des Rabbiners Dr. Marcus Lehmann, Frau Therese Lehmann, geb. Bondi,
eine fromme, brave und allgemein geachtete Frau, im 70. Lebensjahre
gestorben." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 13. Januar 1899: "In Mainz ist am 2. des Monats die Witwe
des Rabbiners Dr. Marcus Lehmann, Frau Therese Lehmann, geb. Bondi,
eine fromme, brave und allgemein geachtete Frau, im 70. Lebensjahre
gestorben." |
Dr. Jonas Marcus Bondi wird zum Rabbiner der Religionsgesellschaft
gewählt (1890)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
5. Mai 1890: "Mainz, 4. Mai. In der heutigen Generalversammlung
der israelitischen Religionsgesellschaft wurde Herr Dr. Jonas M. Bondi
- sein Licht leuchte -, Wien, Neffe und Schüler unseres
unvergesslichen Rabbinen Herrn Dr. Lehmann – das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen – mit allen gegen vier Stimmen zum Rabbiner der
Religionsgesellschaft erwählt. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
5. Mai 1890: "Mainz, 4. Mai. In der heutigen Generalversammlung
der israelitischen Religionsgesellschaft wurde Herr Dr. Jonas M. Bondi
- sein Licht leuchte -, Wien, Neffe und Schüler unseres
unvergesslichen Rabbinen Herrn Dr. Lehmann – das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen – mit allen gegen vier Stimmen zum Rabbiner der
Religionsgesellschaft erwählt.
Es war einer der letzten Wünsche des Herrn Dr. Lehmann – das Andenken an
den Gerechten ist zum Segen – dass die Rabbinerwahl sofort stattfinden
möge.
Die Religionsgesellschaft hat alle Berechtigung zu erwarten, dass der
neugewählte Rabbiner dem der Ruf eines bedeutenden Talmudgelehrten
vorangeht, dem Vorbild seines großen Vorgängers folgen und eine
ersprießliche Tätigkeit zur Erhaltung, Erweiterung dessen entfalten wird,
was unser teurer Rav - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen -
mit so großer Ausdauer und so glücklichem Erfolg geschafft hat.
Herr Rabbiner Dr. Bondi ist auch ein ausgezeichneter Schüler von
Herrn Rabb. Dr. Hildesheimer, Berlin und Herrn Rabb. Dr. Breuer,
Frankfurt a. M..
Wir begrüßen es mit hoher Befriedigung, dass es dem jungen Herrn Rabbinen
vergönnt ist, an der Stelle tätig zu sein, an der seine großen Ahnen, Rabbi
Herz Scheuer – das Andenken an den Gerechten ist zum Segen – und
Rabbi Samuel Bondi – das Andenken an den Gerechten ist zum Segen –
für unsere heilige Sache gewirkt haben."
Anmerkungen: - Rabbiner Dr. Hildesheimer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Esriel_Hildesheimer
- Rabb. Dr. Breuer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Salomon_Breuer
- Rabbi Herz Scheuer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Herz_Scheuer
- Rabbi Samuel Bondi: siehe
oben Artikel von 1877 |
Rabbiner Dr. Jonas Marcus Bondi tritt seine Stelle als Rabbiner
der Religionsgesellschaft an (1890)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Mai
1890: "Mainz, 22. Mai. Heute Nachmittag traf Herr Dr. J. Bondi
aus Wien, der neuerwählte Rabbiner der israelitischen Religionsgesellschaft,
in hiesiger Stadt ein. In
Darmstadt von einer Deputation des Vorstandes und Ausschusses, welche
ihm dahin entgegen gereist, begrüßt und am hiesigen Zentralbahnhof von einer
anderen Deputation und von Mitgliedern der Gemeinde feierlich empfangen,
fand abends 7 Uhr in der hellerleuchteten und blumengezierten Synagoge die
Einführung desselben in sein Amt statt. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Mai
1890: "Mainz, 22. Mai. Heute Nachmittag traf Herr Dr. J. Bondi
aus Wien, der neuerwählte Rabbiner der israelitischen Religionsgesellschaft,
in hiesiger Stadt ein. In
Darmstadt von einer Deputation des Vorstandes und Ausschusses, welche
ihm dahin entgegen gereist, begrüßt und am hiesigen Zentralbahnhof von einer
anderen Deputation und von Mitgliedern der Gemeinde feierlich empfangen,
fand abends 7 Uhr in der hellerleuchteten und blumengezierten Synagoge die
Einführung desselben in sein Amt statt.
Nachdem das Mincha-Gebet verrichtet, zog Herr Rabbiner Dr. Bondi vom
Vorstande und Ausschuss begleitet, unter den Klängen des vom Chor gesungenen
baruch haba, in das Gotteshaus ein. Der Präses des Vorstandes, Herr
Leo Leser, richtete zunächst an den Rabbiner eine Ansprache mit
welcher er die Hoffnung und Erwartung aussprach, dass Herr Dr. Bondi dem
Beispiele seines großen Vorgängers, Herrn Dr. Lehmann – das Andenken an
den Gerechten ist zum Segen – folgend, in Wort und Tat eine
ersprießliche und segensreiche Wirksamkeit für die religiösen Interessen der
Religionsgesellschaft und deren Institutionen entfalten und namentlich der
Unterrichtsanstalt seine besondere Sorgfalt widmen möge.
Herr Dr. Bondi hielt hierauf seine Antrittsrede und betonte, dass er in
tiefer Wehmut die Kanzel betrete, von wo aus sein teurer und unvergesslicher
Lehrer, Herr Dr. Lehmann – das Andenken an den Gerechten ist zum Segen
– in beredter Weise zu seiner Gemeinde gesprochen; er (Dr. B.) habe gehofft,
wenn er als Rabbiner in Amt trete, noch eine Reihe von Jahren der Ratschläge
und Lehren Dr. Lehmanns sich erfreuen zu dürfen, unseres Lebens Odem, von
dem wir sprachen: in seinem Schaffen werden wir leben (Klagelieder 4,20)
nach Gottes weisen Ratschlüssen, aber sei er zu frühe für ihn, seine
Gemeinde und das ganze Judentum von seiner irdischen Laufbahn abberufen
worden.
Der großen Verantwortlichkeit sich bewusst und von der schweren Aufgabe
durchdrungen, die seiner als dem Nachfolger eines so großen und
weltberühmten Mannes harret, wisse er wohl, dass er die durch Dr. Lehmanns
Tod entstandene große Lücke nur schwer und in ihrer Ausdehnung nicht ganz
auszufüllen im Stande sein werde, denn nicht jeder besitze Dr. Lehmanns
Geistes- und Tatkraft, doch aber bringe er in seinem Amte und in der
Gemeinde, wo der große Mann nicht mehr weilt, (zweimal hebräisch und
deutsch), das ernste Bestreben mit, ein Mann zu sein, er
werde mit seinem Wollen und Können die ihm als geistlicher Führer
anvertraute Gemeinde ,in welcher von jeher seine berühmten Vorfahren
segensreichen Einfluss ausgeübt und die Fahne der Tora hochgehalten
haben, und in der seinen heiligen Beruf auszuüben, er darum um so mehr sich
freue, auf dem richtigen Pfade nach den Vorschriften unserer heiligen
Religion zu leiten und zu lenken sich bemühen.
Redner schloss seine mit großem Beifall aufgenommene Predigt mit einem Gebet
in welchem er den Segen Gottes für den Großherzog und die Großherzogliche
Familie, die Staatsregierung, die Regierungs- und Staatsbehörden, die
Vorsteher und Mitglieder der Religionsgesellschaft erflehte.
Nachdem vom Chor der 150. Psalm gesungen, war mit dem Maariv-Gebete,
die erhebende und auf die zahlreiche Zuhörerschaft ihren tiefen Eindruck
nicht verfehlende Feier beendigt.
Anmerkungen: Leo Leser: Siehe
Artikel von 1900
zu seinem Tod
Großherzog:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_IV._(Hessen-Darmstadt) |
Artikel von Rabbiner Dr. Lehmann: "War dem Rabbi Amnon
von Mainz das Gaslicht bekannt?" (Artikel von 1900)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 31. Mai 1900: "War dem Rabbi Amnon von Mainz das Gaslicht bekannt?*) Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 31. Mai 1900: "War dem Rabbi Amnon von Mainz das Gaslicht bekannt?*)
Von Rabbiner Dr. M. Lehmann – das Andenken an den Gerechten ist zum Segen
In einem alten historischen Werke, Schalscheleth ha Kabbalah, dessen
Verfasser vor mehr als 150 Jahren lebte, wird eine Erzählung mitgeteilt, die
vermuten lässt, dass eine der herrlichsten Erfindungen der Neuzeit, das
Gaslicht, bereits vor mehr als acht Jahrhunderten einem Rabbiner in Mainz
bekannt gewesen sei. Rabbi Amnon, der durch seinen Märtyrertod berühmte
Verfasser des Unetaneh Tokef lebte um die Mitte des 11. Jahrhunderts (1050) zu Mainz und
war ein in jeglicher Wissenschaft erfahrener Mann. Man wusste, dass er stets
zum Freitagabende ein Licht anzündete, welches ohne Öl fortwährend brannte,
bis er es am folgenden Freitage auslöschte, um es wieder anzuzünden. Diese
Tatsache hatte ihm den Ruf eines Zauberers zugezogen. Einst kam ein
mächtiger Fürst nach Mainz, hörte von dem wunderbaren Lichte und wünschte
dasselbe zu sehen, da es aber der Rabbi geheim hielt, beschloss der Fürst,
ihn des Abends bei demselben zu überraschen. In jener Zeit herrschte die
Unsitte, dass ausgelassene junge Leute nachts an die Häuser der Juden
klopften und nicht eher nachließen, bis man ihnen etwas verabreicht hatte.
Um sich vor solchen lästigen Besuchern zu schützen und um nicht in seinen
tiefsinnigen Studien gestört zu werden, hatte Rabbi Amnon, der auch in der
Mechanik erfahren war, an seiner Haustüre eine Maschinerie angebracht, eine
Art Prügelmaschine - die den Klopfenden derb züchtigte, sobald Rabbi Amnon
im Innern seines Studierzimmers eine Feder drückte.
Der Fürst kam also mit seinem Gefolge, ließ klopfen und der Klopfer ward
alsobald – geklopft. Als sich aber das Klopfen wiederholte, merkte Rabbi
Amnon, dass hier kein gewöhnlicher Gassenbubenstreich beabsichtigt werde: Er
öffnete die Türe und fand zu seinem Erstaunen den Fürsten an seiner
Schwelle. Dieser eilte in das Haus und fand das vielbesprochene Licht.
Während er dasselbe betrachtete, fragte Rabbi Amnon nach seinem Begehr. 'Ich
habe gehört, dass du ein großer Zauberer seiest und finde hier den Beweis in
diesem Lichte, das ohne Öl brennt.' Da sprach der Rabbi: 'Mein Herr und
Fürst, ich bin kein Zauberer, aber ich bin tief eingedrungen in die
Naturwissenschaften und habe einen nicht sichtbaren Stoff gefunden, welcher
brennt wie Öl.' Noch lange unterhielt sich der Fürst mit dem Weisen über
manch unbekannte Naturkraft und zog ihn später noch oft zu Rate.
Wie viele wichtige Erfindungen mag der Aberglaube des Mittelalters, der die
Erfinder als Zauberer verschrie, gleich bei ihrem Entstehen vernichtet
haben!"
*) Aus 'israelitische Schulbibliothek', ein Zentralorgan für Synagoge,
Schule und Haus. In Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben von K.
Klein Mainz 1859
Anmerkung: -
Rabbi Amnon von Mainz:
https://de.wikipedia.org/wiki/Amnon_von_Mainz
- Unetaneh tokef: https://de.wikipedia.org/wiki/Unetaneh_tokef
|
Jahrzeitstag von Rabbiner Dr. Lehmann
(1904)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April
1904: "Zum Jahrzeitstage von Dr. Lehmann – das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April
1904: "Zum Jahrzeitstage von Dr. Lehmann – das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen
Mainz, 10. April. Vor unseren Augen haben die Toravorlesungen
der letzten Wochen das Heiligtum plastisch erstehen lassen. Mit kunstgeübter
Hand hatten Bezalel und Oholiah und alle die Kunstverständigen und Weisen in
Israel gefertigt und hergestellt alle die herrlichen Gegenstände, dem
Dienste des Höchsten geweihet; in edlem Wetteifer hatten Männer und Frauen,
Alte und Junge sich bemüht, zu arbeiten, zu spenden, mitzuhelfen, auf dass
in Wirklichkeit das Stiftszelt zu einem Nationalheiligtum werde. Nun war
alle Arbeit vollendet, alles geschehen, genau, wie der Herr es befohlen und
gezeigt und Moscheh stellte das Heiligtum auf, das nun geweihet und
geheiligt werden sollte, auf dass es fürderhin weihe und heilige. Und der
Ewige verkündete Lehre und Gesetz des Opferdienstes, Aharon und seine vier
Söhne mit diesem heiligen Priesteramte betrauend. 'Und es gingen Moscheh und
Aharon in das Stiftszelt, und da sie wieder heraustraten und das Volk
segneten, da erschien des Ewigen Herrlichkeit dem ganzen Volke, und es ging
Feuer aus von dem Ewigen und verzehrte auf dem Altare das Emporopfer und die
Fettstücke, da das Volk solches sah, jauchzten sie und feilen nieder auf ihr
Angesicht'. (3. Buch Mose, 9, 23).
Aber mitten in diesem allgemeinen Jubel des freudigen Volksfestes fällt der
düstere Schatten eines traurigen Ereignisses: Die Söhne Aharons, Nadah und
Awihu müssen plötzlich ihr junges Leben lassen. Auch uns überkommt
alljährlich nach Schluss des Pessachfestes tiefe Wehmut, denn noch nicht
vernarbt sind die Wunden, die uns das Pessachfest 5660 geschlagen, dass
unser geliebter Vater auf das Sterbelager geworfen wurde, von dem er am 24.
Nissan zur ewigen Ruhe hinweg gehoben wurde.
Man ist hie und da mit der Frage an uns herangetreten, mit welcher
Berechtigung wir alljährlich einen weiteren Kreis an unserem Jahrzeittage
teilnehmen lassen, man verkenne gewiss die Verdienste Dr. Lehmanns um das
gesetzestreue Judentum nicht, aber es gäbe so viele bedeutende Männer, die
im Laufe der Zeiten dahingegangen, denen man nicht alljährlich ein
Erinnerungsblatt weihe. Wir haben auf diese Fragen stets geantwortet, dass
wir viel weniger der Bedeutung Dr. Lehmanns halber das Gedenken an ihn mit
jeder Wiederkehr seines Sterbetages auffrischen, als vielmehr wegen der
erzieherischen Wirkung, die in dem Vergegenwärtigen seiner segensreichen
Tätigkeit liegt. Wie kein anderer in dem jüngsten Jahrzehnte heimgegangenen
Großen ragt das Wirken Dr. Lehmanns in unsere Zeit hinein, ja, wie notwendig
wäre noch heute sein Auftreten!
Wenn wir sehen, wie heute wieder, wie vor vierzig Jahren die Orgel zum
Schlachtruf in den jüdischen Gemeinden wird, wie der Abfall von Tora und
Mitzwot stets weiter um sich greift, dann wünschten wir einen Dr. Lehmann
herbei, der mit heiligem Ernst oder beißender Satire die Irrenden wieder auf
den rechten Weg leitet.
Und diese Erwägungen geben uns die Berechtigung, in jedem neuen Jahre seiner
in Liebe in diesen seinen Blättern zu gedenken."
Anmerkungen: - Heiligtum:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mischkan
- Bezalel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezalel
- Aharon:
https://de.wikipedia.org/wiki/Aaron_(biblische_Person)
- Nissan:
https://de.wikipedia.org/wiki/Nisan_(Monat)
- Mitzwot: Plural von Mitzwa
https://de.wikipedia.org/wiki/Mitzwa |
25-jähriges Ortsjubiläum von Rabbiner Dr. Jonas Marcus Bondi bei
der Religionsgesellschaft (1915)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. April
1915: "Mainz, 30. April. Am 14. Ijar waren 25 Jahre
verflossen, seitdem Herr Rabbiner Dr. Bondi zum geistigen Führer der
hiesigen 'Israelitischen Religionsgesellschaft' berufen wurde. Die große
Schar der Verehrer, Freunde und Schüler des verdienstvollen Mannes würde gar
zu gerne diesen Tag des Gedenkens zu einem Jubelfeste gestaltet haben, hätte
der Jubilar selbst nicht mit aller Entschiedenheit unter Berufung auf die
Anschauungen seines großen Vorgängers – das Andenken des Gerechten ist zum
Segen – sich jede Festfeier strengstens verbeten. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. April
1915: "Mainz, 30. April. Am 14. Ijar waren 25 Jahre
verflossen, seitdem Herr Rabbiner Dr. Bondi zum geistigen Führer der
hiesigen 'Israelitischen Religionsgesellschaft' berufen wurde. Die große
Schar der Verehrer, Freunde und Schüler des verdienstvollen Mannes würde gar
zu gerne diesen Tag des Gedenkens zu einem Jubelfeste gestaltet haben, hätte
der Jubilar selbst nicht mit aller Entschiedenheit unter Berufung auf die
Anschauungen seines großen Vorgängers – das Andenken des Gerechten ist zum
Segen – sich jede Festfeier strengstens verbeten.
Die Vielseitigkeit der Leistungen Rabbiner Dr. Bondis, der in Schule und
Gemeinde, auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege und wie der Klallarbeit (=
Gemeindearbeit) im Großen, als Schriftsteller und als befruchtender Anreger
auf dem Felde der jüdischen Wissenschaft in den Dezennien seiner Wirksamkeit
Großes und Dauerndes geschaffen hat, spricht für sich selbst und bedarf im
Kreise der Zeitgenossen keiner besonderen Darstellung (Wir rufen unserem
geschätzten Mitarbeiter ein herzliches - und in deinem Schmucke brich
auf, fahr einher für die Sache der Wahrheit (Psalm 45,5) - zu. Redaktion
der 'Israelit'.)"
Anmerkung: - Ijar:
https://de.wiktionary.org/wiki/Ijjar |
Todesanzeige für Rabbiner Dr. Jonas Marcus Bondi
(1929)
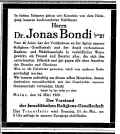 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März
1929: "In tiefem Schmerz geben wir Kenntnis von dem Heimgang unseres
hochverehrten Rabbiners Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März
1929: "In tiefem Schmerz geben wir Kenntnis von dem Heimgang unseres
hochverehrten Rabbiners
Herrn Dr. Jonas Bondi – das Andenken an den Gerechten ist zum
Segen
Fast 40 Jahre hat der Verblichene an der Spitze unserer
Religionsgesellschaft und der damit verbundenen Knaben- und Mädchenschule in
vorbildlicher Weise gewirkt, ein Freund und Berater aller, die sich ihm
anvertrauten, hilfreich und gut gegen alle, ohne Ansehen des Standes und
Glaubens.
Was er als Gelehrter gewesen, wird von anderer Seite gewürdigt werden.
Wir trauern aufrichtig um diesen edlen Menschen, dessen Andenken
unauslöschlich mit der Geschichte unserer Gemeinschaft verbunden bleibt
Sein Verdienst komme uns und ganz Israel zugute.
Mainz, den 14. März 1929. Der Vorstand der Israelitischen
Religionsgesellschaft
Eine Trauerfeier wird Sonntag, 24. des Monats, um 5 Uhr mittags in
unserer Synagoge stattfinden." |
Ausschreibung der Stelle des Rabbiners der Israelitischen Religionsgesellschaft
(1929)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
10. Mai 1929: "In unserer Religionsgesellschaft soll die Stelle eines Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
10. Mai 1929: "In unserer Religionsgesellschaft soll die Stelle eines
Rabbiners
dem auch die Leitung unserer Elementarschule obliegt, alsbald wieder belegt
werden. Gehalt nach Übereinkunft. Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf
werden bis zum 24. Mai 1929 erbeten.
Der Vorstand der Israelitischen Religionsgesellschaft Mainz." |
Rabbinerwahl der Israelitischen Religionsgesellschaft in Mainz (1929)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
12. September 1929: "Rabbinerwahl in Mainz. Mainz, 9.
September. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
12. September 1929: "Rabbinerwahl in Mainz. Mainz, 9.
September.
Zum Rabbiner der Israelitischen Religionsgesellschaft wurde an Stelle des
heimgegangenen Dr. Jonas Bondi – das Andenken an den Gerechten ist zum
Segen -, Herr Rabbiner Dr. Moses Bamberger, zweiter Sohn des
Herrn Rabbiner Dr. (sc. Isaak Selig) Bamberger,
Kissingen fast einstimmig gewählt.
Herr Rabbiner Dr. M. Bamberger hat sich sein talmudisches Wissen zum größten
Teile auf litauischen Jeschiwaus erworben und wird allgemein als Talmid
Chacham (Gelehrter), wie als Mann von reifem profanen Wissen und innerem
Feuer für die Tora und ... geschätzt."
Anmerkung: - Rabbiner Dr. Moses Bamberger (1902-1960):
http://www.steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/bhr?id=1987&suchename=Bamberger
- Jeschiwaus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Jeschiwa |
Jahrestag des Todes von Rabbiner Dr. Jonas Bondi (1930)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13.
März 1930: "Zum Andenken an Rabbiner Dr. Bondi. Trauerfeier in Mainz Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13.
März 1930: "Zum Andenken an Rabbiner Dr. Bondi. Trauerfeier in Mainz
Zu Ehren ihres vor Jahresfrist heimgegangenen Raws, Dr. Jonas Bondi – das
Andenken an den Gerechten ist zum Segen – veranstaltete die Mainzer
Israelitische Religionsgesellschaft am vergangenen Sonntag in ihrer Synagoge
eine Gedenkfeier. Wohl sämtliche Mitglieder der Religionsgesellschaft mit
ihren Frauen und Kindern hatten sich eingefunden; auch eine große Zahl der
übrigen jüdischen Kreise aus Mainz zeigten durch ihre Anwesenheit, wie sehr
der Heimgegangene es verstanden hatte, durch sein Wirken um G'TTes und
seiner Torah willen auch den religiös ferner Stehenden Verehrung für
seine Person abzugewinnen.
Nach Rezitation besonders stimmungsgemäßer Kapitel aus Psalmen
bestieg der jetzige Rabbiner und Nachfolger des Heimgegangenen, Dr.
Bamberger, die Kanzel, um in groß angelegter Rede nochmals der Gemeinde ein
Lebensbild ihres geliebten Führers – das Andenken an den Gerechten ist
zum Segen – vor Augen zu führen, nicht als Totenklage, die sich nach
Ablauf des Trauerjahres ohnehin verboten hätte, sondern als Dankeszoll und
als Mahnung, sich dessen, was der Heimgegangene unermüdlich erstrebt, und
erwirkt hätte, stets würdig zu erweisen und fort zu bauen.
Der verehrte Redner verstand es meisterlich, seine Gedanken mit einer Fülle
von Midraschim, Stellen aus dem Talmud und Tora zu umrahmen, zeigte, wie
bereits das Elternhaus und Abstammung von Großen in Israel in Dr.
Bondi den Grund zu Füßen eines Rabbiners Meier Lehmann – das Andenken an
den Gerechten ist zum Segen – und Dr. Salomon Breuer – das Andenken
an den Gerechten ist zum Segen – gesessen und späterhin als Schüler von
Rabbiner Hildesheimer – das Andenken an den Gerechten ist zum Segen –
immer tiefer in die Hallen der Tora-Wissenschaft eingedrungen sei. -
Seine Würdigkeit, im Hause Gottes weilen und wirken zu dürfen, habe Dr.
Bondi sich als einer, der auf rechtem Wege geht und einer, der gerecht
handelt und die die Wahrheit in unsere Herzen spricht in
unübertrefflicher Weise erworben – überstrahlt aber, wo sein Wirken durch
eine rührende Bescheidenheit, die jeden gewann. Selbstvergessen habe er
jedem seiner Gemeinde herzlich nahegestanden, sei es als Lehrer und Führer,
sei es teilnehmender Freund oder in seinem Wirken fürs Krankenhaus. So habe
man seine Worte überall geschätzt und ihn gerne noch außerhalb zu
Vorlesungen und Vorträgen, zum Vorsitz in den beiden frommen
Rabbiner-Verbänden und ins Kuratorium des Berliner Rabbinerseminars berufen.
Auch im hessischen Lande habe man seine Stimme nie überhört. Die Liebe zu
den Worten der Tora sei der Untergrund seiner
jüdisch-wissenschaftlichen Forschungen gewesen, die namentlich auf
historischem Gebiete Hervorragendes zu Tage gefördert hätten. So sei er der
rechte Leiter der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft gewesen. Niemals aber
habe er sich in Spekulation verloren, sondern gleichsam, wie wir beim
Schma-Gebet zur Abwendung fremdartiger Gedanken die Augen mit der Hand
bedecken, habe er in inniger Gläubigkeit all sein Schaffen nur rein zur
Ehre des Ewigen geübt. Unvergänglich sei sein Wirken an der Schule, der
seine ganze Liebe gegolten habe, um jedes Kind habe er im Verein mit seiner,
sein Wirken stets verständnisvoll unterstützenden Gattin förmlich bei den
Eltern gerungen, dass sie es seiner Schule zuführen möchten; ihr, seiner
Schule, habe sein Sinnen und Sorgen gegolten, noch als er körperlich
geschwächt, sich völliger Ruhe hätte hingeben sollen. Das müsse jedem
Einzelnen in der Kehilla und besonders der von ihm herangebildeten
Generation das Gelöbnis abringen, mitzuhelfen an der Erstarkung der
Israelitischen Religionsgesellschaft im Geiste und im Sinne Dr. Bondis –
das Andenken an den Gerechten ist zum Segen. |
 Diesen
tiefempfundenen Worten schloss sich namens der Familie des Heimgegangenen
der Hanauer
Rabbiner Dr. Gradenwitz in gedrängter, geistvoller und eindringlicher Rede
an, das Wesen des geliebten Mainzer Raws mit den Worten des Propheten Micha
es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert,
nämlich das Recht zu tun, Barmherzigkeit lieben und mit Deinem G'TT gehen
zeichnend. Seine tiefe Gottesfurcht und die ihm daraus quillende Pflicht,
alles Menschenwirken zu einem unablässigen Gottesdienst zu gestalten, sei
bei Bondi – das Andenken an den Gerechten ist zum Segen – gepaart
gewesen mit einer rührenden Liebe zu den Menschen, denen er sein Bestes gab
und von denen er in seinem humanen Sinn sich nie entschließen konnte, etwas
Schlechtes zu denken. Befähigt habe ihn hierzu – und darin habe die Wurzel,
der Trieb, alles unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit zu betrachten, wie es
der tiefe Sinn der Koheleth-Verses sei alles hat G'TT gut gemacht zu
seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in das Herz des Menschen gegeben.
Im Endlichen das Unendliche erfühlend, sei sein ganzes Verhalten getragen
gewesen von dem Bewusstsein eines über alle menschlichen Irrungen und Nöte
hinweg, zum Siege gelangenden Ideals. Seine Kehilla möge das herrliche Bild
des Verewigten sich stets vor Augen halten. Wie einst eine schwere Zeit
vorahnend Josef seinen Brüdern sein … zugerufen habe, so möge die Kehilla
als teuerstes Vermächtnis ihres verewigten Führers immerdar seinen Ruf
vernehmen, der darin gipfelte, dass die Mainzer Kehilla, um weiter einen
Aufschwung zu erzielen, ihn im Geiste immer mit sich nehmen möge, das
fortzusetzen, wofür er gewirkt habe. Diesen
tiefempfundenen Worten schloss sich namens der Familie des Heimgegangenen
der Hanauer
Rabbiner Dr. Gradenwitz in gedrängter, geistvoller und eindringlicher Rede
an, das Wesen des geliebten Mainzer Raws mit den Worten des Propheten Micha
es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert,
nämlich das Recht zu tun, Barmherzigkeit lieben und mit Deinem G'TT gehen
zeichnend. Seine tiefe Gottesfurcht und die ihm daraus quillende Pflicht,
alles Menschenwirken zu einem unablässigen Gottesdienst zu gestalten, sei
bei Bondi – das Andenken an den Gerechten ist zum Segen – gepaart
gewesen mit einer rührenden Liebe zu den Menschen, denen er sein Bestes gab
und von denen er in seinem humanen Sinn sich nie entschließen konnte, etwas
Schlechtes zu denken. Befähigt habe ihn hierzu – und darin habe die Wurzel,
der Trieb, alles unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit zu betrachten, wie es
der tiefe Sinn der Koheleth-Verses sei alles hat G'TT gut gemacht zu
seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in das Herz des Menschen gegeben.
Im Endlichen das Unendliche erfühlend, sei sein ganzes Verhalten getragen
gewesen von dem Bewusstsein eines über alle menschlichen Irrungen und Nöte
hinweg, zum Siege gelangenden Ideals. Seine Kehilla möge das herrliche Bild
des Verewigten sich stets vor Augen halten. Wie einst eine schwere Zeit
vorahnend Josef seinen Brüdern sein … zugerufen habe, so möge die Kehilla
als teuerstes Vermächtnis ihres verewigten Führers immerdar seinen Ruf
vernehmen, der darin gipfelte, dass die Mainzer Kehilla, um weiter einen
Aufschwung zu erzielen, ihn im Geiste immer mit sich nehmen möge, das
fortzusetzen, wofür er gewirkt habe.
Mit dieser Rede und den von Kantor und Gemeinde gemeinsam
vorgetragene Kapiteln 90, 16 und 23 aus den Psalmen, klang die Stunde des
Gedenkens aus, bei allen Hörern einen tiefen Eindruck hinterlassend.
Anmerkungen: - Meier Lehmann:
https://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_Lehmann
- Midraschim, Plural von Midrasch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Midrasch
- Talmud:
https://de.wikipedia.org/wiki/Talmud
- Rabbiner Meier Lehmann:https://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_Lehmann
- Dr. Salomon Breuer:https://de.wikipedia.org/wiki/Salomon_Breuer
- Rabbiner Hildesheimer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Esriel_Hildesheimer
- Kehilla:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kehillah
- Raw: Rabbiner
- Rabbiner Dr. Gradenwitz:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hirsch_Gradenwitz
- Koheleth-Vers:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohelet |
Aus der Geschichte der Lehrer und Kantoren der
Religionsgemeinde
Ausschreibung
der Stelle eines Vorsängers und Schochet (1860)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 14. Februar 1860: "In der hiesigen Religionsgemeinde wird ein
musikalisch gebildeter Vorsänger aufgenommen, welcher auch als Schochet zu
fungieren hat. Der jährliche Ertrag der Stelle beläuft sich auf mindestens
fl. 800,-- . Konkurrenzfähige Bewerber haben sich an den Unterzeichneten zu
wenden. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 14. Februar 1860: "In der hiesigen Religionsgemeinde wird ein
musikalisch gebildeter Vorsänger aufgenommen, welcher auch als Schochet zu
fungieren hat. Der jährliche Ertrag der Stelle beläuft sich auf mindestens
fl. 800,-- . Konkurrenzfähige Bewerber haben sich an den Unterzeichneten zu
wenden.
Mainz, den 30. Januar 1860.
Der Vorstand der israelitischen Religionsgemeinde." |
Anzeige des Pensionates von Oberlehrer Fuld
(1869)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Dezember
1869: "Pensionat. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Dezember
1869: "Pensionat.
Durch die Anstellung meiner Tochter als Lehrerin an der Unterrichtsanstalt
der israelitischen Religionsgesellschaft dahier ist es mir möglich, Mädchen,
welche diese oder eine andere der hiesigen Lehranstalten besuchen, in
Pension zu nehmen. Für eine körperliche und geistige Pflege, für eine den
Anforderungen der Zeit in jeder Beziehung entsprechende gründliche
Ausbildung, für gewissenhafte Beaufsichtigung wird aufs Angelegentlichste
Sorge getragen werden.
Mainz, im Dezember 1869. Fuld, Oberlehrer." |
Hinweis: zwischen 1873 und 1880 war der Rabbiner Dr. Julius Fürst (geb.
1826 in Mannheim, gest. 1899 in Mannheim) Prediger und Religionslehrer in Mainz.
Seit September 1880 war er Klausrabbiner in Mannheim.
Ausschreibung der Stelle des Kantors und
Religionslehrers der Religionsgemeinde (1887)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Januar
1887: "Für unsere Gemeinde wird bei angemessener Besoldung ein in
jeder Beziehung Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Januar
1887: "Für unsere Gemeinde wird bei angemessener Besoldung ein in
jeder Beziehung
gediegener Kantor
gesucht, welche zugleich tüchtiger seminaristisch gebildeter Religionslehrer
sein muss. Meldungen unter Beifügung des Lebens- und Bildungsganges sind dem
unterzeichneten Vorstand einzureichen.
Mainz, den 6. Dezember 1886. Der Vorstand der israelitischen
Religionsgemeinde." |
25-jähriges Amtsjubiläum von E. Gutmann als Rabbi
und Kantor des "3. israelitischen Krankenpflegevereins"
(1889)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Oktober
1889: "Mainz, 27. Oktober. Unter den vielen Vereinen unserer alten
Gemeinde, welche sich der Pflege von Tora, Awodag und Gemiluth Chasodim
(Tora, Gottesdienst und Wohltätigkeit) zur Aufgabe gemacht haben, nimmt der
seit den ersten Jahren dieses Jahrhunderts bestehende und segensreich
wirkende '3. israelitische Krankenpflegeverein' eine hervorragende Stellung
ein. Aus bescheidenen Anfängen hervorgegangen, verdankt er sein kräftiges
Emporblühen der rührigen Tätigkeit seines vor 25 Jahren verstorbenen
Rabbiners und Leiters Victor Koch – das Andenken an den Gerechten ist zum
Segen – unter dessen Führung der Verein ein eigenes Haus erwarb, das mit
einer Synagoge eingerichtet ist, Wohnung für den Vereinsdiener enthält. Nach
Victor Kochs Tode wurde der heute noch funktionierende Herr E. Gutmann als
Rabbi und Kantor berufen, ein Mann, dessen strenge Frömmigkeit eine Garantie
dafür bot, dass die religiösen Verrichtungen im Sinne der frommen Gründer
der Chewra Kadischa (Heilige Bruderschaft, Beerdigungsverein) geübt
werden. Der Verein hat sich mit seinen Erwartungen nicht getäuscht. Herr
Gutmann hat mit seltener Pflichttreue in den vergangenen 25 Jahren sein Amt
verwaltet. Gestern am Ausgang des Heiligen Schabbat (= Samstagabend)
hat sich der Vorstand des Vereins das Vergnügen gemacht, zu Ehren des
geschätzten Jubilars im Saale des Vereinshauses ein kleines Fest zu
veranstalten, wobei der Direktor, Herr G. Haas, dem Gefeierten einen
kunstvoll gearbeiteten Pokal überreichte. Herr Gutmann nahm Anlass, in
längerer Dankesrede, die Gesellschaft mit schönen Midraschkommentaren zu
erfreuen, Toaste ernsten Inhaltes wechselten mit humoristischen Vorträgen –
alle Mitglieder hatten den Eindruck einen vergnügten Abend verlebt zu haben,
und als man sich in später Stunde trennte, da hatte man nur den einen
Wunsch, dass es dem Herrn Jubilar beschieden sein möge, noch ebenso rüstig
wie heute das 50jährige Jubiläum zu feiern. So geschehe sein (G'ttes)
Wille." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Oktober
1889: "Mainz, 27. Oktober. Unter den vielen Vereinen unserer alten
Gemeinde, welche sich der Pflege von Tora, Awodag und Gemiluth Chasodim
(Tora, Gottesdienst und Wohltätigkeit) zur Aufgabe gemacht haben, nimmt der
seit den ersten Jahren dieses Jahrhunderts bestehende und segensreich
wirkende '3. israelitische Krankenpflegeverein' eine hervorragende Stellung
ein. Aus bescheidenen Anfängen hervorgegangen, verdankt er sein kräftiges
Emporblühen der rührigen Tätigkeit seines vor 25 Jahren verstorbenen
Rabbiners und Leiters Victor Koch – das Andenken an den Gerechten ist zum
Segen – unter dessen Führung der Verein ein eigenes Haus erwarb, das mit
einer Synagoge eingerichtet ist, Wohnung für den Vereinsdiener enthält. Nach
Victor Kochs Tode wurde der heute noch funktionierende Herr E. Gutmann als
Rabbi und Kantor berufen, ein Mann, dessen strenge Frömmigkeit eine Garantie
dafür bot, dass die religiösen Verrichtungen im Sinne der frommen Gründer
der Chewra Kadischa (Heilige Bruderschaft, Beerdigungsverein) geübt
werden. Der Verein hat sich mit seinen Erwartungen nicht getäuscht. Herr
Gutmann hat mit seltener Pflichttreue in den vergangenen 25 Jahren sein Amt
verwaltet. Gestern am Ausgang des Heiligen Schabbat (= Samstagabend)
hat sich der Vorstand des Vereins das Vergnügen gemacht, zu Ehren des
geschätzten Jubilars im Saale des Vereinshauses ein kleines Fest zu
veranstalten, wobei der Direktor, Herr G. Haas, dem Gefeierten einen
kunstvoll gearbeiteten Pokal überreichte. Herr Gutmann nahm Anlass, in
längerer Dankesrede, die Gesellschaft mit schönen Midraschkommentaren zu
erfreuen, Toaste ernsten Inhaltes wechselten mit humoristischen Vorträgen –
alle Mitglieder hatten den Eindruck einen vergnügten Abend verlebt zu haben,
und als man sich in später Stunde trennte, da hatte man nur den einen
Wunsch, dass es dem Herrn Jubilar beschieden sein möge, noch ebenso rüstig
wie heute das 50jährige Jubiläum zu feiern. So geschehe sein (G'ttes)
Wille."
Anmerkungen: - Rabbiner E. Gutmann: siehe
Artikel zum Tod von Emanuel Gutmann 1891
- Midrasch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Midrasch |
Ausschreibung der Stelle eines Lehrers und
stellvertretenden Kantors der Religionsgemeinde (1890)
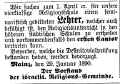 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 9. Februar 1890: "Wir suchen zum 1. April dieses Jahres für unsere
vierklassige Religionsschule einen seminaristisch gebildeten Lehrer,
welcher auch befähigt ist, den Religionsunterricht in den höheren
städtischen Schulen zu erteilen und vorkommendenfalls den ersten Kantor
vertreten kann. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 9. Februar 1890: "Wir suchen zum 1. April dieses Jahres für unsere
vierklassige Religionsschule einen seminaristisch gebildeten Lehrer,
welcher auch befähigt ist, den Religionsunterricht in den höheren
städtischen Schulen zu erteilen und vorkommendenfalls den ersten Kantor
vertreten kann.
Bewerber, welche die Definitovialprüfung bestanden haben, werden bevorzugt.
Mainz, den 29. Januar 1890. Der Vorstand der israelitischen
Religions-Gemeinde." |
50-jähriges Lehrerjubiläum von
Lehrer Simon Lehmann (1904 in Mainz, Simon Lehmann war von 1870 bis nach 1904
Lehrer und Kantor bei der Israelitischen Religionsgemeinde in Mainz)
Anmerkung: nach dem Geburtsregister der jüdischen Gemeinde
Gissigheim ist Simon (Simson) Lehmann
am 1. Dezember 1836 in Gissigheim geboren:
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1224964-89 Nach dem Grabstein
ist allerdings das Geburtsdatum 31. Dezember 1836, was sich mit dem Eintrag im
Geburtsregister nicht in Übereinstimmung bringen lässt. Simon Lehmann war
zunächst Lehrer in Dornheim bei Groß-Gerau
(1854-1863), wo er seine Frau Dina geb. Dahlerbruch kennenlernte, danach
in Bretzenheim (1863-1870) und
schließlich bei der Israelitischen Religionsgemeinde in Mainz, wo er - noch im
Dienst - sein 50-jähriges Lehrerjubiläum feiern konnte. Mit seiner Frau Dina
geb. Dahlerbruch (1840 in Dornheim -
1905, Grab im jüdischen Friedhof Mainz) hatte er vier (?) Kinder: Heinrich
(1865 in Bretzenheim - 1917
https://de.findagrave.com/memorial/196714224/heinrich-lehmann), Gustav
(1868 in Bretzenheim - 1909 Herwen en Aerdt NL
https://www.openarchieven.nl/gld:661988AD-1E26-432F-8348-ED9F0D2649CD),
Hugo (1872 Mainz - 1937), Richard (1880-1915
https://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=juden_nw&ID=I481227&lang=de).
Simon Lehmann starb am 21. Februar 1907 in Mainz und wurde im jüdischen Friedhof
beigesetzt (Grabstein siehe unten).
Eine Enkelin von Simon Lehmann bzw. Tochter von Hugo Lehmann und seiner Frau
Emilie war die Mainzer Opernsängerin Anni Eisler-Lehmann (1904-1999,
KZ-Überlebende)
https://www.annieislerlehmannstiftung.de/newpage16993d52, auch beigesetzt im
jüdischen Friedhof Mainz.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Gemeindebote" vom 8. Juli 1904: "Mainz, 3.
Juli. Gestern feierte hier sein fünfzigjähriges Lehrerjubiläum Herr
Simon Lehmann. Geboren im Jahre 1836 in
Gissigheim (Baden, statt Gittigheim),
trat er im Juli 1854 in Dornheim bei
Groß-Gerau seine erste Lehrerstelle an, woselbst er bis Juli 1863
verblieb. Dann siedelte er nach Bretzenheim bei Mainz über, bis er am
1. Juli 1870 als Lehrer und Kantor bei der Israelitischen Religionsgemeinde
in Mainz angestellt wurde. In Mainz ist Herr Lehmann, der sich großer
körperlicher und geistiger Frische erfreut, nun seit 34 Jahren erfolgreich
tätig und wegen seines lauteren Charakters und persönlicher
Liebenswürdigkeit in allen Kreisen der Stadt geachtet und beliebt. Dem
Jubilar wurden große Ehrungen sowohl seitens der Gemeinde, verschiedener
Vereine wie auch von Freunden und Verehrern zu teil." Artikel
in der Zeitschrift "Der Gemeindebote" vom 8. Juli 1904: "Mainz, 3.
Juli. Gestern feierte hier sein fünfzigjähriges Lehrerjubiläum Herr
Simon Lehmann. Geboren im Jahre 1836 in
Gissigheim (Baden, statt Gittigheim),
trat er im Juli 1854 in Dornheim bei
Groß-Gerau seine erste Lehrerstelle an, woselbst er bis Juli 1863
verblieb. Dann siedelte er nach Bretzenheim bei Mainz über, bis er am
1. Juli 1870 als Lehrer und Kantor bei der Israelitischen Religionsgemeinde
in Mainz angestellt wurde. In Mainz ist Herr Lehmann, der sich großer
körperlicher und geistiger Frische erfreut, nun seit 34 Jahren erfolgreich
tätig und wegen seines lauteren Charakters und persönlicher
Liebenswürdigkeit in allen Kreisen der Stadt geachtet und beliebt. Dem
Jubilar wurden große Ehrungen sowohl seitens der Gemeinde, verschiedener
Vereine wie auch von Freunden und Verehrern zu teil." |
| |
 Grabstein
für Lehrer und Kantor Simon Lehmann im jüdischen Friedhof Mainz (Foto:
https://de.findagrave.com/memorial/176755470/simon-lehmann). Grabstein
für Lehrer und Kantor Simon Lehmann im jüdischen Friedhof Mainz (Foto:
https://de.findagrave.com/memorial/176755470/simon-lehmann).
|
25-jähriges Ortsjubiläum des Reallehrers Eschelbacher
(1917)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. April 1917: "Aus Mainz wird uns geschrieben: Am 1. April
beging Herr Reallehrer Eschelbacher, ein Sohn des verstorbenen
Rabbiners Eschelbacher, sein fünfundzwanzigjähriges Jubiläum als
Religionslehrer der Israelitischen Gemeinde in Mainz." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. April 1917: "Aus Mainz wird uns geschrieben: Am 1. April
beging Herr Reallehrer Eschelbacher, ein Sohn des verstorbenen
Rabbiners Eschelbacher, sein fünfundzwanzigjähriges Jubiläum als
Religionslehrer der Israelitischen Gemeinde in Mainz." |
Aus der Geschichte der Lehrer und Kantoren der
Religionsgesellschaft
Ausschreibung
der Stelle einer Lehrerin in der Religionsgesellschaft (1859)
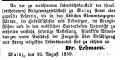 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 5. September 1859: "An der zu errichtenden
Unterrichtsanstalt der israelitischen (orthodoxen) Religionsgesellschaft zu
Mainz findet eine geprüfte Lehrerin, die in den üblichen
Elementargegenständen, im Hebräisch Lesen und Übersetzen, im Französischen
und in den weiblichen Handarbeiten Unterricht zu erteilen versteht,
sofortige Anstellung. Frankierte Anmeldung unter Anschluss der Zeugnisse
über Befähigung und streng religiösen Lebenswandel sind zu richten an
Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 5. September 1859: "An der zu errichtenden
Unterrichtsanstalt der israelitischen (orthodoxen) Religionsgesellschaft zu
Mainz findet eine geprüfte Lehrerin, die in den üblichen
Elementargegenständen, im Hebräisch Lesen und Übersetzen, im Französischen
und in den weiblichen Handarbeiten Unterricht zu erteilen versteht,
sofortige Anstellung. Frankierte Anmeldung unter Anschluss der Zeugnisse
über Befähigung und streng religiösen Lebenswandel sind zu richten an
Dr. Lehmann
Mainz, den 26. August 1859." |
Ausschreibung der Stelle eines Lehrers der
Religionsgesellschaft (1866)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März
1866: "Lehrer gesucht! Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März
1866: "Lehrer gesucht!
Für die Unterrichtsanstalt der israelitischen Religionsgesellschaft zu
Mainz wird zu baldigem Eintritt ein Lehrer gesucht, der in den
gewöhnlichen Elementarfächern einer jüdischen Schule und etwas auch im
Zeichnen zu unterrichten versteht. Zeugnisse über Befähigung und über streng
religiösen Lebenswandel wolle man gefälligst an den Leiter der Anstalt,
Herrn Dr. Lehmann richten." |
Zum Tod des Kultusbeamten der Religionsgesellschaft Moses Marx
(1894)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Februar
1894: "Mainz, am Ausgange des Sabbats Paraschat Tezawe Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Februar
1894: "Mainz, am Ausgange des Sabbats Paraschat Tezawe
In der Nacht zum 7. Adar starb hier plötzlich der langjährige Kultusbeamte
der Israelitischen Religionsgesellschaft, Herr Moses Marx. Das Leben des
Verblichenen illustrierte das Wort unserer Weisen: 'Mehr ist es mit
Talmudgelehrten zu verkehren, und sie zu bedienen, als bei ihnen zu lernen.'
In einfachen Verhältnissen erzogen, hatte der Verblichene in seiner Jugend
nicht das Glück, sich dem Torastudium zu widmen, in seinem Amte jedoch was
es ihm vergönnt, hoch bedeutende Gesetzeslehrer, wie Rabbi Jacob Levi, Rabbi
Samuel Bondi, Rabbi Marcus Lehmann - das Andenken an den Gerechten ist
zum Segen - zu Vorgesetzten zu haben, und in regem Verkehr mit ihnen zu
leben. Welchen Schatz von Kenntnissen in Bezug auf Rechtsentscheide
für die verschiedenartigsten Verhältnisse des Lebens, der Entschlafene sich
hierdurch angeeignet hatte, war ganz erstaunlich. 'So hat es Rabbi Schmul
gemacht', 'so hat es Dr. Lehmann getan', waren seine ständigen Redensarten.
In seiner tiefergreifenden, meisterhaften Trauerrede schilderte ihn unser
verehrter Rabbiner Dr. Bondi - sein Licht leuchte - als einen
pflichttreuen, rastlosen Arbeiter in Bezug auf Tora, Gottesdienst und
Wohltätigkeit. Den in der Halle des Friedhofes dicht gedrängt stehenden
Leidtragenden sah man es an, dass die Lobesworte des Redners ihnen allen aus
der Seele gesprochen waren. Ein weiteres, überaus ehrendes Zeugnis für den
Dahingegangenen gibt der schöne Nachruf, den der Vorstand unserer
Religionsgesellschaft in den hiesigen Tagesblättern ihm widmete. Derselbe
lautet:
In der Nacht zum 13. Februar wurde Herr Moses Marx durch den Tod seiner
rastlosen, gesegneten Tätigkeit entrückt. 38 Jahre hindurch diente er mit
seltenem Pflichteifer und bewundernswerter Arbeitskraft unserer
Religions-Gesellschaft als Kultusbeamter. Sein Verlust bedeutet für uns eine
schmerzliche Lücke, die schwer auszufüllen sein wird. Um unserem Dankgefühl
zu genügen, drängt es uns, dies hier öffentlich auszusprechen. Sein Andenken
wird uns unvergesslich sein.
Ja, es ist eine Lücke, die schwer auszufüllen sein wird. Wie innig
verwachsen Herr Marx mit unserer Religionsgesellschaft war, wie er das
Interesse der Gesellschaft ganz zu dem seinigen gemacht hat, das können nur
die beurteilen, die ihn in seiner Amtstätigkeit gesehen und denen jetzt der
treue Beamte allenthalben fehlt. Zu weiteren Kreisen war der Heimgegangene,
durch seine in Bezug auf Kaschruth musterhaft geleitete Restauration bekannt
und beliebt. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens."
Anmerkungen: - Paraschat Tezawe siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Tezawe
- Rabbi Samuel Bondi: vgl.
Artikel zum Tod von Rabbi Samuel Bondi 1877)
- Rabbiner Dr. Lehmann:https://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_Lehmann
- Kaschruth:
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdische_Speisegesetze |
Religionslehrer
S. Eschelbacher wird Lehrer am Real-Gymnasium, Fräulein Weil wird Lehrerin an
der Volksschule (1904)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. April 1904: "Aus
dem Großherzogtum Hessen. Unser Justizminister hat endlich einmal den
Anfang mit der Anstellung eines stellvertretenden jüdischen Amtsrichters
gemacht. Unser Schulministerium fährt in der Anstellung jüdischer Lehrer
und Lehrerinnen ordentlich fort. Nachdem die Gymnasien in Offenbach und
Bingen jüdische Oberlehrer erhalten haben, wurde dieser Tage Herr Lehrer
S. Eschelbacher, bisher Religionslehrer in Mainz, als ordentlicher
Lehrer an das dortige Real-Gymnasium berufen und Fräulein Cahn aus
Alzey an die Volksschule nach Gießen,
ebenso Fräulein Weil aus Mainz an die Volksschule zu Mainz.
Hoffentlich folgte das Justizministerium in ähnlicher Weise
nach."
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. April 1904: "Aus
dem Großherzogtum Hessen. Unser Justizminister hat endlich einmal den
Anfang mit der Anstellung eines stellvertretenden jüdischen Amtsrichters
gemacht. Unser Schulministerium fährt in der Anstellung jüdischer Lehrer
und Lehrerinnen ordentlich fort. Nachdem die Gymnasien in Offenbach und
Bingen jüdische Oberlehrer erhalten haben, wurde dieser Tage Herr Lehrer
S. Eschelbacher, bisher Religionslehrer in Mainz, als ordentlicher
Lehrer an das dortige Real-Gymnasium berufen und Fräulein Cahn aus
Alzey an die Volksschule nach Gießen,
ebenso Fräulein Weil aus Mainz an die Volksschule zu Mainz.
Hoffentlich folgte das Justizministerium in ähnlicher Weise
nach." |
25-jähriges Ortsjubiläum von Oberkantor und Lehrer der
Israelitischen Religionsgesellschaft Abraham Oppenheimer
(1911)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
13. Juli 1911: "Mainz, 4. Juli. Am vergangenen Samstag waren
25 Jahre verflossen, dass Herr Oberkantor und Lehrer Abraham Oppenheimer
an der hiesigen Israelitischen Religionsgesellschaft seine Tätigkeit begann.
Zu Ehren des Tages war das Vorbeterpult in der Synagoge, die Stätte seiner
Wirksamkeit, mit einem prachtvollen Blumenarrangement versehen worden und
der Herr Rabbiner verlieh ihm die Würde eines Chower. Nach Beendigung des
Gottesdienstes begaben sich Rabbiner und Vorstand in die Wohnung des zu
Feiernden, hier hielt Herr Rabbiner Dr. Bondi eine Ansprache. Im Abschluss
an eine Stelle des Wochenabschnittes entwickelte der Redner die
Eigenschaften, die man von einem Schaliach Zibur (Abgesandter der Gemeinde)
fordere. Den Jubilar ziere, wie hier allbekannt, aufrichtige Frömmigkeit und
könne er sich zugleich großer Beliebtheit bei den Mitgliedern der Gemeinde
erfreuen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
13. Juli 1911: "Mainz, 4. Juli. Am vergangenen Samstag waren
25 Jahre verflossen, dass Herr Oberkantor und Lehrer Abraham Oppenheimer
an der hiesigen Israelitischen Religionsgesellschaft seine Tätigkeit begann.
Zu Ehren des Tages war das Vorbeterpult in der Synagoge, die Stätte seiner
Wirksamkeit, mit einem prachtvollen Blumenarrangement versehen worden und
der Herr Rabbiner verlieh ihm die Würde eines Chower. Nach Beendigung des
Gottesdienstes begaben sich Rabbiner und Vorstand in die Wohnung des zu
Feiernden, hier hielt Herr Rabbiner Dr. Bondi eine Ansprache. Im Abschluss
an eine Stelle des Wochenabschnittes entwickelte der Redner die
Eigenschaften, die man von einem Schaliach Zibur (Abgesandter der Gemeinde)
fordere. Den Jubilar ziere, wie hier allbekannt, aufrichtige Frömmigkeit und
könne er sich zugleich großer Beliebtheit bei den Mitgliedern der Gemeinde
erfreuen.
Der Redner erwähnt dann den ihn in Übereinstimmung mit der Verwaltung der
Religionsgesellschaft Herrn Oppenheimer verliehenen Chowertitel. Mit dem
Wunsche für den Jubilar und die Religionsgesellschaft, dass diese sich noch
lange seiner gesegneten Wirksamkeit erfreuen möge, schloss diese Ansprache.
In Auftrag des Vorstandes dankte deren Vorsitzender, Herr Josef Fulda,
dem Jubilar für seine große Gewissenhaftigkeit und übergab ihm einen
kunstvoll ausgeführten silbernen Chanukkahleuchter. Es sprachen noch im
Auftrage der Gemeindemitglieder, Herr Siegmund Moritz, der zugleich
eine kunstvoll gearbeitete Mappe mit wertvollem Inhalt überreichte, dann
Herr Jakob Cahn, im Auftrage der Schüler. Der Leiter des
Synagogenchores, Herr Hermann Schlesinger pries die jahrelange,
harmonische Zusammenarbeit zwischen Vorsänger und Chor, zugleich einen
Becher mit entsprechender Widmung darbietend. Inzwischen hatten sich die
Räume mit Gemeindemitgliedern gefüllt, die es auch an Einzelgeschenken und
allerhand Aufmerksamkeiten nicht fehlen ließen.
Herr Oppenheimer dankte in tiefbewegten Worten. In jungen Jahren hierher
gekommen, habe er zwei Lehrer, die ihm Freunde waren, vorgefunden, der
unvergessliche Dr. Lehmann – das Andenken an den Gerechten ist zum
Segen - habe ihm die Richtlinien, der von ihm begründeten
Unterrichtsanstalt gewiesen und unter göttlichem Beistand habe er durch das
Eingehen auf die Gedanken dieses Großen in Israel Erfolge erzielt.
Am folgenden Sonntage fand in der Vorhalle der Synagoge unserer Gemeinde
eine Schulfeier statt. Hier hielt vor versammeltem Lehr- und
Schulkörper der Senior der Lehrer, Herr Josef Kahn, eine
tiefempfundene Ansprache auf die der Jubilar bewegt erwiderte. Chorgesang
der Kinder und allerhand heitere Aufführungen schlossen die
Feierlichkeiten."
Anmerkungen: - Vorbeterpult:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bima
- Wochenabschnitt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Parascha
- Chower:
https://de.wiktionary.org/wiki/Chawer
- Josef Fulda: Bankier in Mainz, sein Sohn war Isaak Fulda
https://de.wikipedia.org/wiki/Isaak_Fulda vgl.
Artikel
von 1919
- Chanukkahleuchter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Chanukkia
- Dr. Lehmann:
https://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_Lehmann
- Israel: Jüdische Gemeinschaft |
Zum Tod des Lehrers der Religionsgesellschaft Josef
Kahn (1918)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Oktober
1918: "Mainz, 20. Okt. Die hiesige israelitische
Religionsgesellschaft hat einen schweren Verlust erlitten. Während der
Herbstfeiertage verschied, im hohen Alter von 77 Jahren, Herr Lehrer Josef
Kahn. Es war in der zweiten Hälfte der 50er Jahre des vorigen
Jahrhunderts, als der junge Rabbiner Dr. Lehmann – das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen – nach Begründung der Israelitischen
Religionsgesellschaft auch deren Unterrichtsanstalt ins Leben rief und für
diese unter anderen hervorragenden Lehrkräften auch Herrn Kahn anstellte.
Mit der Verpflichtung dieser Persönlichkeit für die Schule hatte der
Rabbiner einen besonders guten Griff getan, denn dessen pädagogische
Veranlagung, seine Pflichttreue, Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit, vor
allem aber sein reiches Wissen, gingen weit über das hinaus, was man sonst
von Lehrern in ähnlichen Stellungen zu fordern berechtigt ist. Dazu kam
seine ungekünstelte, überzeugungsvolle und aus dem Herzen quellende
Frömmigkeit, die sich auf das kindliche Gemüt als etwas ganz
Selbstverständliches und Notwendiges übertrug. So ward es ihm leicht, auf
die Idee seines großen Meisters einzugehen, der die Parole 'Tora' und 'Derech
Erez' auf die Fahne der Schule geschrieben hatte. In dieser Weise wirkte er
nahezu 60 Jahre in der genannten Anstalt. Andere Lehrer kamen und gingen,
aber er harrte aus. Ja, als die Kriegsnöte es durch Einberufung der jungen
Lehrer verlangten, opferte er noch die wenigen Jahre seines Ruhestandes der
heißgeliebten Anstalt. In einer ergreifenden Rede am Grabe, ebenso in einer
heute in der Synagoge der Israelitischen Religionsgesellschaft stattgehabten
Trauerfeier zeichnete Rabbiner Dr. Bondi das Bild des wackeren Mannes und
seines segensreichen Wirkens. Er verfehlte auch nicht, darauf hinzuweisen,
welche Stütze der Heimgegangene auch dem Schriftsteller Dr. Lehmann gewesen,
indem er sich viele Jahrzehnte als 'Hilfsredakteur' beim 'Israelit'
erfolgreich betätigte. Möge der Allgütige seine Kinder und Enkel trösten!
Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. O.L." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Oktober
1918: "Mainz, 20. Okt. Die hiesige israelitische
Religionsgesellschaft hat einen schweren Verlust erlitten. Während der
Herbstfeiertage verschied, im hohen Alter von 77 Jahren, Herr Lehrer Josef
Kahn. Es war in der zweiten Hälfte der 50er Jahre des vorigen
Jahrhunderts, als der junge Rabbiner Dr. Lehmann – das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen – nach Begründung der Israelitischen
Religionsgesellschaft auch deren Unterrichtsanstalt ins Leben rief und für
diese unter anderen hervorragenden Lehrkräften auch Herrn Kahn anstellte.
Mit der Verpflichtung dieser Persönlichkeit für die Schule hatte der
Rabbiner einen besonders guten Griff getan, denn dessen pädagogische
Veranlagung, seine Pflichttreue, Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit, vor
allem aber sein reiches Wissen, gingen weit über das hinaus, was man sonst
von Lehrern in ähnlichen Stellungen zu fordern berechtigt ist. Dazu kam
seine ungekünstelte, überzeugungsvolle und aus dem Herzen quellende
Frömmigkeit, die sich auf das kindliche Gemüt als etwas ganz
Selbstverständliches und Notwendiges übertrug. So ward es ihm leicht, auf
die Idee seines großen Meisters einzugehen, der die Parole 'Tora' und 'Derech
Erez' auf die Fahne der Schule geschrieben hatte. In dieser Weise wirkte er
nahezu 60 Jahre in der genannten Anstalt. Andere Lehrer kamen und gingen,
aber er harrte aus. Ja, als die Kriegsnöte es durch Einberufung der jungen
Lehrer verlangten, opferte er noch die wenigen Jahre seines Ruhestandes der
heißgeliebten Anstalt. In einer ergreifenden Rede am Grabe, ebenso in einer
heute in der Synagoge der Israelitischen Religionsgesellschaft stattgehabten
Trauerfeier zeichnete Rabbiner Dr. Bondi das Bild des wackeren Mannes und
seines segensreichen Wirkens. Er verfehlte auch nicht, darauf hinzuweisen,
welche Stütze der Heimgegangene auch dem Schriftsteller Dr. Lehmann gewesen,
indem er sich viele Jahrzehnte als 'Hilfsredakteur' beim 'Israelit'
erfolgreich betätigte. Möge der Allgütige seine Kinder und Enkel trösten!
Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. O.L."
Anmerkungen: - Dr. Lehmann:
https://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_Lehmann
- Derech Erez:
https://de.wikipedia.org/wiki/Derech_Erez_Zuta
- Rabbiner Dr. Bondi:
vgl. Artikel zu Rabbiner Dr. Bondi von 1890 |
40-jähriges Ortsjubiläum von Kantor und Lehrer Abraham
Oppenheimer (1926)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juli
1926: "Mainz, 19. Juli. Am Schabbos beging Herr Kantor und
Lehrer Abraham Oppenheimer sein 40jähriges Ortsjubiläum im Dienste der
hiesigen Israelitischen Religionsgesellschaft, nachdem er vorher kurze Zeit
in Lohrhaupten und
Ottensoos gewirkt hatte. Die
Wertschätzung seiner Tätigkeit zeigte sich in der nach beendigtem
Morgengottesdienst in seiner Wohnung stattgehabten Feier. Nach einem vom
Synagogenchor ausgeführten Ständchen ergriff Herr Rabbiner Dr. Bondi das
Wort, zu größeren Ausführungen, um die großen Verdienste des Jubilars in
Schule und Gotteshaus eingehend zu würdigen, worauf der Gefeierte kurz
erwiderte, dass er für alle dargebrachten Ehren bestens danke – die Gemeinde
ließ ein größeres Geschenk überreichen – aber doch nur eigentlich seine
selbstverständliche Pflicht erfüllt habe. Wir aber rufen Herrn Oppenheimer
zu: 'Brich auf, fahr einher bis 100 Jahre' (nach Psalm 45,5)" Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juli
1926: "Mainz, 19. Juli. Am Schabbos beging Herr Kantor und
Lehrer Abraham Oppenheimer sein 40jähriges Ortsjubiläum im Dienste der
hiesigen Israelitischen Religionsgesellschaft, nachdem er vorher kurze Zeit
in Lohrhaupten und
Ottensoos gewirkt hatte. Die
Wertschätzung seiner Tätigkeit zeigte sich in der nach beendigtem
Morgengottesdienst in seiner Wohnung stattgehabten Feier. Nach einem vom
Synagogenchor ausgeführten Ständchen ergriff Herr Rabbiner Dr. Bondi das
Wort, zu größeren Ausführungen, um die großen Verdienste des Jubilars in
Schule und Gotteshaus eingehend zu würdigen, worauf der Gefeierte kurz
erwiderte, dass er für alle dargebrachten Ehren bestens danke – die Gemeinde
ließ ein größeres Geschenk überreichen – aber doch nur eigentlich seine
selbstverständliche Pflicht erfüllt habe. Wir aber rufen Herrn Oppenheimer
zu: 'Brich auf, fahr einher bis 100 Jahre' (nach Psalm 45,5)"
Anmerkungen: - Schabbos Jiddisch für Schabbat,
https://de.wikipedia.org/wiki/Schabbat
- Rabbiner Dr. Bondi:
vgl. Artikel zu Rabbiner Dr. Bondi von 1890 |
25-jähriges Ortsjubiläum von Jakob Tschorniki als
Kultusbeamter der Religionsgesellschaft (1931)
Anmerkung: Jakob Tschornicki ist 1878 in Ostrina geboren, war verheiratet mit
Karoline geb. Caser, geb. 1876 in Obersitzkow. Während seiner Zeit als
Kultusbeamter in Mainz lebte Familie Tschornicki - mit den Kindern Max (geb.
1903 in Rüsselsheim), Willi (1906-1913) und Julian (geb. 1914) in Mainz in der
Großen Bleiche 38. Jakob Tschornicki starb 1936 in Mainz, seine Frau ist nach
der Deportation 1942 im Ghetto Theresienstadt umgekommen. Sohn Max starb nach
seiner Deportation kurz vor Befreiung des KZ Dachau am 2. April 1945. Sohn
Julian konnte nach Mexiko emigrieren. Weitere Informationen siehe
https://stolpersteine-mainz.de/index.php/stolpersteine-in-mainz/biografien/karoline-und-max-tschornicki/
Vor dem Haus Große Bleiche 38 liegen "Stolpersteine" für Max Tschornicki und
seine Mutter Karoline.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. April
1931: "Mainz, 18. April. Am Sabbat Achare Mot Kedoschim
sind es 25 Jahre her, dass Herr Jakob Tschorniki als Kultusbeamter in der
Mainzer Religionsgesellschaft tätig ist. In dem Vierteljahrhundert seines
segensreichen Wirkens hat er sich durch sein tiefes talmudisches Wissen,
seinen Pflichteifer im Amte und seine hohen menschlichen Tugenden das
Vertrauen und die Liebe der ganzen Gemeinde erworben. Wir wünschen dem
Jubilar weitere ungetrübte Jahre der Gesundheit und der Arbeit zum Besten
seiner Kehilla und des toratreuen Judentums. (Alles Gute) bis 120 Jahre". Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. April
1931: "Mainz, 18. April. Am Sabbat Achare Mot Kedoschim
sind es 25 Jahre her, dass Herr Jakob Tschorniki als Kultusbeamter in der
Mainzer Religionsgesellschaft tätig ist. In dem Vierteljahrhundert seines
segensreichen Wirkens hat er sich durch sein tiefes talmudisches Wissen,
seinen Pflichteifer im Amte und seine hohen menschlichen Tugenden das
Vertrauen und die Liebe der ganzen Gemeinde erworben. Wir wünschen dem
Jubilar weitere ungetrübte Jahre der Gesundheit und der Arbeit zum Besten
seiner Kehilla und des toratreuen Judentums. (Alles Gute) bis 120 Jahre".
Anmerkungen: - Achare Mot
https://de.wikipedia.org/wiki/Achare_Mot
- Kedoschim
https://de.wikipedia.org/wiki/Kedoschim
- Kehilla:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kehillah |
Zum Tod von
Lehrer und Kantor Abraham Oppenheimer (1930)
 Artikel
in "Der Israelit" vom 30. Januar 1930: "Lehrer Abraham Oppenheimer.
Mainz, 27. Januar. Artikel
in "Der Israelit" vom 30. Januar 1930: "Lehrer Abraham Oppenheimer.
Mainz, 27. Januar.
Innerhalb Jahresfrist standen wir trauernd an der Bahre von drei führen und
Beamten unserer Gemeinde. Noch ist die Wunde, die der Heimgang unseres Raw
Dr. Bondi - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen -, uns
geschlagen, nicht vernarbt, noch ist der Grabhügel frisch, der sich über dem
Oraun (= Sarg) unseres Kultusbeamten Moses Krieger -
seligen Andenkens - schloss, der vorige Woche uns jäh entrissen wurde -
noch am Morgen hatte der 76-jährige in gewohnter Treue und Hingebung seinen
Dienst im Gotteshause versehen und am Mittag erlag er einem Schlaganfall und
nun trauern wir mit der schwer geprüften Familie um Abraham Oppenheimer,
den Dritten des ... , der die Awoda (Gottesdienst) unserer
Religionsgesellschaft zu einem Awoda HaKodesch (heiligen Gottesdienst)
machte.
Abraham Oppenheimer kam im Jahre 1886 als Lehrer und Kantor nach Mainz,
gewann gleich das Vertrauen von Rabbiner Dr. Markus Lehmann - das
Gedenken an den Gerechten ist zum Segen - und suchte sich immer mehr in
dessen Ideenwelt hineinzufinden. In der Nähe Dr. Lehmanns reifte er zu der
Persönlichkeit heran, als welche er später so hoch geehrt wurde. Der
Schlüsselbewahrer des alten Mainzer Chasonus (Art und Weise des
Vorbetens) in seiner kräftigen Ursprünglichkeit war damals der 1896
heimgegangene Rabbi Jona Bondi - das Gedenken an den Gerechten ist
zum Segen -und an ihm hatte Oppenheimer den ersten und besten Anleitung
für sein Kantor Amt. Wie setzte er seinen Stolz darein, das übernommene Erbe
in Treue zu verwalten und zu mehren! Alle neuen Strömungen auf dem Gebiet
des Chasonus (Art und Weise des Vorbetens). denen er als ein Mann von
musikalischer Bildung zugänglich war, konnten dem überlieferten Nigun
(Melodie, vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Niggun) keinen Abtrag tun. So wie auch
der alte Mainzer Minhag (Brauchtum
https://de.wikipedia.org/wiki/Minhag_(Judentum)) ihm hoch und heilig
blieb. Jahrzehnte wirkte er dann in Schule und Synagoge an der Seite von
Rabbiner Dr. Jonas Bondi - das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen -,
mit dem ihn eine enge Freundschaft verband. Als Lehrer lehrte Oppenheimer
nicht nur durch die Lehre, sondern durch sein Leben. Er entstammte einer
frommen Familie aus Schmalnau und sein ganzes Leben war ein
Gottesdienst. Als im Frühjahr sein einziger Sohn, Rechtsanwalt Dr. Max
Oppenheimer - das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen -
seiner Familie und seinen Freunden entrissen wurde, da bewährte er sich als
Kohen gleich Aaron HaKohen und (hebräisch und deutsch:)
er schwieg und ertrug mit seiner gleichgesinnten edlen Gattin und seinen
Kindern den schweren Schlag als aufrechter. echter Jehudi (frommer Jude).
Nun ist der so schwer geprüften Familie der Vater, der trauernden Gemeinde
der Schaliach Zibur (Abgesandter der Gemeinde) entrissen und im Sinne
des Wortes 'Der Bevollmächtigte eines Menschen ist wie dieser selbst' (Mischna
Berachot V,5 schlucho schel adam kemoto) empfinden wir alle den Verlust
im tiefsten Inneren, als ob ein Stück von uns selbst uns genommen wäre.
Unter überaus großem Ehrengeleite ging die Bestattung am Sonntag Vormittag
vor sich. Unser Rabbiner, Herr Dr. Bamberger, fand warme Töne zur
Würdigung des trefflichen Mannes und unseres herben Verlustes. Nach ihm
sprach für den Vorstand der Religionsgesellschaft Herr Dr. Schlessinger
in ergreifenden Worten den Dank der Gemeinde an ihren Schaliach Zibur
(Abgesandter der Gemeinde) aus. Möge der Heimgegangene uns allen ein
Fürsprecher sein Das Andenken an den gerechten sei zum Segen." |
Weitere Lehrer
Über
Moritz Lorge, von 1908 bis 1933 Oberlehrer und Studienrat an der Höheren
Töchterschule in Mainz
|
Kennkarte
aus der NS-Zeit |
| |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgende Kennkarte ist die Quelle: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |
| |
Kennkarte
des Oberlehrers an der
Höheren Töchterschule in Mainz
Rabbiner Dr. Moritz Lorge |

|
|
Kennkarte (Mainz) für Rabbiner Dr. phil.
Moritz Lorge (geb. 6. Oktober 1874 in Harmuthsachsen). Moritz Lorge
war nach dem Besuch der Schule in Harmuthsachsen Schüler an der Israelitischen
Präparandenschule in Burgpreppach. 1892 bis 1892 studierte er am
Lehrerseminar in Kassel. Er war zwischen 1900 und 1904 jeweils kürzere
Zeit Lehrer in Wolfenbüttel, dann Lehrer und Prediger in Petershagen
sowie Lehrer in Hamm in Westfalen. Ab 1904 studierte er in Berlin und
Tübingen (Promotion 1907). Von 1908 bis 1933 war er Oberlehrer und
Studienrat für Religion, Deutsch und Geschichte in Mainz an der Höheren
Töchterschule. 1935 Bezirksrabbiner in Sobernheim. 1939 in die USA
emigriert und in den folgenden Jahren in Cincinatti und New York Vortrags-
und Lehrtätigkeit zur Geschichte der Juden in Deutschland und den USA.
War verheiratet mit Hedwig geb. Steinweg (Sohn: der 1916 geborene Ernst Mordechai Lorge
wurde gleichfalls Rabbiner, siehe Artikel unten). Moritz Lorge starb 1948 in New
York.
|
|
|
|
 Hinweis auf den Artikel von Gabriele Hannah, Hans-Dieter Graf und Wolfgang
Bürkle in der "Allgemeinen Zeitung Mainz" vom 27. Mai 2016:
"Stets hoffnungsvoll und furchtlos. Hinweis auf den Artikel von Gabriele Hannah, Hans-Dieter Graf und Wolfgang
Bürkle in der "Allgemeinen Zeitung Mainz" vom 27. Mai 2016:
"Stets hoffnungsvoll und furchtlos.
Auswanderer. Ernst Mordecai Lorge flüchtete aus Mainz in die USA /
Seelsorger für KZ-Überlebende..."
Artikel zum 100. Geburtstag von Ernst Mordechai Lorge.
Der Artikel ist eingestellt als Bilddatei (links) und als pdf-Datei. |
|