|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
Synagogen in Bayerisch Schwaben
Harburg/Schwaben (Landkreis Donau-Ries)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Harburg lebten Juden bereits im Mittelalter. Während der
Verfolgung in der Pestzeit 1348/49 wurden Juden in der Stadt ermordet.
Erst im 15. Jahrhundert wird wieder ein jüdischer Einwohner genannt (1459 Jud
Enslin). 1463 ist ein sich nach dem Herkunftsort Günzburg nennender Jude
Rumold auf drei Jahre aufgenommen worden. In der Folgezeit (16.
Jahrhundert) dürften nur wenige oder gar keine Juden am Ort gelebt haben.
Die Entstehung der neuzeitlichen jüdischen Gemeinde geht in das 17.
Jahrhundert zurück. 1671 konnten sich fünf aus dem Herzogtum Pfalz-Neuburg
ausgewiesene Juden mit ihren Familien in der Stadt niederlassen. Der
Wohlhabendste unter ihnen war Moyses Weil aus Höchstädt an der Donau; die
anderen jüdischen Männern waren Gabriel Weil, Sohn von Moyses Weil, Salomon,
Baruch Leve und Jacob Leve. Am 10. März 1671 erfolgte mit Genehmigung
durch Graf Albrecht Ernst I. von Oettingen die Gründung einer jüdischen
Gemeinde. In den folgenden Jahren erfolgte die Aufnahme weiterer jüdischer
Familien, ab 1684 auch in Mönchsdeggingen.
In den folgenden Jahrzehnten bildeten die an den beiden Orten lebenden jüdischen
Familien zunächst eine gemeinsame Gemeinde, die zum Rabbinat Oettingen (seit
1743 zum neu gebildeten Rabbinat Wallerstein) gehörten. 1697 wurden bereits 15
jüdische Familien in der Stadt gezählt.
Die Zahl der jüdischen Einwohner erreichte ihre höchsten Stände Mitte
des 18. Jahrhunderts (zwischen 1735 und 1770 knapp 60 Familien) und im Zeitraum
zwischen dem Ende des 18. Jahrhunderts und den 1840er-Jahren (1794 322 jüdische
Einwohner, 1811 24,5 % der Einwohnerschaft; 1823 83 jüdische Familien, 1834 360
Personen in 60 Familien) und ging danach durch Abwanderung in die Städte
schnell zurück. Von 1840 bis 1881 war Harburg Sitz eines eigenen Rabbiners. Am
19. Mai 1840 wurde Elkan Selz als Rabbiner der Gemeinde installiert. Er blieb
bis 1881 auf dieser Stelle. Zu seinem Distrikt gehörte auch Mönchsdeggingen.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde insbesondere eine Synagoge
(s.u.), eine jüdische Schule (als Elementarschule 1828 bis 1888 im jüdischen
Schul- und Armenhaus Egelseestraße 15, danach Religionsschule), ein rituelles
Bad (im Untergeschoss des Synagogengebäudes) sowie einen Friedhof.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war insbesondere ein Lehrer
angestellt, der auch als Vorbeter und Schochet tätig war. Zeitweise hatte die
Gemeinde auch mehrere Angestellte. So werden 1839 als Vorbeter ein Herr
Steinharder und und als Schulverweser ein Herr Morgenroth genannt. Letzterem
folgte 1839 als Schulverweser ein Herr Berolzheimer. Die Stelle wurde bei
anstehenden Neubesetzungen immer wieder ausgeschrieben (siehe
Ausschreibungstexte unten).
Noch im 19. Jahrhundert waren fast alle jüdischen Familienoberhäupter im
Handel tätig (Vieh-, Eisen-, Leder-, Wein-, Porzellan-, Spezerei- und
Immobilienhandel). Mehrere Familien brachten es zu einigem Wohlstand, wovon bis
heute einige ehemalige jüdische Wohnhäuser in der Stadt zeugen. Langjährige
prägende Persönlichkeit des Gemeindelebens war Gerson Stein, der von
1875 (25jähriges Jubiläum im Dezember 1900 siehe unten) bis zum seinem Tod
1920 fast ein halbes Jahrhundert Gemeindevorsteher war und in dieser Zeit auch
Ämter in der bürgerlichen Gemeinde innehatte (Armenpflegschaftsrat). Er genoss
in der ganzen Stadt hohes Ansehen.
1910 lebten noch 33 Juden in der Stadt. 1920 war die Zahl der
jüdischen Männer am Ort so zurückgegangen, dass der Minjan (Zahl der für
den Gottesdienst notwendigen [10] religionsmündigen jüdischen Männer) nicht
mehr aus eigener Kraft zustande kam.
Um 1924 waren die Gemeindevorsteher die Herren J. Hiller, J. Epstein,
Julius Nebel I und Julius Nebel II. Als vermutlich letzter Kantor, Schochet und
Lehrer war damals Maier Laßmann angestellt. Er unterrichtete allerdings nur
noch ein Kind im Religionsunterricht. Im Frühjahr 1925 verließ er die
Gemeinde. Vermutlich wurde nach ihm kein weiterer Lehrer angestellt, sondern die
Gemeinde durch den Lehrer aus Nördlingen
mitbetreut. An Vereinen war noch aktiv der Frauenverein, ein Frommenverein.
Auch bestand eine "Erez Jsrael Kasse" zur Sammlung von Spenden
für wohltätige Zwecke im Heiligen Land (Erez Jsrael). Die Gemeinde gehörte
zum Distriktsrabbinat Ichenhausen.
1932 war Julius Nebel I der 1. Vorsitzende der Gemeinde, Julius Nebel II
der 2. Vorsitzende.
 1933 lebten noch 13 jüdische
Personen in der Stadt (Foto links von 1938: Schild "Juden sind
unerwünscht"; im Hintergrund die Harburg; Foto - aus dem Nachlass des
Harburger Heimatforschers und Hobbyfotografen Ernst Ruff) erhalten von Rolf
Hofmann, Stuttgart). 1933 lebten noch 13 jüdische
Personen in der Stadt (Foto links von 1938: Schild "Juden sind
unerwünscht"; im Hintergrund die Harburg; Foto - aus dem Nachlass des
Harburger Heimatforschers und Hobbyfotografen Ernst Ruff) erhalten von Rolf
Hofmann, Stuttgart).
1936 wurde die Gemeinde aufgelöst,
die hier noch lebenden Juden wurden der Gemeinde in Nördlingen
angeschlossen. Die letzten drei jüdischen Bewohner wurden im Juli 1939 von Harburg nach
Augsburg zwangsumgesiedelt.
Von den in Harburg geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Ernst Epstein (1882), Hugo
Epstein (1881), Heinrich Guldmann (1871), Josef Guldmann (1869), Heinrich
Hausmann (1871), Dora Hene geb. Nebel (1898), Emma Koch geb. Guldmann (1872),
Sara Mannheimer (1897), Mathilde Nebel geb. Stein (1868), Pauline Nebel geb.
Hiller (1859), Leopold Stern (1875), Frieda Strauss geb. Nebel (1884), Bertha
Wetzler geb. Nebel (1883).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Allgemeine
Beiträge zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Harburg
Die Anfänge der jüdischen
Geschichte Harburgs nach einem Artikel von 1842
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. September
1842 aus einem in mehreren Fortsetzungen erschienen Beitrag von J. M. Fuch
s.u.): "Harburg. In den Judenakten zu Harburg findet sich ein
Bericht vom 1. September 1740 des Inhalts: 'Anno 1671 sind zum
allererstenmal Juden in den allhiesigen Markt Harburg in Schutz
aufgenommen worden, da hingegen vormals nie Juden in dem Markte Harburg
gewesen oder darinnen geduldet worden. Die Anzahl dieser neu aufgenommenen
Juden aber hat sich auf 11 Mann belaufen (vid. Befehl s.d. 10. März
1671). Wie man aber mit diesen 11 Juden ratione ihres jährlich zu geben
habenden Schutzgeldes, zweifelsohne in dem Markt gebrachten Vermögen
nach, akkordiert hat, gibt die obengedachte Beilage und der darin
enthaltene Schutzbrief zu erkennen. Im Jahre 1686 und zwar den 14. Juni
hat man denen Juden in dem Markte Harburg abermals einen Schutzbrief
erteilt. Es sind aber damals statt der obgedachten 11 Juden 12 allhier und
3 Juden zu Deggingen (Mönchsdeggingen)
gewesen, mit welchen abermals ein Akkord auf ein gewisses Schutzgeld
getroffen worden. Die neugedachten 4 Juden zu Deggingen sind aber
allererst im Jahre 1684 und 1686 in den Schutz gekommen, wo vormals zu
Deggingen auch niemals Juden gewesen sind.' Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. September
1842 aus einem in mehreren Fortsetzungen erschienen Beitrag von J. M. Fuch
s.u.): "Harburg. In den Judenakten zu Harburg findet sich ein
Bericht vom 1. September 1740 des Inhalts: 'Anno 1671 sind zum
allererstenmal Juden in den allhiesigen Markt Harburg in Schutz
aufgenommen worden, da hingegen vormals nie Juden in dem Markte Harburg
gewesen oder darinnen geduldet worden. Die Anzahl dieser neu aufgenommenen
Juden aber hat sich auf 11 Mann belaufen (vid. Befehl s.d. 10. März
1671). Wie man aber mit diesen 11 Juden ratione ihres jährlich zu geben
habenden Schutzgeldes, zweifelsohne in dem Markt gebrachten Vermögen
nach, akkordiert hat, gibt die obengedachte Beilage und der darin
enthaltene Schutzbrief zu erkennen. Im Jahre 1686 und zwar den 14. Juni
hat man denen Juden in dem Markte Harburg abermals einen Schutzbrief
erteilt. Es sind aber damals statt der obgedachten 11 Juden 12 allhier und
3 Juden zu Deggingen (Mönchsdeggingen)
gewesen, mit welchen abermals ein Akkord auf ein gewisses Schutzgeld
getroffen worden. Die neugedachten 4 Juden zu Deggingen sind aber
allererst im Jahre 1684 und 1686 in den Schutz gekommen, wo vormals zu
Deggingen auch niemals Juden gewesen sind.'
Der erste erteilte Schutzbrief war auf die Dauer von 3 Jahren gegeben.
Übereinstimmend mit demselben ist ein vorgefundener Schutzbrief von
Albrecht Ernst regierendem Grafen zu Oettingen, d.d. 10. März 1671. Ob er
gleich nur in Fragmenten vorhanden ist, so ist doch an der Echtheit nicht
zu zweifeln." |
| |
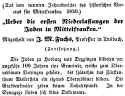 Aus
einem Beitrag von J. M. Fuchs in der "Allgemeinen Zeitung des
Judentums" vom 1. Oktober 1842: "(Aus dem neunten Jahresberichte
des historischen Vereins für Mittelfranken. 1839. 'Über die ersten
Niederlassungen der Juden in Mittelfranken.' Mitgeteilt von J. M. Fuchs,
Professor in Ansbach. (Fortsetzung.) Die Juden zu Harburg und Deggingen
bildeten vor ungefähr 100 Jahren eine Gemeinde, welche zum Oberrabbinate
Oettingen gehörte, bis späterhin das Fürstentum Wallerstein ein eigenes
Oberrabbinat bildete. Die Grabdenkmäler geben keinen Anhaltspunkt. In der
Synagoge finden sich keine Dokumente." Aus
einem Beitrag von J. M. Fuchs in der "Allgemeinen Zeitung des
Judentums" vom 1. Oktober 1842: "(Aus dem neunten Jahresberichte
des historischen Vereins für Mittelfranken. 1839. 'Über die ersten
Niederlassungen der Juden in Mittelfranken.' Mitgeteilt von J. M. Fuchs,
Professor in Ansbach. (Fortsetzung.) Die Juden zu Harburg und Deggingen
bildeten vor ungefähr 100 Jahren eine Gemeinde, welche zum Oberrabbinate
Oettingen gehörte, bis späterhin das Fürstentum Wallerstein ein eigenes
Oberrabbinat bildete. Die Grabdenkmäler geben keinen Anhaltspunkt. In der
Synagoge finden sich keine Dokumente." |
Gemeindebeschreibung 1839
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Juni
1839: "Harburg (Provinz Schwaben in Bayern). 17. Mai (1839).
Die hiesige aus 60 Familienhäuptern bestehende Gemeinde hatte seit langer
Zeit einen eigenen Rabbinen haben wollen, die fürstliche
Standesherrschaft aber wollte uns unter das Distriktsrabbinat von
Wallerstein stellen, und den Sitz des Rabbinen dahin verlegen. Die
königliche Regierung hat aber mittelst allerhöchsten Reskripts zu
unserer Aller Freude uns gestattet, einen eigenen Rabbinen anzunehmen, und
ward uns dies heute eröffnet. Es schwebt nun nur noch die Frage bei der
königlichen Regierung in Augsburg ob, wer als Stimmberechtigter zu
gelten, und werden wir dann sofort zur Wahl schreiten. Gewiss würde es
Ihnen Freude machen, unserem Gottesdienste beizuwohnen. So gut dieser,
ohne Rabbinen vollführt werden kann, würden Sie ihn gewiss finden.
Unserem Vorbeter Steinharder und Schulverweser Morgenroth, den wir aber
leider bald verlieren, verdanken wir vierstimmigen Choralgesang,
Abschaffung des Mizwotverkaufs, höchste Ordnung und andächtige
Stille."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Juni
1839: "Harburg (Provinz Schwaben in Bayern). 17. Mai (1839).
Die hiesige aus 60 Familienhäuptern bestehende Gemeinde hatte seit langer
Zeit einen eigenen Rabbinen haben wollen, die fürstliche
Standesherrschaft aber wollte uns unter das Distriktsrabbinat von
Wallerstein stellen, und den Sitz des Rabbinen dahin verlegen. Die
königliche Regierung hat aber mittelst allerhöchsten Reskripts zu
unserer Aller Freude uns gestattet, einen eigenen Rabbinen anzunehmen, und
ward uns dies heute eröffnet. Es schwebt nun nur noch die Frage bei der
königlichen Regierung in Augsburg ob, wer als Stimmberechtigter zu
gelten, und werden wir dann sofort zur Wahl schreiten. Gewiss würde es
Ihnen Freude machen, unserem Gottesdienste beizuwohnen. So gut dieser,
ohne Rabbinen vollführt werden kann, würden Sie ihn gewiss finden.
Unserem Vorbeter Steinharder und Schulverweser Morgenroth, den wir aber
leider bald verlieren, verdanken wir vierstimmigen Choralgesang,
Abschaffung des Mizwotverkaufs, höchste Ordnung und andächtige
Stille." |
Zur Geschichte der Gemeinde mit ausführlicher
Beschreibung der Synagoge und ihrer Einrichtung - Artikel von 1927
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7.
Januar 1927: "Harburg an der Wörnitz. Am Steilrand des
schwäbischen Jura, dort, wo er als nördlicher Begleiter der Donau mit
einigen pittoresken Felspartien aus der umgebenden Humusschicht zutage
tritt und durch die in malerischen Windungen aus dem weiten Talkessel des
schwäbischen Rieses nach Süden strebende Wörnitz sich von seinem
nordwärts ziehenden fränkischen Bruder absetzt, krönt als weithin
sichtbares Wahrzeichen die mittelalterliche Burg 'Harburg' den
Höhenrücken. Schon früh waren hier menschliche Niederlassungen. Wenn
auch eine alte Lokalsage trügt, dass bereits zu Beginn der allgemeinen
Zeitrechnung Römer dort sich niedergelassen haben, so wird doch seit der
Besetzung der alten Provinz 'Rhaetia' (die ihren Namen der Landschaft
'Ries' in Sonderheit aufgedrückt hat) dieser Durchgangsposten von der
südlich gelegenen Provinzhauptstadt Augsburg zum Reichslimes sicher nicht
unbeachtet geblieben sein. In der Blüte des deutschen Mittelalters,
als gerade im alten Schwaben und Franken Bürgerfleiß und
Bürgerbedeutung ihren Ausdruck in den zahlreichen Reichsstädten dieses
Gebietes fanden, war Harburg als wichtigste Station zwischen den
reichsfreien Städten Donauwörth und Nördlingen ohne Zweifel von
größerer Bedeutung. In diesen Zeiten hatten die Juden als bereits
völlig städtisches Element eine, wenn auch geduldete, aber nicht
unwichtige Rolle im Leben des Bürgers zu erfüllen. Leider wissen wir aus
jenen Tagen nur Weniges, die furchtbare Zeit des 'schwarzen Todes' mit
ihrer Begleiterscheinung, den mörderischen Angriffen gegen die
Judensiedlungen, hat das Meiste vernichtet. Auch Harburg gehörte zu den
'Marterstätten' der Jahre 1348/49, die das in Mainz verwahrte sogenannte
Nürnberger Memorbuch aufzählt. Immerhin hat der Ort bereits 110 Jahre
später wieder einen Juden 'Enslin' aufgenommen (1459), dem bald ein
weiterer 'Joseph Rumolt' folgte. Für die nächsten Jahrhunderte scheint
aber die Zahl der jüdischen Bewohner Harburgs nicht allzu groß gewesen
zu sein. Die Gemeindegründung erfolgte erst am 10. März 1671
durch 5 Einwanderer aus dem Pfalz-Neuburgischen. Dieses damals
wittelsbachische Gebiet führt heute noch als Landstrich den Namen 'Die
Pfalz', zu dem die jüdischen Handeltreibenden noch immer geschäftliche
Beziehungen unterhalten. In der Gründung der Gemeinde können wir das
Zeichen für eine Festigung der politischen und wirtschaftlichen Lage der
Juden erblicken. Bereits 1675 erwirbt die junge Gemeinschaft auf dem
ungefähr 100 Meter höher südwestlich des Ortes am Wege nach Möggingen
gelegenen 'Großen Hühnerberg' einen Friedhof, der heute noch der
Gemeinde dient. Bald Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7.
Januar 1927: "Harburg an der Wörnitz. Am Steilrand des
schwäbischen Jura, dort, wo er als nördlicher Begleiter der Donau mit
einigen pittoresken Felspartien aus der umgebenden Humusschicht zutage
tritt und durch die in malerischen Windungen aus dem weiten Talkessel des
schwäbischen Rieses nach Süden strebende Wörnitz sich von seinem
nordwärts ziehenden fränkischen Bruder absetzt, krönt als weithin
sichtbares Wahrzeichen die mittelalterliche Burg 'Harburg' den
Höhenrücken. Schon früh waren hier menschliche Niederlassungen. Wenn
auch eine alte Lokalsage trügt, dass bereits zu Beginn der allgemeinen
Zeitrechnung Römer dort sich niedergelassen haben, so wird doch seit der
Besetzung der alten Provinz 'Rhaetia' (die ihren Namen der Landschaft
'Ries' in Sonderheit aufgedrückt hat) dieser Durchgangsposten von der
südlich gelegenen Provinzhauptstadt Augsburg zum Reichslimes sicher nicht
unbeachtet geblieben sein. In der Blüte des deutschen Mittelalters,
als gerade im alten Schwaben und Franken Bürgerfleiß und
Bürgerbedeutung ihren Ausdruck in den zahlreichen Reichsstädten dieses
Gebietes fanden, war Harburg als wichtigste Station zwischen den
reichsfreien Städten Donauwörth und Nördlingen ohne Zweifel von
größerer Bedeutung. In diesen Zeiten hatten die Juden als bereits
völlig städtisches Element eine, wenn auch geduldete, aber nicht
unwichtige Rolle im Leben des Bürgers zu erfüllen. Leider wissen wir aus
jenen Tagen nur Weniges, die furchtbare Zeit des 'schwarzen Todes' mit
ihrer Begleiterscheinung, den mörderischen Angriffen gegen die
Judensiedlungen, hat das Meiste vernichtet. Auch Harburg gehörte zu den
'Marterstätten' der Jahre 1348/49, die das in Mainz verwahrte sogenannte
Nürnberger Memorbuch aufzählt. Immerhin hat der Ort bereits 110 Jahre
später wieder einen Juden 'Enslin' aufgenommen (1459), dem bald ein
weiterer 'Joseph Rumolt' folgte. Für die nächsten Jahrhunderte scheint
aber die Zahl der jüdischen Bewohner Harburgs nicht allzu groß gewesen
zu sein. Die Gemeindegründung erfolgte erst am 10. März 1671
durch 5 Einwanderer aus dem Pfalz-Neuburgischen. Dieses damals
wittelsbachische Gebiet führt heute noch als Landstrich den Namen 'Die
Pfalz', zu dem die jüdischen Handeltreibenden noch immer geschäftliche
Beziehungen unterhalten. In der Gründung der Gemeinde können wir das
Zeichen für eine Festigung der politischen und wirtschaftlichen Lage der
Juden erblicken. Bereits 1675 erwirbt die junge Gemeinschaft auf dem
ungefähr 100 Meter höher südwestlich des Ortes am Wege nach Möggingen
gelegenen 'Großen Hühnerberg' einen Friedhof, der heute noch der
Gemeinde dient. Bald |
 nimmt
die Zahl der jüdischen Einwohner zu; am 5. November 1794 werden 322
Seelen gezählt. In die Zeit des 18. Jahrhunderts fallen naturgemäß auch
sonstige Zeugen der ehemaligen Größe, vor allem der Bau der Synagoge. nimmt
die Zahl der jüdischen Einwohner zu; am 5. November 1794 werden 322
Seelen gezählt. In die Zeit des 18. Jahrhunderts fallen naturgemäß auch
sonstige Zeugen der ehemaligen Größe, vor allem der Bau der Synagoge.
Diese ist in ihrer äußeren Gestalt zu den stattlichsten Gebäuden des
zwischen Fels und Fluss eng zusammengepressten Städtchens zu rechnen. An
der ehemaligen Poststraße nach Nördlingen gelegen, die heute durch
Neuanlage der Staatsstraße Nebenstraße geworden ist und den Namen
'Egelsee' führt, erhebt sich das hohe Gebäude, das in den
Untergeschossräumen die frühere Rabbinerwohnung sowie die heute noch
benützte Gemeindestube und die Mikwah enthält. Im ersten Stock betreten
wir die Männersynagoge und sind durch den hohen, luftigen,
tonnengedeckten Raum sofort gefesselt. Unser Blick wird vorzugsweise von
dem als hervorragendes Kunstwerk anzusprechenden Almemor angezogen. In
seiner reizvollen Rokoko-Holzschnitzerei, die aber als echtes Produkt
einer schon eklektisch gewordenen Zeit Anklänge an frühere Stilformen
aufweist, gibt er mit seiner heiteren, auf die Töne Weiß, Blau, Gold und
Grün gestimmten Farblichkeit ein gutes Bild vom handwerklichen Können
seiner Entstehungszeit, der Mitte des 18. Jahrhunderts. Zu diesem
prächtigen Stück stehen die übrigen Einrichtungsgegenständen in gutem
Einklang. Der Aron ha-Kodesch beherrscht in seiner strengeren
Linienführung neben dem die Mitte des quadratischen Hauptraums
einnehmenden Almemor den Gesamteindruck; so werden die beiden den
religiösen Funktionen dienenden Aufbauten in ihrer Bedeutung richtig
betont. Der zur Ostwand gerichtete Blick des Beters wird durch das Schriftwort
(hebräisch und deutsch:) Ich halte mir Gott ständig vor Augen, Psalm
16,8 in eindringlicher Form erneut an den Zweck des Hauses gemahnt.
Darunter erinnert die Angabe des Erbauungsjahres 'im Jahre 514 nach der
kleinen Zählung' (5514 = /154) an die Entstehungszeit. Ein Blick von
der die Westseite einnehmenden Frauenempore auf die mächtig aufsteigende
Gewölbetonne, auf die fein abgewogene Vertikalgliederung, vermittelt die
volle Wirkung des Raumes. Wir schön muss das Gotteshaus erschienen sein,
wenn die große Chanukka-Menorah, die Hängeleuchter und
Wand-Kerzenträger in ihrer heiter-festlichen Rokokogestaltung in vollem
Glanze erstrahlten!
Von der nun leider nicht mehr lebenerfüllten Pracht vergangener Tage
zeugen einzelne noch erhaltene Parochot, besonders ein in freudiger Farbenstickerei
mit Vögeln und Blumen auf maiengrünem Grunde geziertes. In anderer Weise
von dem ehemaligen Leben der Gemeinde erzählen uns die Beschriftungen
anderer Vorhänge, bzw. des der Gemeinde gehörigen Toraschmucks. Da
erfahren wir, dass die Lern-Chewra (Chewrat Kadischa Delomdei Schass
Babli) bereits im Jahre 1775 (5535) aus Schild, Krone und Zeiger
bestehende silber-vergoldete Torageräte (tüchtige kunsthandwerkliche
Arbeit) dem Gottesdienste widmen konnte. Die gleiche Bruderschaft spendete
einen heute noch seinem Zwecke dienenden Vorhang im Jahre 1795 (5555). Der
fromme Wissenseifer in der Gemeinde führte im Jahre 1802 (5562) zur
Gründung einer zweiten Chewra für agadische Vorträge (Chewrat
Kadischa Deagatatah), die im Jahre 1838 (5598) einen Vorhang und im
Jahre 18467 (5606) auch einen, allerdings weniger wertvollen und
künstlerisch nicht so hochstehenden, vollständigen Toraschmuck stiftete.
Im 18. Jahrhundert, in der Blütezeit der Gemeinde, entstand ferner das
auf dem Almemor aufliegende auf Pergament |
 geschriebene Memorbuch. Dieses muss, wie aus dem Fürstengebet für
Grab Philipp Karl von Oettingen-Wallerstein (regierte auch über Harburg
bis zu seinem im Jahre 1766 erfolgten Tode) hervorgeht, im zweiten Drittel
des 18. Jahrhunderts entstanden sein. Sein sonstiger Inhalt geht über den
gebräuchlichen Jiskor-Schematismus nicht hinaus. Als persönliche Notiz
erfahren wir nur, dass der im Jahre 1828 verstorbene Gemeindevorstand, Vorbeter
und Mohel Jakob Moscheh ben Elieser Lipmann Hechinger, der auch im
öffentlichen leben seiner Zeit hervortrat und als Hoffaktor dem
Wallerstein'schen Fürstenhause Dienste leistete, sein bisheriges Wohnhaus
der Gemeinde zur Einrichtung eines Schul- und Armenhauses
hinterließ.
geschriebene Memorbuch. Dieses muss, wie aus dem Fürstengebet für
Grab Philipp Karl von Oettingen-Wallerstein (regierte auch über Harburg
bis zu seinem im Jahre 1766 erfolgten Tode) hervorgeht, im zweiten Drittel
des 18. Jahrhunderts entstanden sein. Sein sonstiger Inhalt geht über den
gebräuchlichen Jiskor-Schematismus nicht hinaus. Als persönliche Notiz
erfahren wir nur, dass der im Jahre 1828 verstorbene Gemeindevorstand, Vorbeter
und Mohel Jakob Moscheh ben Elieser Lipmann Hechinger, der auch im
öffentlichen leben seiner Zeit hervortrat und als Hoffaktor dem
Wallerstein'schen Fürstenhause Dienste leistete, sein bisheriges Wohnhaus
der Gemeinde zur Einrichtung eines Schul- und Armenhauses
hinterließ.
Dieses Gebäude, ein einstockiges Haus, befindet sich in der gleichen
Straße 'Egelsee' etwas unterhalb der Synagoge in der gegenüberliegenden
Häuserreihe. Der einfache Bau ist durch nichts ausgezeichnet; nur eine
Inschrifttafel, die in anmutiger Weise den Namen des Stifters mit dem
schönen Worte der Schrift 'Wie schon sind deine Zelte, Jakob', 4. Mose
24,5 verknüpft, deutet zugleich auf den neuen Zweck des Hauses hin.
Hechingers Familie hatte sich zuvor am oberen Ende des Marktplatzes ein
neues stattliches Haus errichten lassen, dessen Stirnseite von einem Oval
geziert ist, das über dem Monogramm und der Jahrzahl 1807 das Wort 'W'SchMRK''
aufweist, das den Zahlenwert [5]567 (1807) sowie den zwanglosen Sinn 'Ich
werde Dich behüten' ergibt. Auch andere Häuser, die in ihrer Stattlichkeit
eine Zierde des Städtchens sind, waren früher im Besitze von jüdischen
Einwohnern. Der Zug nach der größeren Stadt hat leider inzwischen die
Zahl der Juden verringert. Diese Tatsache wird besonders auf dem oberhalb
der Burg gelegenen Friedhof zum Bewusstsein des Besuchers dringen.
Die riesige Fläche, deren Bestand an Grabdenkmälern durch einen
eigenartigen Vorfall verringert wurde, als die Franzosen im Jahre 1800 in
seiner Nähe biwakierten und die hölzernen Denkmale als Feuerholz
verwendeten, macht die ehemalige Größe und den jetzigen Niedergang der
Gemeinde anschaulich. Die größtenteils dem 19. Jahrhundert entstammenden
Steine geben ein treffliches Bild der vom ästhetischen Gesichtspunkte
nicht besonders erfreulichen Entwicklung der Grabmalkunst und zeigen, wie
manch einfaches Grabmal aus dem Anfang des Jahrhunderts an Würde und
Eindruckskraft die pompösen Steine der letzten Jahrzehnte
überragt." |
Auflösung der Israelitischen Kultusgemeinde Harburg
(1936)
 Artikel in
der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juli 1936: "Bekanntmachung
über Auflösung der Israelitischen Kultusgemeinde Harburg. Artikel in
der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juli 1936: "Bekanntmachung
über Auflösung der Israelitischen Kultusgemeinde Harburg.
Der Rat des Verbandes hat in seiner Sitzung vom 28./29. Juni 1936 nach Anhörung
des zuständigen Bezirksrabbinats auf Grund des § 28 der
Verbandsverfassung beschlossen:
1. Bei der Kultusgemeinde Harburg sind die Voraussetzungen dafür gegeben,
dass diese Kultusgemeinde als aufgelöst anzusehen ist.
2. Die Auflösung der Kultusgemeinde Harburg wird als eingetreten erklärt.
Dieser Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht unter Hinweis
auf § 28 der Verbandsverfassung, laut welchem gegen den Beschluss jedem
Gemeindemitglied binnen einer Frist von einem Monat nach dieser
Bekanntmachung die Beschwerde zum Landesschiedsgericht des Verbandes
zusteht. Die Beschwerdefrist beginnt mit Veröffentlichung dieser
Bekanntmachung.
München, den 9. Juli 1936. Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden.
Dr. Neumeyer." |
Harburg gehört zum Gebiet der Israelitischen Kultusgemeinde
Nördlingen (1936)
 Bekanntmachung
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
September 1936: "Bekanntmachung über Ausdehnung des Gebietes der
Israelitischen Kultusgemeinde Nördlingen auf das Gebiet der politischen
Gemeinde Harburg. Bekanntmachung
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
September 1936: "Bekanntmachung über Ausdehnung des Gebietes der
Israelitischen Kultusgemeinde Nördlingen auf das Gebiet der politischen
Gemeinde Harburg.
Die Verwaltung der Israelitischen Kultusgemeinde Nördlingen, zugleich
Steuerverbandsvertretung, hat am 30. August 1936 folgenden Beschluss
gefasst:
Gemäß § 2 des religionsgesellschaftlichen Steuergesetzes dehnt die
Israelitische Kultusgemeinde Nördlingen ihr Gebiet auf das Gebiet der
politischen Gemeinde Harburg
aus.
Dieser Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Den an der Umbildung Beteiligten, insbesondere den von der Umbildung betroffenen
umlagenpflichtigen Bekenntnisgenossen, wird hiermit Gelegenheit zur
Einsprache gegeben. Die Einsprache soll genau die Gründe darlegen, welche
gegen die bekannt gegebene Umbildung angeführt werden wollen. Die
Einsprache muss binnen einer vom 20. September 1936 ab laufenden Frist von
zwei Wochen bei der Verwaltung der Israelitischen Kultusgemeinde
Nördlingen schriftlich eingereicht werden.
Nördlingen, den 7. September 1936.
Für die Verwaltung der Israelitischen Kultusgemeinde
Nördlingen.
Jacob Seligmann, I. Vorstand. Friedrich Levite." |
Zur Geschichte der Gemeinde - Artikel von 1937
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
Januar 1937: "Vom Schicksal kleinerer jüdischer Gemeinden in
Bayern: Harburg und Nördlingen. Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
Januar 1937: "Vom Schicksal kleinerer jüdischer Gemeinden in
Bayern: Harburg und Nördlingen.
Die exakte, aus Archiven geschöpfte Arbeit von Professor Ludwig
Müller: 'Beiträge zur Geschichte der jüdischen Gemeinde im Ries'
(Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben und Neuburg,
Jahrgänge 1899 und 1900) enthält auch nähere Angaben über die beiden
hier behandelten Gemeinden Harburg und Nördlingen. Über die ältesten
Zeiten (bis 1238) geben die Nachweise in dem in der Gemeindezeitung
öfters erwähnten Sammelwerk 'Germania Judaica' (Breslau 1934) die
nötigen Ergänzungen. Noch am Anfang des 19. Jahrhunderts bestanden im
Ries die jüdischen Gemeinden Aufhausen
unter Schenkenstein, Ederheim,
Erdlingen (Kleinerdlingen), Hainsfahrt
Harburg, Mönchsroth, Oberdorf,
Oettingen, Pflaumloch,
Schopfloch, Steinhart
und Wallerstein. Bekannte,
besonders auch in München und in Bayern vorkommende jüdische
Herkunftsnamen deuten auf diese heute in der Mehrzahl verschwundenen alten
jüdischen Siedlungen. Red.
I. Die jüdische Gemeinde Harburg. Im Frühjahr 1926 wurde die jüdische
Gemeinde Harburg durch Beschluss des Landesverbands bayerischer
israelitischer Gemeinden für aufgelöst erklärt, nachdem die
Mitgliederzahl dieser Gemeinde auf fünf Personen herabgesunken war. Damit
war im Zuge einer schicksalhaften Entwicklung wiederum eine einstmals
ansehnliche jüdische Gemeinde in Schwaben, das früher so reich an
bedeutenden jüdischen Landgemeinden war, erloschen.
Leider ist von den zahlreichen jüdischen Gemeinden im Ries, mit Ausnahme
von Nördlingen, wenig historisches Material erhalten, sodass es heute
schwer ist, sich ein genaues Bild von den frühesten Judenansiedlungen im
Ries und deren Entwicklung bis in die letzten Jahrzehnte zu machen.
Immerhin soll in memoriam der erloschenen jüdischen Gemeinde Harburg
auf Grund der dürftig vorhandenen geschichtlichen Unterlagen ein kurzer
Bericht über sie gegeben werden. Wie bei den meisten deutschen
Judensiedlungen lässt sich auch bei Harburg nicht feststellen, wann die
ersten Juden nach diesem Ort gekommen sind. Da bereits um 1241 Juden in
Donauwörth wohnten, das Gleiche auch für Nördlingen feststehen dürfte,
wird man in der Annahme wohl nicht fehlgehen, dass um diese Zeit auch in
Harburg, das an der damals wichtigen Handelsstraße zwischen diesen beiden
Orten liegt, Juden wohnhaft waren (Anmerkung 1: Die im nachfolgenden
wiedergegebenen historischen Details stützen sich im wesentlichen auf die
ausgezeichnete Darstellung 'Aus fünf Jahrhunderten', Beiträge zur
Geschichte der jüdischen Gemeinden im Ries, von Prof. Dr. L. Müller,
Augsburg 1899). Die erste historische überlieferte Kunde von Juden in
Harburg stammt aus dem Jahre 1348 und wird uns durch das Nürnberger
Memorbuch (Anmerkung 2: Das Martyrologium des Nürnberger Memorbuches,
herausgegeben von Sigmund Salfeld, Berlin 1898) überliefert, denn dort
wird Harburg als eine der Marterstätten zur Zeit des Schwarzen Todes
aufgeführt. Am Anfang des geschichtlich verbürgten Daseins der Harburger
Juden stehen also Verfolgungen, Leiden und |
 Martyrium,
die sie auch in der Folge begleitet haben. Ein weiteres historisches
Dokument aus der frühen Zeit der Harburger Judensiedlung stellt der
Judenschutzbrief dar, den Graf Wilhelm von Öttingen-Wallerstein dem Juden
Joseph Rumold von Günzburg im Jahre 1463 gewährte. In diesem
Judenschutzbrief ist ein jährliches Schirmgeld von 2 Gulden auf die Dauer
von drei Jahre bestimmt, das sich für das erste Jahr auf 5 Gulden und
für die beiden weiteren Jahre auf 6 Gulden erhöht, wenn Joseph Rumold
seinem Schwiegersohn Abraham Verpflegung und Unterkunft in seinem Hause in
Harburg gewährt. Dieses Schutzverhältnis konnte beiderseits mit einer
Frist von einem halben Jahre aufgekündigt werden. Martyrium,
die sie auch in der Folge begleitet haben. Ein weiteres historisches
Dokument aus der frühen Zeit der Harburger Judensiedlung stellt der
Judenschutzbrief dar, den Graf Wilhelm von Öttingen-Wallerstein dem Juden
Joseph Rumold von Günzburg im Jahre 1463 gewährte. In diesem
Judenschutzbrief ist ein jährliches Schirmgeld von 2 Gulden auf die Dauer
von drei Jahre bestimmt, das sich für das erste Jahr auf 5 Gulden und
für die beiden weiteren Jahre auf 6 Gulden erhöht, wenn Joseph Rumold
seinem Schwiegersohn Abraham Verpflegung und Unterkunft in seinem Hause in
Harburg gewährt. Dieses Schutzverhältnis konnte beiderseits mit einer
Frist von einem halben Jahre aufgekündigt werden.
Offenbar wohnten zur damaligen zeit und auch in den folgenden
Jahrhunderten nur einzelne Judenfamilien in Harburg, denn zu einer
förmlichen Gemeindegründung scheint es erst im Jahre 1671 gekommen zu
sein, als anlässlich einer Judenvertreibung aus dem pfalz-neuburgischen
Gebiete die Gründung einer jüdischen Gemeinde zu Harburg durch Graf
Albrecht Ernst von Oettingen genehmigt wurde.
Die Entwicklung der jüdischen Gemeinde Harburg bis zu ihrem Erlöschen
kann wohl am besten die nachfolgende Zusammenstellung über die
Bevölkerungsbewegung in ihr illustrieren. Die Gemeindegründung am 10.
März 1671 erfolgte durch 5 Einwanderer aus dem Pfalz-Neuburgischen. Im
Jahre 1707 zählte die Gemeinde 25 Familien. Die Gemeinde vergrößerte
sich in den folgenden Jahren zusehends und dürfte in der Zeit zwischen
1735 und 1770, der Epoche starker jüdischer Landgemeinden in
Süddeutschland, ihre größte Seelenzahl mit 58 Familien erreicht haben.
Um 1800 trat ein leichter Rückgang auf 51 Familien mit ca. 300 Personen
ein. Das 19. Jahrhundert mit seinem charakteristischen Zug der auf dem
Lande wohnenden Juden in die Stadt und der schon damals beträchtlichen
Auswanderung deutscher Landjuden nach den Vereinigten Staaten von
Nordamerika und England kommt in der andauernden Abnahme der Zahl der
Gemeindemitglieder sehr prägnant zum Ausdruck, denn vom Jahre 1794, in
dem noch 322 Juden in Harburg gezählt wurden, fiel ihre Zahl auf 65 Juden
im Jahre 1899: Das Schwergewicht des deutschen Judentums hatte sich im
Jahrhundert der Emanzipation und des Kapitalismus in die großen Städte
verlagert; eine jüdische Gemeinde wie Harburg war durch diese Entwicklung
sowohl in jüdischer als auch wirtschaftlicher Hinsicht zur
Bedeutungslosigkeit verurteilt. Auch im 20. Jahrhundert nahm die Gemeinde
zusehends ab; den letzten Anstoß zur Auflösung der Gemeinde gab die
Auswanderung der vergangenen Jahre, besonders nach Erez Jisrael, sodass
heute (1936/37) nur noch 5 Juden, wie seinerzeit bei der Gemeindegründung
(1671) in Harburg wohnen.
Einige weitere soziologische Einzelheiten sollen das Bild der alten
Judengemeinde Harburg ergänzen.
Auf Grund der anlässlich der Erneuerung der Schutzbriefe seitens der
oettingischen Herrschaft gezahlten Judenschutzlosungs-Konsensgelder sind
uns auch Unterlagen über die Vermögensverhältnisse der Juden in Harburg
erhalten. So wurde im Jahre 1750 das Gesamtvermögen der
Gemeindemitglieder von Harburg und Deggingen auf 81.000 Gulden, im Jahre
1770 das der Harburger Juden allein auf 92.000 Gulden geschätzte. Für
die Jahre 1788 und 1806 sind die einschlägigen Ziffern 127.250 Gulden und
140.600 Gulden. Auf die einzelne Familie entfiel im Durchschnitt pro Jahr
in Harburg ein Schutzlosungsconsensgeld von 5 Gulden 4 3/4 Kreuzer.
Weitere Abhaben, auf die in diesem Zusammenhang nicht näher eingegangen
werden kann, waren besonders das Kleppar-, Gänse-, Synagogen- und
Herbergsgeld. Erwähnung in diesem Zusammenhang verdient auch die 10 %-ige
Nachsteuer vom gesamten Vermögen, die dann in Betracht kam, wenn ein Jude
freiwillig aus den oettingischen Landen auswanderte - ein Vorläufer
unserer heutigen Reichsfluchtsteuer. Betrachtet man die Juden im Ries im
17. Jahrhundert auf ihre berufliche Zusammensetzung hin, so kamen folgende
Erwerbstätigkeiten in Betracht: Vor allem Pferde-, Vieh- und
Güterhandel, Handel mit Ziehfristen, Darlehensgewährung, Handel mit
Koscherwein, Ringen und dergleichen, Pferdeverleihung,
Geschäftsvermittlung, ferner 'schlechter und geringes Gewerbe', also
Gelegenheitsgeschäfte, die dem Lebensstandard von 'Luftmenschen'
entsprechen.
Aus der Masse der Harburger Juden ragt der Name Jacob Hechingers hervor,
der von der Fürstin Wilhelmine im Jahre 1803 zum Hoffaktor am Hofe zu
Oettingen-Wallerstein wegen seiner dem Fürstenhaus 'geleisteten
nützlichen Dienste' ernannt wurde. Es war dies wohl eine der letzten
Ernennungen von Juden zu Hoffaktoren an einem deutschen Fürstenhof.
Die jüdische Gemeinde in Harburg gehörte zunächst dem
oettingen-oettingischen Landrabbinat mit dem Sitz in Oettingen an. 1743
schied sie aus dem Verband des Landesrabbinats Oettingen aus und wurde dem
Bezirk des Landrabbinats Wallerstein zugeteilt. In der Zeit der größten
Gemeindemitgliederzahl besaß die Gemeinde vorübergehend einen eigenen
Ortsrabbiner. - Beim Gang durch Harburg fällt dem jüdischen Besucher vor
allem die stattliche, sehr idyllisch an der Wörnitz gelegene Synagoge
auf. Ihre spitzbogigen Fenster spiegeln sich im Wasser des langsam
dahinströmenden Flusses. Das Auftreten dieser scheinbar gotischen Formen
darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Synagoge erst im
Jahre 1754 erbaut wurde. Der Judenfriedhof der Gemeinde Harburg,
dessen Entstehung auf das Jahr 1675 zurückgeht, liegt in einiger
Entfernung vom Orte. Am großen Hühnerberg, auf einer Hochfläche, an
einem Wald angelehnt, streckt er sich lang dahin. Wie so viele jüdische
Friedhöfe birgt auch er Märtyrer unseres Volkes und Glaubens -
Holzgrabsteine erinnern an dieses jüdische Heldentum. Dr. Ludwig Mayer,
Augsburg." |
Zur Geschichte des Rabbinates
in Harburg
Provisorische Besetzung der Lehrerstelle, Schwierigkeiten bei der Rabbiner-Wahl
und Tod des Gemeindevorstehers Joseph Goldschmidt (1839)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. August 1839:
"Harburg (Provinz Schwaben in Bayern). 15. Juli. Schon in No.
70 wurde Ihnen von hieraus gemeldet, welche Hindernisse sich der hiesigen
Gemeinde in der Wahl eines Rabbinen entgegenstellen. Gleiches findet nun
mit der definitiven Wiederbesetzung der Gemeindelehrerstelle statt.
Nachdem diese bereits vier Wochen in öffentlichen Blättern
ausgeschrieben war, lief von einer hohen königlichen Regierung für
Schwaben und Neuburg das Reskript ein, durch welches kund gegeben wird,
dass es noch nicht entschieden sei, ob die hiesige israelitische Gemeinde
bei der vorzunehmenden Lehrerwahl das Präsentationsrecht habe? Die
erwähnte Behörde schickte daher provisorisch einen Herrn Berolzheimer,
früheren Privatlehrer als Verweser der Schule her. So befindet sich die
Gemeinde in der eigenen Lage, nur provisorische Beamte zu haben. - Vor
Kurzem starb hier der früher Parnas, Joseph Goldschmid seligen
Andenkens. Bei einem nicht zu beträchtlichen Vermögen hat derselbe
eine ungemessene Wohltätigkeit gegen Bedürftige jeder Konfession geübt,
und auch sein Testament bekundete dies. Derselbe vermachte 2.000 Gulden,
von deren Zinsen Holz für die israelitischen Armen angekauft werden
sollen, 500 Gulden, um die Zinsen zum Ankauf von Ostermehl anzuwenden, 200
Gulden, deren Zinsen an die christlichen Armen zu verteilen sind usw.
Möchte es immer der Ruhm der Israeliten bleiben, der Barmherzigkeit voll
zu sein! H." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. August 1839:
"Harburg (Provinz Schwaben in Bayern). 15. Juli. Schon in No.
70 wurde Ihnen von hieraus gemeldet, welche Hindernisse sich der hiesigen
Gemeinde in der Wahl eines Rabbinen entgegenstellen. Gleiches findet nun
mit der definitiven Wiederbesetzung der Gemeindelehrerstelle statt.
Nachdem diese bereits vier Wochen in öffentlichen Blättern
ausgeschrieben war, lief von einer hohen königlichen Regierung für
Schwaben und Neuburg das Reskript ein, durch welches kund gegeben wird,
dass es noch nicht entschieden sei, ob die hiesige israelitische Gemeinde
bei der vorzunehmenden Lehrerwahl das Präsentationsrecht habe? Die
erwähnte Behörde schickte daher provisorisch einen Herrn Berolzheimer,
früheren Privatlehrer als Verweser der Schule her. So befindet sich die
Gemeinde in der eigenen Lage, nur provisorische Beamte zu haben. - Vor
Kurzem starb hier der früher Parnas, Joseph Goldschmid seligen
Andenkens. Bei einem nicht zu beträchtlichen Vermögen hat derselbe
eine ungemessene Wohltätigkeit gegen Bedürftige jeder Konfession geübt,
und auch sein Testament bekundete dies. Derselbe vermachte 2.000 Gulden,
von deren Zinsen Holz für die israelitischen Armen angekauft werden
sollen, 500 Gulden, um die Zinsen zum Ankauf von Ostermehl anzuwenden, 200
Gulden, deren Zinsen an die christlichen Armen zu verteilen sind usw.
Möchte es immer der Ruhm der Israeliten bleiben, der Barmherzigkeit voll
zu sein! H." |
| |
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. Mai 1840:
"Harburg (Schwaben), 15. April (1840). In No. 70 und 83
vorigen Jahres wurde Ihnen bereits berichtet, welche Hindernisse in der
Wahl einen eigenen Rabbinen gestellt wurden. Nachdem wir unser Recht durch
die hohe Königliche Regierung verwahrt behielten, beeile ich mich, Ihnen
durch Gegenwärtiges die Nachricht mitzuteilen, dass in Folge der heute
hier stattgehabten Rabbinen-Wahl unter neun Bewerbern Herr
Rabbinatskandidaten Elkan Selz von hier, der sich schon an mehrere
Jahre in München aufhält, den Preis davon trug. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. Mai 1840:
"Harburg (Schwaben), 15. April (1840). In No. 70 und 83
vorigen Jahres wurde Ihnen bereits berichtet, welche Hindernisse in der
Wahl einen eigenen Rabbinen gestellt wurden. Nachdem wir unser Recht durch
die hohe Königliche Regierung verwahrt behielten, beeile ich mich, Ihnen
durch Gegenwärtiges die Nachricht mitzuteilen, dass in Folge der heute
hier stattgehabten Rabbinen-Wahl unter neun Bewerbern Herr
Rabbinatskandidaten Elkan Selz von hier, der sich schon an mehrere
Jahre in München aufhält, den Preis davon trug.
Die hiesige israelitische Kultusgemeinde ist schon längere Jahre ohne
Seelenhirt, und sieht daher mit Erwartung der Installation und
Funktions-Antretung ihres künftigen Geistlichen entgegen." |
| |
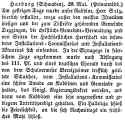 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. Juni 1840:
"Harburg (Schwaben), 20. Mai (1840). Am gestrigen Tage wurde
unser Rabbine, Herr Selz, feierlich installiert, wozu außer den meisten
Israeliten hiesiger und der zum Distrikte gehörenden Gemeinde Deggingen,
die christliche Gemeindeverwaltung und von Seiten der Hochfürstlichen
Herrschaft ein besonderer Installations-Kommissarius und
Installations-Aktuarius sich einfanden. In der Synagoge in feierlichem
Zuge angekommen wurde nach Absingung des 111. Psalms und eines deutschen
Chorals durch das von dem Schulverweser Berolzheimer trefflich geleitete
Schulchor, vom Installations-Kommissarius eine schöne Anrede an Rabbinen
und Gemeinde gehalten, das königliche Regierungsdekret verlesen, und dann
vom Rabbinen eine sehr angemessene und gediegene Antrittspredigt gehalten.
Ein Halleluja schloss die Feierlichkeit, an die sich nachmittags ein
fröhliches Mahl schloss." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. Juni 1840:
"Harburg (Schwaben), 20. Mai (1840). Am gestrigen Tage wurde
unser Rabbine, Herr Selz, feierlich installiert, wozu außer den meisten
Israeliten hiesiger und der zum Distrikte gehörenden Gemeinde Deggingen,
die christliche Gemeindeverwaltung und von Seiten der Hochfürstlichen
Herrschaft ein besonderer Installations-Kommissarius und
Installations-Aktuarius sich einfanden. In der Synagoge in feierlichem
Zuge angekommen wurde nach Absingung des 111. Psalms und eines deutschen
Chorals durch das von dem Schulverweser Berolzheimer trefflich geleitete
Schulchor, vom Installations-Kommissarius eine schöne Anrede an Rabbinen
und Gemeinde gehalten, das königliche Regierungsdekret verlesen, und dann
vom Rabbinen eine sehr angemessene und gediegene Antrittspredigt gehalten.
Ein Halleluja schloss die Feierlichkeit, an die sich nachmittags ein
fröhliches Mahl schloss." |
Aus der
Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1889 /1898
/ 1901 / 1911 / 1920 und der Stelle des Synagogendieners 1884
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1889: "Bekanntmachung.
Gemäß hoher Königlicher Regierungs-Genehmigung vom 21. vorigen Monats
ist die hiesige Religionslehrerstelle neu zu besetzen. Mit dieser Stelle
verbinden sich die Funktionen eines Kantors und Schochets sowie auch die
Aufsicht als Kabron. Nach der festgesetzten Fassion beträgt das Einkommen
inklusive Nebenverdiensten und Wohnung Mark 1.350. Nach Ablauf von
zwei und vier Dienstjahren tritt Gehaltserhöhung ein. Seminaristisch
gebildete Bewerber wollen unter Vorlage ihrer Zeugnisse-Abschriften sich
an die unterfertigte Verwaltung wenden, wo auch die Fassions- und Funktions-Bestimmungen
erholt werden können. Reiservergütung erhält nur der Gewählte. Harburg
(Bayern) am 14. Oktober 1889. Die Verwaltung der israelitischen
Kultusgemeinde. G. Stein, Vorstand." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1889: "Bekanntmachung.
Gemäß hoher Königlicher Regierungs-Genehmigung vom 21. vorigen Monats
ist die hiesige Religionslehrerstelle neu zu besetzen. Mit dieser Stelle
verbinden sich die Funktionen eines Kantors und Schochets sowie auch die
Aufsicht als Kabron. Nach der festgesetzten Fassion beträgt das Einkommen
inklusive Nebenverdiensten und Wohnung Mark 1.350. Nach Ablauf von
zwei und vier Dienstjahren tritt Gehaltserhöhung ein. Seminaristisch
gebildete Bewerber wollen unter Vorlage ihrer Zeugnisse-Abschriften sich
an die unterfertigte Verwaltung wenden, wo auch die Fassions- und Funktions-Bestimmungen
erholt werden können. Reiservergütung erhält nur der Gewählte. Harburg
(Bayern) am 14. Oktober 1889. Die Verwaltung der israelitischen
Kultusgemeinde. G. Stein, Vorstand." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22.
September 1898: "Vakanz! Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22.
September 1898: "Vakanz!
Die hiesige Religionslehrerstelle soll neu besetzt werden. Mit
dieser Stelle verbinden sich die Funktionen eines Kantors und Schochets,
sowie die Aufsicht als Kabron. Nach der festgesetzten Fassion beträgt das
Einkommen Mark 1.400, inklusive Nebenverdiensten und Wohnung. Nach Ablauf
von zwei und vier Dienstjahren tritt Gehaltserhöhung ein. Seminaristisch
gebildete Bewerber wollen baldigst – unter Vorlage ihrer Zeugnisse –
Abschriften sich an die unterzeichnete Verwaltung wenden, woselbst sie
Aufschluss bezüglich der Funktions- und Fassions-Bestimmungen erhalten.
Kandidaten, mit guten Stimmmitteln begabt, erhalten den Vorzug. Zur
Erteilung von Privatunterricht ist Gelegenheit geboten. Reisevergütung
erhält nur der Gewählte. Harburg (Bayern), 12. September 1898.
Die Verwaltung der israelitischen Kultusgemeinde: Gerson Stein,
Vorstand." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Juli 1901:
"Die hiesige Religionslehrerstelle soll neu besetzt werden.
Mit dieser Stelle verbinden sich die Funktionen eines Kantors und
Schochets, sowie die Aufsicht als Kabron. Nach der festgesetzten Fassion
beträgt das Einkommen Mark 1.250 inklusive Nebenverdiensten und Wohnung.
Nach Ablauf von zwei Dienstjahren tritt Gehaltserhöhung ein.
Seminaristisch gebildete Bewerber wollen baldigst unter Vorlage ihrer
Zeugnis-Abschriften - sich an die unterfertigte Verwaltung wenden,
woselbst weitere Aufschlüsse zu erhalten sind. Reisevergütung erhalt nur
der Gewählte. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Juli 1901:
"Die hiesige Religionslehrerstelle soll neu besetzt werden.
Mit dieser Stelle verbinden sich die Funktionen eines Kantors und
Schochets, sowie die Aufsicht als Kabron. Nach der festgesetzten Fassion
beträgt das Einkommen Mark 1.250 inklusive Nebenverdiensten und Wohnung.
Nach Ablauf von zwei Dienstjahren tritt Gehaltserhöhung ein.
Seminaristisch gebildete Bewerber wollen baldigst unter Vorlage ihrer
Zeugnis-Abschriften - sich an die unterfertigte Verwaltung wenden,
woselbst weitere Aufschlüsse zu erhalten sind. Reisevergütung erhalt nur
der Gewählte.
Harburg (Bayern),1 4. Juli 1901. Die Verwaltung der israelitischen
Kultusgemeinde. Gerson Stein, Vorstand." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. November 1911:
"Die hiesige Religionslehrerstelle soll neu besetzt werden.
Mit dieser Stelle verbinden sich die Funktionen eines Kantors und
Schochets sowie die Aufsicht als Kabron. Die Stelle trägt ca. Mark
1.400 nebst freier Wohnung. Seminaristisch gebildete Bewerber wollen sich
gefälligst baldigst - mit Zeugnis-Abschriften - an den Unterfertigten
wenden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. November 1911:
"Die hiesige Religionslehrerstelle soll neu besetzt werden.
Mit dieser Stelle verbinden sich die Funktionen eines Kantors und
Schochets sowie die Aufsicht als Kabron. Die Stelle trägt ca. Mark
1.400 nebst freier Wohnung. Seminaristisch gebildete Bewerber wollen sich
gefälligst baldigst - mit Zeugnis-Abschriften - an den Unterfertigten
wenden.
Harburg (Bayern), 27. November 1911. Gerson Stein,
Kultus-Vorstand." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1920: "Die
Kantor- und Schochet-Stelle dahier soll neu besetzt werden. Mit dieser
Stelle ist auch verbunden die Aufsicht als Kabron. Schöne
Dienstwohnung mit kleinem Garten ist vorhanden. Gehaltsansprüche nach
Übereinkommen. Religiöse Bewerber wollen sich baldigst unter Vorlage von
Zeugnis-Abschriften an die unterfertigte Verwaltung wenden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1920: "Die
Kantor- und Schochet-Stelle dahier soll neu besetzt werden. Mit dieser
Stelle ist auch verbunden die Aufsicht als Kabron. Schöne
Dienstwohnung mit kleinem Garten ist vorhanden. Gehaltsansprüche nach
Übereinkommen. Religiöse Bewerber wollen sich baldigst unter Vorlage von
Zeugnis-Abschriften an die unterfertigte Verwaltung wenden.
Harburg in Schwaben (Bayern), 25. März 1920. Verwaltung der
israelitischen Kultusgemeinde. Gerson Stein, Vorstand." |
| Auf die letztgenannte Ausschreibung bewarb
sich erfolgreich Lehrer M. Laßmann. |
| |
| Synagogendienerstelle |
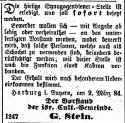 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. März 1884:
"Die hiesige Synagogendienerstelle ist erledigt, und soll sofort
besetzt werden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. März 1884:
"Die hiesige Synagogendienerstelle ist erledigt, und soll sofort
besetzt werden.
Bewerber wollen sich - mit Angabe, ob ledig oder verheiratet - an den
unterfertigten Vorstand wenden, wobei bemerkt wird, dass solche Personen,
welche auch als Schochet zu verwenden sind, besonders berücksichtigt
werden; mit dieser Stelle ist auch die Funktion eines Kabron verbunden.
Der Gehalt wird nach besonderem Übereinkommen bestimmt.
Harburg in Bayern, am 2. März 1884. Der Vorstand der
Israelitischen Kultusgemeinde G. Stein." |
Lehrer Maier Laßmann verlässt die Gemeinde (1925; Lehrer in Harburg von 1920
bis 1925)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Mai 1925: "Harburg (Schwaben), 5.
April (1925). Nach einer nahezu fünfjährigen Wirksamkeit in der hiesigen
israelitischen Kultusgemeinde verlässt Herr M. Lassmann seinen hiesigen
Posten als Kultusbeamter, um die vakante Stelle in Westheim
bei Hammelburg anzutreten. Obwohl wir Herrn Lassmann nur ungern von
hier scheiden sehen, so gönnen wir ihm doch seine bedeutende Verbesserung
in seinem neuen Wirkungskreise. Wir verlieren an ihm einen tüchtigen
Lehrer und vorzüglichen Vorbeter, besonders auch eine friedliebende und
charaktervolle Persönlichkeit. Unsere herzlichsten Glückwünsche
begleiten ihn und seine lieben Angehörigen nach seinem neuen
Wirkungskreise!" Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Mai 1925: "Harburg (Schwaben), 5.
April (1925). Nach einer nahezu fünfjährigen Wirksamkeit in der hiesigen
israelitischen Kultusgemeinde verlässt Herr M. Lassmann seinen hiesigen
Posten als Kultusbeamter, um die vakante Stelle in Westheim
bei Hammelburg anzutreten. Obwohl wir Herrn Lassmann nur ungern von
hier scheiden sehen, so gönnen wir ihm doch seine bedeutende Verbesserung
in seinem neuen Wirkungskreise. Wir verlieren an ihm einen tüchtigen
Lehrer und vorzüglichen Vorbeter, besonders auch eine friedliebende und
charaktervolle Persönlichkeit. Unsere herzlichsten Glückwünsche
begleiten ihn und seine lieben Angehörigen nach seinem neuen
Wirkungskreise!" |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der Gemeinde
Über die Verdienste von Nathan Hechinger (1843)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9. Oktober 1843:
"Aus Bayern, im September (1843). Unsere Stände sind auseinander
gegangen. Was sie für uns Israeliten getan, ist männiglich bekannt, und
eine Dankadresse wäre nicht am unrechten Orte gewesen. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9. Oktober 1843:
"Aus Bayern, im September (1843). Unsere Stände sind auseinander
gegangen. Was sie für uns Israeliten getan, ist männiglich bekannt, und
eine Dankadresse wäre nicht am unrechten Orte gewesen.
Herr Nathan Hechinger in Harburg, ein Mann, der sich auch in gemeindlicher
Beziehung manches Verdienst erworben haben soll, hat für seine Leistungen
in der Feldwirtschaft von dem landwirtschaftlichen Verein für Schwaben
und Neuburg die silberne Medaille samt Preisbuch erhalten. Es ist dies
schon der zweite Fall dieser Art, welchen ich Ihnen zu berichten die
Freude habe. Möchten unsere Reichen nur fortfahren, in diesem Gebiete
Ausgezeichnetes zu leisten; es kann ihnen und dem gesamten Israel nur zum
vielfachen Frommen gereichen." |
Zum Tod von Lippmann Hechinger (1870)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. April 1870:
"Mainz, 26. April (1870). Am zweiten Tage des Pessachfestes hat die
israelitische Gemeinde zu Harburg im Ries einen großen Verlust erlitten;
es starb nämlich Herr Lippmann Hechingen - seligen Andenkens,
Rentner daselbst, einer der geachtetsten Männer der dortigen Gegend, den
Frömmigkeit, Wohltätigkeit, Rechtschaffenheit und alle bürgerlichen
Tugenden in reichem Maße schmückten. Da der Heimgegangene ein naher
Verwandter des Herausgebers dieser Blätter gewesen, so war dieser zu dem
am ersten der Halbfeiertage (= 18. April 1870) stattgehabten Begräbnisse
gereist. Das Begräbnis bezeigte die allgemeine Teilnahme, da sich zu
demselben die ganze Stadt und viele Fremde eingefunden hatten, sodass die
Teilnehmer nach vielen Hunderten zählten. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. April 1870:
"Mainz, 26. April (1870). Am zweiten Tage des Pessachfestes hat die
israelitische Gemeinde zu Harburg im Ries einen großen Verlust erlitten;
es starb nämlich Herr Lippmann Hechingen - seligen Andenkens,
Rentner daselbst, einer der geachtetsten Männer der dortigen Gegend, den
Frömmigkeit, Wohltätigkeit, Rechtschaffenheit und alle bürgerlichen
Tugenden in reichem Maße schmückten. Da der Heimgegangene ein naher
Verwandter des Herausgebers dieser Blätter gewesen, so war dieser zu dem
am ersten der Halbfeiertage (= 18. April 1870) stattgehabten Begräbnisse
gereist. Das Begräbnis bezeigte die allgemeine Teilnahme, da sich zu
demselben die ganze Stadt und viele Fremde eingefunden hatten, sodass die
Teilnehmer nach vielen Hunderten zählten.
Es ergab sich nun die Frage, ob am Sarge gesprochen werden dürfe oder
nicht. Eine eigentliche Leichenrede (Hesped) war der Halbfeiertage
wegen nicht gestattet; (siehe Schulchan Aruch Orach Chajim c. 547 § 1,
Joreh Deah c. 01, § 1), jedoch einige Worte des Lobes und der Mahnung zu
sprechen, ist nach Lebusch c. 696, angeführt von Magen Abraham c. 547, §
6 gestattet, wenn es sich um einen Gelehrten (Talmid Chacham)
handelt. Wiewohl nun Magen Abraham moniert, dass es in unseren Tagen
keinen Talmid Chacham gibt, so hat man hier in Mainz doch seit
uralten Zeiten jene Ausnahme auf jeden frommen rechtlichen Menschen
ausgedehnt, und so hat denn auch der Herausgeber dieser Blätter schon
oftmals diesem Gebrauche entsprechend gehandelt. Er hat demnach auch nicht
Anstand genommen, dem dringenden Wunsche der Familie nachzugeben und als
Freund und Verwandter nach dem Ortsrabbinen Herrn Selz, an der Leiche des
seligen Hechinger einige Worte der Erinnerung und des Lobes zu sprechen
und die Hinterbliebenen zu ermahnen, in den Fußstapfen des
Dahingeschiedenen zu wandeln.
Der Verewigte hat durch letztwillige Verfügung einige Tausend Gulden zu verschiedenen
milden Stiftungen bestimmt. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." |
Zum Tod von Dr. Henriette Mayer geb. Hechinger (1892)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Februar 1892:
"Nürnberg. Mittwoch, den 19. Schewat (= 17. Februar 1892), verschied
im Alter von 59 Jahren nach nur kurzem Leiden Frau Dr. Henriette Mayer,
geborene Hechinger. Die Verblichene, aus hoch angesehener Familie, war von
väterlicher Seite eine Enkelin des frommen und talmudgelehrten Hofagenten
Jacob Hechinger - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - in Harburg, von mütterlicher Seite stammte sie von dem frommen und
talmudgelehrten Jacob Mayer - das Andenken an den Gerechten ist zum
Segen - in Würzburg. Ihr Vater - das Andenken an den Gerechten ist
zum Segen -, Herr Lippmann Hechinger in Harburg, war nicht minder
angesehen und hochgeschätzt als Ehrenmann und strenger Jehudi. Die
Dahingeschiedene war eine würdige Nachfolgerin solcher Vorfahren, sie war
reich an seltenen Eigenschaften, dabei selbstlos in hohem Grade und nur
stets für Andere besorgt. Ihre letzten Worte waren das Schma-Gebet, das
sie mit tiefster Innigkeit sprach und dann ihr edles Leben aushauchte.
Groß und gerecht ist der Schmerz um eine solche edle Frau. Die Leiche
wurde nach dem Geburtsort der Verblichenen, nach Harburg bei Donauwörth,
verbracht und daselbst an der Seite ihrer Vorfahren - das Andenken an die
Gerechten ist zum Segen - beerdigt. Am Grabe sprach zunächst der hoch
geachtete Lehrer der Harburger Gemeinde. Er schilderte in warmen Worten
die Vorzüge der teuren Dahingeschiedenen und erinnerte auch daran, was
ihr, von Allen, die ihn kannten, hoch verehrter Vater, Herr Lippmann
Hechinger, als langjähriger Vorsteher der Gemeinde Harburg geleistet.
Dann sprach der tief gebeugte Gatte, Herr Dr. Mayer. Er stattete zunächst
dem Vorredner seinen Dank ab und schilderte dann mit Worten, die alle
Zuhörer tief ergriffen, das Leben seiner unvergleichlichen Gattin. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Februar 1892:
"Nürnberg. Mittwoch, den 19. Schewat (= 17. Februar 1892), verschied
im Alter von 59 Jahren nach nur kurzem Leiden Frau Dr. Henriette Mayer,
geborene Hechinger. Die Verblichene, aus hoch angesehener Familie, war von
väterlicher Seite eine Enkelin des frommen und talmudgelehrten Hofagenten
Jacob Hechinger - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - in Harburg, von mütterlicher Seite stammte sie von dem frommen und
talmudgelehrten Jacob Mayer - das Andenken an den Gerechten ist zum
Segen - in Würzburg. Ihr Vater - das Andenken an den Gerechten ist
zum Segen -, Herr Lippmann Hechinger in Harburg, war nicht minder
angesehen und hochgeschätzt als Ehrenmann und strenger Jehudi. Die
Dahingeschiedene war eine würdige Nachfolgerin solcher Vorfahren, sie war
reich an seltenen Eigenschaften, dabei selbstlos in hohem Grade und nur
stets für Andere besorgt. Ihre letzten Worte waren das Schma-Gebet, das
sie mit tiefster Innigkeit sprach und dann ihr edles Leben aushauchte.
Groß und gerecht ist der Schmerz um eine solche edle Frau. Die Leiche
wurde nach dem Geburtsort der Verblichenen, nach Harburg bei Donauwörth,
verbracht und daselbst an der Seite ihrer Vorfahren - das Andenken an die
Gerechten ist zum Segen - beerdigt. Am Grabe sprach zunächst der hoch
geachtete Lehrer der Harburger Gemeinde. Er schilderte in warmen Worten
die Vorzüge der teuren Dahingeschiedenen und erinnerte auch daran, was
ihr, von Allen, die ihn kannten, hoch verehrter Vater, Herr Lippmann
Hechinger, als langjähriger Vorsteher der Gemeinde Harburg geleistet.
Dann sprach der tief gebeugte Gatte, Herr Dr. Mayer. Er stattete zunächst
dem Vorredner seinen Dank ab und schilderte dann mit Worten, die alle
Zuhörer tief ergriffen, das Leben seiner unvergleichlichen Gattin.
Möge der Allgütige die Angehörigen trösten und insbesondere der
schmerzerschütterten Mutter der Dahingegangenen, die, ein leuchtendes
Vorbild aller ausgezeichneten Tugenden, so bitteres Leid erdulden muss,
die Kraft geben, den Verlust einer solchen Tochter mit Ergebung in den
Willen des Allgütigen zu tragen. Ihre Seele sei eingebunden in den
Bund des Lebens." |
Zum Tod von Herrmann Hiller (1892)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Mai 1892: "Harburg
(Bayern). Einen entsetzlichen Verlust hat unsere Gemeinde am 21. April
dieses Jahres erlitten. Herr Kaufmann Herrmann Hiller, eine wahre Perle
unseres Städtchens, wurde uns nach kaum zweitägigem Krankenlager in
Folge eines Gehirnschlages, durch einen schmerzlosen, sanften Tod, würdig
eines Frommen, entrissen; - zu früh trotz des erreichten 72. Lebensjahres
für seine Hinterbliebenen, denen er stets ein liebevoller, sorgsamer
Gatte und Bruder gewesen; zu früh für die israelitische Gemeinde, die
wieder einen Mann beim Gottesdienst verloren, da er mit
bewunderungswürdiger Pünktlichkeit als einer der ersten im Gotteshause
erschien. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Mai 1892: "Harburg
(Bayern). Einen entsetzlichen Verlust hat unsere Gemeinde am 21. April
dieses Jahres erlitten. Herr Kaufmann Herrmann Hiller, eine wahre Perle
unseres Städtchens, wurde uns nach kaum zweitägigem Krankenlager in
Folge eines Gehirnschlages, durch einen schmerzlosen, sanften Tod, würdig
eines Frommen, entrissen; - zu früh trotz des erreichten 72. Lebensjahres
für seine Hinterbliebenen, denen er stets ein liebevoller, sorgsamer
Gatte und Bruder gewesen; zu früh für die israelitische Gemeinde, die
wieder einen Mann beim Gottesdienst verloren, da er mit
bewunderungswürdiger Pünktlichkeit als einer der ersten im Gotteshause
erschien.
Herr Hiller lernte in seinen Jugendjahren Musik und machte, gut
talentiert, solch' vortreffliche Fortschritte, dass ihm eine hervorragende
Anstellung angeboten wurde, er glaubte aber die Gesetze seines heiligen
Glaubens, welche er, einem echt jüdischen Hause entstammend, stets vor
sich gesehen, nicht mehr genau beobachten zu können und verzichtete daher
lieber auf diesen Ehrenposten.
Nun widmete er sich dem Handwerke der Posamenterie und es blühte bei
seinem großen Fleiße ihm das Glück.
Viele Jahre stand der Verblichene der hiesigen israelitischen
Kultusgemeinde in Rat und Tat zur Seite; er vollführte das Amt eines
Armenpflegers und später eines Kultusvorstandes, welch' |
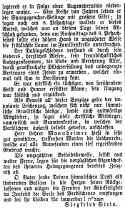 letzteres
er in Folge einer Augenoperation niederlegen musste. - Eine Reihe von
Jahren leitete er die Synagogenchor-Gesänge mit großem Eifer; ja sogar
noch am 8. Pessachtage waltete er dieses Amtes, welches nun an diesem Tage
seinen Abschluss gefunden, denn am Nachmittage des 8. Pessachfestes
(gemeint 8. Pessachtages, 19. April 1892) sollte eine höhere Hand in
ungeahnter Weise die fröhlichste Laune im Familienkreise
unterbrechen. letzteres
er in Folge einer Augenoperation niederlegen musste. - Eine Reihe von
Jahren leitete er die Synagogenchor-Gesänge mit großem Eifer; ja sogar
noch am 8. Pessachtage waltete er dieses Amtes, welches nun an diesem Tage
seinen Abschluss gefunden, denn am Nachmittage des 8. Pessachfestes
(gemeint 8. Pessachtages, 19. April 1892) sollte eine höhere Hand in
ungeahnter Weise die fröhlichste Laune im Familienkreise
unterbrechen.
Der Dahingeschiedene verstand es durch sein biederes, herzliches Wesen,
sein freundschaftliches Entgegenkommen, die Liebe und Verehrung Aller,
durch gewissenhafte Pflichterfüllung das unbegrenzte Vertrauen eines
Jeden zu erwerben, welcher einmal mit ihm in Berührung kam. Er war
wirklich ein tüchtiger, von sprühendem Geist und Humor erfüllter Mann;
sein Umgang war köstlich und erquickend.
Als Beweis all dieser Vorzüge gelte der imposante Leichenzug, welchem
sich nicht nur sämtliche israelitische hiesige, sowie auch auswärtige
Mitglieder, ja sogar viele christliche Mitbürger, namentlich aus
Beamtenkreisen, in welchen der Verblichene äußerst beliebt gewesen, anschlossen.
Herr Lehrer Mannheimer hielt in sehr gut gewählten, treffenden
Worten die Leichenrede, welche auf alle Anwesenden einen tief ergreifenden
Eindruck machte. Die ungezählten Beileidsbeweise, selbst aus weiter
Ferne, legen für die vorzüglichen Eigenschaften des teueren
Heimgegangenen beredtes Zeugnis ab.
O Vater, sende Deinen himmlischen Trost als lindernden Balsam in die
Herzen seiner Rückgelassenen und mögen die Freuden der Glückseligkeit
im Jenseits die Seele des Verblichenen empfangen und bei ihr bleiben für
immerdar! Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. Siegfried
Stein." |
Zum Tod von Samuel Stern (1893)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. März 1893: "Harburg
in Schwaben. Am 1. Schewat (= 18. Januar 1893) starb im Alter von 83
Jahren Herr Samuel Stern - er ruhe in Frieden. Mit ihm ist
einer jeder 'Alten' geschieden, die noch Jehudim von echtem und rechtem
Schlage gewesen! In streng religiösem Hause erzogen, lernte er von Jugend
an Tora, mit der er sich auch sein langes Leben lang beschäftigte.
Seine Frömmigkeit, Redlichkeit, Friedensliebe und überaus große
Einfachheit gewann ihm die Freundschaft aller, die ihn kannten. Er
vereinigte Tora mit respektvollem Benehmen. Alle 2-3 Jahre macht er
einen Sijum über Mischnajot (d.h. er schloss einen
Durchgang durch die Mischna-Abschnitte ab und begann wieder von neuem)
, das er täglich lernte. Auch gehörte er der hiesigen Chewra Mischajot
als Mitglied an." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. März 1893: "Harburg
in Schwaben. Am 1. Schewat (= 18. Januar 1893) starb im Alter von 83
Jahren Herr Samuel Stern - er ruhe in Frieden. Mit ihm ist
einer jeder 'Alten' geschieden, die noch Jehudim von echtem und rechtem
Schlage gewesen! In streng religiösem Hause erzogen, lernte er von Jugend
an Tora, mit der er sich auch sein langes Leben lang beschäftigte.
Seine Frömmigkeit, Redlichkeit, Friedensliebe und überaus große
Einfachheit gewann ihm die Freundschaft aller, die ihn kannten. Er
vereinigte Tora mit respektvollem Benehmen. Alle 2-3 Jahre macht er
einen Sijum über Mischnajot (d.h. er schloss einen
Durchgang durch die Mischna-Abschnitte ab und begann wieder von neuem)
, das er täglich lernte. Auch gehörte er der hiesigen Chewra Mischajot
als Mitglied an." |
Zum Tod von Bernhard Stein (1893)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Mai 1893: "Harburg
in Schwaben. Am 26. Nissan (12. April 1893) trugen wir den
Patriarchen unserer Gemeinde, Herrn Bernhard Stein - er ruhe in Frieden
- in einem Alter von 87 Jahren zu ewigen Ruhe. Den Entschlafenen
zierte nicht nur die Krone des Alters, sondern auch vor allem die des guten
Namens, wodurch er es verdient, dass seiner in diesen geschätzten
Blättern gedacht werden. Ein Jehudi mit Herz und Hand, in
Gesinnung, Wort und Tat, lebte er stets in unserer Heiligen Wahrheit,
geliebt, geachtet und geehrt von Jedermann, ob Israelit oder
Nichtisraelit. Er gehörte mit einem Worte zu den (hebräisch und
deutsch:) Männern der Tat, die in unserer Zeit der hohlen Phrase leider
immer seltener werden. Es ist nicht möglich, in dem kleinen Rahmen hier
sein Bild genügend oder nur annähernd zu zeichnen. Wir betonen nur die
Tatkraft, die er allezeit für Gottesdienst, Tora und Wohltätigkeit eingesetzt,
die glühende Liebe zum Judentum und sein Interesse an Allem, was dasselbe
innerlich und äußerlich berührte, seine Opferfreudigkeit und liebende
Hingabe an Bedürfnisse der Allgemeinheit. - Jahrelang war er Gabbai
(Vorsteher) der hiesigen (Vereine:) Chewra Deagadata und der Chewra
Gemilut Chassodim, alles verwaltete er zur Ehre Gottes. Des
Lebens herbe Kümmernisse ertrug er mit Gottvertrauen und hatte die
Freude, Enkel und Urenkel zu schauen, die alle in seinen Wegen wandeln und
ihn bis zum Tode in Liebe umgaben. Bei seinem Leichenbegängnisse zeigte
sich, welche Teilnahme sein Hinscheiden erweckte. Möge sein Beispiel ein
belehrendes und anregendes Vorbild für uns alle bleiben und seine
irdische Hülle in Frieden ruhen. Seine Seele sei eingebunden in den
Bund des Lebens. N.N." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Mai 1893: "Harburg
in Schwaben. Am 26. Nissan (12. April 1893) trugen wir den
Patriarchen unserer Gemeinde, Herrn Bernhard Stein - er ruhe in Frieden
- in einem Alter von 87 Jahren zu ewigen Ruhe. Den Entschlafenen
zierte nicht nur die Krone des Alters, sondern auch vor allem die des guten
Namens, wodurch er es verdient, dass seiner in diesen geschätzten
Blättern gedacht werden. Ein Jehudi mit Herz und Hand, in
Gesinnung, Wort und Tat, lebte er stets in unserer Heiligen Wahrheit,
geliebt, geachtet und geehrt von Jedermann, ob Israelit oder
Nichtisraelit. Er gehörte mit einem Worte zu den (hebräisch und
deutsch:) Männern der Tat, die in unserer Zeit der hohlen Phrase leider
immer seltener werden. Es ist nicht möglich, in dem kleinen Rahmen hier
sein Bild genügend oder nur annähernd zu zeichnen. Wir betonen nur die
Tatkraft, die er allezeit für Gottesdienst, Tora und Wohltätigkeit eingesetzt,
die glühende Liebe zum Judentum und sein Interesse an Allem, was dasselbe
innerlich und äußerlich berührte, seine Opferfreudigkeit und liebende
Hingabe an Bedürfnisse der Allgemeinheit. - Jahrelang war er Gabbai
(Vorsteher) der hiesigen (Vereine:) Chewra Deagadata und der Chewra
Gemilut Chassodim, alles verwaltete er zur Ehre Gottes. Des
Lebens herbe Kümmernisse ertrug er mit Gottvertrauen und hatte die
Freude, Enkel und Urenkel zu schauen, die alle in seinen Wegen wandeln und
ihn bis zum Tode in Liebe umgaben. Bei seinem Leichenbegängnisse zeigte
sich, welche Teilnahme sein Hinscheiden erweckte. Möge sein Beispiel ein
belehrendes und anregendes Vorbild für uns alle bleiben und seine
irdische Hülle in Frieden ruhen. Seine Seele sei eingebunden in den
Bund des Lebens. N.N." |
Zum Tod von Karoline Stern geb. Stein (1893)
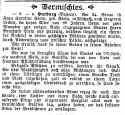 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Juni 1893: "Harburg
(Bayern). Am 24. Siwan (= 8. Juni 1893) ist Frau Karoline Stern geb.
Stein, in Fischach, nach längerem Leiden, im hohen Alter von 86 Jahren,
ihrem vor zwei Monaten zur ewigen Ruhe eingegangenen Bruder Herrn Bernhard
Stein aus Harburg, welchem kürzlich ein ehrender Nachruf in diesen
geschätzten Blättern gewidmet wurde, durch Abberufung vom irdischen
Dasein, nachgefolgt. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Juni 1893: "Harburg
(Bayern). Am 24. Siwan (= 8. Juni 1893) ist Frau Karoline Stern geb.
Stein, in Fischach, nach längerem Leiden, im hohen Alter von 86 Jahren,
ihrem vor zwei Monaten zur ewigen Ruhe eingegangenen Bruder Herrn Bernhard
Stein aus Harburg, welchem kürzlich ein ehrender Nachruf in diesen
geschätzten Blättern gewidmet wurde, durch Abberufung vom irdischen
Dasein, nachgefolgt.
Wie treulich stand sie ihrem Gatten in seinen Arbeiten zur Seite!
Sie war im strengsten Sinne des Wortes ein (hebräisch und deutsch:)
wackeres Weib, eine Gehilfin, die nur von Liebe und frommer
Pflichterfüllung durchdrungen war.
Religiöse Pflichten zu erfüllen, bereitete ihr Genuss. Sie übte
Wohltätigkeit nach allen Richtungen aus. Galt es einen Dürftigen zu
unterstützen, einem Kranken Trost und Mut einzuflößen, galt es endlich
an einem Toten einen gottgefälligen Liebesdienst zu verrichten, so stand
sie nicht fern.
In diesem rühmenswerten Sinne erzog sie auch ihre Kinder, eine Tochter
und einen Sohn, welche durch aufopfernde Pflege und hingebender Sorgfalt
alles, was in menschlichen Kräften lag, getan haben, um das kostbare
Leben der Verblichenen zu verlängern." |
Zum Tod von Mirjam Münster (1895)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. März 1895: "Harburg
(Bayern). Eine treue, gottesfürchtige Schwester, die es verdient, dass
ihrer in diesen geschätzten Blättern ehrende Erwähnung geschehe, wurde
vor Kurzem aus der Mitte unserer Gemeinde abgerufen, um vor dem Throne des
Weltschöpfers zu erscheinen. Frau Mirjam Münster, eine kostbare Perle im
Kranze der jüdischen Frauen, segnete das Zeitliche im 84. Lebensjahre,
nach längerem Krankenlager, wo sie geduldig dem Willen Gottes in frommer
Ergebenheit sich fügte. Mit den Eigenschaften einer wackeren Frau geziert,
war ihr ganzes Streben auf strenge Beobachtung unserer heiligen
Religionsgebote gerichtet. Fleiß, Sparsamkeit und Bescheidenheit waren
die hervorragendsten Tugenden ihres häuslichen Lebens und den goldenen
Frieden suchte sie mit jedermann aufrecht zu erhalten; - sie war eine gern
gesehene Person bei Freud und Leid - Die Beteiligung bei dem
Leichenbegängnisse war eine sehr zahlreiche, wobei die christliche
Bevölkerung reichlich vertreten war. Am Friedhofe pries unser Herr Lehrer
Mannheimer mit beredten Worten die seltenen Vorzüge dieser edlen
Frau." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. März 1895: "Harburg
(Bayern). Eine treue, gottesfürchtige Schwester, die es verdient, dass
ihrer in diesen geschätzten Blättern ehrende Erwähnung geschehe, wurde
vor Kurzem aus der Mitte unserer Gemeinde abgerufen, um vor dem Throne des
Weltschöpfers zu erscheinen. Frau Mirjam Münster, eine kostbare Perle im
Kranze der jüdischen Frauen, segnete das Zeitliche im 84. Lebensjahre,
nach längerem Krankenlager, wo sie geduldig dem Willen Gottes in frommer
Ergebenheit sich fügte. Mit den Eigenschaften einer wackeren Frau geziert,
war ihr ganzes Streben auf strenge Beobachtung unserer heiligen
Religionsgebote gerichtet. Fleiß, Sparsamkeit und Bescheidenheit waren
die hervorragendsten Tugenden ihres häuslichen Lebens und den goldenen
Frieden suchte sie mit jedermann aufrecht zu erhalten; - sie war eine gern
gesehene Person bei Freud und Leid - Die Beteiligung bei dem
Leichenbegängnisse war eine sehr zahlreiche, wobei die christliche
Bevölkerung reichlich vertreten war. Am Friedhofe pries unser Herr Lehrer
Mannheimer mit beredten Worten die seltenen Vorzüge dieser edlen
Frau." |
Kaufmann Gerson Stein wird zum Bevollmächtigten in der
bürgerlichen Gemeindeverwaltung gewählt (1894)
Anmerkung: Gerson Stein, von dem nachfolgende mehrere Berichte
vorgestellt werden, war Vater des Rabbiners Dr. Isaak Stein (geb. 1877 in
Harburg, gest. 1915 in Berlin, Bericht zu seinem Tod 1915 siehe unten). Sohn Isaak hatte Schulen in Nördlingen und
Augsburg besucht und danach an der Universität und am Rabbinerseminar in Berlin
studiert (Promotion 1905 in Rostock). Seit 1905 war er Distriktsrabbiner und
Leiter der Religionsschule in Memel, Ostpreußen; 1914 floh er mit Frau und zwei
Kindern vor den russischen Truppen nach
Berlin. Nach seinem Tod in Berlin wurde er auf dem jüdischen Friedhof in
Harburg beigesetzt.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Januar 1894: "Harburg,
Schwaben. Bei der kürzlich stattgehabten Wahl einer Gemeindeverwaltung
hiesigen Städtchens ging Herr Kaufmann Gerson Stein, langjähriger
Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde, siegreich aus der Urne als
Bevollmächtigter hervor. In unserer vom Antisemitismus durchseuchten
Gegenwart ist ein solcher Fall wohltuend und verdient hier umso mehr
bemerkt zu werden, als es schon über 40 Jahre her ist, seitdem kein
Israelite mit dieser Ehrenstelle betraut wurde. Und so gib Ehre deinem
Volk!" Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Januar 1894: "Harburg,
Schwaben. Bei der kürzlich stattgehabten Wahl einer Gemeindeverwaltung
hiesigen Städtchens ging Herr Kaufmann Gerson Stein, langjähriger
Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde, siegreich aus der Urne als
Bevollmächtigter hervor. In unserer vom Antisemitismus durchseuchten
Gegenwart ist ein solcher Fall wohltuend und verdient hier umso mehr
bemerkt zu werden, als es schon über 40 Jahre her ist, seitdem kein
Israelite mit dieser Ehrenstelle betraut wurde. Und so gib Ehre deinem
Volk!" |
Zum Tod von Jette Sternberger (1899)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Dezember 1899:
"In Harburg (Bayern) ist Frau Jette Sternberger, Gattin des
Herrn Meier Sternberger - sein Licht leuchte - früher Kantor in Ansbach,
nach längerem Krankenlager gestorben. Das ganze Leben der selig
Entschlafenen war eine Kette von guten und frommen Taten; ihre
hoheitsvolle Erscheinung imponiert und erweckte überall Hochachtung und
Verehrung." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Dezember 1899:
"In Harburg (Bayern) ist Frau Jette Sternberger, Gattin des
Herrn Meier Sternberger - sein Licht leuchte - früher Kantor in Ansbach,
nach längerem Krankenlager gestorben. Das ganze Leben der selig
Entschlafenen war eine Kette von guten und frommen Taten; ihre
hoheitsvolle Erscheinung imponiert und erweckte überall Hochachtung und
Verehrung." |
25-jähriges Amtsjubiläum von Gerson Stein (1901)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Januar 1901: "Harburg
(Bayern), 30. Dezember (1900). Die hiesige israelitische Kultusgemeinde
beging gestern die seltene Feier des 25jährigen Amtsjubiläums ihres
verehrten Kultusvorstandes, Herrn Kaufmann Gerson Stein. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Januar 1901: "Harburg
(Bayern), 30. Dezember (1900). Die hiesige israelitische Kultusgemeinde
beging gestern die seltene Feier des 25jährigen Amtsjubiläums ihres
verehrten Kultusvorstandes, Herrn Kaufmann Gerson Stein.
Nach beendetem Morgengottesdienste begaben sich die Gemeindemitglieder
sämtlich in die Wohnung des Jubilars und wurde ihm, nach einer Ansprache
des Kultuskassiers, Herrn Josef Epstein, worin derselbe die ersprießliche
Wirksamkeit des Jubilars würdigte, als Ehrengabe ein prächtiger
silberner Pokal mit Widmung überreicht. Der Jubilar dankte in bewegten,
herzlichen Worten für die ihm zuteil gewordene Ehrung. Zahlreiche
Glückwünsche aus Nah und Fern liefen im Laufe des Festtages ein.
Herr Stadtpfarrer Freiherr von Löffelholz, Vorstand des
Armenpflegschaftsrates der Stadt Harburg, welchem der Herr Jubilar in
seiner Eigenschaft als Kultusvorstand angehört, sowie auch Herr
Bürgermeister Lindenmeier, gratulierten in herzlichen Worten, nachdem der
Herr Jubilar auch längere Zeit das Amt eines Gemeindebevollmächtigten in
hiesiger Stadt bekleidete. Insbesondere dankte Herr Stadtpfarrer Freiherr
von Löffelholz für die Treue und Gewissenhaftigkeit, mit der der
Gefeierte seinen Verpflichtungen als Mitglied des Armenpflegschaftsrates
nachgekommen ist.
Möge es dem Herrn Kultusvorstand Stein vergönnt sein, noch recht viele
Jahre sein Amt in Rüstigkeit und Gesundheit weiter zu führen, zum Segen
und Wohle seiner Gemeinde!" |
Zum Tod von Meier Sternberger (1901, seit 1893 in Harburg wohnhaft)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. September 1901: "Harburg,
Schwaben. Am Sonntag, 7. Juli, wurde ein Mann hier zu Grabe getragen, der
es wohl verdient, dass seiner in diesen geschätzten Blättern gedacht
werde, da sein Lebensgang für jeden wahren Jehudi vorbildlich sein
dürfte. Es war Meier Sternberger seligen Andenkens, den man unter
großer Beteiligung seitens der jüdischen und nichtjüdischen
Bevölkerung zur letzten Ruhe bestattete. Der reiche Lebensinhalt des
Zadik hanedor kann hier nur in skizzenhafter Kürze angedeutet
werden. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. September 1901: "Harburg,
Schwaben. Am Sonntag, 7. Juli, wurde ein Mann hier zu Grabe getragen, der
es wohl verdient, dass seiner in diesen geschätzten Blättern gedacht
werde, da sein Lebensgang für jeden wahren Jehudi vorbildlich sein
dürfte. Es war Meier Sternberger seligen Andenkens, den man unter
großer Beteiligung seitens der jüdischen und nichtjüdischen
Bevölkerung zur letzten Ruhe bestattete. Der reiche Lebensinhalt des
Zadik hanedor kann hier nur in skizzenhafter Kürze angedeutet
werden.
Meier Sternberger war in Deggingen
bei Nördlingen geboren, ein Sohn des frommen Naftali Sternberger,
der dort Vorbeter und Mohel war. Den Grundsätzen und Lehren des
Elternhauses blieb der Verstorbene zeitlebens treu. Nciht weniger als 37
Jahre wirkte er als Chasan und Schochet in Ansbach,
und war ein gewandter, weithin gesuchter Mohel, welches Amt er so oft
unter großen persönlichen Entbehrungen und pekuniären Opfern versah. Im
Verein mit seiner vor 1 1/2 Jahren dahingegangenen Gattin, einer echten Esches
chajil (tüchtiger Frau), gestaltete er sein Heim zu einer von allen
orthodoxen Glaubensgenossen gern und oft aufgesuchten Stätte. Geradezu
unmöglich ist es, all das zu schildern, was beide zusammen für die öffentlichen
Bedürfnisse, insbesondere auf dem Gebiete der Wohltätigkeit
geleistet. Es sei nur erwähnt, dass der Verblichene 32 Jahre lang das
schwere Amt eines Verwalters der Armenkasse für Durchreisende
unentgeltlich versah. Die einzelnen Jahrgänge des 'Israelit' ließ er
unter den Mitgliedern der Gemeinde kursieren, um Sinn für Tora und
Gottesfurcht zu erwecken. In den höchsten Gesellschafts- und
Beamtenkreisen der mittelfränkischen Kreishauptstadt war der
Heimgegangene angesehen und geachtet. Vor acht Jahren zog das kinderlose
Ehepaar hierher, um den Lebensabend in der Nähe von Verwandten zu
verbringen, freudigst begrüßt in der numerisch reduzierten Gemeinde, die
dadurch eine Kräftigung und Neubelebung des Gemeindelebens erfuhr. So
manches Gute hat der Verstorbene hier bewirkt. Nun sind sie beide in
die Ewigkeit gegangen. leibliche Nachkommen hinterlassen sie nicht,
aber ihre guten Taten sind ihre Nachkommen.
Zur Lewajoh (Beisetzung) war der Kultusvorstand von Ansbach,
Herr Selling, herbeigeeilt. In tief empfundenen Worten sprach der
Herr Rabbiner von Ansbach, Herr Dr.
P. Cohn namens dieser Gemeinde, nach diesem Herr A. Mannheimer, Lehrer
in Dettelbach im Auftrage des
engeren Verwandtenkreises, endlich für die Gemeinde Harburg Herr
Lehrer Krämer daselbst.
Möge der S'chus - das Verdienst dieses wahrhaft Frommen uns
beistehen und er ein Meliz joscher - ein rechter Fürsprecher uns
allen sein. Secher zadik liwrochoh - das Andenken an den Gerechten ist
zum Segen.
Wie nachträglich bekannt ward, vermachte der Heimgegangene bedeutende
Lage an Moschab Sekenim und Talmud Thora im heiligen Lande, an die
Präparandien Höchberg, Burgpreppach,
an das israelitische Lehrerseminar und
das israelitische Hospital in Würzburg, endlich an das Rabbinerseminar in
Berlin." |
Über die Parascha Reeh - Gedicht von Dr. Isaak Stein
(1902)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. September
1902: "Zu Paraschat Reeh (Toralesung Reeh zum Schabbat 30.
August 1902, Abschnitt Ree ist 5. Mose 11,26 - 16,17) - von Dr. Isaak Stein
- Harburg (Bayern). Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. September
1902: "Zu Paraschat Reeh (Toralesung Reeh zum Schabbat 30.
August 1902, Abschnitt Ree ist 5. Mose 11,26 - 16,17) - von Dr. Isaak Stein
- Harburg (Bayern).
Zum Gedanken 5. Mose 11,27: 'Den Segen, so ihr gehorchet den Geboten
des Ewigen eures Gottes'.
Schon senken sich die trüben Schatten, Die schwarze Nacht bricht
stürmisch an:
In öder Wildnis wallt der Pilger Auf wüster, undurchforschter
Bahn.
Er darf nicht rasten, darf nicht schlummern, Er kennet nicht die süße
Ruh',
Auf Pfaden wilden Zweifels irrt er Bekümmert seiner Heimat
zu.
Die Sehnsucht flügelt seine Schritte Und treibt ihn fort in
schwerer Qual;
Doch Niemand weiset ihm die Wege, Die leiten aus dem
Jammertal.
Da hebt er seinen Blick zum Himmel Zur Sternenbahn im
Silberschein;
Die Sterne weisen ihm die Richtung Und führen ihn zur Heimat
ein.
Auf, Israel, Du bist gerettet, Sobald du nach dem Himmel
schaust,
In allen Fährden und in Nöten Auf Deinen Lenker stolz
vertraust." |
Gerson Stein zum Gemeindevorsteher wiedergewählt
(1908)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1908: "Harburg
(Bayern), 27. Dezember (1908). Bei der hier vorgenommenen israelitischen
Gemeindewahl wurde Herr Gerson Stein zum Vorstand der hiesigen Gemeinde
einstimmig wiedergewählt. Dieses ehrenvolle Amt bekleidet er schon 33
Jahre hindurch mit treuer Hingabe und in einer ersprießlichen Wirksamkeit
zum Wohle unserer Gemeinde." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1908: "Harburg
(Bayern), 27. Dezember (1908). Bei der hier vorgenommenen israelitischen
Gemeindewahl wurde Herr Gerson Stein zum Vorstand der hiesigen Gemeinde
einstimmig wiedergewählt. Dieses ehrenvolle Amt bekleidet er schon 33
Jahre hindurch mit treuer Hingabe und in einer ersprießlichen Wirksamkeit
zum Wohle unserer Gemeinde." |
Zum Tod des aus Harburg stammenden Rabbiners Dr. Isaak
Stein (geb. 1877 in Harburg, gest. 1915 in Berlin, beigesetzt in Harburg)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juli 1915: "Rabbiner
Dr. Isaak Stein - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen -.
Memel, 18. Juli (1915). Von einem furchtbaren Schlage ist unsere
Gemeinde, die ganze gesetzestreue Judenheit Deutschlands betroffen
worden. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juli 1915: "Rabbiner
Dr. Isaak Stein - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen -.
Memel, 18. Juli (1915). Von einem furchtbaren Schlage ist unsere
Gemeinde, die ganze gesetzestreue Judenheit Deutschlands betroffen
worden.
Unser Rabbiner, Dr. Isaak Stein, ist in der Blüte seiner Jahre, noch
bevor er das vierzigste Lebensjahr erreicht hatte, einer schweren
Krankheit zum Opfer gefallen. Über ein Jahrzehnt lang war Dr. Stein bei
uns tätig und hat es verstanden, in der Nordostecke unseres Vaterlandes
vor den Toren des großen ostjüdischen Ghettos in vornehmer und liebevoller
Gesinnung eine reiche Tätigkeit zu entfalten. Er war Freund und Berater
aller seiner Gemeindemitglieder, als Mitglied des Kuratoriums unseres
Krankenhauses, ein Vater der armen Kranken und in Wort und Schrift allezeit
bemüht, auf der Kanzel wie in Vereinen die Lehren des Judentums zur
Anerkennung zu bringen.
Ein begeisterter Patriot, hat er auch während des Krieges innerhalb und
außerhalb seiner Gemeinde zur Stärkung der Gemüter viel beigetragen.
Die Aufregung, die ihm die kurze Zeit der Russeninvasion brachte, hat
zweifellos dazu beigetragen, dass die heimtückische Krankheit, die an ihm
nagte, rasch zum Ausbruch kam. - Sein Andenken wird in der ganzen Gemeinde
und bei all denen, die ihm näher getreten, ein gesegnetes bleiben. Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." |
| |
 Artikel
in der "Harburger Zeitung" vom 27. Juli 1915 (erhalten von
Rolf Hofmann): "Harburg, 26. Juli (1915). Wie bereits
gemeldet, wurde der weit über die Kreise seiner jüdischen
Glaubensgenossen hinaus hochgeschätzte und bekannte Kreisrabbiner Herr
Dr. Isaak Stein aus Memel, im 39. Lebensjahre, am vergangenen Montag
auf dem hiesigen israelitischen Friedhof zur letzten Ruhe gebettet. Am
Dienstag vorher begab er sich noch nach Berlin, um Heilung einer
entstandenen Nierenkrankheit zu suchen, wo er am Donnerstag vom Tode
ereilt wurde. Kreisrabbiner Dr. Isaak Stein war am 1. Juli 1877 dahier
(Harburg) geboren, besuchte das königliche Gymnasium St. Stephan in
Augsburg, woselbst er mit sehr gutem Erfolge absolvierte. Seine
erfolgreichen Studien beendete er 1902 an der Universität Berlin und 1904
am dortigen Rabbinerseminar. Zum Kreisrabbiner Nach Memel wurde er im
Februar 1905 einstimmig berufen. In seiner mehr als zehnjährigen dortigen
Wirksamkeit entwickelte er eine ersprießliche Tätigkeit. In diversen
Zeitungen sind ehrende Nachrufe über den Verblichenen veröffentlicht.
Die Vorsteher und Repräsentanten der Synagogengemeinde Memel widmen ihm
einen Nachruf, dass er über ein Jahrzehnt lang als Seelsorger in ihrer
Gemeinde tätig gewesen und sich durch seine vornehmen Gesinnungen, seine
nie versiegende Hilfsbereitschaft und seine milde und nachsichtige Art in
der Beurteilung Anderer allgemeine Liebe und Verehrung zu erwerben gewusst.
Mit seltener Selbstlosigkeit und vorbildlicher Pflichttreue hat er sich
seinem Beruf gewidmet und niemals hat er gefehlt, wo es zu helfen und zu
raten gab. Sie verlieren in Herrn Dr. Stein nicht nur einen vornehmen und
stets hilfsbereiten Seelsorger, sondern auch einen lieben und treuen
Freund und Berater, dem sie über das Grab hinaus ein ehrendes Gedenken
bewahren werden. Das Kuratorium des jüdischen Krankenhauses zu Memel,
dessen Mitglied der Entschlafene gewesen, veröffentlicht in einem
Nachruf, dass Herr Dr. Stein in der Blüte seiner Jahre zu Berlin
verschieden ist und trauernd stehe es an der Bahre dieses zu früh
Dahingegangenen hochverehrten Mannes, der der Anstalt stets sein vollstes
Interesse und seine Arbeitskraft widmete. Für das Schicksal der armen
Kranken zeigte er lebhafte Anteilnahme, erfreute sie oft durch seine
Besuche und tröstete sie durch seinen gütigen Zuspruch. Das Gedeihen und
der sichere Forbestand der Anstalt lag ihm am Herzen und hat er ihr viele
Gönner und wohltätige Freunde verschafft. Es werde seiner stets in
Dankbarkeit gedenken, und seinen Namen unter denen der Wohltätiger der
Anstalt zum dauernden Gedächtnis verzeichnen. Ferner beklagen den
schmerzlichen Verlust ihres Vorsitzenden der 'Verein für jüdische
Geschichte und Literatur'. Seine hohe edle Denkungsart hat er in
populär-belehrenden vorträgen verkündet.... Artikel
in der "Harburger Zeitung" vom 27. Juli 1915 (erhalten von
Rolf Hofmann): "Harburg, 26. Juli (1915). Wie bereits
gemeldet, wurde der weit über die Kreise seiner jüdischen
Glaubensgenossen hinaus hochgeschätzte und bekannte Kreisrabbiner Herr
Dr. Isaak Stein aus Memel, im 39. Lebensjahre, am vergangenen Montag
auf dem hiesigen israelitischen Friedhof zur letzten Ruhe gebettet. Am
Dienstag vorher begab er sich noch nach Berlin, um Heilung einer
entstandenen Nierenkrankheit zu suchen, wo er am Donnerstag vom Tode
ereilt wurde. Kreisrabbiner Dr. Isaak Stein war am 1. Juli 1877 dahier
(Harburg) geboren, besuchte das königliche Gymnasium St. Stephan in
Augsburg, woselbst er mit sehr gutem Erfolge absolvierte. Seine
erfolgreichen Studien beendete er 1902 an der Universität Berlin und 1904
am dortigen Rabbinerseminar. Zum Kreisrabbiner Nach Memel wurde er im
Februar 1905 einstimmig berufen. In seiner mehr als zehnjährigen dortigen
Wirksamkeit entwickelte er eine ersprießliche Tätigkeit. In diversen
Zeitungen sind ehrende Nachrufe über den Verblichenen veröffentlicht.
Die Vorsteher und Repräsentanten der Synagogengemeinde Memel widmen ihm
einen Nachruf, dass er über ein Jahrzehnt lang als Seelsorger in ihrer
Gemeinde tätig gewesen und sich durch seine vornehmen Gesinnungen, seine
nie versiegende Hilfsbereitschaft und seine milde und nachsichtige Art in
der Beurteilung Anderer allgemeine Liebe und Verehrung zu erwerben gewusst.
Mit seltener Selbstlosigkeit und vorbildlicher Pflichttreue hat er sich
seinem Beruf gewidmet und niemals hat er gefehlt, wo es zu helfen und zu
raten gab. Sie verlieren in Herrn Dr. Stein nicht nur einen vornehmen und
stets hilfsbereiten Seelsorger, sondern auch einen lieben und treuen
Freund und Berater, dem sie über das Grab hinaus ein ehrendes Gedenken
bewahren werden. Das Kuratorium des jüdischen Krankenhauses zu Memel,
dessen Mitglied der Entschlafene gewesen, veröffentlicht in einem
Nachruf, dass Herr Dr. Stein in der Blüte seiner Jahre zu Berlin
verschieden ist und trauernd stehe es an der Bahre dieses zu früh
Dahingegangenen hochverehrten Mannes, der der Anstalt stets sein vollstes
Interesse und seine Arbeitskraft widmete. Für das Schicksal der armen
Kranken zeigte er lebhafte Anteilnahme, erfreute sie oft durch seine
Besuche und tröstete sie durch seinen gütigen Zuspruch. Das Gedeihen und
der sichere Forbestand der Anstalt lag ihm am Herzen und hat er ihr viele
Gönner und wohltätige Freunde verschafft. Es werde seiner stets in
Dankbarkeit gedenken, und seinen Namen unter denen der Wohltätiger der
Anstalt zum dauernden Gedächtnis verzeichnen. Ferner beklagen den
schmerzlichen Verlust ihres Vorsitzenden der 'Verein für jüdische
Geschichte und Literatur'. Seine hohe edle Denkungsart hat er in
populär-belehrenden vorträgen verkündet....
(ein Teilabschnitt wird nicht zitiert - zum Lesen bitte Textabbildung
anklicken)
An der Bahre sprachen in tief empfundenen Worten Herr Rabbiner
Dr. Rössel aus Tilsit und Herr Distriktsrabbiner Dr. Kohn aus Ansbach
vor einem zahlreichen Leichengefolge aus allen Schichten der Bevölkerung,
ohne Unterschied der Konfessionen, sowohl von hier als auch von auswärts.
Die vielen Beileidsbezeugungen von nah und fern beweisen die große
Beliebtheit des teuren Entschlafenen.
Wie reich muss sein Leben gewesen sein an Edlem und Hohem, dass er schon
jetzt, wo andere erst beginnen, für die Welt etwas zu bedeuten, als ein
ganzes, als ein volles gelten konnte vor dem göttlichen
Richterauge!
Wie viel muss er schon jetzt in seinem kurzen Erdenwallen geleistet haben,
dass er schon jetzt reif war für die Gefilde der Seligen! Er ruhe im
ewigen Frieden!" |
Zum Tod von Gerson Stein (1920) - fast ein halbes
Jahrhundert Gemeindevorsteher
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Dezember 1920: "Harburg
(Schwaben), 29. November (1920). Unsere kleine Gemeinde ist von
einem unersetzlichen Verluste betroffen worden. Gerson Stein ist im Alter
von 76 Jahren von uns geschieden. Mit ihm ist eine Persönlichkeit aus der
'guten alten Zeit' ins Grab gesunken. Er war der Typus des alten Gemeindevorstehers,
gemessen und würdevoll in seinem Auftreten, durchdrungen von höchstem
Pflichtgefühl und voll Liebe für die, denen sein Wirken galt. Fast ein
halbes Jahrhundert hatte ihn das Vertrauen der Gemeinde an ihre Spitze
gestellt; die Chronik unserer Gemeinde zeugt für sein
unermüdliches Schaffen. Auch in den nichtjüdischen kreisen seiner Heimat
wurde der Wert seiner Persönlichkeit erkannt und gewertet; lange war er
in der Verwaltung der Stadt, gehörte er dem städtischen Armenrate an und
stand mit an der Spitze von gemeinnützigen Vereinen. Ihm, dem Manne voll
Gefühl, ward die innere Kraft gebrochen, als ihm in kurzer Zeit die
Gattin und der prächtige Sohn (Dr. Stein - das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen -, Memel), genommen waren und ein liebes
Enkelkind vor seinen Augen dahinwelkte. Die zahlreiche Beteiligung zeigte
die große Verehrung, die der Dahingeschiedene bei allen Konfessionen und
allen Ständen genoss. Der greise Bezirksrabbiner Dr. Cohn, Ichenhausen,
scheute die beschwerliche Reise nicht, um dem langjährigen Freunde Worte
des liebevollen Gedenkens zu widmen. Leider wurde er vor der Beerdigung
von einem kleinen Unfall betroffen. An seiner Stelle schilderte Herr
Rabbiner Dr. Berlinger, Hall, das
Leben des Verewigten und gab dem tiefen Schmerze Ausdruck, der die Familie
und die Gemeinde erfüllt. Dem Zuge folgten u.a. der Oberregierungsrat aus
Donauwörth, der Bürgermeister und die Stadträte, sowie die gesamte
Mannschaft der Feuerwehr. Gerson Stein - das Andenken an den Gerechten
ist zum Segen - führt nun unsere Gemeinde nicht mehr; mit Bangen
sehen wir der Zukunft entgegen, denn nur ein knappes Minjan ist noch
übrig von der blühenden Kehilla von dereinst. Um so stärker
sollten die noch hier Lebenden, das zu erhalten suchen, was ihr
verstorbener Vorsteher ihnen als heiliges Vermächtnis
hinterlassen. Damit wird das Andenken des Verstorbenen am besten
geehrt." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Dezember 1920: "Harburg
(Schwaben), 29. November (1920). Unsere kleine Gemeinde ist von
einem unersetzlichen Verluste betroffen worden. Gerson Stein ist im Alter
von 76 Jahren von uns geschieden. Mit ihm ist eine Persönlichkeit aus der
'guten alten Zeit' ins Grab gesunken. Er war der Typus des alten Gemeindevorstehers,
gemessen und würdevoll in seinem Auftreten, durchdrungen von höchstem
Pflichtgefühl und voll Liebe für die, denen sein Wirken galt. Fast ein
halbes Jahrhundert hatte ihn das Vertrauen der Gemeinde an ihre Spitze
gestellt; die Chronik unserer Gemeinde zeugt für sein
unermüdliches Schaffen. Auch in den nichtjüdischen kreisen seiner Heimat
wurde der Wert seiner Persönlichkeit erkannt und gewertet; lange war er
in der Verwaltung der Stadt, gehörte er dem städtischen Armenrate an und
stand mit an der Spitze von gemeinnützigen Vereinen. Ihm, dem Manne voll
Gefühl, ward die innere Kraft gebrochen, als ihm in kurzer Zeit die
Gattin und der prächtige Sohn (Dr. Stein - das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen -, Memel), genommen waren und ein liebes
Enkelkind vor seinen Augen dahinwelkte. Die zahlreiche Beteiligung zeigte
die große Verehrung, die der Dahingeschiedene bei allen Konfessionen und
allen Ständen genoss. Der greise Bezirksrabbiner Dr. Cohn, Ichenhausen,
scheute die beschwerliche Reise nicht, um dem langjährigen Freunde Worte
des liebevollen Gedenkens zu widmen. Leider wurde er vor der Beerdigung
von einem kleinen Unfall betroffen. An seiner Stelle schilderte Herr
Rabbiner Dr. Berlinger, Hall, das
Leben des Verewigten und gab dem tiefen Schmerze Ausdruck, der die Familie
und die Gemeinde erfüllt. Dem Zuge folgten u.a. der Oberregierungsrat aus
Donauwörth, der Bürgermeister und die Stadträte, sowie die gesamte
Mannschaft der Feuerwehr. Gerson Stein - das Andenken an den Gerechten
ist zum Segen - führt nun unsere Gemeinde nicht mehr; mit Bangen
sehen wir der Zukunft entgegen, denn nur ein knappes Minjan ist noch
übrig von der blühenden Kehilla von dereinst. Um so stärker
sollten die noch hier Lebenden, das zu erhalten suchen, was ihr
verstorbener Vorsteher ihnen als heiliges Vermächtnis
hinterlassen. Damit wird das Andenken des Verstorbenen am besten
geehrt." |
| |
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. April 1921:
"In Harburg (Schwaben) ist der Vorstand der Israelitischen Gemeinde,
Herr Gerson Stein, im Alter von 76 Jahren verschieden. Er war der Typus
des alten 'Parnes' (Gemeindevorstehers), durchdrungen von höchstem
Pflichtgefühl und voll Liebe für die, denen sein Wirken galt. Die
Chronik der Gemeinde zeugt für sein unermüdliches Schaffen; lange war er
in der Verwaltung der Stadt und stand mit an der Spitze von
gemeinnützigen Vereinen. Sein Sohn war der verstorbene Rabbiner Dr. Stein
seligen Andenkens in Memel." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. April 1921:
"In Harburg (Schwaben) ist der Vorstand der Israelitischen Gemeinde,
Herr Gerson Stein, im Alter von 76 Jahren verschieden. Er war der Typus
des alten 'Parnes' (Gemeindevorstehers), durchdrungen von höchstem
Pflichtgefühl und voll Liebe für die, denen sein Wirken galt. Die
Chronik der Gemeinde zeugt für sein unermüdliches Schaffen; lange war er
in der Verwaltung der Stadt und stand mit an der Spitze von
gemeinnützigen Vereinen. Sein Sohn war der verstorbene Rabbiner Dr. Stein
seligen Andenkens in Memel." |
Zum 70. Geburtstag von Sara Guldmann (1922)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. März 1922: "Harburg
(Bayern), 26. Februar (1922). Am gestrigen Schabbat
Kodesch Paraschat Mischpatim (Heiliger Schabbat mit der Toralesung
Mischpatim = 2. Mose 21,1 - 24,18, das war am 25. Februar 1922) vollendete
in körperlicher und geistiger Frische Sara Guldmann dahier, ihr 70.
Lebensjahr. Die Jubilarin ist durch ihre Leutseligkeit und ihr
freundliches Wesen im hiesigen Städtchen allgeschätzt. Von ihrer frühesten
Jugend an Arbeit gewöhnt, obliegt sie heute noch mit aller Hingabe und
Liebe ihrem Berufe. Nicht unerwähnt sei, dass sie heute auf eine
ununterbrochene 28-jährige Tätigkeit bei einer hiesigen achtbaren
Familie, mit der sie in den vielen Jahren stets Freud und Leid teilte, zurückblicken
kann. Gebet und Arbeit ist ihre Losung. Wir entbieten nun unserer
‚Sara’ zu ihrem 70. Wiegenfeste unsere herzlichste Glückwünsche. Mögen
ihr – so Gott will – noch viele gesunde Jahre beschieden sein. (Alles
Gute) bis 100 Jahre." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. März 1922: "Harburg
(Bayern), 26. Februar (1922). Am gestrigen Schabbat
Kodesch Paraschat Mischpatim (Heiliger Schabbat mit der Toralesung
Mischpatim = 2. Mose 21,1 - 24,18, das war am 25. Februar 1922) vollendete
in körperlicher und geistiger Frische Sara Guldmann dahier, ihr 70.
Lebensjahr. Die Jubilarin ist durch ihre Leutseligkeit und ihr
freundliches Wesen im hiesigen Städtchen allgeschätzt. Von ihrer frühesten
Jugend an Arbeit gewöhnt, obliegt sie heute noch mit aller Hingabe und
Liebe ihrem Berufe. Nicht unerwähnt sei, dass sie heute auf eine
ununterbrochene 28-jährige Tätigkeit bei einer hiesigen achtbaren
Familie, mit der sie in den vielen Jahren stets Freud und Leid teilte, zurückblicken
kann. Gebet und Arbeit ist ihre Losung. Wir entbieten nun unserer
‚Sara’ zu ihrem 70. Wiegenfeste unsere herzlichste Glückwünsche. Mögen
ihr – so Gott will – noch viele gesunde Jahre beschieden sein. (Alles
Gute) bis 100 Jahre." |
Zum Tod von Kunigunde Salomon geb. Hiller aus Harburg (gest. 1924 in Nürnberg)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 10. Juli 1924: "Nürnberg, 1. Juli (1924). Am
Sonntag, 23. Juni dieses Jahres, starb dahier im 72. Lebensjahre Frau
Kunigunde Salomon, eine der leider immer seltener werdenden Gestalten
altjüdischer Frömmigkeit. Bei der am Montag stattgehabten Beerdigung
hob Herr Rabbiner Dr. Klein die Tugenden dieser wackeren Frau hervor,
die 36 Jahre den Witwenstand durchlebte, in ihrer Glaubenstreue aber
tapfer und siegreich blieb, sodass sie ihre Kinder zu echten Jehudim
heranreifen sah, ebenso die Enkel. Selbst in einer Gegend, wo wenig
Toratreue zu treffen gewesen, hielt sie die Ideale echter Jüdischkeit
aufrecht. Der Schwiegersohn, Lehrer Sonn - Würzburg,
beklagte den schweren Verlust der Familie und teilte so manches Intime aus
dem Leben der Verstorbenen mit, in dem sich ihre innige Frömmigkeit
wiederspiegelte, von der der Fernstehende kaum eine Ahnung gehabt. Hauptlehrer
Mannheimer - Dettelbach verglich
die Heimgegangene mit Noemi im Buche Rut, der am Lebensabend noch sonniges
Familienglück gelächelt. Er betrachtete sie als Kind ihrer Heimatgemeinde
Harburg in Schwaben, die einst zu den schönsten gezählt und wo die
Urahnen der Verstorbenen sich schon durch besondere Gelehrsamkeit
auszeichneten. Bestand doch in der Familie eine dunkle Tradition von
verwandtschaftlichen Beziehungen zum ... (unklar, wer gemeint). Nun
ist sie dahingegangen, nachdem sie die letzten Monate bei ihrem Sohne,
Herrn Moritz Salomon dahier, verbracht, und aufopfernde, kindliche Liebe
und Pflege fand bis zum letzten Atemzuge. Möge der Verdienst
dieser Edlen, Frommen den Familien und uns allen beistehen. Ihre Seele
sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 10. Juli 1924: "Nürnberg, 1. Juli (1924). Am
Sonntag, 23. Juni dieses Jahres, starb dahier im 72. Lebensjahre Frau
Kunigunde Salomon, eine der leider immer seltener werdenden Gestalten
altjüdischer Frömmigkeit. Bei der am Montag stattgehabten Beerdigung
hob Herr Rabbiner Dr. Klein die Tugenden dieser wackeren Frau hervor,
die 36 Jahre den Witwenstand durchlebte, in ihrer Glaubenstreue aber
tapfer und siegreich blieb, sodass sie ihre Kinder zu echten Jehudim
heranreifen sah, ebenso die Enkel. Selbst in einer Gegend, wo wenig
Toratreue zu treffen gewesen, hielt sie die Ideale echter Jüdischkeit
aufrecht. Der Schwiegersohn, Lehrer Sonn - Würzburg,
beklagte den schweren Verlust der Familie und teilte so manches Intime aus
dem Leben der Verstorbenen mit, in dem sich ihre innige Frömmigkeit
wiederspiegelte, von der der Fernstehende kaum eine Ahnung gehabt. Hauptlehrer
Mannheimer - Dettelbach verglich
die Heimgegangene mit Noemi im Buche Rut, der am Lebensabend noch sonniges
Familienglück gelächelt. Er betrachtete sie als Kind ihrer Heimatgemeinde
Harburg in Schwaben, die einst zu den schönsten gezählt und wo die
Urahnen der Verstorbenen sich schon durch besondere Gelehrsamkeit
auszeichneten. Bestand doch in der Familie eine dunkle Tradition von
verwandtschaftlichen Beziehungen zum ... (unklar, wer gemeint). Nun
ist sie dahingegangen, nachdem sie die letzten Monate bei ihrem Sohne,
Herrn Moritz Salomon dahier, verbracht, und aufopfernde, kindliche Liebe
und Pflege fand bis zum letzten Atemzuge. Möge der Verdienst
dieser Edlen, Frommen den Familien und uns allen beistehen. Ihre Seele
sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Anmerkung: Die aus Harburg stammende Kunigunde
Salomon geb. Hiller war mit dem Handelsmann Jakob Salomon in Mandel
bei Bad Kreuznach verheiratet (dieser ist 1888 in Mandel
gestorben). Eines der Kinder war Hedwig (Helene) geb. Salomon (geb. 2.
Oktober 1877 in Mandel), verheiratet
seit 1901 (Würzburg) mit dem Lehrer David Sonn (geb. 19. Mai 1871 in Mainstockheim,
gest. 12. Juli 1939 in Würzburg), gest. 6. oder 8. November 1932 in
Würzburg.
Quelle: Strätz Biographisches Handbuch Würzburg Juden Bd. II S. 568
(hier ist Hamburg in Harburg zu korrigieren) |
Zum Tod von Siegfried Stein (1933)
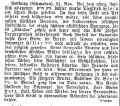 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. November 1933: "Harburg
(Schwaben), 24. November (1933). Auf dem alten, idyllisch gelegenen Friedhof
dahier wurde Siegfried Stein zur letzten Ruhe gebettet. In ihm lebte Geist
und Art unserer einst blühenden Gemeinde weiter, mit ihren
prachtvollen jüdischen Vereinen, der kinderreichen jüdischen
Volksschule, der einzig schönen altjüdischen Synagoge, die 80 'Ständer'
zählte und heute noch das Bild großer Vergangenheit widerspiegelt. Nach
Verfall der Gemeinde suchte Herr Stein im Verein mit seinem verewigten
Schwager Hiller - er ruhe in Frieden - noch aufrecht zu erhalten,
was hier möglich gewesen. Seine klangvolle Stimme und sein beachtliches
jüdisches Wissen befähigten ihn zum rechten, echten Vorsängerdienst.
Jeden Minhag (Brauch, Tradition) kann er. Sein schlichtes, friedliches
Wesen, seine Redlichkeit im Geschäftsleben, sein feines, taktvolles
Auftreten sicherten ihm Freunde und Verehrer weit und breit. Vom
Elternhause her hatte er den jüdischen Geist in altfrommer Prägung in
sich aufgenommen. Ein jüngerer Bruder, Rabbiner Dr. Stein - seligen
Andenkens, in Memel, ging ihm im Tode voran. Am Grabe schilderte der
Schwager des Verewigten, Herr Moses Herz, Hall, Leben und Wirken des
teuren Verwandten. Sein Bild bleibt in ehrenvollem Gedenken bei jedermann
dahier. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des ewigen Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. November 1933: "Harburg
(Schwaben), 24. November (1933). Auf dem alten, idyllisch gelegenen Friedhof
dahier wurde Siegfried Stein zur letzten Ruhe gebettet. In ihm lebte Geist
und Art unserer einst blühenden Gemeinde weiter, mit ihren
prachtvollen jüdischen Vereinen, der kinderreichen jüdischen
Volksschule, der einzig schönen altjüdischen Synagoge, die 80 'Ständer'
zählte und heute noch das Bild großer Vergangenheit widerspiegelt. Nach
Verfall der Gemeinde suchte Herr Stein im Verein mit seinem verewigten
Schwager Hiller - er ruhe in Frieden - noch aufrecht zu erhalten,
was hier möglich gewesen. Seine klangvolle Stimme und sein beachtliches
jüdisches Wissen befähigten ihn zum rechten, echten Vorsängerdienst.
Jeden Minhag (Brauch, Tradition) kann er. Sein schlichtes, friedliches
Wesen, seine Redlichkeit im Geschäftsleben, sein feines, taktvolles
Auftreten sicherten ihm Freunde und Verehrer weit und breit. Vom
Elternhause her hatte er den jüdischen Geist in altfrommer Prägung in
sich aufgenommen. Ein jüngerer Bruder, Rabbiner Dr. Stein - seligen
Andenkens, in Memel, ging ihm im Tode voran. Am Grabe schilderte der
Schwager des Verewigten, Herr Moses Herz, Hall, Leben und Wirken des
teuren Verwandten. Sein Bild bleibt in ehrenvollem Gedenken bei jedermann
dahier. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des ewigen Lebens." |
Zur Geschichte des Betsaales / der Synagoge
Bereits 1695 hatte die jüdische Gemeinde von Harburg die fürstliche Erlaubnis
erhalten, eine "Judenschule" zu bauen. Bedingung dafür war, dass
erstens ein Jude darin wohnte und zweitens das Gebäude keine baulichen
Besonderheiten aufwies, da die Kirche keine bauliche Konkurrenz bekommen sollte.
Damals wurde jedoch keine Synagoge erbaut, sondern der bisherige Betsaal
im Haus des Moyses Weil beibehalten. Dieser hatte kurz nach seiner Aufnahme in
Harburg 1672 ein bis heute erhaltenes stattliches Gebäude am Marktplatz
erworben; 1707 kam das Haus den Besitz von Benjamin Israel. Als 1719 dieses Haus
an einen Christen verkauft werden sollte, wurde die Frage eines Synagogenneubaus
wieder aktuell. Fürst Albrecht Ernst II. befahl auf Grund der neuen Situation
den Bau einer Synagoge, worauf die jüdische Gemeinde einen unbebauten Platz in
der Egelseegasse kaufte und darauf eine Synagoge erbaute. Im Gebäude der
Synagoge war auch die Vorsänger- (zeitweise Rabbiner-)wohnung untergebracht.
Die 1720 erbaute Synagoge war allerdings nach wenigen Jahrzehnten bereits baufällig
geworden, da sie aus "schlechtem Holz" gebaut war und einzustürzen
drohte. Mit fürstlicher Erlaubnis erbaute man 1754 eine neue Synagoge.
Sie wurde am selben Platz gebaut, jedoch erweiterte man die überbaute Fläche
zur Wörnitz hin. Im Erdgeschoss des Gebäudes befand sich die ehemalige
Rabbinerwohnung, die Gemeindestube der Kultusverwaltung und die Mikwe. Der
eigentliche Betsaal lag im ersten Obergeschoss. Die Synagoge mit ihren
Spitzbogenfenstern und ihrer dominanten Lage am Flussufer war nach der Kirche
und dem Pfarrhaus das größte Gebäude am Ort.
Bereits Ende der 1920-Jahre wurde es immer schwieriger, in Harburg die nötige
Zehnzahl der Männer für den Gottesdienst zusammen zu bekommen. 1936 wurde die
Jüdische Kultusgemeinde Harburg aufgelöst, seitdem stand die Synagoge leer.
Abschiedsfeier in der Synagoge (1936)
 Artikel
im "Gemeindeblatt der Israelitischen Gemeinde Frankfurt" vom
August 1936 S. 424: "München. Die bayrische Synagogengemeinde
Harburg, die früher zu den größten des Landes zählte, ist auf fünf
Seelen zusammengeschrumpft und wird in Kürze auf Grund der Satzung des
Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden aufgelöst werden. Vor
kurzem fand in der Synagoge, die im Jahre 1754 errichtet wurde, eine
Abschiedsfeier statt, zu der sich viele ehemalige Mitglieder der Gemeinde
eingefunden hatten." Artikel
im "Gemeindeblatt der Israelitischen Gemeinde Frankfurt" vom
August 1936 S. 424: "München. Die bayrische Synagogengemeinde
Harburg, die früher zu den größten des Landes zählte, ist auf fünf
Seelen zusammengeschrumpft und wird in Kürze auf Grund der Satzung des
Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden aufgelöst werden. Vor
kurzem fand in der Synagoge, die im Jahre 1754 errichtet wurde, eine
Abschiedsfeier statt, zu der sich viele ehemalige Mitglieder der Gemeinde
eingefunden hatten." |
| |
 Artikel
in der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Juni 1936:
"Abschied
von einem Gotteshaus. In der Synagoge zu Harburg fand am Erev Rosch
Chodesch ‚Siwan’ (Vortag zum 1. Siwan = Donnerstag, 21. Mai 1936) die
Abschiedsfeier in Verbindung mit einem Jom Kippur Koton-Gottesdienst
statt. Die Gemeinde Harburg, ehedem eine der bedeutendsten in Schwaben,
ist bis auf fünf Mitglieder zusammengeschrumpft. Schon lange hat in der
altehrwürdigen Synagoge ein Minjan nicht mehr stattgefunden. Die Gemeinde
wird demnächst, entsprechend den Bestimmungen der Verbandssatzungen, förmlich
aufgelöst werden. Die Kultusgemeinde Nördlingen wird ihr Gebiet auf das
Gebiet von Harburg erstrecken. Zur Abschiedsfeier hatten sich zu den
wenigen in Harburg noch ansässigen Juden zahlreiche ehemaligen Mitglieder
und Freunde der Kultusgemeinde Harburg von auswärts gesellt. Lehrer Strauß
(Nördlingen) legte seinen zu Herzen gehenden Ausführungen Worte des
Psalms 102 zugrunde. Die im Jahre 1754 erbaute Synagoge ist eine Sehenswürdigkeit.
Die Besichtigung wird bei jedem Besucher Harburgs einen unvergesslichen
Eindruck hinterlassen." Artikel
in der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Juni 1936:
"Abschied
von einem Gotteshaus. In der Synagoge zu Harburg fand am Erev Rosch
Chodesch ‚Siwan’ (Vortag zum 1. Siwan = Donnerstag, 21. Mai 1936) die
Abschiedsfeier in Verbindung mit einem Jom Kippur Koton-Gottesdienst
statt. Die Gemeinde Harburg, ehedem eine der bedeutendsten in Schwaben,
ist bis auf fünf Mitglieder zusammengeschrumpft. Schon lange hat in der
altehrwürdigen Synagoge ein Minjan nicht mehr stattgefunden. Die Gemeinde
wird demnächst, entsprechend den Bestimmungen der Verbandssatzungen, förmlich
aufgelöst werden. Die Kultusgemeinde Nördlingen wird ihr Gebiet auf das
Gebiet von Harburg erstrecken. Zur Abschiedsfeier hatten sich zu den
wenigen in Harburg noch ansässigen Juden zahlreiche ehemaligen Mitglieder
und Freunde der Kultusgemeinde Harburg von auswärts gesellt. Lehrer Strauß
(Nördlingen) legte seinen zu Herzen gehenden Ausführungen Worte des
Psalms 102 zugrunde. Die im Jahre 1754 erbaute Synagoge ist eine Sehenswürdigkeit.
Die Besichtigung wird bei jedem Besucher Harburgs einen unvergesslichen
Eindruck hinterlassen." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Juli 1936: Text wie im
Gemeindeblatt der israelitischen Gemeinde Frankfurt - siehe oben. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Juli 1936: Text wie im
Gemeindeblatt der israelitischen Gemeinde Frankfurt - siehe oben. |
Beim Novemberpogrom 1938 wurde das Innere
des Gebäudes geplündert. Das Gebäude ging 1939 in den Besitz des Deutschen
Roten Kreuzes über. Während des Krieges diente es mehreren Firmen als
Lagerhalle.
1945 kam das Gebäude in den Besitz der jüdischen
Vermögensverwaltung (JRSO), die es 1952 verkaufte. Seit 1951 wurde die Wohnung
des Synagogendieners wieder für Wohnzwecke benutzt. Das seitdem in Privatbesitz
stehende Gebäude wechselte mehrfach den Besitzer. Mitte der 1960er-Jahre sollte
das Gebäude auf Grund des inzwischen vernachlässigten Zustandes abgebrochen
werden. Nur durch die Initiative eines Geschäftsmannes wurde das Gebäude
gerettet, der aus der Synagoge ein Büro- und Wohnhaus machte. Die Gesamtfassade
blieb jedoch auch bei diesem Umbau unverändert. 1989 bis 1991 wurde die
ehemalige Synagoge als Bürgerhaus und Begegnungsstätte kulturell genutzt
(Einweihung als Kulturzentrum Alte Synagoge Harburg im Juni 1989). Die fehlende
Unterstützung der öffentlichen Hand führte dazu, dass diese Arbeit
eingestellt werden musste. Seitdem wird das Gebäude als Arztpraxis genutzt
(Egelseestraße 8; alte Anschrift: Egelseestr. 114).
Ausführlichere Darstellung der Geschichte der Harburger
Synagoge (Beitrag von Rolf Hofmann): hier
anklicken
| Kurzreferat von
Rolf Hofmann zur Synagoge Harburg (erstellt zur Ausstellung im
Rahmen der Rieser Kulturtage 2014 am 6. Mai 2014, english
version) |
Bei etwas näherer Betrachtung der Geschichte der Harburger Synagoge zeigt sich deren
hervorragende landesgeschichtliche Bedeutung, auch wenn dies heute
vielfach unerwähnt bleibt; bis in die 1930er Jahre war dies jedoch einhellige Meinung von Kunsthistorikern.
Noch Richard Krautheimer erwähnte ihre formale Verwandtschaft mit mittelalterlichen
Synagogen. Im 18. Jahrhundert waren Synagogen dieser Größe selten. Es stellt sich demnach
die Frage nach der Entstehung. In der Mitte des 18. Jahrhunderts hatte eine stattliche Anzahl
jüdischer Familien in Harburg Schutz und Heimat gefunden, nicht zuletzt auch durch die 1741
erfolgte Ausweisung aller Juden aus dem nahegelegenen Monheim. Hochrangige nach
Harburg emigrierte Persönlichkeiten waren der Hoffaktor Abraham Elias Model und der
extrem wohlhabende Alexander Löw. Sowohl Model als auch die Söhne von Alexander Löw
dürften sich 1754 finanziell hervorragend am Neubau der Harburger Synagoge beteiligt haben.
Wegen ihrer Mächtigkeit und ihrer dominanten Lage im Ortspanorama war die Harburger
Synagoge weit und breit ohne Gleichen und repräsentierte das Selbstbewusstsein jüdischer
Untertanen, die sich ihrer Bedeutung im regionalen Wirtschaftsgeschehen bewusst waren,
hatten sie doch weitreichende Fernhandelsbeziehungen und konnten so hervorragende
Produkte bester Qualität zu fairen Preisen anbieten, dies insbesondere auch auf den regionalen
Märkten in Nördlingen und Ingolstadt. Aufgrund dieser Fernhandelsbeziehungen kann man
annehmen, dass vermutlich Baumeister aus Osteuropa für den Bau der Harburger Synagoge
verpflichtet werden konnten. Denkbar wären böhmische Baumeister, deren handwerkliche
Tradition auch heute noch einen guten Ruf hat. Nach Prag weist die Harburger Synagoge
auch aufgrund der architektonischen Verwandtschaft mit der dortigen Altneu-Synagoge.
Die prägnanten Spitzbogenfenster und die massigen Mauern sowie das gewaltige Sprengwerk
der Dachkonstruktion zeigen, dass die Harburger Synagoge in der Mitte des 18, Jahrhunderts
für den ganzen schwäbischen Raum ein Bauwerk besonderer Art und Qualität war. Dies auch
aufgrund der hervorragenden Lage im Ortspanorama, außergewöhnlich zu einer Zeit als
Synagogen eher versteckt platziert wurden und lediglich den Charakter einfacher Wohnhäuser
hatten. Die Harburger Synagoge war bewusster Rückgriff auf mittelalterliche jüdische Kultur,
und diese Bedeutung hat sie heute noch, auch wenn das Innere nicht mehr historisch ist.
Trotz Plünderung in der "Reichspogromnacht" 1938 überstand die äußerlich unversehrte
Synagoge den 2. Weltkrieg und wurde ab 1965 nach Umbau im Innern als Bürogebäude
genutzt, bis sie ab 1989 ein paar Jahre lang in Privatinitiative als überregional erfolgreiches
Kulturzentrum genutzt wurde. Danach hat dort ein Arzt seine Praxis, der mit seiner Familie in
diesem altehrwürdigen Gebäude auch wohnt.
Abschließend sei noch ein Hinweis auf das Jüdische Museum in Berlin gestattet, wo am
Beginn der Ausstellung über das Landjudentum ein Innenraumgemälde der Harburger
Synagoge an hervorragender Stelle platziert ist, verfertigt vom Maler Erich Martin Müller, der
im Spätsommer 1914 mit der Malklasse von Professor Kallmorgen von Berlin aus kommend
in Harburg Station gemacht hatte und hierbei das Innere der Synagoge gemalt
hatte. |
Fotos
1. Fotos von Theodor Harburger und weitere
Abbildungen / Pläne
(Quelle: Central Archives for the
History of the Jewish People, Jerusalem; großenteils veröffentlicht in Th.
Harburger: "Die Inventarisation jüdischer Kunst- und Kulturdenkmäler in Bayern.
1998; die nachfolgenden Fotos wurden direkt von den
Central Archives zur Verfügung gestellt; das mit *) bezeichnete Foto stammt von
Heimatforscher Ernst Ruff).
 |
 |
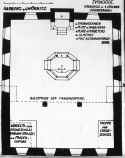 |
Ansicht der ehemaligen
Synagoge Harburg |
Querschnitt der Synagoge:
Blick zur Frauenempore |
Grundriss des 1. Stockes der
ehemaligen Synagoge (Männerraum) |
| |
|
|
 |
 |
 |
Plan Erdgeschoss
der Synagoge
u.a. mit der Mikwe (Sammlung HarburgProject) |
Querschnitt durch
das Synagogengebäude
u.a. mit der Mikwe (Sammlung HarburgProject) |
Plan: Die Stadt
Harburg
um 1840 (Sammlung HarburgProject) |
| |
|
|
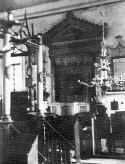 |
 |
 |
| Blick auf den Toraschrein |
Almemor / Bima |
Auf der Frauenempore der
Synagoge
Harburg: der abgegrenzte Bereich
markiert den Aufgang zur
Empore* |
| |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
| Toravorhang |
Torakrone (heute in
Ramot
Hashawim in Israel) |
Toraschild |
| |
|
| |
|
|
Fotos der
Bima
(links um 1925; aus der Sammlung
Lippert im Staatsarchiv Augsburg;
rechts aus der Sammlung HarburgProject) |
 |
 |
| |
|
|
2. Fotos aus der Sammlung HarburgProject
 |
 |
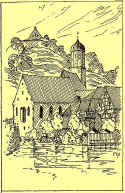 |
Historische Fotografie:
Uferpartie an
der Wörnitz um 1930 mit Blick auf die
Synagoge |
Ölgemälde des Ansbacher
Schullehrers
und Malers Gottfried Scheer: Blick
auf die Synagoge und die
Stadtpfarrkirche Harburg (1934) |
Federzeichnung von Baumeister
Helmut Prechter (1957)
|
| |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
Panorama Harburg - Gemälde
von
Landschaftsmaler Heinrich Fürst
aus Feuchtwangen (1861-1944)
|
Panorama Harburg - kolorierter
Stahlstich nach 1850
von Joseph Maximilian Kolb auf der Grundlage
eines Gemäldes des Münchner Landschaftsmalers
Eduard Gerhardt (1813-1888) |
Panorama Harburg -
Gemälde von Karl Hermann Müller,
der 1905/06 in Harburg malte. Er lebte später in Törwang
am Samerberg (Chiemsee) und nannte sich Müller-Samerberg.
vgl. Wikipedia-Artikel |
| |
|
|
| |
 |
|
| |
Panorama Harburg - Ölgemälde
von Kunstmaler
Ernst Bröcker (München 1893 - München 1963) |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| Ölgemälde von
Erich Martin Müller (1888 Berlin - 1972 Rothenburg ob der Tauber) aus dem
Jahr 1914 unmittelbar vor Ausbruch des 1. Weltkriegs. Müller war damals
Schüler des Landschaftsmalers Professor Friedrich
Kallmorgen an der Berliner Kunstakademie. Kallmorgen war mit seiner
Malklasse auf Erkundungstour entlang der Romantischen Strasse. Nach
Rothenburg, Dinkelsbühl und Nördlingen war dann Harburg die letzte
Station dieser Reise, bevor der Krieg begann. Zu dieser Zeit war auch der
renommierte Potsdamer Maler Wilhelm Thiele in Harburg. Thiele dürfte wohl
Müller dazu eingeladen haben mit ihm zusammen den Innenraum der Harburger
Synagoge zu malen, jeder eine Hälfte (Bild in der Mitte). So entstanden zwei Gemälde, die
zusammen genommen die gesamte Front des Innenraums dieser Synagoge
darstellen. Beide Gemälde befinden sich inzwischen im Fundus des Jüdischen
Museums in Berlin. Müller kehrte übrigens nach dem Krieg nach
Harburg zurück und heiratete eine dortige Lehrerin, mit der er für den
Rest seines Lebens verbunden blieb. |
| |
 |
 |
 |
Die Synagoge aus der
Vogelperspektive.
Links der Synagoge das Guldmann/-
Nebel-Haus; am rechten
Bildrand
Giebel des Hauses des kaiserlichen
Proviantfaktors Simon
Oppenheim (um 1700) |
Die malerisch an der Wörnitz
gelegene Synagoge. Deutlich
erkennbar die Nische des Toraschreines
im
Betsaal des 1. Stockes |
Die Synagoge als wesentlicher
Bestandteil des Stadtpanoramas
mit der mittelalterlichen Burg
im
Hintergrund |
| |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
Historisches Panorama von
Harburg,
um 1945 von Maler Joseph Eschenlohr
fotografiert. Die Synagoge
liegt im
Zentrum der Aufnahme. |
Das Wohnhaus der jüdischen
Familien Guldmann,
später Nebel, in der Egelseestraße |
Zugang zur Mikwe im
Hertle-Haus in Harburg
|
| |
|
| |
|
|
Neuere Fotos
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 12.3.2004)
 |
 |
 |
| Die
"Judengasse" in der Harburger Altstadt |
| |
Haus des Betsaales
1672-1720 |
 |
 |
| |
Das Haus
Marktplatz 5 war seit 1543 Haus von oettingischen Beamten. 1672 kaufte es
Moyses Weyl und richtete in ihm einen Betsaal ein (Dachboden), der bis
1720 genutzt
wurde. 1720 wurde das Haus durch den Wirt Johann Michael Beck
neu erstellt. |
| |
|
| Die 1754 erbaute Synagoge |
|
 |
 |
 |
 |
| Westliche Fassade
der Synagoge an der heutigen Egelseestraße 8 (Foto rechts aus der
Sammlung HarburgProject) |
Oben und unten: Die Synagoge
an der
Wörnitz - von der Brücke aus gesehen |
| |
| |
|
 |
 |
 |
| Eingangsbereich |
Hinweisschild zur Geschichte
der Synagoge |
|
| |
|
|
| Das ehemalige jüdische Schul-
und Armenhaus |
|
 |
 |
 |
Das Haus in der Egelseestraße 15 wurde 1799 durch Isaac David
(hieß ab 1813 Laupheimer) und Jacob Lippmann
Hechinger
gekauft. 1828 bis 1888 befand sich in ihm die jüdische Schule. |
| |
Einige andere Häuser mit
jüdischer Geschichte in Harburg,
jeweils darunter die Hinweistafel |
|
 |
 |
 |
Das Schwarzkopf-Haus in der
Nördlinger
Straße 8, seit 1835 im Besitz der
jüdischen Güterhändler
Samuel
Hechinger und Isaak Blumgart |
Ehemaliges oettingisches
Amtshaus in
der Nördlinger Straße 2 und 4, das
1832-1857 dem jüdischen
Weinhändler
David Wassermann gehörte |
Wohnhaus und Praxis des
jüdischen
Arztes Dr. Raphael Mai in der
Donauwörther Straße 6 |
| |
| |
|
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
|
|
Ehemalige
Privatmikwe
im Gebäude Egelseestraße 4
(Fotos erhalten von Rolf Hofmann,
Aufnahme links vom Mai 2010, rechts vom März 2017) |

 |
| |
Die
Mikwe im Keller des kaiserlichen Proviantfaktors Simon Oppenheim (heute
"Hertle-Haus"), der um
1700
in Harburg lebte und sich dort am Ufer der Wörnitz ein für die
damalige Zeit durchaus
herrschaftliches Anwesen baute. 2010 werden
umfangreiche Sanierungsmaßnahmen
dieses bedeutsamen Baudenkmals durch den
jetzigen Hauseigentümer ausgeführt. |
| |
|
|
Weitere Erinnerungen an die
jüdische Geschichte
(Aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries) |
 |
| |
Brief aus der
Familie des Fürstlichen Salzfaktors Wassermann, adressiert an
Israel
Elkan Wassermann in Harburg. Der Brief selbst ist geschäftlicher Natur,
aus Miesbach und datiert auf den 23.6.1846 |
| |
|
| |
 |
 |
| |
Faltbrief von 1828
aus Dietfurth an den
"Barnoßen und Vorsteher der Judenschaft zu Harburg" |
| |
|
| |
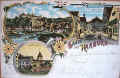 |
 |
| |
Litho-Karte aus Harburg, verschickt am 15. August 1900 nach Fischen im
Allgäu;
auf der rechten Seite des rechten Bildes ist das Geschäft des
jüdischen Gemeindemitgliedes Hermann Hiller zu sehen. |
Einzelne Presseberichte
| Oktober 2010:
Ein Herr Haarburger besucht Harburg |
Artikel in der "Augsburger Allgemeinen" vom 4. Oktober 2010 (Artikel):
"Herr Haarburger besucht Harburg.
Harburg Erst hatte er eine E-Mail geschrieben, dann meldete sich ein junger Mann aus Amerika persönlich bei Bürgermeister Wolfgang Kilian: Er heiße Haarburger und wolle sich Harburg ansehen, sagte er - vor allem aber wolle er suchen, ob Vorfahren seiner Familie
dort zu finden seien.
Denn es ist zwar bekannt, dass eine weitverzweigte jüdische Familie Haarburger existiert, aber erstmals reiste ein Angehöriger mit dem Zunamen Haarburger in die Namen gebende Stadt Harburg.
So erzählte der 24-jährige Amerikaner Jay Haarburger, dass seine Vorfahren im 18. Jahrhundert nach Frankfurt gezogen waren und wahrscheinlich von ihrem bisherigen Herkunftsort den Nachnamen erhielten. Seine Großeltern verließen als Emigranten 1938 ihren letzten Wohnort Dinslaken im Rheinland und kamen nach Ohio, wo er heute in Cleveland lebt.
Bekannter Fotograf. Der Name erinnert auch an den Kunsthistoriker und bekannten Fotografen Theodor Harburger, geboren 1887 in München und gestorben 1949 in Haifa in Israel, der viele frühe Fotos in Harburg machte, sich der Stadt zugehörig fühlte und im Jahrgang 1999 der
'Harburger Hefte' eine Würdigung fand.
Amerikaner bewegt von jüdischem Friedhof. Bürgermeister Kilian vermittelte dem jungen Amerikaner Diethild Graß als Dolmetscherin und einen Termin mit Fritz Thum zur Besichtigung des jüdischen Friedhofes - dem wichtigsten Besuch für den 24-Jährigen: Thum führte ihn dort und zeigte sich als eine unerschöpfliche Quelle zu allen jüdischen Namen, die auf den Grabsteinen verzeichnet sind.
Mithilfe von Thum und Dolmetscherin Graß fanden sich Namen, die möglicherweise in den Vorfahrenkreis der Familie Haarburger führen. Der Amerikaner war zutiefst bewegt von allem, was er auf dem Friedhof sah und erlebte eine innere Begegnung mit seinen möglichen Vorfahren - aber auch die Ruhe und angemessene Stille, die man auf diesem Gottesacker findet. Besonders beeindruckt war er auch von der Fürsorge für die Toten seines Volkes durch Thum.
Große Sympathie für die Stadt entwickelt. Dieses Gefühl für Harburg hat er in den zwei Tagen aufmerksam entwickelt, mit einer großen Sympathie nicht nur beim Besichtigen der Burg, sondern auch beim Wandern in die Stadt hinunter. Diethild Graß führte ihn zu ehemals jüdischen Häusern und deren Geschichte. Haarburger beeindruckte die Herzlichkeit vieler Menschen, denen er begegnen konnte. Hans Martin Tag zeigte ihm die Synagoge und darin seine heutigen Wohnräume. Eine große Überraschung war zudem die Führung durch das ehemalige Haus Oppenheimer, Egelseestraße, das gerade von dem Besitzer Willy Hertle aufwendig restauriert wird. Dieses Haus, von dem jüdischen Ritualbad im Keller bis zu den vielfältigen Wohnräumen in den oberen Stockwerken, ist eine historische Fundgrube für die Lebensgewohnheiten seiner Bewohner seit dem 16. Jahrhundert, aber auch für die Handwerkskunst der Zeiten.
Der Besucher aus Amerika äußerte ein besonderes Gespür für die Menschen, deren Leben er aus den alten Zeugnissen fühlen konnte, etwa beim Ausblick auf die Wörnitz und die Landschaft.
Biersorten getestet und Einladung zum Weißwurst-Essen. Freude bereitete dem 24-Jährigen auch die Möglichkeit, verschiedene deutsche Biersorten zu
'testen' und eine Einladung zum Weißwurst-Essen bei Familie Graß. Als eine für ihn große Kostbarkeit zeigte er eine von 1900 stammende Ausgabe von Heinrich Heines
'Buch der Lieder'. Sie hatte sein 'deutscher' Großvater als amerikanischer Soldat im Zweiten Weltkrieg in Erinnerung an seine Herkunft immer in allen Gefahren mit sich geführt.
Zudem hatte sie ihm sein Großvater vererbt. Erst in Harburg erfuhr Haarburger, wer Heine war und welche Bedeutung er für die deutsche Literatur und die deutschen Juden besonders in der Emigration hatte. Heines populäre Gedichte wurden so zum Erlebnis eines gemeinsamen geistigen Besitzes für Juden und Deutsche.
Karten aus dem 18. Jahrhundert. Mit großem Interesse und Staunen entdeckte der Amerikaner beim Betrachten alter Karten aus dem 18. Jahrhundert, dass der Name des Marktes damals auch
'Haarburg' geschrieben wurde. Kaum ein Wunder, dass eine jüdische Familie aus Harburg, anderswo angekommen, ihren Namen auf diese Weise schrieb.
Der studierte Experte für datenbasierte Geografiesysteme will die Namen gebende Stadt seiner Familie deshalb gerne wieder besuchen, betonte er.
(kmg)" |
| |
| Februar 2012:
Erinnerung an den Landschaftsmaler Erich Martin
Müller (1888-1972) und sein Gemälde der Synagoge Harburg
|
 Abbildung links: Heute im Fundus des Jüdischen Museums Berlin: Das Gemälde zeigt den historischen Innenraum der Harburger
Synagoge (Foto: Rolf Hofmann, abgebildet und den nachfolgenden Text
teilweise wiedergegeben mit Genehmigung von Rolf Hofmann). Abbildung links: Heute im Fundus des Jüdischen Museums Berlin: Das Gemälde zeigt den historischen Innenraum der Harburger
Synagoge (Foto: Rolf Hofmann, abgebildet und den nachfolgenden Text
teilweise wiedergegeben mit Genehmigung von Rolf Hofmann).
Artikel von Rolf Hofmann in der "Donauwörther Zeitung" vom 12.
Februar 2012 (Artikel):
"Mit Spitzweg und Zille auf der Harburg. Erich Martin Müller war einer der großen Landschaftsmaler. Der Berliner hatte beste Verbindungen zur Region
Donauwörth Erich Martin Müller, so sagt man, hatte einen köstlichen Humor. Zille’s Anekdoten mochte er besonders gern. Beim Weggehen soll Zille einmal seiner Frau gesagt haben:
'Und wenn de Kinder frech sind, so hau se mit’m Pinsel; aber nich’ mit’m Schweinfurter Grün, det is det
teuerste.' Auch Müller war ein Talent. Besonders das Malen lag ihm – und hierbei lag dem Berliner besonders die Region rund um Harburg am Herzen. All das hatte seinen Grund..." |
| |
Links und Literatur
Links:
Familienblätter:
Familienblätter sind detaillierte Ausarbeitungen zu jüdischen Familien,
die von Rolf Hofmann im Rahmen der Forschungsinitiative "Harburg Project"
erstellt wurden. Kontakt für Ergänzungen/Korrekturen: Rolf Hofmann, HarburgProject@aol.com.
Literatur:


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Harburg Swabia.
Jews were victims of the Black Death persecutions of 1348/49. A new community
was founded in 1671 by 11 Jews expelled from Hoechstaedt. Jews from Monheim
arrived in 1741 after the expulsions from the principality of Pfalz-Neuburg. A
synagogue was dedicated in 1754. In the 18th century, Jews engaged in
moneylending and traded in horses and cattle, jewelry and wine. In 1834 the
Jewish population was 360, with 40 children in a Jewish public school in 1857.
The Jewish population subsequently declined through emigration to the big cities,
numbering 171 in 1867 (total 1,304) and 13 in 1933. Another ten left by 1939 (six
to Palestine).



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|