|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
Synagogen in Bayerisch Schwaben
Wallerstein (Landkreis
Donau-Ries)
Jüdische Geschichte / Rabbinat / Synagoge
Übersicht
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
(english version)
In dem seit 1261 den Grafen von Oettingen gehörenden Wallerstein bestand eine jüdische
Gemeinde beziehungsweise lebten jüdische Personen von spätestens der Mitte des
14. Jahrhunderts bis 1939.
Im Mittelalter war die Gemeinde von den Judenverfolgungen (1298 oder
1348/49) betroffen. 1434 lebten zwei Juden in Wallerstein. 1488 wird von einem
Juden in Wallerstein berichtet, der damals gefangen gesetzt und später
vertrieben wurde. 1506 wurden die Juden vorübergehend ausgewiesen, nur
ein damals dort praktizierender jüdischer Arzt und seine arzneikundige
Schwiegermutter konnte bleiben. Im weiteren Verlauf des 16. Jahrhunderts
entstand durch den Zuzug von Juden aus anderen Städten und Regionen eine neue
Gemeinde von besonderer Bedeutung, zumal dem Wallersteiner Rabbiner Mosche
Levi Heller die Funktion eines "Rabbiners für ganz Deutschland"
(vermutlich gewählter Sprecher auch anderer Rabbanim und Parnassim gegenüber
weltlichen Behörden) zugekommen ist.
Nach dem Dreißigjährigen Krieg umfasste die jüdische Gemeinde: 1656 23
Familien, 1684 43 Familien, 1688 37 Familien. Bis zum 18. Jahrhundert lebten die
jüdischen Einwohner im Bereich des "Judenhofes" (1787 abgebrochen).
Danach waren ihre Häuser vor allem entlang der "Judengasse"
(heute: Felsenstraße). Die jüdischen Familien lebten vom Handel,
insbesondere vom Pferde- und Viehhandel, auch auch vom Einzel- und
Kleinwarenhandel. Bei den Grafen und Fürsten von Wallerstein waren einige jüdische
Hoffaktoren tätig, u.a. aus der Familie der Model zu Monheim.
Wallerstein war - wie schon an dem genannten Rabbiner Mosche Levi Heller
deutlich wird - vom 16.-19. Jahrhundert Sitz eines bedeutenden Landrabbinates
(zu einzelnen Rabbinern siehe unten). Im 19. Jahrhundert war das "königlich-bayerische
Bezirksrabbinat Wallerstein" zuständig für alle jüdischen Gemeinden
im bayerischen Ries. Nach Rückgang der Zahlen jüdischer Gemeindeglieder seit
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde um 1900 die Rabbinatsbezirk Wallerstein vom
Rabbiner in Ichenhausen
mitbetreut und nicht mehr besetzt.
Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte sich im 19. Jahrhundert wie
folgt: 1811/12 296 jüdische Einwohner (14,0 % von insgesamt 2.120
Einwohnern), 1867 78 (5,7 % von 1.372), 1871 57 (4,1 % von 1.402), 1880 56 (3,8
% von 1.482), 1890 40 (3,1 % von 1.297), 1900 32 (2,5 % von 1.262), 1910 37 (2,9
% von 1.253).
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine
Religionsschule, ein rituelles Bad und einen Friedhof. Zur Besorgung religiöser
Aufgaben der Gemeinde war bis zur 2. Hälfte des 19. Jahrhundert neben dem
Rabbiner noch ein Religionslehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. Nachdem Wallerstein keinen eigenen Rabbiner mehr hatte, gab
es noch einen Religionslehrer beziehungsweise seit Anfang des 20. Jahrhunderts
nur noch einen Vorbeter und Schochtet. Den Religionsunterricht übernahmen nun
Lehrer aus umliegenden Gemeinden.
1925 lebten nur noch 24 jüdische Personen (1,9 % von 1.203). Vorsteher
der Gemeinde waren damals Josef Schulmann und Max Lisberger. Die vier
schulpflichtigen jüdischen Kinder erhielten ihren Religionsunterricht durch die
Lehrer Gustav Erlebacher (Mönchsroth)
und Hermann Strauß (Nördlingen).
1932 wird als Gemeindevorsteher Josef Schulmann genannt, Max Lisberger
als Schriftführer. Offiziell gehörten die jüdischen Einwohner Wallersteins
bereits seit 1928 zur Gemeinde in Nördlingen.
Im Schuljahr 1931/32 gab es nur noch ein schulpflichtiges jüdisches Kind am
Ort.
1933 wurden noch 16 jüdische Einwohner gezählt (1,3 % von 1.182) in
Wallerstein. Von ihnen wurden 1942 mindestens sechs deportiert und ermordet.
Von den in Wallerstein geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen
Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Heinrich Heckscher
(1863), Rosa Kohner geb. Lisberger (1880), Hannchen Lisberger (1876), Ludwig Leo
Meyer (1879), Doris Rachelsohn (1921), Elieser M.
Rachelson (1892), Ida Schlesinger geb. Wallerstein (1881), Berta Schulmann
(1874), Ida Schulmann geb. Cohn (1886), Ludwig Schulmann (1880), Nanette
Schulmann geb. Neuburger (1891), Paula Schulte geb. Meyer (1886), Rosa Seltmann
geb. Brunner (1894), Isidor Stein (1870), Lina Süß-Schülein geb. Marx (1880),
Siegfried Süß-Schülein (1903), Leopold Weinmann (1884), Anna Wild (1880), Lina Wild (1885).
Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Allgemeine Beiträge
zur jüdischen Geschichte
Forschungsstand zur jüdischen Geschichte in Wallerstein (Beitrag von 1842)
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Dezember 1842: "Wallerstein. Die Judengemeinde zu Wallerstein gehört wahrscheinlich zu
den ältesten in Deutschland. Es reichen zwar die schriftlichen Monumente
nicht über die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts hinauf, allein andere
Gründe lassen darauf schließen. Ihre zeremoniellen Gebräuche stimmen
mit denen der ältesten Gemeinden zu Speyer und Worms überein, weniger
mit Fürth, obgleich diese für die meisten als Norm gedient hat und noch
dient. Hieraus konnte man folgern, dass die Wallersteiner Gemeinde älter
als die Fürther sei. Die Begräbnisstätte muss sehr alt sein, weil in früherer
Zeit die Toten aus Regensburg hierher gebracht wurden und doch die
Israeliten in Regensburg schon im vierzehnten Jahrhundert ihre Begräbnisstätte
hatten. Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Dezember 1842: "Wallerstein. Die Judengemeinde zu Wallerstein gehört wahrscheinlich zu
den ältesten in Deutschland. Es reichen zwar die schriftlichen Monumente
nicht über die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts hinauf, allein andere
Gründe lassen darauf schließen. Ihre zeremoniellen Gebräuche stimmen
mit denen der ältesten Gemeinden zu Speyer und Worms überein, weniger
mit Fürth, obgleich diese für die meisten als Norm gedient hat und noch
dient. Hieraus konnte man folgern, dass die Wallersteiner Gemeinde älter
als die Fürther sei. Die Begräbnisstätte muss sehr alt sein, weil in früherer
Zeit die Toten aus Regensburg hierher gebracht wurden und doch die
Israeliten in Regensburg schon im vierzehnten Jahrhundert ihre Begräbnisstätte
hatten.
Das älteste noch leserliche Denkmal auf dem Friedhofe gehört in das fünfzehnte
Jahrhundert und ist der Grabstein eines gelehrten Rabbi Moses. Der Sage
nach waren nach den Römerzügen Juden vorhanden. Die Verfolgungen der
Juden im 13. und 14. Jahrhundert erstrecken sich auch nach Wallerstein (s.
Nördlingen). Die Ursache lag in den Freiheiten und Privilegien, durch
welche sie des Handels sich bemeisterten und die Christen beeinträchtigten.
Das Privilegium Kaiser Ludwigs, erteilt dem Grafen Ludwig dem Älteren in
Oettingen, beweist die Verbreitung der Juden (kaiserliche Kammerknecht) in
Wallerstein (Steinheim) und in der Umgegend (1333, 1348). Im Jahre 1358
erlitten sie vielerlei Verfolgungen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass
sich Juden während der vielen Pfandschaften des heiligen Römischen
Reiches an die Grafen von Oettingen, worunter sich 1313 die Judensteuer zu
Ulm, Nördlingen etc. befindet. Und wegen der dabei geleisteten Dienste,
Besitz und Rechte erwarben." |
Allgemeiner Beitrag über "Die
Juden im Ries", vor allem zu Wallerstein (1847)
 |
 |
 |
 |
Beitrag in der Zeitschrift
"Der treue Zionswächter" vom 7. und 14. September 1847:
zum Lesen bitte Textabbildungen anklicken. |
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Wallerstein
(Beitrag von Rabbiner Dr. Kroner von 1927)
 |
 |
 |
Beitrag in der
"Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. April 1927
Zum Lesen bitte Textabbildungen anklicken |
Aus der Geschichte des Rabbinates in
Wallerstein
In Wallerstein waren u.a. als Rabbiner tätig:
 | Mosche Levi Heller (ca. 1517 - ca. 1600 in
Wallerstein), Vater des R. Nathan Heller (gestorben vor 1579), Großvater
von R. Jomtow Lippmann Heller. |
 | Chanoch Henoch ben Abraham (gest. 1663 in Pfersee):
war bis 1648/49 Rabbiner in Posen und Gnesen, danach einige Jahre in Prag,
bis er um 1655 für einige Jahre als Landesrabbiner nach Wallerstein
kam; später zum Landesrabbiner von Schwaben mit Sitz in Pfersee ernannt. |
 | Abraham ben David Mahler (von Prag): 1715 aus
Prag nach Wallerstein berufen; 1719 nach Oettingen
berufen; 1752 bis 1757
Rabbiner in Bamberg. |
 | Pinchas ben Moses haKohen Katzenellenbogen (von
Dubnow, gest. ca. 1767 in Schwabach): studierte in Prag und Nikolsburg,
erhielt 1719 einen Ruf nach Wallerstein, wo er 1720 mehrere Monate
war, danach Rabbiner in Leipnik in
Mähren, 1722 bis 1750 in Marktbreit
als Rabbiner bzw.Aw Beth Din = Vorsitzender des Rabbinatsgerichtes in
den Schwarzenbergischen Ländern.
Anmerkung: Hinweis auf Literatur: Julia Haarmann. Hüter der Tradition.
Erinnerung und Identität im Selbstzeugnis des Pinchas Katzenellenbogen
(1691-1767). Verlag Vandenhoeck & Ruprecht (Jüdische Religion, Geschichte
und Kultur Bd. 18). 2012. |
 | Isaak Israel Lemberger (von Proßnitz in Mähren,
gest. 1750 in Wallerstein): war bis 1730 Rabbiner in Proßnitz in Mähren,
von 1730 bis 1750 in Wallerstein. |
 | Zwi Hirsch ben Baruch Kahana Rappaport (Sohn des
Fürther und Schnaittacher Rabbiner Baruch Rappaport, gest. 1763 in
Wallerstein): von 1750 bis 1763 Rabbiner in Wallerstein. |
 | Isaak ben Zvi Rappaport (gest. 1788 in Bonn):
übernahm nach dem Tod seines Vater s.o. 1763 das Wallersteiner
Rabbinat, 1772 als Landesrabbiner für das Erzbistum Köln und das Herzogtum
Westfalen berufen. Ihm folgte sein Bruder: |
 | Simcha-Bunem ben Zvi Rappaport (gest. 1816 in Bonn):
war bis 1772 Rabbiner in Marktbreit,
danach bis 1788 in Wallerstein; später in Bonn. |
 | Ascher Löw (auch Ascher Wallerstein, 1754 in Minsk
- 1837 in Karlsruhe): Sohn des Talmudisten Arje Löb ben Ascher, zuletzt in
Metz): 1783 Landesrabbiner der Würzburgischen Ritterschaft in Niederwerrn,
1785 Landesrabbiner des Fürstentums Wallerstein, 1809-1837 Oberlandesrabbiner
in Karlsruhe. |
 | Wolf S. Rothenheim (1801 in Wallerstein, gest. in den
USA 1862): 1841 nach
längerer Vakatur zum Rabbinatsverweser in Wallerstein investiert; bei einer
Wahl in Wallerstein am 19. Januar 1847 setzte sich allerdings David Weiskopf
mit 67 von 104 Stimmen gegen Wohl Rothenheim durch; Rothenheim ist nach dem
anschließenden verlorenen Rechtsstreit nach
Amerika ausgewandert; zunächst in New York, nach 1855 in Cincinatti als
Lehrer; Mitarbeiter an der deutsch-jüdischen Zeitschrift "Die
Deborah".
Artikel
zum Tod von Wolf Rothenheim in der Zeitschrift "The Israelite" vom
7. November 1862 (eingestellt als pdf-Datei) . |
 | David Weiskopf (1798 in Gunzenhausen - 1882 in
Kleinerdlingen): Schüler von Oberrabbiner Abraham Bing in Würzburg;
1830 Religionslehrer und rabbinischer Aktuar des Würzburger Oberrabbiners
Bing in Aub, 1847 zum Rabbiner in Wallerstein
gewählt; 1849 zum Distriktsrabbiner eingesetzt, führte eine kleine Jeschiwa und eine Talmud-Tora-Schule; 1876 zieht er zu seinem Schwiegersohn
Marx Michael Kohn nach Kleinerdlingen. |
Aus Wallerstein stammten u.a. die folgenden Rabbiner:
 | Jomtow Lipmann Heller (1579 in Wallerstein - 1654
in Krakau): bereits mit 18 Jahren wurde er in Prag Rabbinatsassessor. Danach war er
in Nikolsburg, und Wien als Rabbiner, seit 1627 als Oberrabbiner in Prag tätig.
Nach äußerst unruhigen Zeiten wurde er 1644 Rabbiner in Krakau, wo er als
Lehrer der dortigen Jeschiwa erfolgreich bis zu seinem Tod lehrte. Er ist Autor
bedeutender religiöser Werke. Sein Mischna-Kommentar (Tosaphot Jomtow) wird
noch heute studiert. |
 | Abraham Ascher (1794 in Wallerstein - 1837 in
Bühl): lernte in Metz und Fürth, ab 1828 Klaus-Rabbiner
("Beter") in Mannheim, 1829 Rabbinatsverweser, 1832-1837 Rabbiner
in Bühl. |
 | Jakob Oberdorfer (1807 in Wallerstein - 1884 in
Oberdorf), studierte in Hechingen, Fürth, München; 1834 Distriktsrabbiner
in Ansbach, 1842 Prediger in Wandsbek, Hamburg, 1857 Rabbiner in Pniewa
(Pinne), Posen, 1861-1884 Rabbiner in Oberdorf am Ipf. |
Rabbi Mosche Levi Heller - ein "Landrabbiner über
ganz Deutschland"? (Abschnitt aus einem Artikel von 1862: "Über den Versuch
des Königs Ruprecht, den sämtlichen deutschen Juden ein rabbinisches Oberhaupt
zu geben. Von David Oppenheim)
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. April 1862: "...Wir
finden 150 Jahre später wirklich einen Landrabbiner über ganz
Deutschland, der noch dazu in einem kleinen Städtchen seinen Sitz hatte,
genannt. Die betreffende Stelle, die zu einer eingehenden Untersuchung
auffordert, befindet sich in der Vorrede des Korrektors Abraham Israel
Levi zum Midrasch rabba, editio Frankfurt a.d. Oder 1711, … wo derselbe
erzählt, dass er auf dem Grabsteine seines Urahns, R. Moses Levi Heller
in Wallerstein gelesen habe, dass genannter R. Moses Rabbiner über ganz
Deutschland war: (Zitat seine Artikel links)... Wir wissen über unseren R. Moses Levi Heller aus
Wallerstein (blühte 1550) nichts Näheres anzugeben, als dass er der Großvater
des weit berühmteren R. Jomtob Heller (dem Verfasser des Tossefot Jomtob)
war, und dass der Ruhm des Enkels den des Großvaters weit überstrahlte.
Übrigens gedenkt R. Jomtob seines Großvaters mit besonderer Auszeichnung
bloß ein Mal in der Vorrede seines Maadane Melech, welches Werk uns aber
gegenwärtig nicht zu Gebote steht. Vielleicht unternimmt es der Vorstand
oder der Rabbiner zu Wallerstein, das Epitaph des R. Moses Heller getreu
kopieren zu lassen und in diesen Blättern zu veröffentlichen, was gewiss
von den meisten Lesern dieser Zeitung dankbar aufgenommen werden möchte…" Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. April 1862: "...Wir
finden 150 Jahre später wirklich einen Landrabbiner über ganz
Deutschland, der noch dazu in einem kleinen Städtchen seinen Sitz hatte,
genannt. Die betreffende Stelle, die zu einer eingehenden Untersuchung
auffordert, befindet sich in der Vorrede des Korrektors Abraham Israel
Levi zum Midrasch rabba, editio Frankfurt a.d. Oder 1711, … wo derselbe
erzählt, dass er auf dem Grabsteine seines Urahns, R. Moses Levi Heller
in Wallerstein gelesen habe, dass genannter R. Moses Rabbiner über ganz
Deutschland war: (Zitat seine Artikel links)... Wir wissen über unseren R. Moses Levi Heller aus
Wallerstein (blühte 1550) nichts Näheres anzugeben, als dass er der Großvater
des weit berühmteren R. Jomtob Heller (dem Verfasser des Tossefot Jomtob)
war, und dass der Ruhm des Enkels den des Großvaters weit überstrahlte.
Übrigens gedenkt R. Jomtob seines Großvaters mit besonderer Auszeichnung
bloß ein Mal in der Vorrede seines Maadane Melech, welches Werk uns aber
gegenwärtig nicht zu Gebote steht. Vielleicht unternimmt es der Vorstand
oder der Rabbiner zu Wallerstein, das Epitaph des R. Moses Heller getreu
kopieren zu lassen und in diesen Blättern zu veröffentlichen, was gewiss
von den meisten Lesern dieser Zeitung dankbar aufgenommen werden möchte…" |
Die Erneuerung des Grabsteines für Rabbi Mosche Levi Heller (1876)
Anmerkung: dem Webmaster ist einiges unklar: nach dem Artikel bzw.
der zitierten Grabsteininschrift ist Rabbi Mosche Levi Heller 1550 gestorben.
Dies passt nicht zur Angabe des nachfolgenden Beitrages, wonach Rabbi Jomtow
Lippmann Heller (der Enkel von Rabbi Mosche Levi Heller) von seinem Großvater
erzogen wurde, da sein Vater Nathan bereits vor dessen Geburt gestorben ist.
Nach anderen Angaben starb Rabbi Mosche Levi Heller erst um 1600. So liegt
vermutlich ein Lesefehler der Grabsteininschrift vor.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Oktober 1876 (abgekürzt
zitiert): "Bamberg,
24. September (1876). Folgende Mitteilung wird Ihre Leser ohne Zweifel
lebhaft interessieren, weshalb ich hoffe, dass Sie solche einer Ihrer nächsten
Nummern einreihen werden. Auf dem Friedhofe der alten jüdischen Gemeinde
Wallerstein in Schwaben ruhen die Gebeine des hochberühmten HaRaw HaGaon,
unseres Lehrers, der Herr, Herr Mosche Levi Heller – das Andenken an den Gerechten ist zum
Segen -, des Großvaters des in der ganzen jüdischen Welt bekannten
HaRaw HaGadol, unseres Lehrers, der Herr Herr Lippmann Heller Wallerstein – das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen. Von dem großen Ansehen, in welchem Jener bei
seinen Zeitgenossen gestanden, gibt die erfolgte Ernennung desselben durch
den römisch-deutschen Kaiser zum Oberrabbiner aller Juden Deutschlands,
die auch in der Einleitung zu Midrasch Jalkut Schimoni, Ausgabe Frankfurt
a.O., Schanat Schimon Aw, erwähnt ist, sprechendes Zeugnis. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Oktober 1876 (abgekürzt
zitiert): "Bamberg,
24. September (1876). Folgende Mitteilung wird Ihre Leser ohne Zweifel
lebhaft interessieren, weshalb ich hoffe, dass Sie solche einer Ihrer nächsten
Nummern einreihen werden. Auf dem Friedhofe der alten jüdischen Gemeinde
Wallerstein in Schwaben ruhen die Gebeine des hochberühmten HaRaw HaGaon,
unseres Lehrers, der Herr, Herr Mosche Levi Heller – das Andenken an den Gerechten ist zum
Segen -, des Großvaters des in der ganzen jüdischen Welt bekannten
HaRaw HaGadol, unseres Lehrers, der Herr Herr Lippmann Heller Wallerstein – das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen. Von dem großen Ansehen, in welchem Jener bei
seinen Zeitgenossen gestanden, gibt die erfolgte Ernennung desselben durch
den römisch-deutschen Kaiser zum Oberrabbiner aller Juden Deutschlands,
die auch in der Einleitung zu Midrasch Jalkut Schimoni, Ausgabe Frankfurt
a.O., Schanat Schimon Aw, erwähnt ist, sprechendes Zeugnis.
Die Mazewa (Grabstein) dieses Mannes liegt seit undenklichen Zeiten in Trümmer
und immer und immer wurde der Wunsch laut, dass dieselbe wieder
aufgerichtet werden möchte. Endlich ist dieser fromme Wunsch in Erfüllung
gegangen. Am verwichenen 1. Tag der Selichot versammelten sich auf
Einladung des in weiten Kreisen bekannten, ehrwürdigen Herrn
Distrikt-Rabbiners Weiskopf – sein Licht leuchte – viele Männer,
Verehrer der Tora, aus der ganzen Umgegend Wallersteins, um der
Aufrichtung eines neuen Grabsteines, die in einem feingeschliffenen
Sandstein in Obelisk-Form besteht, anzuwohnen. Man würde es vorgezogen
haben, die Bruchstücke des alten Grabsteines zusammen zu fügen, allein
das war leider nicht möglich und man musste sich daher zur Errichtung
eines neuen Denkmals entschließen, welches die Inschrift des alten
Grabsteines enthält, insoweit sich dieselbe (durch die Bemühungen des
Herrn Distriktrabbiners Weiskopf) noch aus den erhaltenen Bruchstücken,
die übrigens an Ort und Stelle gelassen wurden, entziffern ließ. Nach
Aufrichtung des neuen Steins heilt Herr Distrikt-Rabbiner Weiskopf eine
entsprechende Ansprache an die Versammlung, die den tiefsten Eindruck
hervorbrachte. … Den Schluss des erhebenden Aktes bildete Tefilat Mincha
(Mittagsgebet), die in der Synagoge zu Wallerstein von den tief gerührten
Anwesenden verrichtet wurde. Die Inschrift, die nun auf dem neuen
Grabstein in Goldbuchstaben prangt, lautet: "Mosche stieg zu Gott
hinauf /… / Gott hat die Krone von unserem Häuptern genommen / er wurde
von uns genommen / das war der Mann, der uns geführt hat / der uns von
den schlechten Menschen gerettet und uns angesprochen hat / der große
Baum, der Gaon, unser Lehrer / Mosche Levi Heller, das Licht unserer
Augen, / Sohn des Märtyrers R. Abraham unserer Gerechten / am 4. Tag des
Monats Schewat im Jahr 5310", also 1550".
(Übersetzung des Webmasters ohne Garantie, bitte hebräisches Zitat links
vergleichen).
|
Roman über Rabbi Jom tob Lippman Heller von Heinrich Lebermann (1903)
Anmerkung: ein ausführlicher Roman über Rabbi Jom tob Lipmann
Heller von Heinrich Lebermann erschien in Fortsetzungsserie in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 10. September 1903 (Nr. 52) bis 30. November 1903 (95).
Nachstehend der Beginn der 14. Folge.
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. November 1903:
"Rabbi Jom tob Lipmann Heller. Von Heinrich Lebermann." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. November 1903:
"Rabbi Jom tob Lipmann Heller. Von Heinrich Lebermann."
Zum Lesen bitte Textabbildung anklicken. |
Artikel über Rabbi Jomtob Lippmann Heller von Rabbiner
Dr. A. Posner in Kiel (von 1929)
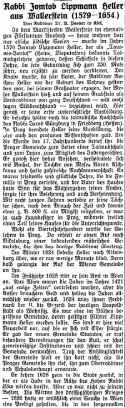 |
 |
 |
|
|
Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. August 1929: "Rabbi Jomtob
Lippmann Heller aus Wallerstein (1579-1654). Von Rabbiner Dr. A. Posner in
Kiel. In dem Marktflecken Wallerstein im ehemaligen Fürstentum Ansbach
– heute wohnen dort nur etliche jüdische Seelen – wurde im Jahre 1579
Jomtob Lippmann Heller, der aus ‚Tausves-Jontof’ (Heine, Disputation)
bekannte Talmudgelehrte geboren, dessen Schicksal in diesem Jahre, da sein
Geburtstag sich zum 250. Male jährt, neu erzählt zu werden verdienen.
Der Knabe wurde, da sein Vater, der Rabbiner Nathan Heller vor der Geburt
des Sohnes gestorben war, bei seinem Großvater erzogen, der Moses
Wallerstein hieß und auf seinem Grabstein als Landrabbiner von ganz
Deutschland – will wohl sagen – Süddeutschland – bezeichnet wird.
Hier genoss er seine erste unterrichtliche Ausbildung. Er besuchte später
noch die talmudische Hochschule des Rabbi Jacob Günzburg in Friedberg
(Hessen). In Prag beendete Heller seine Ausbildung, die hier auch den
profanen Wissenschaften galt. Um die Wende des 17. Jahrhunderts berief ihn
die Prager Gemeinde zum leider einer Talmudschule und zum Dajan, zum
Mitglied des Judengerichtes. Er genoss hier hohes Ansehen, verheiratete
sich mit Rachel, der Tochter von Moses Aaron Aschkenas und hatte
zahlreiche Nachkommenschaft. Es waren friedvolle und glückliche Jahre,
die die Familie in Prag verlebte, und der Vater des Hauses hatte Sinn für
das Wohlergehen seiner Kinder, sorgte für ihre Belehrung und auch
Verheiratung. Mit recht jungen Jahren verlobte er seine Töchter schon,
nach dem Brauch der Zeit und konnte einer z.B. 800 Gulden als Mitgift
mitgeben, er war ja auch Hausbesitzer in Prag, widmete freilich einen Teil
seines Hauses für die Unterrichtszwecke.
Wohl ein Vierteiljahrhundert wirkte der Gelehrte in Prag. Da erhielt er
einen Ruf nach Nikolsburg, einer bedeutenden mährischen Gemeinde, die ihm
das dortige Rabbinat übertrug. Im Winter 1624 siedelte Heller nach
Nikolsburg über, wo er nur wenige Monate blieb. Denn bald gelangte der
Ruf der Wiener Gemeinde an ihn. Im Frühjahr 1625 tritt er sein Amt in
Wien an. Aus Wien waren die Juden im Jahre 1421 ‚auf ewige Zeiten’
vertrieben worden, aber die Kaiser brauchten Geld und holten die Juden
allmählich wieder zurück. 1624 wies ihnen Ferdinand II. die Gegend der
heutigen Leopoldstadt als Wohnsitz. Es war eine im Blühen begriffene
Gemeinde, deren geistiger Führer Lippmann Heller werden sollte. So fand
er hier viel Neuarbeit vor, auf die er sich mit Eifer stürzte. Er gab der
neuen Gemeinde Statuten, er traf besondere Verordnungen für den Kult, er
schuf gemeinnützige Institutionen und schien mit der Gemeinde verwachsen.
Trotz der Anhänglichkeit der Gemeinde hielt es ihn dort nicht, als die
Prager Gemeinde ihn rief, ihn zum Oberrabbiner und Schuloberhaupt
ernannte. Er kehrte 1628 gern in die Stadt zurück, in der er als Jude in
der Nähe des Hohen Rabbi Löw wirken durfte. Aber es war nicht zu seinem
Besten. Die Wirren des Dreißigjährigen Krieges – 1626 hatte er anlässlich
einer Seuche in Wien eine Predigt gehalten, die in den sorgenvollen Zeiten
die Gemeinde mit Mut und vertrauen erfüllte -, beunruhigten sein Leben
und brachten ihn in eine gefährliche und sorgenvolle Lage. Der Krieg
forderte ungeheure Geldsummen, auch der Gemeinderat der Prager jüdischen Gemeinde
musste sich an der Aufbringung beteiligen. Er nahm Anleihen auf, die durch
Besteuerung der Gemeindemitglieder gedeckt werden sollten. Viele
Mitglieder glaubten, zu scharf angefasst zu sein, und scheuten sich nicht,
den eigenen jüdischen Gemeinderat bei den Staatsbehörden anzuzeigen.
Auch gegen den Gelehrten richteten sich die Anklagen der Verleumder. Sie
reichten eine Anklageschrift gegen Heller ein, in der sie ihm Vergehungen
gegen das Steuerwesen vorwarfen und behaupteten auch, dass er in seinen
Schriften bisweilen die christliche Religion zu schmähen nicht unterließe.
Der Kaiser erfuhr dies. Er ließ ihn verhaften und 1629 zum Verhör nach
Wien bringen. Seinen Freunden gelang es, eigene Fahrt für ihn zu erwirken
und ihn von der Schmach der Fesselung zu befreien. Er blieb zunächst
weiter in Untersuchungshaft, in seiner Wohnung, im Kriminalgefängnis, im
Staatsgefängnis. Es wurde eine Untersuchungskommission eingesetzt, die
ihn verhörte. Sie richtete die Frage an ihn, wie er den Talmud, den doch
der Papst verwerfe, anpreisen könne. Er verteidigte sich mit der Angabe,
dass der Talmud eine wichtige religionsgeschichtliche Quelle des Judentums
sei und daher von allen Juden hoch geschätzt werden müsste. Der zweite
Vorwurf der Anklage könne nicht zu Recht bestehen, da kein talmudischer
Ausspruch, der den Nichtjuden gelte, sich gerade auf Christen beziehe; nur
die Heiden des talmudischen Zeitalters seien gemeint. Die anklage
entbehrte so aller rechtlichen Grundlagen. Dennoch – im Interesse der
Staatskasse – wurde Heller zu einer Geldstrafe von 12.000 Reichstalern
verurteilt. Er wollte diese hohe Summe herabgesetzt wissen und brachte
eine entsprechende Bitte vor. Dem Bemühen seiner Fürsprecher ist es zu
danken, dass die Summe auf 10.000 Reichstaler ermäßigt und ihre Zahlung
auf drei Raten verteilt wurde. Außerdem sollten seine Schriften
vernichtet und ihm das Recht, einen Rabbinatsposten zu bekleiden,
abgesprochen werden. Auch hierin wurden noch Milderungen erreicht. Seine
Schriften wurden nur der verdächtigen Stellen beraubt, nur in den
kaiserlichen Erblanden durfte er nicht als Rabbiner wirken.
Krank kehrte der Gelehrte nach Prag zurück,
beraubt seines Vermögens und so vieler Hoffnungen. Drei Monate
musste er der Erholung widmen. Danach im Sommer 1631, verließ er Prag und
begab sich nach Polen. In dem Städtchen Nemirow (Litauen) bekleidete er
zunächst das Rabbinat. Drei Jahre später wurde er nach Lodomir (in
Wolhynien) als Rabbiner berufen. Von dort ging er 1643 als Oberrabbiner
nach Krakau, als Nachfolger des R. Joel Sirkes (genannt der Bach). Hier
verbrachte er lehrend und wirkend seine letzten Lebensjahre. 1654 starb er
in Krakau. Es endete ein Leben, das durch Städte und Länder wandern
musste und nur in der Wissenschaft die ewige Ruhe fand, die das Schicksal
ihm vorenthielt.
Wir besitzen noch die Werke, die den Namen des Rabbi Heller unsterblich
gemacht haben, ja, wir lesen und benutzen sie noch eifrig. Wir lernen da
einen Gelehrten kennen, der im Meere des Talmuds sich zurechtfindet,
Sprache und Geschichte beherrscht und in wenigen Sätzen große Gedankengänge
wiederzugeben vermag. Um 1615 etwa hatte er schon sein größtes Werk
vollendet, es trägt den Titel Tossafot Jomtow-Hinzufügungen des Jomtow,
es ist ein Kommentar zu sämtlichen sechs Ordnungen der Mischna, der ganz
oder ihm Auszug allen Mischna-Ausgaben beigedruckt ist. Zehn Jahre hatte
Heller an diesem Werke gearbeitet, dafür hatte er aber auch die Freude,
dass es sofort beim Erscheinen freundliche Aufnahme fand, und dass er
selbst noch zwei Neuauflagen erlebte. Mehr als der andere übliche
Kommentator der Mischna, R. Obadja von Bertinoro, erfasst der Tossafot
Jomtow den ganzen Zusammenhang und erörtert in großzügiger Weise
Systeme und Prinzipien der talmudischen Erklärungen. Seine Kenntnisse in
der Mathematik zeigen in diesem Kommentar seine vielfachen Zeichnungen und
Berechnungen, zu denen die Mischna oft Anlass gibt. Am Ende dieses Werkes
macht der Verfasser auch einige biografische Angaben über sich selbst.
R. Heller hat außerdem 18 Werke verfasst, viele sind halachischer Natur,
auch Predigten hat er in Prag 1626 herausgegeben. Sein eigenes
unruhevolles Leben beschrieb er in der Megillat ewah. Für die
Vorschriften des Hauses verfasste er ein Büchlein in jüdischdeutscher
Sprache, damit es einem großer Leserkreis zugänglich
sei. Die miterlebte Geschichte gab ihm Veranlassung und Stoff zu mehreren
Gedichten, Selichoth genannt, von denen eines die Schlacht am weißen
Berge (am 8. November 1620) behandelte, es wurde am 14. Cheschwan des
genannten Jahres bei der Gedächtnisfeier in der Altneusynagoge in Prag
vorgetragen. In anderen schildert er die Leiden der Verfolgungen durch
Chmelnicki (1648-50). Diese Gedichte werden noch heute am 20. Siwan in den
jüdischen Gemeinden Polens rezitiert. Aus allen Liedern spricht eine
ungeheure Wärme der Empfindung und liebevolles Mitleid. So war das Leben
dieses Mannes, der auf deutscher Erde geboren, in mährischer Luft seinen
Ruhm begründete und in Polens Boden ruht." |
|
|
| |
Weitere
Berichte über Rabbi Jomtob Lippmann Heller
Links: Vortrag von Dr. Ehrentreu, gehalten im Verein für Jüdische
Geschichte und Literatur am 5. Dezember 1900, in der Zeitschrift "Der
Israelit" vom 17. Dezember 1900; rechts für Kinder
geschrieben: "Aus dem Leben eines Großen" in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 30. November 1922 und vom 7. Dezember
1922.
Bei Interesse: Zum Lesen bitte anklicken. |
 |
 |
 |
 |
 |
Über Rabbiner Ascher Löw siehe Berichte
auf der Seite zu den Rabbinern und Lehrern in Karlsruhe
Investitur des Rabbiners Wolf S. Rothenheim (1841)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. März 1841: "Aus
Bayern, 4. März (1841). Der 11. Februar war für die israelitischen
Bewohner Wallersteins ein wahrer Festtag. Dort war schon lange das Amt
eines Rabbinen verwaist und lange nicht
mehr trotz der ansehnlichen Gemeinde von einem solchen das Wort Gottes an
heiliger Stätte verkündet worden. An diesem Tage wurde der von der
Gemeinde gewählte Kandidat Herr Wolf S. Rothenheim, ein Mann, der mit gründlich
talmudischen Kenntnissen echt wissenschaftliche Bildung vereint, von der
Regierungsbehörde eingewiesen und vorgestellt. Jung und alt, Israeliten
und Nichtisraeliten strömten in die schöne Synagoge, wo der feierliche
Akt vor sich ging und sie hatte fast nicht Raum genug, die Menge der
Erfreuten, Andächtigen und Erbauten aufzunehmen; vor allem aber ward die
Feier durch die Gegenwart der hohen, dort residierenden Wallersteinschen Fürstenfamilie
und vieler Beamten erhöht. Nachdem, wie es in einem Programm festgesetzt
war, einige erhebende Lieder vom Chore abgesungen waren und der königliche
Kommissär, was seines Amtes war, beendet hatte; betrat Herr Rothenheim
die Kanzel und setzte in feurigem, begeisternden Vortrage und gediegener
Rede, als er seinen Dank für die Wahl ausgesprochen hatte, die schwierige
Stellung eines Rabbinen der Jetztzeit bei den herrschenden
Glaubensparteiungen, die Pflicht eines solchen im Allgemeinen, darauf
seine eigene, zuletzt seine Stellung zur Gemeinde und die Stellung der
Gemeinde zu ihm schön und klar auseinander. Einsender glaubt diese Rede
den gehaltreichsten unserer Zeit mit Recht an die Seite stellen zu dürfen
und kann, noch in Betracht des anerkannt biederen Charakters des Herrn
Rothenheim, der Gemeinde Wallerstein nur von allem Herzen gratulieren, ein
solches geistliches Oberhaupt nunmehr zu besitzen." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. März 1841: "Aus
Bayern, 4. März (1841). Der 11. Februar war für die israelitischen
Bewohner Wallersteins ein wahrer Festtag. Dort war schon lange das Amt
eines Rabbinen verwaist und lange nicht
mehr trotz der ansehnlichen Gemeinde von einem solchen das Wort Gottes an
heiliger Stätte verkündet worden. An diesem Tage wurde der von der
Gemeinde gewählte Kandidat Herr Wolf S. Rothenheim, ein Mann, der mit gründlich
talmudischen Kenntnissen echt wissenschaftliche Bildung vereint, von der
Regierungsbehörde eingewiesen und vorgestellt. Jung und alt, Israeliten
und Nichtisraeliten strömten in die schöne Synagoge, wo der feierliche
Akt vor sich ging und sie hatte fast nicht Raum genug, die Menge der
Erfreuten, Andächtigen und Erbauten aufzunehmen; vor allem aber ward die
Feier durch die Gegenwart der hohen, dort residierenden Wallersteinschen Fürstenfamilie
und vieler Beamten erhöht. Nachdem, wie es in einem Programm festgesetzt
war, einige erhebende Lieder vom Chore abgesungen waren und der königliche
Kommissär, was seines Amtes war, beendet hatte; betrat Herr Rothenheim
die Kanzel und setzte in feurigem, begeisternden Vortrage und gediegener
Rede, als er seinen Dank für die Wahl ausgesprochen hatte, die schwierige
Stellung eines Rabbinen der Jetztzeit bei den herrschenden
Glaubensparteiungen, die Pflicht eines solchen im Allgemeinen, darauf
seine eigene, zuletzt seine Stellung zur Gemeinde und die Stellung der
Gemeinde zu ihm schön und klar auseinander. Einsender glaubt diese Rede
den gehaltreichsten unserer Zeit mit Recht an die Seite stellen zu dürfen
und kann, noch in Betracht des anerkannt biederen Charakters des Herrn
Rothenheim, der Gemeinde Wallerstein nur von allem Herzen gratulieren, ein
solches geistliches Oberhaupt nunmehr zu besitzen." |
|
|
 Hinweis
auf die am 11. Februar 1841 von Rabbiner Wolf S. Rothenheim gehaltene
Predigt: "5. *Was ist der Hauptberuf und die Hauptbestimmungen eines
israelitischen Priesters und Geistlichen jetziger Zeit. Eine Predigt,
gehalten bei seiner Einweihung der Synagoge zu Wallerstein am 11. Februar
1841, von W. S. Rothenheim (Verweser des Rabbinats in Wallerstein).
Nördlingen, 1841. 7. C.H.
Beck." Hinweis
auf die am 11. Februar 1841 von Rabbiner Wolf S. Rothenheim gehaltene
Predigt: "5. *Was ist der Hauptberuf und die Hauptbestimmungen eines
israelitischen Priesters und Geistlichen jetziger Zeit. Eine Predigt,
gehalten bei seiner Einweihung der Synagoge zu Wallerstein am 11. Februar
1841, von W. S. Rothenheim (Verweser des Rabbinats in Wallerstein).
Nördlingen, 1841. 7. C.H.
Beck." |
| |
| Hinweis: Artikel
zum Tod von Wolf Rothenheim in der Zeitschrift "The Israelite"
vom 7. November 1862 (eingestellt als pdf-Datei). |
Über die Wahl von David Weißkopf zum Rabbiner (1847)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 16. Februar
1847: "Mittelfranken. Die jüngst stattgehabte Wahl eines
Rabbiner für den Ort und Bezirk Wallerstein im Kreise Mittelfranken
führte zu einem höchst erfreulichen Resultate. Die Majorität stimmte
für den Herrn David Weißkopf aus Gunzenhausen, der schon seit mehreren
Jahren in religiöser Wirksamkeit der Stadtgemeinde Aub, einige Meilen von
Würzburg, eifrig diente. Dessen Charakter ist aufs Ruhmvollste bekannt.
Man liebt ihn allenthalten ob der ihm eigenen Leutseligkeit und
Friedfertigkeit, man sucht seine Gesellschaft, seine Freundschaft, seinen
Rat, denn er verbindet mit herzlicher Offenheit eine tiefe Einsicht und
ein klares Urteil. Man vernimmt gern die Worte seines Mundes, denn sie
fließen ungekünstelt aus einem frommen Gemüte und gesundem Verstande.
Man vertraut ihm mit aller Zuversicht die Lösung aller religiösen Fragen
und Zweifel an, denn man kennt den Fleiß und Eifer, womit er von jeher
bis heute ausdauernd den talmudischen Wissenschaften obgelegen und man
wird von ihm in seinem neuen Wirkungskreise alle rabbinischen Funktionen
mit Liebe und Vertrauen verrichten lassen, da man weiß, wie er von dem
seligen Herrn Oberrabbiner Abraham Bing zu Würzburg, bei dem er sich
durch einen wohl 13-jährigen Unterricht (?) eine alle
rabbinisch-wissenschaftlichen Sphären umfassende Gewandtheit erwarb,
geachtet und nachdrücklich empfohlen wurde. Wir dürfen den frommen
Gemeinden, die ihn sich zum Seelenhorten gewählt, mit ganzem Herzen
gratulieren; die Zukunft wird sowohl unsere gegenwärtige
Charakterzeichnung als wahr erweisen, als auch dem seiner geistlichen
Obhut Empfohlenen die freudige Überzeugung gewähren, dass die
Amtsführung eines orthodoxen Rabbinen für den ganzen Distrikt
heilbringend sei." Artikel
in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 16. Februar
1847: "Mittelfranken. Die jüngst stattgehabte Wahl eines
Rabbiner für den Ort und Bezirk Wallerstein im Kreise Mittelfranken
führte zu einem höchst erfreulichen Resultate. Die Majorität stimmte
für den Herrn David Weißkopf aus Gunzenhausen, der schon seit mehreren
Jahren in religiöser Wirksamkeit der Stadtgemeinde Aub, einige Meilen von
Würzburg, eifrig diente. Dessen Charakter ist aufs Ruhmvollste bekannt.
Man liebt ihn allenthalten ob der ihm eigenen Leutseligkeit und
Friedfertigkeit, man sucht seine Gesellschaft, seine Freundschaft, seinen
Rat, denn er verbindet mit herzlicher Offenheit eine tiefe Einsicht und
ein klares Urteil. Man vernimmt gern die Worte seines Mundes, denn sie
fließen ungekünstelt aus einem frommen Gemüte und gesundem Verstande.
Man vertraut ihm mit aller Zuversicht die Lösung aller religiösen Fragen
und Zweifel an, denn man kennt den Fleiß und Eifer, womit er von jeher
bis heute ausdauernd den talmudischen Wissenschaften obgelegen und man
wird von ihm in seinem neuen Wirkungskreise alle rabbinischen Funktionen
mit Liebe und Vertrauen verrichten lassen, da man weiß, wie er von dem
seligen Herrn Oberrabbiner Abraham Bing zu Würzburg, bei dem er sich
durch einen wohl 13-jährigen Unterricht (?) eine alle
rabbinisch-wissenschaftlichen Sphären umfassende Gewandtheit erwarb,
geachtet und nachdrücklich empfohlen wurde. Wir dürfen den frommen
Gemeinden, die ihn sich zum Seelenhorten gewählt, mit ganzem Herzen
gratulieren; die Zukunft wird sowohl unsere gegenwärtige
Charakterzeichnung als wahr erweisen, als auch dem seiner geistlichen
Obhut Empfohlenen die freudige Überzeugung gewähren, dass die
Amtsführung eines orthodoxen Rabbinen für den ganzen Distrikt
heilbringend sei." |
| |
 Artikel in der Zeitschrift "Der Orient" vom 12.
März 1847: "In Wallerstein ... im Kreise Schwaben und Neuburg,
fiel am besagten Tage die Wahl auf den bisherigen Unterrabbiner David
Weißkopf zu Aub mit 67 Stimmen, wovon
45 auf die Gemeinden Kleinerdlingen
und Ederheim kommen. In der Gemeinde
Wallerstein selbst erhielt der bisherige Verweser H. Rottenheimer
die Mehrheit der Stimmen 27, im Ganzen jedoch nur 37. Wie gewöhnlich wird
auch gegen diese Wahl Reklamation, jedoch wahrscheinlich, erfolglos
erhoben werden." Artikel in der Zeitschrift "Der Orient" vom 12.
März 1847: "In Wallerstein ... im Kreise Schwaben und Neuburg,
fiel am besagten Tage die Wahl auf den bisherigen Unterrabbiner David
Weißkopf zu Aub mit 67 Stimmen, wovon
45 auf die Gemeinden Kleinerdlingen
und Ederheim kommen. In der Gemeinde
Wallerstein selbst erhielt der bisherige Verweser H. Rottenheimer
die Mehrheit der Stimmen 27, im Ganzen jedoch nur 37. Wie gewöhnlich wird
auch gegen diese Wahl Reklamation, jedoch wahrscheinlich, erfolglos
erhoben werden." |
| |
 Artikel in der Zeitschrift "Der Orient" vom 23.
April 1847: "Die Einsetzung des Rabbiners Dr. Weinmann in Welbhausen
ist noch nicht erfolgt und dürften also die Anstände erheblich sein.
Auch Weißkopf harret derselben in Wallerstein. Vielleicht
bringt uns schon die nächste Zeit bezeichnende Entschließungen unseres
Kultusministeriums!" Artikel in der Zeitschrift "Der Orient" vom 23.
April 1847: "Die Einsetzung des Rabbiners Dr. Weinmann in Welbhausen
ist noch nicht erfolgt und dürften also die Anstände erheblich sein.
Auch Weißkopf harret derselben in Wallerstein. Vielleicht
bringt uns schon die nächste Zeit bezeichnende Entschließungen unseres
Kultusministeriums!" |
| |
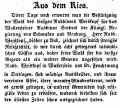 Artikel
in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 14. September
1847: "Aus dem Ries. Dieser Tage noch erwartet man die
Bestätigung der Wahl des hiesigen Rabbiners Weiskopf für das Wallersteiner
Rabbinat seitens der Königlichen Regierung von Schwaben und Neuburg. Herr
Rabbiner Weiskopf, bisher zu Aub, zeichnet sich durch strengste
Religiosität, sowie durch echt gediegenes talmudisches Wissen aus, daher
seine Wahl für die hiesige Gegend als ein wahrer Gewinn angesehen wird.
Rabbiner Weiskopf in Wallerstein und Dr. Feuchtwang in Oettingen, sind
würdige Amtsbrüder, und ihrem vereinten Eifer, ihrer warmen
Glaubenstreue, wird es gewiss gelingen, in unseren Gemeinden das
religiöse Leben zu erhalten, wodurch dieselben sich seit den ältesten
Zeiten schon ausgezeichnet
haben." Artikel
in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 14. September
1847: "Aus dem Ries. Dieser Tage noch erwartet man die
Bestätigung der Wahl des hiesigen Rabbiners Weiskopf für das Wallersteiner
Rabbinat seitens der Königlichen Regierung von Schwaben und Neuburg. Herr
Rabbiner Weiskopf, bisher zu Aub, zeichnet sich durch strengste
Religiosität, sowie durch echt gediegenes talmudisches Wissen aus, daher
seine Wahl für die hiesige Gegend als ein wahrer Gewinn angesehen wird.
Rabbiner Weiskopf in Wallerstein und Dr. Feuchtwang in Oettingen, sind
würdige Amtsbrüder, und ihrem vereinten Eifer, ihrer warmen
Glaubenstreue, wird es gewiss gelingen, in unseren Gemeinden das
religiöse Leben zu erhalten, wodurch dieselben sich seit den ältesten
Zeiten schon ausgezeichnet
haben." |
David Weißkopf wird Distriktsrabbiner in
Wallerstein (1848)
 Artikel
in "Der treue Zionswächter" vom 26. April 1848: "Aub
in Unterfranken, den 17. April (1848). Vor Kurzem ist unserem sehr
geehrten Religionslehrer, Herrn David Weißkopf die königliche
Regierungsbestätigung zum Distriktsrabbiner in Wallerstein, im
Kreise Schwaben und Neuburg mitgeteilt worden. Derselbe wird sogleich nach
dem Pessachfeste seinen neuen Wirkungskreis antreten, und wird die
Zukunft, die von uns gleich bei seiner Wahl (vgl. No. 7 vorigen Jahres)
ausgesprochene Charakterzeichnung als so wahr erwiesen, dass sie den
seiner geistlichen Obhut Empfohlenen die freudige Überzeugung gewähren
wird, wie sehr die Amtsführung dieses orthodoxen Rabbinern für den
ganzen Distrikt heilbringend sei. - Wir können diesen Bericht nicht
schließen, ohne zugleich auf die Wahrhaftigkeit des bekannten bayerischen
Korrespondenten des 'Israeliten' aufmerksam zu machen, der vor kurzer Zeit
in jenem Blatte triumphierend meldete, wie es einer der ersten Akte des
neuen Ministeriums gewesen sei, die Wahl des Rabbiners Weißkopf für
Wallerstein zu annullieren. Freilich, wenn es dem Herrn Korrespondenten
des 'Israeliten' nachginge -; doch was unser Ministerium vor allem
schützt, ist die Freiheit und Selbstständigkeit unserer
Gemeinden." Artikel
in "Der treue Zionswächter" vom 26. April 1848: "Aub
in Unterfranken, den 17. April (1848). Vor Kurzem ist unserem sehr
geehrten Religionslehrer, Herrn David Weißkopf die königliche
Regierungsbestätigung zum Distriktsrabbiner in Wallerstein, im
Kreise Schwaben und Neuburg mitgeteilt worden. Derselbe wird sogleich nach
dem Pessachfeste seinen neuen Wirkungskreis antreten, und wird die
Zukunft, die von uns gleich bei seiner Wahl (vgl. No. 7 vorigen Jahres)
ausgesprochene Charakterzeichnung als so wahr erwiesen, dass sie den
seiner geistlichen Obhut Empfohlenen die freudige Überzeugung gewähren
wird, wie sehr die Amtsführung dieses orthodoxen Rabbinern für den
ganzen Distrikt heilbringend sei. - Wir können diesen Bericht nicht
schließen, ohne zugleich auf die Wahrhaftigkeit des bekannten bayerischen
Korrespondenten des 'Israeliten' aufmerksam zu machen, der vor kurzer Zeit
in jenem Blatte triumphierend meldete, wie es einer der ersten Akte des
neuen Ministeriums gewesen sei, die Wahl des Rabbiners Weißkopf für
Wallerstein zu annullieren. Freilich, wenn es dem Herrn Korrespondenten
des 'Israeliten' nachginge -; doch was unser Ministerium vor allem
schützt, ist die Freiheit und Selbstständigkeit unserer
Gemeinden." |
Beitrag von Rabbinats-Substitut Dr. Hartwig Werner zur
anstehenden Synode (1849)
Anmerkung: Der Verfasser ist Rabbiner Dr. Hartwig Werner (geb. 1819 in Niederwerrn,
gest. 1905 in Bamberg): er studierte in München, Offenbach am Main und Gießen;
vermutlich hat er um 1848/49 die Rabbinatsvertretung übernommen; ab 1851 war er
Rabbinats-Substitut in Adelsdorf, 1859
Rabbiner in Reckendorf, ab 1861
Distriktsrabbiner in Burgebrach.
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 30. April 1849: "Wallerstein, im April
(1849)..."
Hinweis: zum Lesen des Artikels bitte Textabbildungen anklicken. |

|
 |
|
Rabbiner David Weiskopf wird von den Behörden
definitiv als Rabbiner in Wallerstein bestätigt (1849)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 29. Juni 1849: "Aus
Schwaben. Dieser Tage ist endlich nach jahrelangem Hin- und Herzerren die
Angelegenheit des Herrn Rabbiners Weiskopf, gewählt als Rabbiner für
Wallerstein, definitiv erledigt worden. Der Staatsrat als oberste,
definitiv entscheidende Behörde hat unter Aufhebung aller dagegen
sprechenden respektive Regierungs-Beschlüssen die Wahl genehmigt, und der
Gewählte in sein Amt eingesetzt. Wir freuen uns dieser Entscheidung umso
mehr, als durch dieselbe sowohl ein Gewebe von Trug und Hinterlist gänzlich
zerstört, als wir von der Persönlichkeit des Gewählten zu erwarten
volle Berechtigung haben, wie derselbe binnen Kurzem durch ein
segensreiches, gedeihliches Wirken die Herzen aller seiner
Pflegebefohlenen sich erwerben, ihre Zuneigung und Vertrauen zu gewinnen
wissen wird." Artikel
in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 29. Juni 1849: "Aus
Schwaben. Dieser Tage ist endlich nach jahrelangem Hin- und Herzerren die
Angelegenheit des Herrn Rabbiners Weiskopf, gewählt als Rabbiner für
Wallerstein, definitiv erledigt worden. Der Staatsrat als oberste,
definitiv entscheidende Behörde hat unter Aufhebung aller dagegen
sprechenden respektive Regierungs-Beschlüssen die Wahl genehmigt, und der
Gewählte in sein Amt eingesetzt. Wir freuen uns dieser Entscheidung umso
mehr, als durch dieselbe sowohl ein Gewebe von Trug und Hinterlist gänzlich
zerstört, als wir von der Persönlichkeit des Gewählten zu erwarten
volle Berechtigung haben, wie derselbe binnen Kurzem durch ein
segensreiches, gedeihliches Wirken die Herzen aller seiner
Pflegebefohlenen sich erwerben, ihre Zuneigung und Vertrauen zu gewinnen
wissen wird." |
Kritik
am Unterricht künftiger Lehrer durch die Rabbiner von Oettingen und Wallerstein
(1850)
Anmerkung: die kritische Mitteilung erschien in der liberal eingestellten
"Allgemeinen Zeitung des Judentums"
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 29. Juli 1850: "Die Herren Rabbinen zu Oettingen
und Wallerstein sammeln seit einiger Zeit Jünger um sich, die sie
im Talmud etc. unterrichten. Wir anerkennen dies. Der Unterricht an
Jünglinge, welche sich dem Lehrfache widmen wollen oder sonst Freude am
Talmudstudium finden, steht unseren Rabbinen in Anbetracht ihres Amtes und
ihrer disponibeln Zeit wohl an, zumal wenn es wie hier in uneigennütziger
Absicht geschieht. Wenn sie aber diese jungen Leute zu einem exzentrisch
asketischen Leben hintreiben, wenn sich diese unsere künftigen Jugend- und
Volkslehrer nicht einmal in ihrer äußeren Erscheinung der Zeit fügen
und in einem augenfälligen lächerlichen Gebaren eine Ehre suchen, so
kann man dies im Interesse unseres Glaubens und unserer Glaubensgenossen
nur tief beklagen. Unsere künftigen Lehrer sollen aus den Quellen selbst
zu schöpfen vermögen, sie sollen tüchtiger im Hebräischen gebildet
werden, als dies in der Neuzeit hin und wieder geschieht, und wer hierzu
beiträgt, erwirbt sich ein großes Verdienst; aber sie sollen nicht in
der Missachtung des Zeitgemäßen eine Größe suchen, sie solle nicht
einseitig, sondern vielseitig, besonders pädagogisch tüchtig
herangebildet werden!"
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 29. Juli 1850: "Die Herren Rabbinen zu Oettingen
und Wallerstein sammeln seit einiger Zeit Jünger um sich, die sie
im Talmud etc. unterrichten. Wir anerkennen dies. Der Unterricht an
Jünglinge, welche sich dem Lehrfache widmen wollen oder sonst Freude am
Talmudstudium finden, steht unseren Rabbinen in Anbetracht ihres Amtes und
ihrer disponibeln Zeit wohl an, zumal wenn es wie hier in uneigennütziger
Absicht geschieht. Wenn sie aber diese jungen Leute zu einem exzentrisch
asketischen Leben hintreiben, wenn sich diese unsere künftigen Jugend- und
Volkslehrer nicht einmal in ihrer äußeren Erscheinung der Zeit fügen
und in einem augenfälligen lächerlichen Gebaren eine Ehre suchen, so
kann man dies im Interesse unseres Glaubens und unserer Glaubensgenossen
nur tief beklagen. Unsere künftigen Lehrer sollen aus den Quellen selbst
zu schöpfen vermögen, sie sollen tüchtiger im Hebräischen gebildet
werden, als dies in der Neuzeit hin und wieder geschieht, und wer hierzu
beiträgt, erwirbt sich ein großes Verdienst; aber sie sollen nicht in
der Missachtung des Zeitgemäßen eine Größe suchen, sie solle nicht
einseitig, sondern vielseitig, besonders pädagogisch tüchtig
herangebildet werden!" |
Brief von David Weiskopf nach Fürth - ergänzendes Dokument
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries)
Brief von Rabbiner David
Weiskopf
nach Fürth (zwischen 1849 und 1861) |
 |
 |
 |
Der Brief an den
Kaufmann Joel Getz in Fürth wurde aus Wallerstein im Zeitraum
zwischen
1849 und 1861 (Verwendungszeitraum der Briefmarke) geschickt.
Er ist
unterzeichnet (siehe links) von Rabbiner David Weiskopf. |
Über Rabbiner David Weiskopf (1875)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. März 1875 (abgekürzt zitiert;
der Artikel erhält teilweise starke Kritik aus streng orthodoxer Sicht): "Aus dem
Rabbinatsbezirk Wallerstein, im März (1875). Unser ehrwürdiger
Distrikts-Rabbiner Herr David Weiskopf – sein Licht leuchte – versieht
sein Amt trotz seines Alters – Gott vermehre seine Tage und Jahre –
mit jugendlicher Geistesfrische. Die Schechitah im diesseitigen Distrikte
ist in Händen gottesfürchtiger Männer, die den Anordnungen ihres
Rabbiners gern und willig Folge leisten. Es ist nur schade, dass der Ort
Wallerstein nur noch einige jüdische Familien hat, während die Synagoge
und andere jüdische Einrichtungen an die frühere Gemeinde lebhaft
erinnern. Hingegen ist das benachbarte Nördlingen, welches in jedem ‚Memmer-Buch’
(Memorbuch u.a. zur Erinnerung an die Märtyrer von Verfolgungen) als
Gerusch-Ort verzeichnet ist, in wenigen Jahren zu einer jüdischen
Gemeinde von 70-80 Familien herangewachsen. Die junge Gemeinde hat Männer
unter sich, denen das Wort Judentum keine Phrase ist, die vielmehr ihre
ganze Kraft aufbieten, um die bewährten jüdischen Institutionen zu
erhalten. Trauriger sieht es in Oettingen
aus… Wohl gibt es noch Männer in Oettingen, die Jehudim
sein wollen; weil man sich aber fürchtet, von den ‚Tonangebern’,
‚Gebildeten’ und ‚Aufgeklärten’ in der Kaffeegesellschaft
verspottet zu werden, so lässt man es ruhig geschehen, wenn mit manchen
Gebetstücken Tabula rasa gemacht wird und lächelt dazu, wenn man die
Anordnungen eines ehrwürdigen Greises als Karikatur auf den Biertischen
herumzerrt. Besser sieht es in Hainsfahrt aus. Dort holen noch Männer
ihre Aufklärung aus der Gemara, und die Schass Chawera zählt alte und
junge ‚Bale-Batim’. Dort gibt es gebildete, junge, wohlhabende Männer,
die sich ihrer religiösen Gesinnung nicht schämen und nicht zwischen
zwei Stühlen sitzen wollen. Von den übrigen Gemeinden des diesseitigen
Bezirkes ein anderes Mal, so Gott will." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. März 1875 (abgekürzt zitiert;
der Artikel erhält teilweise starke Kritik aus streng orthodoxer Sicht): "Aus dem
Rabbinatsbezirk Wallerstein, im März (1875). Unser ehrwürdiger
Distrikts-Rabbiner Herr David Weiskopf – sein Licht leuchte – versieht
sein Amt trotz seines Alters – Gott vermehre seine Tage und Jahre –
mit jugendlicher Geistesfrische. Die Schechitah im diesseitigen Distrikte
ist in Händen gottesfürchtiger Männer, die den Anordnungen ihres
Rabbiners gern und willig Folge leisten. Es ist nur schade, dass der Ort
Wallerstein nur noch einige jüdische Familien hat, während die Synagoge
und andere jüdische Einrichtungen an die frühere Gemeinde lebhaft
erinnern. Hingegen ist das benachbarte Nördlingen, welches in jedem ‚Memmer-Buch’
(Memorbuch u.a. zur Erinnerung an die Märtyrer von Verfolgungen) als
Gerusch-Ort verzeichnet ist, in wenigen Jahren zu einer jüdischen
Gemeinde von 70-80 Familien herangewachsen. Die junge Gemeinde hat Männer
unter sich, denen das Wort Judentum keine Phrase ist, die vielmehr ihre
ganze Kraft aufbieten, um die bewährten jüdischen Institutionen zu
erhalten. Trauriger sieht es in Oettingen
aus… Wohl gibt es noch Männer in Oettingen, die Jehudim
sein wollen; weil man sich aber fürchtet, von den ‚Tonangebern’,
‚Gebildeten’ und ‚Aufgeklärten’ in der Kaffeegesellschaft
verspottet zu werden, so lässt man es ruhig geschehen, wenn mit manchen
Gebetstücken Tabula rasa gemacht wird und lächelt dazu, wenn man die
Anordnungen eines ehrwürdigen Greises als Karikatur auf den Biertischen
herumzerrt. Besser sieht es in Hainsfahrt aus. Dort holen noch Männer
ihre Aufklärung aus der Gemara, und die Schass Chawera zählt alte und
junge ‚Bale-Batim’. Dort gibt es gebildete, junge, wohlhabende Männer,
die sich ihrer religiösen Gesinnung nicht schämen und nicht zwischen
zwei Stühlen sitzen wollen. Von den übrigen Gemeinden des diesseitigen
Bezirkes ein anderes Mal, so Gott will."
|
Über das Rabbinat Wallerstein (Bericht von 1866)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1866 (aus einem
Bericht von Rabbiner Dr. Israel Hildesheimer über die Situation der
Jeschiwot (Toraschulen) in Bayern): "Im Ries sind zwei Rabbinate, Wallerstein
und Oettingen. Erster Ort hat schon
eine ziemlich alte Geschichte. Schon vor ca. 300 Jahren fungierte der
Großvater des 'tausves jontof, nämlich Rabbiner Mosche Heller
- das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - daselbst; doch ist von
einer Jeschiwa daselbst nichts bekannt. Der gegenwärtige tatkräftige Rabbiner
David Weißkopf, einer der vorzüglichsten Vorkämpfer der Orthodoxie
in Bayern, hat auch immer mit einen jungen Männern gelernt. Doch
hat dieser Ort ebenso wie Harburg und (Mönchs-)Deggingen,
wo früher auch sehr großer Toralehrer als Rabbiner fungierten, an
Einwohnerzahl sehr abgenommen; was natürlich auch auf die Ausführung der
in Rede stehenden Angelegenheit sofort einen Rückschlag übt." ' Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1866 (aus einem
Bericht von Rabbiner Dr. Israel Hildesheimer über die Situation der
Jeschiwot (Toraschulen) in Bayern): "Im Ries sind zwei Rabbinate, Wallerstein
und Oettingen. Erster Ort hat schon
eine ziemlich alte Geschichte. Schon vor ca. 300 Jahren fungierte der
Großvater des 'tausves jontof, nämlich Rabbiner Mosche Heller
- das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - daselbst; doch ist von
einer Jeschiwa daselbst nichts bekannt. Der gegenwärtige tatkräftige Rabbiner
David Weißkopf, einer der vorzüglichsten Vorkämpfer der Orthodoxie
in Bayern, hat auch immer mit einen jungen Männern gelernt. Doch
hat dieser Ort ebenso wie Harburg und (Mönchs-)Deggingen,
wo früher auch sehr großer Toralehrer als Rabbiner fungierten, an
Einwohnerzahl sehr abgenommen; was natürlich auch auf die Ausführung der
in Rede stehenden Angelegenheit sofort einen Rückschlag übt." ' |
Seligmann Weiskopf, Sohn von Rabbiner David Weiskopf
hat die Leitung einer Schule in Damaskus übernommen (1869)
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
25. August 1869: "Syrien. Wie unsern Lesern bekannt, steht
Herr Seligmann Weiskopf aus Wallerstein in Bayern, Sohn des dortigen
Distrikts-Rabbinen, einer von ihm im Auftrage der Alliance Isr.
Universelle in Damaskus gegründeten Schule vor. Wir entnehmen einem uns vorliegenden
Familienbrief desselben Folgendes: ..."
Zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken. |

|
 |
Zum Tod von Rabbi David Weißkopf (1882)
 |
 |
 |
 |
|
Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. März
1882: "Rabbi David Weißkopf - seine Ruhe sei Wonne -.
"Darum gürtet Säcke,
klaget und jammert’ (Zitat aus Jeremia 4,8). Wieder ist gefallen eine herrliche Zeder im Haine
des Herrn, eine der stärksten Stützen des Judentums, eine Koryphäe der
Orthodoxie – unser großer Lehrer, Rabbiner David Weiskopf – das
Andenken an den Gerecht ist zum Segen – der gegangen ist in die künftige
Welt, der greise, ehrwürdige Distrikts-Rabbiner David Weißkopf aus
Wallerstein segnete
das Zeitliche am 19. Adar. Der Tod dieses wahrhaft Gerechten wird weit über
Deutschlands Gauen hinaus Schmerz und Trauer erwecken, denn der Verlebte,
welcher das hohe Alter von fast 84 Jahren erreichte, hatte sich im
Verlaufe seiner tatenreichen Lebensbahn nur Freunde und Verehrer erworben
und zahlreiche Schüler ausgestellt, die in allen Weltgegenden in seinem
frommen Geiste fortwirken.
Rabbi David Weißkopf, geboren Samstag den 12. Ijar 5558 (den 28. April
1798) stammte mütterlicherseits aus einer alten Gelehrtenfamilie, von
denen einzelne Mitglieder Dajanim (Mitglieder des Rabbinatsgerichtes) zu
Metz und Fürth waren. Sein äußerst gottesfürchtiger Vater führte ihn
als einzigen Sohn schon frühe dem Studium der heiligen Tora zu. Den
ersten Grund zu der späteren Berühmtheit des Rabbi David – das
Andenken an den Gerechten ist zum Segen – legte dessen Jugendlehrer R.
Abraham Böhm aus Gunzenhausen, seinem Geburtsorte. Dort schloss er ewige
Freundschaft mit dem so frühe verstorbenen Rabbi Elieser Bergmann –
seligen Andenkens – aus Heidenheim, welcher später nach dem heiligen
Lande übersiedelte und sich um die Angelegenheiten Palästinas so große
Verdienst erworben hat. Beide verlebten eine Reihe von Jahren als wahre
Chaberim (Freunde) in brüderlicher Gemeinschaft und weder die Entfernung
noch der frühzeitige Tod hatten das Feuer der Liebe auslöschen können,
welches Rabbi David Weiskopf bis zu seiner letzten Erdenstunde dem Freunde
und dessen in Jerusalem weilenden Nachkommen bewahrt hat. Immer nur unter
Tränen erwähnte er den längst Verstorbenen, der in Berlin ruht.
Von Gunzenhausen zog R. David nach seiner Bar Mizwah zu Rabbi Moses
Hechheim – das Andenken an den Gerechten ist zum Segen – dem damaligen
Oberrabbiner zu Ansbach. Nach mehrjährigem, eifrigem Studium unter diesem
ebenso frommen, wie tief gelehrten Mann wanderte R. David nach Würzburg,
wo er fortan unter dem väterlichen Schutze des damaligen Medinerabs
(Landrabbiners) Rabbi Abraham Bing – das Andenken an den Gerechten ist
zum Segen – eine lange Reihe von Jahren nur für Tora und gute Werke
lebte. R. David im Vereine mit R. Elieser Bergmann waren die eigentlichen
Pioniere der später so berühmt gewordenen rabbinischen Hochschule,
Jeschiwa, aus welcher so viele edle Männer hervorgegangen sind.
In Würzburg entfaltete sich vollends in R. David der heilige Eifer zur
Gotteslehre, seine Tugendhaftigkeit und sein unvergleichlich frommer
Lebenswandel. Vier Jahre hindurch fungierte der jetzt Heimgegangene an der
Stelle seines durch das Alter gebeugten Lehrers, der ihn wie sein eigenes
Kind liebte. In Würzburg war es auch, wo R. David im Jahre 1826 seine
fromme bescheidene Gattin, eine Tochter des R. Sekel und Nicht des R.
Mendel Rosenbaum (siehe Zell am
Main) heimführte; mit ihr lebte er in einem niemals getrübten
Eheglücke; sie stand ihm treue und hilfreich zur Seite in der streng-jüdischen
Erziehung seiner vier Söhne und drei Töchter.
Ausgerüstet mit einem reichen Wissen auf dem Gebiete der heiligen Lehre
usw. – war er ja dem Ausspruche unserer Weisen gemäß als echter Talmid
Chacham vollkommen geübt auch in der Schechita, Beschneidung usw. –
ging R. David im Jahre 1830 nach Aub in Unterfranken, wo er 19 Jahre zum
Heile der Gemeinde und der ganzen Umgegend wirkte.
Alsdann trat er die Rabbinerstelle in Wallerstein an, welche seit dem
Abgange des R. Oscher Wallerstein – das Andenken an den Gerechten ist
zum Segen - unbesetzt geblieben war. Nachdem vor einigen Jahren die Gemeinde
Wallerstein so abgenommen hatte, dass die Werktage hindurch kein Minjan
zum Gebet mehr zusammengebracht werden konnte, wurde mit Genehmigung des
Rabbinatssprengels der Sitz nach Kleinerdlingen verlegt, wo R. David noch
im hohen Alter das Glück hatte, schöne Tage in der Gesellschaft seines
Schwiegersohnes R. Michael Kohn und seines Freundes R. Salomon
Ettenheimer, zweier ebenso hoch gelehrten wie edlen Männer, zu
verbringen.
Kurz vor Rosch Haschana stellte sich ein Schwächezustand bei R. David ein
und am 19. Adar verschied dieser gottesfürchtige Mann im glücklichen
Greisenalter und satt an Jahren, umringt von seinen Kindern, die auf das
Geheiß der schmerzerfüllten Gattin herbeigeeilt waren.
Freitagnachmittag wurde die Hülle dieses Isch Elokim (Gottesmann) zur
ewigen Ruhe getragen, seine Ruhestätte befindet sich in der nächsten Nähe
des bekannten Reb Lippmann Heller, des Großvaters vom Tosephot Jomtob und
neben dem vor 116 Jahren heimgegangenen Wallersteiner Rabbiners, Rabbi
Hirsch Kahne, Sohn des berühmten Fürther Rabbiners R. Boruch Charif aus
der Familie Rappaport. Eine lange Reihe von Leidtragenden – die sämtlichen
Mitglieder der Gemeinden von Nördlingen und
Kleinerdlingen folgten dem
Verewigten bis zu dem 1 ½ Stunden entfernten Friedhofe in
Wallerstein, so
weit vor dem Orte die wenigen noch dortselbst wohnenden Israeliten sich
dem Trauerzuge anschlossen. Wegen dem Erew Schabbat war es den übrigen
zum Rabbinatsbezirk gehörenden Ortschaften nicht vergönnt, ihrem
verewigten, vielgeliebten Lehrer und Rabbiner die letzte Ehre zu
erweisen.
Vor dem Eingang zum Beth Chajim (Friedhof) sprach Rabbinats-Substitut R.
Michael Kohn einige tief ergreifende Worte, wenige – wegen Erew Schabbat
– aber inhaltsreiche, welche das Herz aller Anwesenden zu Tränen rührten.
Das ganze Leben dieses seltenen Mannes ging in der ununterbrochenen Ausübung
von Tora und Gottesdienst und Wohltätigkeit, dieses drei Grundpfeilern
des Judentums auf.
Von seiner zartesten Jugend an dem unerschöpflichen Quell der heiligen
Lehre weilend, schöpfte er und schaffte er darin mit nimmer
erschlaffendem Fleiße: weder Kälte noch Hitze, weder Freud’ noch
Schmerz, keine irdische Macht konnte ihn stören in dem Forschen nach den
Wahrheiten von unserer heiligen Tora. Und darum wählte er auch den Beruf,
der es ihm ermöglichte, auch andere: Jung und Alt, Männer und Frauen für
die heilige Lehre zu gewinnen. Mit seiner unbegrenzten Demut unterrichtete
R. David selbst die kleinsten Kinder, um sie allmählich in Mischna und
Talmud einzuweihen. Man muss ihn gesehen haben, diesen Mann, mit dem Liebe
verkündenden Blicke der weihevollen Freude und dem heiteren Ernste, auf
dem nur Edles verheißenden Antlitze, wenn er Groß oder Klein Tora
lehrte; da fühlte man dass die Tora, die Wahrheit auf seiner Zunge war,
dass die Zunge nur den Ergüssen eines von der Gottesidee einzig und
allein beseelten Herzens Ausdruck verleihe. Ununterbrochenes Selbststudium
der Tora und Verbreitung der Kenntnis derselben, das war die Aufgabe, an
deren Vollbringung R. David seine ganze Kraft, ja sein ganzes Dasein von
dem ersten Erwachen seines Geistes bis zu seinem letzten Atemzuge setzte.
Erst jüngstens als die körperliche Schwäche den sonst so fein fühlenden
Geist zeitweise umflort hatte, nahm er Verblichene ein Buch zur Hand,
sprechend: Leider habe ich Alles vergessen, ich muss wieder zu erlernen
beginnen.
Und als die Stunde schlug, jene Stunde, die ihn in die himmlische Region führen
sollte, wohin lebenslang sein Blick gewandt, da schied er gerne von
hienieden, weil er – es sind dies eine eigenen Worte – nichts mehr für
die Heilige Tora wirken konnte. Während R. David selbst sein Wissen
unaufhörlich zu bereichern strebte und mit bewunderungswürdiger Geduld
seine Kinder und viele Zöglinge an das Torastudium gewöhnte, erfüllte
mit tiefem Schmerz sein edles Herz die betrübende Wahrnehmung, dass die
Pflege der Gotteslehre leider immer seltener in Israel werde. Unbegrenzt
war seine Liebe zur Tora, unbegrenzt seine Hochachtung für weise Schüler,
untröstlich sein Gemüt, wenn er im laufe der Zeit gar manchen Fels in
Jehuda und Israel von der Erde verschwinden sah. Ein Toragelehrter war für
den unvergesslichen Wallersteiner Rabbiner der kostbarste Diamant. Wenn
nun alle Phasen seines geistigen Seins in der Liebe zur heiligen lehre
aufgingen, so war seine ganze irdische Existenz dem Dienste des Allmächtigen,
dem Gottesdienst und dem Wohle seiner Brüder und dem Heile der
Menschheit, der Wohltätigkeit gewidmet.
Seinem Streben nach Vervollkommnung in unserer heiligen Tora
entspross sein Feuereifer in der täglichen, ja allaugenblicklichen Betätigung
von Gottesdienst. Von frühester Jugend an übte R. David Weißkopf alle
Gebote mit einer Freude, die keine Feder beschreiben kann, mit einer rein
himmlischen Wonne. Nur diejenigen, welche das Glück hatten, ihm nahe zu
stehen, sind imstande, sich einen, aber auch nur schwachen Begriff zu
machen von der Beseligung, die sich seines frommen Gemütes bei der Erfüllung
eines Gebietes bemächtigte: es war nicht mehr irdisch, es war eine höhere
Lust, welche sein ganzes Sein durchströmte, so er eine anscheinend
mindergroße Weisung ausübte. Da vibrierte vor Freude der ganze Mensch in
R. David und auf seiner edlen Stirn konnte man da deutlich die
Gottesfurcht lesen.
Seine große Opferfähigkeit im Dienste des Schöpfers betätigte er auch
durch häufiges Fasten. Abgesehen von den üblichen Hauptfasttagen pflegte
der Heimgegangene an allen Rüsttagen von Rosch Chodesch, die ganze
Selichoth- und Teschubohwoche hindurch bis vor wenigen Jahren ganze Tage
zu fasten, ohne darum in seinem Fleiße und Eifer im Blick auf Tora und
Gottesdienst nachzulassen. Wie oft stand er noch in dem letzten strengen
Winter, vor einigen Jahren, früh morgens, allein in der Synagoge, um
trotz den Unbilden der rauen Jahreszeit, wenn auch ohne Minjan doch an
diesem heiligen Ort zu beten. Und was war Rabbi David Weißkopf als
Mensch, was als Gatte, was als Vater, Sohn, was als Freund, als Gelehrter,
als Lehrer und Unterweiser? In seinem edlen Herzen war nie Raum für eine
Leidenschaft, kein Platz für eine Untugend. Seinem Vater war er ein
folgsamer Sohn, der nur den Willen seiner Eltern kannte, seiner Gattin war
er nur Liebe und Güte und Zuvorkommenheit, sodass auch sie, die ehrwürdige
Matrone kein anderes Glück je gekannt hatte, als an der Seite ihres
teuren Mannes, für ihn und durch ihn zu leben; die Erfüllung seiner Wünsche,
darin allein gipfelte sich das Prinzip, nach welchem diese jüdische
Biederfrau 56 Jahre hindurch im Bunde mit R. David gelebt hat. Wie für
seine Gattin so war der Selige auch nur Liebe und Sanftmut für seine
Kinder, die er mit der größten Selbstverleugnung und Aufopferung großzog
im Geiste des wahren Judentums. Aber nicht für seine Familie allein,
lebte und wirkte R. David Weißkopf – das Andenken an den gerechten ist
zum Segen -, seine Liebe zu der ganzen Judenheit war unbegrenzt, sie war
kosmopolitisch. Von einer Bescheidenheit, wie sie nur bei solcher feurigen
Gottesfurcht zu finden ist, von einer Selbstlosigkeit sondergleichen, war
R. David jedermann gegenüber zuvorkommen, diensteifrig in einem Grade,
der das Menschenmögliche fast überschreitet.
Das können wir von R. David Weißkopf getrost behaupten, zu keiner Zeit
und in keinerlei Verhältnissen konnte irgendein materielles Interesse in
seinem frommen Sinn auftauchen oder gar Wurzel fassen. Nur die
Gottesfurcht, sie allein und keinerlei irdischen Gedanken hat je einen
seiner Schritte bestimmt. Darum war er auch freundlich gegen jedermann,
liebevoll für Alle. Israelit und Nichtjude, Greis oder Knabe, Jung und
Alt, Reich und Arm. Jedermann musste sich im Verkehre mit dieser ehrwürdigen
Gestalt sagen, nur eine Engelseele kann so unvergleichlich gut und sanft
gegen die Menschenkinder sein. Soll ich erzählen, wie er mit
Hintenansetzung seines Vorteiles anderen zu Stellen verholfen hat, wie er
mit der größten Selbstverleugnung jungen Leuten Stipendien zum ungestörten
Torastudium verschafft hat, während seine Kinder in der Ferne darbten,
wie er von Haus zu Haus wandelte oder Nächte durch Briefe schrieb, um die
Begüterten zum Gebot der Ausstattung (armer) Bräute zu veranlassen, wie
Tag und Nacht sann, um ganz Unbekannten helfend beizustehen? Da müsste
ich eines der tatreichsten jüdischen Existenzen der neuen und der alten
Zeit erzählen.
Wer von Rabbi David Weißkopf – das Andenken an den Gerechten ist zum
Segen – gehört, der wird wissen, dass kein Armer je sein Haus
unzufriedne verlassen hat, es war das Haus Davids ein offenes, wo jeder
Trost und Hilfe suchte und fand. Nun, eines muss ich noch hinzufügen:
zahlreich und unschätzbar sind die Edelsteine der uns nun entrissenen
Krone, aber eine Perle glänzt in diesem Diadem, wie kein irdisches Juwel
zu glänzen vermag.
R. David Weißkopf, dem in seinem Leben manche Zurücksetzung nicht
erspart worden war, - wovon aber kein Menschenkind je aus seinem Mund
etwas erfahren hatte – er besaß ein Gottvertrauen, das unerschütterlich
war, eine Zuversicht auf die Hilfe Gottes, die kein Sturm wankend machen
konnte. Sein Vertrauen auf Gott war die ebenbürtige Zwillingsschwester
seiner Selbstverleugnung, seiner Uneigennützigkeit, seines anspruchslosen
Wesens und seiner eminenten Bescheidenheit. Man kann diesem Frommen nachrühmen,
er hat in seinem Leben nie eine Sorge um das Materielle empfunden. Dagegen
verursachten ihm die Reformen und die Verletzung der jüdischen Gesetze
schweren Kummer; es erfüllte seine Seele mit Gram, wenn er sah, wie die Füchse
den Garten des Ewigen zertraten und in dem Weinberg des Herrn die Reben
ausrissen. Da richtete er denn sehnsuchtsvoll seinen Blick nach Jerusalem.
Für Palästina schwärmte R. David. Jahraus, jahrein suchte er Geld für
die Armen der heiligen Städte zu sammeln und gar Vieles aus eigener
Tasche floss dahin. Nie blieb sein Auge tränenlos, wenn er am Heiligen
Schabbat an den Segensspruch gelangte, worin um die Wiederaufrichtung
Jerusalems gefleht wird.
R. David Weiskopf ist nicht mehr; er erntet jetzt den Lohn seines
tadellosen, nur dem Dienste Gottes geweihten Lebens. Möge von den Höhen
des Himmels herab das Verdienst dieses wahren Gerecht und Frommer uns führen
auf die Bahn des Lebens, damit bald nicht mehr Klage ertöne in Israel und
auch verschwinde der Tod. Und die Seele des frommen, viel geliebten Morenu
Harab R. David Weißkopf ruhe im Eden bis zum Tage des Wiedererwachens.
S.D. Weiskopf" |
Aus der
Geschichte der jüdischen Lehrer und Vorbeter
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1865 /
1901 / 1902
 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Juli 1865: "Bekanntmachung. Für den israelitischen Religionsunterricht in der
hiesigen Kultusgemeinde sucht man ein taugliches Subjekt. Ein jährlicher
Gehalt von 200 Gulden und 30 Gulden für Beheizung, denn freie Wohnung
wird zugesichert. Bewerber um diese Stellen wollen ihre Befähigungszeugnisse
an den löblichen Kultusvorstand dahier einsehen oder sich mit dem
Unterfertigten in Benehmen setzen. Wallerstein (Bayern), den 17. Tamus
5625. Der Distriktsrabbiner David S. Weiskopf". Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Juli 1865: "Bekanntmachung. Für den israelitischen Religionsunterricht in der
hiesigen Kultusgemeinde sucht man ein taugliches Subjekt. Ein jährlicher
Gehalt von 200 Gulden und 30 Gulden für Beheizung, denn freie Wohnung
wird zugesichert. Bewerber um diese Stellen wollen ihre Befähigungszeugnisse
an den löblichen Kultusvorstand dahier einsehen oder sich mit dem
Unterfertigten in Benehmen setzen. Wallerstein (Bayern), den 17. Tamus
5625. Der Distriktsrabbiner David S. Weiskopf". |
| |
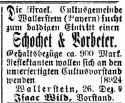 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Januar 1901: "Die
israelitische Kultusgemeinde Wallerstein (Bayern) sucht zum baldigen
Eintritt einen Schochet & Vorbeter. Gehaltsbezüge ca. 900 Mark.
Reflektanten wollen sich an den unterfertigten Kultusvorstand wenden.
Wallerstein, 26. Dezember. Isaac Wild, Vorstand."
Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Januar 1901: "Die
israelitische Kultusgemeinde Wallerstein (Bayern) sucht zum baldigen
Eintritt einen Schochet & Vorbeter. Gehaltsbezüge ca. 900 Mark.
Reflektanten wollen sich an den unterfertigten Kultusvorstand wenden.
Wallerstein, 26. Dezember. Isaac Wild, Vorstand." |
| |
 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1902: "Die
hiesige Kultusgemeinde sucht per 1. oder Mitte März einen Vorbeter und
Schochet. Gehaltsbezüge ca. 800 Mark nebst freier Wohnung. Bewerber
wollen sich gefälligst an den unterfertigten Vorstand wenden.
Wallerstein, 12. Januar. Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1902: "Die
hiesige Kultusgemeinde sucht per 1. oder Mitte März einen Vorbeter und
Schochet. Gehaltsbezüge ca. 800 Mark nebst freier Wohnung. Bewerber
wollen sich gefälligst an den unterfertigten Vorstand wenden.
Wallerstein, 12. Januar.
Der Kultusvorstand: Isaac Wild, Vorstand." |
Berichte zu einzelnen Personen aus der
Gemeinde
Zum Tod des aus Wallerstein stammenden Bamberger
Hofbankiers Angelo von Wassermann (1835 Wallerstein - 1914 Berlin)
sowie über seinen Bruder Emil Wassermann (1842 Wallerstein - 1911 Berlin)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. August 1914:
"Hofbankier Angelo von Wassermann. Geboren am 20. Mai 1835 in Wallerstein.
Gestorben am 6. Mai 1914 in Berlin. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. August 1914:
"Hofbankier Angelo von Wassermann. Geboren am 20. Mai 1835 in Wallerstein.
Gestorben am 6. Mai 1914 in Berlin.
An einem Maientage haben wir in Bamberg nach einer stillen
Trauerfeier, die an Einfachheit und Bescheidenheit nicht übertroffen
werden kann, die Staubeshülle eines Mannes der Familiengruft übergeben,
dessen Leben ein fast wolkenloser Maientag gewesen, der es schon mit
Rücksicht auf seine einflussreiche Stellung und seine Gesinnung
gegenüber dem Judentum verdient, dass ihm an dieser Stelle mit einigen
Worten ein Denkmal der Ehre aufgerichtet werde.
Von Benjamin Disraeli, dem genialen Staatsmann von Großbritannien,
wird erzählt, dass er die adelsstolzen Herren im Hause der Peers, als sie
es wagten, den auf politischer Stufenleiter durch eigene Geisteskraft zur
höchsten Sprosse des Erfolges emporgestiegenen Judenstämmling mit
ironisierender Anspielung an seine israelitische Abstammung zu erinnern,
in ihre Schranken mit den Worten zurückgewiesen habe: mein Adel ist
älter als der eure, denn mein Stammbaum reicht zurück bis auf Abraham,
den zum Segen aller Geschlechter der Erde erwählten Gottesfürsten! Nicht
alle geadelten Israeliten haben so adelig gedacht und empfunden. Auf der
Stufe, die sie erreicht, haben ihrer viele vergessen der Wurzel, der sie
entsprossen, und wir haben im allgemeinen keine Veranlassung, ihr Bild in
der Galerie berühmter Männer des Judentums aufzustellen, wie es ein
zeitgenössischer Schriftsteller getan. Aber Angelo von Wassermann, der am
6. Mai dieses Jahres fern der Heimat, an der sein Herz gehangen, in einem
Sanatorium zu Berlin nach einem an Aussaat und Ernte reich gesegneten
Leben kurz vor Vollendung seines 70. Jahres wie ein verlöschendes Licht
seinen Odem ausgehaucht, kannte keinen höheren Stolz als den der
Abstammung aus einer durch Wissen und Frömmigkeit ausgezeichneten und im
deutschen Vaterland weit verzeigten Familie (Anmerkung: Die Familie
führt ihren Stammbaum, den der als Sammler von auf die Geschichte der
bayerischen Israeliten bezüglichen Akten und Urkunden verdiente David
Wassermann in München aus archivalischen Forschungen mühsam
zusammengestellt, bis Anfang des 17. Jahrhunderts zurück. Als Stammvater
historisch nachgewiesen ist Elkan Wassermann, 1770 Salzfaktor des
Fürsten von Oettingen-Wallerstein. Mütterlicherseits stammt die
Bamberger Linie der Wassermanns angeblich von Rabbi Akiba Eger). |
 Von
diesem Mann kann aber nicht gesprochen werden, ohne zugleich das Andenken
an seinen um einige Jahre jüngeren Bruder zu wecken, der ihm in die
Ewigkeit vorangegangen. Der Name Emil Wassermann (geb. am 12. Mai
1842 in Wallerstein, gest. am 12. November 1911 in Berlin)
bedeutete in weiten Kreisen ein Programm, und dies Programm war das
altüberlieferte Judentum in modernisierter Fassung. Er schützte es, wie
man ein teures Familienerbe schätzt, und dennoch war es ihm ein
Lebendiges und Gegenwärtiges, der Inhalt seines Bewusstseins. Und er
selbst war nach seiner ganzen Erscheinung und Geistesbeschaffenheit ein
echtes Produkt des Judentums, und zwar eines von den immer seltener
werdenden, in welchem der Geist der Vergangenheit und der Geist der
Gegenwart, Thorakenntnis und neuzeitliche Bildung in harmonischem Bunde
vereinigt waren. Es war ein Vergnügen, in seinem mit allem Schönen
geschmückten Hause ein Bibliothekzimmer zu finden, in welchem die
ehrwürdigen Talmudfolianten, denen er gern eine geschäftsfreie Mußestunde
widmete, seine besten Freunde waren. Keine Erscheinung gab es im Judentum,
im Leben oder in der Literatur des Judentums, welcher er nicht sein
lebhaftestes Interesse zugewendet, kein bestreben auf geistigreligiösem
oder gemeinnützigem Gebiete, das er nicht mit Hingabe seines jederzeit
zum Dienen bereiten Wesens und der ihm zur Verfügung stehenden
materiellen Mittel unterstützte. Immer und überall stand er an der
Spitze der Wohltäter und Förderer. Die Krone der Persönlichkeit war
aber doch seine durchaus konservativ gerichtete Frömmigkeit, die ihre
tiefsten Wurzeln in seinem warmfühlenden Herzen hatte. Von solcher
Gesinnung erfüllt, hat er in seiner hinterlassenen Niederschrift seiner
Wünsche seine sieben Söhne, welche bereits geachtete Stellungen in der
Welt einnehmen, gleich den Frommen ehemaliger Zeiten mit ergreifenden
Worten zur treuen Anhänglichkeit gemahnt an das Judentum und seine
Einrichtungen. Von
diesem Mann kann aber nicht gesprochen werden, ohne zugleich das Andenken
an seinen um einige Jahre jüngeren Bruder zu wecken, der ihm in die
Ewigkeit vorangegangen. Der Name Emil Wassermann (geb. am 12. Mai
1842 in Wallerstein, gest. am 12. November 1911 in Berlin)
bedeutete in weiten Kreisen ein Programm, und dies Programm war das
altüberlieferte Judentum in modernisierter Fassung. Er schützte es, wie
man ein teures Familienerbe schätzt, und dennoch war es ihm ein
Lebendiges und Gegenwärtiges, der Inhalt seines Bewusstseins. Und er
selbst war nach seiner ganzen Erscheinung und Geistesbeschaffenheit ein
echtes Produkt des Judentums, und zwar eines von den immer seltener
werdenden, in welchem der Geist der Vergangenheit und der Geist der
Gegenwart, Thorakenntnis und neuzeitliche Bildung in harmonischem Bunde
vereinigt waren. Es war ein Vergnügen, in seinem mit allem Schönen
geschmückten Hause ein Bibliothekzimmer zu finden, in welchem die
ehrwürdigen Talmudfolianten, denen er gern eine geschäftsfreie Mußestunde
widmete, seine besten Freunde waren. Keine Erscheinung gab es im Judentum,
im Leben oder in der Literatur des Judentums, welcher er nicht sein
lebhaftestes Interesse zugewendet, kein bestreben auf geistigreligiösem
oder gemeinnützigem Gebiete, das er nicht mit Hingabe seines jederzeit
zum Dienen bereiten Wesens und der ihm zur Verfügung stehenden
materiellen Mittel unterstützte. Immer und überall stand er an der
Spitze der Wohltäter und Förderer. Die Krone der Persönlichkeit war
aber doch seine durchaus konservativ gerichtete Frömmigkeit, die ihre
tiefsten Wurzeln in seinem warmfühlenden Herzen hatte. Von solcher
Gesinnung erfüllt, hat er in seiner hinterlassenen Niederschrift seiner
Wünsche seine sieben Söhne, welche bereits geachtete Stellungen in der
Welt einnehmen, gleich den Frommen ehemaliger Zeiten mit ergreifenden
Worten zur treuen Anhänglichkeit gemahnt an das Judentum und seine
Einrichtungen.
In seiner Liebe zum Judentum stimmte auch sein älterer Bruder Angelo
von Wassermann mit ihm überein. Nach Wesen und Art war's allerdings
ein anderer. Er war das Weltkind im Goetheschen Sinne dieses Wortes. Seine
Begabung und Neigung betätigte er vor allem auf kommerziellem Gebiete. In
ihm arbeitete ein intelligenter Geist und ein zielbewusster Wille, der den
eroberten Erfolg zu verwandeln wusste in ein Mittel neuer Unternehmungen
und neuer Erfolge. Damit ist bereits gesagt, dass er zu denjenigen
Erscheinungen kaufmännischer Unternehmer gehörte, die durch
schöpferische Arbeitskraft immer neue Betriebe in Bewegung setzen und so
durch ihre anregende und befruchtende Tätigkeit werteschaffend wirken. So
wird ihm mit Recht nachgerühmt, dass das von ihm in Gemeinschaft mit
seinem Bruder geleitete Bankhaus in Bamberg, eines der größten
Privatinstitute im Reiche, das in Berlin ein eigenes Haus hat und
Schwestergeschäfte in London und Brüssel, an der Begründung und an dem
Aufschwung der oberfränkischen Textilindustrie einen hervorragenden
Anteil hatte.
Und er war unser. Die schöne Synagoge in Bamberg wird sein und seines
Bruders Andenken erhalten in der Erinnerung kommender Geschlechter. Am 27.
Mai 1910 hat der verewigte Prinzregent von Bayern ihm den erblichen Adel
verliehen. Ich darf, nachdem er für ewig die Augen geschlossen, verraten,
dass es ihm Vergnügen machte, seinen großen Einfluss bei Hochgestellten
zugunsten von Glaubengenossen, die ein Anliegen hatten, in die Wagschale
zu legen. Nichts aber kennzeichnet so sehr seine Gesinnung als sein
letzter Wille, in welchem er verfügte: 'Da ich mein ganzes Leben lang ein
echter Jehudi war, so will ich auch als solcher begraben werden. Man soll
mich durch die Bruderschaft bestatten lassen und es sollen nur die
hebräischen Gebete gesagt werden. Ich will keine Grabrede und auch kein
deutsches Gebet gehalten haben, das etwa die Stelle einer Leichenrede
ersetzen könnte. Ich will, dass der Geistliche kein deutsches Wort bei
meiner Beerdigung spricht. Das soll durchaus keine Abneigung gegen den
gegenwärtigen Rabbiner bekunden. Grund der vorstehenden Verfügung ist
vielmehr der, weil ich von jeher Feind aller öffentlichen Huldigungen und
Lobeserhebungen war.'
In genauer Befolgung dieser patriarchalischen Wünsche sind im Beisein
einer imposanten Trauerversammlung seine Staubesreste in die Familiegruft,
die er sich nach dem im März 1912 erfolgten Tode seiner Gattin (Dora
geb. Bauer aus Augsburg) errichtet, versenkt worden. Als die auf
seinen Sarg fallenden Erdschollen aus der Tiefe ein dumpfes Echo
aufsteigen ließen, musste ich an die Dichterworte denken:
'Auf einem Berge sterben, Wohl muss das köstlich sein,
Wo sich die Wolken färben Im Morgensonnenschein.
Tief unten der Welt Gewimmel, Forst, Flur und
Stromeslauf,
Und oben tut der Himmel Die goldenen Pforten auf.' Dr. A.
Eckstein." |
| |
Dazu - aus der Sammlung von
Peter Karl Müller (Kirchheim am Ries) - ein Dokument aus der
Familie Wassermann (Bamberg)
Der nachstehende Brief der Brüder Angelo und Emil Wassermann (beide aus
Wallerstein, nun in Bamberg) wurde am 26. Februar 1871 von Bamberg nach
Nördlingen geschickt. |
 |

|
 |
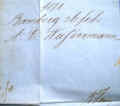 |
Adressat auf
der
Vorderseite des Briefes |
Vergrößerung
des
Firmenstempels |
Briefinhalt |
Absender auf
der
Rückseite des Briefes |
| |
Zum Tod von Isak Wild, 25 Jahre Kultusvorstand der
Gemeinde (1924)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Mai 1924: "Wallerstein, 10.
Mai (1924). Von einem herben Verlust wurde die altehrwürdige Gemeinde
Wallerstein betroffen. Isak Wild, der über 25 Jahre in selbstloser Weise
als Kultusvorstand der jüdischen Gemeinde wirkte, wurde unter Teilnahme
einer fast unübersehbaren Menge aus nah und fern zur letzten Ruhe
gebettet. Herr Lehrer Strauß aus Nördlingen widmete ihm am Hause
herzliche Abschiedsworte und ermahnte die aus allen Konfessionen
zusammengesetzte Trauerversammlung nach dem Vorbild des Verstorbenen den
Frieden und die Eintracht zu pflegen und zu wahren. Am Grabe schilderte
sein Schwiegersohn sein inniges Familienleben, seinen unermüdlichen Fleiß
und sein bescheidenes Wesen. Ein Stück der historischen Gemeinde ist mit
ihm dahingegeben. Möge Gott die wunden Herzen heilen und seinen
himmlischen Trost spenden. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Mai 1924: "Wallerstein, 10.
Mai (1924). Von einem herben Verlust wurde die altehrwürdige Gemeinde
Wallerstein betroffen. Isak Wild, der über 25 Jahre in selbstloser Weise
als Kultusvorstand der jüdischen Gemeinde wirkte, wurde unter Teilnahme
einer fast unübersehbaren Menge aus nah und fern zur letzten Ruhe
gebettet. Herr Lehrer Strauß aus Nördlingen widmete ihm am Hause
herzliche Abschiedsworte und ermahnte die aus allen Konfessionen
zusammengesetzte Trauerversammlung nach dem Vorbild des Verstorbenen den
Frieden und die Eintracht zu pflegen und zu wahren. Am Grabe schilderte
sein Schwiegersohn sein inniges Familienleben, seinen unermüdlichen Fleiß
und sein bescheidenes Wesen. Ein Stück der historischen Gemeinde ist mit
ihm dahingegeben. Möge Gott die wunden Herzen heilen und seinen
himmlischen Trost spenden. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." |
Sonstiges
Handels-Lehrinstitut in Wallerstein (1860)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Oktober 1860:
"Handels-Lehr-Institut in Wallerstein. Mit dem 15. Oktober dieses
Jahres beginn an meiner Anstalt der Unterricht für das Wintersemester und
findet gleichzeitig die Aufnahme neu eintretender Zöglinge statt. Der
Unterricht umfasst die neueren Sprachen sowie alle für das kaufmännische
Fach notwendigen Wissenschaften. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Oktober 1860:
"Handels-Lehr-Institut in Wallerstein. Mit dem 15. Oktober dieses
Jahres beginn an meiner Anstalt der Unterricht für das Wintersemester und
findet gleichzeitig die Aufnahme neu eintretender Zöglinge statt. Der
Unterricht umfasst die neueren Sprachen sowie alle für das kaufmännische
Fach notwendigen Wissenschaften.
Näheres besagt mein Prospektus, den ich auf Verlangen gerne mitteile.
Wallerstein, den 19. September 1860. S. Eldod,
Instituts-Vorstand." |
Die in Wallerstein lebenden jüdischen Personen gehören nun zur Israelitischen Kultusgemeinde
Nördlingen (1928)
 Anzeige
im 'Amtlichen Anzeiger' - Beilage der "Bayerischen Israelitischen
Gemeindezeitung" vom 15. August 1928: "Bekanntmachung des
Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden - Bekanntmachung über die
Erweiterung des Gebietes der Israelitischen Kultusgemeinde Nördlingen. Anzeige
im 'Amtlichen Anzeiger' - Beilage der "Bayerischen Israelitischen
Gemeindezeitung" vom 15. August 1928: "Bekanntmachung des
Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden - Bekanntmachung über die
Erweiterung des Gebietes der Israelitischen Kultusgemeinde Nördlingen.
Die Israelitische Kultusgemeinde Nördlingen hat beschlossen, ihr Gebiet
auf den Finanzbezirk Nördlingen mit Ausnahme der Gemeinde Wallerstein
auszudehnen. Es ergeht hiermit an alle Religionsgenossen, die in dem von
der Ausdehnung betroffenen Gebiete wohnen oder unabhängig vom Wohnsitz
steuerpflichtig sind, die Aufforderung, etwaige Einsprüche gegen die
Gebietserweiterung bis spätestens 20. September 1928 beim Vorstand der
Israelitischen Kultusgemeinde Nördlingen schriftlich oder mündlich
einzulegen.
München, den 6. August 1928. Verband Bayerischer Israelitischer
Gemeinden. Dr. Straus." |
Dokumente jüdischer Gewerbebetriebe
(wenn nicht anders angegeben: aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim am Ries; Erläuterung
gleichfalls von P.K. Müller)
Geschäftsbrief der
Gebrüder Neumark
aus Wallerstein (1840) |
 |
 |
 |
| |
Der
Brief wurde von den Gebr. Neumark am 10. Februar 1840 nach Dörflach bei
Marktredwitz geschickt (Poststempel 11. Februar 1840) |
Inhalt des Briefes |
| |
| |
|
|
Rechnung der
Rosshaar-Manufactur
P. Kirchdörfer & Sohn (1879)
(aus der Sammlung von Christian Porzelt) |

|
| |
Rechnung der
"Rosshaar-Manufactur P. Kirchdoerfer & Sohn", Wallerstein 1879.
Der aus Dennenlohe stammende Pfeifer Kirchdoerfer starb am 2.3.1881 im Alter
von 81 Jahren und liegt auf dem jüdischen
Friedhof in Wallerstein begraben. Vgl. Rolf Hofmann "Wallerstein Jewish
Cemetery - grave list" |
| |
|
|
Brief des
Amschel B. Cohen
nach Trient (1853) |
 |
 |
 |
Es handelt
sich um einen Brief der Firma A. B. Cohen von Wallerstein, der von Wallerstein nach Trient am 28. Juni 1853
verschickt wurden. Er ist unterschrieben von A. B. Cohen und Anselm Cohen.
Aron Benjamin Cohen wurde am 3. Januar 1792 als Sohn von Amschel B. Cohen und Bella Kohn, Tochter des Naphtali Hirsch ben Jehuda Ha-Cohen
geboren. Aron Benjamin Cohen erhielt 1821 die Konzession zur Ausübung eines Großhandels.
Der zweite Unterzeichner des Briefes - Anselm Cohen (geb.
30.11.1827) war einer von sieben Söhnen des Aron Benjamin Cohen (es gab noch
drei Schwestern). Zur selben Zeit, in der Aron Benjamin seines Großhandelskonzession erhielt und zumindest als Kompagnon im väterlichen Geschäft beteiligt wurde,
eröffnete sein Bruder Heinrich Cohen sein eigenes Band- und Seidenwarengeschäft in München, dessen späterer Enkel dann der Heinrich Cohen in der
Löwengrube 23 war. Das Ende des Münchner Spezialgeschäftes kam 1937,
als das Geschäft in den Besitz von Herbert Stiehler, damaliger Chefverkäufer bei
Loden-Frey, überging ("Arisierung").
Zu Heinrich Cohen in München mehr im Buch von Rolf Hofmann "Begegnung mit bemerkenswerten Menschen - Lebensbilder jüdischer Persönlichkeiten".
Im Buch "Jüdisches Leben in München - Lesebuch zur Geschichte des Münchner Alltags - Geschichtswettbewerb 1993/94"
findet sich im Kapitel "Münchner Geschäfte" ein Artikel von Robert Brunner: Sachor oder Heinrich Cohen, Löwengrube 23, in dem sehr detailliert auf die Familien- und Geschäfts-Geschichte von Aron Benjamin Cohen und seine Wurzeln in Wallerstein
eingegangen wird. |
| |
|
|
Geschäftskarte Fa. Gabriel
Süss-Schülein
(1912) |
 |
 |
| Gabriel
Süss-Schülein war verheiratet mit Lina geb. Marx (umgekommen nach der
Deportation). Der Sohn war verheiratet mit einer Frau geb. Rosenstein und bestritt
seinen Lebensunterhalt als Darmhändler. Nach der Postkarte oben war
Gabriel Süss-Schülein Inhaber einer Eisenhandlung und eines
Maschinengeschäftes. Die Karte wurde am 20. März 1912 von Wallerstein
nach Zöbingen versandt. |
Zur Geschichte der Synagoge
Bereits im früheren, am südöstlichen Ortsanfang gelegenen
"Judenhof" gab es eine "Judenschule" (Synagoge) mit Lehrer- und
Rabbinerwohnung neben dem 1804 abgebrochenen "Judentor". Für die
Erlaubnis, Gottesdienste zu feiern, hatte die jüdische Gemeinde 1761 und 1806
jährlich 7 Gulden 30 Kreuzer an "Synagogengeld" zu bezahlen.
Voraussetzung dieser Zahlung war, dass die Synagoge auf Kosten der Herrschaft
errichtet worden war. Bereits 1790 wollte man eine neue Synagoge erstellen, was
an der Finanzierungsfrage scheiterte. Die Gemeinden des Bezirksrabbinates
wollten sich damals am Wallersteiner Neubau finanziell nicht beteiligen. Eine neue Synagoge
mit Wohnung für Lehrer und Rabbiner konnte erst nach dem Abbruch der alten Synagoge
(1804) von 1806 bis 1808 am Eingang zur ehemaligen "Judengasse" an der heutigen Hauptstraße
erbaut werden. Die Baukosten betrugen insgesamt etwa 12.000 Gulden, die von der
jüdischen Gemeinde selbst aufzubringen waren. Man konnte allerdings eine Kollekte
in auswärtigen jüdischen Gemeinden durchführen und wurde von der Herrschaft
durch eine "fürstliche Baugnade" mit Baumaterial unterstützt.
Die Synagoge wurde beim Novemberpogrom 1938 am 10. November 1938 beschädigt,
die Inneneinrichtung und die Ritualien wurden zerstört (darunter ein wertvoller
Kiddusch-Becher aus dem Jahr 1750).
Nach 1945 wurde das Gebäude als Kino zweckentfremdet, 1979
abgebrochen. Das Grundstück wurde mit einem Gebäude der Sparkasse überbaut
(Hauptstraße 61), das in der Architektur an diejenige des Synagogengebäudes
angeglichen wurde.
Fotos
Historische Fotos:
(Quelle: links und Mitte der oberen Reihe aus Volker v. Volckamer s.Lit. S.
203-204; die übrigen Fotos entstammen der Fotosammlung Theodor Harburger und
wurden 1927/28 angefertigt. Die Originale der Dias sind in den Central
Archives Jerusalem; die Fotos sind veröffentlicht in: Theodor Harburger:
Die Inventarisierung s.Lit., teilweise auch in: Pinkas Hakehillot Bavaria hg.
von Yad Vashem Jerusalem)
 |
 |
 |
Johann Georg Bergtold: Plan
für den
Neubau einer Synagoge in Wallerstein
von 1790 (nicht
verwirklicht) |
Synagoge und Sechsherrenbau
auf einem Wallersteiner
Panorama von 1856 |
Pläne der Synagoge: oben
Durchschnitt, unten
Grundriss |
| |
|
|
 |
 |
 |
Außenansicht der Synagoge
von
Südosten |
Außenansicht der Synagoge
von
Südwesten |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
Blick zum Toraschrein
(Aron-ha-Kodesch) |
Hängeleuchter und Gestühl
in
der Frauenempore |
Toraschild um 1700 (heute im Jüdischen
Kulturmuseum Augsburg, Sammlung IKG) |
| |
|
|
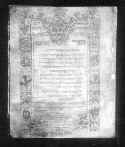 |
 |
|
Memorbuch der
Gemeinde Wallerstein, angelegt am 12. Dezember 1684 durch Vorbeter
Issachar,
Sohn des Dajan Josef. Rechts zwei Seiten mit Hanoten teschua
für Kraft Ernst,
Fürst zu Oettingen-Oettingen und -Wallerstein. Das
Original wurde im November 1938
zerstört oder entwendet. Eine Kopie ist
im Leo-Baeck-Institut New York. |
|
| |
|
| |
|
Historische Karten von Wallerstein
(Quelle: Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries) |
 |
 |
| |
Die Synagoge am rechten
Kartenrand |
Die Synagoge: Ausschnitt aus
Karte links |
| |
|
|
 |
 |
 |
Die Judengasse in Wallerstein,
heute "Felsenstraße" |
Die Synagoge in der Straße
oberhalb der Kirche |
Die Synagoge: Ausschnitt
aus
Karte links |
| |
|
|
| |
 |
 |
| |
Ansichtskarte,
verschickt am 25. Juli 1928 |
| |
|
|
| |
|
|
1950 bis 1979: die
ehemalige Synagoge als Kino
(Quelle: Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries) |
 |
 |
| |
Ende 1950 wurde in
das Synagogengebäude ein Kino eingebaut; 1979 wurde
das Gebäude
abgebrochen. |
Neuere Fotos des Synagogenplatzes
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 14.3.2004)
 |
 |
 |
Auf dem
Grundstück der ehemaligen Synagoge steht heute ein Gebäude
der Sparkasse;
das Gebäude wurde äußerlich dem früheren
Synagogengebäude angeglichen |
Die ehemalige Synagoge stand
an der
Ecke Felsenstraße (frühere "Judengasse")/ Hauptstraße |
| |
|
| |
 |
|
| |
Blick in die Felsenstraße,
frühere "Judengasse" |
|
| |
|
|
| Erinnerungen an die
jüdische Geschichte |
|
|
Brief aus dem Jahr 1853
(Quelle: Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries) |
 |
 |
| |
Brief an Elkan Wassermann
in
Mainz |
Absender: Jacob Rothenheim
in
Wallerstein |
| |
|
|
Brief des Rabbiners
David Seligmann Weiskopf an seinen Sohn Lazarus Weiskopf (vermutlich
1854)
(Quelle: Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries) |
 |
 |
| |
Brief mit Wallersteiner
Poststempel
und der Anschrift |
Lacksiegel mit den Initialen
D.S. Weiskopf |
| |
|
|
| |
|
|
| Abbruch
ehemaliger jüdischer Häuser in der Felsenstraße, ehemals
"Judengasse" |
|
 |
 |
 |
| In den
1970er-Jahren wurden mehrere der ehemaligen jüdischen Wohnhäuser in der
Felsenstraße abgebrochen. Damit wurden mit der Synagoge weitere bauliche
Erinnerungen an die jüdische Geschichte des Ortes beseitigt. In dem oben
abgebildeten Haus gab es ein im Volksmund sogenanntes
"Judenloch" (Foto rechts als Ausschnittsvergrößerung des Fotos
in der Mitte), eine gemauerte Nische, in dem religiöse Bücher und
Schriften aufbewahrt wurden (Haus-Genisa?). Die Fotos wurden von Manuela
Hofmann-Scherrers, Nördlingen, zur Verfügung gestellt. |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Germania Judaica II,2 S. 863; III,2 S. 1553. |
 | Ludwig Müller: Aus fünf Jahrhunderten. Beiträge zur Geschichte
der jüdischen Gemeinden im Riess. in: Zeitschrift des Historischen Vereins
für Schwaben und Neuburg 26 1899 S. 81-183. |
 | Ludwig Brutscher: Der Rabbi von Prag. Leben und Leiden des Jomtow
Lipmann Heller-Wallerstein, in: Nordschwaben 1979 S. 207-210. |
 | Gernot Römer: Der Leidensweg der Juden in Schwaben. Schicksale von
1933-1945 in Berichten, Dokumenten und Zahlen. Augsburg 1983. |
 | ders.: Die Austreibung der Juden aus Schwaben. Schicksale nach 1933 in
Berichten, Dokumenten, Zahlen und Bildern. Augsburg 1987. |
 | ders.: Schwäbische Juden. Leben und Leistungen aus zwei Jahrhunderten. In
Selbstzeugnissen, Berichten und Bildern. Augsburg 1990. |
 | Volker von Volckamer: Aus dem Land der Grafen und Fürsten zu
Oettingen. Kalenderbilder und Kalendergeschichten. Wallerstein 1995. Hierin
ist der Wallersteiner Kalender 1983 aufgenommen worden: "Von den Juden
im Ries. Friedhöfe und Synagogen" S. 157-208. |
 | Theodor Harburger: Die Inventarisation jüdischer Kunst und
Kulturdenkmäler in Bayern. Hg. von den Central
Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem und dem Jüdischen
Museum Franken-Fürth & Schnaittach. Fürth 1998 Bd. 3 S. 752-765
(zu Wallerstein). |
 | Michael Schneeberger: Die Geschichte der Juden in Wallerstein.
Reihe: Jüdische Landgemeinden in Bayern (10). In: Jüdisches Leben in
Bayern. Mitteilungsblatt des Landesverbandes der Israelitischen
Kultusgemeinden in Bayern. 20. Jg. Nr. 97 April 2005 S. 30-39. |
 | 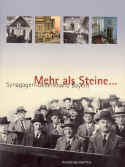 "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band I:
Oberfranken - Oberpfalz - Niederbayern - Oberbayern - Schwaben.
Erarbeitet von Barbara Eberhardt und Angela Hager. Hg.
von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.
Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und
herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im
Allgäu. (mit umfassenden Quellen- und
Literaturangaben) "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band I:
Oberfranken - Oberpfalz - Niederbayern - Oberbayern - Schwaben.
Erarbeitet von Barbara Eberhardt und Angela Hager. Hg.
von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.
Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und
herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im
Allgäu. (mit umfassenden Quellen- und
Literaturangaben)
ISBN 978-3-98870-411-3.
Abschnitt zu Wallerstein S. 530-539. |
 | 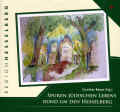 Spuren jüdischen Lebens rund um den Hesselberg. Kleine Schriftenreihe Region Hesselberg Band
6. Spuren jüdischen Lebens rund um den Hesselberg. Kleine Schriftenreihe Region Hesselberg Band
6.
Hrsg. von Gunther Reese, Unterschwaningen 2011. ISBN
978-3-9808482-2-0
Zur Spurensuche nach dem ehemaligen jüdischen Leben in der Region Hesselberg lädt der neue Band 6 der
'Kleinen Schriftenreihe Region Hesselberg' ein. In einer Gemeinschaftsarbeit von 14 Autoren aus der Region, die sich seit 4 Jahren zum
'Arbeitskreis Jüdisches Leben in der Region Hesselberg' zusammengefunden haben, informieren Ortsartikel über Bechhofen, Colmberg,
Dennenlohe, Dinkelsbühl, Dürrwangen, Feuchtwangen, Hainsfarth, Heidenheim am Hahnenkamm, Jochsberg, Leutershausen, Mönchsroth, Muhr
am See (Ortsteil Altenmuhr), Oettingen, Schopfloch, Steinhart, Wallerstein, Wassertrüdingen und Wittelshofen über die Geschichte der ehemaligen jüdischen Gemeinden. Am Ende der Beiträge finden sich Hinweise auf sichtbare Spuren in Form von Friedhöfen, Gebäuden und religiösen Gebrauchsgegenständen mit Adressangaben und Ansprechpartnern vor Ort. Ein einleitender Beitrag von Barbara Eberhardt bietet eine Einführung in die Grundlagen des jüdischen Glaubens. Eine Erklärung von Fachbegriffen, ein Literaturverzeichnis und Hinweise auf Museen in der Region runden den Band mit seinen zahlreichen Bildern ab. Das Buch ist zweisprachig erschienen, sodass damit auch das zunehmende Interesse an dem Thema aus dem englischsprachigen Bereich
abgedeckt werden kann, wie Gunther Reese als Herausgeber und Sprecher des Arbeitskreises betont. Der Band mit einem Umfang von 120 Seiten ist zum Preis von
12,80 €- im Buchhandel oder im Evangelisch-Lutherischen Pfarramt Mönchsroth, Limesstraße 4, 91614 Mönchsroth, Tel.: 09853/1688 erhältlich
E-Mail: pfarramt.moenchsroth[et]elkb.de. |
 |  "Ma
Tovu...". "Wie schön sind deine Zelte, Jakob..." Synagogen
in Schwaben. Mit Beiträgen von Henry G. Brandt, Rolf Kießling,
Ulrich Knufinke und Otto Lohr. Hrsg. von Benigna Schönhagen.
JKM Jüdisches Kulturmuseum Augsburg-Schwaben. 2014. "Ma
Tovu...". "Wie schön sind deine Zelte, Jakob..." Synagogen
in Schwaben. Mit Beiträgen von Henry G. Brandt, Rolf Kießling,
Ulrich Knufinke und Otto Lohr. Hrsg. von Benigna Schönhagen.
JKM Jüdisches Kulturmuseum Augsburg-Schwaben. 2014.
Der Katalog erschien zur Wanderausstellung "Ma Tovu...".
"Wie schön sind deine Zelte, Jakob..." Synagogen in Schwaben des
Jüdischen Kultusmuseums Augsburg-Schwaben und des Netzwerks Historische
Synagogenorte in Bayerisch-Schwaben.
|


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Wallerstein
Swabia. A community was formed around the end of the 13th century, suffering
from persecution in 1358. A new community existed in the first half of the 15th
century. R. Yom Tov Lippmann Heller (1579-1654), the famous Mishna commentator,
was born and educated there. The Jews of Wallerstein found temporary refuge in
Noerdlingen during the Thirty Years War (1618-1648) and again in 1672. They fled
there during the fighting in 1701-04 as well. The Jews maintained a stable
population of around 40 families from the late 17th century to the mid-18th
century, with Wallerstein the seat of the state rabbinate for nearly 200 years
until 1809. Jews engaged in moneylending and the horse and cattle trade as well
as real estate brokerage. A new synagogue was built in 1807. By 1867 the
community numbered 78 (total 1.372); in 1933, 16. Six Jews left in 1936-39 and
the last five were deported to Piaski (Poland) and the Theresienstadt ghetto in
1942.


vorherige Synagoge zur ersten Synagoge
|