|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"
zur
Übersicht "Synagogen im Landkreis Alzey-Worms
Alzey (Landkreis Alzey-Worms)
Jüdische Geschichte / Synagoge
vgl. Seite mit Texten zur
Geschichte der jüdischen Gemeinde in Alzey (interner
Link; Texte zur Synagogengeschichte siehe unten)
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In mittelalterlichen, zur Kurpfalz gehörenden Alzey werden Juden erstmals 1305
genannt. Die Judenverfolgung in der Pestzeit 1348/49 zerstörte zunächst
das jüdische Leben in dieser Stadt. Danach hört man erst 1377 wieder von Juden
in Alzey. In dieser Zeit werden auch in Frankfurt am Main und in Mainz
"Juden aus Alzey" genannt. Bis 1391 lebten höchstens vier jüdische
Familien in der Stadt. In diesem Jahr wurden sie wie die gesamte Judenschaft der
Kurpfalz vertrieben. An die mittelalterliche Ansiedlung erinnert die bis heute
bestehende "Judengasse" (1389 erstmals genannt).
Erst nach 1650 waren wieder Juden in der Stadt; zur Bildung einer
Gemeinde kam es nicht vor 1700. 1743 waren elf, 1789 21 jüdische Familien in
der Stadt. Um 1804 wurden 137 jüdische Einwohner gezählt. Im Laufe des 19.
Jahrhunderts nahm ihre Zahl bis zu einer Höchstzahl von 364 im Jahr 1855
zu.
Die jüdischen Familien spielten im wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Leben der Stadt eine große Rolle. Es gab jüdische Vieh- und
Pferdehandlungen, Metzgereien, Manufakturwarenhandlungen, Wein- und
Landesproduktenhandlungen, Kleinkaufleute, eine Gerberei, eine Eisenhandlung,
einen Arzt, drei Rechtsanwälte.
Alzey war von 1842 bis 1933 Rabbinatssitz (unter den Rabbinern: bis 1857
Dr. Samuel Adler aus Worms, danach vierjährige Vakatur, 1861/62-1891 Dr. David
Rothschild aus Aachen, 1891-1904 Dr. Joseph Levi aus Freudental,
1905-1933 Dr. Julius Lewit). Am Volksschullehrerseminar der Stadt gab es
eine jüdische Abteilung, in der alle jüdischen Lehrer Hessens ausgebildet
wurden. Eine jüdische Volksschule bestand bis um 1920. Mehrere Jahrzehnte prägten
das jüdische Gemeindeleben neben dem Rabbiner: in der Mitte des 19.
Jahrhunderts Lehrer und Kantor Ferdinand Heinbach (1864 nach 20-jährigem
Wirken in Alzey nach Amerika ausgewandert), später der Lehrer und Kantor Abraham
Stern. Er war seit 1889 in Alzey, feierte hier 1914 sein 25jähriges
Ortsjubiläum und war noch 1932 im Amt.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Offz.St. Alfred
Friedrich Koch (geb. 18.10.1888 in Alzey, vor 1914 in Mainz wohnhaft, gef.
12.9.1914), Erwin Strauß (geb. 20.2.1893 in Alzey, vor 1914 in Kreuznach
wohnhaft, gef. 30.4.1915; Bericht),
Paul Friedrich Küchler (geb. 9.7.1890 in Alzey, gef. 23.9.1915), die Brüder Max
Schwarz und Ludwig
Schwarz (geb. 5.5.1886 in Gauersheim, gef. 7.5.1916), Jakob J. Schaffner (geb.
12.9.1895 in Alzey, gef. 1.11.1916), Paul Weinmann (geb. 3.3.1898 in Alzey, gef.
18.10.1917) und Unteroffizier Hugo Weinmann (geb. 27.1.1887 in Alzey, gef.
26.9.1918). Zum ehrenden Gedenken an sie wurden 1921 zwei Tafeln mit den Namen
in der Synagoge angebracht.
Um 1924, als zur jüdischen Gemeinde etwa 240 Personen gehörten (2,9 %
von insgesamt etwa 8500 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde
Jakob Küchler, Sanitäts-Rat Dr. Mainzer, Manfred Weinmann, Moses Kahn, Josef Bär,
Karl Kahn und Dr. Ludwig Baum. Damals unterrichtete Lehrer Abraham Stern 16
Kinder in Religion, teilweise an den höheren Schulen (1932: 25 Kinder). An jüdischen
Vereinen gab es einen Israelitischen Wohltätigkeitsverein (gegründet
1820, 1924 unter Leitung von Ludwig Koch II mit 50 Mitgliedern, 1932 unter
Leitung von Josef Baer mit 65 Mitgliedern; Ziele: Unterstützung ortsansässiger
Hilfsbedürftiger und Kranker), den Israelitischen Armenverein (gegründet
1820, 1924 unter Leitung von Rabbiner Dr. Lewit mit 70 Mitgliedern, 1932 unter
Leitung von Moses Bronne mit 69 Mitgliedern; Ziel: Wanderfürsorge), den Israelitischen
Frauenverein (gegründet 1823, 1924 unter Leitung von Alma Koch mit 70
Mitgliedern, 1932 unter Leitung der Frau von Ferdinand Schaffner mit 50
Mitgliedern; Ziel: Unterstützung Hilfsbedürftiger und Kranker), einen Jüdischen
Jugendverein (1924 unter Leitung von Dr. Baum mit 70 Mitgliedern), eine Ortsgruppe
des Central-Vereins (1924 unter Leitung von Karl Kahn mit 60 Mitgliedern,
1932 unter Leitung von Moses Bronne) sowie eine Ortsgruppe des Reichsbundes jüdischer
Frontsoldaten (1932 Leitung: Moses Bronne). Es gab mehrere Stiftungen:
Alfred Koch-Stiftung (Zweck: Unterstützung junger Kaufleute), Abraham
Koch-Stiftung (Zweck Unterstützung von Armen), Lina Koch-Stiftung (Zweck:
Unterstützung von Armen). 1932 gehörten dem Vorstand sechs Mitglieder
an, darunter weiterhin Jakob Küchler (1. Vorsitzender), Josef Baer (2.
Vorsitzender) und Sally Neu (3. Vorsitzender).
1933 wurden noch 197 jüdische Einwohner gezählt. In
den folgenden Jahren ist ein Teil der jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der
zunehmenden Entrechtung und der Repressalien weggezogen beziehungsweise
ausgewandert.
Über die Ereignisse in der NS-Zeit informiert nach gründlichsten Recherchen
ausführlich das Buch von Dieter Hoffmann: '...wir sind doch Deutsche.' - Zu Geschichte
und Schicksal der Landjuden in Rheinhessen."
1942 und 1943 wurden die bis dahin in Alzey noch verbliebenen jüdischen
Einwohner deportiert und ermordet. Andere sind aus den Städten, wohin sie
verzogen sind, deportiert worden.
Von den in Alzey geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem; ergänzt durch Namen aus der Liste von D. Hoffmann
s.Lit. S. 365-369): Margot Althof (1929), Clementine Badt (geb. 1879), Emil
Badt (1899), Albert Baum (1880), Antonia Baum geb. Haas (1873), Clara Baum geb. Fink
(1878), Elise Baum (1873), Emilie Baum (1879), Frieda Baum (1882), Günter Baum
(1882), Günter Baum (1923), Hannelore Baum (1922), Johanna Baum geb.
Strauss (1891), Karl Baum (1882), Louis Baum (1869),
Ludwig Baum (1860), Ludwig Baum (1886), Max Baum (1857), Melanie
Baum (1893), Rosa Baum geb. Oppenheimer (1884), Arthur Decker (1881), Emmy Fränkel geb.
Neuberger (1861), Bertha Franken geb. Koch (1881), Selma Goldstein
geb. Hirsch (1894), Karl Gutmann (geb. 1892), Jakob Heumann (1872),
Alice Hirsch geb. Wachenheimer (geb. 1893), Berta Hirsch (1874), Elisabeth
Hirsch (1889), Emma
Hirsch geb. Levy (1899), Gerhard Hirsch (1921), Hermann Hirsch (1888), Karoline Hirsch geb. Blum
(1866), Louise Hirsch (1922), Salomon
Hirsch (1884), Rudolphine Honig (1889), Bertha Kahn (1882), Ida
Kahn (1885), Karoline Kahn (1873), Erich Keller (1925), Flora
Keller geb. Strauss (1888), Johanna Keller geb. Baum (1864), Helene
Koch geb. Wolf (1866), Ludwig Koch (1864), Ludwig Koch (1890),
Martha Koch geb. Beckhardt (1892), Otto Koch (1897), August Küchler (1883), Ella Laemle geb. Koch
(1889), Klara Lessing (1876), Johanna Levi (1881), Martin
Levi (1857), Gustav Levy (1878), Hedwig Lewit geb. Neuberger (1878), Jakob Löser
(1874), Johannette Löser geb. Goldmann (1875),
Bertel Mainzer (1902), Eugenie Mainzer geb. Kahn (1876), Wilhelmine (Minnie)
Maertesheimer
geb. Baum (1889), Helene Marx geb. Liebmann (1869), Ida Mayer geb.
Weiner (1887), Malchen Mayer geb. Wertheimer (1880), Mathilde (Meta)
Mayer (1912), Marianne Mayer (1933), Max Mayer (1912), Mina Mayer (1885),
Minna Mayer geb. Wertheimer (1880), Erna Mendel
geb. Schauzer (1888), Heinrich Mendel (1882 oder 1883), Leo Mendel (1884), Paula Mendel
(1886), Settchen Mendel geb. Rosenthal (1886), Bina Nathan geb. Grünenbaum (1869), Mathilde Neuhof geb. Küchler
(1880),
Henriette Oppenheimer geb. Schwarz (1880), Simon Oppenheimer (1880), Helene Rosenthal geb.
Schaffner (1896), Max Rosenthal (1893), Cäcilie Rothschild geb. Wolf (1863), Amalie Sanders
(1869), Heinrich Schwarz (1883), Johanna
Schwarz (1891), Berta Siegel geb. Bernheim (1879), Jakob Siegel (1869), Marcus Siegel
(1861), Emma
Sonnenberger geb. Koch (1861), Hedwig Stern
geb. Koch (1898), Isaak Stern (1896), Jette Stern geb. Würzburger (1869), Albert Strass
(1911), Anna Strass (1910), Ida
Strauss geb. Rosenthal (1892), Jakob Strauss (1878) Johanna Strauss (1883), Kurt Moses Strauß
(1905), Marianne Strauss (1927), Max Moses Strauss (1869),
Pauline Strauss (1890), Richard Strauss (1872), Helene (Ella) Vogel
geb. Strauss (1881), Ilse Weiner (1925), Sofie Weiner (geb. 1889), Elisabeth
Weinmann (1922), Hedwig Weiner geb. Stein (1894).
Zur Erinnerung an die aus
Alzey umgekommen jüdischen Personen wurden
inzwischen zahlreiche
"Stolpersteine" in der Stadt verlegt
(Stand Anfang 2015: es gibt 68 "Stolpersteine" in Alzey;
vgl. Presseberichte unten)
(rechts Fotos von Michael Ohmsen: Stolpersteine in der Schlossgasse 21 für
Karl Baum, Günter Baum und Johanna Baum geb. Strauss,
alle drei ermordet 1943 in Minsk) |
 |
 |
Fotos - Erinnerungen an die jüdische Geschichte in der Stadt
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 3.8.2005)
Erinnerung an die
mittelalterliche
Geschichte |
 |
 |
| |
Die Alzeyer
"Judengasse" |
| |
|
| Erinnerungen an jüdisches Leben im
18./20.Jahrhundert |
|
 |
 |
 |
| Die jüdische
Abteilung im Museum der Stadt Alzey birgt zahlreiche Erinnerungen (Foto
Michael Ohmsen bzw. unten Hahn) |
| |
|
 |
 |
 |
| |
|
|
Zur Geschichte der Synagogen
Im Mittelalter wird eine "Juden Schul" erstmals 1427
genannt. Über sie weiß man nichts Näheres. Vermutlich wurde sie seit der
Vertreibung der Juden 1391 als Wohnhaus genutzt.
Im 18. Jahrhundert ist von einer Betstube in einem Privathaus am
Eingang der Judengasse die Rede (im Haus der heutigen Löwenapotheke). 1791 konnte eine von Elias Simon (Elias
Belmont) gestiftete Synagoge in der "Zwerchspießgaß" gegenüber dem
ehemaligen "Lewenbrunnen" als Synagoge eingeweiht werden. Diese
Synagoge war ein längsrechteckiger Bau, der bis 1854 als jüdisches Gotteshaus
diente und danach als Lagerraum verwendet wurde. 1976 sind die Reste dieses Baus
abgebrochen worden.
Da die alte Synagoge angesichts der stark gewachsenen Gemeinde um 1850 nicht
mehr ausreichte und überdies sehr schlecht gebaut war, baute die jüdische Gemeinde
auf dem Grundstück Augustinerstraße 9 1853/54
eine neue Synagoge. Die neue Synagoge verfügte über 220 Sitzplätze, hatte eine über drei Seiten
verlaufende Frauenempore und eine Orgel. Die Einrichtung stammte teilweise aus
der alten Synagoge. Geprägt war der neue Synagogenbau überwiegend von einer
maurischen Formensprache. Die Fassade war geprägt von einer dreiteiligen
Fensterreihe, die wie das Eingangsportal und dessen Seitenfenster von
orientalisierenden Kielbögen abgeschlossen wurden. Den Giebel der Fassade
prägte ein abgetreppter Bogenfries und zwei polygonale Ecktürmchen auf
Konsolen.
Am 20./21. Oktober 1854 war die feierliche Einweihung der Synagoge.
Zahlreiche weitere Informationen können den nachfolgenden zeitgenössischen
Berichten entnommen werden.
Texte zur Geschichte der Synagogen
Finanzierungsschwierigkeiten um den Synagogen-Neubau
(1852)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelitische Volksschullehrer" vom Februar 1852:
"Aus
Alzey, in Rheinhessen, wird uns die erfreuliche Anzeige, dass daselbst im
verwichenen Herbst eine Anzahl gesinnungstüchtiger israelitischer Männer
sich vereinigt, um den ins Stocken geratenen Synagogen-Neubau durch
bedeutende Opfer aus eigenen Mitteln zu ermöglichen und damit die
Beschaffung und Einrichtung einer Wohnung für den dortigen Rabbiner zu
verbinden. Diese schöne Handlung ist besonders als Akte der Pietät und
Anhänglichkeit für den jetzigen Rabbiner daselbst, Herrn Dr. S. Adler zu
würdigen, welcher auf diese Weise durch sein echt priesterliches Wirken
und Lehren seiner Gemeinde diese Wohltat verursacht hat." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelitische Volksschullehrer" vom Februar 1852:
"Aus
Alzey, in Rheinhessen, wird uns die erfreuliche Anzeige, dass daselbst im
verwichenen Herbst eine Anzahl gesinnungstüchtiger israelitischer Männer
sich vereinigt, um den ins Stocken geratenen Synagogen-Neubau durch
bedeutende Opfer aus eigenen Mitteln zu ermöglichen und damit die
Beschaffung und Einrichtung einer Wohnung für den dortigen Rabbiner zu
verbinden. Diese schöne Handlung ist besonders als Akte der Pietät und
Anhänglichkeit für den jetzigen Rabbiner daselbst, Herrn Dr. S. Adler zu
würdigen, welcher auf diese Weise durch sein echt priesterliches Wirken
und Lehren seiner Gemeinde diese Wohltat verursacht hat." |
Zur Einweihung der Synagoge (1854)
 Zunächst
kurzer Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Oktober 1854:
"In Alzey ist am Samstag, den 21. Oktober 1854 die neu erbaute
Synagoge eingeweiht worden." Zunächst
kurzer Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Oktober 1854:
"In Alzey ist am Samstag, den 21. Oktober 1854 die neu erbaute
Synagoge eingeweiht worden."
|
| |
 Ausführlicher
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1855:
"Alzey,
den 10. November 1854. Wenn Referent sich gedrungen fühlt, in folgenden
schwachen Zügen die jüngsten religiösen Vorgänge seiner Gemeinde zur
öffentlichen Kenntnis zu bringen, so bestimmt ihn dazu das ihm hierdurch
werdende Gefühl der eigenen Befriedigung – erzeugt durch die öffentliche
Aussprache dessen, was das Herz trägt und bewegt – wie nicht minder die
zur Pflicht werdende offene Anerkennung, auf die eine für religiöse
Interessen opferbereite Gemeinde zu machen berechtigt ist, und der Danke
gegen die Öffentlichkeit, die ja auch ihrerseits anregend und belebend
auf uns gewirkt hat. - Ausführlicher
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1855:
"Alzey,
den 10. November 1854. Wenn Referent sich gedrungen fühlt, in folgenden
schwachen Zügen die jüngsten religiösen Vorgänge seiner Gemeinde zur
öffentlichen Kenntnis zu bringen, so bestimmt ihn dazu das ihm hierdurch
werdende Gefühl der eigenen Befriedigung – erzeugt durch die öffentliche
Aussprache dessen, was das Herz trägt und bewegt – wie nicht minder die
zur Pflicht werdende offene Anerkennung, auf die eine für religiöse
Interessen opferbereite Gemeinde zu machen berechtigt ist, und der Danke
gegen die Öffentlichkeit, die ja auch ihrerseits anregend und belebend
auf uns gewirkt hat. -
Unsere 50-60 Glieder zählende Gemeinde feierte nämlich am 20. Oktober
auf eine wahrhaft erhebende Weise die Einweihung einer neuen Synagoge und
Tora, ein Fest, welches eine beträchtliche Anzahl Fremder aus der Nähe
und Ferne als Zeugen der frommen Feier herbeiführte, deren Eindruck auf
die Genossen unserer Gemeinde wie auf alle Teilnehmer auf lange Zeit in
erhebendem Andenken bleiben wird. Die Israeliten hiesiger Gemeinde hatten
bislang ein schlechtes, in einem Stadtwinkel gelegenes Gotteshaus, der
Gottesdienst selbst lag bis zur Ankunft unseres Rabbinen, des Dr. Adler
aus Worms, noch ziemlich im Argen; die halb Verwahrlosung blieb nicht ohne
Folge fürs Leben. Der religiöse Indifferentismus fand an Wurzel zu
schlagen, selbst die Heiligkeit der Sabbate und der Festtage hatte
teilweise bereits zu weichen begonnen. Von einem gedeihliche,
fruchtbringenden Religionsunterrichte kein Gedanke. So fand unser Rabbiner
das Feld seiner Wirksamkeit. Die Verwirklichung der von diesem gleich
anfangs intendierten Bessergestaltung des Kultus hatte indessen an dem
Mangel einer geeigneten Synagoge bedeutenden Widerstand. Zwar
verwirklichte die Gemeinde, soweit tunlich, die Resultate der
Rabbinerversammlung innerhalb ihrer Mitte ohne weiteren Kampf; sie hatte
Herrn Dr. Adler mit dem Religionsunterrichte in der Volks- und Realschule
sowie in dem Privatinstitute betraut, in der Person des Herrn Heinbach
einen tüchtigen Kantor erworben, der zugleich die Kinder hebräisch
lehrt, nebst dem freiwilligen, unentgeltlichen Privatunterricht des
Rabbiners im Urtexte der Bibelabschnitte der Väter und dergleichen; sie
hatte noch außerdem getan, was in ihren Kräften stand, z.B. zwei Vereine
errichtet, deren jeder bereits einen Kapitalstock von 1.000 Gulden besitzt
und für alle wohltätige Zwecke wirksam ist, immer aber fehlte das
Wichtigste, eine würdige Synagoge. Da traten denn einzelne für die Sache
begeisterte Männer unserer Gemeinde auf, kauften auf eigene Kosten den
Bauplatz, zugleich ein anstoßendes Gebäude mit Hof und Garten für den
geliebten Rabbinen, Anfangs nur auf die Dauer seiner hiesigen Wirksamkeit,
auf Anstehen desselben aber für jeden Nachfolger und das Ganze der
Gemeinde zum Geschenk machten. Am Erew
Pessach hatte der Bau seinen Anfang genommen.
Grundsteinlegungsfestlichkeiten fanden nicht statt, die Gemeinde
beschloss, die bei derlei Veranlassungen gebräuchlichen Feierlichkeiten gänzlich
zu unterlassen. Obige Schenkgeber vereinigten sich, aus ihren Mitteln die
etwa auf 80 Gulden belaufenden Unkosten zur Anfertigung einer Sefer Tora (Torarolle) zu bestimmen, die jetzt gleichfalls unsere
Synagoge ziert; die Restsumme für die Anschaffung dieser Gesetzrolle
wurde durch einen Verein von Frauen mit ungefähr 50 Gulden gedeckt.
Schon nach anderthalb Jahren stand das Prachtgebäude, etwa 10.000 Gulden
kostend – eine für die in ihrer Mehrzahl wenig bemittelte Gemeinde
nicht unbeträchtliche Summe, auf dem Platze, den früher ein
Augustinerkloster deckte, fertig da. |
 Selten
mag wohl ein Gegenstand die Gemüter unserer Gemeinde mehr im Voraus beschäftigt
haben, als jene Feier, die den Freunden unseres gottentstammten Glaubens
ein lohnender Kranz ward und ihren Herzerhebenden Eindruck auch auf
Schreiber dieses noch fortdauern lässt. Schon am Freitag Nachmittag beim
Abschiedsgottesdienste im alten Gebäude betätigte die große Zuhörerschar,
zu der auch die Beamten der Verwaltung und der Justiz, sowie die
protestantische Geistlichkeit gehörte, den innigsten Anteil, welchen sie
dem neuen Gotteshause widmete, schon da war es die freudigste Rührung,
die sich der Herzen Aller bemeisterte, als unser Rabbiner, dem zuvor von
mehreren Frauen ein kostbarer Ornat zum Geschenk war gemacht worden,
begeistert und begeisternd, gerührt und rührend das alten Gotteshaus mit
der alten, das neue mit der neuen zeit verglich und die der Lade
entnommene Tora als das köstlichste und alleinige Kleinod pries und
schilderte, das uns auf allen Zügen durchs Leben begleiten müsse. Nach
vorausgegangenen, abwechselnd von Vorbeter und Gemeinde vorgetragenen
Psalmgebeten setzte sich der Festzug unter Anleitung der hierzu Beorderten
und dem Voranschreiten der Ältesten mit den Gesetzrollen, still und
feierlich, die zahlreichen Beamten in ihrer Staatsuniform an der Spitze,
nach der neuen Synagoge in Bewegung. Die ganze Stadt war auf den Beinen,
die Straßen gedrängt voll Menschen, die Fenster der Häuser, vor denen
der Zug vorbeiging, mit Neugierigen besetzt und Alles verriet durch Miene
und Haltung die höchste Ehrerbietung. An der neuen Synagoge angekommen,
empfing der Gr. Kreisrat vom Gr. Baumeister unter Ansprache des Letztern
den auf einem Kissen im Zuge Vorangetragenen Schlüssel, überreichte ihn
mit feierlicher Anrede dem ersten Vorsteher, das Hauptportal wurde
erschlossen und die Teilnehmer traten in das Gebäude, das einen
herzerquickenden Anblick bot. Selten
mag wohl ein Gegenstand die Gemüter unserer Gemeinde mehr im Voraus beschäftigt
haben, als jene Feier, die den Freunden unseres gottentstammten Glaubens
ein lohnender Kranz ward und ihren Herzerhebenden Eindruck auch auf
Schreiber dieses noch fortdauern lässt. Schon am Freitag Nachmittag beim
Abschiedsgottesdienste im alten Gebäude betätigte die große Zuhörerschar,
zu der auch die Beamten der Verwaltung und der Justiz, sowie die
protestantische Geistlichkeit gehörte, den innigsten Anteil, welchen sie
dem neuen Gotteshause widmete, schon da war es die freudigste Rührung,
die sich der Herzen Aller bemeisterte, als unser Rabbiner, dem zuvor von
mehreren Frauen ein kostbarer Ornat zum Geschenk war gemacht worden,
begeistert und begeisternd, gerührt und rührend das alten Gotteshaus mit
der alten, das neue mit der neuen zeit verglich und die der Lade
entnommene Tora als das köstlichste und alleinige Kleinod pries und
schilderte, das uns auf allen Zügen durchs Leben begleiten müsse. Nach
vorausgegangenen, abwechselnd von Vorbeter und Gemeinde vorgetragenen
Psalmgebeten setzte sich der Festzug unter Anleitung der hierzu Beorderten
und dem Voranschreiten der Ältesten mit den Gesetzrollen, still und
feierlich, die zahlreichen Beamten in ihrer Staatsuniform an der Spitze,
nach der neuen Synagoge in Bewegung. Die ganze Stadt war auf den Beinen,
die Straßen gedrängt voll Menschen, die Fenster der Häuser, vor denen
der Zug vorbeiging, mit Neugierigen besetzt und Alles verriet durch Miene
und Haltung die höchste Ehrerbietung. An der neuen Synagoge angekommen,
empfing der Gr. Kreisrat vom Gr. Baumeister unter Ansprache des Letztern
den auf einem Kissen im Zuge Vorangetragenen Schlüssel, überreichte ihn
mit feierlicher Anrede dem ersten Vorsteher, das Hauptportal wurde
erschlossen und die Teilnehmer traten in das Gebäude, das einen
herzerquickenden Anblick bot.
Der Stil des Gebäudes ist zum Verhältnis der Kosten kunstvoll zu nennen.
Schon das Äußere macht einen vorteilhaften Eindruck. Die Sitze sind
bequem, die Räume hell, in akustischer Hinsicht ganz vorzüglich, von den
Vorträgen des Rabbiners und des Kantors geht auch nicht eine Silbe
verloren. Die nach altjüdischer Sitte von dem Männerplatze abgesonderten
Frauensitze erheben sich oberhalb des Schiffes amphitheatralisch und gewähren
nach allen Seiten einen freien Überblick. Der Vorhang, die Kanzel, der
Tisch mit rotem Sammet und prachtvollen Goldstickereien verziert, das
Geschenk eines hiesigen Damen-Vereins, die Kronleuchter und Kandelaber,
ebenfalls Geschenk eines Männer-Vereins, sind von wahrhafter Pracht. An
den Wänden befinden sich mehrere Inschriften und, was zur Nachahmung zu
empfehlen, zwei schöne Tafeln, die eine mit der Zeitbestimmung zum
jedesmaligen Gottesdienste, die andere das Stück der Tora-Vorlesung nach
dem dreijährigen Zyklus und die Haftorot bezeichnend. Die festliche
Beleuchtung erhöhte noch den schönen und würdigen Eindruck in nicht
geringer Weise.
Die Einweihungsfeier selbst begann nach dem Präludium mit der Orgel durch
den Gesang des Ma towu von einem
aus der männlichen und weiblichen Jugend zusammengesetzten ziemlich
starken Chor. Alle, mitunter künstlerisch ausgearbeiteten Gesangpiecen
wurden exakt vom Chore exekutiert. Auch die Solostücke hatte unser Kantor
ganz befriedigend und erhebend ausgeführt. Der Glanzpunkt der Feier war
die bereits im Druck erschienene Predigt unseres Herrn Rabbiners, die
nicht bloß die Objekte, sondern auch die wirkenden Subjekt der Synagoge
seiner scharfsinnigen und taktvollen Betrachtung unterwarf und in
wohltuendster Wärme, Klarheit und überzeugender Kraft alle Punkte,
welche die Feier darbieten konnte, mit einem Scharfblick erkannte und
durchführte. Auch die am Sabbatmorgen gehaltene Predigt war mit derselben
Meisterschaft zur vollsten Befriedigung der Zuhörer vorgetragen. Die Rede
dauerte über eine Stunde und doch zum das ‚Amen’ einem Juden zu früh.
In heiliger und fröhlicher Stimmung wurde der ganze festliche Tag
verlebt.
So besitzt denn nun unsere Gemeinde eine herrliche Synagoge, die, wenn
auch nicht an Größe, doch an Zweckdienlichkeit und verhältnismäßiger
Schönheit allen andern derartigen bauten zur Seite sich stellen kann; sie
besitzt eine der Bildungsstufe der Gemeinde vollkommen entsprechende und
ansprechende Liturgie, einen abgekürzten Perikopen-Zyklus, von deutschen
Übersetzungen und Erklärungen des Rabbinen begleitet, deutsche Haftorot,
einige deutsche Gebete in Verbindung mit den hebräischen und dann, was
wesentlich zur Belebung des Gottesdienstes beiträgt, häufige Abwechslung
der Gemeinde mit dem Kantor durch Responsorien. Das Gute, aus der
Wirksamkeit eines dem Gemeindeinteresse mit ernster Sorgfalt obliegenden
und mit dem Rabbiner Hand in Hand gehenden, sowie auf eine tüchtige
Anzahl wohlgesinnter Gemeindeglieder sich stützenden Vorstandes,
entstammend, hat auf den in Kultussachen sonst nur der Gewohnheit lebenden
Teil der Gemeinde so mächtig gewirkt, dass nirgends ein Widerspruch
dagegen sich erhebt, vielmehr Alles seine herzliche Freude mit den
Errungenschaften der Gemeinde ausdrückt. Namentlich verdient das uneigennützige,
eifrige Bemühen des ersten Vorstehers, des Herrn Simon Mayer, die rühmlichste
Anerkennung und ist ihm auch diese vor einem Jahre bei Gelegenheit der
Feier seiner silbernen Hochzeit durch einen von mehreren Gemeindegliedern
angeschafften und überreichten, mit Inschriften versehenen Pokal nebst
Widmungsschreiben äußerlich zuteil geworden, eine Tatsache, die unter
Juden leider! nicht sehr häufig vorkommen dürfte." |
Einführung der Gasbeleuchtung und Verkauf der
alten Leuchter (1878)
 |
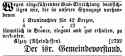 |
|
Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Oktober 1878 und in der
Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Oktober 1878: "Wegen einzuführender
Gas-Einrichtung beabsichtigen wir die in unserer Synagoge vorhandenen: 1
Kronleuchter für 42 Kerzen, 4 Kronleuchter für 12 Kerzen, sämtlich in
Bronze, elegant und gut erhalten, zu verkaufen.
Alzey (Rheinhessen). Der
israelitische Gemeindevorstand".
|
Anzeige der Firma Zulauf & Co., die für die
Synagogenbeleuchtung in Alzey sorgte (1886)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1886: "Zulauf & Co.
Inhaber: Wilh. Und Jos. Reinach. Mainz
& Höchst am Main. Fabrik in allen Gas- und Wasserartikeln, Luster,
Lampen, Ampeln, Suspensions, Hähnen, Klosets, Badewannen etc. etc.
Spezialität:
Synagogenbeleuchtung. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1886: "Zulauf & Co.
Inhaber: Wilh. Und Jos. Reinach. Mainz
& Höchst am Main. Fabrik in allen Gas- und Wasserartikeln, Luster,
Lampen, Ampeln, Suspensions, Hähnen, Klosets, Badewannen etc. etc.
Spezialität:
Synagogenbeleuchtung.
Eingerichtet wurden von uns in allerletzter Zeit die Synagogen Zweibrücken,
Saargemünd, Alzey, Oberstein,
Tübingen, Meiningen etc. etc." |
50-jähriges
Synagogenjubiläum (1904)
Am
3. Oktober 1904 feierte die jüdische Gemeinde nach vollendeter
gründlicher Renovierung den 50. Jahrestag der Einweihung der Synagoge.
Darüber liegen mehrere Berichte vor.
 |
 |
|
Artikel im
"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 19. August 1904 (links) und
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. August 1904 (rechts): "Alzey,
6. August (1904). In diesem Jahre kann die hiesige israelitische
Religionsgemeinde das 50-jährige Fest ihres Synagogenbaues begehen. Schon
seit Wochen wird im Inneren fleißig gearbeitet, um das Gotteshaus fast
vollständig neu und in schönster Weise herzurichten. Nach beendigter
Fertigstellung soll, wie man hört, eine entsprechende Einweihungsfeier
stattfinden. Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums fand am 10. und 11.
Oktober im Jahre 1879 eine kirchliche und weltliche Feier statt, die
damals in schöner und würdiger Weise unter allgemeiner Beteiligung aller
Konfessionen verlief." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Oktober 1904: "Alzey, 10. Oktober. Die hiesige israelitische Gemeinde beging am 3. dieses
Monats das 50-jährige Jubelfest ihres Synagogenbaues unter sehr starker
Beteiligung. Am Vormittag fand in der schön renovierten Synagoge ein
Festgottesdienst statt. Rabbiner Dr. Levy weiht hierauf nach einer sehr
erbauenden und eindrucksvollen Ansprache das neu hergerichtete Gotteshaus wieder
ein. Am Abend fand in dem festlich dekorierten Saalbau die weltliche Feier,
verbunden mit Abschiedsfest zu Ehren des von hier scheidenden Rabbiners Dr. Levy
statt. Rabbiner Dr. Levy hielt die Festrede, in welcher er in meisterhafter
Weise die jüdische Geschichte Alzeys beleuchtet. Hierauf richtete der weltliche
Gemeindevorstand warme Abschiedsworte an den Scheidenden." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Oktober 1904: "Alzey, 10. Oktober. Die hiesige israelitische Gemeinde beging am 3. dieses
Monats das 50-jährige Jubelfest ihres Synagogenbaues unter sehr starker
Beteiligung. Am Vormittag fand in der schön renovierten Synagoge ein
Festgottesdienst statt. Rabbiner Dr. Levy weiht hierauf nach einer sehr
erbauenden und eindrucksvollen Ansprache das neu hergerichtete Gotteshaus wieder
ein. Am Abend fand in dem festlich dekorierten Saalbau die weltliche Feier,
verbunden mit Abschiedsfest zu Ehren des von hier scheidenden Rabbiners Dr. Levy
statt. Rabbiner Dr. Levy hielt die Festrede, in welcher er in meisterhafter
Weise die jüdische Geschichte Alzeys beleuchtet. Hierauf richtete der weltliche
Gemeindevorstand warme Abschiedsworte an den Scheidenden." |
Einweihung von zwei Gedenktafeln für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges
in der Synagoge (1921)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung der Judentums" vom 5. August 1921:
"In der Synagoge zu Alzey wurden zwei Gedenktafeln für die im
Weltkriege gefallenen Söhne der dortigen Gemeinde - Alfred Koch, Erwin
Strauß, Paul Küchler, Max und Ludwig Schwarz, Jakob J. Schaffner, Paul
und Hugo Weimann - eingeweiht. Sanitätsrat Dr. Mainzer hielt die
Begrüßungsansprache und Rabbiner Dr. Lewit die Weiherede." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung der Judentums" vom 5. August 1921:
"In der Synagoge zu Alzey wurden zwei Gedenktafeln für die im
Weltkriege gefallenen Söhne der dortigen Gemeinde - Alfred Koch, Erwin
Strauß, Paul Küchler, Max und Ludwig Schwarz, Jakob J. Schaffner, Paul
und Hugo Weimann - eingeweiht. Sanitätsrat Dr. Mainzer hielt die
Begrüßungsansprache und Rabbiner Dr. Lewit die Weiherede." |
| |
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 26. Juli 1921: Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 26. Juli 1921:
Text wie oben in der "Allgemeinen Zeitung des
Judentums" |
75-jähriges Synagogenjubiläum
(1929)
 Artikel
in den "Mitteilungen des Landesverbandes der israelitischen
Religionsgemeinden Hessens" vom November 1929 S. 6: "Alzey. Die
hiesige israelitische Religionsgemeinde feierte am 20. Oktober, dem zweiten
Tage des Laubhüttenfestes, gleichzeitig das 75-jährige Synagogenjubiläum.
Die Synagoge war aus diesem Anlass sehr schön durch Palmen, Girlanden und
Blumenarrangements geschmückt, so dass sie tatsächlich einen Blumengarten
glich. Auch der Gottesdienst hatte durch Solo- und Chorgesänge ein besonders
festliches Gepräge. In seiner Festpredigt ging Herr Rabbiner Dr. Lewit von
der Haftoroh, welche von der Einweihung des salomonische Tempels berichtet,
aus, gedachte der Vorsteher, die das heutige Gotteshaus erbauen ließen, der
Herrn Maier, Lessing, Levy und Neuberger, erinnerte daran, dass der damalige
Rabbiner Dr. Adler seligen Andenkens seiner Einweihungsrede den Text: 'w'osu
li mikdosch w'schochanti b'sochom' 'sie sollen mir ein Heiligtum machen,
damit ich in ihrer Mitte wohne', zugrunde gelegt habe. Dies gelte auch für
den heutigen Tag. Er verbreitete sich dann über die dreifache Bedeutung des
Gotteshauses als Bes tefilloh Gebetshaus, Bes Hamidrosch
Lehrhaus und Bes hachneseth Versammlungshaus. Im Weiteren erwähnte
der Rabbiner auch, dass durch Gottes Gnade vier Männer der Gemeinde, die
schon zur Zeit der Einweihung lebten, das heutige 75-jährige Jubiläum
mitfeiern könnten. Es sind dies der Nestor der Gemeinde, Herr Abraham Levy,
welcher im vergangenen Sommer seinen 90. Geburtstag feiern konnte, der
Ortsrichter, Herr Albert Levy, Ehrenvorsitzender des Vorstandes und
langjähriger erster Vorsteher der Gemeinde, Herr Karl Neuberger, der auch
zwölf Jahre lang das Amt des Schriftführers im Vorstande verwaltet und Herr
Bäckermeister Simon Süßkind, der wohl vielen rheinhessischen Israeliten als
früherer Matzenlieferant bekannt sein dürfte. Die sämtlichen Herren erfreuen
sich alle, trotzdem sie das höchste biblische Alter, 80 Jahre, überschritten
haben, noch großer Rüstigkeit und besuchen noch fleißig die Synagoge. Mit
dem Wunsch, dass das hiesige Gotteshaus stets seinem Zwecke gerecht werde,
verband der Geistliche noch den Wunsch, dass auch die Gemeinde ihre
religiösen Aufgaben stets erfüllen möge zur Ehre Gottes und zum Segen des
Judentums." Artikel
in den "Mitteilungen des Landesverbandes der israelitischen
Religionsgemeinden Hessens" vom November 1929 S. 6: "Alzey. Die
hiesige israelitische Religionsgemeinde feierte am 20. Oktober, dem zweiten
Tage des Laubhüttenfestes, gleichzeitig das 75-jährige Synagogenjubiläum.
Die Synagoge war aus diesem Anlass sehr schön durch Palmen, Girlanden und
Blumenarrangements geschmückt, so dass sie tatsächlich einen Blumengarten
glich. Auch der Gottesdienst hatte durch Solo- und Chorgesänge ein besonders
festliches Gepräge. In seiner Festpredigt ging Herr Rabbiner Dr. Lewit von
der Haftoroh, welche von der Einweihung des salomonische Tempels berichtet,
aus, gedachte der Vorsteher, die das heutige Gotteshaus erbauen ließen, der
Herrn Maier, Lessing, Levy und Neuberger, erinnerte daran, dass der damalige
Rabbiner Dr. Adler seligen Andenkens seiner Einweihungsrede den Text: 'w'osu
li mikdosch w'schochanti b'sochom' 'sie sollen mir ein Heiligtum machen,
damit ich in ihrer Mitte wohne', zugrunde gelegt habe. Dies gelte auch für
den heutigen Tag. Er verbreitete sich dann über die dreifache Bedeutung des
Gotteshauses als Bes tefilloh Gebetshaus, Bes Hamidrosch
Lehrhaus und Bes hachneseth Versammlungshaus. Im Weiteren erwähnte
der Rabbiner auch, dass durch Gottes Gnade vier Männer der Gemeinde, die
schon zur Zeit der Einweihung lebten, das heutige 75-jährige Jubiläum
mitfeiern könnten. Es sind dies der Nestor der Gemeinde, Herr Abraham Levy,
welcher im vergangenen Sommer seinen 90. Geburtstag feiern konnte, der
Ortsrichter, Herr Albert Levy, Ehrenvorsitzender des Vorstandes und
langjähriger erster Vorsteher der Gemeinde, Herr Karl Neuberger, der auch
zwölf Jahre lang das Amt des Schriftführers im Vorstande verwaltet und Herr
Bäckermeister Simon Süßkind, der wohl vielen rheinhessischen Israeliten als
früherer Matzenlieferant bekannt sein dürfte. Die sämtlichen Herren erfreuen
sich alle, trotzdem sie das höchste biblische Alter, 80 Jahre, überschritten
haben, noch großer Rüstigkeit und besuchen noch fleißig die Synagoge. Mit
dem Wunsch, dass das hiesige Gotteshaus stets seinem Zwecke gerecht werde,
verband der Geistliche noch den Wunsch, dass auch die Gemeinde ihre
religiösen Aufgaben stets erfüllen möge zur Ehre Gottes und zum Segen des
Judentums." |
Bis Mitte der 1930er-Jahre wurde die Synagoge genutzt, danach versammelte sich
die kleiner gewordene Gemeinde in einem Raum eines Privathauses (Haus von Willy
Straß), den man als
Betsaal eingerichtet hatte.
In der Pogromnacht im November 1938 wurde
sowohl dieser Betsaal wie auch die Synagoge zerstört (ausführlich dazu s. D.
Hoffmann Lit. S. 248-273). Die Ritualien wurden mit
Ausnahme einer Torarolle und Torarollenfragmenten verbrannt. Am 8. Mai 1939
kaufte die Stadt die zerstörte Synagoge für 600 Reichsmark. Im Laufe des
Krieges verfiel das Gebäude. Nach 1945 standen nur noch die Außenmauern, die
1955 abgebrochen wurden.
Am Standort der Synagoge wurde 1966 eine Gedenktafel
aus weißem Marmor angebracht. Vor einigen Jahren wurde die Gedenktafel mit
weiteren Tafeln, unter anderem mit den Namen der aus Alzey deportierten und
ermordeten Juden ergänzt. Zu dem weiteren, im Oktober 2009 eingeweihten
Gedenkstein siehe die Pressebericht unten.
Adresse/Standort der Synagoge: Die neue Synagoge stand in
Augustinerstraße (heute Gedenkstätte).
Fotos zur Synagogengeschichte
(Fotos Hahn, Aufnahmedatum 3.8.2005, die historischen
Aufnahmen aus dem Buch: "...und dies ist die Pforte des Himmels" s.Lit.;
Aufnahmen von Michael Ohmsen: Aufnahmedatum Mai 2011, Fotos in höherer
Auflösung auf der Website von M. Ohmsen mit Fotoseiten
zu Alzey)
| Die alten Synagogen |
 |
 |
 |
| |
Bis 1791 befand sich die
Synagoge im Haus
der Löwenapotheke (Ecke Judengasse/
Spießgasse; Foto rechts von Helmut Schmahl) |
Die 1791 erbaute und 1976
abgebrochene Synagoge
in der Spießgasse |
| |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Seit
2009: Denkmal für die 1791 erbaute und 1976 abgebrochene Synagoge in der
Spießgasse mit einer Gedenkinschrift
für den Reform-Rabbiner Dr. Samuel Adler (Fotos von Helmut Schmahl) |
| |
|
|
| Die 1853
eubgeweihte Synagoge |
|
|
 |
 |
 |
Die 1853 eingeweihte Synagoge
in der
Augustinerstraße (Aufnahme von 1925) |
Die 1938
zerstörte Synagoge - als Ruine
vor dem Abbruch 1955 |
| |
|
 |
 |
 |
Gipsmodell der Fassade der
Synagoge
im Museum der Stadt Alzey |
Bauinschrift der Synagoge:
"Es soll aufgeschrieben sein für die zukünftigen Generationen, dass
dies
das erste Gotteshaus ist, das gebaut
hat die Gemeinde mit Hilfe des
Allerhöchsten. Angefangen wurde das
Werk im Januar 1852. Es geschah
die
Vollendung im Oktober 1854" |
Die rechte der Gebotstafeln
vom Giebel
der Synagoge (Museum der Stadt) |
| |
|
 |
|
| |
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
 |
Die aus der Alzeyer Synagoge
gerettete Torarolle |
Schabbatleuchter |
Erinnerung an die Zerstörung
der Synagoge
auf der Geschichtstafel am Rathaus |
| |
| |
|
|
 |
 |
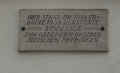 |
Die heutige
Gedenkstätte am Synagogenplatz "zur Erinnerung an unsere
ehemaligen
jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Leben und Heimat
unter dem Regime der
Barbarei, des Rassenwahns und der Unmenschlichkeit verloren.' (Fotos: Michael Ohmsen) |
Die Gedenktafel
von 1966 |
| |
| |
|
|
 |
 |
 |
Die
Namenstafeln. Hinweis: es sind nicht nur Personen genannt, die umgekommen
sind beziehungsweise ermordet wurden,
sondern auch Personen, die ihre Heimat verloren haben, das heißt zur
Emigration gezwungen waren. |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Grafiti-Wand
zur Erinnerung an die Deportation nach Gurs hinter Antoniterstraße 16 |
| |
|
|
Historischer
Torbogen
am Turm in der Schlossgasse |
 |
| |
"Hinweistafel:
"Dieser historische Torbogen wurde 1953 der Stadt Alzey geschenkt von
Frau
Liesel Rosenthal geborene Baum zum Andenken an ihren 1943
verstorbenen Vater Karl Baum". |
| |
|
|
Haus der
Familie Belmont
(Foto: Helmut Schmahl,
Informationen rechts nach Angaben
von Renate Rosenau) |
 |
| |
Es
handelt sich um eines der Häuser der Familie Belmont in Alzey. Das Foto oben
zeigt einen Teil des Anwesens in der St. Georgenstraße 19, das Wohnhaus,
Scheunen und Ställe umfasste. Aron (ziviler Name: August) Belmont
(geb. 8. Dezember 1813 in diesem
Haus) wurde
in New York Bankier und Politiker |
| |
|
|
Hinweis: Das Museum der Stadt Alzey befindet sich in Alzey in der Antoniterstraße 41 (Telefon 06731/498896, E-Mail)
Internetseite
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
| Juli / September 2008:
Das Denkmal für Marianne Strauss in der Selzgasse wird neu
gestaltet |
 Artikel
im "Nachrichten-Blatt" Alzey-Land vom 3. Juli 2008 S. 1 (auszugsweise
zitiert): "Römerkastell und Marianne Strauss. Der
Altertumsverein für Alzey und Umgebung (ATV) wird im September an zwei Stellen
im Alzeyer Stadtbild in Erscheinung treten... Artikel
im "Nachrichten-Blatt" Alzey-Land vom 3. Juli 2008 S. 1 (auszugsweise
zitiert): "Römerkastell und Marianne Strauss. Der
Altertumsverein für Alzey und Umgebung (ATV) wird im September an zwei Stellen
im Alzeyer Stadtbild in Erscheinung treten...
...am 7. September - am Europäischen Tag der jüdischen Kultur - wird das
neu gestaltete Denkmal für Marianne Strauss der Öffentlichkeit
übergeben. Dieses Denkmal für ein jüdisches Mädchen, das 1942 als
15-Jährige zusammen mit ihrer Mutter deportiert und ermordet wurde, steht
vor ihrem Elternhaus in der Selzgasse in Alzey. Es entstand 1993 im Rahmen
eines Projektes an der Volkerschule. Es entstanden Tonkacheln, die sich
auf ihr Leben und ihre Familie bezogen. Dieses Denkmal führte bisher ein
Schattendasein und war auch häufig von Mülltonnen zugestellt. Der ATV
wird nun einen würdigen Rahmen geben und eine Erläuterungstafel
aufstellen. Für die Übergabefeier ist ein Programm mit jüdischer Musik
geplant..." |
| |
| Januar
2009:
Erinnerung an das Schicksal der Alzeyer
Familien Levi und Oppenheim |
Artikel
von Kathrin Damwitz in der "Allgemeinen Zeitung" vom 6. Januar
2009 (Artikel)
: Auch das Eiserne Kreuz nützte nichts
- Alzeyer Familien Levi und Oppenheimer wurden im NS-Reich boykottiert und verschleppt.
ALZEY. Die jüdische Gemeinde in Alzey hat eine lange Geschichte. Schon Anfang des 14.Jahrhunderts hat es eine jüdische Gemeinde gegeben. Bis in die heutige Zeit reichen die Spuren, die von Deutschen jüdischen Glaubens gelegt wurden. Wir stellen das "Jüdische Alzey" in einer Serie
vor...".
Die Serie ist auch im Internet zu finden unter: http://www.az-alzey.de/region/serie/juedischesalzey |
| |
| Januar
2009:
Erinnerung an die
Ereignisse beim Novemberpogrom 1938 |
Beitrag von Anja Reumschüssel in der "Allgemeinen Zeitung" vom
27. Januar 2009 (Main-Rheiner,
Artikel):
Zerstörungswut griff um sich - Reichspogromnacht hinterließ in Alzey und Umgebung tiefe Spuren
ALZEY. Die jüdische Gemeinde in Alzey hat eine lange Geschichte. Schon Anfang des 14. Jahrhunderts hat es sie gegeben. Bis in die heutige Zeit reichen die Spuren, die von Deutschen jüdischen Glaubens gelegt wurden. Wir stellen das "Jüdische Alzey" in einer Serie vor. Heute geht es um die Reichspogromnacht 1938..." |
| |
| Juni 2009:
Neuer Gedenkstein zur Erinnerung an die Synagoge
ist geplant |
Artikel in der "Allgemeinen
Zeitung" vom 29. Juni 2009 (Artikel):
Verein bittet um Spenden.
ALZEY. (red). Der Altstadtverein möchte als Erinnerung an die alte Alzeyer Synagoge von 1791 einen Gedenkstein errichten und sucht Sponsoren und Spender für das Projekt..." |
| |
| Oktober 2009:
Die Einweihung des neuen Gedenksteines findet am 26. Oktober
2009 statt |
Artikel von Katja Schäfer in der "Allgemeinen Zeitung" vom 19.
Oktober 2009 (Artikel):
"Gedenkstein erinnert an ehemalige Synagoge in Alzey
ALZEY. Wo bis vor kurzem noch Sträucher und Bäume das städtische Gelände besiedelten wird in wenigen Tagen der Gedenkstein zur Erinnerung an die einstige Synagoge enthüllt. Mit dem Gebilde will der Altstadtverein an die im Jahr 1976 abgerissene Synagoge erinnern..." |
| |
| Oktober 2009:
Die Einweihung des neuen Denkmals am Synagogenstandort |
Artikel von Armin Burkart in der "Allgemeinen Zeitung" vom 26.
Oktober 2009 (Artikel):
"Erinnerungen an Synagoge. ALZEY. DENKMAL Stein trägt die künstlerische Handschrift von Florian Geyer.
An der Einmündung der Löwengasse auf die Hospitalstraße erinnert seit Sonntag ein Gedenkstein an die ehemalige Synagoge von 1791 und an den dort tätigen Rabbiner Dr. Samuel
Adler..." |
| |
| Oktober 2010:
Neue Broschüre über "Erinnerungsorte"
zur jüdischen Geschichte in Alzey und Umgebung |
Artikel von Sarah Faber in der
"Allgemeinen Zeitung" vom 7. Oktober 2010 (Artikel): "Dem jüdischen Alzey auf der Spur
ALZEY - STADTRUNDGANG Museumsleiter Dr. Rainer Karneth veröffentlicht Broschüre zu
'Erinnerungsorten'..." |
| |
| März 2011:
Verlegung von 18 "Stolpersteinen" in
Alzey |
Artikel von Kathrin Damwitz in der "Allgemeinen Zeitung" (Alzey)
vom 2. April 2011 (Artikel):
"Steine der Erinnerung
ALZEY. NS-ZEIT Altstadtverein und Kölner Künstler gedenken ermordeter jüdischer Mitbürger
Seit Freitag erinnern 18 'Stolpersteine' des Kölner Künstlers Gunter Demnig an jüdische Mitbürger, die jahrzehntelang in der Stadt lebten, bevor sie von den Nationalsozialisten ermordet wurden..." |
| |
| April 2011:
Neue Dokumentation zu Marianne Strauß aus Alzey
(1927-1942) |
 Links:
Einladung des Schulleiters des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums zur
Vorstellung einer Dokumentation über "Marianne Strauß - ein
Mädchen aus Alzey". Dokumentation mit Spielszenen - Video-AG am
Elisabeth-Langgässer-Gymnasium. Premiere am 6. April 2011, 19:00 Uhr im
Museum der Stadt Alzey". Links:
Einladung des Schulleiters des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums zur
Vorstellung einer Dokumentation über "Marianne Strauß - ein
Mädchen aus Alzey". Dokumentation mit Spielszenen - Video-AG am
Elisabeth-Langgässer-Gymnasium. Premiere am 6. April 2011, 19:00 Uhr im
Museum der Stadt Alzey".
Die Einladung als
pdf-Datei; Link zum Elisabeth-Langgässer-Gymnasium
in Alzey
Video-Sequenz
der Video-AG zur Dokumentation über "Marianne Strauß - ein Mädchen
aus Alzey"
(Hinweis: ca. 10 MB; 3gp-Datei; kann u.a. mit VLC-Player angeschaut
werden; Download des VLC-Players kostenlos über http://www.videolan.org/
möglich) |
Gedenkstätte für
Marianne Strauß mit Hinweistafel
in der Selzgasse 16
(Fotos: Michael Ohmsen;
Fotoseiten zu
Alzey) |
 |
 |
|
| |
|
|
|
| |
 |
 |
|
| |
Beide Fotos oben
von Helmut Schmahl |
|
| |
| April 2011:
Informationsveranstaltung zur Verlegung von
"Stolpersteinen" in Alzey |
Artikel von Steffen Nagel in der
"Allgemeinen Zeitung" vom 4. April 2011 (Artikel):
"Alzey. Schicksal der Opfer nie vergessen
ALZEY. STOLPERSTEINE Schüler gestalten Infoveranstaltung am Vorabend der Verlegung..." |
| |
| Juni
2012: Ein Orgelstuhl
erinnert noch an die Orgel der Synagoge in Alzey |
Artikel in der "Allgemeinen
Zeitung" (Lokalausgabe Alzey) vom 14. Juni 2012: "Historische
Details zu Orgelstuhl aus Alzeyer Synagoge bei Museumsnachtisch...."
Link: Historische Details zu Orgelstuhl aus Alzeyer Synagoge bei Museumsnachtisch (Allgemeine Zeitung, 14.06.2012) .
Anmerkung: im Alzeyer Museum befindet sich seit Anfang der 1990er-Jahre
der Orgelstuhl aus der Synagoge. |
| |
| September 2012:
Weitere
"Stolpersteine" werden verlegt |
Artikel in der "Allgemeinen
Zeitung" (Lokalausgabe Alzey) vom 5. September 2012: "Stolpersteine für NS-Opfer
ALZEY (red). In diesem Jahr werden vor sieben Häusern Stolpersteine für 16 Alzeyer Opfer des NS-Rassenwahns gelegt: für einen jungen Mann, der im Rahmen der NS-Euthanasie in Hadamar ermordet wurde, und für 15 Menschen jüdischer Abstammung und jüdischen Glaubens. Am Freitag, 7. September, findet um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Aula der Außenstelle des Gymnasiums am Römerkastell, Bleichstraße, statt. Die eigentliche Verlegung der Stolpersteine durch den Kölner Künstler Gunter Demnig, beginnt am Montag, 10. September, um 9 Uhr am Kirchenplatz 5. Schülerinnen und Schüler stellen die Biografien der Opfer vor deren ehemaligen Wohnhäusern vor..."
Link zum Artikel: Stolpersteine für NS-Opfer (Allgemeine Zeitung, 05.09.2012) |
| |
| Artikel in der "Allgemeinen
Zeitung" vom 10. September 2012: Gegen das Vergessen (Allgemeine Zeitung, 10.09.2012) |
| Artikel in der "Allgemeinen
Zeitung" vom 11. September 2012: 16 Stolpersteine für Alzeyer Juden (Allgemeine Zeitung, 11.09.2012) |
| Artikel im "Alzeyer
Wochenblatt" vom 13. September 2012: "Eine
Verbeugung vor dem Opfer - Künstler Gunter Demnig verlegt zum zweiten Mal
Stolpersteine in Alzey..." (eingestellt als
pdf-Datei) |
| Anmerkung: Stolpersteine
wurden verlegt für Ludwig Klingenschmitt (Kirchplatz 5), Geschwister Gustav
und Johanna Levi (Spießgasse 18), Johanetta Keller geb. Baum, Pauline
Strauß und Helene Vogel geb. Strauß (Spießgasse 71), Heinrich Schwarz
(Weinrufstraße 29) sowie Ida Strauß geb. Rosenthal und Marianne Strauß
(Selzgasse 16). |
| |
| Februar
2015: Alzeyer Schüler
erarbeiten Biografien von NS-Opfern |
| Artikel in der "Allgemeinen
Zeitung" vom 21. Februar 2015: Alzeyer Schüler erarbeiten Biografien von NS-Opfern (Allgemeine Zeitung, 21.02.2015) |
| |
|
September 2017:
Alzeyer Schüler führen zu den
Stolpersteinen |
Artikel von David Schöne vom 28.
September 2017: "Alzeyer Röka-Schüler erinnern bei Rundgang an
deportierte Juden.
ALZEY - Mit zitternden Händen hält Karl Baum den Brief in den Händen.
Hiermit dürfen er und seine Frau und Kinder die Stadt nicht mehr verlassen.
Am nächsten Morgen geht dann alles ganz schnell. Es klingelt an der Tür.
Beamte fordern ihn auf, rasch das Wichtigste zusammenzupacken und sein Hab
und Gut aufzulisten. Er hat dafür genau drei Stunden Zeit. Schnell packt die
Familie ihre sieben Sachen. Die Wertsachen muss sie an die Beamten abgeben.
Und dann beginnt sie: die Reise in den Tod. Als Renate Rosenau der zehnten
Klasse des Gymnasiums Römerkastell die Geschichte des Juden erzählt, folgen
alle gespannt ihren Lippen. Am Sonntag jährte sich die Deportation der
Alzeyer Juden zum 75. Mal. 139 Menschen wurden am 24. September 1942 aus
ihren Häusern geholt und fanden über mehrere Stationen und Aufenthalte
schließlich in der Gaskammer den Tod. Die Anzahl der Überlebenden aus der
Volkerstadt lässt sich fast an einer Hand abzählen. Vieles erinnert nicht
mehr an die Opfer der Nationalsozialisten, sie haben nicht einmal ein
eigenes Grab. Nur wer ab und zu seinen Blick auf den Boden richtet, kann die
Erinnerungsstücke sehen: die Stolpersteine. Renate Rosenau führt Gruppen
durch die Stadt zu den insgesamt 65 Stolpersteinen und berichtet über die
Schicksale der Juden. Gunter Demnig heißt der Künstler, der das Projekt
'Stolpersteine' 2011 ins Leben rief. Seitdem gibt es in Deutschland rund 55
000 kleine Messingplatten, die in den Bürgersteigen verankert sind. Sie
erinnern an Juden, die die Deportation nicht überlebt haben und informieren
über Name, Geburtsdatum und Zeitpunkt der Deportation. Auch der Platz der
Steine ist nicht zufällig gewählt, sondern sie sind dort verankert, wo die
Deportierten zuletzt wohnten. Das Alzeyer Schloss. Hier lebte Karl Baum.
Dort, wo nun tagtäglich Gäste ein und aus gehen und übernachten, wohnte er
mit seiner Frau Johanna und seinen Kindern. Lediglich die Stolpersteine im
Bürgersteig erinnern daran. Die Schulklasse und Renate Rosenau stehen um die
Steine herum. Die Schüler haben die Biografien jedes Alzeyer Deportierten
recherchiert und tragen nun die Lebensgeschichte von Karl Baum vor: Nachdem
er aus dem Haus geworfen wird, kommt er nach Mainz in eine enge Turnhalle,
in der sich tausend weitere Juden aufhalten. Von dort aus geht es einen Tag
später nach Darmstadt. Auch dort ist die Turnhalle einer Schule nicht groß,
doch die zigtausend Juden aus der Umgebung werden dort hineingepfercht. Dort
verliert sich erst einmal seine Spur. Wochen später kommt er im polnischen
Treblinka an. Im Anschluss putzen die Schüler die Stolpersteine, um ihnen
neuen Glanz zu verschaffen. Isabelle Nonnenmacher (15) nimmt Eimer,
Spülmittel und Schwamm und putzt die Steine, während ihre Mitschüler um sie
herum stehen. Es ist still. 'Es war ein trauriger Moment für uns, doch es
ist wichtig, dass so an die Toten gedacht wird', sagt die Schülerin. Renate
Rosenau sieht das ähnlich: 'Das sind alles Mordopfer, die grausam starben.
Man soll bei den Steinen stehen bleiben und sich fragen: Wie konnte es dazu
kommen?' Man solle sich gerade in der heutigen Zeit bewusst machen, was die
Anfänge waren, ergänzt die 76-Jährige. In den fünf Rundgängen werden zum
Gedenken aller Alzeyer Deportierten alle Stolpersteine wieder aufpoliert und
alle Biografien vorgetragen. Renate Rosenau wünscht sich mehr Aufmerksamkeit
für die Erinnerungsstücke: 'Am besten wäre eine App oder ein Buch mit allen
Biografien. Es ist alles recherchiert, jetzt müsste es nur noch gemacht
werden.'"
Link zum Artikel |
| |
Hinweis: Seit der
letzten Verlegung am 9. Mai
2022 liegen in Alzey 86 Stolpersteine, dazu fünf im benachbarten
Siefersheim/Rheinhessen.
Ausführliche Informationen zur Verlegung am 9. Mai 2022 sowie Fotos und
Video siehe:
https://dienamenlose.blog/2022/05/12/stolperstein-verlegung-in-alzey/
|
| |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Germania Judaica II/I S.12; III/I S.12-13. |
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen.
1971 Bd. I,39-42. |
 |  Dieter
Hoffmann: "...wir sind doch Deutsche." Zu Geschichte und
Schicksal der Landjuden in Rheinhessen. Hg. Stadt Alzey 1992. Dieter
Hoffmann: "...wir sind doch Deutsche." Zu Geschichte und
Schicksal der Landjuden in Rheinhessen. Hg. Stadt Alzey 1992.
Auf dem Umschlageinband links: Abraham (genannt
"Alfred") Stern, Lehrer und Kantor des Großherzoglichen Rabbinats
Alzey vor der Rückseite der Synagoge zu Alzey, 1917.
Hinweis: das genannte Buch ist nur noch antiquarisch erhältlich; der Autor
verstarb 2021. |
 | Dieter Hoffmann: Zur Emanzipation der
rheinhessischen Juden. In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und
zur Gedenkstättenarbeit in Rheinland-Pfalz. Heft Nr. 9 1/95. S.
23-27. Beitrag
ist online eingestellt. |
 | Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt
des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies
ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. Mainz 2005. S. 76-78 (mit weiteren Literaturangaben). |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Alzey. The medieval community, established before
1260, was shattered by the Black Death persecutions of 1348-49 and expelled in
1391. Jews returned about 300 years later and their number grew to over 350 (7 %
of the total) in 1861. Mostly successfull businessmen, they played an active
role in the town's social and cultural life. The modern community, which
embraced religious Reform, built a Moorish-style temple (1854) and its rabbi,
Dr. Samuel Adler (1842-57), went on to serve Congregation Emanuel in New York.
His son, Felix Adler (born in Alzey; 1851-1931), founded the Society for Ethical
Culture. Owing to the growth of antisemitism, the Jewish population declined
from 320 (3,8 %) in 1910 to 197 (2 %) in January 1933. From 1924 a branch of the
German Zionist Organization gained support. After the Nazis came to power, a
boycott campaign forced many Jews to emigrate and less than 100 remained on Kristallnacht
(9-10 November 1938), when their synagogue was burned down. The last 41 Jews
were deported in 1942-43.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|