|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht: Jüdische Friedhöfe
in der Region
Jüdische Friedhöfe in Mecklenburg
- Vorpommern
Bitte besuchen Sie auch die Seite www.juden-in-mecklenburg.de
mit Seiten zu den jüdischen Friedhöfen in Mecklenburg www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe
Übersicht:
Jüdische Friedhöfe (und jüdische
*Begräbnisstätten) finden sich in
einzelnen, in allen Stadt- und Landkreisen des Bundeslandes verstreut liegenden
Orten (nachstehend sind die Landkreise und kreisfreien Städte des Landes
Mecklenburg-Vorpommern nach Stand vor der Kreisgebietsreform
Mecklenburg-Vorpommern ab dem 4. September 2011 angegeben): Landkreise
Ludwigslust-Parchim (LUP, HGN, LBZ, LWL, PCH, STB), Mecklenburgische
Seenplatte (NB, MSE, AT, DM, MC, MST, MÜR, NZ, RM, WRN), Nordwestmecklenburg
(HWI, NWM, GDB, GVM, WIS, STB), Vorpommern-Greifswald (HGW, VG, ANK, GW, OVP, PW, SBG, UEM,
UER, UM, WLG, NB), Rostock (LRO, BÜZ, DBR, GÜ, ROS, TET), Vorpommern-Rügen (HST,
VR, GMN, NVP, RDG, RÜG), Rostock (HRO), Schwerin (SN).
Anmerkung: die angegebenen Kfz-Kennzeichen dienen nur der Orientierung; sie sind
gewöhnlich nicht das einzige am Ort gebräuchliche Kfz-Kennzeichen.
Ergänzender Hinweis auf eine online zugängliche Quelle: über die Website des Landesarchivs
Baden-Württemberg ist zugänglich: ein Register zu
Mecklenburg-Schwerin mit einer Eintragung von Geburten, Eheschließungen und
Sterbefällen zwischen 1847 und 1859, zugänglich über http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-445990
(mit Eintragungen aus den Gemeinden Brüel, Crivitz, Croepelin (Kröpelin),
Dargun, Doberau, Dömitz, Gadebusch, Gnoien, Goldberg, Grabow, Güstrow.
Hagenow, Krakow, Kröpelin (Croepelin), Laage, Ludwigslust, Lübtheen (Tote
wurden in Hagenow beigesetzt), Malchin, Malchow, Neubukow, Neukalen,
Neustadt, Parchim, Penzlin, Plau, Rehna, Ribnitz, Röbel, Schwaan, Schwerin,
Stavenhagen, Sternberg, Sülz, Tessin, Teterow, Warin,
Wittenberg. Link: http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-445990
Altentreptow (ehem. Treptow an
der Tollense, MSE)
Zur Geschichte des Friedhofes: 1828
wurde eine erste Beisetzung eines jüdischen neugeborenen Jungen auf einem Platz
in der Nähe des Klosterberges vorgenommen. Dieser Platz wurde jedoch in der
Folgezeit nicht weiter für Beisetzungen verwendet. Noch um 1828 wurde vor dem
Demminer Tor am Klosterberg ein anderes Gelände als jüdischer Friedhof angelegt
und in der Folgezeit für Beisetzungen genutzt. 1841 wurde der Friedhof durch ein
angrenzendes Stück Land vergrößert. Bis 1926 wurden hier Beisetzungen
vorgenommen (die letzte war diejenige von Helene Cohn, die am 9. Oktober 1926
verstorben war).
In der NS-Zeit wurde der Friedhof geschändet, falls alle Grabsteine umgeworfen.
1949 ging das Friedhofsgrundstück nach Verhandlungen mit der Jüdischen
Landesgemeinde Mecklenburg in den Besitz der Stadt über. Er wurde eingeebnet und
die Grabsteinen an einen Steinmetzbetrieb verkauft. Seitdem ist der Friedhof ein
nicht mehr als solcher erkennbarer Teil der Parkanlage am Klosterberg.
Lage: Altentreptow, Klosterberg.
Link: Website der Stadt
Altentreptow
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Treptow_an_der_Tollense_Altentreptow
Literatur:
Anklam (OVP)
 Zu den Friedhöfen in Anklam besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zu den Friedhöfen in Anklam besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Bad Sülze (NVP)
Zur Geschichte des Friedhofes: In Bad Sülze bestand seit 1765 am
Schindanger im sogenannten "Rosengarten" hinter dem kirchlichen Friedhof (vor
dem Rostocker Tor) ein jüdischer Friedhof, auf dem damals die jüdischen Familien
einer weiten Umgebung (u.a. auch aus Stralsund) ihre Toten beigesetzt haben. Der Friedhof
wurde bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts belegt (Auflösung der jüdischen
Gemeinde Bad Sülze 1915). Die Friedhofsfläche umfasste 10,54 ar (nach anderen
Angaben 3,00 ar). Im September 1942 genehmigte das Mecklenburgische
Staatsministerium den Antrag des Bürgermeisters der Stadt auf Schließung des
Begräbnisplatzes und die Einebnung nach "einem vom Staatlichen Gesundheitsamt zu
bestimmenden Zeitpunkt".
Beim Bau einer neuen
Schule in der Kastanienallee 7 (wann?, heute: Grund- und Realschule) wurde der Friedhof
zerstört, als dort eine Heizleitung verlegt wurde. An seiner Stelle befindet
sich ein Parkplatz.
Lage: Früher: Am Schindanger. Heute Schulhof der Schule an der
Kastanienallee (Flur 3, Friedhofsgrundstück ist das Flurstück 40/4).
Link: Website des Amtes
Rechnitz-Trebeltal
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Bad_Suelze
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur S. 24; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S. 630.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Bad Sülze S. 183-185.
Barth (NVP)
 Zur Geschichte des
Friedhofes: Auf
dem städtischen Areal des Barther Friedhofes befinden sich heute mehrere
Gedenksteine, vor allem in Erinnerung an die vielen Opfer des
Nationalsozialismus. Die Stadt erwarb im 19. Jahrhundert diese Fläche von der
Kirche. Sie sollte als Armenfriedhof dienen. Hauptsächlich wurden dort jedoch
nichtchristliche Bürger bestattet. Insofern wurde im Volksmund dieser Platz
"Judenfriedhof" genannt. Hier befinden sich unzählige Gräber von
KZ-Häftlingen, Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern. Bis in die 1950er Jahre müssen
die Gräber gekennzeichnet gewesen sein. Ein heute zu sehender Gedenkstein
erinnert an eine Begräbnisstätte von 114 sowjetischen Kindern von
Zwangsarbeiterinnen, die hier während der Kriegsjahre verstarben. Ein weiterer
Stein trägt die Namen von acht polnischen Männern, ein nächster gedenkt den
Tod italienischer Zwangsarbeiter. Ein anderer Findling kennzeichnet eine Ruhestätte
von 180 Umsiedlern. In dieser Reihe befindet sich auch ein Stein mit
eingearbeitetem Davidsstern, der an die hier begrabenen jüdischen Barther Bürger
erinnert. Zur Geschichte des
Friedhofes: Auf
dem städtischen Areal des Barther Friedhofes befinden sich heute mehrere
Gedenksteine, vor allem in Erinnerung an die vielen Opfer des
Nationalsozialismus. Die Stadt erwarb im 19. Jahrhundert diese Fläche von der
Kirche. Sie sollte als Armenfriedhof dienen. Hauptsächlich wurden dort jedoch
nichtchristliche Bürger bestattet. Insofern wurde im Volksmund dieser Platz
"Judenfriedhof" genannt. Hier befinden sich unzählige Gräber von
KZ-Häftlingen, Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern. Bis in die 1950er Jahre müssen
die Gräber gekennzeichnet gewesen sein. Ein heute zu sehender Gedenkstein
erinnert an eine Begräbnisstätte von 114 sowjetischen Kindern von
Zwangsarbeiterinnen, die hier während der Kriegsjahre verstarben. Ein weiterer
Stein trägt die Namen von acht polnischen Männern, ein nächster gedenkt den
Tod italienischer Zwangsarbeiter. Ein anderer Findling kennzeichnet eine Ruhestätte
von 180 Umsiedlern. In dieser Reihe befindet sich auch ein Stein mit
eingearbeitetem Davidsstern, der an die hier begrabenen jüdischen Barther Bürger
erinnert.
Lage: Städtischer Friedhof an der Kirchwallstraße (beim Rathaus/Friedhofswall)
Link: Website der Stadt Barth
(von hier ist der obige Text und das Foto übernommen)
Förderverein
Dokumentations- und Begegnungsstätte Barth e.V.
Literatur: Brocke/Ruthenberg/Schulenburg S. 240f.
Informationsseite zur jüdischen Geschichte von Barth mit Fotos auf der Website
des Vereins Land und Leute e.V. (unter Projekte): hier
anklicken
Erwähnung in der Liste der International Association of Jewish Genealogical
Societies (Cemetery Project): hier
anklicken .
Bergen/Rügen
Zur Geschichte des Friedhofes: Über die Geschichte eines
jüdischen Friedhofes in Bergen ist nichts Näheres bekannt. Der Friedhof soll
als ein Teil des städtischen Friedhofes in den 1950er-Jahren noch vorhanden
gewesen sein.
Lage: Teil des städtischen Friedhofes.
Link: Website
der Stadt Bergen auf Rügen
Literatur: Brocke/Ruthenberg/Schulenburg S. 251.
Boizenburg/Elbe
(LWL)
Zur Geschichte des Friedhofes: Der jüdische Friedhof wurde
in der Mitte des 18. Jahrhunderts " neben der Richtstätte und der Frohnerei" angelegt.
Das älteste Grab stammt aus dem Jahr 1763. Etwa 1799 wurde der Gemeinde für die
Erweiterung des Friedhofs von der Stadt unentgeltlich eine Fläche an der
"Eichenkoppel und Abhang dahinter" oberhalb des Lauenburger Postweges zur
Nutzung als Begräbnisplatz überlassen, 1882 weitere etwa 20 m², wobei die
Grundstücke in städtischem Eigentum verblieben. Der Friedhof umfasst eine Fläche von 6,80 ar.
Der Friedhof
wurde bis 1936 genutzt (letzte Beisetzung im Juni 1936). In der weiteren Jahren
der NS-Zeit geriet der Friedhof zunehmend in einen
verwahrlosten Zustand. Im August 1937 verabschiedete die Stadt einen Beschluss
über die Schließung des Friedhofes zum 31. Dezember 1938 und die Einebnung nach
30 Jahren. Damals gab es noch etwa 39 Gräber auf dem Friedhof. Die Klage der
Israelitischen Landesgemeinde Mecklenburg gegen diesen Ratsbeschluss wurde vom
Landesverwaltungsgericht im August 1938 abgewiesen. Nach Kriegsende wurde der
Friedhof 1948 wieder instandgesetzt. 1964 sollte er
eingeebnet werden, wogegen die jüdische Landesgemeinde Einspruch erhob. 1966
wurde der Friedhof schwer geschändet (Grabsteine beschädigt, Friedhofsmauer
eingerissen), aber danach wieder hergerichtet. Es sind etwa 30 Grabsteine
erhalten. Auch ein Gedenkstein ist vorhanden.
Im September 2018 wurde der Friedhof wiederum geschändet (siehe nachstehender
Presseartikel). Im Februar/März 2021 erhielt der Friedhof einen neuen Zaun.
|
September 2018:
Der Friedhof wurde geschändet
|
Artikel
in "Neues Deutschland.de" vom 13. September 2018:
"Jüdischer Friedhof in Boizenburg geschändet
Täter sprühten ein Hakenkreuz auf die Haupttreppe einer Gedenkstätte und
beschmierten Mauern sowie Pfeiler
Boizenburg. Unbekannte haben einen jüdischen Friedhof in Boizenburg
(Kreis Ludwigslust-Parchim) geschändet. Die Täter sprühten ein Hakenkreuz
auf die Haupttreppe einer Gedenkstätte auf dem Friedhof und beschmierten
Mauern und Pfeiler, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte. Der
Vorfall soll sich in der Nacht zu Mittwoch ereignet haben. Die Suche nach
den Täter laufe noch. Die Schmierereien in verschiedenen Farben seien am
Mittwoch von einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung bemerkt und angezeigt
worden. Um auf den verschlossenen Friedhof am Stadtpark zu kommen, hätten
die Täter die Eisenstäbe des Zaunes auseinandergebogen. Dort stehen zudem 40
historische Grabsteine. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und des
Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen."
Link zum Artikel
Bitte wenden Sie sich an das Polizeirevier Boizenburg unter der
Telefonnummer 038847 6060. Hinweise nimmt natürlich auch jede andere
Polizeidienststelle entgegen. |
Lage: Am Lauenburger Postweg direkt am Hang, am westlichen Rand der Boizenburger
Altstadt (Boizenburger Stadtpark).

|
Lage des jüdischen Friedhofes
in Boizenburg auf dem dortigen Stadtplan:
links anklicken: der Link zeigt die Lage des jüdischen Friedhofes an;
alternativ unter "Einrichtungen" weiterklicken zu
"Friedhof, jüdisch" |
Link: Website der
Stadt Boizenburg/Elbe
Wikipedia-Artikel
"Jüdischer Friedhof (Boizenburg/Elbe)
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Boizenburg_Elbe
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur S. 23-24; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S. 265-266.
Heidemarie Gertrud Vormann: Bauhistorische Studien zu den Synagogen in
Mecklenburg. Dissertation TU Carolo-Wilhelmina Braunschweig 2009/2010.
Erschienen 2012. Online zugänglich
https://publikationsserver.tu-braunschweig.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbbs_derivate_00022767/Diss_Vormann.pdf
Zu Boizenburg S. 397-472 (zu Synagoge, Mikwe und zum jüdischen Friedhof).
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Boizenburg S. 185-186.
Brüel (PCH)
 Zum Friedhof in Brüel besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Brüel besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Bützow (GÜ)
 Zum Friedhof in Bützow besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Bützow besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Crivitz (PCH)
Zur Geschichte des Friedhofes: Der jüdische Friedhof wurde 1776
angelegt. Zunächst war er von einem Zaun umgeben, 1938 wurde dieser durch eine
massive Mauer ersetzt. In der NS-Zeit wurde der Friedhof restlos zerstört und
eingeebnet. Auf
dem Gelände wurde im Zweiten Weltkrieg ein Lager für sowjetische
Kriegsgefangene angelegt. Das für die Wachmannschaft erbaute Backsteingebäude
Trammerstraße 1 blieb erhalten und ist heute Wohnhaus. Auf dem
Friedhofsgelände, das in den 1980er-Jahren als Lagerplatz eines
Handwerksbetriebes verwendet wurde, ist kein Grabstein mehr vorhanden.
Lage: An der Trammer Straße.
Link: Website
der Stadt Crivitz
Wikipedia-Artikel
"Jüdischer Friedhof (Crivitz)"
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Crivitz
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur S. 26; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S. 288.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Crivitz S. 191-192.
Dargun (DM)
 Zum Friedhof in Dargun besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Dargun besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Demmin (DM)
 Zu den Friedhöfen in Demmin besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zu den Friedhöfen in Demmin besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Dettmannsdorf (Amt Bad
Sülze, NVP)
Zur Geschichte des Friedhofes: Zu diesem Friedhof
sind fast keine Informationen vorhanden. Bitte gegebenenfalls Mitteilung an
unsere Mail-Adresse, siehe Eingangsseite
Die Friedhofshalle des jüdischen Friedhofes wurde 1938 angezündet.
Lage:
Link: Website
des Amtes Recknitz-Trebeltal
Erwähnung in der Liste der International Association of Jewish Genealogical
Societies (Cemetery Project): hier
anklicken
Literatur: Brocke/Ruthenberg/Schulenburg S. 300.
Dömitz (LWL)
 Zum Friedhof in Dömitz besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Dömitz besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Feldberg
(Feldberger Seenlandschaft, MST)
 Zur
jüdischen Geschichte: In Feldberg lebten nur wenige
jüdische Familien. Um 1894/1903 gab es nach den damals jährlichen Ausgaben des
"Statistischen Jahrbuches des Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes" 12 jüdische
Personen am Ort (von insgesamt etwa 1500 Einwohnern), die zur jüdischen Gemeinde in
Mirow gehörten. Zur
jüdischen Geschichte: In Feldberg lebten nur wenige
jüdische Familien. Um 1894/1903 gab es nach den damals jährlichen Ausgaben des
"Statistischen Jahrbuches des Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes" 12 jüdische
Personen am Ort (von insgesamt etwa 1500 Einwohnern), die zur jüdischen Gemeinde in
Mirow gehörten.
Zur Geschichte des Friedhofes: Der
jüdische Friedhof war zunächst ein privater Begräbnisplatz der jüdischen
Kaufmannsfamilie Philippson und wurde 1850 angelegt. Die erste Beisetzung
erfolgte 1873. Wenig später wurden auf dem Friedhof auch die Verstorbenen
anderer jüdischer Familien aus Feldberg und Woldegk beigesetzt. Die
Friedhofsfläche umfasst etwa 3 ar. In der NS-Zeit blieb der Friedhof
unversehrt, nach Angaben auf Grund des Schutzes durch den "Stahlhelm", eine
Organisation ehemaliger Frontsoldaten. Von den früher vorhandenen 14 Grabsteinen sind noch 12 erhalten.
Der älteste Grabstein ist vermutlich aus dem Jahr 1870. Die
letzte Beisetzung war 1959.
Lage: Am Ortsrand von Feldberg, östlich der
Schule, auf dem ehemaligen Mühlenberg (Bereich Abzweig Hans-Fallada-Siedling von
der Harsefelder Straße).
Google-Maps:
https://goo.gl/maps/oLMB8DG97PaV4oEz8
Link: Website
der Gemeinde Feldberg
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Feldberg
Wikipedia-Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Jüdischer_Friedhof_Feldberg
Heide Kramer: Ein nicht geschändeter Friedhof: Der jüdische Friedhof in
Feldberg/Mecklenburg (Feldberger Seenlandschaft):
https://www.hagalil.com/archiv/2007/08/feldberg.htm (von hier die
Zeichnung oben)
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur S. 29; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S. 337.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Feldberg S. 197.
Friedland/Neubrandenburg (MST)
 Zu den Friedhöfen in Friedland besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zu den Friedhöfen in Friedland besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Gnoien (GÜ)
Zur Geschichte des Friedhofes: Der jüdische Friedhof wurde Ende
des 19. Jahrhunderts angelegt. Er wurde bis 1925 belegt (die jüdische Gemeinde
hatte sich 1923 bereits aufgelöst). Im März 1926 geschah die erste Schändung,
als unbekannte Täter den Leichenwagen in der Feierhalle des Friedhofs
zertrümmerten. Weitere Schändungen geschahen im November 1926, 1934 und 1938. Bis
1955 waren noch einige der 37 Grabstellen zu erkennen, ansonsten waren schon
damals nur noch Grabsteinfragmente erhalten. Seit den 1960er-Jahren wird das
Friedhofsgelände landwirtschaftlich genutzt (Kleingärten). 1970 errichtete die Jüdische
Landesgemeinde Mecklenburg eine kleine Gedenkstätte auf dem Friedhof. Ein
Gedenkstein für die Opfer des Holocaust ist vorhanden. Ein neuer
Gedenkstein besteht seit 2024 (vgl. Artikel unten).
Schändung des Friedhofes (1926)
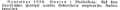 Mitteilung der der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins) vom 28. Januar 1927: "November 1926. Gnoien
in Mecklenburg. Auf dem israelitischen Friedhof wurden Gedenksteine
umgeworfen, Gräber demoliert."
Mitteilung der der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins) vom 28. Januar 1927: "November 1926. Gnoien
in Mecklenburg. Auf dem israelitischen Friedhof wurden Gedenksteine
umgeworfen, Gräber demoliert." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Februar 1927: "(Eine
tieftraurige Statistik). Eine erschütternde Liste der
Friedhofsschändungen, in ihm Laufe der letzten zwei Jahre in Deutschland
verübt wurden, wird in der letzten Nummer der C.V.-Zeitung veröffentlicht.
Den Beschmutzungen und Beschädigungen jüdischer Gotteshäuser in München,
Berlin, Potsdam, Kiel und vielen anderen Orten reihen sich die
Friedhofsschändungen, die hier aufgezeichnet sind, an: ... Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Februar 1927: "(Eine
tieftraurige Statistik). Eine erschütternde Liste der
Friedhofsschändungen, in ihm Laufe der letzten zwei Jahre in Deutschland
verübt wurden, wird in der letzten Nummer der C.V.-Zeitung veröffentlicht.
Den Beschmutzungen und Beschädigungen jüdischer Gotteshäuser in München,
Berlin, Potsdam, Kiel und vielen anderen Orten reihen sich die
Friedhofsschändungen, die hier aufgezeichnet sind, an: ...
(darunter): "Gnoien in Mecklenburg. Auf dem israelitischen Friedhof
wurden Gedenksteine umgeworfen, Gräber demoliert. ...". |
Lage: An der Bobbiner Chaussee.
Fotos
Fotos des
Friedhofsgrundstückes
(Quelle: findagrave.com; Fotos von Tim Peppel) |
 |
 |
Link zu den Google Maps
(der Pfeil markiert die Lage des Friedhofes)
Einzelne Presseberichte zum Friedhof
Eine neue Gedenktafel wird (zu
früh) enthüllt
(2024)
Artikel von Gerald Gräfe im "Nordkurier" vom
23. März 2024: "Grabstelle. Windböe enthüllt Gedenkstein zwei Jahre zu
früh
Gnoien In Gnoien erhält der jüdische Friedhof seine Würde zurück. Schon
weit vor der offiziellen Weihe ist jetzt eine Gedenkstele zu sehen.
Ein heftiger Windstoß hat vor einigen Tagen in Gnoien ein Denkmal enthüllt,
das eigentlich noch verborgen bleiben sollte. Die Böe riss die dunkle Plane
von der Stele auf der Hügelkuppe über dem rechten Warbelufer am östlichen
Stadtrand.
Zwischenzeitlich als Kleingarten genutzt. 'In Gedenken der jüdischen
Bürger von Gnoien' ist auf dem Gedenkstein zu lesen, der jetzt den lange
Zeit vernachlässigten jüdischen Friedhof in der Warbelstadt wieder ein
Gesicht gibt. Grabstellen sind hier keine mehr sichtbar. Die Grünanlage war
zu DDR-Zeiten zunächst verwaist und dann als Kleingarten genutzt worden.
Seit 1996 schon führt die Jüdische Landesgemeinde die Begräbnisstätte auf
dem kleinen Hügel auf der Liste der zu sanierenden derartigen Gedenkstätten.
Die offizielle Weihe für das Denkmal und die gesamte Anlage sei nun in zwei
oder drei Jahren geplant, sagt Bürgermeister Lars Schwarz. Bis dahin sollen
die Arbeiten zur würdevollen Wiederherstellung des Begräbnisplatzes der
Gnoiener Israeliten abgeschlossen sein. In den vergangenen Jahren waren eine
Garage nebst Gartenhaus abgerissen, der Weg hinauf zur Hügelkuppe
gepflastert, ein Zaun mit Tor gesetzt und die Stele errichtet worden. Der
Gedenkstein soll nun noch in den steinernen Bord eingebettet und die gesamte
Anlage modelliert und bepflanzt werden, kündigt Schwarz an. Alle Arbeiten
sind mit der Jüdischen Landesgemeinde abgestimmt und werden über
Landesmittel finanziert. Die Kosten belaufen sich auf knapp 10 000 Euro pro
Jahr, weshalb die Arbeiten an dem Friedhof auch mehrere Jahre dauern. Die
Pflege der Anlage, die mit Wildkräutern bewachsen ist, soll ausgeschrieben
werden, erklärt der Bürgermeister.
Ins Ghetto verschleppt. Die Geschichte der Juden in Gnoien geht bis
auf das Jahr 1756 zurück. Damals wurde Juda Moses als erstem Juden der Zuzug
nach Gnoien gestattet. Um 1835 wurden 75 Juden in der Stadt gezählt. Hundert
Jahre darauf waren es noch zwei - die Geschwister Hermine und Eugen Salomon.
Sie starb 1942 in Gnoien, ihr Bruder am 12. Juli 1943 im Ghetto von
Theresienstadt, wohin er verschleppt worden war. An diese beiden letzten
Juden Gnoiens erinnern heute eine Gedenktafel am Standort von deren
vormaligem Wohnhaus und zwei 'Stolpersteine' im Stadtzentrum.
Die letzte Beisetzung eines jüdischen Bürgers von Gnoien erfolgte wohl 1925.
Ein Jahr darauf wurden mehrere Gräber geschändet und der Leichenwagen
zertrümmert. Ab 1934 kam es zu mehreren Zerstörungen. 1937 wurden 37
erkennbare Gräber gezählt. Deren Grabsteine wurden später zur Befestigung
eines Bachufers in der auf dem Friedhof entstehenden Gartenanlage
missbraucht."
Link zum Artikel |
Link:
Website
von Amt und Stadt Gnoien
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Gnoien
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur S. 30; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S. 363-364.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Gnoien S. 202-203.
Goldberg (PCH)
Zur Geschichte des Friedhofes: In Goldberg bestand ein jüdischer
Friedhof, auf dem bis 1920 Beisetzungen stattfanden. Die Friedhofsfläche
umfasste 7,42 ar. Die jüdische Landesgemeinde verkaufte das Grundstück 1950
für 400.- Mark an die Stadt. Wegen seines angeblich schlechten
Erhaltungszustandes wurde er 1953 eingeebnet. Das Gelände wurde als Garten
verwendet.
Lage: An der Güstrower Straße.
Link: Website
zu Goldberg
Wikipedia-Artikel
"Jüdischer Friedhof (Goldberg)
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Goldberg
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur S. 31; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S. 371-372.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Goldberg S. 204-205.
Grabow (LWL)
Zur Geschichte des Friedhofes: Der jüdische Friedhof in Grabow
wurde vermutlich Ende des 18. Jahrhunderts auf einem alten Weinberg
("Lucasweinberg"), damals am Rande der Stadt, angelegt. 1794 wird er
das erste Mal erwähnt. 1896 wurde er geschändet (siehe Bericht unten) Der
Friedhof wurde bis
in die 1930er-Jahre belegt und umfasste eine Fläche von etwa 9 ar. Die NS-Zeit
bestand er mit nur leichten Beschädigungen. 1952 wurde bei der Umgestaltung des
Friedhofes zu einer Gedenkstätte dieser weitgehend abgeräumt; fast nur die
Grabsteine aus Granit blieben erhalten und wurden halbkreisförmig
aufgestellt. Die Mauer wurde ausgebessert und das
Eingangstor erneuert. Es sind noch 17 Grabsteine erhalten aus der Zeit zwischen
1813 und 1933. 1988 wurde der Friedhof wiederum hergerichtet. Dabei
wurde um die Grabsteine ein schmiedeeiserner Zaun gesetzt.
Der Friedhof wurde mehrfach schwer geschändet. 1970 wurden
Grabsteine umgestoßen und die Friedhofsmauer beschädigt. 1987 wurde ein
Grabstein mit Benzin übergossen und angezündet. Im Februar 2004 besprühten unbekannte Täter eine Gedenktafel
auf dem Friedhof mit Farbe.
Schändung des jüdischen
Friedhofes (1896)
 Artikel
in "Der Israelit" vom 24. Februar 1896: "Grabow. Aus
dem hiesigen jüdischen Kirchhof waren eine Anzahl von Grabsteinen
herausgerissen und zerstört worden. Als Täter wurde der Arbeiter Stanislaus
Szczegulski aus Ostrowo ermittelt, der vom dortigen Schöffengericht zu einem
Jahr Gefängnis und drei Jahren Ehrverlust hierfür verurteilt wurde." Artikel
in "Der Israelit" vom 24. Februar 1896: "Grabow. Aus
dem hiesigen jüdischen Kirchhof waren eine Anzahl von Grabsteinen
herausgerissen und zerstört worden. Als Täter wurde der Arbeiter Stanislaus
Szczegulski aus Ostrowo ermittelt, der vom dortigen Schöffengericht zu einem
Jahr Gefängnis und drei Jahren Ehrverlust hierfür verurteilt wurde." |
Lage: Der Friedhof liegt nordwestlich der Altstadt an der Straße
"Trotzenburg" bzw. am Neukarstädter Weg.
 |
Lage des jüdischen Friedhofes
in Grabow auf dem dortigen Stadtplan: links anklicken und unter
"Einrichtungen" weiterklicken zu
"Friedhof, jüd." |
Link: Website der
Stadt Grabow
Wikipedia-Artikel
"Jüdischer Friedhof (Grabow)"
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Grabow
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur S. 31-32; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S. 376-377.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Grabow S. 206-207.
Greifswald (HGW)
 Zum Friedhof in Greifswald besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Greifswald besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Grevesmühlen (NWM)
Zur Geschichte des Friedhofes: Die Toten der jüdischen Gemeinde
wurden zunächst in Rehna beigesetzt. 1856 kaufte die jüdische Gemeinde ein
Ackerstück zur Anlage eines Friedhofes, doch erst 1877 wurde die behördliche
Genehmigung zu dessen Anlage erteilt. Damals waren die meisten jüdischen
Gemeindemitglieder bereits von der Stadt verzogen, sodass vermutlich nur noch
wenige Beisetzungen erfolgten. In der NS-Zeit wurde der Friedhof zerstört. 1948
wurde er wieder hergestellt und 1966 zu einer Gedenkstätte umgestaltet. Die
Friedhofsfläche umfasst etwa 4,20 ar. Ein Gedenkstein ist vorhanden.
Im August 2001 wurde der Friedhof
geschändet.
Lage: Nordwestlich der Stadt, knapp 1 km vom Stadtzentrum entfernt
am Vielbecker Weg.
 |
Lage des jüdischen Friedhofes
in Grevesmühlen auf dem dortigen Stadtplan: links anklicken und
weiter
zum Straßenverzeichnis unter "Vielbecker Weg". Der Friedhof ist
nicht gesondert eingetragen. |
Link: Website der
Stadt Grevesmühlen
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Grevesmuehlen
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur S. 32-33; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S. 380.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Grevesmühlen S. 208-209.
Grimmen (NVP)
 Zum Friedhof in Grimmen besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Grimmen besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Güstrow (GÜ)
 Zum Friedhof in Güstrow besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Güstrow besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Hagenow (LWL)
Zur Geschichte des Friedhofes: In Hagenow bestand
seit 1806 ein jüdischer
Friedhof, auf dem bis in die 1930er-Jahre etwa 120 Tote - überwiegend aus
Hagenow und Lütheen - beigesetzt wurden. Die letzten Bestattungen waren 1936/37
(Dora Mendel und Samuel Meiningen). Der Ende der NS-Zeit war noch ein Teil der
Grabsteine erhalten. 1949 standen noch 35 Grabsteine aufrecht.
Um 1955/60 wurde der Friedhof planiert und die noch erhaltenen Grabsteine für
das Anlegen eines Fundamentes für den Fahrzeugstellplatz der Stadtwirtschaft
auf dem Friedhof verwendet.
Ein Gedenkstein auf
dem Friedhofsgrundstück wurde später aufgestellt.
2010 wurde das Grundstück beräumt. Dabei konnten Grabsteinfragmente geborgen
werden (siehe Bericht unten). Eine würdige Gestaltung und Herrichtung des
Friedhofsgrundstückes wurde 2014 durchgeführt (Feier nach Abschluss der
Instandsetzung mit Aufstellung einer Gedenkstele im November 2014). Die Fläche des Friedhofes umfasst
etwa 1700 qm.
Eine Liste der auf dem Friedhof
beigesetzten Personen liegt im Hagenower Museum aus.
(Museum Hagenow Lange Straße 79
19230 Hagenow Tel. 03883/722042 Informationsseite)
Lage: Friedrich-Heincke-Straße (neben
dem Autohaus Lindemann)
| Oktober
2010: Arbeiten zur Neugestaltung
des Friedhofes |
Artikel von Dieter Hirschmann in
der "Schweriner Volkszeitung" vom 1. Oktober 2010:
"Geschichts-Puzzle nimmt Formen an.
HAGENOW - Das Geschichts-Puzzle um den ehemaligen jüdischen Friedhof in Hagenow ist um einige wertvolle Steine - und das im wahrsten Sinne des Wortes, - vervollständigt worden. Museums-Chef Henry Gawlik versucht, die vor rund 40 Jahren mit grober Gewalt zertrümmerten Grabsteine zusammenzufügen. "Das ist notwendig, um die Fragmente der Steine den jeweiligen verstorbenen Personen zuordnen zu können, die auf der Sterbeliste vermerkt sind, die mir vorliegt", macht Gawlik aufmerksam.
Worum geht es? Im Zusammenhang mit der jüngsten Beräumung des ehemaligen jüdischen Friedhofes in der Hagenower Friedrich-Heincke-Straße kamen geschichtlich wertvolle Zeitzeugnisse ans Tageslicht. Geborgen wurden u.a. die Granitsäule vom Grabmal der Hildegard Davidsohn, und etliche Sandsteinbrocken, Fragmente von Grabsteinen. "Dank eines Schülerprojektes der Friedrich-Heincke-Schule war bei der Beräumung etwas zu erwarten. Wir wussten nämlich, dass Grabsteine in das Fundament gelangt sind. Es war ein sehr schweres Betonfundament, das vor allem Brocken von Grabsteinen enthielt. Diese Stücke legen zunächst Zeugnis ab von den Ereignissen Anfang der 60-er-Jahre", macht Henry Gawlik deutlich. Denn immerhin wurden seinerzeit für die Errichtung von Gebäuden auf dem Areal, das später von der Hagenower Stadtwirtschaft genutzt wurde, die jüdischen Grabsteine für die Fundamente passend gemacht. Vermutlich mit Wissen und Duldung der damals Herrschenden verschwanden so wichtige Zeugnisse der jüdischen Geschichte. Und das offenbar nur, weil so Beton gespart werden konnte. Denn im Umgang mit der jüdischen Vergangenheit verstand sich die DDR als Vertreter der von den Nazis verfolgten jüdischen Bürgern. Und nun kommt heute zumindest für Hagenow ein ganz anderer Umgang mit dem jüdischen Erbe ans Tageslicht. Bedenklich ist also, dass der jüdische Friedhof die NS-Zeit überstanden hat, im Jahre 1949 standen nach den Worten von Gawlik noch 35 Grabsteine aufrecht, die DDR-Zeit überlebte die Begräbnisstätte nicht.
In wieweit die einzelnen Fundstücke in dem neuen jüdischen Museum in der Hagenower Synagoge als Ausstellungsstücke Eingang finden, kann Henry Gawlik jetzt noch nicht sagen. Möglicherweise ergeben sich mit der Aufarbeitung der Funde auch noch völlig neue und unerwartete Hinweise auf das Leben der jüdischen Gemeinde in Hagenow. Am Tag der Eröffnung des kleinen jüdischen Museums in der Synagoge, am 9. November, wird es weitere Einzelheiten zu den Funden geben.
Und welche Bedeutung haben die Stücke für den Chef des Hagenower Museums? "Die Funde sind Trümmer, aber sie haben für mich eine wichtige historische Bedeutung. Sie legen Zeugnis ab für die Existenz der jüdischen Gemeinschaft und ihrer Begräbnisstätte. Seit 1806 gab es den Friedhof, auf einer Sterbeliste ab dem Jahre 1813 sind ungefähr 120 Tote, meistens aus Hagenow und Lübtheen, aufgeführt, die dort bestattet wurden. Die letzten Bestattungen erfolgte auf dem jüdischen Friedhof in Hagenow im Jahre 1936, Dora Mendel fand dort ihre letzte Ruhestätte, 1937 wurde Samuel Meinungen beerdigt", so Henry Gawlik abschließend.". |
Rechts: der Friedhof vor der
Zerstörung in den 1950er-Jahren
Foto: Museum Hagenow |
 |
 |
Links: das Grundstück bei den
Arbeiten 2010
(Quelle: Artikel der "Schweriner Volkszeitung" siehe oben) |
| |
|
|
|
Artikel im
"Hagenower Kreisblatt" vom 10. Oktober
2012: Im Jahre 2017 sollen Arbeiten abgeschlossen sein. Hagenow
saniert jüdischen Friedhof. Die Stadt Hagenow saniert in
Zusammenarbeit mit dem Landesverband der jüdischen Gemeinden und mit
finanzieller Unterstützung des Innenministeriums in Schwerin den
jüdischen Friedhof in Hagenow..."
Link
zum Artikel. |
|
|
Artikel im "Hagenower Kreisblatt" vom 22. Oktober
2014: "Hagenow - Friedhof bekommt Würde zurück.
Landesgemeinde und Stadt Hagenow bereiten Einweihung des jüdischen
Friedhofes in der Friedrich-Heincke-Straße vor..."
Link
zum Artikel. |
| |
Artikel von Dieter
Hirschmann in den "Norddeutschen Neuesten Nachrichten" ("Hagenower
Kreisblatt") vom 25. November
2014: "Hagenow. Totengebet auf jüdischem Friedhof.
Gedenkstätte in Hagenow bekam gestern ihre Würde zurück. Stele erinnert an
jüdische Gemeinde..."
Link zum Artikel |
Link: Website
der Stadt Hagenow
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Hagenow
Literatur: Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S. 393-394.
Artikel von Axel Seitz in der "Jüdischen Allgemeinen" vom 17. August
2017: "Hagenow. Von Dohnányi war hier. Seit 2007 zieht die Alte Synagoge
als Kulturzentrum prominente Gäste an..." Link
zum Artikel
Heidemarie Gertrud Vormann: Bauhistorische Studien zu den Synagogen in
Mecklenburg. Dissertation TU Carolo-Wilhelmina Braunschweig 2009/2010.
Erschienen 2012. Online zugänglich
https://publikationsserver.tu-braunschweig.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbbs_derivate_00022767/Diss_Vormann.pdf
Zu Hagenow S. 331-397 (zu Synagoge, Gemeindehaus, Mikwe, Wagenschauer und zum
jüdischen Friedhof).
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Hagenow S. 213-214.
Krakow am See (GÜ)
 Zum Friedhof in Krakow am See besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Krakow am See besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Kröpelin (DBR)
 Zum Friedhof in Kröpelin besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Kröpelin besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Laage (GÜ)
Zur Geschichte des Friedhofes: Die Toten der in Laage seit Anfang
des 19. Jahrhunderts lebenden jüdischen Familien wurden zunächst in Güstrow
beigesetzt. Nachdem die Zahl der jüdischen Einwohner in Laage auf etwa 45
angewachsen war (1851), bemühten sie sich um die Anlage eines eigenen
Friedhofes in der Stadt. Dies war 1852 auf dem "Scheibenberg"
möglich. Die Friedhofsfläche umfasste 1913 2,63
ar, einige Jahre danach 3,92 ar. Der letzte auf dem Friedhof Beigesetzte war der
am 8. Juni 1926 verstorbene Albert Mendel (Kaufmann und Vorstandsmitglied der
städtischen Sparkasse in Laage). In der NS-Zeit wurde der Friedhof nicht zerstört.
Er diente der Hitlerjugend als Spielplatz. Bis um 1960 war noch ein Teil der
Grabsteine bzw. deren Reste erhalten. Mit der Zeit verschwanden jedoch auch die
letzten Steine. Über ihren Verbleib ist nichts bekannt. Heute ist auch
keine Einfriedung mehr vorhanden, nur ein mit Bäumen und Gestrüpp bewachsener
Hügel erinnert an die ehemalige Begräbnisstätte. Gedenkstein oder
Hinweistafel sind nicht vorhanden.
Fotos:
(Peter Zeese, Laage, Aufnahmedatum: 23.12.2004)
 |
 |
| Blick auf den
Scheibenberg in Laage, wo heute keine Spuren des Friedhofes mehr zu finden
sind. |
Lage: Etwa 1 km vom Stadtzentrum entfernt in der Nähe des
Reitplatzes auf dem Scheibenberg.
Link: Website der Stadt Laage
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Laage
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur S. 36f; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg S. 444.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Laage S. 218-219.
Der obige Abschnitt wurde erstellt mit Hilfe von Angaben von Peter Zeese, Laage.
Lassan (Amt Ziethen, OVP)
Zur Geschichte des Friedhofes: Über die Geschichte des
jüdischen Friedhofes ist wenig bekannt. Der Friedhof wurde in der NS-Zeit oder
danach zerstört und abgeräumt. Da er nicht eingezäunt und von Ackerflächen
umgeben war, verlor er von 1965 bis 1980 durch Abackerung ständig an Größe.
Jahrelange Bemühungen beim Rat der Stadt, den Friedhof zu einer Gedenkstätte
zu erklären und zu sichern, blieben erfolglos. Grabsteine sind nicht mehr
vorhanden. Um 1990 wurde der Friedhof als Weidekoppel benutzt.
Lage: Der Friedhof liegt südwestlich von Lassan. Von der Straße
in Richtung Anklam zweigt nach links ein Feldweg ab, der sich gabelt. Der rechte
Teil der Weggabelung führt zum Friedhof, der sich rechts von diesem Weg
befindet.
Link: Website
des Amtes Ziethen
Literatur: Brocke/Ruthenberg/Schulenburg S. 446.
Ludwigslust (LWL)
Zur Geschichte des Friedhofes: Der jüdische Friedhof in
Ludwigslust wurde vermutlich bereits Ende des 18. Jahrhunderts angelegt. Er
wurde in der NS-Zeit zerstört und eingeebnet. Das Grundstück wurde 1944 mit einem Wohnhaus bebaut.
Erhalten blieb ein Teil der alten Friedhofsmauer. 1962 wurde hier eine kleine Gedenkstätte errichtet.
Lage: Laascher Weg 4

|
Lage des jüdischen Friedhofes
in Ludwigslust auf dem dortigen Stadtplan:
links anklicken: der Link zeigt die Lage des "Laascher Weges" an
(der Friedhof ist
nicht eingetragen) |
Link: Website der
Stadt Ludwigslust
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Ludwigslust
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur S. 37-38; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Ludwigslust S. 222-223.
Lübz (PCH)
Zur Geschichte des Friedhofes: Der jüdische Friedhof in
Lübz wurde möglicherweise noch im 18. Jahrhundert angelegt. Der älteste
erhaltene Stein ist von 1839, der jüngste von 1924. Noch bis 1934 soll der
Friedhof belegt worden sein. Der Friedhof ging (schon 1916?) an die Stadt über. Er wurde in der
NS-Zeit nicht zerstört. Die Friedhofsfläche umfasst etwa 7,80 ar. Es sind
heute noch etwa 20 Grabsteine erhalten, die 1989 flach auf den Rasen gelegt
wurden.
Lage: Schützenstraße (ehemals Werner-Seelenbinder-Straße) 31.
Link: Website
der Stadt Lübz
Wikipedia-Artikel
"Jüdischer Friedhof (Lübz)"
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Luebz
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur S. 38; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S. 484.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Lübz S. 220-221.
Lychen (UM)
Zur Geschichte des Friedhofes: Wann der jüdische Friedhof in
Lychen angelegt wurde, ist nicht bekannt. Die Geschichte der Juden in der Stadt
geht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Der Friedhof wurde im November 1938 durch
Nationalsozialisten zerstört, sodass nur der kahle Hügel übrig blieb. Seit
1988 erinnert ein Gedenkstein unter einer uralten Eiche (Naturdenkmal) auf dem Hügel
an den Friedhof.
Lage: Vor dem Stargarder Tor im Norden der Altstadt, direkt am
Oberpfuhl, auf einem Hügel.
Link: Website
der Stadt Lychen
Literatur: Brocke/Ruthenberg/Schulenburg S. 485.
Malchin (DM)
 Zum Friedhof in Malchin besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Malchin besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Malchow (MÜR)
 Zum Friedhof in Malchow besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Malchow besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Marlow (NVP)
Zur Geschichte des Friedhofes: In Marlow gab es einen jüdischen
Friedhof, von dem nichts mehr erhalten ist. Er soll bereits in den 1920er-Jahren
"verschwunden" sein, was jedoch ungewöhnlich wäre. Vermutlich wurde
er in der NS-Zeit abgeräumt und eingeebnet. Das Grundstück wurde bebaut. Nach
Angaben von Ortsansässigen wurden in dem Fundament des Hauses einzelne
Grabsteine verbaut. Äußerlich sind keine Hinweise mehr auf den Friedhof
vorhanden.
Lage: "An einem öffentlichen Weg etwa 7-8 Min. vom
Rathaus entfernt" (Auskunft 1989).
Link: Website
der Stadt Marlow
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Marlow
Literatur: Brocke/Ruthenberg/Schulenburg S. 498.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Marlow S. 228: "In Marlow gab es weder eine Synagoge noch
einen jüdischen Friedhof".
Mirow (MST)
Zur Geschichte des Friedhofes: Der jüdische Friedhof wurde
möglicherweise um 1800 angelegt. In der NS-Zeit wurde er zerstört, die
Grabsteine abgeräumt. Ende der 1950er Jahre wurde auf dem Grundstück von der Jüdischen Landesgemeinde Mecklenburg unter
einer Baumgruppe ein Gedenkstein errichtet (großer Findling mit Aufschrift). Bis
in die 1960er-Jahre wurde das Grundstück gepflegt. In den folgenden 20 Jahren
ist es immer mehr verwahrlost. Ein daneben befindlicher Kfz-Betrieb verwendete
einen Teil des Friedhofes als Lagerplatz und hat dafür die Anhöhe teilweise
abgebaggert.
Nach Angaben von Einwohner von Mirow gab es am Ort noch einen
weiteren jüdischen Friedhof (Auskunft 1988).
Lage: An der Lärzer Straße gegenüber Haus Nr. 5 auf einer Anhöhe.
Link: Website
der Stadt Mirow
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Mirow
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur S. 39; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S. 502-503.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Mirow S. 229-230.
Neubrandenburg (NB)
 Zum Friedhof in Neubrandenburg besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Neubrandenburg besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Neubukow (DBR)
 Zum Friedhof in Neubukow besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Neubukow besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Neukalen (DM)
 Zum Friedhof in Neukalen besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Neukalen besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Neustadt-Glewe (LWL)
(Jüdischer Friedhof und KZ-Friedhof)
 Zum Friedhof in Neustadt-Glewe besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Neustadt-Glewe besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Neustrelitz (MST)
(Altstrelitz und Neustrelitz)
 Zu den Friedhöfen in Altstrelitz und Neustrelitz besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zu den Friedhöfen in Altstrelitz und Neustrelitz besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Parchim (PCH)
Zur Geschichte der jüdischen Friedhöfe: In Parchim bestand
bereits ein mittelalterlicher jüdischer Friedhof, der im 12. Jahrhundert
angelegt wurde und vermutlich nach einer Judenverfolgung in der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts zerstört wurde. Mindestens 36 Steine wurden beim Bau der
St. Marienkirche verwendet und können dort großenteils noch besichtigt
werden (teilweise mit Inschriften). Ein Grabstein (von 1334) wurde als
Eingangsschwelle in die Kirche verwendet. Weitere Grabsteine (von 1328 und 1341)
wurden in den 1920er-Jahren bei Dammarbeiten vor dem Kreuztor gefunden und auf
dem (neuen) jüdischen Friedhof aufgestellt.
Ein neuer jüdischer Friedhof wurde Ende des 17. Jahrhunderts angelegt.
Dieser wurde mehrfach erweitert und umfasste zuletzt eine Fläche von ca. 22 ar.
Bis 1938 wurden Beisetzungen vorgenommen. In den Jahren bis 1945 wurde der
Friedhof völlig zerstört, die Gräber aufgewühlt, Särge lagen an der Oberfläche.
1947 wurde die Fläche notdürftig hergerichtet, das Erdreich abgetragen und eingeebnet. Sieben Grabsteine und einige Bruchstücke konnten noch
aufgestellt werden. Da das Gelände aber nicht mehr als Friedhof betrachtet
werden konnte, überließ die Jüdische Landesgemeinde Mecklenburg die Fläche
der Stadt zur Erweiterung der angrenzenden Badeanstalt. Dafür wurde ein Areal
auf dem Städtischen Friedhof der jüdischen Gemeinde zur Verfügung gestellt,
wohin einige Grabsteine überführt wurden. Hier wurde im Juni 1971 auf eine
Gedenkstätte für die ermordeten Juden errichtet.
Lage: Mittelalterlicher Friedhof: zwischen dem Kreuztor und den
Plümmerwiesen (heute Flörkestraße 44).
Neuer Friedhof (seit Ende 17. Jahrhundert)
am Voigtsdorfer Weg westlich des Wockersees.
 |
Ungefähr Lage der jüdischen Friedhofes
in Parchim auf dem dortigen Stadtplan: links anklicken und
im
Straßenverzeichnis weiter zu "Flörkestraße" (für
mittelalterlichen jüdischen Friedhof) bzw. zum
"Voigtsdorfer
Weg" (Friedhof seit Ende 17. Jahrhundert: der Friedhof lag bei der
heutigen Badeanstalt). |
Link: Website der
Stadt Parchim
Wikipedia-Artikel
"Jüdischer Friedhof (Parchim)"
Literatur: Germania Judaica II,2 S. 1086; Zeugnisse jüdischer Kultur S.
44-45; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S. 541-544.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Parchim S. 242-244.
Pasewalk (UER)
Zur Geschichte des Friedhofes: Der jüdische Friedhof in Pasewalk
wurde vermutlich Anfang des 19. Jahrhunderts angelegt. Eine Friedhofshalle wurde
auf dem Grundstück erstellt. Der Friedhof wurde bis 1938 belegt. In den
folgenden Jahren wurde der Friedhof völlig zerstört und abgeräumt, die
Friedhofshalle niedergebrannt. 1947 ließ die Jüdische Landesgemeinde
Mecklenburg mit Hilfe von Spenden einiger in die USA emigrierten ehemaliger
Juden aus Parchim einen großen Gedenkstein mit der hebräischen und deutschen
Inschrift "Zur Erinnerung an den jüdischen Friedhof" aufstellen. Ende
der 1980er-Jahre wurde der Friedhof wieder mit einer Mauer umgeben. Einige
aufgefundene Grabsteine wurden in die Mauer eingefügt.
Fotos
vom Eingangstor und der Gedenktafel
(Fotos von Marc Snow, Pasewalk,
Aufnahmen von April 2018) |
 |
 |
Lage: Der Friedhof liegt am Rande der Stadt beim alten städtischen
Friedhof (Löcknitzer Straße)

|
Lage des jüdischen Friedhofes
in Pasewalk auf dem dortigen Stadtplan: links anklicken und unter
"Einrichtungen" weiterklicken zu
"Alter Friedhof" (der jüdische Friedhof lag
bzw. liegt am alten
städtischen Friedhof) |
Link: Website der
Stadt Pasewalk
Informationsseite zur jüdischen Geschichte von Pasewalk mit Fotos auf der
Website des Vereins Land und Leute e.V. (unter >Orte jüd. Geschichte): hier
anklicken
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur S. 45-46; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S. 544-545;
E. Krüger: Über Juden in Pasewalk nach 1933. In: Der
faschistische Pogrom vom 9.(10. November 1938 - zur Geschichte der Juden in
Pommern. 1989 S. 124-125.
Penkun
(UER)
Zur Geschichte des Friedhofes: Über die Geschichte des
jüdischen Friedhofes in Penkun ist nur wenig bekannt. 1952 war er ungepflegt,
fast zugewachsen und mit einer Hecke umgeben. Damals waren noch Grabsteine aus
schwarzem Granit vorhanden. In der Folgezeit wurde das Friedhofsgrundstück
eingeebnet und dem Sportplatz einverleibt. Die Grabsteine verschwanden.
Lage: Südlich der Stadt am Wartiner Weg.
Link: Website
der Stadt Penkun
Literatur: Brocke/Ruthenberg/Schulenburg S. 546.
Penzlin (MÜR)
Zur Geschichte des Friedhofes: Der Friedhof wurde vermutlich
Mitte des 18. Jahrhundert angelegt, nachdem sich seit 1746 Juden in der Stadt
niederlassen konnten. Die letzte Beisetzung war im November 1923. Es sind acht
Gräberreihen zu erkennen. Insgesamt sind etwa 55 Grabsteine erhalten. Die
Friedhofsfläche umfasst 7,00 ar.
Lage: Am südwestlichen Stadtrand "Am Ziegelkamp" in
einer Kleingartenanlage.
Link: Website
der Stadt Penzlin
Wikipedia-Artikel
"Jüdischer Friedhof (Penzlin)"
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur S. 46; Brocke/Müller:
Haus des Lebens S. 205; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg S. 546-548;
Karl-Heinz Oelke: Auf den Spuren jüdischer Vergangenheit im Müritzkreis.
1998.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Penzlin S. 244-245.
Plau am See (PCH)
 Zum Friedhof in Plau am See besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Plau am See besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Rehna
(NWM)
Zur Geschichte des Friedhofes: Über die Geschichte des
jüdischen Friedhofes in Rehna ist nur wenig bekannt. Der Friedhof wurde
vermutlich noch in der NS-Zeit oder kurze Zeit danach abgeräumt. Steine vom
jüdischen Friedhof wurden als Treppenstufen und Schwellsteine zweckentfremdet,
insbesondere vor einer
Gastwirtschaft am Markt.
Quelle: hier
anklicken
Lage: Nördlich der Stadt am Ortsausgang Richtung
Vitense (an der Straße "Neuer Steinweg", früher "Langer
Jammer").
Text: Über eine Beisetzung auf dem jüdischen Friedhof in
Rehna am 9. November 1894 mit näheren Informationen zur Geschichte der
jüdischen Gemeinde Rehna, dem Friedhof und der Synagoge
 Artikel
in der
Zeitschrift "Der Israelit" vom 22.11.1894): "Rehna, 9. Nov.
Auf dem hiesigen israelitischen Friedhofe wurde heute die im hohen Alter von 88
Jahren verstorbene Frau Itzig beerdigt. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt,
dass die hiesige israelitische Gemeinde vor Jahren eine große Gemeinde mit
eigener Schule und eigener Synagoge gewesen ist. Zu der Gemeinde, die jetzt nur
noch aus 2 Familien in Rehna und 3-4 Familien in Gadebusch besteht, gehörten ursprünglich
auch noch die Glaubensgenossen in dem benachbarten Grevesmühlen, welch'
Letztere sich vor ungefähr 20 Jahren eine eigene Gemeinde gebildet haben.
Nachdem die hiesige Gemeinde in Folge Fortzuges und Tod vieler Mitglieder nach
und nach viel kleiner geworden und daher die Kosten für die Unterhaltung des
Religionslehrers und die Instandhaltung der Synagoge nicht mehr aufgebracht
werden konnten, wurde die letztere vor 10 Jahren öffentlich meistbietend auf
Abbruch verkauft. Die Bundeslade und sonstige Heiligtümer sind mit einer
Urkunde über die Veranlassung auf dem Friedhofe versenkt worden. Der kleinen
Gemeinde gehört jetzt nur noch der mit einer Ziegelsteinmauer umgebene
Friedhof, sowie das neben demselben gelegene Wärterhaus, in dessen Anbau auch
der Leichenwagen untergebracht ist." Artikel
in der
Zeitschrift "Der Israelit" vom 22.11.1894): "Rehna, 9. Nov.
Auf dem hiesigen israelitischen Friedhofe wurde heute die im hohen Alter von 88
Jahren verstorbene Frau Itzig beerdigt. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt,
dass die hiesige israelitische Gemeinde vor Jahren eine große Gemeinde mit
eigener Schule und eigener Synagoge gewesen ist. Zu der Gemeinde, die jetzt nur
noch aus 2 Familien in Rehna und 3-4 Familien in Gadebusch besteht, gehörten ursprünglich
auch noch die Glaubensgenossen in dem benachbarten Grevesmühlen, welch'
Letztere sich vor ungefähr 20 Jahren eine eigene Gemeinde gebildet haben.
Nachdem die hiesige Gemeinde in Folge Fortzuges und Tod vieler Mitglieder nach
und nach viel kleiner geworden und daher die Kosten für die Unterhaltung des
Religionslehrers und die Instandhaltung der Synagoge nicht mehr aufgebracht
werden konnten, wurde die letztere vor 10 Jahren öffentlich meistbietend auf
Abbruch verkauft. Die Bundeslade und sonstige Heiligtümer sind mit einer
Urkunde über die Veranlassung auf dem Friedhofe versenkt worden. Der kleinen
Gemeinde gehört jetzt nur noch der mit einer Ziegelsteinmauer umgebene
Friedhof, sowie das neben demselben gelegene Wärterhaus, in dessen Anbau auch
der Leichenwagen untergebracht ist." |
Link: Website des Amtes
und der Stadt Rehna
Literatur: Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S. 572-573.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Rehna S. 248-249.
Reuterstadt Stavenhagen (DM)
 Zum Friedhof in Stavenhagen besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Stavenhagen besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Ribnitz-Damgarten
(NVP)
 Zum Friedhof in Ribnitz-Damgarten besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Ribnitz-Damgarten besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Röbel (MÜR)
 Zur Geschichte des Friedhofes: Die
jüdische Gemeinde von Röbel hatte möglicherweise bereits im Mittelalter,
spätestens seit der Zeit um 1700 einen eigenen Friedhof (1702 wird ein
"Juden-Kirchhof" genannt). Die Fläche des auf einem kleinen Hügel
gelegenen Begräbnisplatzes umfasste etwa 9 ar. Die letzten Beisetzungen waren
1937/38. In der NS-Zeit wurde der Friedhof zerstört; die meisten Grabsteine an
einen örtlichen Steinmetzen verkauft. In den 1960er-Jahren wurde der Friedhof
beim Bau einer Tankstelle beseitigt, der kleine Hügel des Begräbnisplatzes
wurde teilweise abgebaggert. 2002 wurde das Grundstück durch Initiative
"Vereins "Land und Leute e.V." mit Stelen markiert, die
jedoch wenig später zerstört wurden. Zur Geschichte des Friedhofes: Die
jüdische Gemeinde von Röbel hatte möglicherweise bereits im Mittelalter,
spätestens seit der Zeit um 1700 einen eigenen Friedhof (1702 wird ein
"Juden-Kirchhof" genannt). Die Fläche des auf einem kleinen Hügel
gelegenen Begräbnisplatzes umfasste etwa 9 ar. Die letzten Beisetzungen waren
1937/38. In der NS-Zeit wurde der Friedhof zerstört; die meisten Grabsteine an
einen örtlichen Steinmetzen verkauft. In den 1960er-Jahren wurde der Friedhof
beim Bau einer Tankstelle beseitigt, der kleine Hügel des Begräbnisplatzes
wurde teilweise abgebaggert. 2002 wurde das Grundstück durch Initiative
"Vereins "Land und Leute e.V." mit Stelen markiert, die
jedoch wenig später zerstört wurden.
Lage: Friedrich-Engels-Straße im Bereich der
Tankstelle/Gewerbegebiet.
Link: Schul-Film-Projekt
"Juden in Röbel": Zwei Filme der Dokumentarfilmgruppe des
Joliot-Curie-Gymnasiums Röbel unter Leitung und Mitarbeit von Raimund Schneider
vom Verein Land & Leute e.V. Röbel 2002-2003.
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Roebel_Mueritz
Website des
Vereins
Land und Leute e.V. Röbel mit mehreren Seiten und Abbildungen zur
Geschichte des Friedhofes (Skizze oben von dieser Seite), inzwischen auf
Website
http://www.engelscherhof.de/index.php/juedische-spuren, zum Friedhof http://www.engelscherhof.de/index.php/10-archiv/9-friedhof
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur S. 49; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S. 576-578.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Röbel S. 251-252.
Rossow (VG)
Zur Geschichte des Friedhofes: Im
Mai 1793 erhielten die in Rossow lebenden jüdischen Familien auf ihren Antrag
hin die Erlaubnis zur Anlegung eines "Kirchhofs von 2 Ruthen auf dem Rossower
Felde und [diesen] so lange noch Juden zu Rossow geduldet werden, zu behalten".
Möglicherweise gab es bereits zuvor einen älteren jüdischen Friedhof am Ort. Der
Friedhof wurde bis Mitte des 19. Jahrhunderts belegt; 1854 wurde die jüdische
Gemeinde aufgelöst. 1856 kaufte der Röbeler Kaufmann Moritz den Friedhof mit
Zustimmung des Amtes Wredenhagen, um ihn für die Zukunft zu sichern. Um 1920
wird der Friedhof als verfallen bezeichnet. Um 1950 sollen noch etwa 30 Gräber
sichtbar gewesen sein. Eine amtliche Erhebung im Jahr darauf konnte dies jedoch
nicht bestätigen. 1989 sollen noch Reste von zwei Grabsteinen vorhanden gewesen
sein. Heute ist der Friedhof noch als Grundstück von 2,17 ar im Grundbuch
eingetragen, jedoch nicht mehr als Friedhof erkennbar.
Lage: Bahnhofstraße.
Link:
Website des Amtes Löcknitz-Penkun
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Rossow
Literatur: Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar:
Juden in Mecklenburg 1845-1945. Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch.
Schwerin 2019. Band 1. Texte und Übersichten. Zu Röbel S. 253.
Rostock (HRO)
 Zu den Friedhöfen in Rostock besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zu den Friedhöfen in Rostock besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Schwaan (LRO)
 Zum Friedhof in Schwaan besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Schwaan besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Schwerin (SN)
 Zu den Friedhöfen in Schwerin besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zu den Friedhöfen in Schwerin besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Sternberg (Amt Sternberger Seenlandschaft,
PCH)
Zur Geschichte des Friedhofes: Der jüdische Friedhof liegt am
Fuße des sogenannten "Judenberges", auf dem 1492 27 Juden von
Sternberg auf Grund von falschen Beschuldigungen ermordet wurden.
1824 wurde der Friedhof der seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
entstandenen jüdischen Gemeinde Sternbergs angelegt. Er wurde bis in die
1920er-Jahre belegt. Die Friedhofsfläche umfasst etwa 5 ar. In der NS-Zeit
wurde der Friedhof zerstört. Nach 1947 ließ die Jüdische Landesgemeinde das
Gelände wieder herrichten und einen Gedenkstein setzen. Grabsteine sind nicht
mehr erhalten.
Lage: Der Friedhof liegt am nordwestlichen Stadtrand auf einem
Hügel (Judenberg) am Waldrand zwischen der Eisenbahnlinie/Bahndamm
Sternberg-Brüel und einem dortigen Campingplatz.
Link: Website der
Stadt Sternberg
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Sternberg
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur S. 65-66; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S. 619-620.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Sternberg S. 268-269.
Stralsund (HST)
 Zum Friedhof in Stralsund besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Stralsund besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Strasburg/Uckermark
(UER)
Zur Geschichte des Friedhofes: Der
jüdische Friedhof stammt aus der Zeit vor 1880. Die Fläche des Friedhofes
beträgt etwa 5,00 ar. Es sind noch 19 Grabsteine
vorhanden.
Ende Juni 2002 stoßen Unbekannte elf Grabsteine auf dem jüdischen
Friedhof um.
Lage: An der Bahnhofstraße am Stadtwald auf dem
Sinaihügel.
Link: Website
der Stadt Strasburg/Uckermark
Wikipedia-Artikel
"Jüdischer Friedhof (Strasburg, Uckermark)"
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur ; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S.
Sülstorf (LWL)
(erstellt nach Hinweisen von Mike Redel,
Unna)
Zur Geschichte des Friedhofes: siehe http://www.gemeinde-suelstorf.de/verzeichnis/visitenkarte.php?mandat=172025
Lage: Auf der Straße von Ludwigslust nach
Schwerin kommt auf der linken Seite ein Hinweisschild "Sült-Gedenkstätte".
Etwa 1-2 km hinter der Ortschaft Sült steht rechter Hand ein Hinweisschild
"Sülstorf-Gedenkstätte". Der anfangs gut ausgebaute Feldweg wird
hinterher zur Bahnhofstraße. Bis zum Ende durchfahren. Rechter Hand ist der
Bahnhof von Sülstorf. Beim Bahnhof parken - über die Gleise - hier liegt
gut sichtbar die Gedenkstätte.
Link: Website
der Gemeinde Sülstorf
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur ; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S.
Sundhagen-Niederhof
(NVP)
 Zum Friedhof in Niederhof besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Niederhof besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Tessin bei Rostock (DBR)
Zur Geschichte des Friedhofes: Die
Toten der jüdischen Gemeinde wurden zunächst in
Neubukow beigesetzt. Ein jüdischer Friedhof in Tessin
wurde 1821 angelegt (Größe zunächst 7 ar) und 1851-53 erweitert. Der Friedhof
wurde mit einer Feldsteinmauer umgeben, die immer wieder renoviert wurde. In der NS-Zeit wurde
der Friedhof mehrfach geschändet und verwüstet; insbesondere der vordere Teil
der Feldsteinmauer wurde eingerissen. Auch nach 1945 wurde der Friedhof
geschändet. Sein Zustand hat sich ständig verschlechtert. !987 wurden mit
Zustimmung der jüdischen Landesgemeinde Mecklenburg Reste von Grabsteinen
geborgen und mit einem bereits vorhanden Gedenkstein zum jüdischen Friedhof
Rostock gebracht. Möglicherweise wurden dabei auch die Überreste der Bestatteten
exhumiert. Im Sommer 1992 wurde der Friedhof wieder -
soweit möglich - rekonstruiert. Der nach Rostock verbrachte Gedenkstein wurde
zurückgebracht. Der 1988 abgetragene vordere Teil der Feldsteinmauer wurde durch
eine rote Ziegelsteinmauer mit eisernem Tor ersetzt. Grabsteine sind nicht mehr
vorhanden.
Lage: Etwa zwei Kilometer außerhalb der Stadt in Richtung Cammin
(Camminer Straße bzw. Fortsetzung der St.-Jürgen-Straße) am
Recknitztal bzw. am südlichen Prangenberg.
Link: Website der
Stadt Tessin bei Rostock
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Tessin
Literatur: Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S. 636-637.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Tessin S. 273-274.
Teterow (GÜ)
 Zum Friedhof in Teterow besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof in Teterow besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Ueckermünde (UER)
 Zu den Friedhöfen in Ueckermünde besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zu den Friedhöfen in Ueckermünde besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Waren (Müritz)
(MÜR)
Zur Geschichte des Friedhofes: Die jüdische Gemeinde in der
Stadt legte um 1800 einen Friedhof an und konnte ihn im Januar 1846 durch den
Erwerb weiterer Grundstücke vergrößern. Bis in
die NS-Zeit wurden auf ihm Beisetzungen vorgenommen. Allerdings wirkte der
Friedhof bereits um 1932 nach Schändungen (Umstoßen von Grabsteinen) "sehr
verwahrlost". Beim Novemberpogrom 1938 wurde der Friedhof von
Nationalsozialisten zerstört. Eine letzte Beisetzung erfolgte 1939. 1941 bemühte
sich die Stadt um einen Erwerb des Friedhofes zur künftigen Bebauung. Geplant
war damals die anlage eines Neubaugebietes zwischen Federower Weg, Nesselberg
und Papenbergstraße für etwa 4000 Einwohner. Im September 1948 wurde der Friedhof wieder
hergerichtet, möglicherweise waren bereits damals keine Grabsteine mehr
vorhanden. Seit 1960 ist das Grundstück zu einer parkähnlichen Anlage
umgestaltet worden, in deren Mitte eine Travertinstele mit Inschrift steht.
Lage: Bereich Papenbergstraße/Feldstraße.

|
Ungefähre Lage des jüdischen Friedhofes
in Waren (Müritz) auf dem dortigen Stadtplan:
links anklicken:
der Friedhof liegt an der Feldstraße. |
Link: Website der
Stadt Waren (Müritz)
Wikipedia-Artikel
"Jüdischer Friedhof (Waren)"
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Waren_Mueritz
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur S. 73; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S. 652-654.
Karl-Heinz Oelke: Auf den Spuren jüdischer Vergangenheit im Müritzkreis.
1998.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Waren S. 277-278.
Warin (NWM)
Zur Geschichte des Friedhofes: Der jüdische Friedhof wurde von
der am Ort bestehenden kleinen jüdischen Gemeinde vermutlich im 18. Jahrhundert
angelegt. Es wurden etwa 70-80 Beisetzungen vorgenommen. Die Friedhofsfläche
umfasst etwa 16 ar. Nachdem die Gemeinde Anfang des 20. Jahrhunderts aufgelöst wurde, war
der Friedhof bereits um 1930 in schlechtem Zustand; die Umzäunung
zeigte starke Beschädigungen. In der NS-Zeit wurde der Friedhof verwüstet.
Nach 1945 ist der Platz eingeebnet worden. 1962 richtete die Jüdische
Landesgemeinde eine Gedenkstätte her. Ein 1963 gesetzter Naturstein trägt die
Aufschrift "Die Toten mahnen". Grabsteine sind nicht mehr vorhanden. Eine
Fläche von 6,25 ar ist durch angehäufelte Erde eingegrenzt.
Lage: Am Zahrensdorfer Weg auf einer bewaldeten Anhöhe, etwa 300 m
westlich des Wariner Stadtrandes zwischen dem Ortsteil Waldheim und der Straße
nach Ventschow.
Link: Website
der Stadt Warin
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Warin
Literatur: Zeugnisse jüdischer Kultur S. 73; Brocke/Ruthenberg/Schulenburg
S. 654-655.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Warin S. 279-280.
*Wismar (HWI)
Zur Geschichte jüdischer Begräbnisstätten: In Wismar gab es
keinen jüdischen Friedhof. Die Toten der hier von 1868 bis in die NS-Zeit
lebenden jüdischen Familien wurden auf umliegenden jüdischen Friedhöfen
beigesetzt, insbesondere in Neubukow und
Bützow.
Möglicherweise gab es einzelne Beisetzungen auf dem sogenannten
"Soldatenfriedhof". Dieser war 1698 als Begräbnisstätte für die
schwedische Garnison angelegt worden. Nach 1803 wurden hier auch die Toten der
mecklenburgischen Truppen, Tote anderer Nationen, aber auch Zivilpersonen,
schließlich deutsche Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkrieges beigesetzt.
Anfang der 1970er-Jahre wurde der Soldatenfriedhof eingeebnet und auf dem
Gelände ein Park angelegt. 1993 wurde der Friedhof als Gedenkstätte wieder
hergerichtet.
Lage: An der Rostocker Straße
Link: Website
der Hansestadt Wismar
Der Soldatenfriedhof wird in der Liste der jüdischen Friedhöfe der
International Association of Jewish Genealogical Societies (Cemetery Project)
genannt: hier
anklicken
Literatur: Geschichte von Juden in Wismar: Gustav Willgeroth: Bilder
aus Wismars Vergangenheit. 1908 S. 68-69; keine Nennung des Friedhofes in
"Zeugnisse jüdischer Kultur"; allgemein zum "Soldatenfriedhof:
Hansestadt Wismar (Hg.): Der denkmalgeschützte Friedhof der Hansestadt Wismar;
Brocke/Ruthenberg/Schulenburg S. 664-665.
Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Wismar S. 281.
Wittenburg (LUP)
Zur Geschichte des Friedhofes: Die
Toten der jüdischen Gemeinde wurden zunächst auf dem jüdischen Friedhof in
Schwerin beigesetzt, nach 1806 in Hagenow.
Ein jüdischer Friedhof in Wittenburg wurde 1858 nach dem Kauf eines Ackerstückes
an der Chaussee nach Lehsen neben dem Schäferbruch-Park und dem Park gegenüber
dem christlichen Friedhof angelegt. 1916 ging er nach Auflösung der jüdischen
Gemeinde Wittenburg in das Eigentum der Israelitischen Landesgemeinde über. 1938
wollte der Bürgermeister den Friedhof bereits abräumen und das Grundstück
überbauen. Im Verlauf der NS-Zeit wurde der Friedhof geschändet.
Im März 1944 wurde der Friedhof Eigentum der Reichsvereinigung der Juden in
Deutschland und im November 1944 wurde er von der Reichsfinanzverwaltung an die
Stadt verkauft. Nach 1945 waren noch Reste von Grabsteinen erhalten. Nach 1949
wurde der Friedhof abgeräumt und schließlich eingeebnet. Das Gelände wurde bis
1989 durch eine Gärtnerei genutzt. 2014 wurde der Friedhofscharakter
wiederhergestellt. Es wurden drei Gedenksteine aufgestellt.
Lage: an der Lehsener Chaussee (früher:
Chausseestraße).
Link:
Website des Amtes Wittenburg
Website "Juden in Mecklenburg"
http://www.juden-in-mecklenburg.de/Friedhoefe/Juedischer_Friedhof_Wittenburg
Literatur: Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in Mecklenburg 1845-1945.
Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Schwerin 2019. Band 1. Texte und
Übersichten. Zu Wittenberg S. 282-283.
Wöbbelin - KZ-Gedenkstätte
(LWL)
Zur Geschichte des Friedhofes: Ende 1944 ließ die
SS außerhalb von Wöbbelin das letzte Außenlager des KZ Neuengamme errichten.
Vom 12. Februar 1945 bis zum Tag der Befreiung diente dieses KZ als Auffanglager
für Häftlinge aus 16 europäischen Nationen, die, vor den heranrückenden
alliierten Truppen evakuiert, auf "Todesmärschen" in Richtung Wöbbelin
getrieben wurden. Sie befanden sich in einem jammervollen Zustand, als sie dort ankamen.
Das Lager, unter den Bedingungen der letzten Kriegswochen eingerichtet, war nur
ein Provisorium, aber auch ohne Gaskammer und Massenexekutionen ein
Vernichtungslager. Bei kärglicher Ernährung und fast ohne medizinische
Versorgung starben die durch den Aufenthalt in anderen Lagern und die
Anstrengungen der Evakuierung ohnehin geschwächten Häftlinge zu Hunderten. Für
mehr als tausend der über fünftausend Häftlinge des KZ Wöbbelin -
Widerstandskämpfer, Nazigegner, aus rassischen oder weltanschaulichen Gründen
Verfolgte - kam die Befreiung am 2. Mai 1945 durch die 82. US -
Luftlandedivision zu spät. Sie waren auf Grund der unzureichenden hygienischen
Zustände im Lager und der unmenschlichen Behandlung durch die SS elend
zugrundegegangen. Ihre Leichen, in Massengräbern verscharrt oder achtlos auf
dem KZ - Gelände liegengelassen, wurden auf Befehl der amerikanischen Militärbehörden
durch die deutsche Bevölkerung in Ludwigslust (zwischen Schloss und
Stadtkirche), in Schwerin (am heutigen Platz der Opfer des Faschismus),
in Hagenow (am Krankenhaus) und in Wöbbelin (im Theodor Körner-Park)
zur letzten Ruhe gebettet. Alljährlich zum Tag der Befreiung des KZ Wöbbelin
kommen Menschen aus vielen europäischen Ländern, aus den USA und Israel nach Wöbbelin.
Ehemalige Häftlinge mit ihren Familien, Angehörigen der Verstorbenen und
Veteranen der 82. US - Luftlandedivision gedenken dann gemeinsam an den Gräbern
der KZ - Toten.
Wolgast (OVP)
 Zum Friedhof (?) in Wolgast besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Zum Friedhof (?) in Wolgast besteht eine Unterseite
(interner Link): hier anklicken
Allgemeine Literatur:
 | Zeugnisse jüdischer Kultur. Erinnerungsstätten in
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen und
Thüringen. Projektleitung: Kathrin Wolff. Gesamtredaktion: Cordula Führer.
Berlin 1992. |
 | Michael Brocke/Eckehart Ruthenberg/Kai Uwe Schulenburg:
Stein und Name. Die jüdischen Friedhöfe in Ostdeutschland (Neue
Bundesländer/DDR und Berlin). Berlin 1994. |
 | Irene Diekmann: Wegweiser durch das jüdische Mecklenburg-Vorpommern.
1998. |
 | Michael Brocke/Christiane E. Müller: Haus des Lebens.
Jüdische Friedhöfe in Deutschland. Leipzig 2001. |
 | Norbert Francke / Bärbel Krieger: Schutzjuden in
Mecklenburg. Ihre rechtliche Stellung Ihr Gewerbe Wer sie waren und wo sie
lebten. Hrsg. vom Verein für jüdische Geschichte und Kultur in Mecklenburg
und Vorpommern e.V. Schwerin 2002.
Online
eingestellt (Website von Norbert Francke) bzw.
hier
eingestellt. |
 | Wolfgang Wilhelmus: Juden in Vorpommern. Reihe
Beiträge zur Geschichte Mecklenburg-Vorpommern Nr. 8. Hrsg. von der
Friedrich-Ebert-Stiftung - Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern. Schwerin 2007
(3. überarbeitete und erweiterte Fassung).
Online
eingestellt bzw.
hier
eingestellt. |
 | Heidemarie Gertrud Vormann: Bauhistorische Studien
zu den Synagogen in Mecklenburg. Dissertation TU Carolo-Wilhelmina
Braunschweig 2009/2010. Erschienen 2012. Online zugänglich
https://publikationsserver.tu-braunschweig.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbbs_derivate_00022767/Diss_Vormann.pdf
|
 | Michael Buddrus / Sigrid Fritzlar: Juden in
Mecklenburg 1845-1945. Lebenswege und Schicksale. Ein Gedenkbuch. Unter
besonderer Mitarbeit von Ute Eichhorn / Angrit Lorenzen-Schmidt
/ Martin Wiesche. Insbesondere Band I: Texte & Übersichten.
Schwerin 2019. Bände wurden herausgegeben vom Institut für Zeitgeschichte
München - Berlin und der Landeszentrale für politische Bildung
Mecklenburg-Vorpommern. |
Allgemeine Links:
|