|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht
"Synagogen im Kreis Limburg-Weilburg"
Hadamar
(Kreis Limburg-Weilburg)
mit Thalheim (Gemeinde Dornburg) und Elz (beide Kreis Limburg-Weilburg)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Hadamar bestand eine jüdische
Gemeinde bis 1938/42. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17./18.
Jahrhunderts zurück. Bereits 1651 lebten acht jüdische Familien jüdische Personen in
Hadamar und Umgebung (1666 sieben Familien). Aus Hadamar stammte der
berühmte Arzt Jakob Hayum (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Hayum); er praktizierte bis zu einer
Niederlassung in Mannheim in seiner Heimatort Hadamar (gest. 1682).
Auch im 18. Jahrhundert war die jüdische Gemeinde Hadamar von Bedeutung,
zumal der Ort Sitz eines Rabbiners war (siehe unten). Zu Hadamar zählten auch
die in Thalheim lebenden jüdischen Personen (1807 eine Familie
mit 11 Personen, vgl. unten den Hilferuf von 1903 für eine in Thalheim
lebende arme jüdische Familie).
Genaue Zahlen zu den jüdischen Einwohnern in Hadamar liegen aus dem 19. Jahrhundert vor:
1807
wurden
11 jüdische Familien gezählt: 26 Erwachsene und 34 Kinder. 1842 lebten 15 jüdische Familien in der Stadt, in Thalheim
waren es inzwischen vier Familien. Die höchste Zahl jüdischer Einwohner wurde in
Hadamar 1885 mit
106 Personen erreicht (4,5 % von insgesamt 2.357 Einwohnern). 1887 werden
103 jüdische Gemeindeglieder gezählt, 1888 85, 1892 110 (in 25 Familien), 1896
100 (in 20 Familien), 1897 90 (von insgesamt 2244 Einwohnern, in 20 Familien),
1899 80 (in 18 Familien; dazu 15 Personen in Thalheim in 3 Haushaltungen unter
dem dortigen Vorsteher M. Rosenthal).
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebten die Juden in Hadamar
noch in sehr schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen. Ihren Lebensunterhalt
verdienten sie als Kleinhändler, Trödler oder als Viehhändler. Erst seit den
1830er-Jahren besserten sich die wirtschaftlichen Verhältnisse zumindest bei
einem Teil der jüdischen Familien, sodass an den Bau einer Synagoge gedacht
werden konnte (s.u.).
An Einrichtungen hatte die Gemeinde eine Synagoge, eine Religionsschule,
ein rituelles Bad und einen Friedhof.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Religionslehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (vgl.
Ausschreibungen der Stelle unten). 1843 wird als Teilnehmer einer
Lehrerkonferenz des Rabbinatsbezirkes Diez in Limburg
Lehrer Kahn aus Hadamar genannt (auch genannt in Berichten von 1847).
Um 1881 amtierte Lehrer Ostermann in Hadamar. Seit Dezember 1883 war Adolf Oppenheimer Lehrer in der Gemeinde: er
konnte 1908 sein 25-jähriges, 1923 sein 40-jähriges Ortsjubiläum in Hadamar
feiern (siehe Berichte unten). 1892/1896 unterrichtete er an der Religionsschule der Gemeinde
15 Kinder (1897 13 Kinder, 1899 10 Kinder). 1896 unterrichtete Oppenheimer auch
die damals 15 Kinder an der Religionsschule in
Schupbach (1897 13 Kinder, 1899 2 Kinder). Oppenheimer trat 1927 in den
Ruhestand und ist 1930 verstorben (siehe Bericht unten).
Die Gemeinde
gehörte im 18. Jahrhunderts zum Rabbinat Diez beziehungsweise bildete mit Diez
und anderen Gemeinden ein gemeinsames Rabbinat. Genannt werden dabei unter
anderem Rabbiner Israel ben Elieser Lipschütz (siehe unten) und Rabbiner Chajjim
ben Moses (siehe unten). Mitte des 19. Jahrhunderts verlegte Rabbiner Dr.
Wormser den Sitz des Rabbinats von Diez nach Hadamar. Er starb 1858. 1860 wurde
das Rabbinat Diez aufgelöst und dem Rabbinatsbezirk
Weilburg
zugeteilt. Der dortige Rabbiner Dr. Salomon Wormser (geb. 1814 in Limburg, gest.
1887 in Frankfurt); war bereits seit 1843 Bezirksrabbiner in Diez a.d. Lahn
und seit 1860 Bezirksrabbiner in Weilburg unter
Beibehaltung seiner Funktionen im Rabbinat Diez,
das nicht mehr besetzt wurde. 1880 trat er in den Ruhestand. In den 1920er-Jahren wurden die Rabbinatsbezirke Bad Ems und Weilburg
vereinigt.
Von den Gemeindevorstehern werden im 19. Jahrhundert genannt: um
1841/1842 Aron Salomon, um 1862/1874 Simon Wolf, um
1881/1888 H. Löwenstein, S. Stern, um 1892 L. Liebmann, H. Liebmann, W. Aron, um
1897 L. Liebmann, H. Liebmann, M. Rosenthal, um 1899 L. Liebmann und W. Aron.
Von den jüdischen Vereinen werden genannt: der Israelitische
Frauenverein (gegründet 1891, da 40-jähriges Bestehen 1931 s.u.; um 1892 unter Leitung von Frau Oppenheimer, der Frau von K.
Liebmann und der Frau von W. Aron; 1899 unter Leitung der Frau von Lehrer
Oppenheimer, der Frau von W. Aron und der Frau von H. Kahn, 1905 genannt als
Frauen-Wohltätigkeitsverein unter Leitung von Frau Oppenheimer), der
Israelitische Männerverein (1899 unter Leitung von J. Kahn, L. Rosenthal
sen., Lehrer Oppenheimer und M. Neuhaus; 1905 genannt als Chewra Gemiluth
Chessed - Männer-Wohltätigkeitsverein unter Leitung von J. Kahn), der
Verein zur Bekämpfung des Wanderbettels (1899 unter Leitung von L.
Liebmann).
1905 wurden 80 jüdische Gemeindeglieder gezählt (davon 14 in
Thalheim).
Im Ersten Weltkrieg fielen aus Hadamar die jüdischen Gemeindeglieder
Louis Honi (geb. 27. November 1886 in Ober Netphen, gef. 26. September 1914), Salomon
Kahn (geb. 20. Januar 1882 in Hadamar, gef. 17. Juni 1918), Arthur Liebmann
(geb. 28. Juli 1891 in Hadamar, gef. 8. Juli 1915) und Leopold Seligmann (geb.
21. Februar 1895 in Blessenbach, gef. 5. Oktober 1915).
Um 1925, als etwa 70-80 Personen zur jüdischen
Gemeinde gehörten (2,3 % von insgesamt etwa 3.000 Einwohnern), bildeten den
Gemeindevorstand die Herren Hermann Honi, Max Neuhaus und Hermann Aron. Als
Lehrer und Kantor wirkte Adolf Oppenheimer (gestorben 1930). Er unterrichtete
damals 7 schulpflichtige jüdische Kinder. An jüdischen Vereinen gab es
insbesondere :
den Männer-Wohltätigkeitsverein und den Frauen-Wohltätigkeitsverein.
Angeschlossen an die Gemeinde Hadamar waren auch die in Elz lebenden jüdischen
Personen. 1932 ist als Gemeindevorsteher nur Hermann Honi genannt.
Lehrer, Kantor und Schochet war inzwischen Carl Hartogsohn (aus
Emden, 1933 nach
Frankfurt, bis 1936 in Groß-Gerau). Im Schuljahr 1932/33 hatte er 14 jüdische
Kinder in Religion zu unterrichten.
Nach 1933 ist ein Teil der
jüdischen Gemeindeglieder (1933: 80 bis 100 Personen) auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. 15 verzogen innerhalb
Deutschlands, vor allem nach Frankfurt, einige konnten auswandern. Elf jüdische
Personen emigrierten nach Holland beziehungsweise nach Belgien. Drei von ihnen
wurden von dort aus verschleppt und deportiert. Beim Novemberpogrom 1938 wurden
jüdische Häuser und Wohnungen demoliert; ein Teil der jüdischen Männer wurde
in "Schutzhaft" genommen. Von September 1941 bis zum 10. Juni 1942
mussten die letzten jüdischen Einwohner Hadamars im Wohnhaus der Familie Kahn am
Neumarkt 8 (hier heute Gedenktafel) zusammenziehen. Dabei handelte es sich um
folgende Personen: Arthur Aron, zuletzt wohnhaft Ecke Neumarkt/Herzenbergweg,
Julius und Renate Honi, zuletzt wohnhaft Gymnasiumstraße 13, Frieda Kahn,
Neumarkt 8, Heymann und Hedwig, Irene und Brigitte Liebmann, zuletzt Schulstraße
25, Ferdinand und Ida Nachmann, zuletzt Schulstraße 25, Max und Irma und Ludwig
Nordhäuser, zuletzt Borngasse 21, Sigmund und Johanna und Bertha Rosenthal,
zuletzt Borngasse 34, Franziska und Otto Schönberg, zuletzt Siegener Straße 12
Julius und Berta Strauß, zuletzt Hammelburg 3. 1942 wurden die Bewohner des
Hauses in die Vernichtungslager deportiert.
Von den in
Hadamar geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945", ohne die jüdischen "Euthanasie"-Opfer):
Albert Aron (1871), Artur Aron (1892), David Einhorn (1932), Else Frank
geb. Rosenthal (1896), Brunhilde Honi (1925), Julius Honi (1886), Renate Honi geb. Nordhäuser (1891),
Johanna Jonas geb. Mange (1886), Betti Jüngster geb. Oppenheimer (1893), Frieda
Kahn geb. Strauss (1897), Helene (Hella) Kahn (1914), Max Kahn (1891), Moise Latinik (1898), Rosa Kahn (1898), Susanne Kahn (1928), Jenni
Katzenstein geb. Rosenthal (1877), Rebecca (Rica) Lebrecht geb. Rosenthal
(1880), Brigitte Liebmann
(1924), Emma Liebmann (1876), Ernst Liebmann (1894), Irma Liebmann geb. Isemberg (1896),
Leopold Liebmann (1882), Julie Ida Löwenwarter geb.
Salmony (1867), Rosalie Meyer geb. Siegel (1876), Ferdinand Nachmann (1877), Ida Nachmann geb. Hohenstein (1877),
Adolf Neuhaus (1892), Frieda Neuhaus (1893), Ilse Neuhaus (1924), Helene (Hela) Neuhaus geb. Kahn
(1914), Klara Neumann geb. Neuhaus (1890), Irma Nordhäuser geb. Neuhaus (1895), Ludwig Nordhäuser (1924), Max
Nordhäuser (1882), Hermann Oppenheimer (1868), Julius Reich (1909), Berta Rosenthal (1899),
Ellen Esther Rosenthal (1930), Hugo Rosenthal (1881), Johanna
Rosenthal geb. Eisenthal (1875), Siegmund Rosenthal (1867), Franziska Schönberg
geb. Strauss (1873), Leopold Schönberg (1877), Otto Schönberg (1907), Hilde
Stern (1904), Berta Strauss geb. Kron (1883), Eugen Strauss (1908), Hedwig
Strauss geb. Kahn (1894), Helmut
Strauss (1912), Julius Strauss (1875), Siegfried Winkelstein (1895).
Eine Verlegung von "Stolpersteinen" in Hadamar für die
Opfer der Shoa ist geplant (Stand: Mai 2014).
Aus Thalheim sind umgekommen: Paula Back geb. Hecht (1883), Moritz
Blumenthal (1879), Siegmund Blumenthal (1872), Flora Billa Cahn geb. Liebmann
(1895), Henriette Goldschmidt geb. Königsberger (1862), Hans Höfel (1927),
Albert David Kahn (1891), Max Rosenthal (1892), Robert Rosenthal (1888), Emmy
Strauss geb. Rosenthal (1894), Erna Treidel geb. Hecht
(1892).
Hinweis: es kommt in den Listen teilweise zu Verwechslungen mit Talheim
(Kreis Heilbronn) und Thalheim / Neidenburg / Ostpreußen.
Zu den "Euthanasie"-Verbrechen
in der ehemaligen Anstalt Hadamar, der über 10.000 Menschen zum Opfer fielen,
darunter auch viele jüdische Personen, siehe Website
der Gedenkstätte Hadamar
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte des Rabbinates
Nennung von Rabbiner Israel ben
Elieser Lipschütz (Rabbiner in Diez und Hadamar um 1749)
Hinweise zu den genannten Personen: Elieser ben Salman Lipschütz (aus
polnischer Rabbinerfamilie) starb nach 1750 als Landesrabbiner der
Untergrafschaft Wied in Neuwied. Er war der Vater von Israel Lazar(us)
Lipschütz (bzw. Israelit ben Elieser Lipschütz; gest. 1782 in Kleve, siehe
unten). Dieser wiederum hatte mehrere Söhne, die Rabbiner wurden: Gedalja
Lipschütz (geb. 1748 in Diez, wurde Rabbiner in
Emden, dann in polnischen Gemeinden, starb 1826 in Chodziesen, Provinz
Posen, Sohn:
https://de.wikipedia.org/wiki/Israel_Lipschitz).
Zu wichtigen Rabbiner-Persönlichkeiten aus der Lipschütz-Familie:
https://www.jewishencyclopedia.com/articles/10019-lipschutz-lupschutz-lipschitz-libschitz
Betr.: Rotterdam: von 1710 bis 1735 war Salomo ben Mordechai Lipschütz aus Lissa,
nachdem er zuvor Rabbiner im Haag gewesen war, als Rabbiner in Rotterdam tätig.
Ihm folgte sein Sohn Juda ben Salomon Lipschütz (genannt im Artikel), der 1754
starb
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_opperrabbijnen_van_Rotterdam.
 Artikel in "Bericht des Jüdisch-Theologischen Seminars Fraenckel'scher
Stiftung" (Breslau) 1870 S.
52: "BIBEL. DIE SPRÜCHE SALOMON'S. Salomons, von Elieser Hirsch. (Zwei
und 38 Blätter) Artikel in "Bericht des Jüdisch-Theologischen Seminars Fraenckel'scher
Stiftung" (Breslau) 1870 S.
52: "BIBEL. DIE SPRÜCHE SALOMON'S. Salomons, von Elieser Hirsch. (Zwei
und 38 Blätter)
Neuwied, Johann Balthasar Haupt, 1749. 4.
Approbation von Elieser ben Salomon Salman Lipschütz, Rabbiner in
Neuwied 1748, von Juda ben Salomon Lipschütz, Rabbiner in Rotterdam und von
Israel ben Elieser Lipschütz, Rabbiner in Diez und Hadamar..." |
Nennung von Rabbiner Israel Lazar
Lüpschütz (Lipschitz; Artikel von 1847)
Anmerkung: der genannte Sohn Salomon Lipschütz (1895-1803)
http://www.steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/bhr?id=1131&suchename=Lipsch%C3%BCtz
 Aus einem Artikel in "Der Orient" vom 21. Mai 1847: "Riga,
15. Januar (Fortsetzung). 52) Sefer Or Jisrael enthält verschiedene
Rechtsgutachten (Sche'elot uTeschuwot) von Rabbi Israel Lazar
Lüpschütz, ehemaligem Rabbiner zu Diez (nicht: Deutz),
Runkel und
Hadamar, woselbst er 22 Jahr als Rabbiner fungierte; dann Landrabbiner zu
Kleve, gedruckt in der neuen, soeben errichteten Druckerei zu Kleve, im
Jahre 1770, bei Baruch Elieser Lippmann Wiener, ehemaliger Druckergehilfe zu
Amsterdam, unter Regierung des Friedrich Wilhelm II, König von Preußen. 4.
120 Blatt. - Dieses Werk ist korrigiert durch den Sohn des Autors Schlomo...
(gemeint Rabbiner Salomon Lipschütz) und ist der Inhalt dieses Buches
zwar mehrere Sche'elot uTeschuwot; jedoch spielt die bedeutendste
Rolle in demselben die erste She'ela uTeschuwa über nachstehendes
Faktum..." Aus einem Artikel in "Der Orient" vom 21. Mai 1847: "Riga,
15. Januar (Fortsetzung). 52) Sefer Or Jisrael enthält verschiedene
Rechtsgutachten (Sche'elot uTeschuwot) von Rabbi Israel Lazar
Lüpschütz, ehemaligem Rabbiner zu Diez (nicht: Deutz),
Runkel und
Hadamar, woselbst er 22 Jahr als Rabbiner fungierte; dann Landrabbiner zu
Kleve, gedruckt in der neuen, soeben errichteten Druckerei zu Kleve, im
Jahre 1770, bei Baruch Elieser Lippmann Wiener, ehemaliger Druckergehilfe zu
Amsterdam, unter Regierung des Friedrich Wilhelm II, König von Preußen. 4.
120 Blatt. - Dieses Werk ist korrigiert durch den Sohn des Autors Schlomo...
(gemeint Rabbiner Salomon Lipschütz) und ist der Inhalt dieses Buches
zwar mehrere Sche'elot uTeschuwot; jedoch spielt die bedeutendste
Rolle in demselben die erste She'ela uTeschuwa über nachstehendes
Faktum..." |
Nennung der Rabbiner Israel
Lipschitz (um 1741 bis 1763 Rabbiner in Diez und Hadamar) und Chajjim ben
Moses (um 1770/1780 Rabbiner in Diez und Hadamar; Bericht von 1932)
Anmerkung: Aus dem Beitrag von Bernhard Wachstein:
Das Statut der jüdischen Bevölkerung der Grafschaft Wied-Runkel (Pinkas Runkel).
In: Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland. 1932. Heft 2-3. S.
129-149 (als pdf-Datei eingestellt). Zu Rabbiner Israel Lipschitz/Lipschütz
vgl.
http://www.steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/bhr?id=1128
 Aus einem Artikel in der "Zeitschrift für die Geschichte der Juden in
Deutschland" 1932 Heft 2-3: "Der zweite Rabbiner, unter diesen
Vorsitz 1751-1760 die restlichen Punkte 31-40 zu Stande kamen, war Israel
Lipschitz, der in dem drei Stunden von Runkel gelegenen Diez
domizilierte. Seine Aufnahme in Runkel gab der Gemeinde Friedberg zu einem
Protest Veranlassung, in welchem sie auf den seinerzeit mit Bann
festgelegten Beschluss hinwies, der die Runkeler verpflichtet, sich an das
Friedberger Rabbinat anzugliedern. Aus der Stellung von Lipschitz zu dieser
Streitsache erhalten wir einige belangvolle Daten...
Aus einem Artikel in der "Zeitschrift für die Geschichte der Juden in
Deutschland" 1932 Heft 2-3: "Der zweite Rabbiner, unter diesen
Vorsitz 1751-1760 die restlichen Punkte 31-40 zu Stande kamen, war Israel
Lipschitz, der in dem drei Stunden von Runkel gelegenen Diez
domizilierte. Seine Aufnahme in Runkel gab der Gemeinde Friedberg zu einem
Protest Veranlassung, in welchem sie auf den seinerzeit mit Bann
festgelegten Beschluss hinwies, der die Runkeler verpflichtet, sich an das
Friedberger Rabbinat anzugliedern. Aus der Stellung von Lipschitz zu dieser
Streitsache erhalten wir einige belangvolle Daten...
Israel Lipschitz, ein Gelehrter von Namen, kam um 1741 nach Diez und wirkte
dort mehr als 22 Jahre. 1763 übernahm er das Landrabbinat in Kleve, wo er
bis zu seinem am 3. November 1782 erfolgten Tode verblieb. In Kleve erwuchs
ihm durch die bekannte Scheidungsaffäre ein Streit mit dem Frankfurter
Rabbinat, der einen heftigen Charakter annahm. Lipschitz hatte die namhaften
Autoritäten der Zeit auf seiner Seite6.
Einen neuen Rabbiner, Chajjim ben Moses, finden wir erst 1770 in den
Protokollen. Auch dieser Rabbiner, dem wir bis 1780 begegnen, hat wie seine
Vorgänger sein Hauptrabbinat in Diez. Er ist mir aus einer anderen
hebräischen Quelle nicht nachweisbar, doch scheint er mit dem Rabbiner
Heymann Lesser, der um diese Zeit die Beschwerden der Diez-Hadamar
Judenschaft in gutem Deutsch verfasste7,
identisch zu sein.
Anmerkungen: 6)
Literatur über Israel Lipschitz siehe Eisenstadt-Wiener, Daath Kedoschim,
S. 118 und passim; Kaufmann-Freudenthal, Die Familie Gomperz, S.
74,319; Löwenstein in ZfhB 1902, S. 61-63, und Index Approbationum.
Nr. 2134.
7) Kober. Zur Vorgeschichte der Judenemanzipation in Nassau.
Philippson-Festschrift, S. 284. Nach Note 3 das. hat er 1762 von Israel
Lipschitz die Autorisation erhalten." |
| |
 Im obigen Artikel werden mehrere Verordnungen zitiert, unter denen der Name
von Rabbiner Israel Lipschitz steht: "Verordnungen vom 13. Schebat
511, 8. Februar 1751. ...
Im obigen Artikel werden mehrere Verordnungen zitiert, unter denen der Name
von Rabbiner Israel Lipschitz steht: "Verordnungen vom 13. Schebat
511, 8. Februar 1751. ...
Der geringe Israel Lipschitz, Rabbiner in Diez und Umkreis, sowie im Lande
Runkel und Hadamar (es möge unsere Stadt aufgerichtet werden, Amen).
Der geringe Meir ben Moses Mordechai seligen Andenkens aus
Runkel."
|
Über Rabbiner- und Kantorenwahlen
um 1830 (Bericht von 1908)
 Artikel in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 9. Oktober 1908: Artikel in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 9. Oktober 1908:
Artikel ist noch nicht abgeschrieben. Hadamar kommt nur am Rande vor. Zum
Lesen bitte Textabbildungen anklicken.
|

|
Rabbinatseinteilung 1843
Anmerkung: 1843 gehörte Hadamar zum Rabbinat Diez mit dem Landrabbiner Dr.
Wormser, bis spätestens 1853 der Rabbinatssitz für einige Jahre nach Hadamar verlegt
wurde. Landrabbiner Dr. Salomon Samuel
Wormser, der auch zur Einweihung der Synagoge in Hadamar die
Weiherede sprach (1852, siehe ganz unten bei Synagogengeschichte),
war Sohn des Landrabbiners von Langenschwalbach,
Samuel Salomon Wormser (Bericht zu seinem Tod 1858 unten). Salomon
Samuel Wormser war
zunächst als Religionslehrer in Schwalbach tätig,
wo er noch bei seinem Vater als "Vikar" lernte, ab 1843 mit dem Titel
"Bezirksrabbiner" in Diez angestellt, zuständig für
Limburg, Diez und
Hadamar.
Er setzte sich stark für Reformen ein (daher auch Teilnehmer bei der
Rabbinerkonferenz in Gießen 1855 s.u.). 1852 verlegte er den Rabbinatssitz von
Diez nach Hadamar, wo er bis 1860 wohnte.
Weiteres zu seiner Lebensgeschichte siehe
http://www.steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/bhr?id=1920&suchename=Wormser.
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. August 1843:
"Wiesbaden,
im August (1843). Vor einigen Tagen hat unsere hohe Landesregierung die
Rabbinatsbezirks-Einteilung geordnet, und die Theologen für dieselben
bestimmt. Nämlich: 1) die jüdischen Gemeinden in den Amtsbezirken
Wiesbaden, Rüdesheim, Eltville, Hochheim, Höchst, Königstein und
Idstein sind hinsichtlich der Konfirmation, Religionsschule-Visitation und
zur Hälfte auch der Kopulationen dem Dr. Höchstädter übertragen,
hinsichtlich der anderen Hälfte der Kopulationen dem früheren Privatrabbinen
Igstädter; 2) Diez,
Limburg, Hadamar,
Montabaur, Wallmerod,
Selters und
Hachenburg dem Dr. Wormser; 3)
Weilburg,
Runkel, Mennerod (gemeint:
Rennerod), Harborn (gemeint
Herborn)
und Usingen dem Dr. Süßkind; 4)
Langenschwalbach,
Wehen, Nastätten,
St.
Goarshausen, Nassau und
Braubach dem vormaligen Landrabbinen
S. Wormser
mit einem Substituten für die jährlichen Konfirmationen und
Schulvisitationen." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. August 1843:
"Wiesbaden,
im August (1843). Vor einigen Tagen hat unsere hohe Landesregierung die
Rabbinatsbezirks-Einteilung geordnet, und die Theologen für dieselben
bestimmt. Nämlich: 1) die jüdischen Gemeinden in den Amtsbezirken
Wiesbaden, Rüdesheim, Eltville, Hochheim, Höchst, Königstein und
Idstein sind hinsichtlich der Konfirmation, Religionsschule-Visitation und
zur Hälfte auch der Kopulationen dem Dr. Höchstädter übertragen,
hinsichtlich der anderen Hälfte der Kopulationen dem früheren Privatrabbinen
Igstädter; 2) Diez,
Limburg, Hadamar,
Montabaur, Wallmerod,
Selters und
Hachenburg dem Dr. Wormser; 3)
Weilburg,
Runkel, Mennerod (gemeint:
Rennerod), Harborn (gemeint
Herborn)
und Usingen dem Dr. Süßkind; 4)
Langenschwalbach,
Wehen, Nastätten,
St.
Goarshausen, Nassau und
Braubach dem vormaligen Landrabbinen
S. Wormser
mit einem Substituten für die jährlichen Konfirmationen und
Schulvisitationen." |
Bericht über das Schulwesen im
Rabbinat ("Dietz jetzt Hadamar") von Rabbiner Dr. Wormser (1853)
 Aus einem Artikel in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 21. März 1853:
"Endlich können wir auch über das israelitische Schulwesen in unserem
Herzogtume erfreuliche Mitteilungen machen. Die angestellten Religionslehrer
bestreben sich, in praktischer wie in theoretischer Berufsbildung immer
weiter zu kommen, und dem wahrhaften Fortschritte derzeit zu folgen; wozu
namentlich im diesseitigen Rabbinate die seit 1845 eingeführten
Jahreskonferenzen und der dazugehörige Lesezirkel (beide sind
auch von Herrn Bezirksrabiner Dr. Wormser im Rabbinate
Diez [jetzt
Hadamar] eingeführt) unter dem Vorsitze unseres Bezirksrabbiners Herrn Dr.
Hochstädter - Vieles beitragen. Aus einem Artikel in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 21. März 1853:
"Endlich können wir auch über das israelitische Schulwesen in unserem
Herzogtume erfreuliche Mitteilungen machen. Die angestellten Religionslehrer
bestreben sich, in praktischer wie in theoretischer Berufsbildung immer
weiter zu kommen, und dem wahrhaften Fortschritte derzeit zu folgen; wozu
namentlich im diesseitigen Rabbinate die seit 1845 eingeführten
Jahreskonferenzen und der dazugehörige Lesezirkel (beide sind
auch von Herrn Bezirksrabiner Dr. Wormser im Rabbinate
Diez [jetzt
Hadamar] eingeführt) unter dem Vorsitze unseres Bezirksrabbiners Herrn Dr.
Hochstädter - Vieles beitragen.
Dazu bildet das von dem letztgenannten Geistlichen und erprobten Schulmanne
dirigierte Seminar zur Ausbildung israelitische Religionslehrer und
Vorsänger immer mehr junge Kräfte heran, welche das begonnene Werk der
zeitgemäßen Reform des israelitischen Schul- und Synagogenwesens im
Herzogtum durch eine systematische Vorbereitung für diesen heiligen Beruf
rüstig vollenden helfen. Die Lösung dieser Aufgabe dürfte denselben in der
Folge durch die Herausgabe des im vorigen Jahre angekündigten 'Handbuches
für israelitische Religionsschulen', wovon 'Der praktische Lehrgang
zur leichten Erlernung der biblischen Sprache' bereits unter der Presse
ist, erleichtert werden; in dem hier mit Recht eine methodische Behandlung
des Unterrichtsgegenstandes zu erwarten ist. " |
Verschiedene Berichte über das
Schulwesen und anderes im Rabbinat Hadamar (1853)
Anmerkung: 1853 wird Rabbbiner Dr. Salomon Samuel Wormser für seine
Reformbemühungen in Hadamar in einem Artikel der "Allgemeinen Zeitung des
Judentums" (Ausgabe vom 5. September 1853) gelobt. Der Artikel gibt weitere
Einblick in das damalige jüdische Gemeindeleben in den Zeiten in Hadamar.
 Artikel in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 5. September 1853: "Von
der Lahn, Mitte August (Privatmitteilung). Als ich die Berichte aus
Anrath in Nr. 31-33 dieses Blattes über die diesjährige Lehrerkonferenz des
Krefelder Rabbinatsbezirks las und die Klagen über saumselige Beteiligung
der Lehrer, da hätte ich mir sofort den Verfasser der deutsch-jüdischen
Sprichwörter aus Hamburg herbeigewünscht, hätte ihm in wenigen Zügen ein
Bild der Lehrerkonferenz des Rabbinats Hadamar entworfen und ihm
einen guten Kommentar geliefert zu dem Sprichworte: 'Aschkenas ist ein
Staat' oder in der Übersetzung: Die Krefelder haben getan Was die
Nassauer an der Lahn.
Artikel in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 5. September 1853: "Von
der Lahn, Mitte August (Privatmitteilung). Als ich die Berichte aus
Anrath in Nr. 31-33 dieses Blattes über die diesjährige Lehrerkonferenz des
Krefelder Rabbinatsbezirks las und die Klagen über saumselige Beteiligung
der Lehrer, da hätte ich mir sofort den Verfasser der deutsch-jüdischen
Sprichwörter aus Hamburg herbeigewünscht, hätte ihm in wenigen Zügen ein
Bild der Lehrerkonferenz des Rabbinats Hadamar entworfen und ihm
einen guten Kommentar geliefert zu dem Sprichworte: 'Aschkenas ist ein
Staat' oder in der Übersetzung: Die Krefelder haben getan Was die
Nassauer an der Lahn.
Es hier ist zwar die Gleichgültigkeit gegen die Konferenz nicht so stark,
aber sie ist doch auch vorhanden, wie sich dies bei der am 18. Juli
laufenden Jahres in Limburg abgehaltenen 7. Jahreskonferenz der
Religionslehrer des Rabbinatsbezirks Hadamar gezeigt hat, auf welcher von
zehn Mitgliedern auch nur sieben sich eingefunden hatten und unter den drei
fehlenden war sogar der dem Konferenzorte am nächsten wohnende D. in K., der
lieber ins Bad als zur Konferenz ging; zu ersterem hatte er Geld, zu
letzterer keines. Glauben die Leser vielleicht, dass er krankheitshalber ins
Bad ging? Oh nein! Das ist eine echt russische Natur, kerngesund. Er kam
nicht weil - je nun, weil er nicht wollte; ein anderer, M. in M.,
entschuldigte sich nachträglich mit den naiven Worten: ...; auch er kam
nicht, weil - je nun, weil er nicht wollte; der dritte schützte eine
allgemeine Lehrerkrankheit vor und kam auch nicht, weil er sich mit seinen
beiden Kollegen wahrscheinlich im gleichen Falle befand. Übrigens haben wir
hierzulande Mittel, um solchen Übelwollenden zu begegnen, da nach einem im
vorigen Jahre ergangenen Ministerialrekripte den Rabbinen das Recht zusteht,
eine Konferenz zu berufen und in Widersetzlichkeitsfällen dieselben gleiches
Recht haben, wie die christlichen Schulinspektoren, denen nach § 20 der
Instruktion für die Schulinspektoren, Edikt vom 24. März 1847 (V.O.S.
III.Band S. 318) eine Strafbefugnis bis zu einem Prozent des Dienstgehaltes
des unfolgsamen Lehrers zusteht. Es ist freilich ein Übel, wenn solche
Mittel notwendig sind, allein wenn solche Herren sie mutwillig hervorrufen,
dann sollten sie auch angewandt werden. Zur Konferenz selbst übergehend, so
bildeten den Hauptinhalt der Verhandlungen die vorgesehenen
Konferenzarbeiten, unter denen einzelne recht gelungene waren, und wie in
früheren Jahren, so zeichnete sich auch diesmal wieder die Arbeit des Geist
und Kenntnis reichen Herrn Freund in
Hahnstätten aus, der 'die jüdischen Gebräuche bei Sterbe- und
Beerdigungsfällen' in ebenso satirischer als geistreicher Weise bearbeitete,
und dessen Verbesserungsvorschläge wohl die allgemeinste Beherzigung
verdienen, was auch von dem Dirigenten der Konferenz, Herrn Bezirksrabbiner
Dr. Wormser in Hadamar anerkannt wurde. Auch kam ein von demselben
Verfasser schon im vorigen Jahre bearbeiteter und dem Gouvernement bereits
vorliegender 'Plan zur Gründung einer Pensionsanstalt für israelitische
Lehrer und deren Relikten' zur Besprechung, der, wenn er ins Leben gerufen
werden sollte, die größte Wohltat für alle Beteiligten wäre. Ebenso ist auf
Anregen des Konferenz Dirigenten eine Statistik der Juden in Nassau schon
seit einigen Monaten in Angriff genommen worden und wird wohl schon der im
nächsten Jahre stattfindenden Konferenz vorgelegt werden können, bis wohin
die Materialien zur Hand sein dürften, da die hervorragendsten Lehrer um
ihre Mitwirkung bereits angegangen wurden. Die von Freiherrn von Reden in
Klein's Volkskalender für Israeliten pro 1853 aufgestellten Grundsätze
liegen auch dieser Arbeit zu Grunde und soll dieselbe, wenn die Konferenz
sie dessen würdig hält, seiner Zeit diesen vielgelesenen Blättern zugehen.
Was nun die israelitischen Lehrer Nassaus betrifft, so fehlt es auch diesen
nicht an einem erklecklichen Vorrat von Pia Desideria ('fromme Wünsche'),
woran sowohl die Regierung als auch die Gemeinden die Schuld tragen. Auch
hier ist es, wie in Rheinland und Westfalen das leidige Provisorium, das wie
ein Alp auf den Lehrern lastet. Es steht zwar den Gemeinden nicht unbedingt
frei, ihre Lehrer willkürlich zu entlassen, allein wenn sie auf den nervus
rerum, den Geldpunkt sich stützen, dann bringen Sie mit der Zeit doch durch,
und am übelsten sind die ältesten und verdientesten Lehrer daran, die, wenn
sie von ihrer Stelle entlassen werden, eben darum bei keiner anderen
Gemeinde Aufnahme erhalten. Schon aus diesem Grunde und weil bei solchen
Aussichten auch das jüngere Geschlecht abgeschreckt wird, einen Beruf zu
wählen, der Ihnen für ihr Alter nur die Aussicht auf Brotlosigkeit und
bitteres Elend bietet, sollten die Rabbiner Nassaus, die durchschnittlich
alle für die Hebung der Religionsschulen bemüht sind, sich angelegen |
 sein
lassen, den oben erwähnten Pensionierungsplan auf das Kräftigste bei der
Staatsregierung zu unterstützen, indem wir gegenteiligen Falls der
israelitischen Religionsschule Nassau's kein günstiges Prognostikon stellen
können. Der Weg zum Gedeihen dieser Anstalten ist in Nassau recht gut
angebahnt, und ich glaube, dass wenn die Herren Rabbiner einmütig wirken
wollten, bei unserer Regierung Vieles erwirkt werden könnte, da sie
vielleicht die einzige in Deutschland ist, die trotz aller betrübenden
Beispiele von außen die den Juden seit 1849 gewährte vollständige
bürgerliche und religiöse Freiheit kräftigst, selbst gegen 'Höchst-Krause'
Angriffe im Innern geschützt hat. sein
lassen, den oben erwähnten Pensionierungsplan auf das Kräftigste bei der
Staatsregierung zu unterstützen, indem wir gegenteiligen Falls der
israelitischen Religionsschule Nassau's kein günstiges Prognostikon stellen
können. Der Weg zum Gedeihen dieser Anstalten ist in Nassau recht gut
angebahnt, und ich glaube, dass wenn die Herren Rabbiner einmütig wirken
wollten, bei unserer Regierung Vieles erwirkt werden könnte, da sie
vielleicht die einzige in Deutschland ist, die trotz aller betrübenden
Beispiele von außen die den Juden seit 1849 gewährte vollständige
bürgerliche und religiöse Freiheit kräftigst, selbst gegen 'Höchst-Krause'
Angriffe im Innern geschützt hat.
Unser Synagogenleben bietet wie überall nichts Ganzes. So viel Rabbinate, so
viele Liturgien, nirgends Einheit, nirgends Übereinstimmung; der eine
Rabbiner reformiert und sichtet, der andere lässt's beim Alten und das
benimmt Ihnen allen den Kredit bei ihren Gemeinden. Ich bin überzeugt, dass
wenn unsere vier nassauischen Rabbiner über eine allgemeine Kultus- und
Liturgieordnung im Sinne eines vernünftigen Fortschritts sich einigten - sie
würden die Mehrheit der Gemeinden für sich haben und selbst die Gegner
würden sich fügen. Am meisten hat hierin Dr. Wormser in Hadamar
getan, in dessen Bezirk schon seit 1845 eine zeitgemäße, verbesserte
Kultusform eingeführt ist und auch überall Eingang gefunden hat. So sehr
dieser Mann auf seinem früheren Domizil - Diez - angefeindet war, so
beliebt ist er jetzt in Hadamar, und da sein Wirken jetzt wie früher
sich gleich blieb, so ist dies der beste Beweis, dass an dem früheren
Missverhältnis lediglich jene Gemeinde die Schuld trug. Selbst von einem
echt religiösen Sinne belebt, dabei mit umfassender talmudischer und
philosophischer Gelehrsamkeit ausgerüstet, wirkt sein Auftreten, begünstigt
durch eine würdevoll pastorale Persönlichkeit, überall belehrend und
aufbauend und namentlich sind es die Lehrer, die ihm für seine
Opferwilligkeit, für seine Hingebung zu ihrem schweren Berufe zu Dank
verpflichtet sind. Seine jetzige Gemeinde - Hadamar - erkennt dies
auch aber auch an. Das sind einfache aber biedere Leute, die ohne großes
Aufsehen zu machen, gerne zu allem Guten die Hand bieten, mit bedeutenden
Opfern sich erst vor wenigen Jahren eine sehr schöne neue Synagoge
bauten und sowohl in als außen derselben einen wahrhaft religiösen Sinn an
den Tag legen. Im Ganzen gibt es bei der nassauischen Juden noch viel
braches Feld anzubauen, da der schon so oft gerügte Indifferentismus auch
hier immer mehr Boden gewinnt, und er wird nicht abnehmen, wenn in der
Synagoge alles beim Alten gelassen wird. Sehen wir daher, was uns die
Zukunft bringen wird, und ist dies etwas Erhebliches, was die Leser dieser
Blätter interessieren könnte, so soll es Ihnen nicht vor enthalten werden.
x.y.z." |
Nennung von Rabbiner Dr. Salomon Wormser
bei der Rabbiner-Konferenz in Gießen im Juni 1855
Anmerkung: es handelte sich um eine Konferenz liberal gesinnter Rabbiner.
 Aus einem Artikel in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 6. August 1855:
"Bericht über die zweite Rabbiner-Konferez, abgehalten zu
Gießen am 11.,12. und 13. Juni 1855.
Erste Sitzung: Montag, Mittags um 12 Uhr. Aus einem Artikel in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 6. August 1855:
"Bericht über die zweite Rabbiner-Konferez, abgehalten zu
Gießen am 11.,12. und 13. Juni 1855.
Erste Sitzung: Montag, Mittags um 12 Uhr.
In folge der von dem Provinzialrabbinen Herrn Dr. Levi zu
Gießen ergangenen Einladung haben sich am
11. Juni laufenden Jahres zur diesjährigen Konferenz folgende Rabbiner
eingefunden: Dr. Adler, Kreisrabbiner zu
Alzey, Dr. Aub, erster Rabbiner zu
Mainz, Dr. Cahn, zweiter Rabbiner zu
Mainz, Dr. Formstecher, Kreisrabbiner zu
Offenbach, B. Goldmann,
Landesrabbiner von Birkenfeld zu
Hoppstädten, Dr. Levi, Provinzialrabbiner zu
Gießen, M. Präger, Stadtrabbiner
zu Mannheim, Dr. Sobernheim,
Kreisrabbiner zu Bingen, Leopold Stein,
Rabbiner zu Frankfurt am Main, S. Süßkind, Bezirksrabbiner zu
Wiesbaden und Dr. S. Wormser,
Bezirksrabbiner zu Hadamar." |
Zum Tod des Landrabbiners Samuel Salomon Wormser, Vater
des Rabbiners in Diez/Hadamar Dr. Salomon Wormser (1858)
Anmerkung: Zum Sohn von Landrabbiners Wormser - Dr. Salomon Samuel Wormser -
s.o.. Zu Samuel Salomon Wormser vgl.
http://www.steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/bhr?id=1921&suchename=Wormser.
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Mai 1858: (abgekürzt,
teilweise freier zitiert) "Vom
Rhein, im April 1858. In unserer an echter Frömmigkeit und
talmudischer Gelehrsamkeit so armen Zeit ist der Verlust großer Männer
doppelt schmerzlich... Einen wehmütigen Nachruf verdient
wohl mit Recht der leider am 30. März laufenden Jahres zu Hadamar im
Herzogtum Nassau erfolgte rasche Hintritt des ehrwürdigen Landrabbiners
Herrn Samuel Salomon Wormser von Langenschwalbach, welcher deshalb die
ganze Gemeinde tief erschütterte und das schöne Fest (Chag,
gemeint hier das Pessachfest, an dem Rabbiner Wormser starb) zur
Trauer (Ewal) ihr umwandelte.
Einer berühmten Rabbinerfamilie entstammend und jüngster Sohn des
Oberrabbiners zu Fulda (geb. am 17. Januar 1770), entfaltete er in noch
sehr jugendlichem Alter große, durch seltene Geistesgaben geförderte talmudische Gelehrsamkeit, was seine zahlreichen Diplome von Fürth,
Mannheim, Bonn, Frankfurt und von anderen Orten beurkunden. Schon vom
Jahre 1804 an, wo er sich nach Limburg an der Lahn verheiratete, fungierte
er als Rabbiner in wichtigen Angelegenheiten; jedoch erst mit dem Jahre
1811 wurde er definitiv mit allen Ehren und Würden staatlich als
Landrabbiner der Grafschaft Katzenellenboden angestellt und zwar mit dem
anfänglichen Wohnsitz zu Nastätten
und dann zu Langenschwalbach. Am letztgenannten Badeorte hatte der verklärte
Nestor bis zu seiner auf seinen Antrag im Jahre 1848 wegen Ablebens seiner
Frau erfolgte Pensionierung segensreich gewirkt. Von dieser Zeit an lebte
er an den Wohnorten seines einzigen Sohnes, des zu Hadamar wohnenden
Bezirksrabbiners Dr. Wormser, welcher die höchste Freude seines Mannes-
und Greisenalters war. Bis zu seinem letzten Lebenstage Erew
Pessach (Vortag des Pessachfestes) – an welchem er großer Schwäche
wegen das Bett nicht verlassen konnte – heiter, gesund und im vollen
Besitze seiner eminenten Geisteskräfte und sich fortwährend mit Tora
und Gebet beschäftigend: 'sein Auge war nicht getrübt und seine
Säfte nicht geschwunden' (5. Mose 34,7), blieb auch sein Aussehen
jugendlich frisch und sein herrliches Auge verdunkelte sich nicht eher,
als bis um Mitternacht – Leil Erew
Pessach (Nacht vor dem Pessachfest) es sich auf ewig schloss! Ach,
dieser Trauerfall, obgleich als eine gute Heimkehr und mit einem Kuss
durch den Mund Gottes erfolgt, kam immer noch zu früh, und sehr lange
noch wird diese seltene patriarchalische Erscheinung nah und fern vermisst
werden. Denn nicht nur beklagen wir in dem Verklärten eine unersetzliche
Zeder in dem sehr gelichteten Libanon des alten Judentums, als vielmehr
einen Charakter, der heutigen Tages wohl schwerlich wieder zu finden sein
dürfte. Streng orthodox übte er seine religiösen Pflichten sowie
alle Tugenden und namentlich Gerechtigkeit nur im Verborgenen; er war dabei als großer
Menschenkenner leutselig und liebenswürdig, schonend gegen alle Menschen,
die er eben dadurch zur Gottesfurcht und Tugend hinzuleiten verstand. Das
'und viele brachte er von Sünde zurück' (Maleachi 2,6) fand im vollsten
Sinne des Wortes auf diesen treuen Hirten seine Anwendung, der gleich
seinem berühmte Bruder HaRaw HaGaon Raw Sekel - das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen - in Fulda stets in bescheidener
Zurückgezogenheit gewirkt hatte. Sein überaus zahlreich besuchtes
Leichenbegängnis fand am ersten Tage der Halbfeiertage, den 1.
April statt, und sprach der Sohn des Verewigten tief ergreifende, von
Tränen fast erstickte Worte. – ... Auf dem Friedhofe angelangt,
sprach derselbe noch einiges über Verse 22 und 23 des 9. Kapitels in
Jeremias, um den Lebenswandel des verklärten Frommen zur Nachahmung
anzuempfehlen und schloss mit einem Gebet – auf dass Seine Seele sich
freuen möge eines ewigen Glückseligkeit im Lande des ewigen Lebens. 'Aber
die Verständigen werden glänzen wie der Glanz des Himmels, und die,
welche viele zur Gerechtigkeit führten, wie die Sterne, immer und ewig'
(Daniel 12,3). Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Mai 1858: (abgekürzt,
teilweise freier zitiert) "Vom
Rhein, im April 1858. In unserer an echter Frömmigkeit und
talmudischer Gelehrsamkeit so armen Zeit ist der Verlust großer Männer
doppelt schmerzlich... Einen wehmütigen Nachruf verdient
wohl mit Recht der leider am 30. März laufenden Jahres zu Hadamar im
Herzogtum Nassau erfolgte rasche Hintritt des ehrwürdigen Landrabbiners
Herrn Samuel Salomon Wormser von Langenschwalbach, welcher deshalb die
ganze Gemeinde tief erschütterte und das schöne Fest (Chag,
gemeint hier das Pessachfest, an dem Rabbiner Wormser starb) zur
Trauer (Ewal) ihr umwandelte.
Einer berühmten Rabbinerfamilie entstammend und jüngster Sohn des
Oberrabbiners zu Fulda (geb. am 17. Januar 1770), entfaltete er in noch
sehr jugendlichem Alter große, durch seltene Geistesgaben geförderte talmudische Gelehrsamkeit, was seine zahlreichen Diplome von Fürth,
Mannheim, Bonn, Frankfurt und von anderen Orten beurkunden. Schon vom
Jahre 1804 an, wo er sich nach Limburg an der Lahn verheiratete, fungierte
er als Rabbiner in wichtigen Angelegenheiten; jedoch erst mit dem Jahre
1811 wurde er definitiv mit allen Ehren und Würden staatlich als
Landrabbiner der Grafschaft Katzenellenboden angestellt und zwar mit dem
anfänglichen Wohnsitz zu Nastätten
und dann zu Langenschwalbach. Am letztgenannten Badeorte hatte der verklärte
Nestor bis zu seiner auf seinen Antrag im Jahre 1848 wegen Ablebens seiner
Frau erfolgte Pensionierung segensreich gewirkt. Von dieser Zeit an lebte
er an den Wohnorten seines einzigen Sohnes, des zu Hadamar wohnenden
Bezirksrabbiners Dr. Wormser, welcher die höchste Freude seines Mannes-
und Greisenalters war. Bis zu seinem letzten Lebenstage Erew
Pessach (Vortag des Pessachfestes) – an welchem er großer Schwäche
wegen das Bett nicht verlassen konnte – heiter, gesund und im vollen
Besitze seiner eminenten Geisteskräfte und sich fortwährend mit Tora
und Gebet beschäftigend: 'sein Auge war nicht getrübt und seine
Säfte nicht geschwunden' (5. Mose 34,7), blieb auch sein Aussehen
jugendlich frisch und sein herrliches Auge verdunkelte sich nicht eher,
als bis um Mitternacht – Leil Erew
Pessach (Nacht vor dem Pessachfest) es sich auf ewig schloss! Ach,
dieser Trauerfall, obgleich als eine gute Heimkehr und mit einem Kuss
durch den Mund Gottes erfolgt, kam immer noch zu früh, und sehr lange
noch wird diese seltene patriarchalische Erscheinung nah und fern vermisst
werden. Denn nicht nur beklagen wir in dem Verklärten eine unersetzliche
Zeder in dem sehr gelichteten Libanon des alten Judentums, als vielmehr
einen Charakter, der heutigen Tages wohl schwerlich wieder zu finden sein
dürfte. Streng orthodox übte er seine religiösen Pflichten sowie
alle Tugenden und namentlich Gerechtigkeit nur im Verborgenen; er war dabei als großer
Menschenkenner leutselig und liebenswürdig, schonend gegen alle Menschen,
die er eben dadurch zur Gottesfurcht und Tugend hinzuleiten verstand. Das
'und viele brachte er von Sünde zurück' (Maleachi 2,6) fand im vollsten
Sinne des Wortes auf diesen treuen Hirten seine Anwendung, der gleich
seinem berühmte Bruder HaRaw HaGaon Raw Sekel - das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen - in Fulda stets in bescheidener
Zurückgezogenheit gewirkt hatte. Sein überaus zahlreich besuchtes
Leichenbegängnis fand am ersten Tage der Halbfeiertage, den 1.
April statt, und sprach der Sohn des Verewigten tief ergreifende, von
Tränen fast erstickte Worte. – ... Auf dem Friedhofe angelangt,
sprach derselbe noch einiges über Verse 22 und 23 des 9. Kapitels in
Jeremias, um den Lebenswandel des verklärten Frommen zur Nachahmung
anzuempfehlen und schloss mit einem Gebet – auf dass Seine Seele sich
freuen möge eines ewigen Glückseligkeit im Lande des ewigen Lebens. 'Aber
die Verständigen werden glänzen wie der Glanz des Himmels, und die,
welche viele zur Gerechtigkeit führten, wie die Sterne, immer und ewig'
(Daniel 12,3).
Ja, Dein Gedächtnis lebt in Segen
Bei der Mit- und Nachwelt freudig fort.
Überall tritt uns Dein Bild entgegen,
Allen warst Du ja sein sichrer Hort." |
Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1861
/ 1862 / 1864 / 1865 / 1874 / 1882
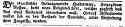 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juni 1861: "Die
israelitische Kultusgemeinde Hadamar. Herzogtum Nassau, sucht einen
Religionslehrer, welcher zugleich das Amt eines Vorbeters übernehmen
muss. Hierauf Reflektierende wollen sich an den Vorstand der Gemeinde,
unter Einsendung ihrer Zeugnisse, wenden." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juni 1861: "Die
israelitische Kultusgemeinde Hadamar. Herzogtum Nassau, sucht einen
Religionslehrer, welcher zugleich das Amt eines Vorbeters übernehmen
muss. Hierauf Reflektierende wollen sich an den Vorstand der Gemeinde,
unter Einsendung ihrer Zeugnisse, wenden." |
| |
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Juni 1862: "Die
hiesige israelitische Kultusgemeinde sucht bis zum 1. September dieses
Jahres einen Religionslehrer, welcher zugleich das Vorbeteramt übernehmen
muss. Hierauf Reflektierende wollen sich franco an den Unterzeichneten
wenden. Hadamar, im Juni 1862. Simon Wolf." Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Juni 1862: "Die
hiesige israelitische Kultusgemeinde sucht bis zum 1. September dieses
Jahres einen Religionslehrer, welcher zugleich das Vorbeteramt übernehmen
muss. Hierauf Reflektierende wollen sich franco an den Unterzeichneten
wenden. Hadamar, im Juni 1862. Simon Wolf." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Dezember 1864: "Die
hiesige israelitische Kultusgemeinde sucht zum baldigen Eintritte einen
Religionslehrer, der auch zugleich das Vorbeteramt zu übernehmen hat.
Fixes Salair beträgt Gulden 350. Hierauf Reflektierende wollen sich an
den Unterzeichneten wenden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Dezember 1864: "Die
hiesige israelitische Kultusgemeinde sucht zum baldigen Eintritte einen
Religionslehrer, der auch zugleich das Vorbeteramt zu übernehmen hat.
Fixes Salair beträgt Gulden 350. Hierauf Reflektierende wollen sich an
den Unterzeichneten wenden.
Hadamar, den 4. Dezember 1864. Simon Wolf,
Mitglied des Vorstandes." |
| |
 Anzeige
in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 14. November 1865: "Die
hiesige israelitische Kultusgemeinde sucht zum baldigen Eintritte einen
Religionslehrer, der auch zugleich das Amt eines Vorbeters zu übernehmen hat. Anzeige
in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 14. November 1865: "Die
hiesige israelitische Kultusgemeinde sucht zum baldigen Eintritte einen
Religionslehrer, der auch zugleich das Amt eines Vorbeters zu übernehmen hat.
Fixes Salair beträgt Gulden 400. Hierauf Reflektierende wollen sich an
den Unterzeichneten wenden.
Hadamar in Nassau, im Oktober 1865. Simon Wolf."
|
| |
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Mai 1874: "Die
hiesige Religionslehrer- und Vorbeterstelle wird Ende August dieses Jahres
vakant. Die jährliche Besoldung beträgt 250 Taler. Da hier nur wenige
Kinder zu unterrichten sind, so ist dem Bewerber Zeit geboten, durch
Privatunterricht sein Einkommen zu vermehren. Hierauf Reflektierende
wollen sich an den Unterzeichneten wenden. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Mai 1874: "Die
hiesige Religionslehrer- und Vorbeterstelle wird Ende August dieses Jahres
vakant. Die jährliche Besoldung beträgt 250 Taler. Da hier nur wenige
Kinder zu unterrichten sind, so ist dem Bewerber Zeit geboten, durch
Privatunterricht sein Einkommen zu vermehren. Hierauf Reflektierende
wollen sich an den Unterzeichneten wenden.
Hadamar in Nassau, im April
1874. Wolf, Kultusvorsteher." |
| |
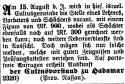 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Juni 1882: "Am 15. August
dieses Jahres wird in hiesiger israelitischer Kultusgemeinde die Stelle
eines Lehrers, Vorbeters und Schächters vakant, mit einem Fixum von Mark
900, wobei als Schächter ebenfalls noch auf Mark 300 gerechnet werden
kann; noch weitere Nebenverdienste sind in Aussicht. Doch mögen sich nur
solche melden, welche mit guten Zeugnissen und Prüfungsattesten versehen
sind. Auf portofreie Anfragen erteilt Auskunft Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Juni 1882: "Am 15. August
dieses Jahres wird in hiesiger israelitischer Kultusgemeinde die Stelle
eines Lehrers, Vorbeters und Schächters vakant, mit einem Fixum von Mark
900, wobei als Schächter ebenfalls noch auf Mark 300 gerechnet werden
kann; noch weitere Nebenverdienste sind in Aussicht. Doch mögen sich nur
solche melden, welche mit guten Zeugnissen und Prüfungsattesten versehen
sind. Auf portofreie Anfragen erteilt Auskunft
der Kultusvorstand zu
Hadamar (Provinz Nassau)." |
Ausschreibungen von Pensionsstellen
von von Lehrer Adolf Oppenheimer (1889 / 1896)
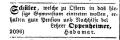 Anzeige in "Der Israelit" vom 4. April 1889: "Schüler,
welche zu Ostern in das hiesige Gymnasium eintreten wollen, erhalten gute
Pension und Nachhilfe bei Anzeige in "Der Israelit" vom 4. April 1889: "Schüler,
welche zu Ostern in das hiesige Gymnasium eintreten wollen, erhalten gute
Pension und Nachhilfe bei
Lehrer Oppenheimer, Hadamar. " |
| |
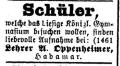 Anzeige in "Der Israelit" vom 2. März 1896: "Schüler, Anzeige in "Der Israelit" vom 2. März 1896: "Schüler,
welche das hiesige königliche Gymnasium besuchen wollen, finden liebevolle
Aufnahme bei:
Lehrer A. Oppenheimer, Hadamar. " |
25-jähriges Orts-Jubiläum von Adolf Oppenheimer als Lehrer und Kantor in Hadamar (1908;
in Hadamar seit 1. Dezember 1883 tätig)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. November 1908: "Hadamar, 18.
November (1908). Am 1. Dezember dieses Jahres begeht der Lehrer der
hiesigen Gemeinde, Herr Oppenheimer, das Jubiläum seiner 25jährigen
Wirksamkeit als Lehrer und Kantor unserer Gemeinde. Die Gemeinde verdankt
dem Jubilar das Aufblühen ihrer Religionsschule, sowie ihres religiösen
Lebens überhaupt und hat sich Herr Oppenheimer durch sein schlichtes,
freundliches Wesen und seine treue Pflichterfüllung die Wertschätzung
Aller erworben." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. November 1908: "Hadamar, 18.
November (1908). Am 1. Dezember dieses Jahres begeht der Lehrer der
hiesigen Gemeinde, Herr Oppenheimer, das Jubiläum seiner 25jährigen
Wirksamkeit als Lehrer und Kantor unserer Gemeinde. Die Gemeinde verdankt
dem Jubilar das Aufblühen ihrer Religionsschule, sowie ihres religiösen
Lebens überhaupt und hat sich Herr Oppenheimer durch sein schlichtes,
freundliches Wesen und seine treue Pflichterfüllung die Wertschätzung
Aller erworben." |
| |
 Artikel
in "Frankfurter Israelitisches Familienblatt" vom 20. November 1908: "Hadamar
im Westerwald. Am 6. Dezember dieses Jahres sind es 25 Jahre, dass Herr
Lehrer Adolf Oppenheimer seines Amtes waltet. Die israelitische
Kultusgemeinde wird den Tag festlich begehen. Dasselbe beabsichtigt der
'Verein israelitischer Lehrer im ehemaligen Herzogtum Nassau'. Herr
Oppenheimer, der jederzeit ein eifriges, förderndes und unterstützendes
Mitglied des Vereins gewesen, hat auch viele Jahre hindurch segensreich im
Vorstand gewirkt. U." Artikel
in "Frankfurter Israelitisches Familienblatt" vom 20. November 1908: "Hadamar
im Westerwald. Am 6. Dezember dieses Jahres sind es 25 Jahre, dass Herr
Lehrer Adolf Oppenheimer seines Amtes waltet. Die israelitische
Kultusgemeinde wird den Tag festlich begehen. Dasselbe beabsichtigt der
'Verein israelitischer Lehrer im ehemaligen Herzogtum Nassau'. Herr
Oppenheimer, der jederzeit ein eifriges, förderndes und unterstützendes
Mitglied des Vereins gewesen, hat auch viele Jahre hindurch segensreich im
Vorstand gewirkt. U." |
40-jähriges Orts-Jubiläum von Lehrer Adolf Oppenheimer (1924)
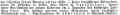 Artikel
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 17. Januar 1924: "Unser
langjähriger Vertrauensmann für Hadamar in Hessen, Herr Lehrer A.
Oppenheimer, konnte unter Anteilnahme der ganzen Gemeinde am 1. Dezember
sein 40-jähriges Jubiläum feiern. Wir sprachen unserem treuen
Mitarbeiter unsere herzlichsten Glückwünsche aus." Artikel
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 17. Januar 1924: "Unser
langjähriger Vertrauensmann für Hadamar in Hessen, Herr Lehrer A.
Oppenheimer, konnte unter Anteilnahme der ganzen Gemeinde am 1. Dezember
sein 40-jähriges Jubiläum feiern. Wir sprachen unserem treuen
Mitarbeiter unsere herzlichsten Glückwünsche aus." |
Zum Tod von Lehrer Adolf
Oppenheimer (1930)
Anmerkung: Der Sohn von Adolf (Abraham) Oppenheimer
war Dr. Max Oppenheimer, der von 1918 bis 1933 als Arzt in Friedberg
tätig war. Er emigrierte später nach Palästina, wo er verstarb. Ihm wurde von
einer aus Hadamar stammenden Frau Maria Mathi ein Buch gewidmet: 'Wenn nur der
Sperker nicht kommt', das 1955 erschienen ist (siehe unten
Literaturverzeichnis).
 Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 8. Oktober 1930: "Hadamar.
(Todesfall.) Nach schwerem Leiden ist der hiesige Lehrer Adolf
Oppenheimer gestorben. 40 Jahre war der Verblichene der geistige Führer
der Gemeinde, der er seine Arbeitskraft widmete, bis er vor etwa drei Jahren
in den Ruhestand trat. Die Beliebtheit des Entschlafenen wurde aus der
ungewöhnlich starken Beteiligung an der Beisetzungsfeier ersichtlich. An
seiner Bahre sprachen Bezirksrabbiner Dr. Lazarus,
Wiesbaden, Lehrer Hartogsohn für die Gemeinde,
Dr. Löwenstein, Bad Nauheim,
Oberkantor Nußbaum,
Wiesbaden, im Auftrag des israelitischen nassauischen Lehrervereins, dessen
Vorstandsmitglied der Verewigte viele Jahre gewesen war. Auch der
katholische und evangelische Pfarrer von Hadamar gaben in tief empfunden in
Worten dem Mitgefühl über den Heimgang des auch in ihren Kirchengemeinten
beliebten Mannes Ausdruck. Oberkantor Nußbaum sang seinem verewigten Freunde
als ergreifenden Abschiedsgruß das Gebet 'El mole Rachamim*.'" Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 8. Oktober 1930: "Hadamar.
(Todesfall.) Nach schwerem Leiden ist der hiesige Lehrer Adolf
Oppenheimer gestorben. 40 Jahre war der Verblichene der geistige Führer
der Gemeinde, der er seine Arbeitskraft widmete, bis er vor etwa drei Jahren
in den Ruhestand trat. Die Beliebtheit des Entschlafenen wurde aus der
ungewöhnlich starken Beteiligung an der Beisetzungsfeier ersichtlich. An
seiner Bahre sprachen Bezirksrabbiner Dr. Lazarus,
Wiesbaden, Lehrer Hartogsohn für die Gemeinde,
Dr. Löwenstein, Bad Nauheim,
Oberkantor Nußbaum,
Wiesbaden, im Auftrag des israelitischen nassauischen Lehrervereins, dessen
Vorstandsmitglied der Verewigte viele Jahre gewesen war. Auch der
katholische und evangelische Pfarrer von Hadamar gaben in tief empfunden in
Worten dem Mitgefühl über den Heimgang des auch in ihren Kirchengemeinten
beliebten Mannes Ausdruck. Oberkantor Nußbaum sang seinem verewigten Freunde
als ergreifenden Abschiedsgruß das Gebet 'El mole Rachamim*.'"
* vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/El_male_rachamim
|
| |
 Artikel
im "Israelitischen Familienblatt" vom 1. Oktober 1930: "Hadamar
(Hessen-Nassau). Im Alter von 67 Jahren starb nach schwerem Leiden Lehrer
Adolf Oppenheimer, Über 40 Jahre war er der religiöse Führer der
Gemeinde. Mit unendlicher Hingebung widmete er sich seinem Amte, von dem er
sich vor etwa drei Jahren in den Ruhestand zurückzog. Ein selten großer
Trauerzug zeugte von der Beliebtheit des Verstorbenen. Am Grabe sprachen:
Rabbiner Dr. Lazarus, Wiesbaden, Lehrer Hartogsohn für die
Gemeinde, Dr. Löwenstein , Bad Nauheim, Oberkantor Nussbaum,
Wiesbaden, im Auftrag des israelitischen nassauischen Lehrervereins, dessen
Vorstandsmitglied der Verewigte lange Jahre gewesen. Nach einem ergreifenden
'El male rachamim' Gebet, das Herr Nutzbaum dem toten Freunde am Grabe sang,
sprachen noch der katholische und der evangelische Pfarrer von
Hadamar, die in tief empfundenen Worten ihrem Mitgefühl über den Heimgang
des auch in ihren Kirchengemeinden beliebten Mannes Ausdruck gaben." Artikel
im "Israelitischen Familienblatt" vom 1. Oktober 1930: "Hadamar
(Hessen-Nassau). Im Alter von 67 Jahren starb nach schwerem Leiden Lehrer
Adolf Oppenheimer, Über 40 Jahre war er der religiöse Führer der
Gemeinde. Mit unendlicher Hingebung widmete er sich seinem Amte, von dem er
sich vor etwa drei Jahren in den Ruhestand zurückzog. Ein selten großer
Trauerzug zeugte von der Beliebtheit des Verstorbenen. Am Grabe sprachen:
Rabbiner Dr. Lazarus, Wiesbaden, Lehrer Hartogsohn für die
Gemeinde, Dr. Löwenstein , Bad Nauheim, Oberkantor Nussbaum,
Wiesbaden, im Auftrag des israelitischen nassauischen Lehrervereins, dessen
Vorstandsmitglied der Verewigte lange Jahre gewesen. Nach einem ergreifenden
'El male rachamim' Gebet, das Herr Nutzbaum dem toten Freunde am Grabe sang,
sprachen noch der katholische und der evangelische Pfarrer von
Hadamar, die in tief empfundenen Worten ihrem Mitgefühl über den Heimgang
des auch in ihren Kirchengemeinden beliebten Mannes Ausdruck gaben."
|
Der langjährige Vorbeter der
Gemeinde Emanuel Liebmann emigriert nach Palästina (1938)
 Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für die Synagogengemeinden in Preußen
und Norddeutschland" vom 1. September 1938: "Aus Hadamar
(Hessen Nassau). Kurz vor den kommenden Herbstfeiertagen scheidet der
langjährige Vorbeter unserer Gemeinde, Herr Emanuel Liebmann, von
uns, um sich im Lande der Väter eine neue Zukunft aufzubauen. Mit seiner
klangvollen Stimme hat er es verstanden, den Gottesdienst zu erhebenden
Stunden zu gestalten. Wir danken ihm für seine Uneigennützigkeit, mit der er
sich in den Dienst der heiligen Sache gestellt hat. Möge ihm im Heiligen
Lande ein neues Glück beschieden sein. " Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für die Synagogengemeinden in Preußen
und Norddeutschland" vom 1. September 1938: "Aus Hadamar
(Hessen Nassau). Kurz vor den kommenden Herbstfeiertagen scheidet der
langjährige Vorbeter unserer Gemeinde, Herr Emanuel Liebmann, von
uns, um sich im Lande der Väter eine neue Zukunft aufzubauen. Mit seiner
klangvollen Stimme hat er es verstanden, den Gottesdienst zu erhebenden
Stunden zu gestalten. Wir danken ihm für seine Uneigennützigkeit, mit der er
sich in den Dienst der heiligen Sache gestellt hat. Möge ihm im Heiligen
Lande ein neues Glück beschieden sein. " |
Aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben
Gründung des Vereines zur Unterstützung bedrängter
russischer Juden (1882)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Februar 1882: "Hadamar, 15.
Februar 1882. Infolge Ihres Artikels in Nr. 6 des Israelit: 'Unsere
Glaubensgenossen in Russland' hat sich in hiesiger Gemeinde ein Verein
zur Unterstützung der bedrängten Brüder in Russland gebildet. Die
Mitglieder zahlen einen wöchentlichen Beitrag (Isch kematnat Jodo,
d.i.: jeglicher nach dem, was seine Hand geben kann, 5. Mose 16,17)
und werden diese Gelder monatlich an eine größere Sammelstelle gesendet.
Hoffentlich werden andere Gemeinden ein Gleiches tun, da nur bei vereinten
Kräften, wenn Jeder sein Scherflein beiträgt, es möglich wird, den
armen, schwer Heimgesuchten etwas Linderung zu verschaffen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Februar 1882: "Hadamar, 15.
Februar 1882. Infolge Ihres Artikels in Nr. 6 des Israelit: 'Unsere
Glaubensgenossen in Russland' hat sich in hiesiger Gemeinde ein Verein
zur Unterstützung der bedrängten Brüder in Russland gebildet. Die
Mitglieder zahlen einen wöchentlichen Beitrag (Isch kematnat Jodo,
d.i.: jeglicher nach dem, was seine Hand geben kann, 5. Mose 16,17)
und werden diese Gelder monatlich an eine größere Sammelstelle gesendet.
Hoffentlich werden andere Gemeinden ein Gleiches tun, da nur bei vereinten
Kräften, wenn Jeder sein Scherflein beiträgt, es möglich wird, den
armen, schwer Heimgesuchten etwas Linderung zu verschaffen." |
40-jähriges Bestehen des Jüdischen
Frauenvereins und Bildung einer Ortsgruppe des Reichsbundes jüdischer
Frontsoldaten (1931)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Februar 1931: "Hadamar,
5. Februar (1931). Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Jüdischen
Frauenvereins hatten sich die Mitglieder desselben am Samstag, 24. Januar
zu einer schlichten Feier zusammengefunden. Mit Rücksicht auf die
wirtschaftliche Lage, sah man von einer großen Feier ab. Herr Lehrer und
Kantor Karl Hartogsohn überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde und
gedachte in seiner Rede besonders der Verdienste des Vereins.
Anschließend trug Frau Franziska Neuhaus in humorvollen Reimen vor. Der
wohl gelungene Abend wird den Besuchern noch lange in Erinnerung
bleiben." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Februar 1931: "Hadamar,
5. Februar (1931). Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Jüdischen
Frauenvereins hatten sich die Mitglieder desselben am Samstag, 24. Januar
zu einer schlichten Feier zusammengefunden. Mit Rücksicht auf die
wirtschaftliche Lage, sah man von einer großen Feier ab. Herr Lehrer und
Kantor Karl Hartogsohn überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde und
gedachte in seiner Rede besonders der Verdienste des Vereins.
Anschließend trug Frau Franziska Neuhaus in humorvollen Reimen vor. Der
wohl gelungene Abend wird den Besuchern noch lange in Erinnerung
bleiben." |
| |
 Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"
vom 18. Februar 1931: "Hadamar. (Jubiläum des jüdischen
Frauenvereins.) Das vierzigjährige Bestehen des Israelitischen
Frauenvereins wurde von den Beteiligten durch eine schlichte Feier
begangen. Lehrer und Kantor Hartogsohn überbrachte die Glückwünsche der
Gemeinde und betonte das segensreiche Wirken des Vereins. Eine gemütliche
Zusammenkunft folgte der offiziellen Feier. - Hier hat sich eine Ortsgruppe
des Reichsbundes Jüdischer Frontsoldaten gebildet, nachdem Dr. Walter
Stern aus Mainz dazu die Anregung gab. Der Vorstand der auch die
Frontkämpfer von Frickhofen und Langendernbach
umfassenden Ortsgruppe besteht aus dem Herren Adolf Neuhaus, Hermann Honi,
Emanuel Liebmann, Hadamar, und Rosenthal, Frickhofen". Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"
vom 18. Februar 1931: "Hadamar. (Jubiläum des jüdischen
Frauenvereins.) Das vierzigjährige Bestehen des Israelitischen
Frauenvereins wurde von den Beteiligten durch eine schlichte Feier
begangen. Lehrer und Kantor Hartogsohn überbrachte die Glückwünsche der
Gemeinde und betonte das segensreiche Wirken des Vereins. Eine gemütliche
Zusammenkunft folgte der offiziellen Feier. - Hier hat sich eine Ortsgruppe
des Reichsbundes Jüdischer Frontsoldaten gebildet, nachdem Dr. Walter
Stern aus Mainz dazu die Anregung gab. Der Vorstand der auch die
Frontkämpfer von Frickhofen und Langendernbach
umfassenden Ortsgruppe besteht aus dem Herren Adolf Neuhaus, Hermann Honi,
Emanuel Liebmann, Hadamar, und Rosenthal, Frickhofen". |
Spendenaufrufe
Aufruf zu Spenden für die arme jüdische Witwe Moses Prag
(1878)
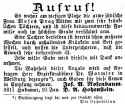 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Januar 1878: "Aufruf! Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Januar 1878: "Aufruf!
Es wohnt am
hiesigen Platze die arme jüdische Frau Moses Prag Witwe mit zwei sehr kränklichen
Töchtern, und ist diese bedauernswerte Familie auch im höchsten Grad
verschämt arm. Eine Tochter derselben ist bereits schon mehrere Wochen
durch anhaltendes Kränkeln ans Bett gefesselt, und wissen die
Unterzeichneten, dass die Armut sehr tief greifend ist.
Jede milde Gabe
wird dieselbe mit Dank annehmen.
Die Wahrheit dieser Angabe wird auf
Anfragen Herr Bezirksrabbiner Dr. Wormser in
Weilburg bezeugen*, auch
Gaben für diese Armen in Empfang nehmen.
Hadamar, 10. Januar Jos. A.
Rosenbaum. D.A. Hohenstein.
(*Bescheinigung liegt bei uns zur Einsicht
offen. Die Expedition)." |
Hilferuf des Lehrers Adolf
Oppenheimer für eine arme jüdische Familie in Sch. (1897)
Anmerkung: es handelt sich bei der Gemeinde Sch. sicher um
Schupbach, wo Adolf Oppenheimer damals u.a.
den Religionsunterricht hielt.
 Anzeige in "Der Israelit" vom 19. Juli 1897: "
Not! Herzliche Bitte! Not! Anzeige in "Der Israelit" vom 19. Juli 1897: "
Not! Herzliche Bitte! Not!
In unserer Nachbargemeinde Sch. wohnt eine gänzlich verarmte, aller
Mittel entblößte, jüdische Familie ihn drückendster Not. Der Vater und
Ernährer, ein 83-jähriger halberblindet der Kreis ist nicht mehr im Stande
seinem Berufe nachzugehen und seine etwa 30 Jahre alte Tochter ist schon
seit Jahren von Krankheit heimgesucht. Die kleine arme Gemeinde Schupbach
bietet alles auf, vermag aber nicht die durch Krankheit und Pflege
entstehenden bedeutenden Kosten aufzubringen. Ich appelliere daher im Namen
der Armen an die Wohltätigkeit edler Glaubensgenossen, indem hier
Gelegenheit geboten wahrhafte Wohltätigkeit zu üben.
Spenden nimmt entgegen: Adolf Oppenheimer, Lehrer, Hadamar
(Nassau).
Auch die Geschäftsstelle dieses Blattes ist gerne bereit, Gaben unter Nummer
4102 anzunehmen und weiter zu befördern. " |
Hilferuf des Lehrers Adolf Oppenheimer für eine in Thalheim in Not befindliche jüdische
Familie (1903)
 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. März 1903: "Not! Hilferuf! Not! Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. März 1903: "Not! Hilferuf! Not!
In dem benachbarten Orte Th. wohnt eine der ärmsten jüdischen
Familien, bestehend aus drei weiblichen, erwerbsunfähigen Personen, von
denen zwei über 60 resp. 70 Jahre alt sind. Diese Armen besitzen ein
kleines Häuschen, ihr einziges Obdach, das dem Einsturze nahe ist, und
polizeilicherseits geschlossen, beziehungsweise niedergelegt werden soll,
wenn es nicht bald einer gründlichen Renovierung unterzogen wird. Es sind
etwa 7-800 Mark erforderlich um die Reparatur vornehmen zu können und
richte ich daher an alle edeldenkende, mitleidsvolle Glaubensgenossen die
dringende Bitte, ihr Scherflein dazu beizutragen, um das einzige Obdach
diesen Ärmsten der Armen erhalten zu können. Zur Annahme und Weiterbeförderung
von Spenden ist der Unterzeichnete
gerne bereit und wird über den Empfang an dieser Stelle quittiert. Adolf
Oppenheimer, Lehrer." |
Hilfeaufruf für einen "armen
Handelsmann" aus Hadamar (1911)
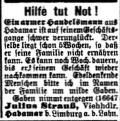 Anzeige in "Der Israelit" vom 31. August 1911:
"Hilfe tut Not! Anzeige in "Der Israelit" vom 31. August 1911:
"Hilfe tut Not!
Ein armer Handelsmann aus Hadamar ist auf seinem Geschäftsgange schwer
verunglückt. Derselbe liegt schon fünf Wochen, sodass er seine Familie nicht
ernähren kann. Es kann noch Wochen dauern, bis er seinem Geschäft wieder
nachkommen kann. Edeldenkende Menschen bitte ich im Namen der Familie um
milde Gaben.
Gaben nimmt entgegen Julius Strauss, Viehhändler, Hadamar bei
Limburg an der Lahn. " |
Berichte zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
Suizid des Schriftstellers Gustav Salmony aus Hadamar
(1894)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. Januar 1894: "Süddeutsche Blätter berichten von zwei
Selbstmorden. Der Schriftsteller Gustav Salmony aus Hadamar
hat in einem hinterlassenen Briefe angegeben, er nehme sich das Leben,
weil er mit seinen 'dramatischen Arbeiten nirgends landen' könne und
daher auf die 'schriftstellerische Karriere verzichten' müsse. - In
Würzburg hat sich der jüdische Buchhändler Goldstein im Alter von 72
Jahren erschossen. Sein Spezialgeschäft war katholische
Theologie." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. Januar 1894: "Süddeutsche Blätter berichten von zwei
Selbstmorden. Der Schriftsteller Gustav Salmony aus Hadamar
hat in einem hinterlassenen Briefe angegeben, er nehme sich das Leben,
weil er mit seinen 'dramatischen Arbeiten nirgends landen' könne und
daher auf die 'schriftstellerische Karriere verzichten' müsse. - In
Würzburg hat sich der jüdische Buchhändler Goldstein im Alter von 72
Jahren erschossen. Sein Spezialgeschäft war katholische
Theologie." |
| |
 Artikel
in "Der Gemeindebote" vom 19. Januar 1894: Artikel
in "Der Gemeindebote" vom 19. Januar 1894:
derselbe Text wie oben in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums".
|
Arthur Liebmann tritt in die
Studentenverbindung Rheno-Siledia in Bonn ein (1910)
Anmerkung: K.C. ist der Kartell-Convent der Verbindungen Deutscher Studenten
Jüdischen Glaubens.
 Mitteilung in "KC-Blätter" vom 1. Januar 1910:
"Rheno - Silesia - Bonn: Es traten in die Verbindung stud.
Arthur Liebmann aus Hadamar ein." Mitteilung in "KC-Blätter" vom 1. Januar 1910:
"Rheno - Silesia - Bonn: Es traten in die Verbindung stud.
Arthur Liebmann aus Hadamar ein." |
Arthur Aron aus Hadamar tritt der
Studenten-Verbindung Licaria bei (1912)
Anmerkung: zu K.C. wie oben. Zur Studentenverbindung Licaria München vgl.
https://objekte.jmberlin.de/person/jmb-pers-365458 .
Zu Arthur Aron siehe Martina Hartmann-Menz: Arthur Aron aus Hadamar.
Dokumentation 2017. Eingestellt
als pdf-Datei
 Mitteilung in "KC-Blätter" vom 1. März 1912: "Licaria
... In die Verbindung trat neu ein: stud.jur.et rer.pol. Arthur Aron
aus Hadamar (Hessen-Nassau)." Mitteilung in "KC-Blätter" vom 1. März 1912: "Licaria
... In die Verbindung trat neu ein: stud.jur.et rer.pol. Arthur Aron
aus Hadamar (Hessen-Nassau)." |
Goldene Hochzeit von Moses Rosenthal und Frau (1915)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juli 1915: "Am
Sonntag, den 4. Juli feierten die Eheleute Moses Rosenthal und Frau die
Goldene Hochzeit in selten geistiger und körperlicher Frische. Aus Nah
und Fern kamen Verwandte und Bekannte herbeigeeilt und überaus zahlreich
waren die Gratulationen, welche telegraphisch und schriftlich einliefen.
Die Feier in der Synagoge verlief sehr würdig. Herr Lehrer Oppenheimer
begrüßte in schöner Ansprache das Jubelpaar und hob hervor, dass die
Eheleute es verstanden haben, ihre Kinder als fromme, gute Jehudim zu
erziehen. Alsdann sprach der erste Vorsteher der Gemeinde, Herr H.
(Hermann) Oppenheimer, im Namen der Gemeinde und überbrachte gleichzeitig im
Auftrage des königlichen Landrats dessen Glückwünsche. Im Auftrage
Seiner Majestät des Kaisers überreichte er alsdann die goldene
Ehejubiläums-Medaille. Hierauf sprach der Bürgermeister Dr. Decher im
Auftrage der Stadt. Mit einem Schlussgesang schloss die schöne
Feier." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juli 1915: "Am
Sonntag, den 4. Juli feierten die Eheleute Moses Rosenthal und Frau die
Goldene Hochzeit in selten geistiger und körperlicher Frische. Aus Nah
und Fern kamen Verwandte und Bekannte herbeigeeilt und überaus zahlreich
waren die Gratulationen, welche telegraphisch und schriftlich einliefen.
Die Feier in der Synagoge verlief sehr würdig. Herr Lehrer Oppenheimer
begrüßte in schöner Ansprache das Jubelpaar und hob hervor, dass die
Eheleute es verstanden haben, ihre Kinder als fromme, gute Jehudim zu
erziehen. Alsdann sprach der erste Vorsteher der Gemeinde, Herr H.
(Hermann) Oppenheimer, im Namen der Gemeinde und überbrachte gleichzeitig im
Auftrage des königlichen Landrats dessen Glückwünsche. Im Auftrage
Seiner Majestät des Kaisers überreichte er alsdann die goldene
Ehejubiläums-Medaille. Hierauf sprach der Bürgermeister Dr. Decher im
Auftrage der Stadt. Mit einem Schlussgesang schloss die schöne
Feier." |
70. Geburtstag von Hermann Oppenheimer (1936)
Anmerkung: Hermann Oppenheimer (geb. 28.7.1866 in Blessenbach,
umgekommen Februar 1943 im Ghetto Theresienstadt) war der Sohn von Zaddok
(Heinrich) Oppenheimer. 1892 heiratete er Hermine (Hannchen) geb. Rosenthal (geb.
1864 in Willmenrod, gestorben in Hadamar),
eine Tochter von Löw Rosenthal und Betty geb. Strauss. Die beiden hatten zwei
Töchter: Betty (Betti, Elisabeth, 1893 Hadamar - ermordet 1942, war
verheiratet mit Sally/Sali Jüngster aus Hadamar, 1883 - ermordet 1942)
und Sidonie (1895 Hadamar - ?).
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juli 1936:
"Tann, 15. Juli (1936). Herr
Hermann Oppenheimer, langjähriger Kultusvorsteher der Gemeinde Hadamar
(Kreis Limburg) begeht am 28. Juli seinen 70. Geburtstag. Möge es dem
verdienten Jubilar vergönnt sein, noch recht lange Jahre gesund und
glücklich im Kreise seiner Kinder und Enkelkinder zu leben. (Alles Gute) bis
120 Jahre." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juli 1936:
"Tann, 15. Juli (1936). Herr
Hermann Oppenheimer, langjähriger Kultusvorsteher der Gemeinde Hadamar
(Kreis Limburg) begeht am 28. Juli seinen 70. Geburtstag. Möge es dem
verdienten Jubilar vergönnt sein, noch recht lange Jahre gesund und
glücklich im Kreise seiner Kinder und Enkelkinder zu leben. (Alles Gute) bis
120 Jahre." |
80. Geburtstag von Nathan Benjamin
(1937)
Anmerkung: es handelt sich um Nathan Benjamin, geboren 1. September
1857 in Langendernbach (nicht:
Langensassbach). Nathan Benjamin lebte in Langendernbach. Er wurde am 1.
September 1942 ab Frankfurt am Main in das Ghetto Theresienstadt deportiert, wo
er am 1. Oktober 1942 umgekommen ist.
 Mitteilung in "Der Schild" vom 11. September 1937: "Hadamar.
Am 1. September feierte Herr Nathan Benjamin Langendernbach, seinen 80.
Geburtstag. Er ist der Vater unseres Kameraden Siegfried Benjamin." Mitteilung in "Der Schild" vom 11. September 1937: "Hadamar.
Am 1. September feierte Herr Nathan Benjamin Langendernbach, seinen 80.
Geburtstag. Er ist der Vater unseres Kameraden Siegfried Benjamin." |
70. Geburtstag von Lehrer Siegmund
Rosenthal (1938)
 Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für die Synagogengemeinden in Preußen
und Norddeutschland" vom 1. Februar 1938: "Hadamar. Am 21.
Dezember vorigen Jahres konnte Herr Siegmund Rosenthal sein 70.
Lebensjahr vollenden. Seit Jahren widmet er mit warmen menschlichen
Empfinden alle seine berufsfreie Zeit der Mitarbeit im Vorstand der
Kultusgemeinde Hadamar und versieht auch das Amt des Toravorlesers." Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für die Synagogengemeinden in Preußen
und Norddeutschland" vom 1. Februar 1938: "Hadamar. Am 21.
Dezember vorigen Jahres konnte Herr Siegmund Rosenthal sein 70.
Lebensjahr vollenden. Seit Jahren widmet er mit warmen menschlichen
Empfinden alle seine berufsfreie Zeit der Mitarbeit im Vorstand der
Kultusgemeinde Hadamar und versieht auch das Amt des Toravorlesers." |
Über die Familie Schönberg
Siehe Beitrag von Martina Hartmann-Menz: Franziska, Otto und Bertha
Schönberg aus Hadamar. Dokumentation 07/2016. Als
pdf-Datei eingestellt.
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige der Porzellan-, Glas-,
Galanterie- usw.- Handlung H. Rosenthal (1885)
 Anzeige in "Der Israelit" vom 16. März 1885: "Lehrling
mit guten Schulkenntnissen gesucht. Anzeige in "Der Israelit" vom 16. März 1885: "Lehrling
mit guten Schulkenntnissen gesucht.
H. Rosenthal in Hadamar in Nassau.
Porzellan-, Glas-, Galanterie-, Kurz- und Spielwaren en gros & en détail." |
Lehrling von Sattlermeister Max
Neuhaus gesucht (1891)
 Anzeige in "Der Israelit" vom 9. März 1891: "Ein kräftiger
Junge kann per 1. April bei dem Unterzeichneten in die Lehre treten.
Kost und Logis gegen Vergütung im Hause. Samstags geschlossen.
Anzeige in "Der Israelit" vom 9. März 1891: "Ein kräftiger
Junge kann per 1. April bei dem Unterzeichneten in die Lehre treten.
Kost und Logis gegen Vergütung im Hause. Samstags geschlossen.
Max Neuhaus, Sattler und Polsterer. Hadamar (Nassau). " |
Lehrer Oppenheimer sucht für einen
jungen Mann eine Stelle (1901)
 Anzeige in "Der Israelit" vom 3. Januar 1901: "Kolonialwaren
Engros oder Landesprodukten. Anzeige in "Der Israelit" vom 3. Januar 1901: "Kolonialwaren
Engros oder Landesprodukten.
Junger Mann, 17 Jahre alt, in allen Comptoir- und Lagerarbeiten vertraut,
sucht unter bescheidenen Ansprüchen passende Stellung.
Lehrer A. Oppenheimer,
Hadamar, Nassau. ." |
Anzeige der Frau von Hermann
Rosenthal - Haushaltshilfe gesucht (1903)
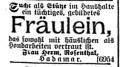 Anzeige in "Der Israelit" vom 9. November 1903: "Suche
als Stütze im Haushalte ein tüchtiges, gebildetes Anzeige in "Der Israelit" vom 9. November 1903: "Suche
als Stütze im Haushalte ein tüchtiges, gebildetes
Fräulein, das sowohl mit häuslichen als Handarbeiten vertraut ist.
Frau Hermann Rosenthal, Hadamar." |
Die Geschwister Prag bieten
Sabbatlampen und anderes Inventar an (1904)
Anmerkung (nach Paul Arnsberg S. 313): Über die Grenzen Nassaus hinaus
bekannt war das Antiquitätengeschäft von Mina Prag und Bette Prag; die beiden
Schwestern waren ledig und hatten ihr Geschäft in einem winzigen Häuschen. Bette
Prag soll geistig etwas behindert gewesen sein; Mina Prag lebte 1931 noch in
Hadamar, wo sie 1857 geboren wurde. Es wird berichtet, dass die Kunden von Mina
Prag aus höchsten Kreisen stammten; sogar mit dem holländischen Königshaus
sollen Geschäfte abgeschlossen worden sein.
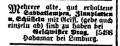 Anzeige in "Der Israelit" vom 4. Oktober 1904: "
Mehrere alte, gut erhaltene Sabbatlampen Zinnplatten und Schüsseln mit
Griff, (gebe auch einzeln ab) sind zu haben bei Anzeige in "Der Israelit" vom 4. Oktober 1904: "
Mehrere alte, gut erhaltene Sabbatlampen Zinnplatten und Schüsseln mit
Griff, (gebe auch einzeln ab) sind zu haben bei
Geschwister Prag,
Hadamar bei Limburg" |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst wurden die Gottesdienst in der Betstube eines jüdischen
Privathauses abgehalten. Dieser hatte allerdings nur 29 Plätze, sodass bei der
steigenden Zahl der jüdischen Einwohner eine neue Synagoge spätestens in dem
1830er-Jahren dringend geboten erschien. 1839 konnte mit dem Bau einer Synagoge begonnen
werden. Die Pläne hatte ein Werkmeister namens Hilleritz ausgefertigt. Am 25.
Juni 1841 wurde die Synagoge mit einem großen Fest für den ganzen Ort eingeweiht.
Hierzu liegt ein
Bericht in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. September 1841 vor.
Interessanterweise wurde dabei ein Bericht aus einer nichtjüdischen
"Allgemeinen Kirchenzeitung" übernommen:
 Hadamar. Die Allgemeine Kirchenzeitung enthält
folgende Korrespondenz: Hadamar. Am 25. Juni dieses Jahres fand hier die
feierliche Einweihung der neuen israelitischen Synagoge statt. Aus dem engen
Raume des bisherigen Bethauses bewegte sich der Zug mit Musik nach dem neuen
Gotteshause; voran zog mit ihrem Lehrer die Schar der festlich geschmückten
israelitischen Jugend, der sich auch mehrere Kinder aus der christlichen
Elementarschule angeschlossen hatten; dann folgte, unter einem blauen Traghimmel
einherschreitend, der zur Einweihung berufene Rabbiner Herr Dr. S. Wormser
von Schwalbach, umgeben von den Mitgliedern der Gemeinde, welche die Pergamentrollen
des Gesetzes trugen, und begleitet von einem zahlreichen Gefolge seiner
Glaubensgenossen aus der Stadt und vom Lande. In dem festlich mit Blumengewinden
verzierten, anständig und würdevoll eingerichteten Tempel hatten sich die
Behörden des herzoglichen Amtes, der Stadtvorstand, die christliche
Geistlichkeit und besonders mehrere Landpfarrer, die Lehrer des Pädagogs und
viele Honoratioren und Bürger der Stadt eingefunden. - Hadamar. Die Allgemeine Kirchenzeitung enthält
folgende Korrespondenz: Hadamar. Am 25. Juni dieses Jahres fand hier die
feierliche Einweihung der neuen israelitischen Synagoge statt. Aus dem engen
Raume des bisherigen Bethauses bewegte sich der Zug mit Musik nach dem neuen
Gotteshause; voran zog mit ihrem Lehrer die Schar der festlich geschmückten
israelitischen Jugend, der sich auch mehrere Kinder aus der christlichen
Elementarschule angeschlossen hatten; dann folgte, unter einem blauen Traghimmel
einherschreitend, der zur Einweihung berufene Rabbiner Herr Dr. S. Wormser
von Schwalbach, umgeben von den Mitgliedern der Gemeinde, welche die Pergamentrollen
des Gesetzes trugen, und begleitet von einem zahlreichen Gefolge seiner
Glaubensgenossen aus der Stadt und vom Lande. In dem festlich mit Blumengewinden
verzierten, anständig und würdevoll eingerichteten Tempel hatten sich die
Behörden des herzoglichen Amtes, der Stadtvorstand, die christliche
Geistlichkeit und besonders mehrere Landpfarrer, die Lehrer des Pädagogs und
viele Honoratioren und Bürger der Stadt eingefunden. - |
 Nach den üblichen
Gebeten und Choralgesängen hielt der Rabbine Dr. Wormser vor dem Altare über
1. Chronik 29,15.16 (nach Luthers Übersetzung 1. Chronik 30,15.16, in der Vulgata I. Paralopom. 29,15.16) die Einweihungsrede, worin er nach einer
geistigen Auffassung der mosaischen Lehre über die Bestimmung des Gotteshauses
und insbesondere über die echte Gottesverehrung im Geiste und in der Wahrheit
sich verbreitete, eine Rede, die jeden Gebildeten ansprechen musste, weil die
Wahrheiten, die sie ans Herz legte, aus dem Herzen stammen und ewig Segen
stiften, indem sie das Band des Friedens um die Herzen aller Gottesverehrer
schlingen. Die gediegene Rede schloss mit einem Gebete, worin Segenswünsche
für unsern Herzog und das herzogliche Haus, für das Vaterland, für die Stadt
Hadamar, die israelitische Gemeinde, die Vorsteher derselben und die Gründer
des Gotteshauses ausgesprochen wurden . - Dem jungen Prediger, der sich auch der
gelehrten Welt durch eine lateinische Abhandlung über die heiligen Schriften
der Hebräer und durch eine Trauerrede auf den höchstseligen Herzog Wilhelm von
Nassau bekannt gemacht hat, reichen wir freundlich die Hand und wünschen, dass
er bei einer vielleicht bald zu erwartenden neuen Organisation der
israelitischen Religionsverhältnisse eine seinen Talenten entsprechende
Stellung erhalten möge; weil wir die Überzeugung hegen, dass er, wenn er in
diesem Geiste zu lehren und zu schreiben fortfährt, nicht nur im Dienste der
Synagoge für die Bildung seiner Glaubensgenossen, sondern auch im Dienste der
Menschheit für das Reich der Wahrheit segensvoll wirken werde. Nach den üblichen
Gebeten und Choralgesängen hielt der Rabbine Dr. Wormser vor dem Altare über
1. Chronik 29,15.16 (nach Luthers Übersetzung 1. Chronik 30,15.16, in der Vulgata I. Paralopom. 29,15.16) die Einweihungsrede, worin er nach einer
geistigen Auffassung der mosaischen Lehre über die Bestimmung des Gotteshauses
und insbesondere über die echte Gottesverehrung im Geiste und in der Wahrheit
sich verbreitete, eine Rede, die jeden Gebildeten ansprechen musste, weil die
Wahrheiten, die sie ans Herz legte, aus dem Herzen stammen und ewig Segen
stiften, indem sie das Band des Friedens um die Herzen aller Gottesverehrer
schlingen. Die gediegene Rede schloss mit einem Gebete, worin Segenswünsche
für unsern Herzog und das herzogliche Haus, für das Vaterland, für die Stadt
Hadamar, die israelitische Gemeinde, die Vorsteher derselben und die Gründer
des Gotteshauses ausgesprochen wurden . - Dem jungen Prediger, der sich auch der
gelehrten Welt durch eine lateinische Abhandlung über die heiligen Schriften
der Hebräer und durch eine Trauerrede auf den höchstseligen Herzog Wilhelm von
Nassau bekannt gemacht hat, reichen wir freundlich die Hand und wünschen, dass
er bei einer vielleicht bald zu erwartenden neuen Organisation der
israelitischen Religionsverhältnisse eine seinen Talenten entsprechende
Stellung erhalten möge; weil wir die Überzeugung hegen, dass er, wenn er in
diesem Geiste zu lehren und zu schreiben fortfährt, nicht nur im Dienste der
Synagoge für die Bildung seiner Glaubensgenossen, sondern auch im Dienste der
Menschheit für das Reich der Wahrheit segensvoll wirken werde. |
Die Synagoge in Hadamar hatte 82 Männer- und 42 Frauenplätze. Äußerlich
auffallend ist ihr Stil mit den stark gotisierenden Fenster- und
Portalrahmungen, da der gotische Baustil bei Synagogen als der "typisch
deutsche Baustil" nur selten vorkommt.
1892 konnte mit einem Fest für die ganze Stadt das 50-jährige Bestehen der
Synagoge gefeiert werden. Bezirksrabbiner Dr. A. Lewinsky aus
Weilburg hielt die
Festrede.
50-jähriges Bestehen der Synagoge
(1892)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Juli 1892: "Hadamar. In unserer
Zeit, in welcher die Wogen des Antisemitismus so hoch gehen, ist es
besonders erfreulich von einem Akt wahrer Toleranz und Humanität
berichten zu können. – Der erste Tag des heiligen Schabuotfestes war für
die hiesige israelitische Gemeinde ein besonderer Freudentag, galt es doch
an demselben das 50jährige Bestehen unseres Gotteshauses zu feiern.
Bereits am Morgen hatten die Bürger unserer Stadt ohne Unterschied der
Konfession den Straßen ein Festgewand angelegt, als sichtbares Zeichen,
dass der Klassen- und Rassenhass, der auch in unserer Provinz sich geltend
macht, in ihrer Mitte keinen Boden gefunden. Die öffentlichen Gebäude,
wie das Rathaus, Kloster, Konvikt u.a.m. sowie eine überaus große Anzahl
von Privathäusern prangten im Flaggenschmuck. Um 10 Uhr begann in der
herrlich geschmückten Synagoge der Festgottesdienst. Herr Bezirksrabbiner
Dr. Lewinsky aus Weilburg hielt die Festrede, in welcher er es verstand,
durch seinen wohl durchdachten, formvollendeten Vortrag die gesamte Zuhörerschaft
zu fesseln. Die Rede wird auf allgemeinen Wunsch dem Drucke übergeben
werden. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Juli 1892: "Hadamar. In unserer
Zeit, in welcher die Wogen des Antisemitismus so hoch gehen, ist es
besonders erfreulich von einem Akt wahrer Toleranz und Humanität
berichten zu können. – Der erste Tag des heiligen Schabuotfestes war für
die hiesige israelitische Gemeinde ein besonderer Freudentag, galt es doch
an demselben das 50jährige Bestehen unseres Gotteshauses zu feiern.
Bereits am Morgen hatten die Bürger unserer Stadt ohne Unterschied der
Konfession den Straßen ein Festgewand angelegt, als sichtbares Zeichen,
dass der Klassen- und Rassenhass, der auch in unserer Provinz sich geltend
macht, in ihrer Mitte keinen Boden gefunden. Die öffentlichen Gebäude,
wie das Rathaus, Kloster, Konvikt u.a.m. sowie eine überaus große Anzahl
von Privathäusern prangten im Flaggenschmuck. Um 10 Uhr begann in der
herrlich geschmückten Synagoge der Festgottesdienst. Herr Bezirksrabbiner
Dr. Lewinsky aus Weilburg hielt die Festrede, in welcher er es verstand,
durch seinen wohl durchdachten, formvollendeten Vortrag die gesamte Zuhörerschaft
zu fesseln. Die Rede wird auf allgemeinen Wunsch dem Drucke übergeben
werden.
Zu dem Festgottesdienst waren die Räte der Stadt, an deren Spitze der Bürgermeister
Mathi, die Geistlichkeit und noch viele andere achtbare Mitbürger
erschienen. Es nahm daher Herr Rabbiner Dr. Lewinsky in seiner Rede
Veranlassung mit herzlichen Dankesworten für den bekundeten Akt der
Toleranz den innigen Wunsch auszusprechen, dass, wie bisher, auch fürderhin,
der friedlich, humane Geist in Hadamars Mauern weilen möge! Vorbeter und
Chor trugen die Festgesänge meisterhaft vor." |
| |
|
Publikation der Rede von Rabbiner Dr. A. Lewinsky (1892)
|
 Anzeige
in "Der Israelit" vom 3. November 1892: "Lewinsky, A.,
Rede gehalten beim Festgottesdienst anlässlich des Geburtstages König
Willhelm II. Mark -.30. Derselbe: Rede gehalten beim Festgottesdienst
anlässlich der Feier des 50jährigen Synagogenjubiläums zu Hadamar Mark
.-40." Anzeige
in "Der Israelit" vom 3. November 1892: "Lewinsky, A.,
Rede gehalten beim Festgottesdienst anlässlich des Geburtstages König
Willhelm II. Mark -.30. Derselbe: Rede gehalten beim Festgottesdienst
anlässlich der Feier des 50jährigen Synagogenjubiläums zu Hadamar Mark
.-40." |
Beim Novemberpogrom 1938 wurde in den Morgenstunden
des 10. November durch einen SS-Trupp aus Limburg (SS-Sturm 7/78: Teil des
SS-Sturmbannes II/78 in Limburg) in der Synagoge Feuer gelegt.
Nachbarn konnten den Brand jedoch löschen. Die Inneneinrichtung wurde im
Verlauf des Tages unter anderem durch Schulkinder geschändet und
verwüstet.
Nach 1945: 1953 wurde das Synagogengebäude,
das sich schon damals in einem schlechten baulichen Zustand befand, von der
JRSO, einer Treuhandgesellschaft für jüdisches Vermögen, als Atelier an den
Scherenschnittkünstler Ernst Moritz Engert verkauft (1892-1986, siehe
Wikipedia-Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Moritz_Engert), der es jedoch mit zunehmendem Alter
nicht mehr unterhalten konnte. Nachdem das Haus bereits gravierende Schäden
aufwies, gelang es der Stadt im Jahr 1980, die ehemalige Synagoge zu
kaufen und nach historischem Vorbild zu restaurieren. Am 6. September 1982 wurde
sie als Gedenk- und Erinnerungsstätte eröffnet und wird seitdem für
Gedenkfeiern, Ausstellungen und Vortragsveranstaltungen genutzt (Kontakt siehe
unten bei "Hinweise". Eine mit Hilfe des Hessischen Hauptstaatsarchivs
erarbeitete Dokumentation informiert über die Geschichte der jüdischen
Gemeinde Hadamar). Eine erneute Sanierung ist 2020 notwendig (vgl.
Presseartikel unten).
Adresse/Standort der Synagoge: Ehemalige
Synagoge Hadamar, Nonnengasse 6, 65589 Hadamar (gegenüber dem
St.-Anna-Krankenhaus)
Hinweise:
 | Führungen (auch im Zusammenhang mit Stadtführungen) durch
die Synagoge können über die Stadtverwaltung beziehungsweise das
Fremdenverkehrsamt vereinbart werden. |
 | Kurzinformationen zu Bau und Einrichtung der
Synagoge sind kostenlos erhältlich. |
 | Der Eintritt ist frei. |
 | Öffnungszeiten nach Vereinbarung. |
 | Informationen/Kontakt über den Träger: Magistrat
der Stadt Hadamar, Rathaus, Untermarkt 1, 65589 Hadamar, Telefon: 06433/89112,
Fax: 06433/89155, E-Mail;
Ansprechpartner: Jürgen Lanio (Hauptamt);
Stadtführungen (mit Synagoge) über das Fremdenverkehrsamt der Stadt,
Telefon 06433/89157 (um rechtzeitige Anfrage wird gebeten). |
Fotos
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| November/Dezember
2010: Ausstellung in der Synagoge
"Damals - Dort" |
Artikel in der "Frankfurter Neuen
Presse" vom 13. November 2010 (Artikel):
"'Damals – Dort': Ausstellung in Synagoge
Hadamar. Am Gedenktag zur Reichspogromnacht eröffnete in der ehemaligen Synagoge in Hadamar die Ausstellung
'Damals – Dort'. Gezeigt werden Objekte des Holocaustüberlebenden Dr. Martin Kieselstein, der gemeinsam mit seiner Schwiegertochter und seiner Enkelin Maja (Foto) zur Eröffnung aus Israel anreiste. Die Gedenkstätte Hadamar hat die Ausstellung, die noch bis zum 5. Dezember geöffnet ist, in Kooperation mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Limburg und dem Verein zur Förderung der Gedenkstätte Hadamar
organisiert..." |
| |
| Januar 2011:
Gedenkfeier zum Holocaust-Gedenktag
|
Artikel von König (koe) in der "Nassauischen Neuen Presse" vom
28. Januar 2011 (Artikel):
"Gedenken an die Opfer. Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit hatte in die Synagoge geladen
Allein aus Hadamar wurden 50 Juden ermordet: Anlässlich des Holocaust-Gedenktages hatte die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit zu einer Gedenkfeier eingeladen.
Hadamar. Erfolglos kämpften zwei tragbare Heizgeräte gegen die eisige Kälte in der kleinen Synagoge an. Die zahlreichen Gäste, die zur Gedenkfeier erschienen waren, ließen ihre Mäntel an und saßen dick eingemummt in der ehemaligen Gebetsstätte. Aus Respekt vor der Tradition des Ortes setzten mehrere männliche Besucher aber eine Kippa, die traditionelle jüdische Kopfbedeckung, auf. Die Stimmung ist andächtig und ruhig, aber trotz der Temperaturen keineswegs kühl..."
|
| |
| Mai 2014:
Die Verlegung von "Stolpersteinen" ist
auch in Hadamar geplant |
Artikel in der "Nassauischen Neuen
Presse" vom 6. Mai 2014: "Stolpersteine in Hadamar Steine gegen das Vergessen
Die Aktion 'Stolpersteine' setzt nun auch in Hadamar Denkmäler: Am Donnerstag, 22. Mai, laden Bürger aus der Fürstenstadt um 19 Uhr in die Gedenkstätte Hadamar ein, um über die Verlegung der Steine zu sprechen.
Hadamar. Vertreterinnen und Vertreter der beiden Kirchen und der Gedenkstätte Hadamar unterstützen das Projekt, das an die Opfer des Nationalsozialismus vor Ort erinnern soll..."
Link
zum Artikel |
Weiterer Artikel in der "Naussauischen
Neuen Presse" vom 27. Mai 2014: "Stolpersteine auch für
Hadamar?"
Link
zum Artikel |
Weiterer Artikel in der "Frankfurter
Neuen Presse" vom 1. Juli 2014: "Stolpersteine sollen an
Nazi-Opfer erinnern"
Link
zum Artikel |
| |
| November
2014: Stadtrundgang zum Gedenken an
die Pogromnacht 1938 |
Artikel von Christof Hüls in
der "Frankfurter Neuen Presse" vom 7. November 2014: "Reichspogromnacht Im Spiegel der dunklen Zeitgeschichte
Fast einhundert Menschen nahmen am Mittwochabend am Stadtrundgang im Gedenken an die Reichspogromnacht teil. Die Hadamarer setzten damit ein Zeichen, dass sie nicht vergessen wollen, was am 9. November 1938 auch in der Fürstenstadt
passierte...
Link
zum Artikel |
| |
| Februar
2015: Fotos und weitere Dokumente
gesucht |
Aufruf in der "Nassauischen
Neuen Presse" vom 26. Februar 2015: "Gedenkstätte sucht historische Fotos und Postkarten.
Hadamar. Die Gedenkstätte Hadamar und die AG „Stolpersteine“ in Hadamar suchen historische Fotos und Postkarten aus der Zeit vom 19. Jahrhundert bis Anfang der 1950er Jahre. Im Rahmen der AG „Stolpersteine“ werden zusätzliche Materialien für die Verlegung der Stolpersteine im Herbst gesucht.
Dabei geht es insbesondere um Fotos und möglicherweise Dokumente zu den jüdischen Mitbürgern, die in Hadamar lebten. Die Gedenkstätte Hadamar interessiert sich besonders für Fotos und Postkarten, auf denen die Gebäude der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt bzw. des Klosters zu sehen sind. Gern werden auch Fotos und weitere Dokumente zu den ehemaligen Angestellten oder Patienten entgegengenommen.
Die Initiatoren bitten um eine leihweise Überlassung; falls gewünscht, übernimmt die Gedenkstätte Hadamar die Fotos auch gern in ihrem Bestand und garantiert damit eine fachgerechte Aufbewahrung und Zugänglichkeit.
Kontakt: Philipp Erk, Telefon: 0 64 33/91 71 72, E-Mail". |
| |
Dezember
2017: Erinnerung an die Synagoge in
Hadamar
Artikel von Michael Skoruppa in hagalil.com: http://www.hagalil.com/2017/12/die-synagoge-von-hadamar/ |
| |
|
März 2020:
Eine erneute Sanierung der
Synagoge ist notwendig |
Artikel von Kerstin Kaminsky in
der "Frankfurter Neuen Presse" vom 6. März 2020: "Hadamar. Ehemalige
Synagoge in Hadamar braucht dringend Pflege
Der Stadtführer möchte mit der Synagoge die Erinnerung an die jüdische
Gemeinde gerne wachhalten. Die Stadt verspricht ein Konzept.
Hadamar - Am einstigen spirituellen Zentrum der jüdische Bevölkerung von
Hadamar nagt der Zahn der Zeit. Seit der Grundsanierung von 1980 unter
Bürgermeister Hermann Bellinger ist hier wenig geschehen. 'In meinen Augen
hat die Stadt die Synagoge vergessen', beklagt Stadtführer Harald Zumpe. Er
findet es wichtig, dass dieses erhaltenswerte Denkmal gepflegt und mit neuem
Leben erfüllt wird. Das ehemalige jüdische Bethaus in der Hadamarer
Nonnengasse hat als eine der wenigen hessischen Synagogen die
Reichspogromnacht überdauert. Zwar wurde dort in den frühen Morgenstunden
des 10. November 1938 ein Brand gelegt, doch als ein Nachbar aus der
Nonnengasse um 6 Uhr zum Bahnhof gehen wollte, um zur Arbeit zu fahren,
entdeckte er den Feuerschein und schlug Alarm. Schnell fanden sich weitere
Nachbarn ein und gemeinsam betraten die Männer die aufgebrochene Synagoge.
Zum Glück fanden sie nur einiges Gerät sowie Papiere, Gewänder, Tücher und
Wimpel auf einem Haufen brennend vor, der schnell gelöscht war.
Sicherheitshalber rückte auch noch die Feuerwehr an, hatte aber nicht viel
zu tun.
Synagoge in Hadamar: Lehrer wütete mit seinen Schülern. Deutlich
größeren Schaden als die SS-Männer bei ihrer nächtlichen Feuer-Aktion
richteten am Vormittag des 10. November 1938 junge Einheimische an. Nach dem
Bericht von Zeitzeugen sei am Vormittag ein Volksschullehrer mit den älteren
Schülern in die Synagoge eingerückt. Der Lehrer soll die Schüler
aufgefordert haben, die Ausstattung des Gotteshauses zu demolieren. Nach
Schulschluss seien auch noch Gymnasiasten hinzugekommen. Sie trieben die
Verwüstung weiter voran, indem sie das Mobiliar von der Empore hinabwarfen.
Synagoge in Hadamar: Atelier des Künstlers Ernst Moritz Engert. Nach
dem Krieg gab es in Hadamar keine Juden mehr. Die Synagoge ging in den
Besitz der JRSO, einer Treuhandgesellschaft für jüdisches Vermögen, über.
Der Hadamarer Künstler Ernst Moritz Engert erwarb im Jahr 1953 das
inzwischen ziemlich heruntergekommene Gebäude von der JRSO und richtete dort
sein Atelier ein. 1980 kaufte und sanierte die Stadt Hadamar die ehemalige
Synagoge. 'Das ist ja nun schon Jahrzehnte her. Seit damals ist dort nicht
viel geschehen', beklagt Stadtführer Harald Zumpe. Statt das Denkmal dem
weiteren Verfall preiszugeben, wünscht er sich eine Renovierung und die
regelmäßige Nutzung, zum Beispiel für Lesungen. 'Wir wollen ein Zeichen
gegen Antisemitismus setzen und die Erinnerung an das Leben und die Kultur
der jüdischen Gemeinde von Hadamar wachhalten', beschreibt er seine
Intention.
Synagoge in Hadamar: Heizung fehlt. Neben einer Renovierung der
Außenfassaden sei auch an den Fenstern der ehemaligen Synagoge einiges zu
tun. Außerdem fehlt in dem Gebäude eine Heizung. Bislang wurden zwei mobile
Öfen betrieben, wenn beispielsweise am Tag des offenen Denkmals Gäste
erwartet wurden. Die Nutzung dieser Heizgeräte ist aber inzwischen
feuerpolizeilich nicht mehr gestattet. 'Nachdem das Abbild der 'grauen
Busse' in unserer Stadtmitte aufgestellt war und auch die Gedenkstätte
erweitert und aufgewertet wird, sollte auch der ehemaligen Synagoge wieder
mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden', so Zumpe. Durch das Engagement einiger
Bürger sei es in letzter Zeit gelungen, immer mehr Menschen aus anderen
Städten für das Leben und die Sitten und Gebräuche der Hadamarer Juden zu
interessieren. Zumpe geht von steigenden Besucherzahlen aus. 'Toll wäre
zudem, wenn wir Schulgruppen in die Synagoge holen können', sagt er.
Stadt will sich in diesem Jahr um die Synagoge in Hadamar kümmern.
Ende November vergangenen Jahres hatte Harald Zumpe bei der Stadt Hadamar
die Renovierung der ehemaligen Synagoge beantragt und auch schon einen
Kostenvoranschlag für die Arbeiten an der Außenfassade vorgelegt. Ihm wurde
schriftlich zugesichert, dass im Jahresverlauf ein Konzept für die Sanierung
und spätere Nutzung erarbeitet wird, dass schließlich den politischen
Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden soll."
Link zum Artikel |
| |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. S. 310-313. |
 | ders.: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Bilder -
Dokumente. S. 81. |
 | Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 S. 93-94. |
 | dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945? Teil II. 1994. S. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 130-134. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 422-424. |
 | 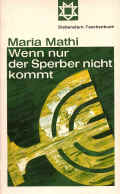 Maria Mathi: Wenn nur der Sperber nicht kommt!
Hadamar 1955. Maria Mathi: Wenn nur der Sperber nicht kommt!
Hadamar 1955.
Das Buch erschien nach 1955 in zahlreichen Neuauflagen (u.a. Siebenstern
Taschenbuch 1965( und Übersetzungen in verschiedenen Sprachen.
Es handelt sich um einen Roman über das Leben der jüdischen Hadamarer vom Ersten Weltkrieg bis zur Deportation.
Überaus einfühlsam beschrieb Maria Mathi (1889-1961) darin das Zusammenleben der Religionen bis
zur nationalsozialistischen Machtergreifung.
Das Buch wird heute von der Kulturvereinigung Hadamar e.V. herausgegeben. Es ist in der Gedenkstätte erhältlich.
Vgl. zur Autorin den Wikipedia-Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Mathi.
Dazu dort genannte Beiträge von Martina Hartmann-Menz über Maria Mathi. |
 | Peter Paul Schweitzer: Das Schicksal der Hadamarer
Juden. Die israelitische Gemeinde Hadamar und ihre Synagoge. Hrsg.:
Magistrat der Stadt Hadamar. 2. Aufl. Hadamar 1989. |
 | ders.: Juden im nassauischen Hadamar. Augstieg und
Untergang. CD-Rom. Hrsg.: Magistrat der Stadt Hadamar 2006.
Enthält die Geschichte der Hadamarer Juden, viele Originaltexte,
detaillierte Darstellungen der jüdischen Einwohner mit Lebensdaten, -läufen
und Stammbäumen. |
 | Monica Kingreen: Jüdische Kranke als Patienten der Landesheilanstalt Hadamar (1909-1940) und als Opfer der Mordanstalt Hadamar (1941-1945), in: Uta George, Georg Lilienthal, Volker Roelcke, Peter Sandner, Christina Vanja (Hg.): Hadamar - Heilstätte-Tötungsanstalt-Therapiezentrum, Marburg 2006, S. 189-215. |
 |  Andrea
von Treuenfeld: In Deutschland eine Jüdin, eine Jeckete in Israel.
Geflohene Frauen erzählen ihr Leben. Gütersloher Verlagshaus 2011. Andrea
von Treuenfeld: In Deutschland eine Jüdin, eine Jeckete in Israel.
Geflohene Frauen erzählen ihr Leben. Gütersloher Verlagshaus 2011.
In diesem Buch findet sich S. S. 86-93 die Lebensgeschichte von Herta
Proter, geboren als Herta Liebmann am 30. Mai 1912 in Hadamar (Vorfahren aus
Ellar), lebte später in Qiryat Motzkin
(Israel). |
 | Martina Hartmann-Menz: Franziska, Otto und Bertha
Schönberg aus Hadamar. Dokumentation 2017. Eingestellt
als pdf-Datei (Beitrag wurde als Grundlage erstellt für die in
2017 zu verlegenden "Stolpersteine" für die drei Mitglieder der
Familie Schönberg) |
 | dies.: Die Kaufmannsfamilie Rosenthal aus Hadamar.
Dokumentation 2017. Eingestellt
als pdf-Datei (Beitrag wurde als Grundlage erstellt für die in 2017 zu
verlegenden "Stolpersteine" für vier Mitglieder der Familie
Rosenthal; Siegmund Rosenthal war Kultusvorsteher der jüdischen Gemeinde
Hadamar). |
 | dies.: Familie Klein aus Frankfurt. Dokumentation 2017. Eingestellt
als pdf-Datei (die Tochter Selma Klein war in der Landesheil- und
Pflegeanstalt Hadamar untergebracht. Für sie ist in den Akten belegt, dass
sie die Hadamarer Synagoge besuchte. Selma Klein war in den 1930er-Jahren
als Hausmädchen bei einer jüdischen Familie in Hadamar tätig. Mit Blick
auf die sozialen Verhältnisse der Hadamarer Familien jüdischer Herkunft
ist mit höchster Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass sie bei Familie
Rosenthal arbeitete. Selma Klein war zwar jüdischer Herkunft, die
Systematik der Verfolgung jedoch ist die der Verfolgung sogenannter
"Asozialer"). |
 | dies.: Arthur Aron aus Hadamar. Dokumentation 2017. Eingestellt
als pdf-Datei. |
 | dies.: Neumarkt Nummer 8 in Hadamar. Ein Haus und
seine Bewohner in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Spiegel der
Devisen- und Entschädigungsakten. Dokumentation 2020.
Eingestellt als pdf-Datei. |
 | dies.: Erinnerung am "falschen Ort?". Der Grabstein des
Seekapitäns Reichmann vor der Synagogen in Hadamar. 2022.
Eingestellt als pdf-Datei. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Hadamar
Hesse-Nassau. Established in the 17th century, the Jewish community built a
synagogue in 1841 and numbered 100 (5 % of the total) in 1842. Salomon Wormser,
the district rabbi (1852-1860), tried to promote Reform Judaism but met with
strong opposition. Numbering 80 (3 %) in 1925, the community also had members in
Hausen and Langendernbach. On Kristallnacht (9-10 November 1938), the
synagogue's interior was destroyed. Of the 68 Jews who lived there in 1933, 29
left (17 emigrating), four committed suicide, and 27 were deported (1942).
The psychiatric hospital in Hadamar war turned into a Nazi "euthanasia"
center housing a gas chamber and crematoria which was used in Januar-August 1941
to eliminate 10.000 mentally ill, retarded, or incurable people - some of them
Jews, including the children of misc marriages.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|