|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"
zu den "Synagogen im
Westerwaldkreis"
Montabaur (Kreisstadt)
mit Wirges (beide
Westerwaldkreis)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Montabaur (Stadtrechte seit 1291; gehörte zum
Erzstift Trier) lebten Juden bereits im Mittelalter. Durch die Judenverfolgungen
1337 ("Armleder"-Verfolgung) und in der Zeit der Pest 1348/49 wurde
jüdisches Leben in dieser Stadt vernichtet. Nach der Verfolgung in der Pestzeit
wird erstmals 1369 wieder ein jüdischer Bewohner der Stadt genannt
(Gottschalk von Montabaur). Dieser hatte seinen Wohnsitz zunächst nur in
Montabaur danach (spätestens ab 1372) hier und in Trier, nach 1384 nur noch in
Trier. Weitere nach Montabaur benannte Juden ließen sich nieder in Frankfurt am
Main (1373: Lewe von Montabaur), Oberwesel (1379: Joseph Sohn des Jakob von
Montabaur) und Trier (Jakob von Montabaur). Im 15. Jahrhundert wird mehrfach
eine "Judengasse" genannt (in der judengassen 1477,
1478, 1491 und joedengasse 1499).
Die Entstehung der neuzeitlichen Gemeinde geht auf das 17. Jahrhundert zurück.
Spätestens seit Beginn des 17. Jahrhundert lebten Juden wieder in der
Stadt. Aus dem Jahr 1674 ist ein Geschäftsbuch des jüdischen Händlers Jakob
Hirsch erhalten. 1777 werden acht in der Judengasse lebende Familien genannt.
Im Laufe des
19. Jahrhunderts nimmt die Zahl der jüdischen Gemeindeglieder weiter zu (1803 5
Familien mit 44 Personen, 1810 9
Familien mit 25 minderjährigen Kindern, 1818 13 Familien zusammen 58 Personen,
1842 64, 1871 95, 1895 102 (in 24 Haushaltungen), 1901 112 Personen (1901 in 26
Haushaltungen; von insgesamt 3.300 Einwohnern), um 1905 mit 117 Personen den
Höchststand zu erreichen.
1818 war Samuel Heyum Gemeindevorsteher, ab 1835
Hirsch Maier Löb, 1841 Feist Gumbrich Anschel, 1862 Moses Steinthal, um 1877 A.
Kahn. Die
jüdischen Familien lebten von den Einkünften als Viehhändler oder Metzger,
Eisenwaren- und Weinhändler. Die jüdische Gemeinde wurde 1852 dem
Bezirksrabbinat (Bad) Ems
zugeteilt.
An Einrichtungen bestanden - spätestens seit dem 17. Jahrhundert - ein
Betsaal / eine Synagoge, eine jüdische Religionsschule mit Lehrerwohnung sowie
ein rituelles Bad und ein Friedhof. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Religionslehrer
angestellt. Dieser war zugleich als Kantor und Schochet (Schächter) tätig
(vgl. unten Ausschreibungstexte der Stellen). Auf die Ausschreibung der Stelle
1877 hin bewarb sich Lehrer H. Wagschal, der
bis 1914 der Gemeinde gute Dienste tun sollte (s.u. zum 25-jährigen Jubiläum
1902; 1898 besuchten 18, 1899 13, 1901 19 Kinder den Religionsunterricht). 1922 bis 1925 war Lehrer Siegmund Zodick, sein Nachfolger
vermutlich ab 1925 Josef Zeitin.
Gemeindevorsteher waren um 1899/1901 G. Schloss, H. Stern und H. Loeb.
Als Synagogendiener wird 1901 S. Hannopel genannt.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: aus Montabaur
Isidor Löw (geb. 19.12.1881 in Montabaur, gest. 27.9.1916), aus Wirges:
Albert Winter (geb. 9.8.1879 in Mönchengladbach, gef. 8.8.1917).
Um 1925, als noch 85 Personen der jüdischen Gemeinde angehörten (1,4 %
von etwa 6.000 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde Willi Stern,
Heinrich Heimann und Albert Stern. Als Lehrer, Kantor und Schochet war Siegmund
Zodick angestellt. Er erteilte damals neun schulpflichtigen jüdischen Kindern Religionsunterricht.
An jüdischen Vereinen waren ein Jüdischer Frauenverein (schon 1901
genannt) und ein Jüdischer
Jugendbund vorhanden. 1932 war Gemeindevorsteher Eugen Stern. Lehrer und Kantor
war inzwischen Josef Zeitin. Er hatte im Schuljahr 1932/33 neun Kinder zu
unterrichten. Der jüdischen Gemeinde in Montabaur waren auch die drei
jüdischen Einwohner aus Wirges angeschlossen.
1933 wurden noch 82 jüdische Einwohner gezählt. Von ihnen konnte in
den folgenden Jahren ein Teil emigrieren (15 in die USA, je zwei nach Holland
bzw. England, einzelne in andere Länder); einige verzogen in andere Städte
(Frankfurt, Wiesbaden, Berlin). 1941 wurden mehrere der bis dahin in Montabaur verbliebenen jüdischen
Einwohner zunächst in ein Arbeitslager nach Friedrichssegen/Lahn gebracht, von
dort in die Vernichtungslager deportiert. Andere sind aus den Städten, wohin sie
verzogen sind, deportiert worden.
Von den in Montabaur geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Hugo Abraham (1872), Johanna Abraham geb. Kahn (1868),
Regine Abraham geb. Heumann (1870), Hedwig Ascher geb. Stern (1883), Hilda Bernstein geb.
Stern (1885), Erwin Blumenthal (1909), Moses Falkenstein (1869), Amalie (Mally) Grünewald geb. Stern
(1876), Berta Vera Heilberg (1931), Ingeborg (Inge) Heilberg (1930), Adolf Heimann (1891), Elise
(Elisabeth, Betti) Heimann geb. Goldschmidt (1893), Heinrich Heimann (1889), Inge(borg)
Heimann (1924), Rega Heimann geb. Stern (1888), Albert Kahn (1874), Billa Kahn
geb. Wolff (1882), Erich
Kahn (1912), Erna Kahn geb. Kahn (1908), Erwin Kahn (1914), Hilde Kahn geb.
Mendel (1888), Julius Kahn (1878), Leopold Kahn (1876), Anna Levy geb. Falkenstein
(1903), David Levy (1891), Bertha Liffmann geb. Rosenthal (1887), Alfred Löb
(1893), Bertha Löb (1872), Johanna Löb (1876), Greta Mainzer
geb. Löwensberg (1880), Berta Rückersberg geb. Wagschal (1884), Hedwig Schlomann geb. Löwenthal (1878), Berthold
Schloss (1898), Siegfried Schönfeld (1884),
Hedwig Stern (1883), Betty
Stern geb. Löwenstein (1896), Frieda Stern geb. Falkenstein (1881), Julius Stern
(1877), Ludwig Stern (1907), Willi Stern (1885), Ludwig Wagschal (1882), Hedwig Zodick geb. Oppenheimer (1897), Kurt Zodick (1925), Ruth
Zodick (1923), Lehrer Siegmund Zodick (1893).
Bei dem in einigen Listen falsch geführten umgekommenen "Ludwig
Stein" handelt es sich um Ludwig Stern (Namensverwechslung).
Anmerkung: die in einigen Listen genannte Else Schloss, geb. Abraham
(1875), ist 1939 nach Südafrika ausgewandert, Anfang der 1950er remigriert und
am 31. Dezember1954 in Frankfurt/M verstorben (Sterbeurkunde des StA Frankfurt/M
Nr.4/IV vom 3.01.1955; Hinweis von Claus Peter Beuttenmüller vom 27.3.2024).
Aus Wirges sind umgekommen: Ludwig Hermann (1899), Manfred Hans Hermann
(1921).
2011 hat die Stadt Montabaur beschlossen, die Initiative "Stolpersteine"
des Künstler Gunter Demnig zu unterstützen. 2012/14 wurden im Stadtgebiet 26
Stolpersteine an 13 verschiedenen Adressen verlegt (u.a. Kleiner Markt 3 für
Hugo und Regine Abraham, Alleestraße 8a für Ludwig Stern, Vorderer Rebstock 29
für Erwin Kahn).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1877 /
1924
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. November 1877:
"Die hiesige Gemeinde wünscht bis den 1. Mai kommenden Jahres einen
Religionslehrer, der gleichzeitig Kantor und Schochet, ledigen Standes,
mit einem Gehalt von (je nach Befähigung) 600-900 Mark zu engagieren.
Ertrag der Schechitah und Nebenverdienste circa 150 Mark. Bewerber wollen
sich an mich wenden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. November 1877:
"Die hiesige Gemeinde wünscht bis den 1. Mai kommenden Jahres einen
Religionslehrer, der gleichzeitig Kantor und Schochet, ledigen Standes,
mit einem Gehalt von (je nach Befähigung) 600-900 Mark zu engagieren.
Ertrag der Schechitah und Nebenverdienste circa 150 Mark. Bewerber wollen
sich an mich wenden.
Montabaur, den 5. November 1877. A. Kahn, Vorsteher." |
| |
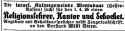 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember 1924:
"Die israelitische Kultusgemeinde Montabaur (Hessen-Nassau) sucht
für den 1. April 1925 einen Religionslehrer, Kantor und Schochet. Angebote
mit Gehaltsansprüchen nebst Zeugnisabschrift an den Vorstand Willi
Stern." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember 1924:
"Die israelitische Kultusgemeinde Montabaur (Hessen-Nassau) sucht
für den 1. April 1925 einen Religionslehrer, Kantor und Schochet. Angebote
mit Gehaltsansprüchen nebst Zeugnisabschrift an den Vorstand Willi
Stern." |
Über die Amtszeit des Lehrers Wagschal - Lehrer von 1878 bis 1914
 Auszeichnungen
für 15jährige Tätigkeit 1892: Bericht in der Zeitschrift "Der
Israelit" vom 16. Juni 1892: "Montabaur, 9. Juni (1892). Dass
Hohe Königliche Regierung zu Wiesbaden für das Wohl der israelitischen
Religionslehrer stets bedacht war, auch deren Leistungen in der
Religionsschule stets anerkannt hat, kann mit Folgendem bewiesen werden:
Dem Herrn Lehrer Wagschal, welcher bereits 15 Jahre in der Gemeinde
Montabaur fungiert, hat Hohe Königliche Regierung am 24. Juni 1888 durch
den Bezirksrabbiner Herrn Dr. Kopfstein eine schriftliche Anerkennung für
seine guten Leistungen in der Schule zukommen lassen. Und soeben erhielt
Herr Lehrer Wagschal durch den Bezirksrabbiner Herrn Dr. Weingarten von
Königlicher Regierung eine zweite Anerkennung für seine vorzüglichen
Leistungen in der Religionsschule." Auszeichnungen
für 15jährige Tätigkeit 1892: Bericht in der Zeitschrift "Der
Israelit" vom 16. Juni 1892: "Montabaur, 9. Juni (1892). Dass
Hohe Königliche Regierung zu Wiesbaden für das Wohl der israelitischen
Religionslehrer stets bedacht war, auch deren Leistungen in der
Religionsschule stets anerkannt hat, kann mit Folgendem bewiesen werden:
Dem Herrn Lehrer Wagschal, welcher bereits 15 Jahre in der Gemeinde
Montabaur fungiert, hat Hohe Königliche Regierung am 24. Juni 1888 durch
den Bezirksrabbiner Herrn Dr. Kopfstein eine schriftliche Anerkennung für
seine guten Leistungen in der Schule zukommen lassen. Und soeben erhielt
Herr Lehrer Wagschal durch den Bezirksrabbiner Herrn Dr. Weingarten von
Königlicher Regierung eine zweite Anerkennung für seine vorzüglichen
Leistungen in der Religionsschule." |
| |
 Feier
zum 25jährigen Ortsjubiläum des Lehrers Wagschal 1904: Aus
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Januar 1904:
"Montabaur. Am 3. Januar dieses Jahres feierte Herr Lehrer Wagschal
sein 25jähriges Ortsjubiläum. Bei dieser Gelegenheit zeigte es sich so
recht, welcher Beliebtheit sich der Jubilar bei seinen Vorgesetzten,
seinen Kollegen und seiner Gemeinde erfreut. Der Gemeinde-Vorstand hat ihm
ein ansehnliches Geldgeschenk überweisen lassen. Der Verein der
israelitischen Lehrer im ehemaligen Herzogtum Nassau, dessen
Vorstandsmitglied der Jubilar ist, ließ demselben durch eine Deputation,
unter Führung der Herrn Vorsitzenden Oberkantor Nußbaum-Wiesbaden, die
herzlichsten Wünsche überbringen. Herr Nußbaum hob in kernigen Worten
das rege Interesse, das der Jubilar stets dem Verein entgegengebracht,
hervor, und dass bei allen Beratungen die Worte des Herr Wagschal stets in
die Wagschale fielen. Als Zeichen der Liebe und Hochachtung überreichte
dann die Deputation einen prachtvollen silbernen Pokal mit entsprechender
Widmung und ein Album mit den Photographien der Vereinsmitglieder. Auch
die Herren Bezirksrabbiner im ehemaligen Herzogtum Nassau, Dr. Dr.
Silberstein - Wiesbaden, Landau - Weilburg und Weingarten - Ems, ließen dem
Jubilar durch Seine Ehrwürden Herrn Bezirksrabbiner Dr. Weingarten - Ems,
zu dessen Bezirk Montabaur gehört, die innigsten Glückwünsche übermitteln.
Herr Dr. Weingarten hat in einer warm empfundenen Rede das verdienstvolle
Wirken des Jubilars in Schule und Gemeinde geschildert. Sichtlich gerührt
ob all der Ehrungen knüpfte der Jubilar an den Ausruf unseres Erzvaters
Jakob: "Ich bin der geringste von allen Frommen..." Dankesworte.
Ein solennes Mahl mit herrlichen Reden gewürzt, gab dem Jubelfest einen
würdigen Abschluss." Feier
zum 25jährigen Ortsjubiläum des Lehrers Wagschal 1904: Aus
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Januar 1904:
"Montabaur. Am 3. Januar dieses Jahres feierte Herr Lehrer Wagschal
sein 25jähriges Ortsjubiläum. Bei dieser Gelegenheit zeigte es sich so
recht, welcher Beliebtheit sich der Jubilar bei seinen Vorgesetzten,
seinen Kollegen und seiner Gemeinde erfreut. Der Gemeinde-Vorstand hat ihm
ein ansehnliches Geldgeschenk überweisen lassen. Der Verein der
israelitischen Lehrer im ehemaligen Herzogtum Nassau, dessen
Vorstandsmitglied der Jubilar ist, ließ demselben durch eine Deputation,
unter Führung der Herrn Vorsitzenden Oberkantor Nußbaum-Wiesbaden, die
herzlichsten Wünsche überbringen. Herr Nußbaum hob in kernigen Worten
das rege Interesse, das der Jubilar stets dem Verein entgegengebracht,
hervor, und dass bei allen Beratungen die Worte des Herr Wagschal stets in
die Wagschale fielen. Als Zeichen der Liebe und Hochachtung überreichte
dann die Deputation einen prachtvollen silbernen Pokal mit entsprechender
Widmung und ein Album mit den Photographien der Vereinsmitglieder. Auch
die Herren Bezirksrabbiner im ehemaligen Herzogtum Nassau, Dr. Dr.
Silberstein - Wiesbaden, Landau - Weilburg und Weingarten - Ems, ließen dem
Jubilar durch Seine Ehrwürden Herrn Bezirksrabbiner Dr. Weingarten - Ems,
zu dessen Bezirk Montabaur gehört, die innigsten Glückwünsche übermitteln.
Herr Dr. Weingarten hat in einer warm empfundenen Rede das verdienstvolle
Wirken des Jubilars in Schule und Gemeinde geschildert. Sichtlich gerührt
ob all der Ehrungen knüpfte der Jubilar an den Ausruf unseres Erzvaters
Jakob: "Ich bin der geringste von allen Frommen..." Dankesworte.
Ein solennes Mahl mit herrlichen Reden gewürzt, gab dem Jubelfest einen
würdigen Abschluss."
Anmerkung: Ein Artikel zum Jubiläum von Lehrer Wagschal erschien auch
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 22. Januar 1904
S. 4. |
| |
Hinweis auf einen Sohn von Lehrer Wagschal: Ferdinand Wagschal
(Hinweis auf den Artikel erhalten von Fritz Schwind, Montabaur)
|
| Aus dem "Kreisblatt für den
Unterwesterwaldkreis" von 1903: "Wagschal, Ferdinand, israelitisch, geb. 4.
August 1879 in Montabaur, machte Ostern 1898 Abitur am
Kaiser-Wilhelms-Gymnasium in Montabaur, studierte Medizin. Im Juni 1903
bestand der 'cand. med.' F. Wagschal das Staatsexamen als Arzt 'in allen
umfassenden Fächern mit der Note sehr gut*. Sein Vater war von 1878 – 1914
israelitischer Religionslehrer in Montabaur (KUW Juni 1903)". |
Anmerkung: Ferdinand Wagschal schrieb
eine Dissertation über "Quantitative Studien über die Giftigkeit der
Blausäure-Dämpfe". Er war bis nach 1933 als Arzt in Mainz tätig. Ihm wurde
im September 1938 der Doktortitel der Universität Würzburg wieder aberkannt
(Depromotion). Damals war er bereits (1936) in die USA emigriert. Er war
spätestens ab 1940 als Arzt in Denver/Colorado tätig und starb am 17. Juli
1969.
Quelle: Die geraubte Würde. Die Aberkennung des Doktorgrads an der
Universität Würzburg 1933-1945. Hrsg. von der Universität Würzburg. Beiträge
zur Würzburger Universitätsgeschichte Band 1. Verlag Königshausen & Neumann.
Würzburg 2011. S. 221. |
Geburtsanzeige von Ruth Zodick (1923)
Anmerkung: Lehrer
Siegmund Zodick ist am 5. Juni 1893 in Laubach
geboren als Sohn des Religionslehrers Emanuel Zodick und der Josephine geb.
Westerfeld. Im Ersten Weltkrieg war er von 1914 bis 1916 eingesetzt. Er war
verheiratet mit Hedwig geb. Oppenheimer (geb. 12. Oktober 1897 in Essen). Die
beiden hatten zwei Kinder: Ruth (geb. 15. Juni 1923 in Montabaur) und
Kurt (geb. 11. Juni 1925 in Montabaur). Siegmund Zodick war seit 1922
Lehrer und Kantor in Montabaur, danach Lehrer in
St. Wendel. 1935 verzog Siegmund Zodick
nach Bad Buchau, wo er noch bis 1938/39 die
jüdischen Kinder unterrichtete. Nach dem Novemberpogrom 1938 wurde er für
mehrere Wochen in das KZ Dachau verbracht. Ende August 1939 mussten er und seine
Familie Bad Buchau verlassen und nach Bad
Mergentheim ziehen. Die ganze Familie wurde am 1. Dezember 1941 von
Stuttgart aus nach Riga - Jungfernhof, Außenlager des Ghetto Riga deportiert und
im September 1944 in Auschwitz ermordet.
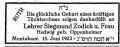 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Juni 1923:
"RUTH. Gott sei gepriesen. Die glückliche Geburt eines
kräftigen Töchterchens zeigen dankerfüllt an: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Juni 1923:
"RUTH. Gott sei gepriesen. Die glückliche Geburt eines
kräftigen Töchterchens zeigen dankerfüllt an:
Lehrer Siegmund Zodick und Frau Hedwig geb. Oppenheimer. Montabaur,
15. Juni 1923 - 1. Tammus 5683." |
Aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben
Purimfeier der Chewrah Kadischah (1907)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. März 1907:
"Montabaur, 6. März (1907). Die in der Chewrah Kadischah vereinigten
Familien veranstalteten eine gemeinsame Purimfeier. Der gelungene Verlauf
hat bewiesen, dass die Chewrah ein echt jüdischer Geist durchweht." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. März 1907:
"Montabaur, 6. März (1907). Die in der Chewrah Kadischah vereinigten
Familien veranstalteten eine gemeinsame Purimfeier. Der gelungene Verlauf
hat bewiesen, dass die Chewrah ein echt jüdischer Geist durchweht." |
1000-Jahr-Feier der Stadt Montabaur mit Beteiligung der
Israelitischen Gemeinde (1930)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
26. Juni 1930: "Montabaur, 24. Juni (1930). Die
Westerwaldstadt Montabaur feierte vom 21. bis 23. Juni das Fest ihres
tausendjährigen Bestehens. Stadtverwaltung und Bürger hatten
umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um diese seltene Stadtfeier in
festlicher Weise zu begehen. Am Schabbat Vormittag gedachte der Lehrer
der Israelitischen Gemeinde, Herr J. Zeitin, in der Predigt der
Bedeutung des Tages. - Nachmittags 4.30 Uhr fand im großen Sitzungssaale
des Rathauses der akademische Festakt statt. Aus Anlass der
Tausendjahrfeier hat die Stadtverwaltung eine umfangreiche Festschrift
herausgegeben, in der auch ein Beitrag 'Aus der Geschichte der
Israelitischen Kultusgemeinde Montabaur' von Lehrer J. Zeitin enthalten
ist, in welchem er nachweist, dass die Israelitische Gemeinde über 600
Jahre besteht." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
26. Juni 1930: "Montabaur, 24. Juni (1930). Die
Westerwaldstadt Montabaur feierte vom 21. bis 23. Juni das Fest ihres
tausendjährigen Bestehens. Stadtverwaltung und Bürger hatten
umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um diese seltene Stadtfeier in
festlicher Weise zu begehen. Am Schabbat Vormittag gedachte der Lehrer
der Israelitischen Gemeinde, Herr J. Zeitin, in der Predigt der
Bedeutung des Tages. - Nachmittags 4.30 Uhr fand im großen Sitzungssaale
des Rathauses der akademische Festakt statt. Aus Anlass der
Tausendjahrfeier hat die Stadtverwaltung eine umfangreiche Festschrift
herausgegeben, in der auch ein Beitrag 'Aus der Geschichte der
Israelitischen Kultusgemeinde Montabaur' von Lehrer J. Zeitin enthalten
ist, in welchem er nachweist, dass die Israelitische Gemeinde über 600
Jahre besteht." |
Berichte zu einzelnen
Personen aus der Gemeinde
Zum Tod von Julie Schloß, Frau des Gemeindevorstehers G.
Schloß (1902)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. September 1902: "Montabaur,
18. September (1902). Am Sabbat Paraschat Schauftim (Sabbat mit der
Toralesung Schofetim = 5. Mose 16,18 - 21,9 = 6. September 1902)
starb dahier Frau Julie Schloß, die Gattin des Vorstehers Herrn G.
Schloß, nach mehrmonatlichem, schmerzlichem Krankenlager, im Alter von 61
Jahren. Wenn irgendeine Frau es verdient, dass ihr im 'Israelit' ein
nachruf gewidmet werde, so ist es bei der Dahingeschiedenen der Fall. Sie
war der Besten und Edelsten eine, sie vereinigte in sich alle Tugenden
einer Esches chajil (wackeren Frau). Wahre ungeheuchelte
Frömmigkeit, gepaart mit innigem Gottvertrauen, das sie in allen Lagen
des Lebens aufrecht erhielt, bildeten die Grundzüge ihres Charakters; sie
verstand es, ihr Haus durch aufrichtige Frömmigkeit, wahre
Menschenfreundlichkeit, große Wohltätigkeit, unbegrenzte Herzensgüte
und Milde zu einem Tempel zu gestalten. Ihrem Gatten war sie in dem
34-jährigen Zusammenleben eine treue und liebevolle Gefährtin, ihren
Kindern eine zärtliche Mutter, deren Erziehung und Wohl die Ziele ihres
unausgesetzten Denkens und Strebens waren. Daher ist die Trauer eine
allgemeine, bei Juden und Christen. War der tief gebeugte Gatte, die
Kinder, Geschwister und unsere Gemeinde verloren, das zu schildern, ist
die Feder zu schwach, aber alle, alle, die sie gekannt, verlieren in ihr
eine Freundin von höchstem Werte, die ihr ganzes Glück darin fand,
andere glücklich zu machen; denn wie viel Tränen hat sie getrocknet, wie
viel Arme und Bedürftige unterstützt. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. September 1902: "Montabaur,
18. September (1902). Am Sabbat Paraschat Schauftim (Sabbat mit der
Toralesung Schofetim = 5. Mose 16,18 - 21,9 = 6. September 1902)
starb dahier Frau Julie Schloß, die Gattin des Vorstehers Herrn G.
Schloß, nach mehrmonatlichem, schmerzlichem Krankenlager, im Alter von 61
Jahren. Wenn irgendeine Frau es verdient, dass ihr im 'Israelit' ein
nachruf gewidmet werde, so ist es bei der Dahingeschiedenen der Fall. Sie
war der Besten und Edelsten eine, sie vereinigte in sich alle Tugenden
einer Esches chajil (wackeren Frau). Wahre ungeheuchelte
Frömmigkeit, gepaart mit innigem Gottvertrauen, das sie in allen Lagen
des Lebens aufrecht erhielt, bildeten die Grundzüge ihres Charakters; sie
verstand es, ihr Haus durch aufrichtige Frömmigkeit, wahre
Menschenfreundlichkeit, große Wohltätigkeit, unbegrenzte Herzensgüte
und Milde zu einem Tempel zu gestalten. Ihrem Gatten war sie in dem
34-jährigen Zusammenleben eine treue und liebevolle Gefährtin, ihren
Kindern eine zärtliche Mutter, deren Erziehung und Wohl die Ziele ihres
unausgesetzten Denkens und Strebens waren. Daher ist die Trauer eine
allgemeine, bei Juden und Christen. War der tief gebeugte Gatte, die
Kinder, Geschwister und unsere Gemeinde verloren, das zu schildern, ist
die Feder zu schwach, aber alle, alle, die sie gekannt, verlieren in ihr
eine Freundin von höchstem Werte, die ihr ganzes Glück darin fand,
andere glücklich zu machen; denn wie viel Tränen hat sie getrocknet, wie
viel Arme und Bedürftige unterstützt.
Ihr Leichenbegängnis legte beredtes Zeugnis hiervon ab; aus Nah und Fern
waren die Freunde herbeigeströmt, um ihr den letzten Tribut der Liebe und
Freundschaft zu zollen. Herr Bezirks-Rabbiner Dr. Weingarten - Ems
schilderte am Grabe in tief bewegten Worten die vielen guten Eigenschaften
der Verstorbenen und gab dem großen Schmerz und der tiefen Trauer der
Verwandten und Freunde um dieselbe gebührenden Ausdruck.
Mögen sich die so schwer heimgesuchten Hinterbliebenen mit dem erhebenden
Gedanken trösten, dass die nun Verklärte sich in dem Herzen Aller ein
dauerndes Denkmal der Liebe gesetzt. Ihre Seele sein eingebunden in den
Bund des Lebens.
H. Wagschal, Lehrer." |
Zum Tod von Johanna Stern (1931)
 Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 4. Februar 1931:
"Montabaur (Persönliches). Das älteste Mitglied der hiesigen
Gemeinde, Frau Johanna Stern, langjähriges Vorstandsmitglied des
jüdischen Frauenbundes, den sie auch begründen half, ist im 84.
Lebensjahres verschieden. Die Beerdigung fand unter lebhafter Beteiligung
der Bevölkerung statt. Lehrer Zeitin hob am Grabe die Verdienste der
Verewigten um die Allgemeinheit
hervor."
Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 4. Februar 1931:
"Montabaur (Persönliches). Das älteste Mitglied der hiesigen
Gemeinde, Frau Johanna Stern, langjähriges Vorstandsmitglied des
jüdischen Frauenbundes, den sie auch begründen half, ist im 84.
Lebensjahres verschieden. Die Beerdigung fand unter lebhafter Beteiligung
der Bevölkerung statt. Lehrer Zeitin hob am Grabe die Verdienste der
Verewigten um die Allgemeinheit
hervor." |
| |
 Links:
Grabstein für Johanna Stern (1847-1931) und ihren Mann, denn Kaufmann Nathan Stern (1837 in
Meudt - 1914 in Montabaur) im jüdischen
Friedhof in Montabaur Links:
Grabstein für Johanna Stern (1847-1931) und ihren Mann, denn Kaufmann Nathan Stern (1837 in
Meudt - 1914 in Montabaur) im jüdischen
Friedhof in Montabaur |
Erinnerung an die Familie Stern in Montabaur - 75 Jahre
danach (Artikel von 2013)
(Artikel von Gerald Stern, erhalten über Angelika Messmer)
 Der
Artikel ist verfasst von Gerald Stern, Sohn des früheren Kaufmanns
in Montabaur Alfred Stern und Enkel von Willi Stern. Alfred
Stern konnte 1939 über einen Kindertransport nach England
gelangen. Der
Artikel ist verfasst von Gerald Stern, Sohn des früheren Kaufmanns
in Montabaur Alfred Stern und Enkel von Willi Stern. Alfred
Stern konnte 1939 über einen Kindertransport nach England
gelangen. |
Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Nathan Stern sucht einen Lehrling für sein gemischtes
Warengeschäft (1893 / 1901)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. März 1893: "Ein
Lehrling aus achtbarer Familie mit guten Schulzeugnissen wird in ein
gemischtes Warengeschäft per sofort gesucht. Kost und Logis im Hause,
Sabbat und Festtage geschlossen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. März 1893: "Ein
Lehrling aus achtbarer Familie mit guten Schulzeugnissen wird in ein
gemischtes Warengeschäft per sofort gesucht. Kost und Logis im Hause,
Sabbat und Festtage geschlossen.
Nathan Stern, Montabaur." |
| |
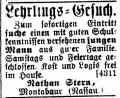 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1901: "Lehrlings-Gesuch. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1901: "Lehrlings-Gesuch.
Zum sofortigen Eintritt suche einen mit guten Schulkenntnissen
versehenen jungen Mann aus guter Familie. Samstags und Feiertage
geschlossen. Kost und Logis frei im Hause.
Nathan Stern, Montabaur
(Nassau)." |
Anzeigen von Leopold Schloß, Kurzwarengeschäft en gros (1899)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Mai 1899: "Lehrling oder
Volontär Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Mai 1899: "Lehrling oder
Volontär
in mein Kurzwaren-Engros-Geschäft per sofort gesucht.
Kost und Logis im Hause.
Leopold Schloss, Kurzwaren Engros.
Montabaur (Hessen-Nassau)." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember 1899: "Lehrling Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember 1899: "Lehrling
per 1. Januar gesucht. Kost und Logis im Hause.
Leopold Schloß.
Kurzwaren engros, Montabaur." |
Anzeige des Manufaktur- und Konfektionsgeschäftes Nathan Stern
(1903)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. September 1903: "Suche
per sofort oder später einen Lehrling und ein Lehrmädchen aus
guter Familie. Samstags und Feiertage geschlossen. Kost und Logis im
Hause. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. September 1903: "Suche
per sofort oder später einen Lehrling und ein Lehrmädchen aus
guter Familie. Samstags und Feiertage geschlossen. Kost und Logis im
Hause.
Nathan Stern, Manufaktur- und Konfektion,
Montabaur." |
Anzeige von Julius Stern (1922)
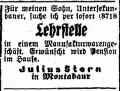 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. November 1922:
"Für meinen Sohn, Untersekundaner, suche ich per sofort Lehrstelle
in einem Manufakturwarengeschäft. Erwünscht wird Pension im Hause. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. November 1922:
"Für meinen Sohn, Untersekundaner, suche ich per sofort Lehrstelle
in einem Manufakturwarengeschäft. Erwünscht wird Pension im Hause.
Julius Stern in Montabaur." |
Hochzeitsanzeige von
Adolf Ullmann und Else geb. Abraham (1934)
Anmerkung: Adolf Ullmann war ein Sohn von Simon
Ullmann und seiner Frau Bertha geb. Gottschalk in
Westerburg, Informationen zur Familie
siehe in der Website von Horst Jung
https://hjung.home.ktk.de/J%C3%BCdische%20Familien%20in%20Westerburg/ab_33BB222A0CB54C6C8DA1736822A397AB.htm
Else geb. Abraham war eine Tochter von Hugo Abraham und seiner Frau Regine
geb. Hermann in Montabaur.
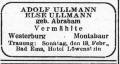 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 15. Februar 1934: "Adolf Ullmann
- Else Ullmann geb. Abraham Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 15. Februar 1934: "Adolf Ullmann
- Else Ullmann geb. Abraham
Vermählte
Westerburg -
Montabaur
Trauung: Sonntag, den 18. Februar, Bad Ems, Hotel Löwenstein." |
Sonstiges
Erinnerungen an die Auswanderungen im 19. Jahrhundert: Grabstein in New York für Morris
R. Loeb aus Montabaur (1878-1903, ??)
Anmerkung: das Grab befindet sich in einem jüdischen Friedhof in NY-Brooklyn;
die Jahreszahlen sind nur schwer lesbar.
 |
Grabstein für
"Morris R. Loeb
Born in Montabaur, Germany
1878-1903" (??) |
Zur Geschichte der Synagoge
Im Mittelalter wird noch keine Synagoge genannt. Erst die im 17. Jahrhundert zugezogenen Familien
haben nachweislich eine Synagoge
("Judenschule") eingerichtet. Sie wird 1691 erstmals erwähnt.
Ihr Standort ist nicht bekannt. Mitte des 18. Jahrhunderts befand sich ein
Betsaal im Haus Vorderer Rebstock 26. Von diesem Betsaal ist eine Platzordnung
aus dem Jahr 1780 erhalten: es gab 23 Plätze. 1868 plante man eine Erweiterung
des Betsaales beziehungsweise den Neubau einer Synagoge. Als jedoch 1875 eine
staatliche Beihilfe zum Neubau abgelehnt wurde, musste man die Pläne zunächst
verschieben.
1889 konnte die jüdische Gemeinde ein geeignetes Grundstück an der Wallstraße
erwerben. Wenig später wurde mit dem Bau einer neuen Synagoge begonnen.
Ihre feierliche Einweihung durch Rabbiner Dr. Michael Silberstein aus Wiesbaden
war am 3. Chanukkatag (28. Kislev 5650), d.h. am 20./21.Dezember 1889.
Über die Einweihung liegt ein Bericht in der Zeitschrift "Der
Israelit" vom 13. Januar 1890 vor:
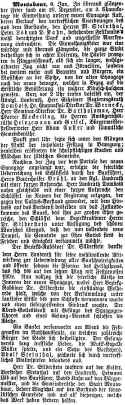 Montabaur, 6. Januar (1890). In überaus glänzender
Feier fand am 20. Dezember, am 3. Chanukkatage die Einweihung unserer neuen
Synagoge statt, deren Verlauf den vortrefflichen Anordnungen des aus dem
Vorstande, den Herrn M. Steinthal, Heimann Löb und David Kahn, bestehenden Festkomitees
wohl berechtigten Dank und ungeteilte Anerkennung einbrachten. Die
Einweihungsfeier war eine würdige und überaus glänzende, die ganze Stadt
beteiligte sich in echter Toleranz, die Häuser prangten in Flaggenschmuck, als
sich ein langer, wohlgeordneter Zug nicht nur aus Israeliten, sondern bei weitem
mehr aus Beamten und Bürgern, ein Musikchor an der Spitze, von der alten
Synagoge nach der neuen bewegte, welcher in Bezug auf die christliche Bevölkerung
ein wahrer Kiddusch-haschem (Heiligung des Namens Gottes) gewesen. Kurz
vor 2 Uhr trafen daselbst ein, der Königliche Landrat, Herr Geheimer
Regierungsrat Dombois, Herr Gymnasial-Direktor Dr. Wernecke, Herr
Seminar-Direktor Dr. Bartholomae, Herr Pfarrer Weckerling, die Herren
Amtsgerichtsräte Heinzemann und Geisel, Bürgermeisterstellvertreter Herr Adam
Custer und sämtliche Gemeinderäte. Montabaur, 6. Januar (1890). In überaus glänzender
Feier fand am 20. Dezember, am 3. Chanukkatage die Einweihung unserer neuen
Synagoge statt, deren Verlauf den vortrefflichen Anordnungen des aus dem
Vorstande, den Herrn M. Steinthal, Heimann Löb und David Kahn, bestehenden Festkomitees
wohl berechtigten Dank und ungeteilte Anerkennung einbrachten. Die
Einweihungsfeier war eine würdige und überaus glänzende, die ganze Stadt
beteiligte sich in echter Toleranz, die Häuser prangten in Flaggenschmuck, als
sich ein langer, wohlgeordneter Zug nicht nur aus Israeliten, sondern bei weitem
mehr aus Beamten und Bürgern, ein Musikchor an der Spitze, von der alten
Synagoge nach der neuen bewegte, welcher in Bezug auf die christliche Bevölkerung
ein wahrer Kiddusch-haschem (Heiligung des Namens Gottes) gewesen. Kurz
vor 2 Uhr trafen daselbst ein, der Königliche Landrat, Herr Geheimer
Regierungsrat Dombois, Herr Gymnasial-Direktor Dr. Wernecke, Herr
Seminar-Direktor Dr. Bartholomae, Herr Pfarrer Weckerling, die Herren
Amtsgerichtsräte Heinzemann und Geisel, Bürgermeisterstellvertreter Herr Adam
Custer und sämtliche Gemeinderäte.
Punkt zwei Uhr setzte sich unter den Klängen der Musik der imposante Festzug in
Bewegung; denselben eröffneten die schulpflichtigen Knaben und Mädchen der jüdischen
Gemeinde.
Nachdem der Zug vor dem Portale der neuen Synagoge angelangt war, erfolgte die
feierliche Überreichung des Schlüssels durch den Bauführer, Herrn
Bautechniker Brühl an den Königlichen Landrat mit einer kurzen Ansprache. Herr
Landrat Dombois nahm gleichfalls mit einer kurzen Ansprache den Schlüssel im
Namen der Regierung entgegen, der gegen den Kultusverband gewendet, mit dem
Hinweis auf das Verdienst desselben um das Zustandekommen des Baues, das ihm zur
großen Ehre gereiche, den Schlüssel dem Bezirksrabbiner Herrn Dr. Silberstein
unter Anfügung des schönen Wunsches übergab, dass der nun vollendete neue
Tempel die Gemeinde zur Ehre Gottes stets in Frieden und Einigkeit versammeln möchte.
Der Bezirks-Rabbiner Dr. Silberstein dankte dem Herrn Landrat für seine
wohlwollende Mitwirkung zur Überwindung aller Bauschwierigkeiten und öffnete
sodann die Pforten des Heiligtums, das sich bis auf den letzten Platz mit
Festgenossen füllte. Nun vollzog sich die feierliche Weihe im Inneren der neuen
Synagoge, wobei Herr Bezirksrabbiner Dr. Silberstein die einstündige Weiherede
hielt, welche von der Versammlung unter lautloser Stille bis zum Schlusse
vernommen wurde und einen tief ergreifenden Eindruck machte. Der
Abend-Gottesdienst mit Gesängen des Synagogenchores und eines Gesangvereines
schlossen die Weihe.
Ein Bankett versammelte am Abend die Festgenossen im Rathaussaale, an welchem
zahlreiche Bürger der Stadt sich beteiligten. Der Gesangverein sang treffliche
Lieder, die Musik-Kapelle Müller spielte, und ein Sohn des Vorstehers, Adolf
Steinthal, zeichnete sich durch vortreffliches Violinspielen besonders aus.
Herr Dr. Silberstein toastierte auf den Kaiser, Vorsteher Steinthal auf den
Landrat, Heimann Löb auf den Bauführer, David Kahn auf den Bürgermeister, und
die Gemeinderäte der Stadt Montabaur, Lehrer Wagschal auf den Vorstand der
israelitischen Gemeinde und auf all diejenigen, welche das Werk haben fördern
helfen. |
Ein weiterer Bericht liegt aus der Zeitschrift "Allgemeine Zeitung des
Judentums" vom 16. Januar 1890 vor:
 Man
schreibt uns aus Montabaur, 20. Dezember (1889). Gestern und heute beging
die hiesige israelitische Gemeinde unter der Teilnahme nicht nur der israelitischen,
sondern auch der christlichen Bevölkerung das Fest der Einweihung ihrer neuen Synagoge.
Die ganze Stadt war in reichen Fahnenschmuck gehüllt und bezeugte das lebhafte
Interesse, das auch der christliche Teil der Einwohnerschaft an dem Freuden- und
Ehrentage ihrer jüdischen Mitbürger nahm. Nach einem feierlichen
Abschiedsgottesdienst in der alten Synagogue bewegte sich der unabsehbare
Festzug nach der neuen Synagoge, vor welcher die Schlüsselübergabe stattfand.
Der Landrat der Kreises, Geheimer Regierungsrat Dambois, übergab den Schlüssel
mit passenden Worten dem Herrn Bezirksrabbiner Dr. Silberstein von Wiesbaden,
der ihn unter Dankesworten entgegennahm. Den Mitteilpunkt der Einweihungs- und
auch der Abschiedsfeier bildeten die trefflichen, herz- und geistvollen Reden
des Herrn Dr. Silberstein, die eine tiefe Bewegung in der dichtgedrängten
Zuhörerschaft erzeugten. Bei dem Abends im festlich geschmückten Rathaussaale
abgehaltenen Bankett wurde der erste Toast, von Herrn Dr. Silberstein auf den
Kaiser ausgebracht, mit großem Beifalle aufgenommen; ihm folgten noch zahlreiche
Toaste auf diejenigen, die sich um das Gelingen des schönen Werks Verdienste
erworben. Anderen Tags fand der erste Hauptgottesdienst in der schön erbauten
Synagoge statt, bei dem die Predigt des Herrn Rabbiner Dr. Silberstein, die
interne Verhältnisse besprach, wieder den Mittelpunkt bildete, und eine tiefe
und hoffen wir, auch nachhaltige Wirkung ausübte. Man
schreibt uns aus Montabaur, 20. Dezember (1889). Gestern und heute beging
die hiesige israelitische Gemeinde unter der Teilnahme nicht nur der israelitischen,
sondern auch der christlichen Bevölkerung das Fest der Einweihung ihrer neuen Synagoge.
Die ganze Stadt war in reichen Fahnenschmuck gehüllt und bezeugte das lebhafte
Interesse, das auch der christliche Teil der Einwohnerschaft an dem Freuden- und
Ehrentage ihrer jüdischen Mitbürger nahm. Nach einem feierlichen
Abschiedsgottesdienst in der alten Synagogue bewegte sich der unabsehbare
Festzug nach der neuen Synagoge, vor welcher die Schlüsselübergabe stattfand.
Der Landrat der Kreises, Geheimer Regierungsrat Dambois, übergab den Schlüssel
mit passenden Worten dem Herrn Bezirksrabbiner Dr. Silberstein von Wiesbaden,
der ihn unter Dankesworten entgegennahm. Den Mitteilpunkt der Einweihungs- und
auch der Abschiedsfeier bildeten die trefflichen, herz- und geistvollen Reden
des Herrn Dr. Silberstein, die eine tiefe Bewegung in der dichtgedrängten
Zuhörerschaft erzeugten. Bei dem Abends im festlich geschmückten Rathaussaale
abgehaltenen Bankett wurde der erste Toast, von Herrn Dr. Silberstein auf den
Kaiser ausgebracht, mit großem Beifalle aufgenommen; ihm folgten noch zahlreiche
Toaste auf diejenigen, die sich um das Gelingen des schönen Werks Verdienste
erworben. Anderen Tags fand der erste Hauptgottesdienst in der schön erbauten
Synagoge statt, bei dem die Predigt des Herrn Rabbiner Dr. Silberstein, die
interne Verhältnisse besprach, wieder den Mittelpunkt bildete, und eine tiefe
und hoffen wir, auch nachhaltige Wirkung ausübte. |
1901 stand ein besonderes Ereignis bevor - die Einweihung
einer neuen Torarolle, über die der nachstehende Bericht
vorliegt:
Einweihung einer neuen Torarolle in der Synagoge (1901)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Oktober 1901: "Montabaur,
7. Oktober (1901). Eine seltene Feier beging am 5. dieses Monats unsere
Gemeinde. Handelte es sich doch um die Einweihung der neuen Tora-Rolle,
die von der in weiten Kreisen durch ihren wohltätigen und frommen Sinn
bekannten Frau Isaak Stern Witwe gespendet worden war, um einem fühlbaren
Mangel abzuhelfen. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Oktober 1901: "Montabaur,
7. Oktober (1901). Eine seltene Feier beging am 5. dieses Monats unsere
Gemeinde. Handelte es sich doch um die Einweihung der neuen Tora-Rolle,
die von der in weiten Kreisen durch ihren wohltätigen und frommen Sinn
bekannten Frau Isaak Stern Witwe gespendet worden war, um einem fühlbaren
Mangel abzuhelfen.
Am Freitag Nachmittag begann die Vorfeier dieses hier außergewöhnlichen
Festes. Die Tora-Rolle wurde um 5 Uhr unter großer Beteiligung der hier
weilenden zahlreichen Fremden und der gesamten Gemeinde, aus dem Hause des
Herrn Heimann Stern in feierlicher Begleitung unter den Klängen einer
Musikkapelle zur Synagoge getragen. Nachdem von einem eigens zu dieser
erhabenen Feier gebildeten Chor das 'Matauwu' in ergreifender Weise
gesungen und die Tora in den Araun hakodesch (Toraschrein) gestellt
war, hielt Seine Ehrwürden Herr Rabbiner Dr. Weingarten - Ems die
Festrede. Zunächst dankte er der edlen Spenderin für ihre hochherzige
Gabe in beredten Worten und erflehte für sie Gottes Segen. Alsdann wies
der darauf hin, wie zu allen Zeiten die Tora von unseren Vätern
hochgehalten wurde, 'wie der Jude stets über seiner Tora lag und sie
studierte', selbst dann, als das Interesse aller Völker durch
welterschütternde Ereignisse für deren Religionen geschwunden war. Und
so solle auch die Gemeinde das Gotteswort stets hoch achten und es nicht
über den Sorgen des Alltagslebens vergessen und vor allem für die
religiöse Erziehung der Kinder Sorge tragen. Mit einem Segen für die
Gemeinde endete die Vorfeier.
Der Festgottesdienst am Sabbatmorgen wurde ebenfalls mit dem 'Matauwu'
eröffnet. darauf erfolgte die eigentliche Einweihung der neuen Tora durch
Vorlesung aus derselben. Nach dem Vortrage eines Chorals hielt der Herr
Rabbiner eine Anspruche an die Gemeinde, welcher er die Worte zugrunde
legte: 'man erscheine nicht leer vor dem Angesicht des Ewigen' (5.
Mose 16,16). Darauf sprach er über die Bedeutung des 'Regen-Gebetes'. Wie
der Regen nichts nützen könne, wenn der Acker nicht bearbeitet und zu
seiner Aufnahme genügend vorbereitet wäre, so sei auch mit dem bloßen
Beten nichts getan, wenn nicht die Arbeit, d.h. das rechte Verständnis
der in der Tora enthaltenen Lehren und die Ausübung der Gebote dem Gebete
vorausgegangen sei. Darum sollen wir unsere Kinder stets auf die Bedeutung
der göttlichen Gebote aufmerksam machen und sie zu deren Erfüllung
anhalten; in der Jugend müsse das Herz für die Aufnahme der Tora
vorbereitet und fähig gemacht werden, pflügen müsse man, wenn der Segen
nützen soll.
Daran schloss sich das Mussaphgebet, bei welchem abermals der Chor durch
seine Vorträge zur Verschönerung des Gottesdienstes
beitrug." |
Die Synagoge blieb fast 50 Jahre lang Zentrum des jüdischen Gemeindelebens
in Montabaur. Das vierzigjährige Bestehen der Synagoge konnte am 28.
Dezember 1929 feierlich begangen werden. Die Festansprache hielt der
damalige Lehrer Josef Zeitlin.
Im folgenden Jahr 1930 noch noch eine umfassende
Renovierung der Synagoge statt. Am 20. September 1930 war die
Wiedereinweihung,
über die in der Zeitschrift "Der Israelit" am 6. Oktober 1930
berichtet wurde:
 "Montabaur,
29. September (1930). Am Schabbat vor Rosch HaSchana (Schabbat vor dem
jüdischen Neujahrsfest, das war 1930: am 20. September 1930) fand die
Wiederweihe der renovierten Synagoge statt. Der erste Vorsteher der
Gemeinde, Herr Eugen Stern wies in seinen Ausführungen auf die dringende
Notwendigkeit der erfolgten Wiederherstellung des G'tteshauses hin, die
danke der Opferwilligkeit der Gemeindemitglieder und der für diesen Zweck
gewährten Subvention des Preußischen Landesverbandes durchgeführt
werden könnte. Ganz besonderen Dank stattete der Vorsteher dem hiesigen
jüdischen Frauenverein ab, der Stiftung eines Vorhanges für den Aron
Hakodesch (Toraschrein) sowie eines Almemor und Omuddeckchens (Decke für
den Vorlesepult) zur wundervollen Ausstattung der Synagoge beigetragen
hat. Es folgte nach der Ansprache des Vorstehers die vom Lehrer der
Gemeinde, Herrn J. Zeitin, gehaltene Festpredigt im Anschluss an den Psalm
"Samachti beomerim li beit haAdonai nelech" "Ich
freue mich, wenn man zu mir spricht, ins G'tteshaus wollen wir
gehen". Er führte u.a. aus: Wie die Freude, die das Herz unserer
Ahnen erfüllte, als sie zum heiligen Tempel wallten nicht den herrlichen
Hallen, die sie schauten und dem Glanz, der ihr Auge blendete, galt,
sondern hervorgerufen wurde durch den Gedanken, dass sie hier die
Verbindung mit G'tt, die der Seele des Menschen so sehr Bedürfnis ist und
die das Leben so häufig lockert und löset, von neuem knüpfen und
festigen werden, so soll auch die Freude, die in uns das G'tteshaus
erweckt, ihren tieferen Grund haben in dem, was Seele und Geist hier
finden. Der Gedanke der Gleichheit des Menschengeschlechts ist aus dem
Leben geschwunden. Er hat sich gerettet und geflüchtet ins G'tteshaus, wo
wir ihn bewahren wollen als köstliches Gut, dass er von dieser Stätte
einst seinen Weg nehme ins Leben, in die Menschheit, auf dass die ganze
Erde werde ein Beit HaKnesset, eine Stätte der Einigung und
Sammlung von Menschen in Liebe und Frieden". "Montabaur,
29. September (1930). Am Schabbat vor Rosch HaSchana (Schabbat vor dem
jüdischen Neujahrsfest, das war 1930: am 20. September 1930) fand die
Wiederweihe der renovierten Synagoge statt. Der erste Vorsteher der
Gemeinde, Herr Eugen Stern wies in seinen Ausführungen auf die dringende
Notwendigkeit der erfolgten Wiederherstellung des G'tteshauses hin, die
danke der Opferwilligkeit der Gemeindemitglieder und der für diesen Zweck
gewährten Subvention des Preußischen Landesverbandes durchgeführt
werden könnte. Ganz besonderen Dank stattete der Vorsteher dem hiesigen
jüdischen Frauenverein ab, der Stiftung eines Vorhanges für den Aron
Hakodesch (Toraschrein) sowie eines Almemor und Omuddeckchens (Decke für
den Vorlesepult) zur wundervollen Ausstattung der Synagoge beigetragen
hat. Es folgte nach der Ansprache des Vorstehers die vom Lehrer der
Gemeinde, Herrn J. Zeitin, gehaltene Festpredigt im Anschluss an den Psalm
"Samachti beomerim li beit haAdonai nelech" "Ich
freue mich, wenn man zu mir spricht, ins G'tteshaus wollen wir
gehen". Er führte u.a. aus: Wie die Freude, die das Herz unserer
Ahnen erfüllte, als sie zum heiligen Tempel wallten nicht den herrlichen
Hallen, die sie schauten und dem Glanz, der ihr Auge blendete, galt,
sondern hervorgerufen wurde durch den Gedanken, dass sie hier die
Verbindung mit G'tt, die der Seele des Menschen so sehr Bedürfnis ist und
die das Leben so häufig lockert und löset, von neuem knüpfen und
festigen werden, so soll auch die Freude, die in uns das G'tteshaus
erweckt, ihren tieferen Grund haben in dem, was Seele und Geist hier
finden. Der Gedanke der Gleichheit des Menschengeschlechts ist aus dem
Leben geschwunden. Er hat sich gerettet und geflüchtet ins G'tteshaus, wo
wir ihn bewahren wollen als köstliches Gut, dass er von dieser Stätte
einst seinen Weg nehme ins Leben, in die Menschheit, auf dass die ganze
Erde werde ein Beit HaKnesset, eine Stätte der Einigung und
Sammlung von Menschen in Liebe und Frieden". |
Nach dieser letzten Renovierung fanden noch acht Jahre lang
Gottesdienste in der Synagoge Montabaur statt.
Bereits in der Nacht vom 3. auf den 4. November 1938 wurde in die
Synagoge eingebrochen. Fast alle Ritualien wurden zerschlagen, ein Teil wurde
gestohlen. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Inneneinrichtung der
Synagoge durch einen SA-Trupp aus Höhr und Grenzhausen demoliert. Am Abend des
10. November wurde von SA-Angehörigen Feuer gelegt. Mit Rücksicht auf die
umliegenden Gebäude wurde das Feuer jedoch wieder gelöscht. In den
1940er-Jahren wurde das Synagogengebäude abgebrochen. Auf dem Grundstück wurde
nach 1945 eine Autoreparaturwerkstatt erstellt. Später wurde auf dem
Grundstück ein Ladengeschäft (Einkaufsmarkt, Jeansgroßverkauf, 2007
leerstehend) erstellt, an dem sich eine Gedenktafel befindet (Inschrift
s.u.).
Bei den Grabungsarbeiten im Blick auf eine Neubebauung des
Synagogengrundstückes wurden im Frühjahr 2016 die Grundmauern
(Fundamentreste) der ehemaligen Synagoge gefunden (siehe Fotos und Berichte
unten).
Adresse/Standort der Synagoge: Wallstraße 5
Fotos
(Historische Ansichtskarte der "Judengasse":
Sammlung Hahn; Historische Fotos der Synagoge: Originale im Stadtarchiv Montabaur, veröffentlicht bei
Arnsberg Bilder s. Lit. S. 152 und in Landesamt s.Lit. S. 274; vgl. auch Beitrag
von Löwenguth; neuere Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 23.08.2009 beziehungsweise
Klara Strompf, Aufnahmedatum im Juni 2020)
Die "Judengasse" in Montabaur
als Erinnerung an die mittelalterliche Gemeinde
Anmerkung: die 1477 erstmals genannte Judengasse wurde in ihrem oberen
Teil bereits 1899 in "Elisabethenstraße umbenannt"; seit 1938
wurde die ganze Gasse "Elisabethenstraße" genannt. Auf Antrag
einer Klasse der Heinrich-Roth-Hauptschule Montabaur an die Stadtverwaltung
wurde nach längeren Diskussionen in der Stadt die Elisabethenstraße ab
dem 29. März 1995 wieder "Judengasse" genannt. |
Historische
Ansichtskarte der
"Judengasse" in Montabaur |
 |
|
| |
Die Karte ist
undatiert |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
| Straßenschild |
Ansichten der
"Judengasse" im August 2009 |
| |
|
 |
 |
 |
| Hausschild
Judengasse 18 |
Ansichten
der "Judengasse" im Juni 2020 (Fotos: K. Strompf) |
| |
|
|
|
Das alte jüdische Bethaus (18./19.
Jahrhundert) in der Straße "Vorderer Rebstock" |
 |
 |
 |
| Blick auf das
alte jüdische Bethaus mit einer Hinweistafel; Text der Tafel: "Altes
jüdisches Bethaus. Haus aus dem 17. Jahrhundert. Ab 1780 als 'Betraum'
der seit 1336 nachgewiesenen jüdischen Gemeinde in Montabaur schriftlich
dokumentiert. Ein Vorläufer des Betraums, die 'Judenschul' befand sich
1691 in der Kirchgasse. Auf Beschwerden hin wurde gemäß der Judenordnung
des Kurfürstentums Trier von 1723 ein neues Gebäude gesucht, das
'mindestens vier Häuser von christlichen Häusern entfernt' stehen
musste. 1889 Umzug in die neue Synagoge in der Wallstraße, da die 23
Plätze nicht mehr ausreichten". |
| |
|
|
|
Die Synagoge von 1889 in der Wallstraße |
|
 |
 |
 |
| Die Synagoge in
Montabaur |
Die Synagoge links im
Hintergrund |
| |
|
 |

 |
Die
Wallstraße in Montabaur im Jahr 1904. Rechts ist ein Teil der Synagoge zu
sehen, links daneben das Fotoatelier August Diel. Bei der Unschärfe
rechts handelt es sich um eine Person, die sich während der Aufnahme
bewegt hat und wegen der damaligen langen Belichtungszeiten unscharf
abgebildet ist
(Foto aus der Sammlung von Fritz Schwind/Manfred Lorenz,
Montabaur) |
Fliegeraufnahme
von Montabaur 1933 - rechts
Ausschnittvergrößerung mit der Synagoge (aus der Sammlung
von Fritz Schwind/Manfred Lorenz, Montabaur) |
| |
|
|
Das Synagogengrundstück im Sommer
2009
(Foto links Hahn, Aufnahmedatum 23.08.2009;
Foto rechts: Georg Weyand,
Montabaur, Mitte September 2007)
|
|
 |
 |
|
|
Das an Stelle der ehemaligen Synagoge
stehende Gebäude mit der Gedenktafel zwischen den beiden Fenstern
links des Eingangs; Inschrift: "Wer seine Fehler verheimlicht, hat
kein Gedeih'n, wer sie aber bekennet und verlässt, dem wird Versöhnung -
Salomon 28-16. Hier stand die Synagoge der jüdischen Kultusgemeinde.
Einweihung am 20. Dezember 1889. Zerstörung durch SA-Angehörige in der
Reichskristallnacht am 9-10-1938." |
| |
|
|
|
Aufmaß/Bauzeichnungen der ehemaligen
Synagoge
Montabaur anlässlich der Neubebauung 2016 |
 |
 |
| |
Das Aufmaß der
Synagoge Montabaur zeigt links die Lage der Synagoge im Straßennetz,
rechts innerhalb des Planes der Neubebauung 2016: entgegen der
ursprünglichen Planung mit Fundamentgräben wird die Neubebauung mit
Punktfundamenten gegründet, die den Synagogenrest nicht beschädigen
dürfen (Quelle: Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz,
Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz; erhalten über C. P.
Beuttenmüller) |
| |
|
| |
|
|
Frühjahr 2016: bei den
Vorarbeiten zur Neubebauung des
Grundstückes wurden die Grundmauern der Synagoge gefunden
(Fotos erhalten von Claus Peter Beuttenmüller) |
 |
 |
| |
Deutlich erkennbar
- rechts markiert: die Grundmauern der früheren Synagoge - Blick nach Osten
(Toraschrein) |
| |
|
|
| |
|
|
Einzelhandelsgeschäft
im Besitz einer jüdischen Familie
(aus der Sammlung von Anka Hertle, Montabaur) |

|
| |
Das
Manufaktur- und Modewaren-Geschäft von Gustav Stern; das Foto zeigt die
Familie Stern am 18. Oktober 1910
das Geschäft von Gustav Stern ("Textil & Konfektion") bestand bis nach 1933
in der Bahnhofstraße. |
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| |
| September 2014:
Die Verlegung von "Stolpersteinen" in
Montabaur ist vorerst abgeschlossen |
Artikel in der
"Nassauischen Neuen Presse" vom 19. September 2014: "Stolperstein-Projekt abgeschlossen
In jahrelanger Recherche sind in Montabaur die Lebenswege von Opfern der Verfolgung im
'Dritten Reich' nachgezeichnet worden. Die Lebensdaten der letzten beiden sind jetzt mit sogenannten
'Stolpersteinen' verewigt worden.
Montabaur. Bereits zum dritten Mal besuchte der Aktionskünstler Gunter Demnig Montabaur, um
'Stolpersteine' zum Gedenken an die Opfer des NS-Regimes zu verlegen. Mit den Stolpersteinen für Erwin Kahn und Ludwig Stern ist das Projekt in Montabaur nun abgeschlossen, denn es sind derzeit keine weiteren NS-Opfer bekannt. Insgesamt 26 kleine, in die Straßen und Wege eingelassene Messingtafeln erinnern an die ehemaligen Bürger der Stadt, die von den Nationalsozialisten verschleppt und ermordet wurden.
Im September 2012 hatte Gunter Demnig die ersten fünf Stolpersteine in Montabaur verlegt, weitere 19 kamen im März 2013 hinzu. Die meisten Stolpersteine liegen in der Innenstadt am großen und kleinen Markt, am Rebstock und in der Bahnhofstraße, weil dort die meisten jüdischen Montabaurer lebten. Allerdings bezieht sich das Projekt Stolpersteine auf alle Opfer des NS-Regimes und beschränkt sich nicht allein auf die dem Holocaust zum Opfer gefallenen Juden.
'Hier wohnte…' – mit diesen Worten beginnt die Inschrift der kleinen Messingtafeln, die vor den Häusern verlegt werden, wo ein NS-Opfer seinen letzten frei gewählten Wohnsitz hatte.
Im Rahmen einer Gedenkstunde, an der neben Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland auch einige Einwohner teilnahmen, verlegte Gunter Demnig die vorerst letzten beiden Stolpersteine in Montabaur: einen für Erwin Kahn am Vorderen Rebstock 29 und einen für Ludwig Stern in der Alleestraße 8a. Michael Musil und Volker Müller-Strunk, beide aktiv beim Amateurtheater Oase, lasen die Biografien der beiden NS-Opfer vor.
Namensverwechslung. Zu Beginn der Gedenkstunde hatte Dr. Regina Fiebich, Leiterin des Stadtarchivs, von NS-Opfern aus Montabaur berichtet und einen Überblick über das Projekt Stolpersteine gegeben. Mit viel Geduld und akribischen Recherchen hatte sie die Lebensstationen zusammengetragen.
'Den Stolperstein für Ludwig Stern können wir erst heute in der Alleestraße verlegen, obwohl dort bereits seit einem guten Jahr Stolpersteine an seine Eltern Frieda und Julius
erinnern', sagte Fiebich. Lange Zeit habe es Probleme gegeben, die Lebensstationen von Ludwig Stern ausfindig zu machen. Das lag an einer Namensverwechslung, wegen der er im Gedenkbuch des Bundesarchivs Berlin als Ludwig Stein geführt wurde.
'Durch Zufall sind wir auf diesen Schreibfehler gestoßen und konnten erst mit diesem Wissen seine Lebensgeschichte vollständig
recherchieren', erläuterte die Stadtarchivarin.
Den Stolperstein für Erwin Kahn hatte man aus weit profaneren Gründen zurückgestellt: Als im März 2013 etliche Stolpersteine am Rebstock verlegt wurden, war vor dem Haus am Vorderen Rebstock 29 eine Baustelle. Den Anstoß für die Stolpersteine in Montabaur hatte der ehemalige Stadtrat und Geschichtslehrer Paul Widner gegeben, der heute als Stadtführer unter anderem Rundgänge zum Thema
'Die Juden in Montabaur' anbietet. nnp."
Link
zum Artikel |
| |
| Frühjahr 2016:
Zur Ausgrabung der Fundamentreste der ehemaligen
Synagoge |
1. Offener Brief von Claus Peter
Beuttenmüller vom 14. April 2016 an die Verantwortlichen der
Bauleitplanung des Denkmalschutzes bei der Stadt und Verbandsgemeinde
Montabaur und der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises:
Zur Dokumentation der Bau- und Zerstörungsgeschichte der Montabaurer Synagoge
"Sehr geehrte Damen und Herren,
über Monate habe ich Stadt-, Verbandsgemeinde- und Kreisverwaltung informiert und bekniet, zu Tage tretende Baureste und Zerstörungsschichten auf der Baustelle am Standort der 1938/1940 zerstörten Montabaurer Synagoge zu dokumentieren und mögliche Sachüberreste zu sichern. Ich wurde von allen zuständigen Stellen trotz meiner Schlussfolgerungen aus den Bauunterlagen und der Zerstörungsgeschichte der Synagoge immer wieder beruhigt, erstens „sei da nichts mehr" und wenn doch, dann gebe es da die Vorschriften zum Denkmalschutz usw. usw. usw. (siehe Auskunft unten). Ich habe von niemandem Unterstützung und vom Bauherren trotz mehrfacher Nachfrage kein Betretungsrecht für die Baustelle erhalten.
Jetzt wurden beim Abziehen der Oberfläche wie zu erwarten die Umrisse der Synagoge sichtbar, was ich Ihnen gemeldet habe. Trotz meiner sofortigen Intervention beim Bauherren wurde das Gelände auf Entscheidung der Bauleiter der Firmen Manns und Leidig umgehend nivelliert und versiegelt, ohne dass irgendjemand das verhinderte. Der Zerstörungsschutt wurde ohne Untersuchung auf etwaige Sachüberreste abtransportiert.
Ich bin entsetzt von diesem Umgang mit unserer (Stadt-)Geschichte, unserem kulturellen Erbe und unserer historischen Verantwortung. Und ich bin zutiefst enttäuscht von der Hinhaltetaktik und den Lippenbekenntnissen der Bauleitplanung der Stadt-/Verbandsgemeindeverwaltung und der für den Denkmalschutz Verantwortlichen der Kreisverwaltung in einem derart sensiblen Bereich. Nachträglich eine Gedenktafel (wieder) anzubringen, ist nicht mehr als eine billige Pflichtübung.
Ich bitte Sie jetzt um Auskunft, wie Sie auf diesen offensichtlichen Verstoß gegen die von Ihnen aufgeführten Anzeigepflicht und Garantie von Untersuchungsmöglichkeit reagieren, und wie Sie vielleicht doch noch Ihrer Pflicht zur Dokumentation der historischen Bausubstanz nachkommen.
Bisher hatte ich es aufgrund vielfacher Versicherungen aller Seiten für völlig unnötig und kontraproduktiv gehalten, zur Unterstützung meines Anliegens die Öffentlichkeit zu suchen. Das war naiv und falsch. Seien Sie versichert, dass ich jetzt, wenn auch leider eigentlich zu spät, versuchen werde, die öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Und ich werde die überlebenden jüdischen Montabaurer Mitbürger der Verfolgungen der 30er-Jahre bzw. deren Nachkommen über Ihr beschämendes, unfassbar unsensibles Verhalten informieren.
Ich rechne mit einer zeitnahen Auskunft und verbleibe mit freundlichen Grüßen
C.P. Beuttenmüller, Geschichtelehrer am Landesmusikgymnasium in Montabaur, 14.04.2016". |
| |
2. Presseartikel von Markus Müller in
der "Rhein-Zeitung" vom 19. April 2016: "Mauern von ehemaliger Synagoge in Montabaur freigelegt
Westerwaldkreis. Seit mehr als sieben Jahrzehnten war die ehemalige Synagoge von Montabaur im wahrsten Sinn des Wortes in der Versenkung verschwunden. Bei Abbruch- und Ausschachtungsarbeiten für das sogenannte Quartier Mitte in der Innenstadt wurden jetzt die Grundmauern des Gotteshauses freigelegt.
Die Mauerreste bleiben aber nur für kurze Zeit offen sichtbar. Allerdings sollen die Reste des historischen Bauwerkes bei der Bebauung des Geländes komplett geschont und unverändert unter der Bodenplatte erhalten werden.
In den vergangenen Monaten hatte der Montabaurer Historiker Claus Peter Beuttenmüller, Lehrer am Landesmusikgymnasium, die Verwaltungen von Stadt, Verbandsgemeinde und Kreis informiert und förmlich bekniet, zutage tretende Baureste und Zerstörungsschichten mindestens zu dokumentieren und mögliche Sachüberreste zu sichern. Er wurde von den zuständigen Stellen trotz seiner Schlussfolgerungen aus den Bauunterlagen und der Zerstörungsgeschichte der Synagoge immer wieder vertröstet.
Beuttenmüllers Hinweise und auch die Auflagen der Baubehörde, beim Abriss der alten Gebäude auf mögliche Überreste zu achten, führten jetzt dazu, dass die Landesarchäologie verständigt wurde, als tatsächlich die Grundmauern der alten Synagoge sichtbar wurden. Sie waren zwar schon wieder mit einer Schicht von recyceltem Schutt überdeckt worden, wurden aber für die digitale archäologische Aufnahme komplett freigelegt. Dabei erschlossen sich zum ersten Mal die großen Ausmaße der auf historischen Bildern recht klein wirkenden Synagoge. Auch ein kleiner Anbau ist an den massiven Mauerresten noch gut zu erkennen.
Der Bau der Synagoge war schon von 1868 an geplant worden. Im Dezember 1889 schließlich wurde das Gebäude in der Wallstraße eingeweiht. Die Synagoge blieb fast 50 Jahre lang das Zentrum des jüdischen Gemeindelebens in Montabaur. 1930 wurde das schöne Gebäude umfassend renoviert.
Bereits Anfang November 1938 wurde in die Synagoge eingebrochen und die Ritualien zerschlagen oder gestohlen. Während der Pogromnacht 1938 wurde die Synagoge von SA-Gruppen geschändet und in Brand gesteckt. Allerdings wurde das Feuer von der Feuerwehr gelöscht. Die Brandruine wurde anschließend verkauft, mit der Auflage, die Überreste zu beseitigen. Nach dem Krieg wurde hier eine Autowerkstatt angesiedelt, anschließend ein Geschäftshaus erbaut, das zuletzt als Sozialkaufhaus genutzt wurde. An dessen Mauer war auch eine Gedenktafel für die Synagoge angebracht, die erhalten bleibt und an den neuen Gebäuden wieder angebracht werden soll.
Auch die Grundmauern der Synagoge bleiben komplett erhalten - allerdings unter der Bodenplatte der neuen Gebäude. Das hat Archäologe Jost mit Behörden- und Firmenvertretern sowie den Bauherren vereinbart. Auch die Bohrgründungen, die die Bodenplatte stützen, wollen die Baufachleute so planen, dass sie die Grundmauern der Synagoge nicht beschädigen.
"Mehr als konservieren können wir in diesem Fall allerdings nicht tun", bedauert Jost. Er und sein Kollege konnten auch keine weitergehenden Funde machen. Claus Peter Beuttenmüller hätte gern noch den Bauschutt auf eventuelle Reste der Synagoge, wie zum Beispiel Bodenfliesen, untersucht. Aber der war schon abtransportiert."
Link
zum Artikel |
| |
|
Dezember 2020:
Auf den Spuren der jüdischen
Geschichte in Wirges |
Artikel im "Westerwaldkurier" vom Dezember
2020: "Auf den Spuren jüdischen Lebens in Wirges
Wirges. Durch die Lektüre von Büchern, die von Dr. Uli Jungbluth und
Joachim Jösch geschrieben wurden, stieß Jankowitsch auf die Geschichte der
Familie Isselbächer aus Wirges, die schon kurz nach der Machtergreifung
nachts aus ihrem Haus getrieben, misshandelt und verspottet und ihr Geschäft
ruiniert wurde. Ihnen gelang aber noch rechtzeitig im gleichen Jahr die
Flucht in die USA. 'Doch war es die einzige jüdische Familie in Wirges?'
fragte sich der SPD-Politiker. In den Melderegistern von Wirges taucht 1920
der Name Ludwig Hermann auf, der in Quirnbach geboren wurde, wo die Familie
schon seit über einem Jahrhundert lebte. Von Beruf war er Metzger. Er war
Jude. Warum er nach Wirges zog, war nicht genau zu ermitteln, vermutlich
aber wegen einer jungen Frau Minni Walli Essalinek, die evangelisch getauft
war. Die beiden bekommen einen Sohn namens Manfred Hans Hermann, der
ebenfalls evangelisch getauft wurde. Da das Melderegister lückenhaft ist,
lässt sich nur ermitteln, dass Manfred Hans Hermann wieder in Wirges in der
Grenzstr.6, der heutigen Martin-Luther-Straße 12, wohnt, wo es tatsächlich
eine Metzgerei gibt und der Junge dort eine Lehre beginnt. Im Bundesarchiv
findet Jankowitsch heraus, dass Ludwig und Manfred Hans Hermann 1936 in die
Niederlande fliehen, dort nach dem Einmarsch der Wehrmacht 1940 in das
Sammellager Westerbork und Ludwig später über Theresienstadt nach Auschwitz
gebracht wird. Dort gilt er als verschollen, sein Tod wird aber auf den 28.
Februar 1945 datiert. Manfred Hans Hermann wird nach Buchenwald deportiert,
wo er am 24. Februar 1945 an einer Blutvergiftung infolge von erfrorenen
Füßen verstirbt. Die SPD setzt sich nunmehr mit dem Künstler Demnig in
Verbindung, der in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus vor deren
ehemaligen Häusern sogenannte Stolpersteine anbringt. Durch weitere
Recherchen kommen aber Zweifel am tatsächlichen Wohnort der Hermanns in
Wirges auf. Es findet sich ein Dokument aus dem Jahr 1938, in dem Vater und
Sohn die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt wird. Adressiert ist es an
die Neue Straße 6 in Wirges. Das Verlegen der Stolpersteine wird deshalb auf
einen Zeitpunkt verschoben, bis der genaue Standort der Wohnung zweifelsfrei
geklärt ist. Dies soll im Laufe des nächsten Jahres sein. Jankowitsch setzt
nunmehr seine Recherche fort und findet im Staatsarchiv in Wiesbaden
Dokumente der gesamten Familie Hermann. Viele sind vor den Nazis in die USA
und Argentinien geflohen. Im Internet findet der junge Politiker eine
Familiendatenbank, aus der hervorgeht, dass einige mit den Hermanns aus
Quirnbach verwandt sind und nach Übersee auswanderten. Ein Cousin in den USA
bestätigt Jankowitsch, dass die Familie Ludwig Hermann tatsächlich in der
Neuen Straße 6 wohnte. Doch es sollte noch besser kommen. Jankowitsch setzte
sich mit einer Großnichte von Ludwig Hermann namens Liliana Hermann in
Buenos Aires in Verbindung. Sie bestätigte, dass ihr Großvater Hugo Hermann
und sein Bruder Lothar maßgeblich an der Entdeckung und Verhaftung von Adolf
Eichmann in Argentinien beteiligt waren, was auch der israelische
Geheimdienst Mossad bestätigte. Nunmehr steht der Verlegung der
Stolpersteine nichts mehr im Wege. Einen entsprechenden Antrag wird die SPD
im Stadtrat stellen. Jankowitsch ärgert sich, wenn er in den Nachrichten
hört, dass sich sogenannte Querdenker mit verfolgten Juden vergleichen.
'Diese wissen offenbar nicht, dass den Juden alle Rechte geraubt wurden,
sogar das Recht auf Leben,' sagt er. Ludwig und Manfred Hans Hermann stehen
stellvertretend für alle Juden in Wirges und europaweit, denen es zum
Verhängnis wurde, ein Jude zu sein. (PM)"
Link zum Artikel |
| |
| |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Germania Judaica II/2 S. 547; III/2 S. 883-884. |
 | Stadtverwaltung Montabaur (Hrsg.): Montabaur und der
Westerwald (930-1930). Festschrift aus Anlass der Tausendjahrfeier der Stadt
Montabaur. Feudingen 1930 (mit einem Beitrag des damaligen jüdischen
Lehrers zur jüdischen Geschichte in der Stadt). |
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen.
1971 Bd. II S. 94-96. |
 | Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt
des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies
ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. Mainz 2005. S. 274-275 (mit weiteren Literaturangaben). |
 | Franz-Josef Löwenguth: Die Reichskristallnacht in
Montabaur: online
zugänglich |
 | Markus Wild: Die Geschichte der jüdischen Gemeinde
von Montabaur. Frankfurt (Homann) 1984. 124 S. bzw. Selbstverlag 1991 184 S.
und Abbildungen. |
 | Artikel in "Westerwald extra" (Rheinzeitung) am 11.
Februar 2014 über "Flucht nach New York gelang nicht mehr" und "Ludwig Stern
ging 1933 nach Frankreich" -
eingestellt als pdf-Datei. |
 | Jewish Persecution. Ed. by Stadt Montabaur. 8 S.
eingestellt als pdf-Datei. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Montabaur. Founded during the Crusades, Montabaur took its
name from Mount Tabor in the Holy Land. Jews lived there in the early 14th
century, but fell victim to the Armleder massacres of 1336-39 and the Black
Death persecutions of 1348-49. A community was only established 400 years,
numbering 115 (3 % of the population). Its members built a synagogue in 1889 and
was affiliated with the rabbinate of Bad Ems. SA units, joined by many
townspeople, launched a pogrom on Kristallnacht (9-10 November 1938),
burning the synagogue and looting Jewish property. Of the 82 Jews registered
there in 1933, 41 emigrated, mostly to the United States, and 20 perished in the
Holocaust.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|