|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"
Rimpar (Kreis
Würzburg)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Rimpar bestand eine jüdische Gemeinde bis 1942. Ihre
Entstehung geht in die Zeit des 16. Jahrhunderts zurück. 1577 wird der Jude
Schmul genannt, der mit Frau, Kindern und seiner Mutter in Rimpar wohnte und
jährlich 40 Gulden Schutzgeld zu zahlen hatte.
Eine jüdische Gemeinde bestand seit dem 18. Jahrhundert. 1742 stiftete Jehuda
b. Isaak Mosche aus Rimpar ein Memorbuch. 1792 gab es 14 jüdische Haushaltungen
am Ort.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1814 114 jüdische Einwohner (9,2 % von insgesamt 1.236), 1837 130
(8,0 % von insgesamt 1.620), 1867 142 (6,6 % von 2.152), 1880 (83 (3,6 % von
2.304), 1887 91, 1892 85 (in 24 Familien), 1894 81 (in 17 Familien), 1895 77 (in
19 Familien), 1899 76 (in 16 Haushaltungen), 1900 67 (3,0 % von 2.225).
Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 wurden auf 23 Matrikelstellen
die folgenden jüdischen Familienvorstände in Rimpar genannt (mit bereits neuem
Familiennamen und Erwerbszweig): Jakob Amschel Schloßfelder (Warenhandel),
Moses Hirsch Hermann (Viehhandel), Juda Joseph Frank (Viehhandel), Lob Joseph
Schwab (Viehhandel), Salomon Joseph Schwab (Warenhandel), Samuel Isak
Gondersheim (Warenhandel), Moses Löb Lebold (Viehhandel), Moses Löb Lebold
(Viehhandel), Moyses Löb Schwab (Unterhändler), Samson Löser Oppenheimer
(Viehhandel), Jüdlein Meyer Lehmann (Warenhandel), Abraham Löb Lehmann
(Warenhandel), Meyer Moses Grünebaum (Viehhandel), Jüdlein Moses Wohlmann
(Schacherhandel), Abraham Nathan Frohmann (Viehhandel), Jakob Nathan Frohmann
(Warenhandel), Säcklein Nathan Bestmann (Viehhandel), Abraham Säcklein
Volkmann (Unterhändler), Abraham Seligmann Hofmann (Unterhändler), Isak Samuel
Kleinmann (Warenhandel), Mendel Simon Goldschmitt (Warenhandel), Abraham Joseph
Frank (Viehhandel), Heya, Witwe von Samuel Isak Gondersheim (Schacherhandel),
Moses Joseph Schwab (Viehhandel), Mayer Wolf Löb Adler (Viehhandel).
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge
(s.u.), ein Gemeindehaus mit einem Schulraum (Religionsschule) und eine Mikwe.
Die Toten der Gemeinde wurden im jüdischen Friedhof in Schwanfeld
beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter (Kantor) und Schochet tätig war. Bei
der Erstellung der Matrikellisten 1817 wird als damaliger Vorsänger (ohne
Matrikelstelle) Gerson Löb Stockheimer genannt. Später werden als Lehrer genannt:
Nathan Freund (von ca. 1833 bis zu seinem Tod 1868), gefolgt 1869
bis um 1900 von Simon Buttenwieser (zuvor
in Fechenbach tätig), danach seit 1898 sein
Schwiegersohn Simon Blumenthal (unterrichtete um 1899 auch die Kinder in
Bibergau [1 Kind] und
Estenfeld [9 Kinder]; Blumenthal feierte 1923 das
25-jährige Ortsjubiläum in Rimpar, wechselt zum 15. Mai 1924 nach
Hofheim). Ab 1925 unterrichtete ein
Wanderlehrer die jüdischen Kinder in Rimpar und umgebenden Orten (vgl. unten;
weitere Lehrer siehe unten).
Um 1892 wurden an der
Religionsschule der Gemeinde 15 Kinder unterrichtet, 1893 13 Kinder, 1895 19
Kinder, 1899 15 Kinder.
Als Synagogendiener wird 1894 S. Rosenbaum genannt.
Die Gemeinde gehörte zum Distriktsrabbinat Würzburg.
An jüdischen Vereinen gab es: den Israelitischen Wohltätigkeitsverein
(um 1892 unter Leitung von Lehrer Buttenwieser, um 1899 A. Adler) und den
Israelitischen Frauenverein (um 1892 unter Leitung der Frau von M. Hoffmann,
1899 unter Leitung der Frau von F. Schwab) und die Armenkasse (1899 unter
der Leitung von S. Blumenthal).
Als Gemeindevorsteher werden genannt: um 1869 M. Hoffmann, um 1887 B. J.
Schwab und Wolf Gundersheim, um 1892/1898 Salomon Schwab und Wolf Gundersheim, um
1899 Salomon Schwab und L. Tannenwald.
In den Kriegen 1866 und 1870/71 waren als Kriegsteilnehmer aus der
jüdischen Gemeinde an den Fronten: Bor. Schwab (1866) und Abraham Adler
(1870/71). Ihre Namen stehen auf dem Kriegerdenkmal auf dem Ortsfriedhof neben
der Pfarrkirche von Rimpar. Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen
Gemeinde Joseph Adler (geb. 17.2.1889 in Rimpar, gef. 15.4.1916), Adolf Schwab
(geb. 3.10.1884 in Rimpar, gef. 1.11.1918), Alfred Schwab (geb. 29.6.1891 in
Rimpar, gef. 15.9.1915) und Gefreiter Sali Schwab (geb. 28.12.1886 in Rimpar,
gef. 3.9.1916). Ihre Namen
stehen auf einem weiteren Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten
Weltkrieges im Friedhof Rimpar. Die Namen standen auch auf einem Denkmal in der
ehemaligen Synagoge, das jedoch weitgehend zerstört ist (Namen nicht mehr
lesbar). Vgl. zu den Gefallenen
http://www.denkmalprojekt.org/2016/rimpar-heimatchronik_lk-wuerzburg_wk1_bay.html
Um 1924, als noch 50 jüdische Einwohner in Rimpar gezählt wurden (1,82 % von
insgesamt etwa 3.300) waren die Vorsteher der Gemeinde Sally Schwab und Karl
Tannenwald. Die Lehrerstelle war im Schuljahr 1924/25 unbesetzt. Im März 1925
wurde ein Wanderlehrer mit dem Sitz in Würzburg für die Gemeinden Rimpar,
Estenfeld, Veitshöchheim, Ober- und Unteraltertheim sowie Reichenberg
bestimmt. 1932 war erster
Gemeindevorsteher Josef Frank, zweiter Vorsteher Bruno Bayer. Als Lehrer und
Kantor war Meier Laßmann tätig (Vater der Lehrerin Julie Laßmann, siehe
Texte unten). Im Schuljahr 1931/32 waren von ihm elf jüdische Kinder zu unterrichten. An jüdischen Vereinen bestanden der
Israelitische Frauenverein (1932 unter Leitung von Ernestine Schwabe, Zweck und
Arbeitsgebiete: Unterstützung, Kranken- und Totenwache, Bestattung) sowie die
Männer-Chewra (Leitung Josef Frank: Zweck und Arbeitsgebiete: Unterstützung,
Kranken- und Totenwache, Bestattung).
1933 wurden noch 54 jüdische Einwohner gezählt (1,7 % von insgesamt
3.228). Auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts und der zunehmenden
Repressalien sind zunächst nur wenige von ihnen von Rimpar verzogen bzw.
ausgewandert. Im Mai 1937 lebten noch 46 jüdische Personen in Rimpar, darunter
eine fünfköpfige, unterstützungsbedürftige Familie. Beim Novemberpogrom
1938 wurden zahlreiche jüdische Einwohner tätlich angegriffen. Im
Dezember 1938 brach ein Parteifunktionär in die Wohnung eines Juden ein und
stahl verschiedene Wertsachen. 1939 lebten nur noch 15 jüdische Personen
in Rimpar. 22 konnten bis dahin in die USA emigrieren, einer nach Dänemark.
Sieben waren nach Frankfurt am Main verzogen, sieben in vier andere deutsche
Orte. Im Februar 1942 lebten noch neun jüdische Personen in Rimpar.
Sechs wurden am 24. April 1942 über Würzburg nach Izbica bei Lublin deportiert.
Die drei letzten jüdischen Einwohner wurden am 14. Juli 1942 in das Altersheim
in Würzburg gebracht, von hier aus am 23. September 1942 in das Ghetto
Theresienstadt.
Von den in Rimpar geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Fanny Bähr geb. Frank
(1884), Lenchen Dillenberger geb. Frank (1892),
Benzion (Benno) Frank (1861), Fränzie (Frenzie) Edith Frank
(1921), Elsa Frank geb. Dillenberger (1890), Fränzi (Frenzie Edith M.) Frank
(1921), Inge Frank (1925), Josef Frank (geb. 10.1.1885; später in Königshofen),
Joseph Frank (geb. 25.9.1885), Margot Senta Frank (1923), Samuel Gundersheim (1879),
Thekla Therese Gutmann geb. Schwab (1908), Rosa Hamburger geb. Schwab (1875), Babette
Kaufmann geb. Schwab (1881), Amalie Kohn
geb. Schwab (1873), Julie Lassmann (1905), Leopold Lebermann (1868), Therese
(Theresia) Lindner geb. Schwab (1885), Pauline Machol geb. Schwab (1855), Ernst Mayer (1904), Bertha Schloss
geb. Schwab (1885), Richa Schuster geb. Gundersheim (1857), Abraham Schwab
(1869), Ernestine Schwab geb. Lindner (1878), Klara Schwab geb. Schwab (1884), Pauline (Paula) Schwab
(1889), Sofie Schwab (1889). Manfred Sturm (1927), Hannchen Tannenwald geb.
Kleinmann (1860), Isidor Tannenwald (1885).
Berichte
aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Lob des jüdisch-religiösen
Unterrichts in Rimpar (unter Lehrer Nathan Freund, 1846)
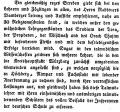 Aus
einem Artikel in "Der treue Zionswächter" vom 3. Februar 1846: "Ein
gleichmäßig reges Streben gibt sich bei den Lehrern und Zöglingen in allen,
des Herrn Rabbiners Bamberger (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Seligmann_Bär_Bamberger) Leitung und
Aufsicht empfohlenen, nahe an 30 Religionsschulen kund, in welchen außer den
gewöhnlichen Lehrgegenständen das Studium der Tora, der Propheten, der
Mischnah und des Orach Chajim (vgl.
https://en.wikipedia.org/wiki/Orach_Chayim) mit besonderem Fleiße
und mit dem befriedigendsten Erfolge betrieben wird. Sogar in den
talmudischen Wissenschaften zeichnen sich mehrere Lehrer, die in den die
Kreishauptstadt Würzburg zunächst umgebenden Gemeinden angestellt sind, zu
welchen vorzüglich die in Höchberg,
Rimpar und Fuchsstadt mit lobender
Anerkennung zu rechnen sind, durch ihre vortrefflichen Leistungen aus, und
gleichwohl haben sich diese Talmudlehrer mit ihren einheimischen und
auswärtigen Talmud lernenden Schülern des fallen bei falls der Inspektoren
der deutschen Schule zu erfreuen. " Aus
einem Artikel in "Der treue Zionswächter" vom 3. Februar 1846: "Ein
gleichmäßig reges Streben gibt sich bei den Lehrern und Zöglingen in allen,
des Herrn Rabbiners Bamberger (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Seligmann_Bär_Bamberger) Leitung und
Aufsicht empfohlenen, nahe an 30 Religionsschulen kund, in welchen außer den
gewöhnlichen Lehrgegenständen das Studium der Tora, der Propheten, der
Mischnah und des Orach Chajim (vgl.
https://en.wikipedia.org/wiki/Orach_Chayim) mit besonderem Fleiße
und mit dem befriedigendsten Erfolge betrieben wird. Sogar in den
talmudischen Wissenschaften zeichnen sich mehrere Lehrer, die in den die
Kreishauptstadt Würzburg zunächst umgebenden Gemeinden angestellt sind, zu
welchen vorzüglich die in Höchberg,
Rimpar und Fuchsstadt mit lobender
Anerkennung zu rechnen sind, durch ihre vortrefflichen Leistungen aus, und
gleichwohl haben sich diese Talmudlehrer mit ihren einheimischen und
auswärtigen Talmud lernenden Schülern des fallen bei falls der Inspektoren
der deutschen Schule zu erfreuen. " |
In Rimpar besteht eine Vorbereitungsschule für die
Lehrer- und Rabbinerausbildung (1859)
Anmerkung: es handelt sich um die in dem nachfolgenden Artikel über Lehrer
Nathan Freund im Rimpar bestehende kleine Schule. Der Berichterstatter in der
liberal geprägten "Allgemeinen Zeitung des Judentums" äußert sich
sehr kritisch über die diese orthodoxe Kleinschule (unterer Abschnitt
"Institut der Finsternis"), während sie ein paar Jahre zuvor und auch
danach aus konservativ-orthodoxer Sicht hoch gelobt wurde (siehe oben Bericht
von 1846 und unten Bericht von 1866).
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 1. August 1859: "Teils reicht die Würzburger Jeschibo (Jeschiwa
= Talmudschule) nicht
mehr aus, teils kann man doch nicht alles und jedes dort so passend
unterbringen; man hat deshalb in Höchberg,
Gerolzhofen, Rimpar und
vielen andern Orten Schulen nach dem Muster der alten Chedorim gegründet
und als Zweck sich die Aufgabe gestellt, die Zöglinge ihrem Berufe als
Rabbiner und Lehrer zuzuführen, wie dies in einem Rundschreiben dargelegt
wird. Da aber nur solche Eltern ihre Kinder dieser Musterschule
anvertrauen, deren Vermögensverhältnisse nicht gestattet, anderweitig
für dieselben zu sorgen, so brauchte man vor allem Geld. Neue
Rundschreiben wurden erlassen und unter dem verführerischen Namen 'Fürs
Toralernen' aller Orten freiwillige Gaben gesammelt. Reichlich flossen und
fließen die Gaben von allen Seiten und die Leute machen brillante
Geschäfte. Sie klopfen nirgends vergebens an. Alt wie Neu öffnet ihnen
willig den Säckel und so mancher glaubt Wunder was zu tun, wenn er Leute
dafür honoriert, das zu tun, was er nicht mehr für zeitgemäß hält,
aber nur für sich. Was soll aber daraus werden Schon jetzt macht sich ein
sehr bedeutender Lehrermangel fühlbar. Der Seminarbesuch ist für
Israeliten nicht mehr notwendig und denjenigen, die es ja noch besuchen
wollen - im Würzburger Seminar sind gegenwärtig vier jüdische Zöglinge
- erschweren die sogenannten Schwarzen ihre Lage nach Kräften, und wer
nicht Alles aus eigenen Mitteln bestreiten kann, kann sich dort nicht mehr
halten. Wie leicht aber die Befähigungsnote als Rabbiner und Lehrer
erlangt wird, davon könnten wir so manches hübsche Beispiel erzählen,
wollen aber nur erwähnen, dass Rabbiner Bamberger die Hauptperson bei der
Prüfungskommission bildet. Bedenkt man nun, dass die Vorsteher
dieser Pflanzstätten jüdischer Lehrer und Rabbiner auch des
geringsten weltlichen Wissens bar, kaum der Mehrzahl nach im Stande sind,
Deutsch zu schreiben und jedenfalls nicht korrekt, so können auch nur
geistig verkümmerte Subjekte aus dieser Schule hervorgehen. Freue dich
aber dann, bayerisches Judentum, wenn erst deine geistlichen
Angelegenheiten und die Erziehung deiner Jugend in solche Hände
übergegangen. Traurig ist die Zukunft, der wir auf solche Weise
entgegengehen, und es tut wahrhaftig Not, diesen Leuten
entgegenzuarbeiten. Niemand unterschätze die Gefahr, die unsern
heiligsten Interessen droht. Soll jedoch etwas geschehen, so muss dies
rasch geschehen, ehe es zu spät ist. Darum kann es nicht laut genug
gesagt werden: Ihr Freunde des Judentums, scharet Euch zusammen, entziehet
Eure Spenden diesen Spekulanten auf Eure Gutmütigkeit, wendet sie solchen
jungen Leuten zu, denen es jetzt doppelt schwer wird, sich für ihren
Beruf gehörig vorzubilden. Doppelt wünschenswert erscheint es aber unter
den gegebenen Verhältnissen, dass man, sobald die Zeitumstände sich
wieder freundlicher gestalten, Hand an die Gründung eines jüdischen
Schullehrer-Seminars für Süddeutschland lege. Wohl lässt sich nicht
leugnen, dass für das Studium des Religiösen mehr geschehen muss, als in
der letzten Zeit geschehen ist; aber ein Extrem ist so verwerflich als das
andere, und sehr treffen lehren unsere Weisen: 'ohne Tora gibt es kein
profanes Wissen' und 'ohne profanes Wissen gibt es kein (Wissen um die)
Tora'. Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 1. August 1859: "Teils reicht die Würzburger Jeschibo (Jeschiwa
= Talmudschule) nicht
mehr aus, teils kann man doch nicht alles und jedes dort so passend
unterbringen; man hat deshalb in Höchberg,
Gerolzhofen, Rimpar und
vielen andern Orten Schulen nach dem Muster der alten Chedorim gegründet
und als Zweck sich die Aufgabe gestellt, die Zöglinge ihrem Berufe als
Rabbiner und Lehrer zuzuführen, wie dies in einem Rundschreiben dargelegt
wird. Da aber nur solche Eltern ihre Kinder dieser Musterschule
anvertrauen, deren Vermögensverhältnisse nicht gestattet, anderweitig
für dieselben zu sorgen, so brauchte man vor allem Geld. Neue
Rundschreiben wurden erlassen und unter dem verführerischen Namen 'Fürs
Toralernen' aller Orten freiwillige Gaben gesammelt. Reichlich flossen und
fließen die Gaben von allen Seiten und die Leute machen brillante
Geschäfte. Sie klopfen nirgends vergebens an. Alt wie Neu öffnet ihnen
willig den Säckel und so mancher glaubt Wunder was zu tun, wenn er Leute
dafür honoriert, das zu tun, was er nicht mehr für zeitgemäß hält,
aber nur für sich. Was soll aber daraus werden Schon jetzt macht sich ein
sehr bedeutender Lehrermangel fühlbar. Der Seminarbesuch ist für
Israeliten nicht mehr notwendig und denjenigen, die es ja noch besuchen
wollen - im Würzburger Seminar sind gegenwärtig vier jüdische Zöglinge
- erschweren die sogenannten Schwarzen ihre Lage nach Kräften, und wer
nicht Alles aus eigenen Mitteln bestreiten kann, kann sich dort nicht mehr
halten. Wie leicht aber die Befähigungsnote als Rabbiner und Lehrer
erlangt wird, davon könnten wir so manches hübsche Beispiel erzählen,
wollen aber nur erwähnen, dass Rabbiner Bamberger die Hauptperson bei der
Prüfungskommission bildet. Bedenkt man nun, dass die Vorsteher
dieser Pflanzstätten jüdischer Lehrer und Rabbiner auch des
geringsten weltlichen Wissens bar, kaum der Mehrzahl nach im Stande sind,
Deutsch zu schreiben und jedenfalls nicht korrekt, so können auch nur
geistig verkümmerte Subjekte aus dieser Schule hervorgehen. Freue dich
aber dann, bayerisches Judentum, wenn erst deine geistlichen
Angelegenheiten und die Erziehung deiner Jugend in solche Hände
übergegangen. Traurig ist die Zukunft, der wir auf solche Weise
entgegengehen, und es tut wahrhaftig Not, diesen Leuten
entgegenzuarbeiten. Niemand unterschätze die Gefahr, die unsern
heiligsten Interessen droht. Soll jedoch etwas geschehen, so muss dies
rasch geschehen, ehe es zu spät ist. Darum kann es nicht laut genug
gesagt werden: Ihr Freunde des Judentums, scharet Euch zusammen, entziehet
Eure Spenden diesen Spekulanten auf Eure Gutmütigkeit, wendet sie solchen
jungen Leuten zu, denen es jetzt doppelt schwer wird, sich für ihren
Beruf gehörig vorzubilden. Doppelt wünschenswert erscheint es aber unter
den gegebenen Verhältnissen, dass man, sobald die Zeitumstände sich
wieder freundlicher gestalten, Hand an die Gründung eines jüdischen
Schullehrer-Seminars für Süddeutschland lege. Wohl lässt sich nicht
leugnen, dass für das Studium des Religiösen mehr geschehen muss, als in
der letzten Zeit geschehen ist; aber ein Extrem ist so verwerflich als das
andere, und sehr treffen lehren unsere Weisen: 'ohne Tora gibt es kein
profanes Wissen' und 'ohne profanes Wissen gibt es kein (Wissen um die)
Tora'.
Erfreulich ist es, zu sehen, wie neben diesen Instituten der Finsternis
auch recht gute Elementarschulen, und so sich seminaristisch gebildete
Lehrer befinden. Außerdem sind zwei in höchster Blüte stehende
Handelsinstitute fast nebeneinander, in Marktbreit
und Segnitz, von denen jedes 70-80
Schüler, worunter viele christliche zählt. Bisher wurde in diesen
Instituten, vielleicht aus letzterem Grunde, der israelitische
Religionsunterricht etwas stiefmütterlich behandelt, doch ist in Segnitz
letzter Zeit ein Vorstandswechsel eingetreten, und wird jetzt jedenfalls
dort das religiöse Element die gehörige Würdigung finden, ohne dass
deshalb weltliches Wissen vernachlässigt wird, und so soll es sein. Um
den Bericht nicht allzu sehr auszudehnen, will ich Spezielles aus
einzelnen Gemeinden für nächstens sparen und nur bemerken, dass auch in
Unterfranken Herr Rabbiner Lebrecht für die Bibelanstalt tätig ist.
Derselbe ist unermüdlich für alles wahrhaft Gute und lässt sich durch
keine Hindernisse, von welcher Seite sie auch kommen mögen, in seinem
anerkennenswerten Eifer beirren". |
Lob des jüdischen Lehrers Nathan Freund in Rimpar
(1866)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juni 1866: "Dahn
(bei Pirmasens), am 14. Juni (1866). (Dem Verdienste seine Krone.) Die
trefflichen Abhandlungen des Herrn Dr. Hildesheimer über die 'Jeschiba-Angelegenheit'
haben gewiss alle Leser Ihrer geschätzten Zeitschrift mit Interesse
gelesen, dieselben zollen aber auch Ihnen, geehrter Herr Redakteur, die
tiefste Achtung dafür, dass Sie auch denjenigen Nachträgen die Spalten
Ihrer werten Zeitung öffnen, welche jene Abhandlungen
vervollständigen. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juni 1866: "Dahn
(bei Pirmasens), am 14. Juni (1866). (Dem Verdienste seine Krone.) Die
trefflichen Abhandlungen des Herrn Dr. Hildesheimer über die 'Jeschiba-Angelegenheit'
haben gewiss alle Leser Ihrer geschätzten Zeitschrift mit Interesse
gelesen, dieselben zollen aber auch Ihnen, geehrter Herr Redakteur, die
tiefste Achtung dafür, dass Sie auch denjenigen Nachträgen die Spalten
Ihrer werten Zeitung öffnen, welche jene Abhandlungen
vervollständigen.
Daher erlauben Sie mir, geehrter Herr, den Namen eines Mannes zu
erwähnen, der im Gebiete von der 'Verbreitung der Tora in Israel'
Außerordentliches leistet und ein wahrhafter rechtschaffener
Gottesmann ist.
In einer kleinen, aber wohlhabenden Gemeinde des Würzburger Rabbinats (sc.
Rimpar) wirkt dieser ehrwürdige Gärtner im Weinberge des Herrn, dessen
ganzes Leben der Tora und der Gottesfurcht geweiht ist.
Nicht nur, dass er selbst das Nachsinnen über die Tora bei Tag und
Nacht wörtlich betätigt, sondern er erfüllt auch noch die
schwierige Aufgabe, 4-5 junge Männer aus Nah und Fern zu
größeren Jeschiwot vorbereitend, in Mischna und Gemara
zu unterrichten und derart Gottesliebe und Gottesfurcht in deren
Herzen zu verpflanzen, dass bei ihnen nicht bloß das Hören,
sondern auch das Tun in Erfüllung geht.
Auch in seiner Gemeinde erweckt er solche Gottesfurcht, dass sich
auch viele der Familienvorsteher dem Torastudium bei ihm
unterziehen und es sind deren nicht wenige, die er so weit gebracht hat,
dass sie die Bibel, Mischna und Chaj Adam recht gut verstehen.
Möge Israel den Namen dieses Frommen, des ...Lehrers, Herr und
Meisters Nathan Freund - sein Licht leuchte -, Religionslehrer
in Rimpar, kennen...." R.G. |
Zum Tod von Lehrer Nathan Freund
(1868)
 Artikel
in "Der Israelit" vom 12. August 1868: "Heidingsfeld
(Bayern). (Ungern verspätet.) Ein teures Leben ist dahingegangen in Israel!
Ein edles Herz hat zu schlagen aufgehört! Gerne möchte ich schweigen von der
Trauerkunde, von dem im 67. Lebensjahr erfolgten Heimgange des gewiss einem
großen Teile des Leserkreises dieser Blätter rühmlichst bekannten
Lehrers Nathan Freund in Rimpar bei Würzburg; aber
verschwunden ist der Gerechte (Zadik) für sein verschwindendes Geschlecht
und gewiss dieser Gerechte (Zadik) ist wert, von ganz Israel betraut
zu werden. Von unbemittelten Eltern in
Wittelshofen in Mittelfranken geboren, besuchte er in seinen
Jünglingsjahren die Hochschule des berühmten Hagaon Abraham Bing das
Andenken an den Gerechten ist zum Segen (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Bing) und war einer von dessen
hervorragenden Schülern. Die profanen Wissenschaften studierte er unter
Leitung der damaligen gelehrtesten Professoren der Würzburger Universität.
Die gründliche Gelehrsamkeit in Schas und Posekim, ganz
besonders aber die eminent Sprachkenntnisse, namentlich in der hebräischen
und chaldäischen Sprache dieses Mannes, seine Universalbildung und seine so
tief wurzelnde G"ttesfurcht, seine Herzensgüte verbunden mit der
aufopfernsten Wohltätigkeit und Spendenbereitschaft (frei
übersetzt) sind allen bekannt, die ihm näher standen. - Als Lehrer
wirkte er erfolgreich in Theilheim,
hierauf circa fünf Jahre in Heidingsfeld,
wo Einsender (sc. dieses Artikels) auch so glücklich war, zu seinen
Schülern zu gehören und zuletzt in Rimpar, wo er 35 Jahre als
Gesetzeslehrer (sc. zur Klärung von halachischen Problemen berechtigte
Person) und Vorbeter segensreich wirkte und durch seinen so
gründlichen Unterricht und seine so glückliche Vorsorge für die religiösen
Institutionen, durch sein eifriges Bemühen, Herz und Sinn von Klein und Groß
im Sinne unserer heiligen Religion auszubilden, Rimpar zu einer
Mustergemeinde hervorhob. Dabei beschäftigte er sich, wenn seine
Berufsgeschäfte es ihm erlaubten, trotz seiner schon vieljährigen
Kränklichkeit, unausgesetzt mit dem Torastudium. - Wie er lebte, so starb
er; mit gottergebener Geduld harte er auf seinem höchst schmerzvollen
Krankenlager aus; bis zu den letzten Stunden genoss er nichts ohne Vor- und
Nach-Bracha (= Segensspruch)! Fortwährend flüsterten die heiligen
Lippen, welchen trotz der heftigsten Schmerzen kein Seufzer entfuhr,
Worte der Tora. Wenn solche Sterne in Israel erbleichen, wem blutet da
nicht das Herz von unaussprechlicher Wehmut? Das bezeugten auch heute seine
Gemeindeglieder, von denen viele seiner Schüler waren, und viele andere
seiner guten Freunde und Gönner, als sie schluchzend und wehklagend den Sarg
des geliebten Lehrers umstanden, - Zadikim werden oft mehr geachtet, wenn
sie unter den Toten als unter den Lebenden sind (frei übersetzt) - und
gewiss wurde heute an seinem Grabe noch bei Manchem der Entschluss, den
Lehren des Seligen unwandelbar treu zu bleiben und hiermit dessen Andenken
am besten zu ehren, nochmals besiegelt und befestigt! Der Gemeinde Rimpar
aber wünschen wir von Herzen wieder einen Mann, in dem sie, bin auch nur
einigermaßen, Ersatz für ihren so schweren Verlust finden möge. ER (=
G"tt) macht verschwinden den Tod auf immer (Jesaja 25,8).
Heidingsfeld, am 18. Tamus. G-dt." Artikel
in "Der Israelit" vom 12. August 1868: "Heidingsfeld
(Bayern). (Ungern verspätet.) Ein teures Leben ist dahingegangen in Israel!
Ein edles Herz hat zu schlagen aufgehört! Gerne möchte ich schweigen von der
Trauerkunde, von dem im 67. Lebensjahr erfolgten Heimgange des gewiss einem
großen Teile des Leserkreises dieser Blätter rühmlichst bekannten
Lehrers Nathan Freund in Rimpar bei Würzburg; aber
verschwunden ist der Gerechte (Zadik) für sein verschwindendes Geschlecht
und gewiss dieser Gerechte (Zadik) ist wert, von ganz Israel betraut
zu werden. Von unbemittelten Eltern in
Wittelshofen in Mittelfranken geboren, besuchte er in seinen
Jünglingsjahren die Hochschule des berühmten Hagaon Abraham Bing das
Andenken an den Gerechten ist zum Segen (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Bing) und war einer von dessen
hervorragenden Schülern. Die profanen Wissenschaften studierte er unter
Leitung der damaligen gelehrtesten Professoren der Würzburger Universität.
Die gründliche Gelehrsamkeit in Schas und Posekim, ganz
besonders aber die eminent Sprachkenntnisse, namentlich in der hebräischen
und chaldäischen Sprache dieses Mannes, seine Universalbildung und seine so
tief wurzelnde G"ttesfurcht, seine Herzensgüte verbunden mit der
aufopfernsten Wohltätigkeit und Spendenbereitschaft (frei
übersetzt) sind allen bekannt, die ihm näher standen. - Als Lehrer
wirkte er erfolgreich in Theilheim,
hierauf circa fünf Jahre in Heidingsfeld,
wo Einsender (sc. dieses Artikels) auch so glücklich war, zu seinen
Schülern zu gehören und zuletzt in Rimpar, wo er 35 Jahre als
Gesetzeslehrer (sc. zur Klärung von halachischen Problemen berechtigte
Person) und Vorbeter segensreich wirkte und durch seinen so
gründlichen Unterricht und seine so glückliche Vorsorge für die religiösen
Institutionen, durch sein eifriges Bemühen, Herz und Sinn von Klein und Groß
im Sinne unserer heiligen Religion auszubilden, Rimpar zu einer
Mustergemeinde hervorhob. Dabei beschäftigte er sich, wenn seine
Berufsgeschäfte es ihm erlaubten, trotz seiner schon vieljährigen
Kränklichkeit, unausgesetzt mit dem Torastudium. - Wie er lebte, so starb
er; mit gottergebener Geduld harte er auf seinem höchst schmerzvollen
Krankenlager aus; bis zu den letzten Stunden genoss er nichts ohne Vor- und
Nach-Bracha (= Segensspruch)! Fortwährend flüsterten die heiligen
Lippen, welchen trotz der heftigsten Schmerzen kein Seufzer entfuhr,
Worte der Tora. Wenn solche Sterne in Israel erbleichen, wem blutet da
nicht das Herz von unaussprechlicher Wehmut? Das bezeugten auch heute seine
Gemeindeglieder, von denen viele seiner Schüler waren, und viele andere
seiner guten Freunde und Gönner, als sie schluchzend und wehklagend den Sarg
des geliebten Lehrers umstanden, - Zadikim werden oft mehr geachtet, wenn
sie unter den Toten als unter den Lebenden sind (frei übersetzt) - und
gewiss wurde heute an seinem Grabe noch bei Manchem der Entschluss, den
Lehren des Seligen unwandelbar treu zu bleiben und hiermit dessen Andenken
am besten zu ehren, nochmals besiegelt und befestigt! Der Gemeinde Rimpar
aber wünschen wir von Herzen wieder einen Mann, in dem sie, bin auch nur
einigermaßen, Ersatz für ihren so schweren Verlust finden möge. ER (=
G"tt) macht verschwinden den Tod auf immer (Jesaja 25,8).
Heidingsfeld, am 18. Tamus. G-dt." |
Über Lehrer Simon Blumenthal (ab ca.
1900 bis 1918 Lehrer in Rimpar)
Anmerkung: Lehrer Simon Blumenthal ist am 1. April 1872 in der Hansestadt Lübeck geboren.
Er stammte aus einer kinderreichen Lehrerfamilie. Sein Vater Lazarus Blumenthal
unterrichtete von 1872 bis 1905 in
Laudenbach bei Karlstadt. Simon studierte, wohl nach der damals üblichen
Berufsvorbereitung an einer Präparandenanstalt, an der
Isr. Lehrerbildungsanstalt in Würzburg (Examen
1891). Seit etwa 1899 unterstützte er seinen Schwiegervater Simon Buttenwieser
als Lehrer in Rimpar. Im Ersten Weltkrieg Kriegsdienst in einem bayerischen
Infanterie-Ersatzbataillon (1916): Ab Juli 1917 war er wieder als Lehrer in
Rimpar. Zum 15. Mai 1924 wechselte er nach
Hofheim. 1930 bildete sich auf seine Initiative eine Bezirkskonferenz
jüdischer Lehrer für Burgpreppach-Hofheim,
die auch für die Fortbildung der Kultusbeamten in den umliegenden Gemeinden
zuständig war. Ab Ende 1933 lebte Simon Blumenthal mit seiner Frau und seinen
Töchtern Zartella (1927-2005) und Henriette (1932-) im Ruhestand in Würzburg,
zeitweise zusammen mit seiner Schwester Nanni Blumenthal. Simon Blumenthal und
seine Familie emigrierten im August 1939 nach London. Von Oktober 1939 bis
Januar 1941 war Simon als Feindlicher Ausländer auf der Isle of Man interniert.
Anzeige von Lehrer Simon Blumenthal
(1906)
 Anzeige
in "Der Israelit" vom 25. Mai 1906: "Für ein kinderloses Ehepaar wird ein
religiöses Anzeige
in "Der Israelit" vom 25. Mai 1906: "Für ein kinderloses Ehepaar wird ein
religiöses
Mädchen gesucht,
das mit einfacher, bürgerlicher Küche und allen Hausarbeiten vertraut ist.
Näheres bei
S. Blumenthal, Lehrer, Rimpar bei Würzburg." |
25-jähriges Ortsjubiläum von Lehrer
Simon Blumenthal (1923)
 Mitteilung
in "Mitteilungen des Israelitischen Lehrervereins für Bayern" vom 29. Juli
1923: "Lehrer Simon Blumenthal in Rimpar feierte sein 25-jähriges
Ortsjubiläum." Mitteilung
in "Mitteilungen des Israelitischen Lehrervereins für Bayern" vom 29. Juli
1923: "Lehrer Simon Blumenthal in Rimpar feierte sein 25-jähriges
Ortsjubiläum." |
Lehrer Simon Blumenthal wechselt
nach Hofheim (1924)
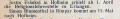 Mitteilung
in "Mitteilungen des Israelitischen Lehrervereins für Bayern" vom 26. März
1924: Mitteilung
in "Mitteilungen des Israelitischen Lehrervereins für Bayern" vom 26. März
1924:
"Justin Fränkel in Hofheim erhielt ab 1.
April die Religionslehrerstelle in Erlangen.
Simon Blumenthal in Rimpar kommt am 15. Mai nach
Hofheim. " |
Für den Unterricht in Rimpar und
anderen Orten wird ein Wanderlehrer bestellt (1925)
Lehrer Lermann (Lehmann?) wechselt von Rimpar nach Berlin (1929)
Anmerkung: zu einem Lehrer Lermann liegen keine weiteren Angaben vor. Er kann
sich nicht um den Lehrer David Lehmann handeln, der aus Rimpar stammte und bis
1928 in Bad Brückenau unterrichtete (siehe Bericht unten). Dieser ist 1928 nach
Würzburg gezogen und dort im Februar 1929 gestorben.
 Meldung
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
Januar 1929: "Lehrer Lermann (Rimpar) wurde an eine Schule in Berlin
berufen". Meldung
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
Januar 1929: "Lehrer Lermann (Rimpar) wurde an eine Schule in Berlin
berufen". |
Lehrer Maier Laßmann kommt nach Rimpar (1929, Lehrer von 1920 bis
1925 in Harburg, 1925 bis 1929 in Westheim)
Anmerkung: Maier Lassmann (geb. 4. Dezember 1872 in Polen) war von
ostjüdischer Herkunft. Nach seiner Religionsausbildung arbeitete er als
Religionslehrer, Kantor, Schächter und Gemeindediener für verschiedene
bayerische Israelitische Kultusgemeinden. Als junger Mann und Familienvater war
er ab etwa 1900 in der bayerisch-schwäbischen Gemeinde
Hainsfarth tätig. Es folgten Stellen in
Harburg (1920), dann in den unterfränkischen
Orten Westheim bei Hammelburg und
Rimpar (1929). Er war verheiratet mit Sara geb. Villut, die im
Dezember 1932 verstarb (siehe Bericht unten). Maier Lassmann blieb in Rimpar und
war wohl 1939 unter den letzten 15 jüdischen Einwohnern von Rimpar. Im September
des Jahres kam er nach Würzburg, wo schon seine später deportierte Tochter
Julie lebte (vgl. Bericht unten).
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Mai
1929: "Westheim bei Hammelburg. Herr Meier
Laßmann, der hier seit
vier Jahren als Lehrer, Schochet und Chasen amtiert hat und gleichzeitig
in der Nachbargemeinde Völkersleier diese Ämter verwaltete, verlässt
die hiesige Gemeinde, um sein Amt in der Gemeinde Rimpar anzutreten. Wir
sehen mit aufrichtigem Bedauern diesen tüchtigen Mann von hier scheiden.
Er besitzt ein überaus großes jüdisches Wissen, ist ein tüchtiger
Schochet und hat auch beim Religionsunterricht große Erfolge erzielt. Mit
allen Gemeindemitgliedern lebte er in bestem Einvernehmen. Auch der
zuständige Rabbiner, Herr Dr. Bamberger (Kissingen) hat sich jederzeit
lobend über die Wirksamkeit unseres Lehrers ausgesprochen, dies
insbesondere bei der kürzlich stattgehabten Religionsprüfung. Die besten
Wünsche unserer Gemeinde begleiten Herrn Lehrer Laßmann in seinen neuen
Wirkungskreis, woselbst er auch die verdiente Anerkennung finden
möge." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Mai
1929: "Westheim bei Hammelburg. Herr Meier
Laßmann, der hier seit
vier Jahren als Lehrer, Schochet und Chasen amtiert hat und gleichzeitig
in der Nachbargemeinde Völkersleier diese Ämter verwaltete, verlässt
die hiesige Gemeinde, um sein Amt in der Gemeinde Rimpar anzutreten. Wir
sehen mit aufrichtigem Bedauern diesen tüchtigen Mann von hier scheiden.
Er besitzt ein überaus großes jüdisches Wissen, ist ein tüchtiger
Schochet und hat auch beim Religionsunterricht große Erfolge erzielt. Mit
allen Gemeindemitgliedern lebte er in bestem Einvernehmen. Auch der
zuständige Rabbiner, Herr Dr. Bamberger (Kissingen) hat sich jederzeit
lobend über die Wirksamkeit unseres Lehrers ausgesprochen, dies
insbesondere bei der kürzlich stattgehabten Religionsprüfung. Die besten
Wünsche unserer Gemeinde begleiten Herrn Lehrer Laßmann in seinen neuen
Wirkungskreis, woselbst er auch die verdiente Anerkennung finden
möge." |
Zum Tod der Frau von Lehrer Laßmann
(1932)
Anmerkung: Sara Laßmann/Lassmann geb. Villut (vergleiche oben) ist vermutlich
am Samstag, 3. Dezember 1932 gestorben. Der nachstehende Bericht ist am Samstag,
10. Dezember 1932 geschrieben wurden. Hier wird vom Todestag von Frau Lassmann
"am vorletzten Sabbat" gesprochen, womit vermutlich der 3. Dezember 1932 gemeint
ist.
 Artikel
in "Der Israelit" vom 15. Dezember 1932: "Rimpar (bei Würzburg), 10.
Dezember. Am vorletzten Sabbat starb im jüdischen Krankenhaus zu
Würzburg, wo sie Heilung von einem mehrjährigen Leiden gesucht hatte,
Frau Lehrer Lassmann von hier. Sie war eine Schwägerin des Somploner
Raw das Andenken an den Gerechten ist zum Segen, in dessen
Jeschiwa (Toraschule) auch der nunmehr verwitwete Gatte 'lernte', dem
sie dann die Hand zum Lebensbund reichte. Man kann sich denken, dass hier
ein echt jüdisches Haus begründet wurde, dem gleichgesinnte Kinder und Enkel
entsprossen. Ihren Gatten, den sie nach verschiedenen Stellen begleitete,
unterstützte sie in seinem heiligen Berufe durch ihr für die ganze Gemeinde
mustergültiges frommes Leben. Bei der Beerdigung auf dem altehrwürdigen
Beit Chajim ('Haus des Lebens' =
Friedhof) Höchberg hielt der Schwager, der Kultusbeamte Philippsohn aus
München, einen ergreifende, von Midrasch- und Talmudworten durchwobenen
Hesped (Trauerrede). Als für den frommen Sinn der Verstorbenen
bezeichnend hob er den letzten Wunsch derselben hervor, ihre Tochter möge
nur einen Ben Tora (= frommen jüdischen Mann) heiraten. Nach dem
Hesped sprach noch Hauptlehrer Mannheimer,
Dettelbach, als Freund der trauernden
Familie schlichte Worte des aufrichtigen Gedenkens für die Entschlafene
seligen Andenkens. Möge ihr Verdienst den Hinterbliebenen wie
ganz Israel beistehen. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens. " Artikel
in "Der Israelit" vom 15. Dezember 1932: "Rimpar (bei Würzburg), 10.
Dezember. Am vorletzten Sabbat starb im jüdischen Krankenhaus zu
Würzburg, wo sie Heilung von einem mehrjährigen Leiden gesucht hatte,
Frau Lehrer Lassmann von hier. Sie war eine Schwägerin des Somploner
Raw das Andenken an den Gerechten ist zum Segen, in dessen
Jeschiwa (Toraschule) auch der nunmehr verwitwete Gatte 'lernte', dem
sie dann die Hand zum Lebensbund reichte. Man kann sich denken, dass hier
ein echt jüdisches Haus begründet wurde, dem gleichgesinnte Kinder und Enkel
entsprossen. Ihren Gatten, den sie nach verschiedenen Stellen begleitete,
unterstützte sie in seinem heiligen Berufe durch ihr für die ganze Gemeinde
mustergültiges frommes Leben. Bei der Beerdigung auf dem altehrwürdigen
Beit Chajim ('Haus des Lebens' =
Friedhof) Höchberg hielt der Schwager, der Kultusbeamte Philippsohn aus
München, einen ergreifende, von Midrasch- und Talmudworten durchwobenen
Hesped (Trauerrede). Als für den frommen Sinn der Verstorbenen
bezeichnend hob er den letzten Wunsch derselben hervor, ihre Tochter möge
nur einen Ben Tora (= frommen jüdischen Mann) heiraten. Nach dem
Hesped sprach noch Hauptlehrer Mannheimer,
Dettelbach, als Freund der trauernden
Familie schlichte Worte des aufrichtigen Gedenkens für die Entschlafene
seligen Andenkens. Möge ihr Verdienst den Hinterbliebenen wie
ganz Israel beistehen. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens. " |
Berichte aus dem jüdischen
Gemeindeleben
Vortragsveranstaltung der jüdischen
Nationalfonds (1927)
Anmerkung: zu Schimon Kranzer aus Veitshöchheim liegen keine weiteren
Informationen vor.
 Artikel
in "Das jüdische Echo" vom 13. Mai 1927: "Rimpar. Im Rahmen der
Pessach-Aktion, zu Gunsten des National-Fonds (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Jüdischer_Nationalfonds), fand auch in
Rimpar eine Veranstaltung statt, für welche als Redner Herr
Schimon Kranzer aus Veitshöchheim
gewonnen war, der über das Thema: 'Die Wanderungen der Juden als Problem'
referierte. In der Diskussion ergänzte Herr Lehrmann die Ausführungen des
Redners. Die lebhafte Anteilnahme der Zuhörer an den vorgetragenen Ideen,
der vielerseits geäußerte Wunsch nach einer Wiederholung ähnlicher
Veranstaltungen, nicht zuletzt das als gut zu bezeichnende Sammelergebnis
dokumentieren aufs deutlichste das Verständnis auch der Rimparer Juden für
den Palästina-Gedanken. Für das glückliche Gelingen der Veranstaltung
gebührt dem Gemeindevorstand, Herrn Adler, besonderer Dank." Artikel
in "Das jüdische Echo" vom 13. Mai 1927: "Rimpar. Im Rahmen der
Pessach-Aktion, zu Gunsten des National-Fonds (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Jüdischer_Nationalfonds), fand auch in
Rimpar eine Veranstaltung statt, für welche als Redner Herr
Schimon Kranzer aus Veitshöchheim
gewonnen war, der über das Thema: 'Die Wanderungen der Juden als Problem'
referierte. In der Diskussion ergänzte Herr Lehrmann die Ausführungen des
Redners. Die lebhafte Anteilnahme der Zuhörer an den vorgetragenen Ideen,
der vielerseits geäußerte Wunsch nach einer Wiederholung ähnlicher
Veranstaltungen, nicht zuletzt das als gut zu bezeichnende Sammelergebnis
dokumentieren aufs deutlichste das Verständnis auch der Rimparer Juden für
den Palästina-Gedanken. Für das glückliche Gelingen der Veranstaltung
gebührt dem Gemeindevorstand, Herrn Adler, besonderer Dank." |
Berichte zu Personen aus der
Gemeinde
Über den Lebenslauf von Caroline Schwerin geb. Frank
(geb. in Rimpar 1808, gest. 1884 in Ramsgate)
Anmerkung: Weiteres zu dem genannten Sir Moses bzw. Moses Montefiori, bei dem
Caroline Schwerin als Haushältern tätig war, siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Moses_Montefiore.
 Artikel
in "Der Israelit" vom 2. Dezember 1884: "Ramsgate, 27. November. Nach
dem jüngsten Bulletin des Dr. Woodmann befindet sich Sir Moses wieder
vollständig wohl - mit G"ttes Hilfe. Das am 13. dieses Monats
erfolgte Ableben seiner getreuen Haushälterin Madame Schwerin, hatte
auf Sir Moses Befinden wesentlich ungünstig ein gewirkt, da diese streng
religiöse und anhängliche Dienerin schon seit 40 Jahren das Hauswesen
versah, auch die Reise nach Jerusalem mitmachte und sich um die Pflege ihres
edlen Gönners viele Verdienste erwarb. Mrs. Schwerin sie ruhe in Frieden
war in Rimpar bei Würzburg (in Bayern) geboren." Artikel
in "Der Israelit" vom 2. Dezember 1884: "Ramsgate, 27. November. Nach
dem jüngsten Bulletin des Dr. Woodmann befindet sich Sir Moses wieder
vollständig wohl - mit G"ttes Hilfe. Das am 13. dieses Monats
erfolgte Ableben seiner getreuen Haushälterin Madame Schwerin, hatte
auf Sir Moses Befinden wesentlich ungünstig ein gewirkt, da diese streng
religiöse und anhängliche Dienerin schon seit 40 Jahren das Hauswesen
versah, auch die Reise nach Jerusalem mitmachte und sich um die Pflege ihres
edlen Gönners viele Verdienste erwarb. Mrs. Schwerin sie ruhe in Frieden
war in Rimpar bei Würzburg (in Bayern) geboren." |
| |
 Artikel
aus der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Dezember 1884: "Rödelsee
in Bayern. Im Nachtrage zu Ihrer Korrespondenz in Nr. 96 d.d. Ramsgate,
27. November, erlaube ich mir, den geehrten Lesern Ihres geschätzten
Blattes Näheres über meine selige Tante, Mrs. Schwerin zu berichten; hat
sie es doch verdient, dass ihr auch in dieser weit verbreiteten
Zeitschrift ein Denkstein gesetzt wird. Meine Tante - sie ruhe in
Frieden - Caroline Schwerin, eine geb. Frank, war in Rimpar bei
Würzburg 1808 von frommen Eltern geboren. Nachdem sie eine gute Erziehung
genossen hatte, kam sie frühzeitig in die Fremde, nach Frankfurt am Main,
und siedelte 1839 mit einer Familie Königswarter nach London über. Hier
heiratete sie 1844, genoss jedoch das Glück der Ehe nicht lange; gar zu
bald musste sie Witwe werden. Sie ward an Lady Montefiore rekommandiert
und übernahm schon anno 1845 im Hause der großen Philanthropen - Gott
mehre seine Tage und seine Jahre - die Küche, welche sie treu und zur
vollkommensten Zufriedenheit ihrer Herrschaft bis zu ihrem Ende
verwaltete. Sie war zugleich die Beschließerin des Hauses und schon bei
der seligen Lady Montefiore und nach deren Ableben auch bei Sir Moses,
vertrat sie oft die Stelle eines Gesellschaftsdame. Sehr oft in den
letzteren Jahren, besonders am Freitagabend, machte sie die Vorleserin.
Dass sie in dem hohen Hause eine sehr angenehme Stelle bekleidete,
beweisen ihre Reisen mit Sir Moses nach Jerusalem und anderwärts. Artikel
aus der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Dezember 1884: "Rödelsee
in Bayern. Im Nachtrage zu Ihrer Korrespondenz in Nr. 96 d.d. Ramsgate,
27. November, erlaube ich mir, den geehrten Lesern Ihres geschätzten
Blattes Näheres über meine selige Tante, Mrs. Schwerin zu berichten; hat
sie es doch verdient, dass ihr auch in dieser weit verbreiteten
Zeitschrift ein Denkstein gesetzt wird. Meine Tante - sie ruhe in
Frieden - Caroline Schwerin, eine geb. Frank, war in Rimpar bei
Würzburg 1808 von frommen Eltern geboren. Nachdem sie eine gute Erziehung
genossen hatte, kam sie frühzeitig in die Fremde, nach Frankfurt am Main,
und siedelte 1839 mit einer Familie Königswarter nach London über. Hier
heiratete sie 1844, genoss jedoch das Glück der Ehe nicht lange; gar zu
bald musste sie Witwe werden. Sie ward an Lady Montefiore rekommandiert
und übernahm schon anno 1845 im Hause der großen Philanthropen - Gott
mehre seine Tage und seine Jahre - die Küche, welche sie treu und zur
vollkommensten Zufriedenheit ihrer Herrschaft bis zu ihrem Ende
verwaltete. Sie war zugleich die Beschließerin des Hauses und schon bei
der seligen Lady Montefiore und nach deren Ableben auch bei Sir Moses,
vertrat sie oft die Stelle eines Gesellschaftsdame. Sehr oft in den
letzteren Jahren, besonders am Freitagabend, machte sie die Vorleserin.
Dass sie in dem hohen Hause eine sehr angenehme Stelle bekleidete,
beweisen ihre Reisen mit Sir Moses nach Jerusalem und anderwärts.
Am 2. Tag Rosch haschanah dieses Jahres, nachdem sie mit Sir Moses
die Schofartöne gehört hatte, überfiel sie die hartnäckige Krankheit,
deren Keim schon lange in ihr verborgen lag, und welcher keine Genesung
mehr folgen sollte. Am 12. vorigen Monats wurde ich telegraphisch an ihr
Krankenbett gerufen. Ich reiste mit meinem Bruder sogleich nach Ramsgate,
kam am 14. dort an und traf sie leider nicht mehr am Leben. Am 13. vorigen
Monats stieg ihre reine Seele zum Throne des Allmächtigen empor. Ich
erhielt sogleich Audienz bei Sir Moses, er bewillkommnete mich und
drückte mir sein Beileid mit den herzinnigsten Worten aus. Er sagte mir,
der Tod meiner Tante habe ihn um Vieles zurückgeworfen; sie wäre ihm
eine so treue streng religiöse Dienerin gewesen. Er bewirtete mich in
seinem Hause, woselbst mir alle Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Am 16.
mittags war die Beisetzung. Diese gestaltete sich zu einer großartigen.
Ein Verwandter des Sir Moses, ferner der Vertraute meiner seligen Tante,
Herr Dr. Löwe, die sämtlichen Rabbonim des Ohel Mosche WeJehudit, die
2 Vorbeter, sämtliche Juden Ramsgates, sowie eine unabsehbare Menge
Leidtragender aus allen Klassen der Bevölkerung folgten dem
Leichenkondukte. Nachmittags 2 Uhr wurde durch einen Neffen des Sir Moses
der letzte Willen meiner seligen Tante bekannt gegeben. Ihr echt
religiöser Sinn, ihre Liebe und Anhänglichkeit an das heilige Land,
welches sie mit eigenen Augen geschaut, das Elend unserer Brüder
dortselbst lag ihr so am Herzen, dass sie seiner nicht nur im Leben oft
durch reiche Gaben gedachte - sie hatte sich schon vor 4 Jahren dort
eingekauft für immer - sie hat das Land unserer Ahnen auch in ihrem
letzten Willen bedacht. So vermachte sie der portugiesischen Gemeinde
1.000 Mark und der aschkenasischen ebenfalls 1.000 Mark. Außerdem
bestimmt sie für zwei Synagogen je 1.000 Mark, für welche die in Rimpar
im Trauerjahr das übliche Kaddischgebet zu verrichten hat. Auch das Ohel
Mosche WeJehudit, die Rabbonim, den Chasan, den Schochet
und das Dienstpersonal Sir Moses bedachte sie mit größeren, respektive
kleineren Legaten. So hat sich denn meine selige Tante - sie ruhe in
Frieden - verewigt für alle Zeiten. Ihre Seele sei eingebunden in
den Bund des Lebens.
Aus dem Nachlasse meiner seligen Tante erhielt ich eine Menge Bücher,
welche Abhandlungen von den Reisen des Baronets ins heilige Land und
nach |
 Marokko
enthalten und eine prachtvolle Bibel Tanach, in hoch elegantem
Goldschnitt gebunden, welch Bücher alle Sir Moses meiner seligen Tante
als Präsente verehrte und denen seine Unterschrift in Autographie
beigegeben ist. Vor meiner Abreise in Ramsgate verabschiedete ich mich bei
meinem hoch geehrten Gastgeber. Ich dankte ihm für die große
Aufmerksamkeit und aufopfernde Liebe, welche meiner, nun in Gott ruhenden
Tante - sie ruhe in Frieden, während ihrer langen Krankheit im Hause des
edlen Baronets erwiesen wurden, sowie für die gute und aufmerksame
Aufnahme, die ich während meines fünftägigen Aufenthaltes daselbst
gefunden hatte. Der greise, hoch betagte Sir nahm meine beiden Hände und
sprach mit lauter Stimme, welche noch die Frische des Geistes vernehmen
ließ: 'Ich danke für Ihre gütigen Worte. Ihre selige Tante war mir
stets eine treue Dienerin, eine werte Gesellschafterin. ich werde ihrer
nie vergessen, sie wird stets in meinem Gedächtnisse fortleben. Treten
Sie in religiöser Beziehung in die Fußstapfen Ihrer seligen Frau Tante
ein und halten Sie die Lehre Moses hoch für alle Zeiten.' Marokko
enthalten und eine prachtvolle Bibel Tanach, in hoch elegantem
Goldschnitt gebunden, welch Bücher alle Sir Moses meiner seligen Tante
als Präsente verehrte und denen seine Unterschrift in Autographie
beigegeben ist. Vor meiner Abreise in Ramsgate verabschiedete ich mich bei
meinem hoch geehrten Gastgeber. Ich dankte ihm für die große
Aufmerksamkeit und aufopfernde Liebe, welche meiner, nun in Gott ruhenden
Tante - sie ruhe in Frieden, während ihrer langen Krankheit im Hause des
edlen Baronets erwiesen wurden, sowie für die gute und aufmerksame
Aufnahme, die ich während meines fünftägigen Aufenthaltes daselbst
gefunden hatte. Der greise, hoch betagte Sir nahm meine beiden Hände und
sprach mit lauter Stimme, welche noch die Frische des Geistes vernehmen
ließ: 'Ich danke für Ihre gütigen Worte. Ihre selige Tante war mir
stets eine treue Dienerin, eine werte Gesellschafterin. ich werde ihrer
nie vergessen, sie wird stets in meinem Gedächtnisse fortleben. Treten
Sie in religiöser Beziehung in die Fußstapfen Ihrer seligen Frau Tante
ein und halten Sie die Lehre Moses hoch für alle Zeiten.'
Ich musste weinen, solche Worte, solche gutmeinenden Worte aus dem Munde
dieses Besten der Menschen vernehmen gekonnt zu haben, welche zugleich die
Versicherung enthielten, welch hohe Achtung und Ehre meiner seligen Tante
in diesem Hausee zuteil geworden waren. Nach einem nochmaligen, herzlichen
Händedruck entließ mich der hochedle Greis. Seine Worten werden nie
meinem Gedächtnisse entfallen. - Nach einer Nachricht, die ich soeben aus
Ramsgate erhielt, kann ich Ihnen, sehr geehrter Herr Redakteur,
versichern, dass Sir Moses nach Umständen wieder ganz wohl ist. A.
Frank." |
Zum Tod von Jehuda Hofmann (gest. 1892) und seiner Frau
Minna (gest. 1895, siehe unten)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember 1892:
"Rimpar. Es war ein schmerzlicher Gang, von dem ich soeben
zurückkehre. Einen braven, frommen Jehudi haben sie heute ins kühle Grab
gesehnt. Das Gemeindeglied Herr Jehuda Hofmann ist nicht mehr, Gott
hat ihn zu sich genommen. Wahrlich, er hat es verdient, dass ihm in Ihrem
geschätzten Blatte ein Denkstein gesetzt werde, denn von den Grundsäulen
unserer heiligen Religion, von der Tora, dem Gottesdienst und der
Wohltätigkeit war sein ganzes Leben gefüllt. Ein aufmerksamer
Schüler des Herrn Nathan Freund - das Gedenken an den Gerechten
ist zum Segen - lernte er frühzeitig Mischna und Gemara mit
einer Geistesschärfe, dass damals der Lehrer behauptete, dass er der
Zweite nach dem Rav würde, wenn ihn seine Mutter, eine von Nahrungssorgen
bedrängte Witwe hätte weiter lernen lassen. Was aber die Mutter
unterließ, das sichte er freiwillig wieder gut zu machen. Sobald er
geschäftlich frei war, lernte er und so führte er den Spruch unserer
Weisen gut ist die Verbundenheit von Tora und profanem Leben am schönsten aus. Er lernte, lehrte und lebte nach den
Vorschriften der heiligen Tora. Nie fehlte er im Gotteshause. Und mit
welcher Andacht verrichtete er die Gebete! Wer ihn beobachtete, merkte die
Gottesfurcht, die ihn beseelte. Jeden Sabbat trug er vor versammelter
Gemeinde das Chai Adam oder aus dem Kizzur Schulchan Aruch vor
und war bestrebt, seine Zuhörer zu echten Jehudim heranzubilden. Im
Stillen übte er Wohltaten, damit sein Name nicht in der Öffentlichkeit
genannt werde. Er war ein seltener Mensch, ein Chassid im wahren
Sinne des Wortes, ein Mann des biedersten Charakters und der ehrlichsten
Sinnesart, er war genau im Beobachten der Gebote und erzog seine
Kinder zu strenggläubigen Jehudim. Seine liebste Unterhaltung war die in
der Tora. Wie oft äußerte er mir den Wunsch, wenn es ihm einst vergönnt
sein werde, den Rest seiner Lebenstage in Frankfurt a.M. bei seinem Sohne
verleben zu können, so würde er den ganzen Tag bei dem Rav weilen, um
sich an seinem Schiur zu ergötzen. So groß war seine Liebe zur Tora und
zu ihren Lehrern. Doch der Allgütige hatte es anders beschlossen. Bis
hierher! Jetzt weilt er in den Gefilden der ewigen Seligkeit, uns als
Muster der wahren Frömmigkeit und alles Edlen leuchtend. Das Gedenken
an den Gerichten ist zum Segen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember 1892:
"Rimpar. Es war ein schmerzlicher Gang, von dem ich soeben
zurückkehre. Einen braven, frommen Jehudi haben sie heute ins kühle Grab
gesehnt. Das Gemeindeglied Herr Jehuda Hofmann ist nicht mehr, Gott
hat ihn zu sich genommen. Wahrlich, er hat es verdient, dass ihm in Ihrem
geschätzten Blatte ein Denkstein gesetzt werde, denn von den Grundsäulen
unserer heiligen Religion, von der Tora, dem Gottesdienst und der
Wohltätigkeit war sein ganzes Leben gefüllt. Ein aufmerksamer
Schüler des Herrn Nathan Freund - das Gedenken an den Gerechten
ist zum Segen - lernte er frühzeitig Mischna und Gemara mit
einer Geistesschärfe, dass damals der Lehrer behauptete, dass er der
Zweite nach dem Rav würde, wenn ihn seine Mutter, eine von Nahrungssorgen
bedrängte Witwe hätte weiter lernen lassen. Was aber die Mutter
unterließ, das sichte er freiwillig wieder gut zu machen. Sobald er
geschäftlich frei war, lernte er und so führte er den Spruch unserer
Weisen gut ist die Verbundenheit von Tora und profanem Leben am schönsten aus. Er lernte, lehrte und lebte nach den
Vorschriften der heiligen Tora. Nie fehlte er im Gotteshause. Und mit
welcher Andacht verrichtete er die Gebete! Wer ihn beobachtete, merkte die
Gottesfurcht, die ihn beseelte. Jeden Sabbat trug er vor versammelter
Gemeinde das Chai Adam oder aus dem Kizzur Schulchan Aruch vor
und war bestrebt, seine Zuhörer zu echten Jehudim heranzubilden. Im
Stillen übte er Wohltaten, damit sein Name nicht in der Öffentlichkeit
genannt werde. Er war ein seltener Mensch, ein Chassid im wahren
Sinne des Wortes, ein Mann des biedersten Charakters und der ehrlichsten
Sinnesart, er war genau im Beobachten der Gebote und erzog seine
Kinder zu strenggläubigen Jehudim. Seine liebste Unterhaltung war die in
der Tora. Wie oft äußerte er mir den Wunsch, wenn es ihm einst vergönnt
sein werde, den Rest seiner Lebenstage in Frankfurt a.M. bei seinem Sohne
verleben zu können, so würde er den ganzen Tag bei dem Rav weilen, um
sich an seinem Schiur zu ergötzen. So groß war seine Liebe zur Tora und
zu ihren Lehrern. Doch der Allgütige hatte es anders beschlossen. Bis
hierher! Jetzt weilt er in den Gefilden der ewigen Seligkeit, uns als
Muster der wahren Frömmigkeit und alles Edlen leuchtend. Das Gedenken
an den Gerichten ist zum Segen." |
Zum Tod von Minna Hofmann (1895)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Mai 1895: "Aus
Unterfranken. Eine edle Frau in Israel hat Dienstag, 6. Ijar (30.
April 1895) ihr tatenreiches Erdenleben vollendet. Frau Minna Hofmann aus
Rimpar bei Würzburg wurde durch den Tod aus dem Kreise ihrer Kinder und
Enkel hinweggenommen. Weit über ihren Verwandtenkreis hinaus wird dieser
Verlust mit großem Schwere empfunden. Einfach und bescheiden in ihrem
Wesen, vereinigte sie mit altjüdischer Frömmigkeit so viel Edles und
Vornehmes, dass sie stets mit vollem Rechte als tüchtige Frau bezeichnet
werden konnte. In einer langen, glücklichen Ehe war sie stets treue
Gefährtin ihres Gatten, des Gemeindegliedes Herrn Jehuda Hofmann,
der ihr vor kaum 2 Jahren in den Tod vorangeeilt ist. Im Vereine mit
demselben wusste sie ihr Haus zu einem echt jüdischen zu gestalten und
für Tora, Gottesdienst und Wohltätigkeit in edler Weise zu
wirken. Als Tochter eine Torakundigen Vaters und Gattin eines stets
Torabeflissenen Mannes, war ihr Herz von wahrer Ehrfurcht von
der Tora erfüllt, die sie durch große Verehrung der Träger der Tora
und durch so vielfache Förderung des Tora-Studiums bekundete. Ihr
gottesdienstliches Leben als jüdische Frau konnte als mustergültiges
betrachtet werden. Da blieb nicht die kleines Vorschrift unbeachtet, da
wurde nicht das geringste Verbot übersehen und über alles
Zweifelhafte, erholte sie sich stets bei Torakundigen Rat.
Außergewöhnlich anspruchslos in ihren eigenen Bedürfnissen, spendete
sie aber stets mit vollen Händen, wenn es galt, Not und Leid zu lindern.
Die Gäste wurden stets in liebevollster Weise in ihrem Hause gastlich
aufgenommen und es war wohl selten am Schabbat und Jom Tow
(Versöhnungstag), dass nicht ein Gast zu Tische geladen war. Sie übte
aber nicht nur Gerechtigkeit, sondern auch in der vollkommensten Weise
Wohltätigkeit. In hingebenster Weise suchte sie Franke nicht nur zu
besuchen, sondern auf alle mögliche Weise ihnen hilfreich zur Seite zu
stehen. Wenn es galt, Wohltätigkeit zu üben, war sie gewiss zu
jeder Tages oder Nachtzeit eine der Ersten zur Stelle. Jahreslang versah
sie auch in der treuen Weise das Amt einer Vorsitzenden der Frauen-Chewra
(Verein für Wohltätigkeits- und Bestattungswesen der Frauen) in Rimpar.
So wie sie das Leid der Traurigen zu mildern suchte, so wusste sie durch
sorgliches Mitgefühl die Freude der Freudigen zu vergrößern und ihren
zahlreichen Freunden und Freundinnen war sie eine selten treue Freundin,
denen sie so gerne mit Rat und Tat zur Seite stand. Sie hatte auch die Freude,
ihren einzigen Sohn Herrn A. J. Hofmann in Frankfurt a.M., ihre Töchter
und Schwiegersöhne als echte Jehudim in ihrem Geiste und dem
Geistes ihres Gatten - seligen Angedenkens - weiterleben zu
sehen. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Mai 1895: "Aus
Unterfranken. Eine edle Frau in Israel hat Dienstag, 6. Ijar (30.
April 1895) ihr tatenreiches Erdenleben vollendet. Frau Minna Hofmann aus
Rimpar bei Würzburg wurde durch den Tod aus dem Kreise ihrer Kinder und
Enkel hinweggenommen. Weit über ihren Verwandtenkreis hinaus wird dieser
Verlust mit großem Schwere empfunden. Einfach und bescheiden in ihrem
Wesen, vereinigte sie mit altjüdischer Frömmigkeit so viel Edles und
Vornehmes, dass sie stets mit vollem Rechte als tüchtige Frau bezeichnet
werden konnte. In einer langen, glücklichen Ehe war sie stets treue
Gefährtin ihres Gatten, des Gemeindegliedes Herrn Jehuda Hofmann,
der ihr vor kaum 2 Jahren in den Tod vorangeeilt ist. Im Vereine mit
demselben wusste sie ihr Haus zu einem echt jüdischen zu gestalten und
für Tora, Gottesdienst und Wohltätigkeit in edler Weise zu
wirken. Als Tochter eine Torakundigen Vaters und Gattin eines stets
Torabeflissenen Mannes, war ihr Herz von wahrer Ehrfurcht von
der Tora erfüllt, die sie durch große Verehrung der Träger der Tora
und durch so vielfache Förderung des Tora-Studiums bekundete. Ihr
gottesdienstliches Leben als jüdische Frau konnte als mustergültiges
betrachtet werden. Da blieb nicht die kleines Vorschrift unbeachtet, da
wurde nicht das geringste Verbot übersehen und über alles
Zweifelhafte, erholte sie sich stets bei Torakundigen Rat.
Außergewöhnlich anspruchslos in ihren eigenen Bedürfnissen, spendete
sie aber stets mit vollen Händen, wenn es galt, Not und Leid zu lindern.
Die Gäste wurden stets in liebevollster Weise in ihrem Hause gastlich
aufgenommen und es war wohl selten am Schabbat und Jom Tow
(Versöhnungstag), dass nicht ein Gast zu Tische geladen war. Sie übte
aber nicht nur Gerechtigkeit, sondern auch in der vollkommensten Weise
Wohltätigkeit. In hingebenster Weise suchte sie Franke nicht nur zu
besuchen, sondern auf alle mögliche Weise ihnen hilfreich zur Seite zu
stehen. Wenn es galt, Wohltätigkeit zu üben, war sie gewiss zu
jeder Tages oder Nachtzeit eine der Ersten zur Stelle. Jahreslang versah
sie auch in der treuen Weise das Amt einer Vorsitzenden der Frauen-Chewra
(Verein für Wohltätigkeits- und Bestattungswesen der Frauen) in Rimpar.
So wie sie das Leid der Traurigen zu mildern suchte, so wusste sie durch
sorgliches Mitgefühl die Freude der Freudigen zu vergrößern und ihren
zahlreichen Freunden und Freundinnen war sie eine selten treue Freundin,
denen sie so gerne mit Rat und Tat zur Seite stand. Sie hatte auch die Freude,
ihren einzigen Sohn Herrn A. J. Hofmann in Frankfurt a.M., ihre Töchter
und Schwiegersöhne als echte Jehudim in ihrem Geiste und dem
Geistes ihres Gatten - seligen Angedenkens - weiterleben zu
sehen.
Möge ihr edles Beispiel vielfach Nachahmung finden und dadurch das
Gedenken an sie zum Segen werden. Dieses gereiche auch der trauernden
Familie in ihrem Schmerze zum Troste. J.A.B." |
Zeichen des aufkommenden Antisemitismus -
Verleumdung gegen den jüdischen Arzt Dr. Mayer (1903)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16. Oktober 1903:
"Würzburg, 9. Oktober (1903). Die antisemitisch-bauernbündlerische
"Neue Bayerische Landeszeitung" schrieb im Januar in einem
Artikel, der jüdische Arzt Dr. Mayer in Rimpar sage beim Besuch von
christlichen Kranken den christlichen Gruß und besprenge sich mit
Weihwasser. Dr. Mayer stellte Beleidigungsklage, über welche nach
mehrmaligen Vertagungen nunmehr das Schöffengericht zu urteilen hatte.
von einer großen Anzahl Zeugen konnte kein einziger die Behauptungen des Bündlerorgans bestätigen. Das Urteil lautete für den zeichnenden
Redakteur, der vorgab, den Artikel nicht selbst geschrieben zu haben, auf
300 Mark Geldstrafe". Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16. Oktober 1903:
"Würzburg, 9. Oktober (1903). Die antisemitisch-bauernbündlerische
"Neue Bayerische Landeszeitung" schrieb im Januar in einem
Artikel, der jüdische Arzt Dr. Mayer in Rimpar sage beim Besuch von
christlichen Kranken den christlichen Gruß und besprenge sich mit
Weihwasser. Dr. Mayer stellte Beleidigungsklage, über welche nach
mehrmaligen Vertagungen nunmehr das Schöffengericht zu urteilen hatte.
von einer großen Anzahl Zeugen konnte kein einziger die Behauptungen des Bündlerorgans bestätigen. Das Urteil lautete für den zeichnenden
Redakteur, der vorgab, den Artikel nicht selbst geschrieben zu haben, auf
300 Mark Geldstrafe". |
Zum Tod von Eva (?) Adler (1911)
Anmerkung: Zuordnung unklar; möglicherweise handelt es sich um Ella Adler
geb. Frank, Frau des Viehhändlers Abraham Adler in Rimpar. Sohn Willi Benjamin
Adler (geb. 3. September 1877 in Rimpar) wird genannt bei Strätz Biographisches
Handbuch Würzburger Juden Bd. I S. 53.
 Artikel in "Der Israelit" vom 16. März 1911: "Rimpar,
5. März. Durch den am Montag, 29. Schewat (5671 = 27. Februar
1911) unerwartet erfolgten Tod der Frau Ella (?) Adler wurden
nicht nur deren Familie, sondern alle, die ihr nahe standen, in große Trauer
versetzt. Die verblichenen eine wackere Frau im wahren Sinne des
Wortes, die ein Alter von 63 Jahren erreicht hat, war stets bestrebt, den in
ihrem strengen religiösen Elternhause erhaltenen Lehren und Beispielen
nachzuleben und dieselben auch auf ihre Kinder zu übertragen. Ihrem Gatten,
ihren Kindern und allen Familienangehörigen war sie in inniger Liebe
zugetan. Als einfach schlichte Hausfrau entsprach sie voll und ganz dem
Frauenideal, wie es ihm Salomonische Liede (vgl.
http://spurensuche.steinheim-institut.org/pdf/LobdertuechtigenFrauEinheitsuebersetzung.pdf)
von dem jüdischen Biederweibe gezeichnet wird. Ihre große Herzensgüte,
Bescheidenheit und Menschenfreundlichkeit entzückte alle, welche mit ihr in
Berührung kamen. Davon legte auch die starke Teilnahme an dem
Leichenbegängnisse, wozu Freunde aus nah und fern erschienen waren, beredtes
Zeugnis ab. In Anbetracht des Rosch Chodesch* musste von einer
Grabrede abgesehen werden. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." Artikel in "Der Israelit" vom 16. März 1911: "Rimpar,
5. März. Durch den am Montag, 29. Schewat (5671 = 27. Februar
1911) unerwartet erfolgten Tod der Frau Ella (?) Adler wurden
nicht nur deren Familie, sondern alle, die ihr nahe standen, in große Trauer
versetzt. Die verblichenen eine wackere Frau im wahren Sinne des
Wortes, die ein Alter von 63 Jahren erreicht hat, war stets bestrebt, den in
ihrem strengen religiösen Elternhause erhaltenen Lehren und Beispielen
nachzuleben und dieselben auch auf ihre Kinder zu übertragen. Ihrem Gatten,
ihren Kindern und allen Familienangehörigen war sie in inniger Liebe
zugetan. Als einfach schlichte Hausfrau entsprach sie voll und ganz dem
Frauenideal, wie es ihm Salomonische Liede (vgl.
http://spurensuche.steinheim-institut.org/pdf/LobdertuechtigenFrauEinheitsuebersetzung.pdf)
von dem jüdischen Biederweibe gezeichnet wird. Ihre große Herzensgüte,
Bescheidenheit und Menschenfreundlichkeit entzückte alle, welche mit ihr in
Berührung kamen. Davon legte auch die starke Teilnahme an dem
Leichenbegängnisse, wozu Freunde aus nah und fern erschienen waren, beredtes
Zeugnis ab. In Anbetracht des Rosch Chodesch* musste von einer
Grabrede abgesehen werden. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens."
Anmerkung: Rosch Chodesch vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosch_Chodesch meint den 1. des neuen
Monats bzw. im Monat Adar auch den letzten des vorigen Monats, also den 30.
Schewat und den 1. Adar 5671. Die Beisetzung dürfte am 1. Adar = 1. März
1911 stattgefunden haben. Im traditionellen Judentum wird am Rosch Chodesch
keine Trauerrede gehalten. |
85. Geburtstag von Babette Schwab (1927)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Juni 1927: "Rimpar
bei Würzburg, 31. Mai (1927). Die in weiten Kreisen bekannte und
beliebte Frau Babette Schwab feierte am 3. Juni ihren 85. Geburtstag.
Möge ihr noch ein froher Lebensabend beschieden sein." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Juni 1927: "Rimpar
bei Würzburg, 31. Mai (1927). Die in weiten Kreisen bekannte und
beliebte Frau Babette Schwab feierte am 3. Juni ihren 85. Geburtstag.
Möge ihr noch ein froher Lebensabend beschieden sein." |
Texte von Rabbiner Kuno Lehrmann (1928)
Anmerkung: Rabbiner Kuno (Cuno, Chanan, Charles) Lehrmann ist als Sohn des
Tora-Schreiber Chaim Lehrmann 1905 in Stryzow / Galizien geboren. Er ließ sich
an der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in Würzburg ausbilden (1921 bis zum
Examen 1924). Von 1924 bis 1929 war er als Religionslehrer, Prediger und Kantor
in Tübingen, Crailsheim
und Rimpar tätig. 1928 bis 1932 Studium in Würzburg und Berlin (1932
Promotion in Würzburg; 1933 Examen am Rabbiner-Seminar Berlin). Von 1929 bis
1933 war er als Erzieher an einem jüdischen Waisenhaus in Berlin tätig. 1933
ist er in die Schweiz emigriert, wo er von 1934 bis 1948 Privatdozent für
jüdische und französische Literatur an der Universität Lausanne war; 1936 bis
1948 zugleich Rabbiner in Freiburg
(Fribourg)/Schweiz. 1949 bis 1958 war er
Landesrabbiner von Luxemburg, 1958 bis 1960 Gastdozent in Ramat Gan/Israel, 1960
bis 1971 Gemeinderabbiner in Berlin (West), daneben ab 1967 Honorarprofessor
für Romanistik an der Universität Würzburg. Lehrmann war seit 1937
verheiratet mit Graziella geb. Gandoli (geb. 1913 in Oberhofen/Schweiz,
Schriftstellerin); Tochter: Myriam Mali Beer (geb. 1938 in Paris, war später
Schauspielerin in Israel). Lehrmann war Verfasser zahlreicher Publikationen
(Übersicht bei Zapf S. 145).
Quelle: u.a. Lilli Zapf: Die Tübinger Juden S. 143-146).
 Veröffentlicht
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Juli 1928: "Dem
auserwählten Volke! Veröffentlicht
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Juli 1928: "Dem
auserwählten Volke!
Ich rang die Hände nachts in meiner Kammer Und aus mir wild schrie
meines Volkes Stimme: '
Wie lang noch, Herr, willst Du in Deinem Grimme Mit anseh'n,
Deines Volkes blut'gen Jammer?
Sind wir zum einz'gen Volke auserkoren, Daß wir als Opferlamm der
Menschheit dienen,
Allzeit des Volkes Wahnwitz schweigend sühnen? Wir lösen Dich vom
Schwur, den Du geschworen!'
'Nicht wert ist, wem in fruchtlos lauten Klagen Sein
Gottvertrau'n in Zeit der Not zerschellt, Den stolzen Namen 'Israel' zu
tragen. Leicht ist's im Glück; im Leid sollst Du
beweisen, Welch Gottesgeist Dich groß, unsterblich hält!
So wirst Du wert, mich einst im Glück zu preisen. Kuno
Lehrmann, Rimpar." |
Erzählung "Schnorrer" von Lehrer
Kuno Lehrmann (1928)
 Artikel in "Das jüdische Echo" vom 23. November 1928: "Schnorrer. Von Lehrer
Kuno Lehrmann (Rimpar)..."
Artikel in "Das jüdische Echo" vom 23. November 1928: "Schnorrer. Von Lehrer
Kuno Lehrmann (Rimpar)..."
Der Artikel wird nicht abgeschrieben, da es direkten inhaltlichen Bezüge
zu Rimpar gibt. |

|
Zum Tod von Lehrer David Lehmann
(geboren 1856 in Rimpar, 1879 bis 1922 Lehrer in
Brückenau; gest. 1929)
 Artikel
in "Mitteilungen des Israelitischen Lehrervereins für Bayern" vom 15. März
1929: "David Lehmann. Artikel
in "Mitteilungen des Israelitischen Lehrervereins für Bayern" vom 15. März
1929: "David Lehmann.
'Am Morgen noch in kraftvoller Frische, am Abend schon gefällt, dem Leben
entrückt!' Diese Worte des 90. Psalmes durchzuckten wohl jäh und schmerzvoll
viele Herzen, als sich am Abend des 18. Februar in Würzburg die Trauerkunde
verbreitet hat, Lehrer Lehmann ist eingegangen in die ewige Heimat. Am
Morgen noch war er, der 73-jährige, trotz Unbilden der Witterung, im
Gottesdienste, - nachmittags befiehl ihn ein Unwohlsein und nach kurzen
Stunden raffte ihn ein Herzschlag dahin. Mit ihm ist eine vorbildliche
Lehrerpersönlichkeit aus dem Leben geschieden, eine Persönlichkeit von
seltener Pflichttreue und Selbstlosigkeit, ein Mann voll wahrer
Bescheidenheit und echter Frömmigkeit, eine Natur von abgeklärtester Ruhe,
Sanftmut und Menschenfreundlichkeit. Geboren am 15. Februar 1856 in
Rimpar, besuchte er die
Präparandie in Höchberg und das
Israelitische Lehrerseminar Würzburg, dass er 1874 absolvierte. Nach
kürzerer Amtstätigkeit in Höchheim und
Mellrichstadt wirkte er 43 Jahre
als Religionslehrer, Vorbeter und Schochet in
Brückenau, bis er 1922 in den
wohlverdienten Ruhestand trat, den er in Würzburg im Hause seines
Schwiegersohnes des Seminardirektors Jakob Stoll (sc. 1876 in
Maßbach - 1962 in New York), des Gatten seiner einzigen Tochter (sc.
Gitta Stoll geb. Lehmann, 1885 in Bad Brückenau - 1951 in New York), mit
seiner treuen Gattin (sc. Lea geb. Kuhn, 1864
Aidhausen - 1942 Ghetto
Theresienstadt), getragen von Liebe und Verehrung erlebte. Die
Bestattung des Verlebten zeigte eine derart große Beteiligung, wie sie
Würzburg selten gesehen. Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde
Brückenau waren fast vollzählig
erschienen, ebenso Vertretern der benachbarten Gemeinden im Rhönbezirk, dazu
natürlich sehr viele Würzburger, denn fast jeder kannte und schätzte den
ehrwürdigen Greis, der für jeden Begegnenden stets einen freundlichen Gruß,
ein Lächeln, einen Händedruck, ein liebes Wort hatte, dem jeder zugetan sein
musste. Auch Nichtjuden waren erschienen: Kreisschulrat Emrich, Oberlehrer
Englert und andere befanden sich im Trauergefolge. Die jüdische Lehrerschaft
Würzburg, das Lehrerseminar, die Präparandenschule usw. fehlten nicht.
An der Bahre gab Bezirksrabbiner Dr. Hanover in ergreifenden Worten ein
Lebensbild des Heimgegangenen. Im Anschluss an die Eingangsverse des
Abschnittes Tezawe (= 2. Mose 27,20 - 30,10) in Auffassung der
Talmud- und Midraschlehrer verglich er Leben und Wirken Lehmanns mit dem
Lichte im Heiligtum. In ihm war Licht und er verbreitete Licht, das Licht
der Tora, der g'ttlichen Erleuchtung, als ein echter Lehrer in Israel. Die
wahre, alte, jüdische Gottesfurcht kennzeichnete sein ganzes Wesen und war
bedingend für seine Persönlichkeit und sein Wirken in Pflichttreue und
Bescheidenheit, in Liebe und Güte und wird ihn unvergesslich bleiben lassen.
Bezirksrabbiner Dr. Bamberger (Bad
Kissingen), zu dessen Bezirk Brückenau gehört, war herbeigeeilt und
zeichnete das Bild Lehmanns in Anlehnung an einen talmudischen Trauerredner
im Symbol des Tamarbaumes, der nur 'ein Herz' habe und in gleicher Weise
vielfachsten Zecken dienen. So sei der Entschlafende eine geschlossene,
einheitliche Charakterpersönlichkeit gewesen, dessen Wirken als Lehrer,
Chasan und Schochet in musterhafter Vorbildlichkeit sich auf Tora, Abodah
(Gottesdienst) und Gemilus Chasodim erstreckte, geeint durch echte, geradezu
selbstverständlicher Frömmigkeit als wahrer Zadik, den die Schrift dem Tamar
vergleiche. Er betonte auch besonders das patriarchalisch innige Verhältnis,
das zwischen dem Verblichenen und dem Rabbinate jederzeit bestanden habe.
Hauptlehrer Gundersheimer, der Amtsnachfolger Lehmanns sprach namens und im
Auftrage der Kultusgemeinde Brückenau deren innigen Dank aus für alle Liebe
und Treue und Aufopferung, die der Verblichene in 43-jähriger Tätigkeit in
bewundernswerter Selbstlosigkeit der Gemeinde Brückenau erwiesen, betonte,
wie unter seiner Führung sich
Brückenau zu einem blühenden jüdischen Gemeinwesen entwickelt habe und
gelobte stetes, unentwegtes Festhalten an den Grundsätzen des geliebten
alten Lehrers, wodurch ihm in aller Herzen das schönste dauernde Denkmal
gesetzt sei.
Als letzter Trauerredner nahm Seminardirektor Stoll in rührenden Worten und
mit tränenerstickter Stimme Abschied von dem geliebten Vater, von dem alle
nur Liebe und Güte erfahren, aus dessen Mund nie ein unfreundliches Wort
gekommen, der in seiner schlichten, edlen Herzensgüte die Menschen stets nur
nach der besseren Seite beurteilte. Im Anschluss an ein Midraschwort
(Ausspruch des Ben Asai über die Bedeutung des Satzes 2. Buch Mose Kapitel
29,39) legt er noch einmal dar, wie Nächstenliebe und stete
Opferbereitschaft die Grundzüge waren im Charakterbilde des Heimgegangenem,
die ihn in seiner Bescheidenheit und Selbstverleugnung, unserem großen
Lehrer Mose gleich, prädestinierten zum erfolgreichen Lehrer und Führer der
Gemeinde.
Auch auf der öffentlichen Würzburger Bezirkskonferenz vom Montag, 25.
Februar sprach zur Eröffnung Herr Dr. Neubauer Worte des Gedenkens an David
Lehmann. Er erinnerte an die wertvollen Eigenschaften, die den Verstorbenen
auszeichneten. Für seine Liebe zum Lernen sei es bezeichnend, dass, soweit
die Erinnerung der Teilnehmer reicht, David Lehmann niemals bei einer der
wöchentlichen Konferenzen gefehlt hat bis an jenem Montag, da er sich auf
seinem letzten Krankenlager befand. Auf den Verstorbenen mögen jene
Aussprüche angewendet werden, die einst beim Tode des Samuel Hakaton
gesprochen wurden: 'Über diesen ziemt es zu trauern, über diesen ziemt es zu
klagen, Könige sterben und lassen ihre Kronen ihren Söhnen, Reiche sterben
und lassen ihren Reichtum ihren Söhnen, Samuel ha Katon aber hat das
kostbarste der Welt mit sich genommen und ist dahingegangen!' 'Wehe ob des
Bescheidenen, des Frommen, des Schülers von Hillel Hasken!' (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hillel). Im Anschlusse an diese
Ausführungen gab dann Hauptlehrer Mannheimer (Dettelbach)
nochmals dem Schmerze der Konferenz Ausdruck, die einen so lieben und treuen
Kollegen verloren habe. Herr Mannheimer erzählte von seinen persönlichen
Erinnerungen an den Verstorbenen von jenen Zeiten her, da er vor langen
Jahren in Zeitlofs amtiert hatte und
oftmals in das so freundliche, von jüdischem Geiste erfüllte Haus seines
Nachbarkollegen gekommen war.
Lehmann ist von uns gegangen, Lehmanns Bild wird immer unter uns weilen,
aneifernd zu stetem Streben, in seiner Art zu wirken, dem Judentum und der
Menschheit fördernd zu dienen.
Es ist mir ein Bedürfnis, dem liebevollen Nachruf, den Seminaroberlehrer
Anfänger meinem lieben Lehrer David Lehmann seligen Andenkens
gewidmet hat, noch einige Worte der Liebe und des Dankes anzufügen. David
Lehmann war das Muster eines idealen Lehrers. Mit Liebe und Begeisterung
hing er an seinem Berufe, dem er auch jede freie Minute des Tages opferte.
An uns, seine Schüler, stellte er große Anforderungen. Bei uns gab es keinen
freien Sonntag und keinen freien Nachmittag in der Woche. Während wir
vormittags unseren pflichtmäßigen Religionsunterricht hatten, arbeitete er
jeden Nachmittag nach dem Volksschulunterricht noch 2 Stunden und am Sonntag
5 Stunden an uns und mit uns.
In dem kleinen Zimmer, in dem er Schule hielt, konnte man ihn auch außerhalb
der Unterrichtszeit stets treffen. Das Schulzimmer war ihm der liebste Raum
im Schulhause. Er war so sehr Lehrer mit ganzem Herzen, dass sich seine
Liebe zum Berufe auch auf das Schulzimmer erstreckte.
Nur der Schabbat gehörte nicht der Schule, der gehörte, aber auch ganz der
Gemeinde. Von einem Schiur (Lehrstunde) eilte er zum andern, und
durch seine Lehre und durch sein Vorbild und durch seine tiefe Fröhlichkeit
war er der Idealste Erzieher seiner Gemeinde. Und wenn heute die Kehilo
(jüdische Gemeinde) Brückenau wohl eine der religiösesten Kehilot
(jüdische Gemeinden) in Bayern ist und wenn dort kein einziges Geschäft am
Schabbat geöffnet ist, dann ist ein Teil dieser Entwicklung auf das Konto
Lehmann zu buchen.
Er war auch der treue Vater seiner Gemeinde. Er nahm regen Anteil an den
Freuden und Leiden jedes einzelnen Mitgliedes. Wer Rat brauchte, kam zu
'Lehrer Lehmann'.
Nie kam ein Wort des Unmutes über seine Lippen. Man brachte ihm Liebe
entgegen, weil er selbst Liebe aus streute. Er war eine wahre Hillel-Natur
(vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hillel). Seine Anspruchslosigkeit und
Bescheidenheit ist in Brückenau sprichwörtlich geworden. So hat er sich
selbst ein Denkmal in den Herzen seiner Gemeinde Mitglieder und seiner
Schüler errichtet. Und ich kann wohl im Namen aller seiner Schüler sagen:
lieber Lehrer David Lehmann! Wir werden deiner nie vergessen, wir werden
dich in liebevoll im Andenken bewahren, solange unser Herz schlägt. Habe
Dank für alles Liebe und Treue, die du uns erwiesen hast. Möge dir der
himmlische Lohn dafür zu Teil werden! M. Adler." |
Beitrag von Julie Laßmann (geb. 1905 in Hainsfahrt, lebte in Rimpar, ermordet
1945 in Auschwitz)
Anmerkung: Julie Laßmann war eine alleinstehende Musik- und
Sprachlehrerin, die bis um 1935 mit ihren Eltern in Rimpar lebte, wo ihr Vater
Maier Laßmann (s.o.) seit 1929 Kultusbeamter, das heißt vor allem Vorbeter, Religionslehrer und Schochet war.
Ihre Mutter starb 1932 (siehe Bericht oben). 1935 verzog sie nach Würzburg, wo sie im Auftrag der Israelitischen Kultusgemeinde
Fremdsprachkurze zur Vorbereitung der Emigration hielt. Zuletzt war sie als
Hilfsnäherin in einer Uniformfabrik in Würzburg zur Zwangsarbeit verpflichtet.
Am 17. Juni 1943 wurde sie nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Den
nachfolgenden Text schrieb Julie Laßmann 1934 in Rimpar:
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1934:
"So bin ich zu jüdischem Bewusstsein erwacht! Ein
Tischoh-beaw-Erlebnis (9. Aw = Gedenktag der mehrfachen Zerstörungen
des Tempels in Jerusalem). Von Julie Laßmann in Rimpar. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1934:
"So bin ich zu jüdischem Bewusstsein erwacht! Ein
Tischoh-beaw-Erlebnis (9. Aw = Gedenktag der mehrfachen Zerstörungen
des Tempels in Jerusalem). Von Julie Laßmann in Rimpar.
Wenn ich heute mit geöffneten Augen zurückschaue auf mein
früheres Leben, auf jenen Dämmerzustand in der Atmosphäre eines wohligen
Geborgenseins, der vor dem jüdischen Erlebnis liegt, bin ich zu einer
Feststellung gezwungen, die beschämend genug ist für einen jüdischen
Menschen: Aus gesetzestreuer Familie stammend, Abkömmling eines
Geschlechtes, das dem Judentum Männer von Namen schenkte - eine Abkunft,
die verpflichtet -, habe ich bin dahin doch mein Judesein mehr als private
religiöse Angelegenheit empfunden. Wie locker war aber doch im ganzen die
Bindung an Volk und Gemeinschaft! Beschämend, ja. Erst des Geschehens der
letzten Zeit hat es bedurft, der Wucht dieses Erlebten, um hineinzufinden
zum jüdischen Volksbewusstsein. - Eine Stunde aber ist, die mir die
Verbundenheit mit meinem Volke erst ganz und voll ins Bewusstsein gerufen
hat, nicht nur die Verbundenheit durch das Gemeinsame des äußeren
Erlebens, sondern durch das Teilhaben an einer göttlichen Gnade: Eine
Stunde, in der ich erschauernd das Glück des Judeseins empfand.
Es war am Morgen des neunten Aw. Vater war sehr früh zur Synagoge
gegangen und noch nicht daraus zurückgekehrt; so war ich allein im Hause.
Ich wanderte umher in den Räumen, die noch erfüllt sind von ihr, von der
Seele des Hauses, von der teuren Mutter, die erst vor kurzem uns
abgefordert wurde nach des Himmels unerforschbarem Ratschluss. Es war ein
Gefühl in mir, ganz eigen und sonderbar zerschlagen, ein unklares
Gefühl, dass ich etwas suchen müsste, was mir fehlt, und dass ich es
doch nicht würde finden könnten. Früh hatte ich in den Geschichtswerken
gelesen, hatte mich in Bücher vertieft, die von den Ereignissen der
schicksalsschweren Tage erzählen, an die der heutige erinnern soll, von
der Belagerung Jerusalems und der Zerstörung des Tempels, von
Gefangenschaft und Flucht, von erneuter Belagerung der wiedererstandenen
Stadt mehrere Jahrhunderte später, von heldenmütiger Verteidigung eines
durch Hunger und Pest geschwächten Volkes, von der Einäscherung seines
Heiligtums und dem gänzlichen Verlust der politischen Selbständigkeit.
Drückend lastete auf mir die Schwermut des Tages. Da auf einmal, als ich
wieder die Reihen der Bücher durchsah, wurde mir klar, was ich hier
eigentlich wollte: Das 'Chumisch' (sc. eigentlich Pentateuch, hier aber
Bibelausgabe bzw. Andachtsbuch gemeint) der Mutter suchte ich, ihr
Andachtsbuch, um mich mit ihm auf die Erde zu setzen und das Klagelied des
Propheten zu lesen, wie sie es vordem alljährlich getan. Ich nahm es heraus
aus dem Schranke, dieses Buch mit dem Lederrücken und den abgegriffenen
Deckeln, das ich so oft ihr zugereicht hatte. Eine Fromme ist sie gewesen,
die Mutter. Von jener echten tiefsinnigen Frömmigkeit war sie, die
unentwegt auf Gottes Hilfe vertraut, die unbeirrbar festhält an dem
Zukunftsglauben, den kein auch noch so schweres Geschickt erschüttern
kann. Und aus diesem Vertrauen wuchs inneres Frohsein, blühte ihr eine
Freudigkeit des Seele, die ein Dauerndes geworden war und die sich jedem
mitteilte, der in rechter Bereitschaft zu ihr kam, Dies Andachtsbuch, wie
oft hat sie es in den arbeitsmüden Händen gehalten, wie oft sich an
seinen frommen Erzählungen und Gleichnissen erbaut und uns Kindern daraus
vorgelesen. So am Vorabend des neunten Aw. Da mussten wir uns, ob klein,
ob erwachsen, zu ihr auf die Erde setzen und hörten dann in wehmutsvoller
Ergriffenheit des Propheten Klage um die Stadt, die eine Krone war unter
den Städten, um das zerstörte Heiligtum, um die verlorene Heimat. Mit
Tränen in der Stimme las sie. Wir Kinder sahen verlegen vor uns hin; wir
konnten diesen Schmerz im letzten nicht verstehen. Warum immer noch einem
verlorenen Lande nachweinen, wenn man doch in einem so schönen anderen
leben darf, in dem es uns gut ergeht und das wir von ganzem Herzen lieben!
O Mutter, Deine Tränen verstehe ich jetzt. Wie würden sie heute
fließen! Mutter, liebe fromme Mutter, Dir ist dies erspart geblieben,
diesen bitteren Schmerz hast Du nicht erleben müssen.
Das Buch Eicho (= Klagelieder Jeremias) liegt aufgeschlagen vor mir. Ich
lese darin, meine Augen sehen die Linien, und meine Hand wendet die
Blätter um. Doch was ich sehe, sind nicht Zeilen und Blätter, ist nicht
Papier. Tränen verdunkeln mir den Blick, denn ich schaue die Geschichte
meines Volkes. Eine Geschichte von Leiden Jahrtausende hindurch, eine
Kette von Bedrückungen und Verfolgungen. Jede Zeit, jedes Jahrhundert
brachte anderes Leid, ewig wiederkehrend, ewig sich ablösend und
erneuernd. Ewig gleichbleibend aber, einziges lichtes Wunder, ist
Beharren. Geschlechter kamen, litten, vergingen, Zehntausende ereilte der
Opfertod: Das Judentum blieb. Keine Macht, kein Zeitgeschehen, kein noch
so unerbitterlicher Zerstörungswille hat es auszurotten vermocht. Nicht
'zufällig' ist das Geschehen von heute; die Geschichte offenbart uns den
Zusammenhang, zeigt uns das Walten eines höheren Sinnes in den
Vorgängen, in der Entwicklung. - So lese ich in dem Buche vor mir, das so
mächtig zu mir spricht: 'Darum gebe |
 ich die Hoffnung nicht auf: Dass Deine Gnade nie endet, Dein Erbarmen nie
aufhört. Deine Gnade erneuert sich jeden Tag, groß ist Deine Treue.'
Spricht nicht unerschütterlicher Zukunftsglaube aus diesen Worten des
Propheten, schimmert nicht tröstende Verheißung durch? O hohe Stunde,
was lehrst Du mich! Glaubensstärke und Gottvertrauen, Wille zum Leben,
freudiges Bejahen, Zukunftsvollen: Das ist's was auch diese Zeit von uns
fordert. Und erstarken müssen wir in dem Bewusstsein der
Zusammengehörigkeit, im jüdischen Bewusstsein. - Mutter, wie sprichst Du
zu mir, wir höre ich mit der Stimme des Propheten machtvoll Deine Stimme!
Dein Geist ist es, der in diesem Worten lebt, in diesen Worten des
Trostes, der Stärkung, des Zukunftswillen! - Und so gelobte ich ihr, die
mir das Leben gab: Dass in diesem Geiste ich dies Leben führen will
Vertrauen haben auf den Höchsten; Vertrauen auch darauf, dass der, der
uns solche Leiden schickt, auch die Kraft gibt, sie zu ertragen;
unerschütterliche Festigkeit und Treue bewahren, Treue der Gemeinschaft,
zu der ich freudig mich bekenne: Das gelobte ich in dieser verpflichtenden
Stunde. Und mit tiefer Beglückung wurde ich es gewahr: In dieser Stunde
habe ich heimgefunden, heimgefunden zu meinem Volke."
ich die Hoffnung nicht auf: Dass Deine Gnade nie endet, Dein Erbarmen nie
aufhört. Deine Gnade erneuert sich jeden Tag, groß ist Deine Treue.'
Spricht nicht unerschütterlicher Zukunftsglaube aus diesen Worten des
Propheten, schimmert nicht tröstende Verheißung durch? O hohe Stunde,
was lehrst Du mich! Glaubensstärke und Gottvertrauen, Wille zum Leben,
freudiges Bejahen, Zukunftsvollen: Das ist's was auch diese Zeit von uns
fordert. Und erstarken müssen wir in dem Bewusstsein der
Zusammengehörigkeit, im jüdischen Bewusstsein. - Mutter, wie sprichst Du
zu mir, wir höre ich mit der Stimme des Propheten machtvoll Deine Stimme!
Dein Geist ist es, der in diesem Worten lebt, in diesen Worten des
Trostes, der Stärkung, des Zukunftswillen! - Und so gelobte ich ihr, die
mir das Leben gab: Dass in diesem Geiste ich dies Leben führen will
Vertrauen haben auf den Höchsten; Vertrauen auch darauf, dass der, der
uns solche Leiden schickt, auch die Kraft gibt, sie zu ertragen;
unerschütterliche Festigkeit und Treue bewahren, Treue der Gemeinschaft,
zu der ich freudig mich bekenne: Das gelobte ich in dieser verpflichtenden
Stunde. Und mit tiefer Beglückung wurde ich es gewahr: In dieser Stunde
habe ich heimgefunden, heimgefunden zu meinem Volke." |
Weiterer Beitrag von Julie Laßmann: "Das
Berchestragen - Eine Idylle" (1934)
 Beitrag
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September 1934: Beitrag
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September 1934:
zum Lesen bitte die Textabbildung anklicken |
Weitere Persönlichkeiten
Vertreter der jüdischen Familie Lehman aus Rimpar
 Zwischen
1844 und 1840 wanderten die Brüder Emmanuel, Mayer und Henry Lehman
aus Rimpar in die USA aus. Henry war der älteste der Brüder (geb. 1821
im Rimpar). Er gründete in Montgomery/Alabama zunächst einen Hausierhandel
mit Pferdewagen. Zusammen mit seinem Brüdern Emanuel und Mayer
begründete er ein Handelsgeschäft. Als Henry Lehman an Gelbfieber starb,
übernahm der Bruder Emanuel Lehman das Familiengeschäft (auf dem Foto
links vermutlich Emanuel und Mayer Lehman). Nach dem Amerikanischen
Bürgerkrieg wurde der Firmensitz nach New York verlagert. Hier entstand
nach einigen Jahrzehnten wechselvoller Firmengeschichte die
Investmentbank Lehmann Brothers. Die Firma mit Hauptsitzen in New York
City, London und Tokio (Büros in Frankfurt am Main [Lehmann Brothers
Bankhaus] und in München) hatte im Jahr 2007 weltweit 28.600 Angestellte.
Am 15. September 2008 musste sie im Zuge der Finanzkrise 2007/2008
Insolvenz anmelden. Zwischen
1844 und 1840 wanderten die Brüder Emmanuel, Mayer und Henry Lehman
aus Rimpar in die USA aus. Henry war der älteste der Brüder (geb. 1821
im Rimpar). Er gründete in Montgomery/Alabama zunächst einen Hausierhandel
mit Pferdewagen. Zusammen mit seinem Brüdern Emanuel und Mayer
begründete er ein Handelsgeschäft. Als Henry Lehman an Gelbfieber starb,
übernahm der Bruder Emanuel Lehman das Familiengeschäft (auf dem Foto
links vermutlich Emanuel und Mayer Lehman). Nach dem Amerikanischen
Bürgerkrieg wurde der Firmensitz nach New York verlagert. Hier entstand
nach einigen Jahrzehnten wechselvoller Firmengeschichte die
Investmentbank Lehmann Brothers. Die Firma mit Hauptsitzen in New York
City, London und Tokio (Büros in Frankfurt am Main [Lehmann Brothers
Bankhaus] und in München) hatte im Jahr 2007 weltweit 28.600 Angestellte.
Am 15. September 2008 musste sie im Zuge der Finanzkrise 2007/2008
Insolvenz anmelden. |
| |
 Links:
Stammhaus der Familie Lehmann in der Niederhoferstraße in Rimpar. Links:
Stammhaus der Familie Lehmann in der Niederhoferstraße in Rimpar. |
Zum Tod von Emanuel Lehmann (1907)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 1. Februar 1907: "New York. Die hiesige Judenheit hat
einen schweren Verlust erlitten. Emanuel Lehmann, der seit vielen
Jahren an der Spitze aller Wohltätigkeitsbestrebungen stand, ist nicht
mehr! - Lehmann, 1827 in Bayern als Sohn von Abraham Lehmann und Frau
Hanna geb. Rosenheim geboren, kam bereits im Alter von 20 Jahren nach
Amerika und hatte geschäftlich bald großen Erfolg. Er war Direktor
verschiedener Banken und industrieller Unternehmungen und genoss
geschäftlich wie privat das größte Ansehen." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 1. Februar 1907: "New York. Die hiesige Judenheit hat
einen schweren Verlust erlitten. Emanuel Lehmann, der seit vielen
Jahren an der Spitze aller Wohltätigkeitsbestrebungen stand, ist nicht
mehr! - Lehmann, 1827 in Bayern als Sohn von Abraham Lehmann und Frau
Hanna geb. Rosenheim geboren, kam bereits im Alter von 20 Jahren nach
Amerika und hatte geschäftlich bald großen Erfolg. Er war Direktor
verschiedener Banken und industrieller Unternehmungen und genoss
geschäftlich wie privat das größte Ansehen." |
Beziehungen des Gouverneurs in New
York Herbert Henry Lehmann zur Familie Roosevelt (1933)
Artikel "100 Jahre Lehman Brothers" -
Geschichte eines von deutschen Juden gegründeten amerikanischen Bankhauses
(1951)
 Artikel in der Zeitschrift "Aufbau" vom 9. Februar 1951: "100
Jahre Lehman Brothers. Geschichte eines von deutschen Juden gegründeten
amerikanischen Bankhauses. Von Richard Dyck. In den vierziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts lebte in Rimpar, einem Marktflecken von 1200
Einwohnern in der Nähe von Würzburg, der Viehhändler Abraham Lehmann
und seine Frau Harriet und seinen Kindern. Wenn man Abraham vorausgesagt
hätte, dass seine Söhne einst die Gründer eines berühmten und
hochangesehenen amerikanischen Bankhauses werden würden, hätte er wohl ungläubig
die Achseln gezuckt...." Zum weiteren Lesen bitte
Textabbildung anklicken. Artikel in der Zeitschrift "Aufbau" vom 9. Februar 1951: "100
Jahre Lehman Brothers. Geschichte eines von deutschen Juden gegründeten
amerikanischen Bankhauses. Von Richard Dyck. In den vierziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts lebte in Rimpar, einem Marktflecken von 1200
Einwohnern in der Nähe von Würzburg, der Viehhändler Abraham Lehmann
und seine Frau Harriet und seinen Kindern. Wenn man Abraham vorausgesagt
hätte, dass seine Söhne einst die Gründer eines berühmten und
hochangesehenen amerikanischen Bankhauses werden würden, hätte er wohl ungläubig
die Achseln gezuckt...." Zum weiteren Lesen bitte
Textabbildung anklicken. |
Website der Lehmann Brothers
Holdings Inc.
Englischer
Wikipedia-Artikel "Lehman Brothers"
Deutscher
Wikipedia-Artikel "Lehman Brothers"
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeigen von Wolf Gundersheim,
Inhaber eines gemischtes Warengeschäftes bzw. eines Schnitt- und
Eisenwarengeschäftes (1884 / 1891 / 1893)
Anmerkung: Wolf Gundersheim ist am 3. Mai 1849 in Rimpar geboren als Sohn des
Kaufmanns Samuel Gundersheim und der Hannchen geb. Eisfelder. Er führte in
Rimpar ein Schnitt- und Eisenwarengeschäft, bis er 1899 nach Würzburg verzog und
dort eine Tuch- und Manufakturwarenhandlung eröffnete, zeitweise auch eine
"Agentur für Nähmaschinen, Öfen und Eisenteile". Mit seinem Schwiegersohn Harl
Heilberg war er nun Teilhaber der Firma "Wolf Gundersheim & Co.". Wolf
Gundersheim war verheiratet mit Fanny geb. Mayer. Er verstarb am 3. Februar 1925
in Würzburg. Seine Tochter und seine Witwe konnten 1939 nach Brasilien
emigrieren. Sein Sohn Samuel wurde 1942 von Würzburg deportiert.
 Anzeige
in "Der Israelit" vom 25. September 1884: "Lehrling gesucht. Anzeige
in "Der Israelit" vom 25. September 1884: "Lehrling gesucht.
Ein Sohn aus achtbarer Familie kann bei mir sofort unter günstigen
Bedingungen in meinem gemischten Warengeschäft eintreten.
Wolf Gundersheim, Rimpar bei Würzburg." |
| |
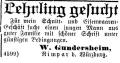 Anzeige in "Der Israelit" vom 3. August 1891:
"Lehrling gesucht. Anzeige in "Der Israelit" vom 3. August 1891:
"Lehrling gesucht.
Für mein Schnitt- und Eisenwarengeschäft suche einen jungen Mann aus guter
Familie mit schöner Schrift unter günstigen Bedingungen. W. Gundersheim,
Rimpar bei Würzburg. " |
| |
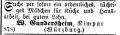 Anzeige in "Der Israelit" vom 2. Februar 1893: "Suche
per sofort ein ordentliches, tüchtiges Mädchen für Küche und Hausarbeit, bei
gutem Lohn. Anzeige in "Der Israelit" vom 2. Februar 1893: "Suche
per sofort ein ordentliches, tüchtiges Mädchen für Küche und Hausarbeit, bei
gutem Lohn.
W. Gundersheim, Rimpar (Würzburg)." |
| |
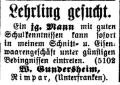 Anzeige in "Der Israelit" vom 1. Oktober 1893: "Lehrling
gesucht. Anzeige in "Der Israelit" vom 1. Oktober 1893: "Lehrling
gesucht.
Ein junger Mann mit guten Schulkenntnissen kann sofort in meinem
Schnitt- und Eisenwarengeschäft unter günstigen Bedingungen eintreten.
W. Gundersheim, Rimpar, (Unterfranken)." |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war vermutlich ein Betsaal vorhanden. Eine Synagoge
wurde auf Antrag der jüdischen Gemeinde von 1791 im folgenden Jahr 1792 errichtet, nachdem auch der Rimparer Pfarrer seine Zustimmung
gegeben hatte. Das Grundstück lag am ehemals sogenannten "Judenplatz"
und war umgeben von Häusern jüdischer Familien. An der Außenwand wurde über
dem Haupteingang ein Chuppastein ("Hochzeitsstein", s.u. bei
den Fotos) angebracht. Bei den sogenannten Hep-Hep-Unruhen im August 1819 wurde die
Synagoge beschädigt. Das Gebäude wurde aufgebrochen, die Fenster
zerschlagen. Ein Militärkommando - zwei Offiziere und 50 Soldaten - kam nach
Rimpar, um weitere Ausschreitungen zu verhindern.
Ausschreitungen gegen die Synagoge in Rimpar (1819)
Anmerkung: Über die
Ereignisse wurde auch in einer schweizerischen Zeitung berichtet; der zweite
Artikel ist ein Rückblick in einem Bericht von 1935.
 Artikel im
"Wochenblatt für die vier löblichen Kantone Ury, Schwytz, Unterwalden und
Zug" vom 4. September 1819 unter Meldungen aus Deutschland: "In
Sommerach im Würzburgischen wurden den Juden die Fenster eingeworfen. Auch
zu Rimpar wurden am 18. August in der Nacht den Juden mit sehr großen
Steinen die Fenster eingeschlagen. Selbst die Fenster in der Schule
(Synagoge) wurden eingeworfen. Dann drang ein Haufe Pöbel in die Synagoge
selbst ein, zerschnitt die Gebetbücher, riss den Vorhang vor der Lade herab,
worin sich die tora befindet, schleppte ihn auf die Straße hinaus,
zertrümmerte die Leuchter, und trieb andern schändlichen Unfug. Ein
Deputierter suchte die Ordnung wieder herzustellen, und rief nach der
ausgestellten Wache, die aber nicht zu finden war. Am folgenden Tag wurde
über die Unordnungen der vorigen Nacht vom Ortsvorstande ein Protokoll
aufgenommen, und die Wache verhaftet... Je mehr sich dergleichen strafbare
Unordnungen verbreiten, desto dringender erscheint die Notwendigkeit, die
größte Strenge anzuwenden, um den Pöbel vor solchen Exzessen abzuhalten;
wobei in diesem Falle selbst das Heiligste, die Symbole einer Religion nicht
geschont wurden, die unter dem Schutze der Gesetze steht." Artikel im
"Wochenblatt für die vier löblichen Kantone Ury, Schwytz, Unterwalden und
Zug" vom 4. September 1819 unter Meldungen aus Deutschland: "In
Sommerach im Würzburgischen wurden den Juden die Fenster eingeworfen. Auch
zu Rimpar wurden am 18. August in der Nacht den Juden mit sehr großen
Steinen die Fenster eingeschlagen. Selbst die Fenster in der Schule
(Synagoge) wurden eingeworfen. Dann drang ein Haufe Pöbel in die Synagoge
selbst ein, zerschnitt die Gebetbücher, riss den Vorhang vor der Lade herab,
worin sich die tora befindet, schleppte ihn auf die Straße hinaus,
zertrümmerte die Leuchter, und trieb andern schändlichen Unfug. Ein
Deputierter suchte die Ordnung wieder herzustellen, und rief nach der
ausgestellten Wache, die aber nicht zu finden war. Am folgenden Tag wurde
über die Unordnungen der vorigen Nacht vom Ortsvorstande ein Protokoll
aufgenommen, und die Wache verhaftet... Je mehr sich dergleichen strafbare
Unordnungen verbreiten, desto dringender erscheint die Notwendigkeit, die
größte Strenge anzuwenden, um den Pöbel vor solchen Exzessen abzuhalten;
wobei in diesem Falle selbst das Heiligste, die Symbole einer Religion nicht
geschont wurden, die unter dem Schutze der Gesetze steht."
|
| |
 Aus
einem Beitrag in "Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland"
1935 Heft 4 S. 235: "Der damalige Student August von Platen* hielt die
Ereignisse der ersten Augusttage (sc. in Würzburg) mit lebendiger
Frische in seinem Tagebuche fest: Aus
einem Beitrag in "Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland"
1935 Heft 4 S. 235: "Der damalige Student August von Platen* hielt die
Ereignisse der ersten Augusttage (sc. in Würzburg) mit lebendiger
Frische in seinem Tagebuche fest:
'... Die Juden waren fast alle geflüchtet. Selbst in den höchsten
Kreisen ist der Hass gegen sie zu finden. Vorgestern Mittag erreichten die
Unruhen ihren Höhepunkt. Fenster wurden eingeschlagen, Haustüren erbrochen;
ein Haus wurde geplündert, Möbel in Trümmern geschlagen. Es gab zwei Tote,
einen Soldaten und einen Zivilisten. Inzwischen hat das auf die Straßen
verteilte Militär Ruhe geschaffen. Die Hep-Hep-Rufe, von denen die Stadt
widerhallte, haben aufgehört. Was den Charakter des niedrigen Volkes
anlangt: es ist dumm, fanatisch und von schlechter Gesinnung.'
Die Unruhen bestanden in der Hauptsache aus Straßenaufläufen, Angriffen auf
Häuser und Geschäfte von Juden, ferner aus Bedrohungen besonders des
judenfreundlichen Universitätsprofessor Brendel und dauerten den ganzen
Monat August und noch im September an. Ohne die energischen Gegenmaßnahmen
der Regierung wären die Ausschreitungen weit furchtbarer gewesen. In
Rimpar bei Würzburg wurde eine Synagoge erbrochen und verwüstet. Die
Unruhen verbreiteten sich rasch über Würzburg hinaus und fanden bald ihre
Parallelen in allen größeren Orten zwischen Frankfurt am Main und Bamberg,
Bayreuth und Prag."
* Zu dem Studenten August von Platen, der damals aus Würzburg berichtete,
siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/August_von_Platen-Hallermünde
Zu Prof. Brendel in Würzburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Sebald_Brendel. Dieser wurde bei den
Hep-Hep-Unrufen verdächtigt, von Juden bestochen zu sein. Er setzte sich für
den Erhalt des Judenedikts ein, und erhielt daraufhin Morddrohungen.
|
Auf Grund der gestiegenen Zahl der Gemeindeglieder beschloss die jüdische
Gemeinde 1850 die Erweiterung der Synagoge, die 1851/52 durchgeführt
wurde. Dabei ist ein Turm mit einem Stiegenhaus angebaut worden; eine Galerie im
ersten Stock für die Frauen wurde eingebaut. 1922 wurden neben dem Toraschrein
steinerne Gedenktafel für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges angebracht.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde das gesamte Inventar der Synagoge
einschließlich der Ritualien zerstört, das Gebäude blieb jedoch erhalten.
Das Synagogengebäude blieb nach 1945 erhalten. Es wird bis zur Gegenwart
als Lagerhalle verwendet; das Gebäude das im Original noch vollständig
erhalten (auch Originalfenster- und Türen). Im Inneren befindet sich eine
zerstörte Gedenktafel für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Auch die
schön bemalte Decke ist noch teilweise erhalten. 1994 wurde das
Gebäude in die Denkmalliste aufgenommen. Vorübergehend war das Gebäude
damals auf Grund einer Neubaumaßnahme in der Günterslebener Straße gut von
der Straße aus sichtbar. Seit Abschluss des Neubaus ist ein Blick auf die
ehemalige Synagoge nicht mehr möglich, da das Gebäude vollkommen von anderen
Bauten umschlossen ist.
Eine Gedenktafel wurde 1989 im Innenhof des früheren Schlosses und
heutigen Rathauses angebracht. Sie enthält den Text: "In Rimpar bestand
bis 1942 eine Jüdische Kultusgemeinde, Synagoge Marktplatz 8, die in der
Pogromnacht außen beschädigt und innen verwüstet wurde. Zur Erinnerung an
unsere ehemaligen jüdischen Mitbürger".
Adresse/Standort der Synagoge: Hinterhof des
Anwesens Marktplatz 8 beziehungsweise Storchstraße 4 (alte Anschrift 1932:
Güntersleberstraße)
Fotos
(Quelle: Fotos obere Zeile links und Mitte: Sporck-Pfitzer s.Lit.
S. 72-73; Foto rechts von Theodor Harburger, veröffentlicht in:
ders.: Die Inventarisation jüdischer Kunst- und Kulturdenkmäler in Bayern. Hg.
von den Central Archives for the History of the Jewish People Jerusalem und dem
Jüdischen Museum Franken - Fürth & Schnaittach Bd. 3 S. 673).
 |

 |
 |
Die ehemalige Synagoge mit dem
1851/52 angebauten Treppenhaus |
Der Hochzeitsstein |
Tora-Schild (Tass) aus der
Synagoge
(1938 vermutlich zerstört) |
| |
| |
|
|
 |
|
Gedenktafel im
Schloss/Rathaus Inschrift: "In Rimpar bestand bis 1942 eine Jüdische
Kultusgemeinde, Synagoge Marktplatz, die in der Pogromnacht außen
beschädigt und innen
verwüstet wurde. Zur Erinnerung an unsere
ehemaligen jüdischen Mitbürger". |
|
Erinnerungsarbeit vor Ort -
einzelne Berichte
|
September 2008:
Verlegung von "Stolpersteinen" in
Rimpar |
 |
 |
Artikel von Nadja Hoffmann in
der "Mainpost" vom 17.
September 2008 (zugeschickt von Joachim Braun, Würzburg) |
|
RIMPAR. Stolpersteine gegen das Vergessen.
Besondere Aktion will in Rimpar an ermordete jüdische Mitbürger erinnern.
Nach Würzburg und Estenfeld werden nun auch in Rimpar sogenannte "Stolpersteine" zur Erinnerung an die ermordeten jüdischen Mitbürger verlegt.
Am Samstag, 20. September, wird der Künstler Gunter Demnig in der Gemeinde Rimpar 13 Steine verlegen. Sie erinnern an
Pauline Schwab und ihren Sohn Theodor, das Ehepaar Josef und Elsa Frank und ihre Kinder Fränzi, Margot und Inge, das Ehepaar Abraham und Ernestine Schwab und ihre Verwandte aus Würzburg, Klara Schwab, Hannchen und Karoline Tannenwald sowie Julie Lassmann.
Es geht nicht darum, "Kollektivschuld zu suggerieren, sondern kollektive Verantwortung zu
tragen", sagt Bürgermeister Burkard Losert. Bei einem Besuch auf dem Obersalzberg sei er erschüttert über die akribische Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten gewesen. Dies dürfe sich nicht wiederholen und müsse im Bewusstsein der Bevölkerung bleiben.
Gemeinsam mit Schülern der Hauptschule werden am Samstag während der Einlassung der Steine Texte vorgetragen, die Christian Will (MdL a.D.) erarbeitet hat. Dabei werden die Rimparer interessante Dinge über die ehemaligen jüdischen Mitbürger erfahren.
In der Hofstraße 2 das Kurzwarengeschäft der Familie Tannenwald. Von Schulheften über Betten und Schuhe gab es hier alles zu kaufen. Das Problem war, dass ab 1935 tagsüber nicht mehr dort eingekauft werden durfte. Doch trotz großer Achtsamkeit durch die Wächter, machten die Menschen dort nachts ihre Besorgungen. Inhaber waren Karl und Hannchen Tannenwald, die das Geschäft mit Sohn Leopold betrieben.
Im Frühjahr 1937 beschloss Sohn Leopold Tannenwald wegen des steigenden staatlichen Druckes mit seiner Frau Selda und den Söhnen Kurt und Fritz nach Amerika auszuwandern und dort eine neue Existenz zu gründen. Seine Eltern blieben in Deutschland. Vater Karl Tannenwald starb 1940. Mutter Hannchen sowie eine Verwandte aus Würzburg (Karolina) wurden 1942 nach Theresienstadt gebracht und dort ermordet.
In der Kirchenstraße 1 war das Manufakturgeschäft der Witwe Meta Schwab und ihrer Tochter Sophie. Beide starben noch vor Beginn der Deportationen eines natürlichen Todes. Pauline Schwab und ihr 16-jähriger Sohn Theodor waren unter den ersten unterfränkischen Juden, die nach Riga deportiert wurden.
"Es geht nicht darum, Kollektivschuld zu suggerieren, sondern
kollektive Verantwortung zu tragen" Burkart Losert, Bürgermeister.
In der Kirchenstraße 7 wohnten Abraham und Ernestine Schwab, sowie Klara Schwab. Abraham und Ernestine wurden 1942 von Würzburg aus nach Theresienstadt gebracht, Klara von Rimpar aus nach Isbica bei Lublin im östlichen Polen. Sie waren einfache Leute, die nie sonderlich aufgefallen waren.
Eine weitere Station für die Verlegung der Steine ist in der Lömmelsgasse 20, wo die Familie Frank wohnte. In der Pogromnacht wurde ihre Hauseinrichtung zerstört, die Kinder barfüßig auf die Straße getrieben. 1942 wurde die Familie, wie Klara Schwab, nach Isbica gebracht.
Die letzten Steine werden am Marktplatz 5 verlegt. Hier wohnte der israelische Kultusbeamte Mayer Lassmann mit seiner Frau und der Tochter Julie. Die Mutter von Julie starb bereits 1939, der Vater 1941. Christian Will war häufig Gast bei den Lassmanns und erinnert sich, dass Julie oft mit ihm und anderen Kindern musizierte. Etwa 1935 zog Julie nach Würzburg und wurde 1943 als Hilfsnäherin zur Zwangsarbeit in der Würzburger Uniformfabrik Kreisel verpflichtet. 1943 wurde sie zusammen mit den 56 letzten unterfränkischen Juden ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert und in der Gaskammer ermordet. Der damalige Gauleiter meldete stolz nach Berlin:
"Mainfranken ist Judenfrei!" |
| |
| September
2008: Zahlreiche
Presseartikel zu Rimpar nach dem Zusammenbruch der Investbank
der Lehman Brothers, z.B. in der "Süddeutschen": |
Artikel von Hannah Wilhelm in der "Süddeutschen"
vom 20. September 2008: "Herr Lehmann, Herr Goldmann, Herr Sachs
Drei Franken gründeten in Amerika Geldhäuser von Weltruhm. Jetzt kratzt der Bankenkrach an ihrem Erbe. Eine Spurensuche
Rimpar/Trappstadt - Das kleine unterfränkische Örtchen Rimpar bangt. 'Es ist traurig, wirklich traurig', sagt der Apotheker der 7500-Seelen-Gemeinde im Vorbeigehen, er zuckt resigniert mit den Schultern und verschwindet in seinem Laden. Ja, die Bankenkrise ist traurig und nun sie ist auch in Rimpar bei Würzburg angekommen.
Rimpar ist der Geburtsort von Heinrich Lehmann, dem Gründer der US-Investmentbank Lehman Brothers. Hier, im Haus, in dem nun die Apotheke ist, wuchs er auf, bevor er 1844 im Alter von 23 Jahren auswanderte, ins ferne Amerika, wo er zunächst einen Gemischtwarenladen in Alabama aufmachte. Darauf war man so stolz hier - und jetzt?
Hühner in der ehemaligen Synagoge. Ganz in der Nähe der Apotheke wohnt Ludwig Heldwein und er hat es auch schon gehört: Lehman ist pleite, im Radio kam es, sagt er. Der kräftige Mann kratzt sich am Kopf, fährt mit der Hand durch die weißen Haarborsten und schließt eben schnell sein Hoftor auf, denn dahinter verbirgt sich ein besonderer Schatz, die Synagoge, die Heinrich Lehmann als Kind besucht hat.
Der Putz bröselt von der Decke, die rostroten Wandbemalungen sind nur noch schwach zu erkennen. Staub kitzelt in der Nase. Aufgeschreckt flattern und gackern 30 Hühner durch die ehemalige Synagoge. Sie leben hier.
'Ich bin Geflügelzüchter', sagt Heldwein und schält die blaue Plastikplane von einem Denkmal für die vier jüdischen Rimparer, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind.
'Ich muss es mit der Plane schützen, damit die Hühner nichts kaputt machen', erklärt er.
Träume vom Geld aus New York. In guten Zeiten, da hat Bürgermeister Burkard Losert mal davon geträumt, dass die große Investmentbank aus New York vielleicht ein bisschen Geld rausrückt, damit die alte Synagoge renoviert werden kann. Aber aus, vorbei, das wird wohl nichts. Das weiß auch Bürgermeister Losert. Ein paar Millionen hätte die Gemeinde für das Projekt schon gebraucht. Aber Lehman Brothers hat Konkurs angemeldet, die Bank wird abgewickelt, am Schluss hatte sie viele Milliarden Dollar Schulden. Da bleibt auch für die Träume eines unterfränkischen Bürgermeisters kein Geld mehr.
Die 300 Millionen, die die staatliche Förderbank KfW noch am Tag der Pleite an Lehman überwiesen hat - aus Versehen, wie die Radionachrichten gerade vermelden - die hätten locker gereicht für die Renovierung der Synagoge.
'Also, wie so etwas passieren kann', ärgerlich schüttelt Losert den Kopf, 'unser Stadtkämmerer, der schaut jeden Tag in die Zeitung, und wenn da über eine Insolvenz von einem Unternehmen berichtet wird, da überweisen wir von der Gemeinde keinen Cent mehr. Das ist doch klar.' Nein, sagt Losert, dem Stadtkämmerer von Rimpar wäre so ein Missgeschick nicht passiert.
'Man kann nur hoffen, dass es Goldman Sachs besser ergeht', sagt die Bibliothekarin Cordula Kappner und lässt ihre Augen über den märchenhaft-idyllischen jüdischen Friedhof in Kleinbardorf schweifen.
Um die Investmentbank Goldman Sachs geht es der 67-Jährigen nicht wirklich, die ist ihr ziemlich egal. Es geht ihr um Marcus Goldmann, den Gründer von Goldman Sachs. Sie hat ihn kürzlich entdeckt - genauer gesagt hat sie entdeckt, dass auch er aus einem kleinen fränkischen Ort kommt. Aus Trappstadt, das ist etwa eine Autostunde von Rimpar entfernt.
'Ich habe mich so gefreut, dass es ihm so gut ergangen ist, einem von hier, der so viel erreicht hat', sagt Kappner. Das soll doch nun bitte nicht den Bach runtergehen. Bankenkrise hin, Finanzkrise her.
Keine Perspektive mehr in Unterfranken. Drei der ganz großen amerikanischen Bankengründer vergangener Zeiten kommen aus Unterfranken: Heinrich Lehmann, Gründer von Lehman Brothers, aus Rimpar. Marcus Goldmann, Gründer von Goldman Sachs, aus Trappstadt. Und auch sein Kompagnon Joseph Sachs kommt aus Unterfranken. Woher genau, weiß man nicht,
'aber ich bin dran', verspricht Bibliothekarin Kappner. Bald wird sie wieder in Würzburg ins Archiv gehen; den Joseph Sachs, den treibt sie auch noch auf.
Drei Banker von Weltruhm - alle drei waren sie Juden, die keine Perspektive mehr sahen in Unterfranken, Mitte des 19. Jahrhundert. Keine Zukunft, kaum Spielraum - die Gesetze für Juden waren hier sehr streng. Jüdische Bürger konnten sich nicht einfach niederlassen oder heiraten, wenn sie wollten. Sie durften keinen Beruf erlernen. Zahlen mussten sie aber - Steuern und Sonderabgaben für alles und nichts. Heinrich Lehmann, Marcus Goldmann, beide Söhne von Viehhändler, wollten so nicht leben.
Die letzte Lehmann-Erbin starb im KZ. Also nahmen sie das Schiff nach Amerika; Lehmann 1844, Goldmann 1848. Die, die in Franken blieben, blieben meist kleine Händler und zahlten weiter. Im 20. Jahrhundert leiteten die Nachkommen von Lehmann und Goldmann die mittlerweile riesigen Banken in New York, waren Politiker oder Richter. Die Nachkommen der Zurückgebliebenen wurden im nationalsozialistischen Deutschland verfolgt, einigen gelang die Flucht, die anderen wurden ermordet. Die letzte Lehmann-Erbin, die noch in Unterfranken lebte, starb 1942 in Treblinka, im KZ.
Cordula Kappner stapft über den Kleinbardorfer Friedhof und sucht nach
einem Grabstein. Da ist er: 'Sannel Goldmann' steht kaum noch lesbar auf einem der vielen Grabsteine, die von grünem, gelben und braunen Moosflechten bewachsen sind. Sannel war ein kleiner Bruder von Marcus Goldmann. 1848 haben sie sich wohl das letzte Mal in ihrem Leben gesehen - als Marcus seine Sachen packte und ging. Für immer. Der kleine Sannel blieb und wurde hier in Unterfranken begraben.
Der verwitterte Grabstein ist eine der wenigen Spuren, die noch vom Leben des Marcus Goldmann erzählen. Es gibt noch ein paar weitere Gräber von Verwandten. Auf dem alten jüdischen Friedhof in Würzburg zum Beispiel, liegen eine Schwester von Marcus Goldmann und ein Neffe von Heinrich Lehmann begraben. Goldmann und Lehmann - in Deutschland kannten sie sich wohl nicht, aber sie kamen aus dem gleichen Milieu. Und es war das gleiche Leben, das sie nicht mehr leben wollten." |
| |
| November
2008: Bemühungen um den Erhalt der
ehemaligen Synagoge |
| Rechts (Fotos von Norbert Schwarzott): Die ehemalige Synagoge wird als Hühnerstall verwendet |
 |
 |
Links: Der Treppenturm - Anbau
zum Betsaal und Zugang der Frauen zur Frauenempore |
Artikel von Kurt Mintzel in der
"Mainpost" vom 12. November 2008:
"RIMPAR. Förderverein soll die ehemalige Synagoge retten. Nicht alles verfallen lassen.
Werden nun auch die Rimparer einen Förderverein ins Leben rufen, der sich um den Erhalt der ehemaligen Synagoge kümmert? Das Gebäude ist im Privatbesitz und wird als Hühnerstall genutzt. Bei der Gedenkstunde an die Pogromnacht im Rittersaal des Grumbach-Schlosses fehlte es nicht an Appellen, den unhaltbaren Zustand zu ändern.
Standort der ehemaligen Synagoge ist der Hinterhof Marktplatz 9 oder Storchstraße 4. 1932 lautete die Anschrift noch Günterslebener Straße.
Zunächst war vermutlich ein Betsaal vorhanden. 1791 stellte die damalige jüdische Gemeinde einen Antrag auf Errichtung einer Schule.
Als der katholische Pfarrer in Rimpar seine Zustimmung gegeben hatte, wurde sie 1792 erbaut. Das Grundstück war umgeben von Häusern jüdischer Familien.
An der Außenwand wurde über dem Haupteingang ein Hochzeitsstein angebracht.
Weil die Zahl der Gemeindemitglieder wuchs, beschlossen die Verantwortlichen die Erweiterung um eine Frauenempore mit Zugang über einen angebauten Treppenturm.
Dieser Anbau ist das Charakteristikum der Rimparer Synagoge und einmalig in ganz Franken.
Heute wird die Synagoge, die in Privatbesitz ist, als Hühnerstall genutzt.
In einer Reportage hat unser Redaktionsmitglied Angelika Becker am 27. September 2008 den Zustand der ehemaligen Synagoge so beschrieben:
In der Storchstraße klingelt Bürgermeister Burkard Losert bei Ludwig Heldwein.
Der ist gleich bereit, uns über den Hof und durch die Scheune zu führen, vorbei an Strohballen, unter spinnwebenverhangenen Balken hindurch.
Dann öffnet Heldwein eine Tür, und wir stehen in der alten Synagoge von 1792. Von Osten dringen Sonnenstrahlen durch den Staub, den das Federvieh aufwirbelt.
In mannshohen Ställen, die den Raum vollständig füllen, gackern Zwergseidenhühner und Kraienköppe.
"Ludwig ist ein engagierter Geflügelzüchter", sagt Losert. Engagiert kümmert sich Heldwein auch um den brüchigen Synagogenbau. Einiges Geld habe er schon in das Haus gesteckt. Das Türmchen, das einst zur Galerie der Frauen führte, hat er renoviert, weil es ihm gefiel.
"Man kann ja nicht alles einfach verfallen lassen." Der Hausherr zieht von einem Gedenkstein zu Ehren der vier jüdischen Rimparer Gefallen des Ersten Weltkriegs die Plastikplane.
"Die schützt ihn vor den Hühnern." Soweit der Auszug aus der Reportage. Zur Synagoge gehörte auch eine Mikwe, ein Ritualbad mit fließendem Quell- oder Grundwasser. In Rimpar lag das Bad beim Haus des Rabbiners hinter der ehemaligen Bäckerei Wild.
Losert erinnerte daran, das erst kürzlich durch den Zusammenbruch der Lehmann Bank, deren Gründer aus Rimpar stammten, das Schicksal der Rimparer Synagoge wieder ins öffentliche Bewusstsein gerückt wurde.
Mehrere Fernsehteams aus dem In- und Ausland filmten im Inneren. Losert meinte, es sei verwunderlich, dass sich niemand über den Zustand des Gebäudes aufregt.
Er erinnerte daran, dass Berichte über Kirchen, die die Sowjets als Kuhstall und Lagerhallen nutzten, für große Aufregung in der Öffentlichkeit gesorgt haben.
"Auch wenn eine Synagoge nach der Schändung nicht mehr als Gebetsraum genutzt werden darf, ist es ein unhaltbarer
Zustand", so der Bürgermeister. Man müsse sich an vielen fränkischen Gemeinden ein Beispiel nehmen, die ihre ehemaligen Synagogen renoviert haben und jetzt kulturell nutzen. Losert nannte als Beispiele Gaukönigshofen, Urspringen, Kitzingen und Veitshöchheim.
"Unsere Synagoge mit ihren besonderen Turm und den jetzt noch restaurierbaren inneren Malereien wäre es wert, dass sich unsere Bürger für eine Renovierung dieses denkmalgeschützten Gebäudes
engagieren", so Losert weiter. Das Hauptproblem dabei: Die ehemalige Synagoge hat keinen direkten Zugang mehr zur Straße.
Losert forderte die Rimparer Bürger auf: "Machen wir es wie unsere Nachbarn, packen wir an und versuchen den Kraftakt der Sanierung gemeinsam
anzugehen." |
| |
| Dezember
2010: Weitere Bemühungen um den
Erhalt der ehemaligen Synagoge und einen öffentlichen Zugang zum Gebäude |
Artikel von Irene Konrad in der
"Main-Post" vom 14. Dezember 2010 (Artikel): "RIMPAR - Unterschriften für die Synagoge
Engagierte Rimparer wollen einen öffentlichen Zugang zum ehemaligen Gebetshaus
Engagierte Rimparer Bürger haben einen erneuten Rettungsversuch für die ehemalige Synagoge gestartet. Am Montag überreichten Hannelore Mintzel, die evangelische Pfarrerin Bettina Lezuo und Guido Bausenwein im Rathaus Bürgermeister Burkard Losert eine Unterschriftenliste. 137 Rimparer hatten binnen weniger Tage mit ihrem Namen bezeugt, dass sie sich für die denkmalgeschützte ehemalige Synagoge in Rimpar einsetzen.
Um einen öffentlichen Zugang zur einstigen Synagoge zu schaffen, bitten sie den Marktgemeinderat, ein Grundstück neben der einstigen Synagoge zu kaufen. Dessen Besitzer signalisieren Gesprächsbereitschaft.
Marktgemeinderat berät. Am Donnerstag, 16. Dezember, steht der Zugang zur Rimparer Synagoge auf der Tagesordnung der Sitzung des Marktgemeinderats, und zwar im nichtöffentlichen Teil, weil es um Grundstücksangelegenheiten geht.
'Im Raum steht eine sechsstellige Summe im niedrigen Bereich', äußert sich Bürgermeister Losert noch etwas bedeckt über die Möglichkeit, ein der einstigen Synagoge benachbartes Grundstück mit 435 Quadratmeter kaufen zu können. Für Hannelore Mintzel und ihre Mitstreiter ist dieser Grundstückankauf
'eine einmalige, nicht wiederkehrende Chance'. Die Sprecherin des Arbeitskreises Pogromgedenken sieht in der ehemaligen Synagoge ein Kulturgut,
'für das sich aller Einsatz lohnt".
Synagoge entstand 1792. Spätestens seit November 2008 bei einer Gedenkstunde an die Pogromnacht in Rimpar vor 70 Jahren ist sich ein Kreis engagierter Bürger einig, dass sich die Synagoge aus dem Jahr 1792 in einem unhaltbaren Zustand befindet. Dabei gilt sie mit ihren noch vorhandenen Wandmalereien im Innenraum und dem angebauten Treppenturm mit eckiger Turmhaube als einmalig in ganz Franken. Der Turm wurde 1838 aufgrund der wachsenden jüdischen Gemeinde als Aufgang zu einer neuen Frauenempore gebaut.
Heute ist der ehemalige Gebetsraum in Privatbesitz. Seit der Zerstörung 1938 wurde die Synagoge als Lagerraum und Stall genutzt. Aktuell dient sie einem Kleintierzüchter als Hühnerstall. Beim Novemberpogrom 1938 war die Synagoge besonders im Innenraum schwer beschädigt worden. Aber sie wurde damals von den SA-Schergen nicht abgebrannt.
'Das lag wohl an der engen Bebauung rund um die Synagoge', mutmaßt Bürgermeister Losert. Die umliegenden Gebäude sollten wohl nicht gefährdet werden.
Die einstige Synagoge ist nicht mehr im Bewusstsein vieler Rimparer. Mit dem Ankauf des benachbarten Grundstücks könnte sich das ändern.
'Irgendwann einmal', wenn die Finanzen der Marktgemeinde einmal besser sind, wird es im Einvernehmen mit dem Besitzer vielleicht einmal möglich sein, die ehemalige Synagoge vor dem Verfall zu retten.
Keine leichte Entscheidung. Dass die Gemeinde aufgrund ihrer derzeitigen Finanzlage ein Grundstück in der Ortsmitte kaufen sollte, wird im Ratsgremium umstritten sein. Die Marktgemeinde befindet sich angesichts ihrer Schuldenlast auf einem
'rigorosen Sparkurs' und ist froh, dass sie in den letzten drei Jahren die Pro-Kopf-Verschuldung senken und den Haushalt einigermaßen sanieren konnte.
Mit Herzblut. Es gibt laut Bürgermeister Losert aber 'einen Sanierungsstau, allein bei Straßen und Kanälen' und
'einen gewaltigen Einbruch bei der Gewerbesteuer'. Dabei stehen der Gemeinde mit dem Bau der Umgehungsstraße gewaltige Ausgaben in zweistelliger Millionenhöhe ins Haus. Die Unterzeichner für den Ankauf des Grundstücks hoffen dennoch mit Herzblut, dass die Abstimmung im Marktgemeinderat zugunsten der ehemaligen Synagoge ausgeht.
'Damit wäre ein erster Schritt gemacht, der Türen offen hält', erklärt
Mintzel." |
| |
| Dezember
2010: Weiteres Engagement für den
Erhalt der ehemaligen Synagoge |
Artikel von "hon" in der "Main-Post" vom 22.
Dezember 2010 (Artikel): "Freundeskreis für die Synagoge
Mittlerweile haben 157 Bürger dafür unterschrieben, dass die ehemalige Synagoge in Rimpar saniert werden sollen. Dies ist laut Bürgermeister Burkard Losert ein Meinungsbild mit dem man sich nun intensiv auseinandersetzen soll. Einigkeit herrschte im Gemeinderat darüber, dass die Sanierung der Synagoge wichtig ist. Das Foto zeigt Wandmalereien in der ehemaligen Rimparer Synagoge.
Angesichts der schlechten Finanzlage des Marktes sieht man aber keinen vorrangigen Handlungsbedarf. Eine optimale Voraussetzung zur Sanierung der Synagoge wäre dann gegeben, wenn neben dem in Rede stehenden Grundstück Marktplatz 8, eine Teilfläche des benachbarten Grundstückes als unmittelbarer Zugang zum Hauptportal der Synagoge und der Erwerb der Synagoge selbst gelinge.
Diese drei Schritte müssten parallel erfolgen, damit nicht das eine Geschäft gemacht würde und das andere nicht zustande komme und die Sache im Ansatz am Grundsätzlichen scheitere, so Losert. Die Synagoge sei als wichtiges Kulturgut der Gemeinde alle Anstrengungen wert, erhalten zu werden.
Der Weg könne aber nur einer sein, nämlich ein Förderverein, der das Projekt voranbringe, meint Losert. Ein Beispiel wäre das Schloss Grumbach mit seinem Freundeskreis oder auch das Walderlebniszentrum, das mit europäischer Förderung gestemmt wurde.
Weitere Zuschusstöpfe wären die Städtebauförderung, das Denkmalamt und der Kulturfonds des Bezirks Unterfranken. Der Gemeinderat nahm dies zur Kenntnis und empfiehlt den Verantwortlichen mit dem Initiativkreis auf die Beteiligten zuzugehen und Gespräche zu führen." |
| |
| September
2011: Die ehemalige Synagoge wird
weiterhin als Hühnerstall verwendet |
Artikel in der
"Main-Post" vom 23. September 2011: "Ehemalige Synagoge
(k)ein Ort des Erinnerns.
Die ehemalige Synagoge in Rimpar wird als Hühnerstatt genutzt. Das ist
eine Tatsache. Warum man das aber ausgerechnet den israelitischen Gästen
aus dem Partnerlandkreis Mate Yehuda zeigen musste, sorgte nicht nur bei
den Israelis für Kopfschütteln. Eine Reihe von Missverständnissen
seitens des Landratsamtes führte zu dem umstrittenen
Programmpunkt..."
Link
zum Artikel; auch eingestellt
als pdf-Datei. |
| |
|
Dezember 2018:
Vortrag zur jüdischen Geschichte
in Rimpar |
Artikel von Michaela Moldenhauer
in der "Main-Post" vom Dezember 2018: "Rimpar. Hanne Mintzel referierte
über die Juden in Rimpar
Viele interessante Einblicke über die Anfänge und Entwicklung der jüdischen
Gemeinde in Rimpar gab die ehemalige Rektorin der Maximilian-Kolbe-Schule,
Hanne Mintzel, in einem Vortrag im Rittersaal des Rimparer Schlosses.
Veranstalter war der Freundeskreis Schloss Grumbach, heißt es in einer
Pressemitteilung. Die ersten Rimparer Juden waren sogenannte Schutzjuden,
die vor der Herrschaft des Fürstbischofs Julius Echter geflohen waren und
sich im 16. Jahrhundert unter den Schutz des Rimparer Schlossherrn Konrad
von Grumbach begeben hatten. Sie wurden von diesem jedoch in erster Linie
als eine willkommene Geldquelle gesehen und ausgebeutet. Immerhin ließ
Konrad von Grumbach die Gründung des jüdischen Friedhofs in Schwanfeld zu.
In den dann folgenden Jahrhunderten entwickelte sich allmählich eine starke
jüdische Gemeinde in Rimpar, die, abgesehen von den Hep-Hep-Unruhen im Jahr
1819, in guter Harmonie mit der übrigen Bevölkerung lebte und zeitweise fast
zehn Prozent der Einwohner Rimpars stellte. Der Wunsch nach einer würdigen,
eigenen Synagoge wurde laut, und Hanne Mintzel zeigte anschaulich die
Entstehung der Rimparer Synagoge 1792 und ihre spätere Erweiterung auf. Die
Erlaubnis zum Bau gewährte der Würzburger Fürstbischof, nicht ohne sich
durch entsprechende Auflagen finanzielle Vorteile zu sichern. Doch damit
nicht genug, auch der Pfarrer in Rimpar musste zusätzlich seine Zustimmung
geben, was wiederum mit Auflagen für die jüdische Gemeinde verbunden war. So
durfte die Synagoge keinesfalls entlang eines Prozessionsweges stehen, das
heißt, an einer der Straßen, durch die zum Beispiel die
Fronleichnamsprozession führte. Dies ist mit ein Grund, warum die ehemalige
Rimparer Synagoge heute kaum sichtbar zwischen Wohnhäusern eingebaut ist.
Die Referentin schilderte dann anhand von Einzelschicksalen, wie sich unter
den Nationalsozialisten die Lage für die Juden auch in Rimpar zusehends
verschlechterte, so dass ein Teil auswanderte, zumeist in die USA. Zu deren
Nachkommen hat Frau Mintzel heute noch Kontakt. Kaum vorstellbar für uns,
die wir heute in einem Rechtsstaat leben, was sich dann in der Pogromnacht
1938 ereignete und was bald darauf mit den verbliebenen Rimparer Juden
geschah: Deportation und Ermordung in Konzentrationslagern. Mit Fotos von
einzelnen Mitgliedern betroffener Familien gab die Referentin diesen dunklen
Geschehnissen konkrete Namen und Gesichter. In dem kurzweiligen, sehr gut
verständlichen Vortrag zeigte Hanne Mintzel zahlreiche Details des jüdischen
Lebens in Rimpar auf, die den meisten Zuhörern bis dahin wohl kaum bekannt
waren und erhellte damit ein Kapitel der Rimparer Geschichte, das bis jetzt
nur wenig erforscht wurde. Nach lange anhaltendem Applaus am Ende wurde der
Wunsch geäußert, Frau Mintzel möge doch all ihre Erkenntnisse, die sie in
einem Vierteljahrhundert zusammengetragen hat, publizieren und damit einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich machen."
Link zum Artikel |
| |
|
März 2019:
Über die ehemalige Synagoge in
Rimpar und ihre Zukunft |
Artikel von Israel Schwierz in
haGalil.com vom 10. März 2019: "Soll die Synagoge aus Rimpar
verschwinden?...."
Link zum Artikel
|
| |
|
Juni 2019:
Konzept für die Nutzung des
Synagogengebäudes gesucht |
Artikel von Klaus Richter in der
"Main-Post" vom 3. Juni 2019: "Rimpar. Konzept für die Synagoge gesucht
Was passiert mit der Rimparer Synagoge? Gibt es eine Chance, das ehemalige
jüdische Gotteshaus zu erhalten? Im Lichte der aktuellen Diskussionen um die
Zukunft der Synagoge in Rimpar machte sich die Landkreis-SPD um ihren
Landtagsabgeordneten Volkmar Halbleib ein Bild vor Ort. Hannelore Mintzel
und Guido Bausenwein vom Initiativkreis zum Erhalt der Synagoge im Ort
zeigten den Sozialdemokraten ihre Überlegungen. Die Rimparer Synagoge hat
eine reiche Geschichte, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Unter
anderem die Lehmann-Brüder, die später in die Vereinigten Staaten
emigrierten und dort die in der Finanzkrise weltweit bekannt gewordene Bank
Lehmann Brothers gründeten, waren im 19. Jahrhundert Teil der jüdischen
Gemeinde Rimpars. Seit den Novemberpogrom 1938 und der Deportation der
Rimparer Juden in die Vernichtungslager wird die historische Religionsstätte
jedoch lediglich als Lagerhalle verwendet. Allerdings sei die Synagoge trotz
zweckentfremdeter Nutzung vergleichsweise gut erhalten, machte Hannelore
Mintzel deutlich. So ist die bemalte Decke noch teilweise sowie
Fensterrahmen und Türen im Original erhalten. Die Farben der Wandmalerei
sind noch erkennbar. Eine Besonderheit stellt der achteckige Treppenturm
dar, der einzigartig in Franken ist. Der Zugang zur Synagoge ist jedoch
derzeit verbaut. Die Gemeinde hat ein Vorkaufsrecht für ein leerstehendes
Gebäude verstreichen lassen, dass den Eingang in das historische Gebetshaus
wieder ermöglich hätte, bedauert der Initiativkreis. Stattdessen will der
Gemeinderat einen Abbau der Synagoge und einen Wiederaufbau im
Freilandmuseum Fladungen prüfen lassen. Nach Überzeugung des
Initiativkreises ist dies nur die zweitbeste Lösung. Zunächst einmal sollte
die Gemeinde eine Machbarkeitsstudie für den Erhalt und Zugänglichkeit an
Ort und Stelle erarbeiten lassen und die Zuschussmöglichkeiten prüfen, so
Mintzel. Hier signalisierte Halbleib, der unter anderem Mitglied im
Stiftungsrat der Bayerischen Landesstiftung und im Landesdenkmalrat ist,
seine Unterstützung. Der mainfränkische SPD-Landtagsabgeordnete machte
jedoch zugleich deutlich, dass die Klärung und Entscheidung in den Händen
des Rimparer Gemeinderats liegt. Wenn man die Synagoge in Rimpar erhalten
will, müsse der nächste Schritt die Erstellung eines Sanierungs- und
Nutzungskonzeptes sein, für das es staatliche Zuschüsse gebe."
Link zum Artikel |
| |
|
Oktober 2019:
Machbarkeitsstudie soll Zukunft
der Rimparer Synagoge klären |
Artikel von Christian Ammon in
der "Main-Post" vom 24. Oktober 2019: "Rimpar. Machbarkeitsstudie soll
Zukunft der Rimparer Synagoge klären
Eine Machbarkeitsstudie soll die Möglichkeiten für eine Sanierung der
Rimparer Synagoge klären. Der Gemeinderat folgt damit einer Empfehlung des
Bezirksheimatpflegers Klaus Reder, der eine umfangreiche Förderung der
Studie in Aussicht gestellt hat. 'Es geht darum, Klarheit zu bekommen, wie
das Synagogengebäude und das Umfeld genutzt und gestaltet werden könnten',
erklärt Bürgermeister Burkard Losert. Zu der Studie gehörten auch die für
jede weitere Nutzung zentralen Fragen des Zugangs, der nach Kriegsende
weitgehend verbaut wurde, und des Lärmschutzes für die umliegenden Anwesen.
Eine Machbarkeitsstudie ist die Voraussetzung für weitere Schritte. Noch im
Frühjahr hatte der Gemeinderat geschlossen dafür gestimmt, einen Abbau und
eine Übergabe an das Freilandmuseum in Fladungen zu prüfen. Auf eine
Anhörung eines Vertreters des Initiativkreises wurde damals verzichtet. Es
gab einen Ortstermin mit der Museumsleiterin, die das Gebäude begutachtet
hat. Eine Übergabe scheint zumindest vorerst vom Tisch. Losert betonte nun,
dass es damals lediglich um einen Auftrag an die Verwaltung gegangen sei,
diese Möglichkeit zu klären. Eine Entscheidung über das weitere Schicksal
der Synagoge sei damit nicht verbunden gewesen. Der Bürgermeister sieht gute
Möglichkeiten, für das Projekt europäische Fördermittel zu bekommen. Seit
den frühen 1990er Jahren engagieren sich Bürger für eine Erhaltung der
Synagoge. Seit Jahren organisieren sie am 9. November eine Gedenkstunde für
die Opfer des Holocausts.
Kleine Konzerte oder Lesungen. Als Sprecherin des Initiativkreises
erhielt Hannelore Mintzel auf Antrag von IGU-RL-Rat Wolfram Bieber
Rederecht. Sie warb dafür, die Synagoge vor Ort in Rimpar zu erhalten. 'Für
manch einen mag sie einfach nur eine baufällige Ruine sein, ein solches
Gebäude hat aber eine ungeheure Symbolkraft, ist mehr als nur Steine',
stellte die frühere Leiterin der Mittelschule fest. Befürchtungen, dass eine
Sanierung für die Marktgemeinde zu teuer wird, begegnete sie damit, es nicht
um eine 'Komplettrenovierung' gehe. Ziel sei vielmehr, Besuchern ein
'lebendiges Bild von der Geschichte des Gebäudes und der jüdischen Gemeinde
zu geben'. Als Vorbilder nannte sie die Synagogen in Memmelsdorf und
Obernbreit. Sie kann sich eine Dauerausstellung und kleine Konzerte oder
Lesungen vorstellen. Materialien seien im Archiv zahlreich vorhanden. Ein
Förderverein könnte unterstützend zur Seite stehen.
Im Dach könnten sich interessante Fundstücke befinden. In Rimpar
haben Juden seit der Zeit Julius Echters gelebt. Es entfaltete sich ein
reges jüdisches Gemeindeleben, sodass es 1792 nötig war, eine Synagoge zu
errichten und sie 1852 zu erweitern. Die Rimparer Synagoge steht seit 1980
unter Denkmalschutz. Sie hat einige für das fränkische Landjudentum
einmalige Besonderheiten aufzuweisen. Dazu gehört ein Treppenturm, der noch
heute von der Straße aus zu sehen ist und als Zugang zur Frauenempore
gedacht war. Über dem Eingang befindet sich ein Chuppastein für Hochzeiten.
Erhalten sind auch der Thoraschrein, Reste von Decken- und Wandgemälden und
eine Gedenktafel für die jüdischen Gefallenen im Ersten Weltkrieg. Der
Initiativkreis erwartet zudem, dass sich im Dach, das bisher nicht näher
untersucht wurde, für die Ortsgeschichte interessante Fundstücke befinden."
Link zum Artikel |
| |
|
Dezember 2019:
Die ehemalige Synagoge ist
nicht für das Freilichtmuseum Fladungen geeignet |
Artikel von Hanns Friedrich in
der "Main-Post" vom 5. Dezember 2019: "Mellrichstadt. Synagoge von Rimpar
nicht fürs Freilandmuseum Fladungen geeignet
Die Synagoge von Rimpar sei aufgrund ihres desolaten Zustandes nicht für das
Fränkische Freilandmuseum Fladungen geeignet. Das sagte Museumsleiterin
Ariane Weidlich bei der Zweckverbandsversammlung in Würzburg. Sie
untermauerte dies durch entsprechendes Bildmaterial. Das zeigte, dass die
Synagoge unter anderem als Hühnerstall genutzt wurde und wohl auch deshalb
im Innenbereich stark beschädigt ist. Zudem ist sie in eine Scheune
eingebaut und ein Abtransport wäre damit mit einem erhöhtem Aufwand
verbunden. Ebenfalls nicht geeignet, so hieß es bei der Versammlung weiter,
sei ist die Synagoge von Kleineibstadt.
Die Museumsleiterin war im März selbst in Rimpar und hat das Gebäude
besichtigt. Eingebunden war auch das Landesamt für Denkmalpflege. Vor Ort
zeigte sich, dass der Erhaltungszustand durch starke Verunreinigungen sehr
schlecht ist, da hier einmal Geflügelställe waren. Der Dachbereich ist nicht
begehbar. "Wenn wir die Synagoge übernehmen würden, müssten wir vieles
rekonstruieren und hätten einen enormen finanziellen Aufwand." Hinzu komme,
dass man im Fundus des Fränkischen Freilandmuseums keine Exponate habe, um
die Synagoge entsprechend auszustatten. Ariane Weidlich schloss jedoch
keinesfalls aus, dass eines Tages auch eine Synagoge im Freilandmuseum
stehen wird. "Allerdings nicht in den nächsten drei Jahren, denn da haben
wir viele andere Aufgaben zu erledigen." Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel
warf dazu ein, dass der Bezirk Unterfranken über die Kulturstiftung die
Instandhaltung von Synagogen fördere, allerdings sollten diese am Ort selbst
bleiben. Bestes Beispiel sei die ehemalige Synagoge in Oberelsbach. Eine
Übertragung ins Museum sei nicht der richtige Weg.
Zweckverbandsvorsitzender, Rhön-Grabfelds Landrat Thomas Habermann, stellte
fest, dass es zur Zeit keine Synagoge gebe, die für eine Translozierung
geeignet sei. Allerdings sei eine Synagoge im Fränkischen Freilandmuseum
nicht auszuschließen..."
Link zum Artikel |
Ähnlicher Artikel von Hanns
Friedrich in der "Saale-Zeitung" (inFranken.de) vom 28. Dezember 2019.
Link zum Artikel |
| |
|
Juni 2020:
Zukunft der ehemaligen Synagoge
weiter offen - die Gemeinde will "verantwortlich" mit dem Gebäude umgehen
|
Artikel von Christian Ammon in
der "Main-Post" vom 19. Juni 2020: "Rimpar. Jüdisches Erbe: Die ungewisse
Zukunft der Rimparer Synagoge
Das Freilandmuseum Fladungen möchte das Gebäude aus dem Jahr 1792 nicht.
Deshalb soll jetzt bald eine Machbarkeits- und Nutzungsstudie im Gemeinderat
vorgestellt werden.
Das Schicksal der Rimparer Synagoge ist weiterhin offen. Pläne für einen
Abbau und eine Verlagerung ins Freilandmuseum nach Fladungen hatten sich im
vergangenen Jahr schon bald zerschlagen. Ariane Weidlich, die
Museumsleiterin, hatte bei der Versammlung des Zweckverbands Fränkisches
Freilandmuseum nochmals bestätigt, dass es kein Interesse an dem
denkmalgeschützten Gebäude aus dem Jahr 1792 gebe und dies dem hohen Aufwand
für Abbau und Rekonstruktion des schwer zugänglichen Baus begründet. Auf der
Arbeitsliste des neuen Rimparer Bürgermeisters Bernhard Weidner steht die
Synagoge jedoch ganz oben, wie er auf Nachfrage versicherte. 'In der
Verwaltung haben wir uns intensiv damit befasst und Gespräche geführt',
erklärt er. Die Marktgemeinde wolle ihrer Verantwortung gerecht werden und
die 'dorfprägende' Synagoge erhalten. Eine Versetzung der kompletten
Synagoge, die der Gemeinderat im Januar 2019 einstimmig befürwortet hatte,
sei nur eine von mehreren Optionen gewesen, so Weidner: 'Die Tür ist offen.'
Die Gemeinde werde mit der Synagoge verantwortlich umgehen. Eine erste
Weiche dafür hat der alte Gemeinderat noch kurz vor der Wahl mit der
Beauftragung einer Machbarkeits- und Nutzungsstudie gestellt. Die
Ausschreibung und Prüfung der Angebote hat das Landesamt für Denkmalschutz
übernommen. Die eingegangenen Angebote sollen, so Weidner, in einer der
kommenden Sitzungen auf der Tagesordnung stehen. Er geht davon aus, dass
dabei unterschiedlich aufwendige Varianten für eine Sanierung geprüft
werden. 'Das letzte Wort hat dann der Gemeinderat', so Weidner. Die
Entscheidung von Januar 2019 war auf heftige Kritik getroffen. Auch
innerhalb des Gemeinderats. So fühlt sich die Fraktion IGU-RL falsch
informiert. Für Irritationen hatte vor allem die Entscheidung gesorgt, die
im nichtöffentlichen Teil der gleichen Sitzung gefallen war, das
Vorkaufsrecht für ein Grundstück, das den Zugang ermöglicht, nicht
wahrzunehmen. Dies sei zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht bekannt gewesen.
Auch der Zustand der Synagoge sei damals falsch und die Renovierungskosten
mit geschätzt zwei Millionen Euro deutlich zu hoch dargestellt worden.
'Die Synagoge ist von bestem Rimparer Maurerhandwerk'. Auch aus einem
Förderkreis, der sich seit Jahren um die Erhaltung der Synagoge sorgt, gab
es Kritik. 'Die Synagoge ist von bestem Rimparer Maurerhandwerk', erklärte
später Sprecherin Hannelore Mintzel: Ein Zimmerer haben zudem bestätigt,
dass die Dachkonstruktion solide gearbeitet sei. Die Schäden an einer Empore
im Dachbereich seien durch eindringendes Regenwasser entstanden. Die
Gemeinde hatte damals kurzfristig reagiert und den weiteren Verfall
gestoppt, indem sie das Dach mit der Lkw-Plane absicherte. Dennoch sind die
Schäden unübersehbar: Eine Zwischendecke hängt durch und ist nicht
betretbar. Gesteinsbrocken und Putz liegen im Raum. Laut Statikern ist es
derzeit nicht möglich, das ungesicherte Gebäude zu betreten.
'Hier ist nichts für ein- und allemal in Stein gemeißelt'. Auf Anfrage
versicherte der frühere Bürgermeister Burkard Losert, dass die Annahme des
Vorkaufsrechts damals finanziell nicht darstellbar und die Option auch nicht
unbegrenzt hinausschiebbar gewesen sei. Er sieht jedoch gute Möglichkeiten,
den gordischen Knoten doch noch zu zerschlagen. 'Hier ist nichts für ein-
und allemal in Stein gemeißelt.' Die im ausgehenden 18. Jahrhundert noch vor
der rechtlichen Gleichstellung der Juden in Bayern errichtete Synagoge war
bewusst schwer einsehbar errichtet worden.
Rimpar will sich seiner Geschichte stellen. Daran lässt Bürgermeister
Weidner keinen Zweifel: Es soll neben dem vorhandenen Mahnmal im Schlosshof
für die Ausschreitungen vom 9. November einen weiteren Gedenkort für die
Deportation der Juden geben. Ihn gestaltet eine Schulklasse des Gymnasiums
Veitshöchheim. Dabei soll ein wie vergessen wirkender Koffer aufgestellt
werden. Das Gegenstück befindet sich am kürzlich eingeweihten Gedenkort am
Würzburger Bahnhof."
Link zum Artikel |
| |
|
Juni 2020:
Eine Machbarkeitsstudie soll
erstellt werden |
Artikel von Christian Ammon in
der "Main-Post" vom 28. Juni 2020: "Rimpar. Machbarkeitsstudie für
Synagoge in Rimpar ist greifbar nah
Die Angebote für eine Machbarkeitsstudie für eine Sanierung der Rimparer
Synagoge liegen vor und sind vom Landesamt für Denkmalschutz ausgewertet
worden. Eine Förderzusage des Landesamtes für die Studie steht noch aus. Es
hier um Kosten von etwa 30 000 Euro. Bei einer Förderzusage und der Einigung
mit dem privaten Eigentümer des Gebäudes soll der Auftrag vergeben werden.
Die Erstellung einer Machbarkeitsstudie, die aus einer Bestandsaufnahme und
der möglichen Nutzung des Gebäudes besteht, hatte noch der alte
Marktgemeinderat beschlossen. Hierbei soll auch die bislang ungeklärte Frage
eines öffentlichen Zugangs zur Synagoge berücksichtigt werden."
Link zum Artikel |
| |
|
Juli 2020:
Der Gemeinderat stimmt der
Machbarkeitsstudie zu |
Artikel von Christian Ammon in
der "Main-Post" vom 27. Juni 2020: "Rimpar. Machbarkeitsstudie für die
Synagoge
Der Rimparer Marktgemeinderat hat einer Machbarkeitsstudie für die ehemalige
Synagoge in der Ortsmitte zugestimmt. Sie soll eine Bestandsaufnahme und im
Anschluss die Ausarbeitung einer Nutzungsstudie umfassen. Beauftragt wird
damit das Architekturbüro Wieser aus Eibelstadt. Die Kosten belaufen sich
auf 31 000 Euro. Eine Förderung über das Landesamt für Denkmalpflege ist
möglich. Bei einer Ortseinsicht mit einem Statiker hat sich ergeben, dass
noch vor einer Bestandsaufnahme die zweite Ebene mit Hilfe von Stützen
abgesichert und begehbar gemacht werden muss. Auch sind stellenweise noch
Schutt und Einbauten beiseite zu räumen. Die Kosten zwischen 4000 und 6000
Euro muss die Marktgemeinde übernehmen."
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 392-393. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 106-107. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 565-567.
|
 | Roland Flade: The Lehmans - From Rimpar to the New
World. A Family History. Wuerzburg 1996.
|
 | Ders.: Die Lehmanns und die Rimparer Juden -
Zur Dauerausstellung im Rathaus Rimpar. Würzburg 1996. |
 | Jutta Sporck-Pfitzer: Die ehemaligen jüdischen
Gemeinden im Landkreis Würzburg. Hg. vom Landkreis Würzburg. Würzburg
1988. S. 72-74.
|
 | Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen
Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche
Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.
Würzburg 2008. S. 274-275. |
 |
 Hannelore
Mintzel: Die unbekannte Welt von nebenan. Die letzten jüdischen
Familien in Rimpar. Ein vernachlässigtes Stück Heimatgeschichte. Hrsg. vom
Freundeskreis Rimpar e.V. Rimpar 2020 (Rimparer Geschichtsblätter Band 11).
Für 10.- € direkt zu bestellen bei der Autorin unter
hajuli@gmx.de. Hannelore
Mintzel: Die unbekannte Welt von nebenan. Die letzten jüdischen
Familien in Rimpar. Ein vernachlässigtes Stück Heimatgeschichte. Hrsg. vom
Freundeskreis Rimpar e.V. Rimpar 2020 (Rimparer Geschichtsblätter Band 11).
Für 10.- € direkt zu bestellen bei der Autorin unter
hajuli@gmx.de.
Besprechung der Dokumentation von Israel Schwiertz im Mitteilungsblatt
des Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern vom 26.
März 2021 (eingestellt als pdf-Datei). |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Rimpar Lower Franconia. The
Jewish settlement dates from no later than the first half of the 18th century.
The Jewish population grew to 142 in 1867 (total 2.152). Rimpar war the
birthplace (1878) of Herbert Lehman, governor of New York in 1932-42 and U.S.
senator in 1949-57. In 1933, 54 Jews remained; 37 left in 1936-40, 22 emigrating
to the United States. On Kristallnacht (8-10 November) the synagogue was
vandalized and Jews were beaten. Of the nine Jews remaining in 1942, six were
deported to Izbica in the Lublin district (Poland) on 24 April and three to the
Theresienstadt ghetto on 23 September 1942.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|