|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht
"Synagogen im Kreis Bergstraße"
 Lorsch
(Kreis Bergstraße) mit Einhausen Lorsch
(Kreis Bergstraße) mit Einhausen
Jüdische Geschichte / Synagoge
(das Foto zeigt die Torhalle
zum Kloster Lorsch aus karolingischer Zeit - ohne Bezug zur jüdischen Geschichte
des Ortes, vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Torhalle_Lorsch)
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Lorsch bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938. Ihre Entstehung geht in die
Zeit des 17./18. Jahrhunderts zurück, als der Ort noch zum
"Kurstaate" Mainz, Oberamt Starkenburg gehörte und im Blick auf jüdische
Belange dem Rabbinat Mainz unterstand. Möglicherweise lebten bereits im 13. und
14. Jahrhundert einzelne jüdische Personen am Ort. Nach Überlieferung der
Familie Mainzer ließ sich diese um 1500 im damals "mainzischen"
Lorsch nieder und nahm später den Familiennamen "Mainzer" an. Die
ersten schriftlichen Nachweise für Juden am Ort datieren ab 1660/68.
Damals werden drei jüdische Familien in Lorsch und Kleinhausen genannt (Simon
und Lazarus in Lorsch, Hersch in Kleinhausen, seit 1937 zusammen mit
Großhausen:
Einhausen).
Genaue Zahlen der jüdischen Einwohner liegen aus dem 19. Jahrhundert
vor: 1828 72 (etwa 10 Familien), 1837 70, 1845 80, 1861 86 jüdische
Gemeindeglieder (2,6 % der Gesamteinwohnerschaft von 3.262 Personen). Die Höchstzahl
jüdischer Einwohner wurde 1871 mit 110 Personen erreicht. Danach ging sie
durch Ab- und Auswanderung wieder zurück: 1880 96, 1895 101, 1900 88, 1910 72 jüdische
Gemeindeglieder. Anfang des 19 Jahrhunderts waren die als Ortsbürger in
Lorsch aufgenommenen Juden: Aaron Mainzer, Meier Baruch Mainzer, Samuel Mainzer,
Lazarus Rohrheimer, Simon Krakauer, Leopold Mainzer, Meier Mainzer II, Süßkind
Abraham und Samuel Abraham. Die Vorfahren der Familie Mainzer stammten ursprünglich
aus Spanien. Die jüdischen Familien lebten zunächst überwiegend vom Vieh- und
Fruchthandel, später von Handlungen und kleineren Geschäften. Bekannt waren
bis nach 1933 u.a. das Schuhgeschäft der Schwestern Jakob am Marktplatz oder
das Manufakturwaren- und Bettengeschäft von Sigmund Abraham (Kirchstraße 12).
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine Religionsschule
sowie ein rituelles Bad. Die Toten der Gemeinde wurden auf dem jüdischen
Friedhof in Alsbach
beigesetzt. Für die Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein
Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. Als
Lehrer werden u.a. genannt: 1866-1872 Lehrer E. Nathan, um 1889/93 M. Jaffé, bis
1905 Jakob Lewin (dann nach Randegg). Die
Gemeinde war dem orthodoxen Rabbinat Darmstadt II zugeteilt.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde die Brüder
Abraham Guthof (geb. 13.1.1895 in Lorsch, gef. 23.6.1918), Adolf Guthof (geb.
22.1.1894 in Lorsch, gef. 22.12.1916) und Siegmund Guthof (geb. 11.5.1891 in
Lorsch, gef. 11.2.1917).
Um 1925 gehörten der jüdischen Gemeinde etwa 70 Personen an (1,37 % der
Gesamtbevölkerung von etwa 5.100 Einwohnern). Zur Gemeinde in Lorsch gehörten
wie bereits im 18. Jahrhundert die im benachbarten Kleinhausen lebenden (damals
drei) jüdischen Einwohnern. Mitglieder des Gemeindevorstandes waren
damals Jacob Lorch II, Hermann Lorch und Josef Marx. Als Rechner war Adam Huba tätig.
Die damals sechs schulpflichtigen jüdischen Kinder erhielten an der
Religionsschule der Gemeinde Unterricht der Lehrer Heinrich Müller aus
Bensheim. An jüdischen Vereinen bestanden der Israelitische
Brautausstattungs- und Wohltätigkeitsverein unter Leitung von Hermann Lorch
sowie der Verein Somech Noflim (Unterstützung von Hausarmen) und Leitung
von Abraham Abraham.
1932 waren die beiden Vorsteher Hermann Lorch (1. Vorsteher) und Abraham
Abraham.
Nach 1933 ist ein Teil der jüdischen Gemeindeglieder (1933: 73 Personen)
auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der Repressalien weggezogen
beziehungsweise ausgewandert. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge
niedergebrannt sowie die Wohnungen und Geschäfte der jüdischen Familien verwüstet
und geplündert. Das Haus einer jüdischen Familie in Einhausen wurde von fünf
SA-Leuten überfallen, die die Wohnung zerstörten und das Haus anzündeten.
Diese Gewalttaten führten dazu, dass bis September 1939 die meisten der jüdischen
Einwohner auswanderten. Diejenigen, die blieben, wurden 1941 aus ihren Wohnungen
vertrieben und in ein "Judenhaus" (Karlstraße 1) eingewiesen. Im August
1942 erfolgten die Deportationen der noch in Lorsch lebenden jüdischen
Personen.
Von den in Lorsch geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945", ergänzt durch die Angaben
im "Gedenkbuch" siehe Heimatgeschichtlicher Wegweiser u.Lit.):
Else
Abraham geb. Weingarten (1902), Gustav Abraham (1890), Johanna Abraham geb.
Wachenheimer (1904), Siegmund Abraham (1892), Ida Bendheim (1893), Friedrich
(Fritz) Jaffe (1888, "Stolperstein" in
Seligenstadt), Max Jaffe (1885), Rosa Jaffe geb. Abraham (1888), Regina
Josef (1878), Liesel Kahn (1926),Miriam Kahn (1925), Paula
Kahn geb. Lorch (1902), Ruth Carola Kahn (1923), Suse Kahn (1829), Betty Lichtenstein
geb. Lorch (1875), Jenny Lichtenstein (1899), Alfred Lorch (1899), Bertha Lorch
geb. Krämer (1877), Eli Lorch (1940), Franziska Lorch geb. Oppenheimer (1903),
Margarethe Lorch (1931), Martin Lorch (1927), Gustine (Christine, Justine)
Mainzer (1897), Johanna Mainzer geb. Mayer (1863), Siegbert
Mann (1904), Johanna Marx (1877), Mathilde Marx geb. Haas (1875), Emma Mayer
geb. Oppenheimer (1893), Friedrich Mayer (1926), Otto Max Mayer (1891), Ernst
Nathan (1871), Nathan Nathan (1871), Antonie Rosalie Oppenheimer geb. Mayer
(1880), Bertha Oppenheimer (1877), Hannchen Oppenheimer (1871), Leopold
Oppenheimer (1873), Lore Podolski geb. Herzberger (1921), Lina Schnautser geb.
Marx (1875), Frieda Seelig geb. Guthof (1874).
Hinweis: der in einigen Listen genannte Heinz Kahn (geb. 25.8.1931 in Lorsch)
konnte emigrieren und lebt in Kanada (Mitteilung von Angehörigen 17.3.2015).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1860 /
1872 / 1876 / 1877 / 1878 / 1900 / 1903 / 1907 / 1924
 Ausschreibung
der Stelle des Religionslehrers und Vorbeters in Lorsch in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 29. August 1860: "Ein unverheirateter Religionslehrer
und Vorbeter kann in der Gemeinde Lorsch bei Worms sofort eine Anstellung
bekommen. Bei freier Wohnung und Heizung ist der Gehalt 300 Gulden und dürfte
derselbe um 100 Gulden vergrößert werden, wenn Reflektant die Schechitah
(das Schächten) verstände. Ausschreibung
der Stelle des Religionslehrers und Vorbeters in Lorsch in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 29. August 1860: "Ein unverheirateter Religionslehrer
und Vorbeter kann in der Gemeinde Lorsch bei Worms sofort eine Anstellung
bekommen. Bei freier Wohnung und Heizung ist der Gehalt 300 Gulden und dürfte
derselbe um 100 Gulden vergrößert werden, wenn Reflektant die Schechitah
(das Schächten) verstände.
Franco-Offerten entweder an Unterzeichneten oder an die bezeichnete
Gemeinde direkt.
Biblis, Hessen-Darmstadt. Dr.
E. Sander." |
| |
 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. August 1872: "Lehrerstelle-Vakanz.
Wegen Rücktritt unseres seitherigen Lehrers aus Gesundheitsgründen ist
die hiesige Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle mit einem Gehalt von
ca. 400 Gulden und mindestens 200-250 Gulden Nebenakzidenzien nebst freier
Wohnung sofort oder innerhalb 3 Monate zu besetzen. Lorsch an der Bergstraße,
24. Juli 1872. Der Vorstand Jonas Mainzer." Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. August 1872: "Lehrerstelle-Vakanz.
Wegen Rücktritt unseres seitherigen Lehrers aus Gesundheitsgründen ist
die hiesige Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle mit einem Gehalt von
ca. 400 Gulden und mindestens 200-250 Gulden Nebenakzidenzien nebst freier
Wohnung sofort oder innerhalb 3 Monate zu besetzen. Lorsch an der Bergstraße,
24. Juli 1872. Der Vorstand Jonas Mainzer." |
| |
 Ausschreibung
der Stelle des Religionslehrers und Vorbeters in Lorsch in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 25. Oktober 1876: "Annonce. Die hiesige
Religionslehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle ist vakant und soll
alsbald wieder besetzt werden. Fixer Gehalt 700 Mark nebst mindestens 500
Mark Nebeneinkommen und freier Wohnung. Hierauf Reflektierende belieben
sich beim unterzeichneten Vorstande zu melden. Ausschreibung
der Stelle des Religionslehrers und Vorbeters in Lorsch in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 25. Oktober 1876: "Annonce. Die hiesige
Religionslehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle ist vakant und soll
alsbald wieder besetzt werden. Fixer Gehalt 700 Mark nebst mindestens 500
Mark Nebeneinkommen und freier Wohnung. Hierauf Reflektierende belieben
sich beim unterzeichneten Vorstande zu melden.
Lorsch a.d. Bergstraße, 19. Oktober 1876.
Abraham Lorch." |
| |
 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Januar 1877: "Die hiesige
Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle ist vakant und soll alsbald
besetzt werden. Fixer Gehalt 900 Mark nebst mindestens 500 Mark
Nebeneinkommen und freier Wohnung. Hierauf Reflektierende belieben sich
alsbald bei dem unterzeichneten Vorstande, unter Angabe ob ledig oder
unverheiratet zu melden. Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Januar 1877: "Die hiesige
Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle ist vakant und soll alsbald
besetzt werden. Fixer Gehalt 900 Mark nebst mindestens 500 Mark
Nebeneinkommen und freier Wohnung. Hierauf Reflektierende belieben sich
alsbald bei dem unterzeichneten Vorstande, unter Angabe ob ledig oder
unverheiratet zu melden.
Anmeldungen von Russen und Polen bleiben unberücksichtigt.
Lorsch a.d. Bergstraße, im Januar 1877. Abraham Lorch." |
| |
 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Juli 1878: "Die hiesige
Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle ist vakant und bis 1. September
zu besetzen. Fixer Gehalt 900 Mark, Nebeneinkommen ca. 5-600 Mark nebst
freier Wohnung. Hierauf Reflektierende belieben sich alsbald unter Angabe,
ob ledig oder verheiratet, bei dem unterzeichneten Vorstande zu melden. Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Juli 1878: "Die hiesige
Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle ist vakant und bis 1. September
zu besetzen. Fixer Gehalt 900 Mark, Nebeneinkommen ca. 5-600 Mark nebst
freier Wohnung. Hierauf Reflektierende belieben sich alsbald unter Angabe,
ob ledig oder verheiratet, bei dem unterzeichneten Vorstande zu melden.
Lorsch an der Bergstraße, im Juli 1878. Abraham Lorch." |
| |
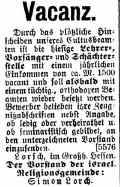 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. August 1900: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. August 1900:
"Vakanz.
Durch das plötzliche Hinscheiden unseres Kultusbeamten ist die hiesige
Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle mit einem jährlichen Einkommen
von ca. Mark 1.500 vakant und soll alsbald mit einem tüchtigen,
orthodoxen Beamten wieder besetzt werden. Bewerber belieben ihre
Zeugnisabschriften nebst Angabe, ob ledig oder verheiratet und ob
seminaristisch gebildet, an den unterzeichneten Vorstand
einzusenden.
Lorsch, im Großherzogtum Hessen.
Der Vorstand der israelitischen Religionsgemeinde.
Simon Lorch." |
| |
 Ausschreibung
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 17. März 1903:
"Lorsch a.d. Bergstraße. Lehrer, Vorbeter und Schächter per
1. Mai. Einkommen Mark 1.500 und freie
Wohnung." Ausschreibung
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 17. März 1903:
"Lorsch a.d. Bergstraße. Lehrer, Vorbeter und Schächter per
1. Mai. Einkommen Mark 1.500 und freie
Wohnung." |
| |
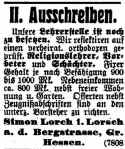 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März 1907: Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März 1907:
"II. Ausschreiben.
Unsere Lehrerstelle ist noch zu besetzen. Wir reflektieren
auf einen verheirateten, orthodoxen geprüften Religionslehrer, Vorbeter
und Schächter. Fixer Gehalt je nach Befähigung 900 bis 1.000 Mark.
Nebeneinkommen ca. 800 Mark nebst freier Wohnung und Garten. Offerten
nebst Zeugnisabschriften sind an den unterzeichneten Vorsteher zu richten.
Simon Lorch in Lorsch an der Bergstraße, Großherzogtum Hessen." |
| |
 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1924: "Für die hohen
Feiertage suchen wir einen Hilfsvorbeter. Israelitische Religionsgemeinde
Lorsch, Hessen." Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1924: "Für die hohen
Feiertage suchen wir einen Hilfsvorbeter. Israelitische Religionsgemeinde
Lorsch, Hessen." |
Abschied von Lehrer E. Nathan (1866-1872 Lehrer in Lorsch)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Dezember 1872: "Lorsch an der
Bergstraße. (Durch Zufall verspätet). Am verflossenen Schabbat Bereschit (Schabbat mit der Toralesung Bereschit
1. Mose 1,1- …) hielt unser seitheriger Lehrer Herr Nathan seine
Abschiedsrede, die auf alle Anwesenden den tiefsten Eindruck machte. Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Dezember 1872: "Lorsch an der
Bergstraße. (Durch Zufall verspätet). Am verflossenen Schabbat Bereschit (Schabbat mit der Toralesung Bereschit
1. Mose 1,1- …) hielt unser seitheriger Lehrer Herr Nathan seine
Abschiedsrede, die auf alle Anwesenden den tiefsten Eindruck machte.
Herr Nathan hat sechs Jahre hindurch in unserer Gemeinde mit unermüdlichem
Eifer und strenger Gewissenhaftigkeit segensreich gewirkt. Wir bedauern
deshalb alle, dass er durch seine geschwächte Gesundheit genötigt ist,
von seinem seitherigen Berufe zurückzutreten. Möge in Worms, in seinem
neuen Wirkungskreise, seine Gesundheit erstarken. Möge es durch seinen
biedern Charakter ihm gelingen, die achtungsvolle Liebe seiner Mitbürger
in gleichem Grade zu erringen, wie sie ihm hier allseitig zuteil geworden
ist." |
| |
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. November 1872: "Dank! Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. November 1872: "Dank!
Für die
vielen Beweise von aufrichtiger Freundschaft, die mir während meiner
sechsjährigen Wirksamkeit als Lehrer in der Gemeinde Lorsch zuteil
geworden, ganz besonders aber für die herzliche Anerkennung, respektive für
das schöne und wertvolle Geschenk, das mir als Beweise derselben beim
Abschiede überreicht wurde, sage ich hiermit meinen herzlichen, tief gefühlten
Dank! Mögen die Grundpfeiler der jüdischen Religion Tora, Gottesdienst
und Wohltätigkeit die in der Gemeinde Lorsch stets einen fruchtbaren
Boden gefunden, auch ferner in derselben blühen und Früchte tragen und
auch meinem Nachfolger eine recht segensreiche Tätigkeit beschieden sein.
Worms, im Marcheschwan 5633. E. Nathan." |
Lehrer Jakob Lewin wechselt
nach Randegg (1905)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. Dezember
1905: "Karlsruhe: "Das neueste Verordnungsblatt des
Großherzoglichen Oberrates der Israeliten meldet folgende Veränderungen
in der Besetzung der Religionsschullehrerstellen: Jakob Lewin
seither in Lorsch nach Randegg,
Sally Rosenfelder in Eubigheim nach Buchen,
Nathan Adler von Külsheim nach Eubigheim,
Kantor Simon Metzger von Sulzburg nach
Bretten, Samuel Strauß von Berlichingen
nach Sulzburg, Jakob Schloß von Talheim
nach Malsch bei Ettlingen. Auf
Ansuchen wurden von ihren Stellen enthoben: Kantor Weiß in Gailingen
und Religionslehrer Jakob Lorch in Untergrombach,
letzterer behufs Übernahme der Verwalterstelle der M.A. d.
Rothschild'schen Lungenheilstätte in Nordrach." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. Dezember
1905: "Karlsruhe: "Das neueste Verordnungsblatt des
Großherzoglichen Oberrates der Israeliten meldet folgende Veränderungen
in der Besetzung der Religionsschullehrerstellen: Jakob Lewin
seither in Lorsch nach Randegg,
Sally Rosenfelder in Eubigheim nach Buchen,
Nathan Adler von Külsheim nach Eubigheim,
Kantor Simon Metzger von Sulzburg nach
Bretten, Samuel Strauß von Berlichingen
nach Sulzburg, Jakob Schloß von Talheim
nach Malsch bei Ettlingen. Auf
Ansuchen wurden von ihren Stellen enthoben: Kantor Weiß in Gailingen
und Religionslehrer Jakob Lorch in Untergrombach,
letzterer behufs Übernahme der Verwalterstelle der M.A. d.
Rothschild'schen Lungenheilstätte in Nordrach." |
Aus dem jüdischen
Gemeinde- und Vereinsleben
Lob der Gemeinde für Ihre Wohltätigkeit (1870)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. April 1870: "Lorsch an der Bergstraße.
Die hiesige israelitische Gemeinde, aus nur 15 Mitgliedern bestehend,
zeichnet sich ganz besonders durch hervorragende Wohltätigkeit aus, wovon
nicht allein die Spendenlisten des 'Israelit’, sondern auch viele Arme
in der Nähe und Ferne Zeugnis ablegen. Mögen die edlen Wohltäter im
Wohl tun nicht ermüden; mögen aber auch andere, größere und wohlhabendere Gemeinden sich ein Beispiel daran nehmen und es der unseren
zuvortun." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. April 1870: "Lorsch an der Bergstraße.
Die hiesige israelitische Gemeinde, aus nur 15 Mitgliedern bestehend,
zeichnet sich ganz besonders durch hervorragende Wohltätigkeit aus, wovon
nicht allein die Spendenlisten des 'Israelit’, sondern auch viele Arme
in der Nähe und Ferne Zeugnis ablegen. Mögen die edlen Wohltäter im
Wohl tun nicht ermüden; mögen aber auch andere, größere und wohlhabendere Gemeinden sich ein Beispiel daran nehmen und es der unseren
zuvortun." |
Über den Brautausstattungsverein in Lorsch (1868)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26.
Mai 1868: "Aber auch für die echt jüdische Wohltätigkeit ist hier ein
fruchtbares Feld gefunden. Fast in jeder Gemeinde besteht eine Chewra Kadischa, ein Wohltätigkeitsverein. In Lorsch besteht seit vielen
Jahren eine Chewroh kaddischoh Hachnoßas
Kalloh""
(Brautausstattungsverein) für Lorsch und die umliegenden Orte, welche im Ganzen
nur etwa 20 Mitglieder zählt, aus welcher aber alle zwei Jahre ein armes Mädchen
600 Gulden zur Ausstattung erhält. Ähnliche Chewarot
(Vereine) bestehen in Biblis und in Pfungstadt." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26.
Mai 1868: "Aber auch für die echt jüdische Wohltätigkeit ist hier ein
fruchtbares Feld gefunden. Fast in jeder Gemeinde besteht eine Chewra Kadischa, ein Wohltätigkeitsverein. In Lorsch besteht seit vielen
Jahren eine Chewroh kaddischoh Hachnoßas
Kalloh""
(Brautausstattungsverein) für Lorsch und die umliegenden Orte, welche im Ganzen
nur etwa 20 Mitglieder zählt, aus welcher aber alle zwei Jahre ein armes Mädchen
600 Gulden zur Ausstattung erhält. Ähnliche Chewarot
(Vereine) bestehen in Biblis und in Pfungstadt."
|
Vortrag in der Synagoge (1908)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Mai 1908:
"Lorsch, 21. Mai (1908). In Anwesenheit fast sämtlicher
Gemeindeangehörigen referierte am letzten Sonntag in unserer Synagoge
Herr Kaufmann Aron aus Frankfurt am Main über 'Die Aufgaben des
gesetzestreuen Judentums in der Gegenwart.' Redner wies auf die Ursachen
des religiösen Niedergangs aller gesetzestreu Gesinnten auf dem flachen
lande hin und empfahl den Zusammenschluss aller gesetzestreu Gesinnten von
Stadt und Land. Nachdem Herr Aron über die Ziele und Bestrebungen der
'Freien Vereinigung für die Interessen des orthodoxen Judentums' einiges ausgeführt
hatte, erklärten sämtliche Gemeindemitglieder ihren Beitritt zu
derselben. Der Verlauf der Versammlung bewies zur Genüge, dass in unserer
Gemeinde noch echte Frömmigkeit vorhanden ist, und dass sich der von
unserem früheren Lehrer Jaffé, während seiner langjährigen, hiesigen Tätigkeit
eingepflanzte religiöse Geist treu erhalten hat." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Mai 1908:
"Lorsch, 21. Mai (1908). In Anwesenheit fast sämtlicher
Gemeindeangehörigen referierte am letzten Sonntag in unserer Synagoge
Herr Kaufmann Aron aus Frankfurt am Main über 'Die Aufgaben des
gesetzestreuen Judentums in der Gegenwart.' Redner wies auf die Ursachen
des religiösen Niedergangs aller gesetzestreu Gesinnten auf dem flachen
lande hin und empfahl den Zusammenschluss aller gesetzestreu Gesinnten von
Stadt und Land. Nachdem Herr Aron über die Ziele und Bestrebungen der
'Freien Vereinigung für die Interessen des orthodoxen Judentums' einiges ausgeführt
hatte, erklärten sämtliche Gemeindemitglieder ihren Beitritt zu
derselben. Der Verlauf der Versammlung bewies zur Genüge, dass in unserer
Gemeinde noch echte Frömmigkeit vorhanden ist, und dass sich der von
unserem früheren Lehrer Jaffé, während seiner langjährigen, hiesigen Tätigkeit
eingepflanzte religiöse Geist treu erhalten hat." |
Hauptversammlung des Brautausstattungsvereins in Lorsch
und Spende von Lazarus Oppenheimer aus Lindolsheim (1910)
Anmerkung: Lazarus Oppenheimers Vorfahren
stammten aus Kleinhausen bei Lorsch. Die in Kleinhausen lebenden jüdischen
Familien gehörten zur Lorscher Gemeinde. Einer der beiden Gründer der Firma
"Adler & Oppenheimer" - zeitweilig der größte Konzern der europäischen
Lederindustrie - war Ferdinand Oppenheimer, der in Kleinhausen geboren ist und
sich 1871 in Straßburg niedergelassen hatte. Zur Firma vgl. Wikipedia-Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Adler_%26_Oppenheimer und
Seite zu Lingolsheim.
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 28. Januar 1910: "Lorsch
(Hessen). Am Erew Rausch-Chaudesch Sch'wat (= Vorabend zum 1. Schwat)
wurde die alljährliche Hauptversammlung des hiesigen
Brautausstattungsvereins (Chewro kaddischoh 'Hachnoßas Kalloh')
abgehalten. Der seitherige Vorstand, dessen Vorsitzender der
Gemeindevorsteher Herr Simon Lorch ist, wurde durch Zuruf
wiedergewählt und wegen des alljährlichen Vereinsessens der Jahresbeitrag
von 10 M. auf 12 M. erhöht. Nach Schluss der Versammlung fand in der
Synagoge zu Lorsch der übliche Jaum-Kippur-koton-Gottesdienst statt, in dem
das Vereinsmitglied, Herr Lehrer B. Rohrheimer -
Biblis, das Amt des Vorbeters versah.
Anschließend an den Gottesdienst fand in den Räumlichkeiten des
Vereinsvorsitzenden ein Festessen statt, bei dem sich die Mitglieder
von nah und fern für einige Stunden geselligen Zusammenseins gern ein
Stelldichein gaben. Herr Lehrer Jaffé von Lorsch gab diesem
Bewusststein gemeinsamer Arbeit Ausdruck in seinen Worten, mit denen er an
die Gründung der ersten jüdischen Chewroh erinnerte - an die Geburt des
jüdischen Volkes in der Erlösungsnacht. Lehrer Rohrheimer knüpfte
seine Worte an das Tefillingebot an und stellte so das Judentum als eine
Religion der Tat hin, die zur Ausübung sittliche Handlungsweise, Mitzwaus,
verpflichtet und dadurch das Glauben und das Aufstellen von Glaubenslehren
stark in den Hintergrund stellt. Wie das Gesamtjudentum im Großen, so hat
unsere 'Kippe' im Kleinen die sittliche Tat zum Vereinszweck und in ihrer
Tätigkeit schon viele Saaten des Segens und der Liebe ausgestreut. Herr
Dr. Mainzer - Alzey pries den
Erew-Rausch-Chaudesch Sch'wat als das Einigungsband der 'Jungen' und der
'Alten'. Im Jahre 1912 beabsichtigt der Verein sein 100-jähriges Bestehen in
einem größeren Stiftungsfest zu feiern. Wie im letzten Jahre, so wurden auch
in diesem namhafte Beiträge von Seiten aller Mitglieder zu diesem Zweck
gezeichnet. Herr Lazarus Oppenheimer aus
Lingolsheim spendete für die Firma
Adler und Oppenheimer in Straßburg 100 M. Das Tischgebet wurde nun
versteigert und dann trennte man sich mit dem Wunsche eines fröhlichen
Wiedersehens bei der 'Jahrhundertfeier'." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 28. Januar 1910: "Lorsch
(Hessen). Am Erew Rausch-Chaudesch Sch'wat (= Vorabend zum 1. Schwat)
wurde die alljährliche Hauptversammlung des hiesigen
Brautausstattungsvereins (Chewro kaddischoh 'Hachnoßas Kalloh')
abgehalten. Der seitherige Vorstand, dessen Vorsitzender der
Gemeindevorsteher Herr Simon Lorch ist, wurde durch Zuruf
wiedergewählt und wegen des alljährlichen Vereinsessens der Jahresbeitrag
von 10 M. auf 12 M. erhöht. Nach Schluss der Versammlung fand in der
Synagoge zu Lorsch der übliche Jaum-Kippur-koton-Gottesdienst statt, in dem
das Vereinsmitglied, Herr Lehrer B. Rohrheimer -
Biblis, das Amt des Vorbeters versah.
Anschließend an den Gottesdienst fand in den Räumlichkeiten des
Vereinsvorsitzenden ein Festessen statt, bei dem sich die Mitglieder
von nah und fern für einige Stunden geselligen Zusammenseins gern ein
Stelldichein gaben. Herr Lehrer Jaffé von Lorsch gab diesem
Bewusststein gemeinsamer Arbeit Ausdruck in seinen Worten, mit denen er an
die Gründung der ersten jüdischen Chewroh erinnerte - an die Geburt des
jüdischen Volkes in der Erlösungsnacht. Lehrer Rohrheimer knüpfte
seine Worte an das Tefillingebot an und stellte so das Judentum als eine
Religion der Tat hin, die zur Ausübung sittliche Handlungsweise, Mitzwaus,
verpflichtet und dadurch das Glauben und das Aufstellen von Glaubenslehren
stark in den Hintergrund stellt. Wie das Gesamtjudentum im Großen, so hat
unsere 'Kippe' im Kleinen die sittliche Tat zum Vereinszweck und in ihrer
Tätigkeit schon viele Saaten des Segens und der Liebe ausgestreut. Herr
Dr. Mainzer - Alzey pries den
Erew-Rausch-Chaudesch Sch'wat als das Einigungsband der 'Jungen' und der
'Alten'. Im Jahre 1912 beabsichtigt der Verein sein 100-jähriges Bestehen in
einem größeren Stiftungsfest zu feiern. Wie im letzten Jahre, so wurden auch
in diesem namhafte Beiträge von Seiten aller Mitglieder zu diesem Zweck
gezeichnet. Herr Lazarus Oppenheimer aus
Lingolsheim spendete für die Firma
Adler und Oppenheimer in Straßburg 100 M. Das Tischgebet wurde nun
versteigert und dann trennte man sich mit dem Wunsche eines fröhlichen
Wiedersehens bei der 'Jahrhundertfeier'."
|
Hundertjähriges Jubiläum des Braut-Ausstattungsvereines
(1912)
 Artikel im
"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2. Februar 1912: "Lorsch.
Der Braut-Ausstattungsverein (Chewrah
kadischa wehachnosaß kaloh) beging sein 100jähriges Jubiläum. Auf
Anregung Landrabbiners Dr. Marx wurde während der Festessens auch von den
Frauen ein gleicher Verein gegründet." Artikel im
"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2. Februar 1912: "Lorsch.
Der Braut-Ausstattungsverein (Chewrah
kadischa wehachnosaß kaloh) beging sein 100jähriges Jubiläum. Auf
Anregung Landrabbiners Dr. Marx wurde während der Festessens auch von den
Frauen ein gleicher Verein gegründet." |
Publikation "Gedenkblätter zur Erinnerung an das 175jährige Jubiläum des
Wohltätigkeitsvereins im ehemaligen Amt Starkenburg (Sitz Lorsch) 1739-1914.
Von Dr. phil. Moritz Mainer - Frankfurt am Main (1916).
 Artikel
im
"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Juni 1916:
"Gedenkblätter zur Erinnerung an das 175-jährige Jubiläum
des Wohltätigkeitsvereins im ehemaligen Amt Starkenburg (Sitz Lorsch)
1739-1914. Von Dr. phil. Moritz Mainzer – Frankfurt am Main. Artikel
im
"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Juni 1916:
"Gedenkblätter zur Erinnerung an das 175-jährige Jubiläum
des Wohltätigkeitsvereins im ehemaligen Amt Starkenburg (Sitz Lorsch)
1739-1914. Von Dr. phil. Moritz Mainzer – Frankfurt am Main.
Diese Gedenkblätter stellen eine sehr verdienstvolle Arbeit dar.
Denn aus ihnen wehr der starke Geist der alten treu-jüdischen
Familiengeschichte, der heute mehr denn jemals von Bedeutung für unsere jüdische
Gegenwart ist. Im Rahmen einer Vereingeschichte spielt sich hier ein Stück
Leben und sterben einer kleinen Landgemeinde vor uns ab, wie sie für die
vergangene Zeit typisch ist. Darin liegt auch der besondere Wert dieser
Arbeit, dass sie in der Darstellung der Geschichte eines Wohltätigkeitsvereins,
wie sie zu Hunderten im 18. und 19. Jahrhundert in Deutschland blühten,
die typischen kulturhistorischen Züge der jüdischen Landgemeinde
aufweist.
Wir sehen hier, wie das jüdische Leben noch im Mittelpunkt alles Denkens
und Schaffens unserer Ahnen stand, wie ihnen kein Gegenstand zu gering und
keine Mühe zu groß schien, wenn das innere jüdische Leben, das echter
Menschenliebe und edlem Wohl tun geweiht war, dadurch gestärkt wurde. Die
Lokalgeschichte, die auch dem genealogischen Forscher viel Material
bietet, wird hierdurch Beitrag zur inneren Kulturgeschichte der deutschen
Juden in den beiden letzten Jahrhunderten.
Wir erfahren, wie wenig vereinsmäßig dieser Verein geleitet, wie seine
Sitzungen ohne Protokoll geführt wurden, wie aber trotzdem der Zweck des
Vereins, die Liebestat selbstlos geübt wurde. Wir lernen die bescheidenen
Freuden der deutschen Landjuden kennen, die aber doch in ihrer
Schlichtheit und Einfachheit tief ans Herz griffen. Die ganze entwürdigende
Rechtlosigkeit unserer Altvorderen empfinden wir beim lesen dieser Denkblätter,
denn nicht einmal das Begräbnis wurde diesen Ausgeschlossenen ohne
Zollhinterlegung gestattet. Die Vereinssatzungen waren 32 Paragraphen,
entsprechend der Zahl des Werkes 'leiw’. Von 14 Männern wurde der
Verein begründet, vielleicht hinweisend auf 'jad’ (sc. der Zahlenwert
[J = 10 + D = 4] des hebräischen Wortes Jad = Hand ist 14), das tatvolle
Handanlegen damit bezeichnend. Alt und Neuvorsteher leiten die Vereinigung
und haben auch das Recht der Strafverhängung.
Der Verein, der als Krankenpflege- und Beerdigungsverein begründet
wurde, erweiterte später seine Ziele durch Angliederung eines
Brautausstattungsvereins und wirkt auch in dieser Hinsicht sehr
segensreich. Er war wohl der vornehmste und tätigste Verein der Zeit, und
alljährlich auf dem Brudermahl hält auch die Freude in dem kreise der
Mitglieder Einzug, und der silberne Pokal, mit den Sternbildern und
Emblemen der jüdischen Stämme reich verziert, macht die Runde.
Alles in allem, eine sehr fleißige, interessante und gehaltvolle Arbeit,
die uns aus dem damals kraftvollen jüdischen Landleben, die alte längst
verklungene Zeit wieder hervorzaubert mit all deren Leid, aber auch ihren
stillen Freuden. W."
|
Zum Tod von Jacob Lorch, Vertrauensmann des "Central-Vereins" in Lorsch
(1928)
 Artikel in
der "Centralvereins-Zeitung" vom 10. August 1928: "Durch das Hinscheiden
unseres Vertrauensmannes in Lorsch (Hessen), Herr Jacob Lorsch, erleiden
wir einen schmerzlichen Verlust. In seiner Treue zum Judentum, seinem
Gemeinsinn, seiner entschlossenen und großzügigen Art und seinem
Eintreten für unsere Ideale war er ein Vorbild, dem seine Kinder
nachstreben." Artikel in
der "Centralvereins-Zeitung" vom 10. August 1928: "Durch das Hinscheiden
unseres Vertrauensmannes in Lorsch (Hessen), Herr Jacob Lorsch, erleiden
wir einen schmerzlichen Verlust. In seiner Treue zum Judentum, seinem
Gemeinsinn, seiner entschlossenen und großzügigen Art und seinem
Eintreten für unsere Ideale war er ein Vorbild, dem seine Kinder
nachstreben." |
| |
 Anzeige in
der "Centralvereins-Zeitung" vom 10. August 1928: "Heute Nacht ist unser
innigst geliebter treu sorgender Vater, unser lieber Großvater,
Schwiegervater, Bruder, Schwager und Onkel Herr Jakob Lorch im 59.
Lebensjahre von uns geschieden. Alfred Lorch und Frau Fränze geb.
Oppenheimer, Karl Kahn und Frau Paula geb. Lorch. Julius Strauss und Frau
Irma geb. Lorch. Leo Lorch. Lorsch (Hessen), Michelstadt im Odenwald, New
York den 15. Aw 5688 / 1. August 1928". Anzeige in
der "Centralvereins-Zeitung" vom 10. August 1928: "Heute Nacht ist unser
innigst geliebter treu sorgender Vater, unser lieber Großvater,
Schwiegervater, Bruder, Schwager und Onkel Herr Jakob Lorch im 59.
Lebensjahre von uns geschieden. Alfred Lorch und Frau Fränze geb.
Oppenheimer, Karl Kahn und Frau Paula geb. Lorch. Julius Strauss und Frau
Irma geb. Lorch. Leo Lorch. Lorsch (Hessen), Michelstadt im Odenwald, New
York den 15. Aw 5688 / 1. August 1928". |
Berichte über
einzelne Personen aus der Gemeinde
Tragische Geschichte mit der "Bitte um Auskunft" nach dem
Verschwinden von Jette Abraham (1867)
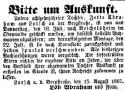 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. August 1867: "Bitte um
Auskunft: Unsere achtzehnjährige Tochter, Jette Abraham aus Lorsch an der
Bergstraße, ist von uns Donnerstag, den 18. Juli, nach Reichelsheim im
Odenwalde geschickt worden, um daselbst bestellte Putzwaren abzuliefern; am
darauf folgenden Monate, den 22. Juli, ist sie nach Darmstadt zurückgekehrt und
seitdem spurlos verschwunden. Alle bisherigen Nachforschungen waren vergeblich.
Die tief betrübten Eltern richten die ergebene Bitte an Juden, der über den
Verbleib ihrer obgenannten Tochter Auskunft zu erteilen imstande ist, ihnen
Nachricht zukommen zu lassen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. August 1867: "Bitte um
Auskunft: Unsere achtzehnjährige Tochter, Jette Abraham aus Lorsch an der
Bergstraße, ist von uns Donnerstag, den 18. Juli, nach Reichelsheim im
Odenwalde geschickt worden, um daselbst bestellte Putzwaren abzuliefern; am
darauf folgenden Monate, den 22. Juli, ist sie nach Darmstadt zurückgekehrt und
seitdem spurlos verschwunden. Alle bisherigen Nachforschungen waren vergeblich.
Die tief betrübten Eltern richten die ergebene Bitte an Juden, der über den
Verbleib ihrer obgenannten Tochter Auskunft zu erteilen imstande ist, ihnen
Nachricht zukommen zu lassen.
Lorsch a.d. Bergstraße, den 15. August 1867. Löb Abraham und Frau."
|
Zum Tod (Suizid) des Albert Hirsch aus Mannheim (1869)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. April 1869: "Lorsch an der Bergstraße.
Ein nicht freudiges Ereignis hat sich am verflossenen … in dieser
Gemeinde zugetragen. Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. April 1869: "Lorsch an der Bergstraße.
Ein nicht freudiges Ereignis hat sich am verflossenen … in dieser
Gemeinde zugetragen.
Herr Albert Hirsch aus Mannheim, Ingenieur und Eisenbahnunternehmer an der
ihrer Vollendung nahen Worms-Bensheimer Bahn, hat am 30. März seinem
jungen tatkräftigen Leben durch Erschießen ein Ende gemacht.
Herr Hirsch, ein Jehudi, aber
leider nur dem Namen nach, war den Vorschriften unserer heiligen Religion
ganz entfremdet. Sogar am verflossenen Jom
Kippur sah man denselben auf der Bahnstrecke seinen gewöhnlichen
Beschäftigungen obliegen.
In seinem sonstigen leben soll er sehr menschenfreundlich, sehr tüchtig
in seinem Fache und gewissenhaft in seinen Geschäften gewesen sein. Das
zeigte sich auch bei seinem Leichenbegängnisse, an welchem sich fast alle
hiesigen Honoratioren, das ganze Aufsichtspersonal der zu erbauenden
Eisenbahn, viele Mitglieder des hiesigen Ortsvorstandes und noch viele
andere Christen beteiligten.
Dass sich die hiesigen Jehudim,
obwohl Herr Hirsch ihnen im Leben ferne gestanden, nicht zurückzogen, ist
selbstverständlich.
Da der Tod nicht unmittelbar nach dem Schusse erfolgt (Hirsch lebte noch
einen halben Tag und starb auf seinem Bette in Gegenwart eines großen
Teiles der Gemeinde unter Anerkennung des Einig-einzigen Sch’ma Jisrael usw.), da ferner der Selbstmord höchst
wahrscheinlich, aber doch nicht unzweifelhaft nachgewiesen werden konnte,
so erzeigten wir dem Dahingegangenen alle Liebesdienste, die wir auch
einem anderen Toten schuldig sind. – Der Einsender dieser Zeilen sprach
an der Bahre einige Worte über das tragische ende des Dahingegangenen.
Ausgehend von den Worten (Zitat)
suchte er von dem Wahne zu warnen, als ob dieses Leben das ganze Ziel des
Menschen, als ob mit dem Tode Alles abgeschlossen sei etc. etc.; er suchte
aber auch nachzuweisen, dass wir in unserem Urteile über die Handlungen
des Nächsten nie zu strenge sein dürften, da wir Alle menschlichen
Schwachen unterworfen, und einst vor dem Könige aller Könige
Rechenschaft über unsere Handlungen abzulegen haben.
Unser Streben müsse nur dahin gerichtet sein, für alle, auch für die
unglücklichsten Fälle des menschlichen Lebens, eine Stütze zu haben,
welche uns nie sinken lasse! Diese Stütze bilde der Glaube, dass der Gerechte in der Wahrheit bleibe. – Der Fromme lebt in und für
seinen Glauben, und er bleibe aufrecht in den heftigsten Stürmen des
Lebens.
Diese wenigen Worte, verbunden mit der Beteiligung der ganzen hiesigen
Gemeinde am Leichenbegängnisse, machten einen wohltuenden Eindruck auf
den gebildeten Teil der ganz katholischen hiesigen Bevölkerung; nur die
Geistlichkeit soll sich missbilligend darüber geäußert haben, dass man
einen Selbstmörder wie einen anderen Menschen behandele! – (Nach jüdischem
Religionsgesetze wird nur Derjenige als Selbstmörder betrachtet, welcher
vor Zeugen vorher die Absicht des Selbstmordes dargetan und denselben in
Gegenwart von Zeugen ausgeführt hat. – Jore Deah Cap. 345 § 2 –
Redaktion)." |
Zum Tod von Salomon Abraham (1886)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. September 1886: "Von der Bergstraße.
Wenn der Monat Aw eintritt, beschränkt man die Freude. Auf doppelte Weise
kam dieser Satz in der Gemeinde Lorsch zur Anwendung; denn abgesehen von
der allgemeinen Trauer im Monat Aw wurde sie noch außerdem in tiefe
Trauer versetzt durch den am 13. Aw erfolgten Heimgang ihres ältesten
Mitgliedes Salomon Abraham, Sohn des durch seine bedeutende jüdische
Gelehrsamkeit und Frömmigkeit ausgezeichneten Rabbi
Salmon Lorsch – das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen. Und
diese allgemeine Trauer war eine gerechte. War doch der Entschlafene das
Muster eines jüdischen Mannes, hervorragend durch Frömmigkeit, stets
festhaltend an den Satzungen unserer heiligen Tora, in der er sich ein großes
Wissen angeeignet. Überall wurde er geliebt und verehrt. Jedem war er ein
wahrer Freund und gewissenhafter Ratgeber. Mit inniger Freude nahm er Gäste
bei sich auf und sah es mit Wonne, wen sich Gäste an seinem Tische
labten, obschon er selbst mit Glücksgütern nicht gesegnet war. In seinem
Hause versammelte sich die ganze Gemeinde; seine Worte, mit köstlichen
Witzen gewürzt, wurden gerne gehört, und seine Zurechtweisungen von
jedem gerne angenommen. Nach all diesem war es kein Wunder, dass zu seinem
Leichenbegängnisse sich so viele Menschen aus der ganzen Umgegend
eingefunden hatten, um dem Verblichenen die letzte Ehre zu erweisen. Dem
allgemeinen Schmerze gab zuerst unter Zugrundelegung des am Eingang erwähnten
Satzes mit vor Tränen erstickter Stimme der Schwiegersohn des
Verstorbenen Herr Rohrheimer aus Biblis Ausdruck; dann folgte Herr Lehrer
Jaffé aus Lorsch, der die Tugenden des Dahingeschiedenen, wie ich sie nur
teilweise angeführt, in ergreifenden Worten schilderte; es würde zu weit
führen, wenn ich alles einzeln wiedergeben wollte. Schließlich konnte es
sich der greife Vorstand der Lorscher Chawera
Herr Sinsheim aus Bierstadt, nicht versagen, seinem Freunde ein letztes
Lebewohl nachzurufen, indem er noch hervorhob, dass es dem Verblichenen
vergönnt gewesen, seine Kinder zu edlen Menschen heranwachsen zu sehen,
die es sich zur Pflicht gemacht, die Eltern aufs höchste zu ehren. Dem
anwesenden jüngsten Sohne, Herrn Prediger S. Abraham in Stuttgart, war es
nicht möglich, seinen großen Schmerz in Worte zu kleiden. Möge der Allgütige
der trauernden Witwe, die im wahren sinne des Wortes alle Eigenschaften
einer echten Eschet chajil
(wackeren Frau) besitzt und 44 Jahre lang mit dem selig Entschlafenen in
Liebe verbunden war, Trost wie auch den Kindern Kraft geben, den sie
betroffenen Verlust in Ergebung zu tragen. Ihm aber möge in den lichten Höhen
der Lohn zuteil werden, der alle Frommen und Edeln erwartet. Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. September 1886: "Von der Bergstraße.
Wenn der Monat Aw eintritt, beschränkt man die Freude. Auf doppelte Weise
kam dieser Satz in der Gemeinde Lorsch zur Anwendung; denn abgesehen von
der allgemeinen Trauer im Monat Aw wurde sie noch außerdem in tiefe
Trauer versetzt durch den am 13. Aw erfolgten Heimgang ihres ältesten
Mitgliedes Salomon Abraham, Sohn des durch seine bedeutende jüdische
Gelehrsamkeit und Frömmigkeit ausgezeichneten Rabbi
Salmon Lorsch – das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen. Und
diese allgemeine Trauer war eine gerechte. War doch der Entschlafene das
Muster eines jüdischen Mannes, hervorragend durch Frömmigkeit, stets
festhaltend an den Satzungen unserer heiligen Tora, in der er sich ein großes
Wissen angeeignet. Überall wurde er geliebt und verehrt. Jedem war er ein
wahrer Freund und gewissenhafter Ratgeber. Mit inniger Freude nahm er Gäste
bei sich auf und sah es mit Wonne, wen sich Gäste an seinem Tische
labten, obschon er selbst mit Glücksgütern nicht gesegnet war. In seinem
Hause versammelte sich die ganze Gemeinde; seine Worte, mit köstlichen
Witzen gewürzt, wurden gerne gehört, und seine Zurechtweisungen von
jedem gerne angenommen. Nach all diesem war es kein Wunder, dass zu seinem
Leichenbegängnisse sich so viele Menschen aus der ganzen Umgegend
eingefunden hatten, um dem Verblichenen die letzte Ehre zu erweisen. Dem
allgemeinen Schmerze gab zuerst unter Zugrundelegung des am Eingang erwähnten
Satzes mit vor Tränen erstickter Stimme der Schwiegersohn des
Verstorbenen Herr Rohrheimer aus Biblis Ausdruck; dann folgte Herr Lehrer
Jaffé aus Lorsch, der die Tugenden des Dahingeschiedenen, wie ich sie nur
teilweise angeführt, in ergreifenden Worten schilderte; es würde zu weit
führen, wenn ich alles einzeln wiedergeben wollte. Schließlich konnte es
sich der greife Vorstand der Lorscher Chawera
Herr Sinsheim aus Bierstadt, nicht versagen, seinem Freunde ein letztes
Lebewohl nachzurufen, indem er noch hervorhob, dass es dem Verblichenen
vergönnt gewesen, seine Kinder zu edlen Menschen heranwachsen zu sehen,
die es sich zur Pflicht gemacht, die Eltern aufs höchste zu ehren. Dem
anwesenden jüngsten Sohne, Herrn Prediger S. Abraham in Stuttgart, war es
nicht möglich, seinen großen Schmerz in Worte zu kleiden. Möge der Allgütige
der trauernden Witwe, die im wahren sinne des Wortes alle Eigenschaften
einer echten Eschet chajil
(wackeren Frau) besitzt und 44 Jahre lang mit dem selig Entschlafenen in
Liebe verbunden war, Trost wie auch den Kindern Kraft geben, den sie
betroffenen Verlust in Ergebung zu tragen. Ihm aber möge in den lichten Höhen
der Lohn zuteil werden, der alle Frommen und Edeln erwartet. Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zum Tod von Bella Lorch (1887)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Dezember 1887: "Lorsch
(Hessen) (hebräisch und deutsch:) 'Eine Frau, die erfüllt ist von Gottesfurcht,
verdient gerühmt zu werden.’ Einer solchen gottesfürchtigen Frau
sollen folgende Zeilen gewidmet sein. Am verflossenen 5.
Marcheschwan verstarb hier im Alter von 83 Jahren Frau Bella Lorch,
eine jener jüdischen Frauengestaltet, deren Charakter nur in jenem
herrlichen Liede des weisen Königs Salomon Eschet
Chajil seine volle Würdigung findet. Sie konnte mit Beruhigung auf
ihr zurückgelegtes hohes Alter zurückblicken, denn es war ein Leben voll
edlen Wirkens und frommer Strebsamkeit. Sie war die würdige Gattin ihres
vor ca. 14 Jahren verstorbenen Gemahls, Herrn Model Lorch – seligen
Andenkens, dessen Frömmigkeit und edle Gesinnungen noch heute in der
ganzen Umgegend gerühmt werden. Von geringen Anfängen zu hohem Wohlstand
sich in strenger Rechtlichkeit durch Fleiß und Ausdauer emporringend,
hatte sich dieses edle Paar nicht als Besitzer des irdischen Gutes,
sondern stets nur als die von Gott eingesetzten Verwalter desselben
betrachtet, und erfüllten sie als solche ihre Pflichten auf das
Gewissenhafteste; sie spendeten nicht nur bei jeder sich darbietenden
Gelegenheit mit vollen Händen, sondern auch ihr Haus war eine Zufluchtsstätte
für alle Armen und Bedrängten, denen sie wirksame Helfer in der Not
waren. All ihr tun war durchseelt vom Geiste der Religiosität und der
Gottesfurcht, wovon die Erziehung ihrer Kinder zu edel denkenden Menschen
und zu wahrhaft frommen Jehudim das beste Zeugnis ablegt. Zum Öfteren äußerte
die edle Greisin tränenden Auges ihre Freude darüber, dass ihr vom Allgütigen
vergönnt sei, sich von solchen Kindern umgeben zu sehen, die für Jüdischkeit
Herz und Sinn haben. Und wahrlich! Ihr Stolz und ihre Freude waren
vollkommen berechtigt. Seit einer Reihe von Jahren nehmen ihre Söhne den
Vorsitz im Vorstande der hiesigen Gemeinde ein, und ist nicht zum
Mindesten deren Wirken und Einfluss das Verdienst zuzuschreiben, dass in
hiesiger Gemeinde noch der Geist des alten unmodifizierten Judentums
herrscht und allem jüdisch-Religiösen das größte Interesse
entgegengebracht wird. – So wurde hier vor etwa 2 Jahren unter strenger
Wahrnehmung aller religionsgesetzlichen Anforderungen eine neue
komfortabel erbaute Synagoge eingeweiht, woran sich dann die Herstellung
aller anderen Gemeindeinstitutionen anreihte, Unternehmungen,
die sowohl von der Opferwilligkeit aller Gemeindemitglieder für
alles Religiöse, als auch von der unerschütterlichen Energie des
Vorstandes zeugen, dessen Vorsitz gegenwärtig Herr Simon Lorch, jüngster
Sohn der edeln Verstorbenen, inne hat. – An der Nahre der
Dahingeschiedenen hielt Herr Rabbiner Dr. Marx aus Darmstadt die
Trauerrede, in welcher er mit ergreifenden Worten die hohen Vorzüge der
Entschlafenen schilderte, deren tugendhaftes Leben des Anwesenden als
Beispiel empfehlend. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Dezember 1887: "Lorsch
(Hessen) (hebräisch und deutsch:) 'Eine Frau, die erfüllt ist von Gottesfurcht,
verdient gerühmt zu werden.’ Einer solchen gottesfürchtigen Frau
sollen folgende Zeilen gewidmet sein. Am verflossenen 5.
Marcheschwan verstarb hier im Alter von 83 Jahren Frau Bella Lorch,
eine jener jüdischen Frauengestaltet, deren Charakter nur in jenem
herrlichen Liede des weisen Königs Salomon Eschet
Chajil seine volle Würdigung findet. Sie konnte mit Beruhigung auf
ihr zurückgelegtes hohes Alter zurückblicken, denn es war ein Leben voll
edlen Wirkens und frommer Strebsamkeit. Sie war die würdige Gattin ihres
vor ca. 14 Jahren verstorbenen Gemahls, Herrn Model Lorch – seligen
Andenkens, dessen Frömmigkeit und edle Gesinnungen noch heute in der
ganzen Umgegend gerühmt werden. Von geringen Anfängen zu hohem Wohlstand
sich in strenger Rechtlichkeit durch Fleiß und Ausdauer emporringend,
hatte sich dieses edle Paar nicht als Besitzer des irdischen Gutes,
sondern stets nur als die von Gott eingesetzten Verwalter desselben
betrachtet, und erfüllten sie als solche ihre Pflichten auf das
Gewissenhafteste; sie spendeten nicht nur bei jeder sich darbietenden
Gelegenheit mit vollen Händen, sondern auch ihr Haus war eine Zufluchtsstätte
für alle Armen und Bedrängten, denen sie wirksame Helfer in der Not
waren. All ihr tun war durchseelt vom Geiste der Religiosität und der
Gottesfurcht, wovon die Erziehung ihrer Kinder zu edel denkenden Menschen
und zu wahrhaft frommen Jehudim das beste Zeugnis ablegt. Zum Öfteren äußerte
die edle Greisin tränenden Auges ihre Freude darüber, dass ihr vom Allgütigen
vergönnt sei, sich von solchen Kindern umgeben zu sehen, die für Jüdischkeit
Herz und Sinn haben. Und wahrlich! Ihr Stolz und ihre Freude waren
vollkommen berechtigt. Seit einer Reihe von Jahren nehmen ihre Söhne den
Vorsitz im Vorstande der hiesigen Gemeinde ein, und ist nicht zum
Mindesten deren Wirken und Einfluss das Verdienst zuzuschreiben, dass in
hiesiger Gemeinde noch der Geist des alten unmodifizierten Judentums
herrscht und allem jüdisch-Religiösen das größte Interesse
entgegengebracht wird. – So wurde hier vor etwa 2 Jahren unter strenger
Wahrnehmung aller religionsgesetzlichen Anforderungen eine neue
komfortabel erbaute Synagoge eingeweiht, woran sich dann die Herstellung
aller anderen Gemeindeinstitutionen anreihte, Unternehmungen,
die sowohl von der Opferwilligkeit aller Gemeindemitglieder für
alles Religiöse, als auch von der unerschütterlichen Energie des
Vorstandes zeugen, dessen Vorsitz gegenwärtig Herr Simon Lorch, jüngster
Sohn der edeln Verstorbenen, inne hat. – An der Nahre der
Dahingeschiedenen hielt Herr Rabbiner Dr. Marx aus Darmstadt die
Trauerrede, in welcher er mit ergreifenden Worten die hohen Vorzüge der
Entschlafenen schilderte, deren tugendhaftes Leben des Anwesenden als
Beispiel empfehlend. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zum Tod von Jette Abraham (1892)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1892: "Lorsch (Hessen). Am
Mittwoch, den 18. Mai wurde hier eine Frau zu Grabe geleitet, die es wohl
verdienst, dass ihr ein ehrendes Andenken auch in weiteren Kreisen bewahrt
werde. Frau Jette Abraham vereinigte in sich all jene Frauentugenden, wie
sie nur in dem herrlichen Liede Eschet
Chajil völlig gewürdigt werden. Ihre Lebensaufgabe scheint sie nur
in der Betätigung von Tora,
Gottesdienst und Wohltätigkeit erblickt zu haben. Denn in diesem
Sinne erzog sie ihre Kinder zu Frömmigkeit und Gottesfurcht, in diesem
Sinne pflegte sie fleißig den synagogalen und häuslichen Gottesdienst
und in demselben Sinne ließ sie, trotz ihrer bescheidenen Verhältnisse,
keine Gelegenheit vorübergehen, Gerechtigkeit und Gastfreundschaft
auszuüben. Ihr mildes gewinnendes Wesen zog ihr alle Herzen in Liebe und
Verehrung zu, wovon die allgemeine Beteiligung bei der Beerdigung das beste Zeugnis abgab. An der Bahre haben ihr
Schwiegersohn, Herr Lehrer Rohrheimer aus Biblis, ihr Sohn, Herr Prediger
S. Abraham aus Stuttgart, sowie Herr Lehrer Jaffé von hier der
allgemeinen Trauer beredten Ausdruck. Ihre Seele sei eingebunden in den
Bund des Lebens". Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1892: "Lorsch (Hessen). Am
Mittwoch, den 18. Mai wurde hier eine Frau zu Grabe geleitet, die es wohl
verdienst, dass ihr ein ehrendes Andenken auch in weiteren Kreisen bewahrt
werde. Frau Jette Abraham vereinigte in sich all jene Frauentugenden, wie
sie nur in dem herrlichen Liede Eschet
Chajil völlig gewürdigt werden. Ihre Lebensaufgabe scheint sie nur
in der Betätigung von Tora,
Gottesdienst und Wohltätigkeit erblickt zu haben. Denn in diesem
Sinne erzog sie ihre Kinder zu Frömmigkeit und Gottesfurcht, in diesem
Sinne pflegte sie fleißig den synagogalen und häuslichen Gottesdienst
und in demselben Sinne ließ sie, trotz ihrer bescheidenen Verhältnisse,
keine Gelegenheit vorübergehen, Gerechtigkeit und Gastfreundschaft
auszuüben. Ihr mildes gewinnendes Wesen zog ihr alle Herzen in Liebe und
Verehrung zu, wovon die allgemeine Beteiligung bei der Beerdigung das beste Zeugnis abgab. An der Bahre haben ihr
Schwiegersohn, Herr Lehrer Rohrheimer aus Biblis, ihr Sohn, Herr Prediger
S. Abraham aus Stuttgart, sowie Herr Lehrer Jaffé von hier der
allgemeinen Trauer beredten Ausdruck. Ihre Seele sei eingebunden in den
Bund des Lebens". |
Spätes Kinderglück für Lion Lorch
und Mina geb. Wolff (1903)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. September 1903: "Lorsch.
Das Haupt der israelitischen Gemeinde Lorsch hat ein merkwürdig
glückliches Ereignis zu verzeichnen, das die allgemeine Aufmerksamkeit
auf sich lenkt. Im Jahre 1878 nämlich verheiratete sich Herr Lion Lorch
mit Fräulein Mina Wolff. Sie lebten glücklich, und in Gottes Wegen
wandelnd, bewährten sie sich auch durch ihre edlen Taten und
segensreiches Wirken zu Gunsten der Gemeinde. Herr Lorch wurde auch
seinerzeit zum Gemeindevorsteher ausersehen. Nur Eins bedrückte sie, dass
sie kinderlos waren. Zum Glück segnete sie der liebe Gott zur silbernen
Hochzeitsfeier und Frau Mina Lorch geb. Wolff ist am Erew Rosch ha Schono
(sc. am Tag vor Neujahr) von einem Knäblein entbunden worden. Wir
wünschen ihnen hierzu unsern herzlichsten Masel tow." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. September 1903: "Lorsch.
Das Haupt der israelitischen Gemeinde Lorsch hat ein merkwürdig
glückliches Ereignis zu verzeichnen, das die allgemeine Aufmerksamkeit
auf sich lenkt. Im Jahre 1878 nämlich verheiratete sich Herr Lion Lorch
mit Fräulein Mina Wolff. Sie lebten glücklich, und in Gottes Wegen
wandelnd, bewährten sie sich auch durch ihre edlen Taten und
segensreiches Wirken zu Gunsten der Gemeinde. Herr Lorch wurde auch
seinerzeit zum Gemeindevorsteher ausersehen. Nur Eins bedrückte sie, dass
sie kinderlos waren. Zum Glück segnete sie der liebe Gott zur silbernen
Hochzeitsfeier und Frau Mina Lorch geb. Wolff ist am Erew Rosch ha Schono
(sc. am Tag vor Neujahr) von einem Knäblein entbunden worden. Wir
wünschen ihnen hierzu unsern herzlichsten Masel tow." |
| Anmerkung: der Junge ist am 21. September
(Tag vor Neujahr) geboren. |
Artikel zum Tod von Frau G. Wolff geb. Lorch (1904)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. November 1904: "Lorsch
(Hessen), 23. Oktober. Unter größter Beteiligung, ohne Unterschied der
Konfession, wurde heute der irdischen Hülle der seligen Frau G. Wolff Witwe
geb. Lorch von hier, das letzte Geleite gegeben. Von Nah und Fern waren Freunde
und Bekannte herbeigeeilt. Um der Entschlafenen die letzte Ehre zu erweisen,
deren sie sich als Eschet Chajal (sc. "tüchtige
Frau") in des Wortes ausgiebigster Bedeutung wohl verdient gemacht hatte. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. November 1904: "Lorsch
(Hessen), 23. Oktober. Unter größter Beteiligung, ohne Unterschied der
Konfession, wurde heute der irdischen Hülle der seligen Frau G. Wolff Witwe
geb. Lorch von hier, das letzte Geleite gegeben. Von Nah und Fern waren Freunde
und Bekannte herbeigeeilt. Um der Entschlafenen die letzte Ehre zu erweisen,
deren sie sich als Eschet Chajal (sc. "tüchtige
Frau") in des Wortes ausgiebigster Bedeutung wohl verdient gemacht hatte.
Wer die Verblichene näher kennen gelernt hatte, dem drängten sich bei dem
Gedanken an die edlen Eigenschaften der Dahingeschiedenen die Worte auf: "Eine
herrliche Zierde ist das Greisenalter, auf dem Wege der Gerechtigkeit wird es
erreicht".
Mit vollem Rechte findet dieser Satz unseres weisen Salomo auf unsere teure
Dahingeschiedene Anwendung. Reich an edlen Taten, begnadet mit einem liebevollen
Herzen, erreichte sie das Alter von 73 Jahren. Früh musste sie durch den
Verlust ihres Ehegatten, mit dem sie kaum zwei Jahre verbunden, das Leben von
seiner ernsten Seite kennen lernen. Doch als eine Frau gehören und erzogen in
echt rein-jüdischem Hause wusste sich die teure Entschlafene in ihrem seltenen
Gottvertrauen ihrem Geschicke hinzugeben. Ihre tugendhafte Führung, ihre große
Willensstärke und menschenfreundliches Entgegenkommen ließen sie gedeihen zum
Gliede einer edlen Menschenkette. War auch ihre geschäftliche Tätigkeit, die
sie mannesgleich vertrat, gar des Öfteren untermischt von manchem Tropfen
bitteren Wermuts, so vergaß sie doch nicht, ihren zwei geliebten Töchtern die
peinlich sorgfältigste Erziehung und in ihrem erhabenen Wohltätigkeitssinn
Notleidenden jeden Standes hilfeleistend Gutes angedeihen zu lassen. Ein
Familienleben, wie es die Dahingeschiedene führte, und dies noch in ihren
letzten Tagen ihren teuren Angehörigen gegenüber dokumentierte, kann nur als
musterhaft bezeichnet werden; unbeschreiblich war die Harmonie zwischen ihr und
ihrer Umgebung. Ihr Haus war gestützt und getragen von den drei Pfeilern, die
unsere Weisen nennen mit den Worten ämät
din weschalom (Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden), dies waren die Grundsätze,
die sich unsere liebe Unvergessliche zu eigen machte, und die ihr den großen
Ruf und das hohe Ansehen sicherten für alle Zeiten. Möge der Allmächtige
ihren Angehörigen Trost spenden. Ihre
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens".
|
Zum Tod von Leopold Oppenheimer (1909)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 6. August 1909: "Lorsch
(Bergstraße). Am Tischo-be-Aw starb unser Gemeindemitglied Herr Leopold
Oppenheimer in Bad Soden. Die Beerdigung fand auf dem großen
Friedhof in
Alsbach statt. Herr Lehrer Jaffé rühmte in kurzen, kernigen Worten die
Tugenden, besonders die Friedfertigkeit und und Fleiß des Heimgegangenen.
Der Verstorbene stammt aus Kleinhausen und war ein Bruder des Begründers
der Weltfirma Adler und Oppenheimer in Straßburg, für die er bis zu
seinem Lebensende eifrig gearbeitet hat." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 6. August 1909: "Lorsch
(Bergstraße). Am Tischo-be-Aw starb unser Gemeindemitglied Herr Leopold
Oppenheimer in Bad Soden. Die Beerdigung fand auf dem großen
Friedhof in
Alsbach statt. Herr Lehrer Jaffé rühmte in kurzen, kernigen Worten die
Tugenden, besonders die Friedfertigkeit und und Fleiß des Heimgegangenen.
Der Verstorbene stammt aus Kleinhausen und war ein Bruder des Begründers
der Weltfirma Adler und Oppenheimer in Straßburg, für die er bis zu
seinem Lebensende eifrig gearbeitet hat." |
| |
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. August 1909: "Lorsch (Bergstraße),
29. Juli. Mit tiefem Schmerze erfüllte uns am 9.
Aw die Trauerbotschaft von dem Ableben unseres teuren
Gemeindemitgliedes, Herrn Leopold Oppenheimer aus
Bad Soden. Wohl kam es für
uns nicht überraschend, und doch war unsere Gemeinde in die größte
Aufregung, in die tiefste Trauer versetzt worden, als die Todeskunde hier eintraf. Am Erew Schabbat Kodesch
Nachamu war die Beerdigung auf dem großen
Friedhof in Alsbach, wo
sich Juden und Christen versammelt hatten, um ihrem treuren Bruder und
Freunde das letzte Geleite zu geben. Es blieb kein Auge tränenleer, als
Herr Lehrer Jaffé in kurzen, kernigen Worten den 55jährigen Lebensweg
des Heimgegangenen ausmalte. Wie der Erzvater konnte er die Jahre seines
Lebens als kurz und leidvoll schildern. 'Liebe die Arbeit' war sein
Losungswort. Hatten ihn die Werktage 'hinaus ins feindliche Leben’ gerufen, so verbrachte er den Schabbat im
Kreise der Familie und der Gemeinde. Da vergaß er nicht seinen Gott; er
nahm seinen Segen mit in die Alltagsbeschäftigung hierüber; über seinem
Hause ruhte der Schein, den die beglückenden Mizwot (Weisungen) ausstrahlen. Möge Gott den trauernden
Hinterbliebenen und der Gemeinde die Fülle seiner Trostes angedeihen
lassen. Seine Seele sei eingebunden
in den Bund des Lebens."
Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. August 1909: "Lorsch (Bergstraße),
29. Juli. Mit tiefem Schmerze erfüllte uns am 9.
Aw die Trauerbotschaft von dem Ableben unseres teuren
Gemeindemitgliedes, Herrn Leopold Oppenheimer aus
Bad Soden. Wohl kam es für
uns nicht überraschend, und doch war unsere Gemeinde in die größte
Aufregung, in die tiefste Trauer versetzt worden, als die Todeskunde hier eintraf. Am Erew Schabbat Kodesch
Nachamu war die Beerdigung auf dem großen
Friedhof in Alsbach, wo
sich Juden und Christen versammelt hatten, um ihrem treuren Bruder und
Freunde das letzte Geleite zu geben. Es blieb kein Auge tränenleer, als
Herr Lehrer Jaffé in kurzen, kernigen Worten den 55jährigen Lebensweg
des Heimgegangenen ausmalte. Wie der Erzvater konnte er die Jahre seines
Lebens als kurz und leidvoll schildern. 'Liebe die Arbeit' war sein
Losungswort. Hatten ihn die Werktage 'hinaus ins feindliche Leben’ gerufen, so verbrachte er den Schabbat im
Kreise der Familie und der Gemeinde. Da vergaß er nicht seinen Gott; er
nahm seinen Segen mit in die Alltagsbeschäftigung hierüber; über seinem
Hause ruhte der Schein, den die beglückenden Mizwot (Weisungen) ausstrahlen. Möge Gott den trauernden
Hinterbliebenen und der Gemeinde die Fülle seiner Trostes angedeihen
lassen. Seine Seele sei eingebunden
in den Bund des Lebens." |
Todesanzeige für Minna Lorch geb. Oppenheimer (1924)
 Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 21. Februar 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 21. Februar 1924:
"Nach längerem Krankenlager verschied heute nacht meine
innigstgeliebte Gattin, die treubesorgte Mutter ihrer Kinder, Frau
Minna Lorch geb. Oppenheimer
im 46. Lebensjahre. Lorsch (Hessen), den 5. Februar 1924 / 30.
Schewat 5684.
Jakob Lorch II Alfred Lorch Paula Kahn geb.
Lorch Irma Lorch Leo Lorch Karl Kahn."
|
Zum Tod von Mina Lorch (1928)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. August 1928:
"Lorsch, 15. August (1928). Am Schabbat Nachamu (Schabbat
nach dem 9. Av, das war 4. August 1928), an ihrem 71.
Geburtstag, wurde Frau Mina Lorch, die Gattin des vor ungefähr anderthalb
Jahrzehnten ihr im Tode vorangegangenen langjährigen früheren Gemeindevorstehers,
Simon Lorch, in die ewige Heimat, zum Schabbat und Ruhetag für das
ewige Leben abberufen. Wenn zu den von König Salomon hervorgehobenen
Eigenschaften und Vorzüge einer wackeren Frau, auch (hebräisch und
deutsch) 'Auf sie vertraut ihres Mannes Herz' mitzählt, so
kann das Lebensbild der Verklärten, ihre hervorstechenden Tugenden und
Wesensart, nicht besser als mit diesen vier Wörtchen gezeichnet werden.
Mit der ihr angeborenen vornehmen Gesinnung, echtjüdischer Denkungsart
und Herzensgüte, gepaart mit inniger, tiefwurzelnder Frömmigkeit alten
Schlages, die ihr höchstes Lebensziel war, übernahm sie das heilige
Vermächtnis ihres Mannes; übte ganz in seinem Geiste in ihrem trauten
Heim, im Kreise ihrer Gemeinde, wie auch auswärts in stiller und
schlichter Weise Wohltätigkeit; linderte, ohne dass es jemand ahnte, so
manches Leid und trocknete viele Tränen. Das große Trauergefolge von Nah
und Fern legte beredtes Zeugnis von der Beliebtheit und Wertschätzung,
deren sich die Verblichene bei allen Schichten der Bevölkerung erfreute.
Herr Rabbiner Dr. Merzbach - Darmstadt und Herr
Jacob Teßler - Nürnberg,
letzterer als früherer Lehrer der Gemeinde, sprachen an der Bahre tief
ergreifende Worte und entwarfen ein treues Bild der Heimgegangenen. Ihre
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. August 1928:
"Lorsch, 15. August (1928). Am Schabbat Nachamu (Schabbat
nach dem 9. Av, das war 4. August 1928), an ihrem 71.
Geburtstag, wurde Frau Mina Lorch, die Gattin des vor ungefähr anderthalb
Jahrzehnten ihr im Tode vorangegangenen langjährigen früheren Gemeindevorstehers,
Simon Lorch, in die ewige Heimat, zum Schabbat und Ruhetag für das
ewige Leben abberufen. Wenn zu den von König Salomon hervorgehobenen
Eigenschaften und Vorzüge einer wackeren Frau, auch (hebräisch und
deutsch) 'Auf sie vertraut ihres Mannes Herz' mitzählt, so
kann das Lebensbild der Verklärten, ihre hervorstechenden Tugenden und
Wesensart, nicht besser als mit diesen vier Wörtchen gezeichnet werden.
Mit der ihr angeborenen vornehmen Gesinnung, echtjüdischer Denkungsart
und Herzensgüte, gepaart mit inniger, tiefwurzelnder Frömmigkeit alten
Schlages, die ihr höchstes Lebensziel war, übernahm sie das heilige
Vermächtnis ihres Mannes; übte ganz in seinem Geiste in ihrem trauten
Heim, im Kreise ihrer Gemeinde, wie auch auswärts in stiller und
schlichter Weise Wohltätigkeit; linderte, ohne dass es jemand ahnte, so
manches Leid und trocknete viele Tränen. Das große Trauergefolge von Nah
und Fern legte beredtes Zeugnis von der Beliebtheit und Wertschätzung,
deren sich die Verblichene bei allen Schichten der Bevölkerung erfreute.
Herr Rabbiner Dr. Merzbach - Darmstadt und Herr
Jacob Teßler - Nürnberg,
letzterer als früherer Lehrer der Gemeinde, sprachen an der Bahre tief
ergreifende Worte und entwarfen ein treues Bild der Heimgegangenen. Ihre
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zum Tod von Sanitätsrat Dr. Meier Mainzer (geb. 1867 in Lorsch, 1909 bis 1929
praktischer Arzt in Alzey) (1929)
 Artikel
im "Mitteilungsblatt des Landesverbandes der israelitischen
Religionsgemeinden in Hessen" Nr. 4 1929 S. 5: "Alzey. In der Nacht
vom 25. auf den 26. März starb im städtischen Krankenhaus zu Mainz, wo er
von längerem, schwerem Leiden Heilung suchte, Herr Sanitätsrat Dr. Meier
Mainzer. Der Verewigte war im Jahre 1867 zu Lorsch geboren und
wirkte seit zwanzig Jahren in Alzey
als praktischer Arzt sowie als Reichsbahnarzt. Er hatte sich durch seine
ärztliche Tüchtigkeit und seine Hilfsbereitschaft Armen wie Reichen
gegenüber in den weitesten Kreisen der Bevölkerung Sympathie und
Hochschätzung erworben und hatte sich, ausgestattet mit reichem, jüdischem
Wissen und Empfinden, durch langjährige Mitarbeit im Vorstande der
israelitischen Religionsgemeinde Alzey auch
um seine Glaubensgemeinschaft verdient gemacht. Bei der Beerdigung, welche
am 28. März auf dem Mainzer israelitischen
Friedhof erfolgte, gab die israelitische Religionsgemeinde Alzey und der
ärztliche Kreisverein Alzey der Trauer um
den Verlust des Heimgerufenen Ausdruck. Weite Kreise beklagen mit der
Gattin, den Kindern und Geschwistern des Verewigten den frühen Heimgang
dieses Mannes." Artikel
im "Mitteilungsblatt des Landesverbandes der israelitischen
Religionsgemeinden in Hessen" Nr. 4 1929 S. 5: "Alzey. In der Nacht
vom 25. auf den 26. März starb im städtischen Krankenhaus zu Mainz, wo er
von längerem, schwerem Leiden Heilung suchte, Herr Sanitätsrat Dr. Meier
Mainzer. Der Verewigte war im Jahre 1867 zu Lorsch geboren und
wirkte seit zwanzig Jahren in Alzey
als praktischer Arzt sowie als Reichsbahnarzt. Er hatte sich durch seine
ärztliche Tüchtigkeit und seine Hilfsbereitschaft Armen wie Reichen
gegenüber in den weitesten Kreisen der Bevölkerung Sympathie und
Hochschätzung erworben und hatte sich, ausgestattet mit reichem, jüdischem
Wissen und Empfinden, durch langjährige Mitarbeit im Vorstande der
israelitischen Religionsgemeinde Alzey auch
um seine Glaubensgemeinschaft verdient gemacht. Bei der Beerdigung, welche
am 28. März auf dem Mainzer israelitischen
Friedhof erfolgte, gab die israelitische Religionsgemeinde Alzey und der
ärztliche Kreisverein Alzey der Trauer um
den Verlust des Heimgerufenen Ausdruck. Weite Kreise beklagen mit der
Gattin, den Kindern und Geschwistern des Verewigten den frühen Heimgang
dieses Mannes." |
80. Geburtstag von Abraham Abraham (1934)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1934:
"Lorsch (Hessen), 20. August (1934). Am Schabbat Paraschat Reeh
beging Herr Abraham Abraham in seltener körperlicher und geistiger
Frische, geehrt von der jüdischen und nichtjüdischen Bevölkerung, im
Kreise seiner Familie, den 80. Geburtstag. Herr Abraham übt noch heute -
ehrenamtlich - die Funktion des 'Bal Kaure' (Toravorlesers) aus, und hält alsabbatlich den Gemeinde-Schiur (Lernstunde) ab. Zur Feier des Tages
prangte die Synagoge sowie der Platz des Gefeierten in festlichem
Blumenschmuck. Nach dem Einheben (der Torarollen) brachte der Vorstand der
Gemeinde, Herr Alfred Lorch, in warmen Worten den besonderen Dank der
Gemeinde zum Ausdruck und überreichte in deren Auftrag ein Geschenk. Herr
Rabbiner Dr. Merzbach, Darmstadt, gratulierte in einem herzlichen Schreiben
von der Urlaubsreise, unter Verleihung des Ehrentitels 'Chower'.
Möge es Herrn Abraham vergönnt sein, diese heiligen Funktionen in
gleicher Jugendfrische und Gesundheit bis 120 Jahre
auszuüben." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1934:
"Lorsch (Hessen), 20. August (1934). Am Schabbat Paraschat Reeh
beging Herr Abraham Abraham in seltener körperlicher und geistiger
Frische, geehrt von der jüdischen und nichtjüdischen Bevölkerung, im
Kreise seiner Familie, den 80. Geburtstag. Herr Abraham übt noch heute -
ehrenamtlich - die Funktion des 'Bal Kaure' (Toravorlesers) aus, und hält alsabbatlich den Gemeinde-Schiur (Lernstunde) ab. Zur Feier des Tages
prangte die Synagoge sowie der Platz des Gefeierten in festlichem
Blumenschmuck. Nach dem Einheben (der Torarollen) brachte der Vorstand der
Gemeinde, Herr Alfred Lorch, in warmen Worten den besonderen Dank der
Gemeinde zum Ausdruck und überreichte in deren Auftrag ein Geschenk. Herr
Rabbiner Dr. Merzbach, Darmstadt, gratulierte in einem herzlichen Schreiben
von der Urlaubsreise, unter Verleihung des Ehrentitels 'Chower'.
Möge es Herrn Abraham vergönnt sein, diese heiligen Funktionen in
gleicher Jugendfrische und Gesundheit bis 120 Jahre
auszuüben." |
Schuhwarenhändler Sieghart Mann wird verurteilt (1933)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1933: "Mainz.
Der jüdische Schuhwarenhändler Sieghart Mann aus Lorsch bei
Bensheim wurde in Worms festgenommen, weil er sich als Nationalsozialist
ausgab und einem Geschäftsmann das unter seinem Rockkragen befestigte
Hakenkreuz zeigte. Mann wurde das Parteiabzeichen abgenommen, er selbst
wurde einige Zeit nach Osthofen gebracht (sc. KZ). Nun wurde er wegen
unberechtigten Tragens des Abzeichens von der Ferienstrafkammer Mainz zu
einem Monat Gefängnis verurteilt." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1933: "Mainz.
Der jüdische Schuhwarenhändler Sieghart Mann aus Lorsch bei
Bensheim wurde in Worms festgenommen, weil er sich als Nationalsozialist
ausgab und einem Geschäftsmann das unter seinem Rockkragen befestigte
Hakenkreuz zeigte. Mann wurde das Parteiabzeichen abgenommen, er selbst
wurde einige Zeit nach Osthofen gebracht (sc. KZ). Nun wurde er wegen
unberechtigten Tragens des Abzeichens von der Ferienstrafkammer Mainz zu
einem Monat Gefängnis verurteilt." |
75. Geburtstag von Johanna Mainzer
geb. Mayer (1938)
Anmerkung: Johanna Mainzer ist am 5. März 1943 im
Ghetto Theresienstadt umgekommen.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. April 1938: "Lorsch,
1. April (1938). Frau Johanna Mainzer geb. Mayer, Lorsch, feierte am Schabbat,
den 26. März, in seltener geistiger körperlicher Rüstigkeit ihren 75.
Geburtstag. (Alles Gute) bis 120 Jahre." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. April 1938: "Lorsch,
1. April (1938). Frau Johanna Mainzer geb. Mayer, Lorsch, feierte am Schabbat,
den 26. März, in seltener geistiger körperlicher Rüstigkeit ihren 75.
Geburtstag. (Alles Gute) bis 120 Jahre." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige der Tuch-, Wollen- und Bettwarenhandlung von Löb
Abraham (1856)
(erhalten von Hans-Peter Traumann)
 Anzeige
im "Intelligenzblatt für den Kreis Lindenfeld Nr. 29 vom 18. Juli
1856": "(Lorsch). Bettfedern. Anzeige
im "Intelligenzblatt für den Kreis Lindenfeld Nr. 29 vom 18. Juli
1856": "(Lorsch). Bettfedern.
Der Unterzeichnete hält fortwährend Lager von neuen weißen
Bettfedern und Pflaumen, sowie Bett-Barchent und Zwillich in schöner
Auswahl zu den billigsten Preisen. Auch bringt derselbe zugleich sein
Lager von anderen Ellenwaren, als Tuch, Wollen- und Seidenstoffe,
Druckkattune etc. im empfehlende Erinnerung.
Lorsch, den 27. Juni 1856. Löb Abraham." |
Verlobungsanzeige von Minna Wertheimer und Heinrich Guthof (1923)
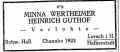 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1923: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1923:
"Gott sei gepriesen.
Minna Wertheimer - Heinrich Guthof. Verlobte.
Schwäbisch Hall - Chanukka 1923 - Lorsch in Hessen /
Halberstadt." |
Anzeige zum Tod von Minna Lorch geb. Oppenheimer (1924)
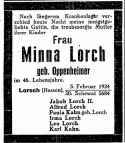 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Februar 1924: "Nach längerem
Krankenlager verschied heute Nacht meine innigstgeliebte Gattin, die
treubesorgte Mutter ihrer Kinder Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Februar 1924: "Nach längerem
Krankenlager verschied heute Nacht meine innigstgeliebte Gattin, die
treubesorgte Mutter ihrer Kinder
Frau Minna Lorch geb. Oppenheimer
im 46.
Lebensjahre.
Lorsch (Hessen). 5. Februar 1924 = 30. Schewat 5684.
Jakob
Lorch II. Alfred Lorch Paula
Kahn geb. Lorch Irma Lorch
Leo Lorch Karl Kahn". |
Todesanzeige für Jacob Lorch (1928)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. August 1928:
"Heute nacht ist unser innigstgeliebter treu sorgender Vater, unser
lieber Großvater, Schwiegervater, Bruder, Schwager und Onkel Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. August 1928:
"Heute nacht ist unser innigstgeliebter treu sorgender Vater, unser
lieber Großvater, Schwiegervater, Bruder, Schwager und Onkel
Herr Jacob
Lorch
im 59. Lebensjahre von uns geschieden.
Lorsch (Hessen) Michelstadt/Odenwald, New York, den 15. Aw 5688 - 1.
August 1928.
Alfred Lorch und Frau Fränze geb. Oppenheimer. Karl Kahn und Frau Paula
geb. Lorch. Julius Strauß und Frau Irma geb. Lorch. Leo
Lorch." |
Zur Geschichte des Betsaales / der Synagoge
Bereits im 18. Jahrhundert war ein Betsaal beziehungsweise eine Synagoge vorhanden.
1725 hatte die Lorscher Judenschaft "drei Gulden für das Synagogicum"
abzuliefern und nach Mainz abzuführen. Offenbar versammelten sich damals die
Lorscher Juden in einem Betsaal zum Gottesdienst und hatten dafür zu bezahlen.
Der damals benutzte Betsaal könnte noch derselbe gewesen sein wie der Betsaal um
1784, als dieser sich im Obergeschoss des Hauses Nr. 205 (in der früheren
Obergasse, heute Bahnhofstraße 10) der jüdischen Familie Mainzer befand.
1794 gab es Unruhe zwischen den in Lorsch und Kleinhausen (heute
Einhausen) lebenden jüdischen Familien. Einige Familien war von jenseits des
Rheins nach Kleinhausen gezogen, worauf die hier lebenden Familien nicht mehr
nach Lorsch zum Gottesdienst kommen wollte. In Kleinhausen sollte nun eine
eigene Synagoge sein. Die Lorscher Juden protestierten erfolglos; ein
Separatgottesdienst in einem Betsaal in Kleinhausen wurde genehmigt und für
einige Monate abgehalten. Nachdem die zugezogenen Familien Kleinhausen 1795
wieder verlassen hatten, gab es nur noch vier jüdische Familien in Kleinhausen,
die - um eigene Gottesdienste feiern zu können - auswärtige jüdische Männer
dazu einladen mussten. Nun protestierten die Lorscher Juden erneut, worauf das
Erzbischöfliche Generalvikariat die Kleinhauser Juden anwies, wie früher zum
Gottesdienst nach Lorsch zu gehen.
Eine
neue Synagoge wurde auf dem Grundstück der bisherigen Synagoge 1885 erbaut. Sie hatte 82 Männer- und 36
Frauenplätze. Ein Bericht zur Einweihung konnte noch nicht gefunden werden.
Neben
den gewöhnlichen Gottesdiensten an Werktagen, Schabbat und den Feiertagen gab
es auch besondere Ereignisse, zu denen die Gemeinde in der Synagoge zusammenkam.
So war mit den Hauptversammlungen des Brautausstattungsvereines (s.o.) ein
Gottesdienst in der Synagoge verbunden. worüber ein Bericht
in der Zeitschrift "Frankfurter Israelitisches Familienblatt" vom 28. Januar
1910 vorliegt:
 "Lorsch (Hessen). Am Erew
Rausch-Chaudesch Sch’wat (am Vorabend zum Beginn des Monats Schwat) wurde
die alljährliche Hauptversammlung des hiesigen Brautausstattungsvereins (Chewroh
kaddischoh 'Hachnoßas Kalloh’) abgehalten. Der seitherige Vorstand,
dessen Vorsitzender der Gemeindevorsteher Herr Simson Lorch ist, wurde durch
Zuruf wieder gewählt und wegen des alljährlichen Vereinsessens der
Jahresbeitrag von 10 Mark auf 12 Mark erhöht. Nach Schluss der Versammlung fand
in der Synagoge zu Lorsch der übliche Jaum-Kippur-koton-Gottesdienst
statt, in dem das Vereinsmitglied, Herr Lehrer B. Rohrheimer - Biblis, das Amt des
Vorbeters versah. Anschließend an den Gottesdienst fand in den Räumlichkeiten
des Vereinsvorsitzenden ein Festessen statt, bei dem sich die Mitglieder von nah
und fern für einige Stunden geselligen Zusammenseins gern ein Stelldichein
gaben. Herr Lehrer Jaffé von Lorsch gab diesem Bewusstsein gemeinsamer Arbeit
Ausdruck in seinen Worten, mit denen er an die Gründung der ersten jüdischen Chewroh
erinnerte – an die Geburt des jüdischen Volkes in der Erlösungsnacht. Lehrer
Rohrheimer knüpfte seine Worte an das Tefillingebot an und stellte so das
Judentum als eine Religion der Tat hin, die zur Ausübung sittlicher
Handlungsweise, Mitzwaus (Gebote), verpflichtet und dadurch das Glauben und das
Aufstellen von Glaubenslehren stark in den Hintergrund stellt. Wie das
Gesamtjudentum im Großen, so hat unsere 'Kippe’ im Kleinen die 'sittliche
Tat’, zum Vereinszweck – und in ihrer Tätigkeit schon viele Saaten des
Segens und der Liebe ausgestreut. Herr Dr. Mainzer – Alzey pries den Erew
Rausch-Chaudesch Sch’wat als das Einigungsband der 'Jungen’ und der 'Alten’. Im Jahre 1912
beabsichtigt der Verein sein hundertjähriges Bestehen in einem größeren
Stiftungsfest zu feiern. Wie im letzten Jahre, so wurden auch in diesem namhafte
Beiträge von Seiten aller Mitglieder zu diesem Zweck gezeichnet. Herr Lazarus
Oppenheimer aus Lingolsheim spendete für die Firma Adler und Oppenheimer in
Straßburg 100 Mark. Das Tischgebet wurde nun versteigert und dann trennte man
sich mit dem Wunsche eines fröhlichen Wiedersehens bei der
'Jahrhundertfeier’. "Lorsch (Hessen). Am Erew
Rausch-Chaudesch Sch’wat (am Vorabend zum Beginn des Monats Schwat) wurde
die alljährliche Hauptversammlung des hiesigen Brautausstattungsvereins (Chewroh
kaddischoh 'Hachnoßas Kalloh’) abgehalten. Der seitherige Vorstand,
dessen Vorsitzender der Gemeindevorsteher Herr Simson Lorch ist, wurde durch
Zuruf wieder gewählt und wegen des alljährlichen Vereinsessens der
Jahresbeitrag von 10 Mark auf 12 Mark erhöht. Nach Schluss der Versammlung fand
in der Synagoge zu Lorsch der übliche Jaum-Kippur-koton-Gottesdienst
statt, in dem das Vereinsmitglied, Herr Lehrer B. Rohrheimer - Biblis, das Amt des
Vorbeters versah. Anschließend an den Gottesdienst fand in den Räumlichkeiten
des Vereinsvorsitzenden ein Festessen statt, bei dem sich die Mitglieder von nah
und fern für einige Stunden geselligen Zusammenseins gern ein Stelldichein
gaben. Herr Lehrer Jaffé von Lorsch gab diesem Bewusstsein gemeinsamer Arbeit
Ausdruck in seinen Worten, mit denen er an die Gründung der ersten jüdischen Chewroh
erinnerte – an die Geburt des jüdischen Volkes in der Erlösungsnacht. Lehrer
Rohrheimer knüpfte seine Worte an das Tefillingebot an und stellte so das
Judentum als eine Religion der Tat hin, die zur Ausübung sittlicher
Handlungsweise, Mitzwaus (Gebote), verpflichtet und dadurch das Glauben und das
Aufstellen von Glaubenslehren stark in den Hintergrund stellt. Wie das
Gesamtjudentum im Großen, so hat unsere 'Kippe’ im Kleinen die 'sittliche
Tat’, zum Vereinszweck – und in ihrer Tätigkeit schon viele Saaten des
Segens und der Liebe ausgestreut. Herr Dr. Mainzer – Alzey pries den Erew
Rausch-Chaudesch Sch’wat als das Einigungsband der 'Jungen’ und der 'Alten’. Im Jahre 1912
beabsichtigt der Verein sein hundertjähriges Bestehen in einem größeren
Stiftungsfest zu feiern. Wie im letzten Jahre, so wurden auch in diesem namhafte
Beiträge von Seiten aller Mitglieder zu diesem Zweck gezeichnet. Herr Lazarus
Oppenheimer aus Lingolsheim spendete für die Firma Adler und Oppenheimer in
Straßburg 100 Mark. Das Tischgebet wurde nun versteigert und dann trennte man
sich mit dem Wunsche eines fröhlichen Wiedersehens bei der
'Jahrhundertfeier’. |
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge von
SA-Leuten unter engagierter Beteilung von Bürgern aus Lorsch zunächst geschändet und verwüstet, anschließend in Brand gesteckt.
Die jüdische Gemeinde musste die Kosten für den Abbruch der Ruine
übernehmen. Das Grundstück wurde nach 1945 mit einem Wohn- und
Geschäftshaus neu überbaut. Unter Verwendung von Steinen der Lorscher
Synagoge wurde 1949 die Friedhofskapelle der Gemeinde erbaut.
Im Beisein des Landesrabbiners Prof. Dr. Ernst Roth wurde im
November 1982 in der Lorscher Schulstraße eine Mahntafel mit folgendem
Text enthüllt: "Dem Andenken der jüdischen Bürger unserer Stadt - Zur
Erinnerung an die Synagoge der jüdischen Gemeinde Lorsch, die am 10. November
1938 zerstört wurde." Eine Anbringung einer Gedenktafel am Haus auf dem
Grundstück der ehemaligen Synagoge war damals nicht möglich, da der Besitzer
aus Angst vor Sachbeschädigungen keine Tafel an diesem Gebäude sehen wollten.
Inzwischen befindet sich auch an diesem Haus eine Gedenktafel. Im
September 2024 wurde im Gehweg vor der Bahnhofstraße 10 eine sogenannte "Stolperschwelle"
zur Erinnerung an die früheren Synagogen in Lorsch verlegt (siehe Presseartikel
unten).
Adresse/Standort der Synagoge: Bahnhofstraße 10
Fotos
(Quelle: Foto obere Zeile rechts: aus Arnsberg, Bilder S.
135)
Historische Ansichten
der Synagoge |
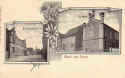 |
 |
| |
Historische Ansichtskarte mit
Ansicht der Synagoge |
Fassade der Synagoge mit
den Gebotstafeln |
| |
|
|
| |
 |
 |
| |
Historische
Ansichtskarte von Lorsch - versandt 1900 - mit freundlicher
Genehmigung
von Frantisek Bányai übernommen aus der Website www.judaica.cz |
| |
|
|
Der Standort der
ehemaligen Synagoge im Sommer 2011
(Fotos: Michael Ohmsen) |
 |
 |
| |
Standort der
Synagoge mit Inschriftentafel: "Ehemalige Synagoge. Hier stand
die Synagoge, die 1885 für die 96 Mitglieder der jüdischen Gemeinde
Lorsch erbaut wurde. Im Zuge der nationalsozialistischen Judenverfolgung
mussten zahlreiche jüdische Mitbürger ihre Heimat verlassen. In der
'Reichskristallnacht' am 9. November 1938 wurde die Lorscher Synagoge
durch Brandstiftung zerstört. 1942 waren noch 14 Juden in Lorsch
verblieben. Sie wurden am 10./15. August und am 10./15. September in die
Konzentrationslager Auschwitz und Theresienstadt
deportiert." |
| |
|
|
Der Standort der
ehemaligen Synagoge im Juni 2021
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 16.6.2021) |
 |
 |
| |
|
|
| |
|
|
Gedenkstätte in der
Schulstraße
(eingeweiht 1982)
(Fotos: Michael Ohmsen von 2011) |
 |
 |
| |
Die Inschrift der
Gedenktafel: "Dem Andenken der jüdischen Bürger unserer Stadt.
Zur
Erinnerung an die Synagoge der jüdischen Gemeinde Lorsch, die am
10.
November 1938 zerstört wurde." |
| |
|
|
Gedenkstätte in der
Schulstraße im Juni 2021
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 16.6.2021) |


|

 |
| |
|
|
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
Gedenken an die Zerstörung der Synagoge
(Quelle: Website
der Gemeinde Lorsch)
 GEDENKEN.
Eigentlich kommt die Gedenkstätte für die Lorscher Opfer des Dritten Reiches,
vorwiegend jüdische Mitbürger, nur einmal im Jahr so richtig zur Geltung, am
9. November, der "Reichskristallnacht", wenn Bürgermeister und
Stadtverordnetenvorsteher, unser Bild, im Namen der Gemeinde ein Blumengesteck
niederlegen. ml/Bild: ml GEDENKEN.
Eigentlich kommt die Gedenkstätte für die Lorscher Opfer des Dritten Reiches,
vorwiegend jüdische Mitbürger, nur einmal im Jahr so richtig zur Geltung, am
9. November, der "Reichskristallnacht", wenn Bürgermeister und
Stadtverordnetenvorsteher, unser Bild, im Namen der Gemeinde ein Blumengesteck
niederlegen. ml/Bild: ml
MAHNUNG. Trotz regnerischen Wetters trafen sich am Abend des 9. November
über 30 Menschen an der Gedenkstätte für die Opfer des Naziterrors in der
Schulstraße. Bürgermeister Klaus Jäger, links, erinnerte in einer Rede an die
Gräueltaten dieser Zeit und mahnte den Kampf gegen Wiederholungen dieser Art
an. ml/Bild: ml
Lorsch. Ein Blumengesteck legten Bürgermeister Klaus Jäger und
Stadtverordnetenvorsteher Harald Horlebein als Vertreter der Lorscher Bürgerschaft
am Abend des 9. November an der Gedenkstätte für die Lorscher Opfer des
Naziterrors in der Schulstraße nieder. Zahlreiche Bürger hatten sich trotz
schlechten Wetters dort eingefunden, um am Datum der "Reichskristallnacht",
als auch die Lorscher Synagoge in der Bahnhofstraße niedergebrannt wurde, der
ermordeten Mitbürger zu gedenken. Es sei ein Gedenken an die Menschen, die
unter den Pogromen der Nazis hätten leiden müssen, die ihre Gesundheit und ihr
Leben verloren hätten, sagte Bürgermeister Klaus Jäger in einer kurzen
Ansprache. Die Vorkommnisse in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 seien
schlimme und beschämende Ereignisse in der deutschen Geschichte gewesen, mit
denen eine Entwicklung eingeleitet worden sei, die man als schweren Schlag gegen
Anstand, Zivilisation und Humanität verstehen müsse. Man dürfe nicht
vergessen, dürfe das Erinnern aber auch nicht zu einem Ritual verkommen lassen,
mahnte das Stadtoberhaupt. Ohne Erinnerung bestehe die Gefahr, "dass wir in
unserem Staat, unserer Gesellschaft und unserer Gemeinschaft die Orientierung
und Identität verlieren". Man müsse dies den folgenden Generationen
weitergeben, um der Opfer und sich selbst gerecht zu werden. Erinnern bedeute
Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, den Entwürdigten Gerechtigkeit
angedeihen zu lassen. Man müsse sich aber auch der Taten und der Täter
erinnern, müsse sich fragen, wie Mitmenschen dazu gebracht werden konnten,
andere Menschen auszusondern und zu vernichten? Erinnern müsse Trauer über
Leid und Verlust zum Ausdruck bringen aber auch zur Wachsamkeit und zum Kampf
gegen Wiederholung motivieren. Erinnern müsse so gestaltet sein, dass jüngere
Generationen ihre Verantwortung für Demokratie, Freiheit und Menschenwürde
verinnerlichen könnten. |
 Man
müsse mit jungen Menschen den Dialog suchen, damit sie die richtigen Schlüsse
ziehen könnten. In Anspielung auf wieder aufkommende recht braune Tendenzen in
der Bundesrepublik forderte Klaus Jäger auf, sich vor Augen zu führen, dass
immer dann, "wenn irgendwo unterschieden, klassifiziert und selektiert
wird, niemand sicher sein kann, dass er nicht eines Tages selbst zu den
Ausgesonderten gehört". Es liege in unserer Verantwortung, gegen solche
Entwicklungen anzugehen. "Es darf nicht zugelassen werden, dass die
Wertigkeit eines Menschen abhängig gemacht wird von seiner Rasse oder Herkunft,
von Überzeugung oder Glauben, von Gesundheit oder Leistungsfähigkeit. Es sei
aber auch wichtig, beim Erinnern an die Geschichte des Dritten Reiches auch
diejenigen nicht zu vergessen, die Widerstand geleistet hätten, militärisch
oder im Alltag. Diese Aktionen seien ein Beleg dafür, dass das Gewissen
funktionieren könne, dass der Einzelne nicht ganz machtlos sei. Über 4000
Deutsche würden heute in der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem als
Jugendretter geehrt. Sie hätten Vorbildfunktion für unsere Jugend. Abschließend
zitierte Klaus Jäger den früheren Bundespräsidenten Roman Herzog zu dieser
Art Heldentum. "Heldentum dieser Art wird wohl nie zu einer alltäglichen
ethischen Verhaltensweise werden. Niemand kann es von anderen einfordern. Erst
recht – auch das sage ich vor allem den Jungen – darf sich niemand im
Nachhinein einbilden, er selbst wäre im Ernstfall ein Held gewesen. Umso mehr
haben wir alle die tägliche Pflicht, für Verhältnisse in unserem Land zu
sorgen, in dem niemand ein Held sein muss, um ein guter, um ein anständiger
Mensch zu sein". Man
müsse mit jungen Menschen den Dialog suchen, damit sie die richtigen Schlüsse
ziehen könnten. In Anspielung auf wieder aufkommende recht braune Tendenzen in
der Bundesrepublik forderte Klaus Jäger auf, sich vor Augen zu führen, dass
immer dann, "wenn irgendwo unterschieden, klassifiziert und selektiert
wird, niemand sicher sein kann, dass er nicht eines Tages selbst zu den
Ausgesonderten gehört". Es liege in unserer Verantwortung, gegen solche
Entwicklungen anzugehen. "Es darf nicht zugelassen werden, dass die
Wertigkeit eines Menschen abhängig gemacht wird von seiner Rasse oder Herkunft,
von Überzeugung oder Glauben, von Gesundheit oder Leistungsfähigkeit. Es sei
aber auch wichtig, beim Erinnern an die Geschichte des Dritten Reiches auch
diejenigen nicht zu vergessen, die Widerstand geleistet hätten, militärisch
oder im Alltag. Diese Aktionen seien ein Beleg dafür, dass das Gewissen
funktionieren könne, dass der Einzelne nicht ganz machtlos sei. Über 4000
Deutsche würden heute in der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem als
Jugendretter geehrt. Sie hätten Vorbildfunktion für unsere Jugend. Abschließend
zitierte Klaus Jäger den früheren Bundespräsidenten Roman Herzog zu dieser
Art Heldentum. "Heldentum dieser Art wird wohl nie zu einer alltäglichen
ethischen Verhaltensweise werden. Niemand kann es von anderen einfordern. Erst
recht – auch das sage ich vor allem den Jungen – darf sich niemand im
Nachhinein einbilden, er selbst wäre im Ernstfall ein Held gewesen. Umso mehr
haben wir alle die tägliche Pflicht, für Verhältnisse in unserem Land zu
sorgen, in dem niemand ein Held sein muss, um ein guter, um ein anständiger
Mensch zu sein". |
| |
| April 2012:
Presseartikel zum Ende der jüdischen Geschichte
in Lorsch |
Artikel von Thilo Figaj in "Echo
online" vom 25. April 2012: "Ende einer jüdischen Gemeinde
in Südhessen. Geschichte - In Lorsch pulsierte wie in vielen anderen
Orten der Region das jüdische Leben - Im Jahr 1942 wurde es von den
Nationalsozialisten systematisch ausgelöscht..."
Link
zum Artikel |
Das o.g. Artikel darf mit
Genehmigung des Verfassers hier wiedergegeben werden: "Ende einer jüdischen Gemeinde in Südhessen
Geschichte – In Lorsch pulsierte wie in vielen anderen Orten der Region das jüdische Leben – Im Jahr 1942 wurde es von den Nationalsozialisten systematisch ausgelöscht.
Für Lorsch gelte, so eine 2009 veröffentlichte Untersuchung 'zur Klärung des
Nationalsozialismus', dass der Ort 'mit diesen Zahlen weder besonders aktiv noch
passiv' gewesen sei. Die weitgehend namenlose statistische Erkenntnis lässt der Aufsatz als abschließendes Urteil im Raum stehen und stößt damit bei mindestens denjenigen auf Unbehagen, die es aus Überlieferungen – oder aus eigenem Erleben – besser wissen.
Die Erforschung der jüngeren Geschichte erfolgte immer nur bis zu jenem Punkte, an dem erklärt werden muss, wie eine ehedem blühende jüdische Gemeinde spurlos aus der Mitte des Ortes verschwand, samt ihrer Synagoge, ihrer Menschen und Besitztümer. Allein eine Schülerzeitung traute sich 1985 weiter vor. Ihr verdankt Lorsch die ersten veröffentlichten Zeugnisse Lorscher Überlebender der Shoa. Dagegen sind die 38 Namen von Lorschern vergessen, die der Shoa zum Opfer fielen.
Dabei kann noch heute gut nachvollzogen werden, wie auch in Lorsch über die Staatspolizeistellen, die Landräte und Bürgermeister den Deportationsbefehlen Adolf Eichmanns, Leiter des
'Judenreferats' im Berliner 'Reichssicherheitshauptamt', Folge geleistet wurde. Die Meldekarten der Deportierten weisen verzogen nach
'unbekannt' aus, so wie es Eichmann verlangte.
Aber da war ja noch diese Datumsspalte, die konnte in einer Behörde nicht leer bleiben. Und so setzte ein treuer Diener des Dritten Reiches seine ganze Fantasie ein und kritzelte irgendetwas und bei jedem etwas anderes hinein; nur nicht die Wahrheit.
Seither wurden diese Daten nie mehr korrigiert. Sie stehen auf einer billigen Plastiktafel in der Bahnhofstraße Lorsch. Dass sie unplausibel waren, störte offenbar niemanden, auch nicht, dass den Opfern damit das letzte Stückchen Identität genommen wurde: den Hinweis auf den Zeitpunkt ihres Todes. An dieser Stelle wird Verdrängen sichtbar, und nur genaues Nachschauen wirkt hier als Gegenmittel.
1923 kommt in der Lorscher Bahnhofstraße 14 Ruth Carola Kahn zur Welt. Das Mädchen ist die erste von vier Töchtern des jüdischen Viehhändlers Karl Kahn, der aus
Sickenhofen bei Babenhausen stammt. Dessen Frau Paula, Jahrgang 1902, stammt aus der Familie Lorch, die es in der Klosterstadt zu einigem Wohlstand und Ansehen gebracht hatte. Lorscher Juden hatten wesentlich früher als in der Umgebung nach 1821 das Ortsbürgerrecht beantragt und auch erhalten. Simon Krakauer zum Beispiel: Mit seinem in Lorsch geborenen Sohn Julius und dessen Bruder David begründet er 1869 die Pianofabrik
'Krakauer Brothers' in New York.
Die Lorchs bleiben im Großherzogtum. Ihnen gehören um 1890 weite Areale der Ortsmitte, die Hofreiten der Bahnhofstraße gehen durch bis zur Kirchstraße. Dieser Umstand erlaubt es der jüdischen Gemeinde, eine stattliche Synagoge in der Bahnhofstraße zu errichten. Um sie herum pulsiert das jüdische Leben.
Auf Ruth folgen weitere Töchter: Miriam (1925), Liesel (1926) und schließlich Suse (1929). Nachdem Paulas Vater Jakob 1928 gestorben ist, kommt ihr Bruder Alfred mit seiner Familie aus Bensheim zurück in seine Heimatstadt und übernimmt als Oberhaupt der Familie den Holzhandel und wenig später auch den Vorsitz der jüdischen Gemeinde. Mit ihm und seiner Frau Franziska kommen Sohn Martin (1927) und die gerade geborene Margarethe (1931) an den Stammsitz der Familie. Im Sommer 1929 wird Ruth Kahn eingeschult. Auf dem Klassenfoto sehen wir ein ernstes, ausnehmend hübsches Mädchen. Die Kinder der Lorscher Juden gehen selbstverständlich gemeinsam mit ihren Altersgenossen zur Schule.
Nur wenige Jahre später ist alles anders: Der frisch ins Amt gehievte Wormser Polizeidirektor Heinz Jost, ein Lorscher, lässt Missliebige ins KZ Osthofen bringen. Am 26. August 1933 überschreibt die Frankfurter Zeitung den Polizeibericht aus Worms:
'Letzte Warnung an die Juden'. Eine größere Anzahl aus Worms und Umgebung sei im KZ Osthofen in Haft genommen, vermeldet Josts Staatspolizeistelle.
Aus dieser Zeit berichtet nach dem Krieg die Witwe des Lorscher Juden Siegbert Mann, die Katholikin Betty Mann, von der ersten Verhaftung ihres Mannes: Der Lederhändler ist nach Worms gefahren, aber nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Statt seiner stehen plötzlich mehrere SA- oder SS-Männer in der Lorscher Bahnhofstraße 18. Sie bedrängen die schwangere Frau und pressen ihr drei Mark als Fahrgeld für die Rückfahrt nach Worms ab. Sie sucht Beistand bei Nachbarn.
Die wissen im Gegensatz zu ihr von Josts Stellung und raten ihr, selbst nach Worms zu fahren und ihr Glück direkt beim Polizeichef zu suchen, was sie auch tapfer tut. Siegbert Mann kommt ein paar Tage nach der Intervention seiner Frau wieder frei, nur um wenig später wieder für einen Monat in Haft zu verschwinden. Angeblich hat er sich als Parteigenosse ausgegeben.
Paula Kahn gibt 1934 ihr kleines Manufakturwarengeschäft in Lorsch auf und zieht mit Mann und den vier Töchtern nach Babenhausen. Karl Kahn hofft, hier den Lebenserwerb für seine Familie auf solidere Füße zu stellen, als er das in Lorsch kann. Er besitzt in Babenhausen eine Hofreite und zwei Morgen Land. Der Viehhandel ist eine Domäne der hessischen Juden, und in Lorsch war die Konkurrenz der Juden untereinander groß. Jetzt wird es noch schwerer. Auch die Bauern sind in der Zwickmühle. Der Umgang mit den Juden ist verpönt, aber ausgerechnet sie haben den Zugang zu den Schlachthöfen. Geschäfte werden nur noch heimlich gemacht. Die Gestapo Darmstadt fordert am 22. April 1936 alle Kreis- und Polizeiämter zur Denunziation Beteiligter auf. Schließlich werden die Juden, teilweise mit Gewalt, aus den Schlachthöfen gejagt. Kahn ist mutig, er wehrt sich. 1937 klagt er gegen den Viehwirtschaftsverband Hessen Nassau.
Die Kinder der Lorscher Juden dürfen keine Regelschulen mehr besuchen. Sie fahren täglich nach Worms, drangsaliert von Hitlerjungen, oder sie besuchen die jüdischen Schulen in Darmstadt und Frankfurt. Margarethe und Martin Lorch wohnen dort bei Verwandten und Bekannten. Aus Lorsch müssen ihre Eltern sie abmelden und bei Beginn der Ferien wieder anmelden.
Das Leben wird unerträglich. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 setzen auch in Lorsch die Plünderungen und Brandstiftungen ein. Die Synagoge wird zerstört, die schönen Buntsandsteinquader behält man – und baut nach dem Krieg eine Friedhofskapelle damit.
Als sich der Rauchvorhang hebt, sind mindestens drei Menschen verschwunden: der 84 Jahre alte Abraham Abraham und sein Sohn Siegmund, sie kommen später aus Dachau wieder zurück. Aron Lorch aber bleibt für immer verschollen.
'9.11.38 verzogen nach Frankfurt' steht im Melderegister. Eine Chiffre für die Verschleppung ins Gestapogefängnis. Oder soll man glauben, dass ein Siebenundsechzigjähriger seine sechs Jahre jüngeren Frau zurücklässt, ausgerechnet in der Pogromnacht einfach so
'verzieht' und nicht die kleinste Spur hinterlässt?
Alfred Lorch, seine Frau Franziska (Fränzi) und die Kinder ziehen in Arons Wohnung, zur Tante Bertha, in die Bahnhofstraße 13. Ihr eigenes Anwesen mit der Holzhandlung in der Nummer 17 würden sie verkaufen und dann auswandern. Das Ziel: Chile. Auch Schwester Paula und Schwager Karl, dem mutigen Viehhändler, war in Babenhausen schwer zugesetzt worden. Zwei Wochen nach den Pogromen stellen sie Antrag auf Ausreise nach Südafrika. Sie sind spät dran, aber Paula ist schwanger geworden. Ihr fünftes Kind stirbt nach der Geburt.
Ihr Eigentum wird unter Preis verkauft. Im Juni 1939 endlich geben die Behörden das Einverständnis. Doch dann kommt der Krieg, und kein deutsches Schiff fährt mehr nach Südafrika. Die Kahns bekommen ihre gepackten Überseekisten aus Bremen zurück, das Landratsamt behält die Pässe. Den Verwandten in Lorsch ergeht es ähnlich. Franziska ist auch noch einmal schwanger geworden und bringt am 21. Januar 1940 ein Mädchen zur Welt. Elia Lorch ist der letzte jüdische Mensch, der in Lorsch geboren wird.
Die Geschwister Alfred und Paula sitzen mit ihren Familien in der Falle. Das zweite Opfer aus dem Familienverband wird Ruth Kahn. Die Studentin hat sich 1939 aus Babenhausen abgemeldet; sie gerät im Oktober 1940 in eine von Eichmann persönlich koordinierte Aktion der Zwangsverschleppung von Juden aus Baden in das Lager Gurs in Frankreich, am Rande der Pyrenäen. Nach zwei Jahren der Agonie wird die Neunzehnjährige im September 1942 von dort nach Auschwitz deportiert. Da ist ihre Familie bereits tot.
Am 21. August 1941 weist der Bergsträßer Landrat die Bürgermeister im Kreis an, die
'umzusiedelnden Juden zunächst zur Räumung ihrer bisherigen Wohnungen zu
veranlassen.' Ein konkreter Hinweis auf die bevorstehenden Deportationen. Spätestens jetzt weiß man auch in der Provinz Bescheid. Neben der Familie Lorch, den drei Kindern und Tante Bertha leben noch elf Juden in Lorsch. Sie müssen nun den Judenstern tragen, wenn sie überhaupt aus dem Haus dürfen. Der Briefträger versorgt sie heimlich mit Lebensmitteln.
Mit weißer Farbe pinseln die Juden ihre Namen, ihre Kennnummern und ihre Deportationsorte auf die Gepäckstücke, die sie tragen können. Alles ist bis ins Kleinste organisiert, jeder Deportationszug, den Eichmann bei der Reichsbahn bestellt, fasst 1000 Personen. Der
'Gesellschaftssonderzug' mit der Nummer DA 14 fährt nach Sonderfahrplan am 25. März 1942 ab Mainz über Darmstadt in den Bezirk Lublin im sogenannten Generalgouvernement (Polen). Hier ist das Durchgangslager Piaski.
Aus diesem ländlichen Getto werden zur gleichen Zeit die polnischen Bewohner in die Vernichtung nach Belzec und Majdanek getrieben, um Platz zu machen für die
'Reichsjuden'. Einige glauben immer noch an Pionierarbeit im Osten und schleppen ihr Werkzeug mit. Die Lorchs aus Lorsch treffen die Kahns aus Babenhausen im Zug wieder.
Am 27. März kommen die Familien Kahn und Lorch und vier weitere Lorscher Juden in Lublin an. Wie lange sie möglicherweise in Gettos oder Arbeitslagern noch leben, ist nicht bekannt. Post aus Piaski darf in Hessen nicht zugestellt werden.
Das Ende kommt dann meistens in den Vernichtungsanstalten der Region, in Belzec oder Majdanek. Bis heute weiß man es nur vom 15 Jahre alten Martin Lorch. Eine Todesmeldung nennt den 4. August 1942 und Majdanek. In Lorsch zurückgeblieben sind nun noch sieben Menschen, für die ein
'Alterstransport' nach Theresienstadt vorgesehen ist. Am 27. September 1942 sind auch sie verschwunden – mit dem letzten großen Transport aus Südhessen, DA 520, wieder aus Mainz und Darmstadt.
Weil er in Mischehe lebt und kleine Kinder hat, war der Jude Siegbert Mann
ausdrücklich von Eichmanns Deportationsbefehl ausgenommen. Doch auch er
verschwindet an einem unbekannten Tag aus Lorsch. Von Mann gibt es nicht
einmal den 'verzogen'-Vermerk. Alles, was seine Frau später erhält, ist die Todesmeldung. Siegbert Manns Witwe dient in einem der Nürnberger Prozesse gegen deutsche Kriegsverbrecher ausgerechnet der Verteidigung von Heinz Jost. Für das falsche Bild vom guten Nazi muss noch einmal die Geschichte mit Siegbert Mann herhalten, den Jost 1933 kurz hatte laufen lassen." |
Personen,
die in obigem
Artikel genannt werden
(Fotos abgebildet mit
Genehmigung des
Verfassers; die Fotos befinden
sich im Stadtarchiv Lorsch*
bzw. im Staatsarchiv
Darmstadt) |
 |
 |
 |
 |
| Karl Kahn |
Martin Lorch* |
Ruth Carola Kahn |
Siegbert Mann* |
| |
|
Juli 2015:
Erste Verlegung von
"Stolpersteinen" in Lorsch |
| Vgl. Liste im Wikipedia-Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Lorsch
|
| |
|
April 2016:
Über die Aktivitäten zur
Erinnerungsarbeit im Lorscher Heimat- und Kulturverein
|
Artikel von Hans-Jürgen Brunnengräber in "Echo-online.de"
vom April 2016: "Die Wirkung reicht bis New York
LORSCH - Von der Verlegung der ersten Stolpersteine für ehemalige
jüdische Mitbürger über öffentliche Veranstaltungen zum 70. Jahrestag des
Kriegsendes bis zu den Bürgerprojekten Tabak, Kräuter- und
Pfingstrosengarten reichten die Aktivitäten des Lorscher Heimat- und
Kulturvereins 2015. Dafür dankte der Vorsitzender Reinhard Diehl den
Mitgliedern. 70 von ihnen waren zur Jahresversammlung in den Karolinger Hof
gekommen. In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte Diehl an die
Stolperstein-Aktion, mit welcher der Kölner Bildhauer Gunter Demnig an die
Opfer der NS-Zeit erinnerte. Dazu waren Nachfahren ehemaliger jüdischer
Bürger aus den USA nach Lorsch gekommen. Der Verein organisierte eine
öffentliche Veranstaltung sowie ein Besuchsprogramm. Daraus habe sich ein
freundschaftliches Verhältnis entwickelt, sagte Diehl. Vor wenigen Wochen
weilte Thilo Figaj, Projektleiter 'Jüdisches Leben in Lorsch' des Vereins
zum Gegenbesuch in den Vereinigten Staaten. Er hielt Vorträge in jüdischen
Gemeindezentren in Pasadena und New York. Für 2017 plant die Arbeitsgruppe
eine Ausstellung über Repressalien deutscher Finanzbehörden gegenüber Juden
in der Zeit des Nationalsozialismus im Museumszentrum...
NEUE HOMEPAGE. Der Lorscher Heimat- und Kulturverein wurde 1926
gegründet. Seine Mitglieder fühlen sich der Kloster- und der Stadtgeschichte
verpflichtet, aber auch den vielen kleinen Geschichten in und um Lorsch.
Über seine Aktivitäten berichtet der Verein auch auf seiner neuen Homepage:
www.kulturverein-lorsch.de..."
Link zum Artikel |
| |
|
November 2016:
Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht 1938 |
Pressemitteilung der Stadt Lorsch vom 5.
November 2020: "Lorsch: Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht am 9.
November
Lorsch – 'Mag es auch manchen schon weit weg erscheinen: Wir wollen und
müssen lebendig halten, was mit den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
während der Nazi-Diktatur auch in unserer Stadt geschah. Ihre Namen, ihre
Geschichten wollen wir lebendig, ihr Schicksal soll uns wachsam halten.' Mit
diesen Worten lädt Bürgermeister Christian Schönung die Bevölkerung ein, am
diesjährigen Pogrom-Gedenken teilzunehmen. Wie stets am 9. November, findet
auch am nächsten Mittwoch um 18 Uhr eine Gedenkveranstaltung statt. Sie
beginnt am Mahnmal für die ehemaligen Lorscherinnen und Lorscher jüdischen
Glaubens in der Schulstraße /Ecke Nibelungenstraße. Neben Vertreterinnen und
Vertretern der Stadt nimmt auch der Jugendrat an der Veranstaltung teil.
Schon seit einigen Jahren versucht die Lorscher Stadtverwaltung,
insbesondere mit Hilfe von Thilo Figaj vom Heimat- und Kulturverein,
anlässlich dieses Tages den Teilnehmenden das jüdische Lorsch näher zu
bringen. Wer waren die Opfer? Wo wohnten sie? Welchen Berufen gingen sie
nach? Welche Stellung hatten sie im damaligen Dorf? 'Wir wollen – über der
Trauer und Betroffenheit anlässlich der Nazi-Verbrechen an der jüdischen
Bevölkerung – einen möglichst persönlichen Bezug zu den einzelnen Personen
und deren Schicksalen herstellen, die hinter den aufgelisteten Namen
stehen', heißt es deshalb von Veranstalterseite. In den vergangenen Jahren
hatte man deshalb etwa gemeinsam die Süßkindgasse, die Stiftstraße 17 oder
die Orte der ersten Stolperstein-Verlegungen, ebenfalls in der Schulstraße,
besucht. Am nächsten Freitag führt der Weg vom Mahnmal in die
Nibelungenstraße 19, zum Gelände der ehemaligen Cigarrenfabrik Herzberger
und Mainzer, später Henkes & Co. Dort wird einmal mehr Thilo Figaj die
Geschichte der jüdischen Fabrikantenfamilie erzählen. Ihr Weggang aus Lorsch
war nicht durch die Nationalsozialisten verursacht. Die Spur ihrer in Lorsch
geborenen Tochter Lore jedoch verliert sich in der mörderischen Zeit des
Dritten Reiches. 'Wir haben uns in diesem Jahr für diese Geschichte
entschieden', so Gabi Dewald vom KULTour-Amt. 'Uns geht es nicht nur darum,
die Erinnerung an die Ermordeten und Vertriebenen aufrecht zu erhalten.
Sondern auch darum, der heutigen Lorscher Bevölkerung eine Vorstellung davon
zu geben, wie die aus unserer Mitte verschwundenen Jüdinnen und Juden das
Gesicht und das Leben in unserer Stadt geprägt haben. Vieles im heutigen
Lorsch wäre ohne die soziale, die Arbeitsleistung oder auch ohne die
Investitionen der Juden nicht da. Es gilt, die Bezüge zum Heute, zu den
heute hier Lebenden, zu schaffen. Je länger die Nazi-Zeit zurückliegt, desto
wichtiger ist diese lebendige Verbindung in die Vergangenheit, wenn wir sie
nicht vergessen wollen.'
Infobox: Die Gedenkfeier anlässlich der Reichspogromnacht 1938 beginnt am
Mittwoch, den 9. November um 18 Uhr am jüdischen Mahnmal in der
Schulstraße/Ecke Nibelungenstraße." |
| |
|
März 2017:
Lorscher Bürger und die
Pogromnacht 1938 |
Artikel von Christiane Knatz in der "Bürstädter
Zeitung" vom 13. März 2017: "Pogromnacht 1938: Thilo Figaj schildert
Lorscher Verstrickungen.
LORSCH - Vier Jahre nach Ende des NS-Regimes schrieb Lorschs
Bürgermeister Georg Werner, von den Lorscher Juden und ihrem Ende wisse man
so gut wie nichts. 'Das ist der Auftakt zur Unterdrückung der Geschichte',
sagte Thilo Figaj. Das definitive Ende ist die Forschungsarbeit des
Unternehmers und Lokalhistorikers. In einem trotz Frühlingswetter sehr gut
besuchten Vortrag schilderte er im Detail die Vorgänge der sogenannten
Reichspogromnacht, deren korrektes Datum der 10. November 1938 ist. Was
Werner und viele Zeitzeugen nicht gehört und gesehen haben wollen, lässt
sich ganz gut rekonstruieren aus Akten und vereinzelten mündlichen
Berichten. Auf Spekulationen verzichtet der mit viel Applaus bedachte
Referent, auch auf die Nennung all der vielen, die schuldig geworden waren:
am 10. November und in der Zeit darum. 'Ich nenne nur die Haupttäter.'
Bürger aus Lorsch brannten die Synagoge nieder. Das genügte zur
Untermauerung einer Kernthese. Das Unglück kam nicht allein in Form
auswärtiger SA-Banden über Lorsch, von denen die SA-Brigade Starkenburg in
allen Abhandlungen als Alleintäter behandelt wird. Nein, es waren Lorscher,
welche die Synagoge niederbrannten, später die Reste niederrissen (das hatte
niemand höheren Orts angeordnet) und die jüdischen Mitbürger quälten und
beraubten. Dem SA-Trupp aus der Nachbarschaft folgte willig ein eigener,
befehligt vom SA-Standortführer Karl Jost und Truppführer Franz Blust.
Staatsmacht wird zum Staatsterroristen. Wie andernorts handelten sie
planvoll. 'Aus dem Spritzenhaus wurden Äxte und Beile geholt', hielt ein
Zeuge fest. Wie praktisch: Einen Schlüssel zum Feuerwehrgerätehaus im
Rathaus-Anbau hatte Josts Bruder Helmut von der Apotheke nebenan, das hatte
er selbst in Büchern nach dem Krieg festgehalten. Ab fünf Uhr lief auch in
Lorsch innerhalb weniger Stunden das ab, was zentral befohlen worden war,
aber lokal mit Eifer umgesetzt wurde: Zerstörung, später Enteignung unter
tätiger Mithilfe des Lorscher Notars Karl Selzer (Figaj: 'Er hat die
Bergstraße entjudet'), Inhaftierung im Rathaus, Verschleppung in die
Konzentrationslager Dachau und Sachsenhausen, wohl auch öffentliche
Demütigungen. 'Niemand soll sagen: So was hat’s bei uns nicht gegeben',
mahnte der Fachmann. Erst als die jüdischen Männer weggesperrt waren, griff
der plündernde Mob die verbliebenen Juden an. 'So feige waren die', sagte
Figaj. Und noch immer war der selbstgemachte Schrecken nicht zu Ende. Am
Beispiel einer couragierten Lorscher Jüdin, die mit Erfolg Forderungen des
Finanzamts mit Verweis auf den organisierten Raub abwehrte, wurde die
Geschichte eines Orts-Gendarms erzählt, der drei Tage nach dem Pogrom den
Lorscher Juden als Räuber gegenübertrat. Auch nach den letzten
Habseligkeiten griff die Staatsmacht, die zum Staatsterroristen verkommen
war. Karl Jost wurde nach dem Krieg wegen Landfriedensbruch verurteilt,
sonst schufen Gerichte im Lorscher Fall so gut wie keine Gerechtigkeit.
Historiografisch standen bis vor Kurzem ein paar Andeutungen in
Lorsch-Büchern, zwei Schülerprojekte der Siemens-Schule und ein Artikel der
Südhessischen Post von 1991 recht alleine da. Thilo Figaj appellierte an die
eher spärlich vertretenen Lorscher Politiker, bei der 1949 gebauten
Friedhofskapelle das Lorscher Schweigen beispielhaft zu durchbrechen: Es
solle am Gebäude einen Hinweis darauf geben, dass es in der Ära Georg Werner
aus Steinen der Synagoge errichtet wurde."
Link zum Artikel |
| |
| April 2017:
Rundgang zu den "Lorscher Gräbern" im
jüdischen Friedhof Alsbach |
 Artikel
im "SüdhessenMorgen" vom 26. April 2017: "Legalisierter
Raub: Thilo Figaj erzählt am 30. April von Lorscher Gräbern in Alsbach. Rundgang
über den Judenfriedhof..." Artikel
im "SüdhessenMorgen" vom 26. April 2017: "Legalisierter
Raub: Thilo Figaj erzählt am 30. April von Lorscher Gräbern in Alsbach. Rundgang
über den Judenfriedhof..."
Link
zum Artikel |
| |
|
Oktober 2018:
Weitere Verlegung von
"Stolpersteinen" in Lorsch |
Artikel von Nina Schmerzing im "Bergsträßer
Anzeiger" vom 29. Oktober 2018: "Lorsch. Mahnmal In der Kirch- und in der
Bahnhofstraße Gedenktafeln verlegt / Elternhaus von Claude Abraham und der
Familie Marx. Sieben Stolpersteine erinnern an Schicksale Lorscher Juden
Lorsch. Als Knirps von sieben Jahren wurde Kurt Abraham von der SA
aus seinem Elternhaus in der Lorscher Kirchstraße getrieben. Direkt
gegenüber brannte bereits die Synagoge. Von der dramatischen Flucht des
kleinen Jungen nach Frankreich, von der Ermordung der Mutter in Auschwitz
und den vielen Angehörigen der Familie, die der Holocaust auslöschte,
berichtete am Samstag Thilo Figaj. Anlass war die Verlegung von
Stolpersteinen. Die kleinen Pflastersteine, versehen mit Bronzetafeln, auf
denen die Namen der früheren jüdischen Bewohner eingraviert sind, erinnern
an das Schicksal der Menschen, die ihr Zuhause nicht freiwillig verließen,
und an die Gräuel der NS-Zeit. Sieben Steine ließen Heimat- und Kulturverein
in Zusammenarbeit mit der Stadt Lorsch zum Gedenken an ehemalige Mitbürger
in der Kirch- und in der Bahnhofstraße verlegen. Zu jedem Gedenkstein
erzählte Figaj, herausragender Kenner der regionalen jüdischen Geschichte,
die von ihm recherchierten Biografien.
Nachfahren aus Tel Aviv angereist. Unter den zahlreichen Teilnehmern,
die die Stolperstein-Aktion des Kölner Künstlers Gunter Demnig begleiteten,
befanden sich auch Nachfahren der einstigen Hausbewohner. Eine Großnichte
war aus Tel Aviv angereist, ihre Cousine aus Berlin. Sie bedankten sich,
sichtlich bewegt, mit einem Kaddisch-Gebet, vorgetragen in hebräischer
Sprache. Kurt Abraham, der in Frankreich den Vornamen Claude annahm und
Professor wurde, ließ aus Los Angeles Grüße übermitteln. Die weite Reise
wollte der 2001 von der Stadt Lorsch mit dem Ehrenring ausgezeichnete fast
87-Jährige nicht mehr auf sich nehmen. Er bat aber darum, ihm Fotos und
Berichte zuzusenden. Diesem Wunsch kamen die Organisatoren gerne nach. An
der Adresse Kirchstraße 12 lebte die Familie Abraham seit 1853. Figaj
erzählte von dem Kaufhaus und der Auswanderer-Agentur, die die Abrahams dort
betrieben. Er schilderte Alltagssorgen, verlas einen Brief, in dem sich die
Familie 1911 beim Bürgermeister in höflicher Form über andauernde
Hochwasserschäden beschwerte und charakterisierte Claudes Großvater Abraham
mit dem Hinweis auf eine Kandidatur 1920 auf der Liste der Vereinigten
Volkspartei als 'politisch engagierten' Menschen. Die Abrahams hatten einen
ausgezeichneten Ruf in Lorsch, dennoch wurden sie so vernichtend wie keine
zweite Lorscher Familie von den Pogromen der Nazis getroffen. Von den sechs
Kindern Abraham Abrahams kamen drei mitsamt ihren Familien zu Tode. Geschäft
und Wohnung in der Kirchstraße wurden im November 1938 verwüstet und
geplündert. Nichts erinnerte dort seitdem an dieses grausame Kapitel der
Geschichte. Die 'Stolpersteine' rufen es nun ins Bewusstsein. Gisela Steines
vom Heimat- und Kulturverein legte weiße Rosen mit Trauerflor an den
Gedenksteinen für Abraham Abraham, dessen Sohn Sigmund mit Ehefrau Johanna
und deren Sohn Claude Abraham nieder.
Doppelte Deportation. Eine lange Tradition als jüdisches
Geschäftshaus hat auch die Bahnhofstraße 33. Dort wurden am Samstag drei
Stolpersteine verlegt, für Lina Schnauzer, Mathilde und Simon Marx. Thilo
Figaj informierte über das Martyrium von Lina Schnauzer, das er angesichts
ihrer doppelten Deportation – erst Theresienstadt, dann Auschwitz, wo sie
ermordet wurde – als 'besonders tragisch' herausstellte. Er erläuterte, wie
Lina, die in Lorsch geboren und dort auch ihren aus Galizien stammenden
Ehemann geheiratet hatte, bei der Rückkehr in ihre Heimatstadt als
'staatenlos' geführt wurde. Er berichtete, wie Nachbarn ihr helfen wollten,
einen neuen Pass zu beantragen, aber denunziert und bestraft wurden und wie
sich ihre Schwägerin Mathilde 1940 um ein Visum für England bemühte –
vergeblich. Nur Simon Marx glückte, nachdem er zunächst nach Buchenwald
verbracht wurde, die Ausreise. Er gelangte in die USA. Nachfahren der
Familie, die nach dem Krieg im Rahmen eines Wiedergutmachungsantrags
wenigstens auf einige Erinnerungsstücke hofften, gingen leer aus, berichtete
Figaj: 'Der Hausrat war im Ort vor den Häusern versteigert worden.'
Link zum Artikel |
Vgl. Artikel von Christopher Frank in "echo-online.de"
vom 16. Oktober 2018: "Lorscher Unternehmer-Familien Abraham und Marx
wird mit sieben neuen Stolpersteinen gedacht
Der Kölner Künstler Gunter Demnig verlegt am 27. Oktober sieben weitere
Stolpersteine in der Klosterstadt.
LORSCH - Bislang erinnern 19 Stolpersteine an fünf Standorten an
ehemalige Lorscher Mitbürger, die in der Zeit des Nationalsozialismus
verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben
wurden. Am 27. Oktober kommen laut Mitteilung des Heimat- und Kulturvereins
Lorsch sieben Gedenksteine hinzu, weitere sollen im nächsten Jahr an der
Bahnhofstraße folgen..."
Link zum Artikel |
| |
|
April 2019:
Bericht zur Erinnerungsarbeit in
2018 |
Artikel von Norbert Weinbach im "Bergsträßer
Anzeiger" vom 5. April 2019 (nur auszugsweise zitiert): "Lorsch.
Heimat- und Kulturverein - Berichte zeugen von zahlreichen Aktivitäten im
vergangenen Jahr / Zwölf neue Stolpersteine im August. Neue Exponate im
Tabakmuseum
Lorsch. Die Neuwahlen des Vorstands standen im Mittelpunkt der
Jahreshauptversammlung des Heimat- und Kulturvereins Lorsch (HuK) im
Nibelungensaal des alten Rathauses...
Thilo Figaj berichtete, dass 2018 sieben neue Stolpersteine zum Gedenken an
ehemalige jüdische Bürger verlegt wurden. In diesem Jahr sollen am 8.
August zwölf weitere Steine folgen. Damit steige die Gesamtzahl in Lorsch
auf 38. Das sei ausreichend, um zum Jahresende eine gedruckte
Stolperstein-Informationsschrift herauszugeben. Im Jahr 2021 sollen 17
weitere Stolpersteine verlegt werden. Jüdische Mitbürger seien zur
Verlegung angereist aus Berlin und Israel. Figaj berichtete von der
Gedenkstunde 80 Jahre Novemberpogrom und gab einen Hinweis, dass der
Westermann-Verlag ein Schulbuch herausgegeben habe zum Thema 'Holocaust'.
Darin werde auch ausführlich über die Ereignisse im Jahr 1938 in Lorsch
berichtet."
Link zum Artikel |
| |
|
August 2019:
Vierte Verlegung von
"Stolpersteinen" in Lorsch |
Artikel im Mannheimer Morgen vom 9. August
2019: "Stolpersteine erinnern an jüdische Mitbürger in Lorsch.
Lorsch. Weitere zwölf Stolpersteine hat der Kölner Künstler Gunter
Demnig gestern in Lorsch verlegt. Die kleinen Pflastersteine mit
aufgesetzter Bronzetafel erinnern an ehemalige jüdische Bürger, die Opfer
von Gewalt und Vertreibung wurden. Insgesamt gibt es in Lorsch damit jetzt
38 Stolpersteine. Bis zum Jahr 2022 sollen es insgesamt 55 werden. Mit der
aktuellen Verlegeaktion wird an vier Familien erinnert, die in der
Bahnhofstraße lebten. Heimatforscher Thilo Figaj berichtete aus den
Biografien der früheren Lorscher Bürger, von denen viele in die USA fliehen
konnten. Andere wurden in Auschwitz ermordet oder in den Tod getrieben."
Link zum Artikel |
| |
|
September 2024:
Stolperschwelle zur Erinnerung an die Synagoge in Lorsch
|
 Pressemitteilung der Stadt Lorsch vom 5. September 2024 (Abbildung:
© Heimat- und Kulturverein Lorsch): "'Stolperschwelle'
in der Bahnhofstraße. Am Ort der ehemaligen Lorscher Synagogen.
Pressemitteilung der Stadt Lorsch vom 5. September 2024 (Abbildung:
© Heimat- und Kulturverein Lorsch): "'Stolperschwelle'
in der Bahnhofstraße. Am Ort der ehemaligen Lorscher Synagogen.
Abbildung links: Das Grundstück der jüdischen Gemeinde um 1885,
Blickrichtung Norden. Links in der Kirchstraße 5 das Haus des Lehrers, in
der Mitte das Badehaus und rechts die Synagoge in der Bahnhofstraße 10. ©
HKV Lorsch, Harry Niemann.
Der Künstler Gunter Demnig (Alsfeld) verlegt am Donnerstag, den 12.
September 2024 um 11 Uhr im Gehweg vor der Bahnhofstraße 10 eine sogenannte
Stolperschwelle. Das ist eine Gedenktafel, die in Form und Aussehen an die
bekannten Stolpersteine erinnert, allerdings bei gleicher Höhe um ein
Vielfaches breiter ist. Damit ist genügend Platz gegeben an diesem Ort der
Erinnerung mit einem Text den beiden Lorscher Synagogen zu gedenken, die
hier einst standen. Vor fast genau 300 Jahren, 1725, machte sich der damals
neue Lorscher Pfarrer Johannes Nikolaus Steden einen Vermerk in sein
Kirchenbuch. Von der 'hiesigen Judenschaft' seien 'drei Gulden für das
Synagogicum' einzusammeln und nach Mainz abzuführen. Das ist unser ersten
Nachweis einer organisierten jüdischen Gemeinde. In Lorsch versammelten sich
seit jeher auch die Kleinhäuser Juden zum regelmäßigen Gottesdienst. Ein
Situationsplan aus dem 19. Jahrhundert für die damalige 'Obergasse' belegt
den Standort der ersten Synagoge an genau der gleichen Stelle, wie der des
Nachfolgebaus aus dem Jahr 1885. Etwa zeitgleich mit dem Toleranzedikt von
1784 des Mainzer Kurfürsten Friedrich Karl Joseph von Erthal, welches es
Juden erlaubte, Häuser und Grundstücke zu erwerben, war das Haus Nr. 205
(Bahnhofstraße 10) im Besitz der jüdischen Familie Mainzer, die im
Obergeschoss einen Betraum für die Gemeinde einrichtete. Das Erdgeschoss
wurde gewöhnlich an einen angestellten Lehrer und Kantor vermietet, die hier
mit ihren Familien lebten. Einen Wechsel gab es alle paar Jahre. Dutzende
Lehrerkinder wurden hier geboren, am bekanntesten ist vielleicht Hannchen
Marx, geb. Isaak (1839-1910). Sie war die Großmutter der Marx-Brothers, das
waren ganz frühe und weltberühmte Hollywood Stars der Stummfilmzeit. Nicht
so berühmt war Ernst Nathan, der als viertes Kind des Lehrers Emanuel Nathan
1871 hier geboren wurde. Er lebte später in Bruchsal und wurde 1942 in
Auschwitz ermordet. Sein Name soll stellvertretend für alle Lorscher
Jüdinnen und Juden genannt sein, für die hier oder anderenorts keine
Stolpersteine verlegt sind. Auch zu ihrem Gedenken wird die Stolperschwelle
verlegt. Ab 1885 – mit der Errichtung der neuen Synagoge aus Stein – sind
keine Geburten mehr im Haus Nr. 205 verzeichnet. Der Bauherr der Synagoge,
Simon Lorch, der gleich nebenan sein Geschäft betrieb, hatte das Haus in der
Kirchstraße 5 dazu erworben, welchen nun als Lehrerhaus diente. Zwischen
diesem Haus und der neuen Steinsynagoge wurde ebenfalls neu eine, im
Umkleideraum beheizbare, Grundwasser Mikwe für die Ritualbäder gebaut. Die
Finanzierung des Neubaus war eine gewaltige Anstrengung für die Lorscher und
Kleinhäuser Juden. Maßgeblich zum Erfolg trugen großzügige Spenden bei, so
zum Beispiel aus der Familie des Ferdinand Oppenheimer. Der gebürtige
Kleinhäuser Jude war in Strasbourg mit einer Lederfabrik zu einem
beträchtlichem Vermögen gekommen. Mit dem Ende des Kaiserreiches und dem
verlorenen Krieg endete die Blütezeit der hiesigen Landjudenschaft. Viele
hatten beträchtliche Summen in Kriegsanleihen investiert. Inflation und
Wirtschaftskrisen folgten, die Nationalsozialisten raubten sich den Rest der
jüdischen Vermögen, einschließlich ihrer Synagoge. Der Gemeinderat
besiegelte mit dem Abbruch der Brandruine nach dem Pogrom das Ende der
jüdischen Gemeinde in Lorsch.
Drei Lorscher Familien hatten in Folge der Übergriffe 1938 unmittelbar Tote
in ihrer Mitte zu beklagen: Moritz Mainzer, der in der Schulstraße 12
geboren worden war, starb nach Misshandlung an einem Herzinfarkt in seiner
Heimatstadt Frankfurt. Simon Lorch aus Dieburg, ein Schwiegersohn Abraham
Abrahams aus der Kirchstraße 12, wurde in Buchenwald ermordet; die Familie
erhielt nur noch ein Paket mit seiner Asche. Schließlich auch Aron Lorch aus
der Bahnhofstraße 13, den man schon auf dem Weg nach Buchenwald gequält
hatte, verstarb Wochen später ebenfalls im Frankfurter Rothschild Hospital.
Ihre Namen sind mit den Tagen der Schändungen deutscher Synagogen verknüpft,
und so soll auch für sie die Stolperschwelle in der Bahnhofstraße ein
Denkzeichen der Erinnerung sein.
Nach der gemeinsam von der Stadt Lorsch und dem Heimat- und Kulturverein
veranstalteten Verlegung der Stolperschwelle ist die Dokumentation
Landjudenschaft im Alten Schulhaus bis etwa 14 Uhr geöffnet. Hier besteht
die Gelegenheit, sich den Film mit der 3D-Rekonstruktion der Lorscher
Synagoge anzuschauen. Aller Lorscherinnen und Lorscher und alle auswärtigen
Gäste sind herzlich eingeladen." |
| |
|
November 2024:
Gedenken an den Novemberpogrom
1938 |
Artikel (red) in "echo-online.de" vom
November 2024: "Lorsch (Bergstraße). Gedenken an die Reichspogromnacht in
Lorsch.
Am Mahnmal in der Schulstraße startet am 9. November um 18 Uhr ein stiller
Spaziergang.
KREIS BERGSTRAßE. (red). Am 9. November jähren sich die Schrecken der
Reichspogromnacht zum 86. Mal. Diese Nacht der organisierten und
flächendeckenden Zerstörung, Schändung, Vertreibung und Verschleppung gilt
als Auftakt der Naziherrschaft, die den Holocaust für die jüdischen
Mitbürgerinnen und Mitbürger brachte, auch in Lorsch. Am Ende wurden sechs
Millionen jüdische Frauen, Männer und Kinder auf bestialische Weise ermordet
und das jüdische Leben in Deutschland war ausgerottet.
Auch in Lorsch griffen Bürgerinnen und Bürger zu Benzinkanistern und setzten
das stolze Gotteshaus der Jüdinnen und Juden, Symbol und Mittelpunkt der
Gemeinde, in Brand. Die Feuerwehr, damals unweit des Brandortes in der
Kirchstraße 5 stationiert, griff nicht ein. Drei Augenzeugenberichte liegen
über diese Nacht vor, in der Nachbarn zu Verbrechern wurden, angestiftet
durch eine menschenverachtende Diktatur, unterstützt durch eine schweigende
Mehrheit. Der Magistrat lädt alle Bürgerinnen und Bürger um 18 Uhr zur
Gedenkstätte in der Schulstraße ein. Nach einer kurzen Begrüßung wird ein
stiller Spaziergang rund um das ehemalige Gelände der Lorscher Synagogen
stattfinden – vorbei an verschiedenen Stolpersteinen und hin zu der im
September neu verlegten Stolperschwelle in Erinnerung an die beiden Lorscher
Synagogen, die über zwei Jahrhunderte in der Schulstraße bestanden. Alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine kleine Karte an die Hand, mit
der man die Lage der ehemaligen Gebäude gut nachvollziehen kann. Nach dem
Spaziergang finden sich alle wieder an der Gedenkstätte ein. Hier werden
Bürgermeister Christian Schönung und der Vorsitzende des Heimat- und
Kulturvereins, Thilo Figaj, zum Themenkomplex Antisemitismus heute und
früher sprechen. "
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 501-504. |
 | ders.: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Bilder -
Dokumente. S. 135. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 24-25. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 228-230. |
 | Paul Schnitzer und Hans Degen: Zur Geschichte der
jüdischen Gemeinde in Lorsch. Laurissa Jubilans. Festschrift zur
1200-Jahrfeier von Lorsch. Mainz 1964 S. 182-187. |
 | dies.: Juden im Amt Lorsch zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
In: Geschichtsblätter Kreis Bergstrasse. Bd. 12 1979 S. 149-160. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Lorsch Hesse.
Established before 1750, the community drew members from nearby Kleinhausen and
numbered 110 (about 3 % of the total) in 1871. Affiliated with the Orthodox
rabbinate of Darmstadt, it maintained good relations with the largely Catholic
population. Of the 66 Jews living there in 1933, 26 left before Kristallnacht
(9-10 November 1938) when the synagogue was burned down. By 1939 most had
emigrated to the United States.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|