|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht über die
Synagogen im Kreis Fulda
Eiterfeld mit
Buchenau (Kreis
Fulda)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Hinweis: es besteht auch die Website http://juden-in-eiterfeld.de
sowie Seiten zu Eiterfeld in der Website
https://www.juedspurenhuenfelderland.de/die-jüdischen-familien-in-hünfeld/eiterfeld/
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Eiterfeld bestand eine jüdische
Gemeinde bis 1942. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 16./18. Jahrhunderts
zurück. Erstmals werden 1567 in einem Bericht an den Landgrafen Wilhelm von
Hessen Juden am Ort genannt. 1701 gab es zwei jüdische Haushaltungen am Ort, die des Hirz
Müller und des Jakob Katz.
Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wie
folgt: 1854 13 jüdische Haushalte mit 65 Personen, 1861 74 jüdische Einwohner (11,9 % von insgesamt 622 Einwohnern),
1871 81 (14,3 % von 565), 1875 83, 1885 105 (17,9 % von 588), 1887 100,
1892 117 (in 21 Familien), 1893 101 (in 19 Familien), 1895 84 (15,4 % von
544), 1897 83 (in 15 Familien), 1899 78 (von insgesamt 588 Einwohnern; in 15
Haushaltungen), 1905 64 (10,9 % von 587).
Zur jüdischen Gemeinde gehörten die in Buchenau und
seit 1927 auch die in Erdmannrode
lebenden jüdischen Einwohner (in Buchenau 1924 acht Personen, 1932 sieben
Personen; zu Erdmannrode siehe auf der dortigen Seite).
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische
Religionsschule beziehungsweise von 1857 bis nach 1930 eine jüdische Elementar-/öffentliche Volksschule
sowie ein rituelles Bad. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein
Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet
tätig war. Unter den Lehrern sind bekannt: Isaak Fauerbach (aus
Rhina, 1861 bis 1904), Julius Schuster (1904 bis 1924)
sowie sein Nachfolger Karl (Carl, Kalmann) Oppenheimer (zuvor Lehrer in Lichenroth,
in Eiterfeld ab Dezember 1924 bis 1933, danach in
Ingolstadt). Die jüdische Volksschule wurde um
1892 von 26 Kindern besucht, um 1897 von 20 Kindern, um 1899 von 16 Kindern,
1902 von 14 Kindern.
An jüdischen Vereinen werden genannt: Der Wohltätigkeitsverein Chewra
gemilus chesed (um 1887/95 unter Leitung von L. Rapp) und ein Verein
Talmud Tora (um 1888/1895 unter Leitung von Lehrer Isaak Fauerbach).
 Die
jüdischen Haushaltsvorsteher waren als Vieh- und Schnittwarenhändler tätig,
auch gab es zwei jüdische Schuhmacher am Ort (noch 1930). Das Foto links zeigt
den Laden von Moritz Rosenstock (Quelle). Die
jüdischen Haushaltsvorsteher waren als Vieh- und Schnittwarenhändler tätig,
auch gab es zwei jüdische Schuhmacher am Ort (noch 1930). Das Foto links zeigt
den Laden von Moritz Rosenstock (Quelle).
Unter den Gemeindevorstehern werden u.a. genannt: um 1887/89 L. Rapp, um
1892 L. Nußbaum, um 1897 A. Rosenstock, B. Nußbaum und A. Katz, um 1899 B.
Nußbaum.
Im deutsch-französischen Krieg 1870/71 wurde aus Eiterfeld Magnus Heller
schwer verletzt (siehe Bericht unten). Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Leopold Lomnitz
(geb. 4.12.1898 in Eiterfeld, gef. 22.10.1918). Außerdem ist gefallen: Benjamin
(Benno) Rosenstock (geb. 26.3.1883, vor 1914 in Wiesbaden wohnhaft, gef. 3.
September 1914).
Um 1924, als noch 56 jüdische Gemeindeglieder gezählt wurden (7,5 %
von insgesamt 750 Einwohnern), war Vorsteher der Gemeinde Jakob Rapp. Als Lehrer
war der bereits genannte Julius Schuster angestellt. Er unterrichtete an der jüdischen Volksschule
damals 11 Kinder. 1932 war Vorsteher der Gemeinde Max Lomnitz. Als Lehrer
und Schochet war inzwischen Karl Oppenheimer am Ort. An jüdischen Vereinen
wird (wie schon Ende des 19. Jahrhunderts, s.o.) genannt: der Chewroh-Verein (Ziel: Wohltätigkeit und Bestattung;
Vorsitzender Max Lomnitz) sowie ein Frauen-Verein (1932 unter Leitung von
Fanny Rapp).
1933 lebten noch 45 jüdische Personen in Eiterfeld (5,9 % von 768).
Nachdem 1933 nur noch acht Kinder die jüdische Volksschule besucht hatte, wurde
sie mit Wirkung vom 1. Mai 1933 geschlossen. Die verbliebenen Kinder besuchten
nun die katholische Volksschule. In
den folgenden Jahren ist ein Teil der
jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. SA-Leute am Ort unter
Federführung des Kreisbauernführers Salzmann errichteten bereits 1933
auf dem Marktplatz einen Galgen, an dem sich drei Schlingen und die Inschrift
befand: "Hier gehören die Volksausbeuter hin: Lomnitz, Strauss und
Rosenstock". Zum 1. September 1937 wurde in Burghaun
eine private jüdische Volksschule eingerichtet, die auch von den Kindern in
Eiterfeld besucht wurde.
In Buchenau lebte nach 1938 lebte noch eine jüdische Familie (Geschwister Rosenstock);
beim Novemberpogrom 1938 wurden in ihrem Haus durch SA und Helfeshelfer die
Fenster eingeworfen. Die Geschwister Rosenstock wurden Anfang September 1942
über Kassel nach Theresienstadt deportiert. Dort sind Malchen
und Veilchen Rosenstock umgekommen. Levi Rosenstock wurde in Auschwitz ermordet, Hannchen
und Helene Rosenstock starben im Ghetto Minsk.
Von den in Eiterfeld geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945", ergänzt durch die Liste von Elisabeth Sternberg-Siebert
s.Lit.): Maria Abt
geb. Waiter (1895), Rosa Fichtelberger geb. Rosenstock (1902), Mina Goldstein
geb. Wiesenfelder (1879), Julchen Klebe geb. Strauß (1889), Inge Marx (1926),
Mali (Mally, Wally) Marx geb. Rosenstock (1903), Kallmann Müller (1883), Rosa
Neumann geb. Wiesenfelder (1883), Julius Nussbaum (1869), Siegfried Rapp (1889),
Ludwig Rosenstock (1913), Frieda Rothschild geb. Nussbaum (1867), Minna Scherbel
geb. Wiesenfelder (1877), Rebekka Scherbel geb. Wiesenfelder (1873), Lina Sommer
geb. Strauss (1885), Minna Sommer geb. Rapp (1877), Johanna Stern geb. Kapp
(1865), Sara Stern geb. Nussbaum (1862), Adolf (Abraham) Strauss (1890), Amalie
(Alice) Strauss (1923), Fritz Strauß (), Hulda Strauss geb. Lorge (1892), Bella
Weinberg (1904), Emma Weinberg geb. Lebrecht (1871), Lina Weinberg geb. Rapp
(1894), Bertha Wiesenfelder (1928), Dewara Wiesenfelder (1939), Herbert
Wiesenfelder (1926), Martha Wiesenfelder (1923), Rosa Wiesenfelder geb. Klebe
(1896), Salomon Wiesenfelder (1875), Selig Wiesenfelder (1877, siehe
Kennkarte unten), Siegmund
Wiesenfelder (1890), Paula Zander geb. Wiesenfelder (1891).
Von den in Buchenau geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945", ergänzt durch
die Liste von Elisabeth Sternberg-Siebert s.Lit.):
Lisa Back
(1914), Bernhard Löbenstein
(1880), Helene
Rosenstock (1871), Levi Rosenstock (1885), Malchen (Malge) Rosenstock (1881), Manchen Rosenstock (1869), Veilchen
(Feilchen) Rosenstock (1873).
Hinweis: es kommt immer wieder zu Verwechslungen mit Buchenau
(Gemeinde Dautphetal, Kreis Marburg-Biedenkopf), wo mehrere Familien mit dem
Familiennamen Isenberg lebten.
Im Mai 2012 wurden für die oben genannten fünf Geschwister
Rosenstock vor deren früherem Wohnhaus in Buchenau (Hermann-Lietz-Straße 3)
sog. "Stolpersteine" verlegt . Die Geschwister betrieben am Ort einen gut gehendenden Handelsbetrieb
mit Gastwirtschaft und Schlachterei, was sie (vor allem Manchen Rosenstock)
bereits von ihrem Vater Hesekiel übernommen haben (vgl. Artikel
in der Fuldaer Zeitung vom 16.12.2011; zur Verlegung siehe Hinweis auf
Presseartikel unten).
Am 4. Oktober 2022 wurde in
Wüstensachsen (Rhönstraße 6) ein "Stolperstein" verlegt für Rosa Buchsbaum
geb. Rosenstock, die am 13. April 1896 in Eiterfeld geboren ist und in
Wüstensachsen lebte. Sie überlebte mehrere Konzentrationslager, zuletzt KZ
Stutthof und kam am 7. August 1945 nach Fulda; im März 1947 emigrierte sie in
die USA, wo sie am 2. August 1975 gestorben ist, Grab und Fotos siehe https://de.findagrave.com/memorial/155609264/rosa-buchsbaum_katten.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Lehrers / Vorbeters / Schächters 1870 / 1904 /
1924
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juli 1870:
"Zur Wiederbesetzung der Stelle eines Religions- und Elementarlehrers
nebst Vorbeters und Schächters bei der israelitischen Gemeinde zu
Eiterfeld mit Buchenau (Kreis Hünfeld), mit welcher ein fester Gehalt von
150 Talern und 70 Talern Akzidenzien verbunden sind, wollen Bewerber sich
an die unterzeichnete Stelle unter Vorlage ihrer Atteste wenden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juli 1870:
"Zur Wiederbesetzung der Stelle eines Religions- und Elementarlehrers
nebst Vorbeters und Schächters bei der israelitischen Gemeinde zu
Eiterfeld mit Buchenau (Kreis Hünfeld), mit welcher ein fester Gehalt von
150 Talern und 70 Talern Akzidenzien verbunden sind, wollen Bewerber sich
an die unterzeichnete Stelle unter Vorlage ihrer Atteste wenden.
Fulda, am 19. Juni 1870. Vorsteheramt der Israeliten." |
| |
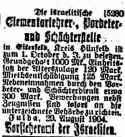 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. September 1904: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. September 1904:
"Die israelitische Elementarlehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle
in Eiterfeld Kreis Hünfeld ist zum 1. Oktober diesen Jahres (1904), zu
besetzen. Grundgehalt 1.000 Mark, Einheitssatz der Alterszulage 120 Mark,
Mietsentschädigung 125 Mark, Nebeneinnahmen durch den Vorbeter- und
Schächterdienst etwa 300 Mark. Bewerbungen nebst Zeugnissen sind sofort
an die unterzeichnete Behörde zu richten.
Fulda, 29. August 1904.
Vorsteheramt der Israeliten." |
| |
 Anzeige
im Frankfurter Israelitischen Familienblatt vom 9. September 1904:
"Eiterfeld (Kreis Hünfeld). Elementarlehrer, Vorbeter und Schächter
per 1. Oktober. Grundgehalt 1.000 Mark, Einheitssatz der Alterszulage 120
Mark, Mietsentschädigung 125 Mark, Nebeneinkommen 300 Mark. Meldungen an
das Vorsteheramt der Israeliten in Fulda." Anzeige
im Frankfurter Israelitischen Familienblatt vom 9. September 1904:
"Eiterfeld (Kreis Hünfeld). Elementarlehrer, Vorbeter und Schächter
per 1. Oktober. Grundgehalt 1.000 Mark, Einheitssatz der Alterszulage 120
Mark, Mietsentschädigung 125 Mark, Nebeneinkommen 300 Mark. Meldungen an
das Vorsteheramt der Israeliten in Fulda." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1924:
"Für die durch Versetzung des Lehrers frei gewordene Lehrerstelle an
der israelitischen Volksschule zu Eiterfeld wird sofort ein orthodoxer
Nachfolger gesucht, der gleichzeitig Vorbeter und Schächter sein soll.
Bewerber mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Referenzen sind bis
spätestens 14. September zu richten an das Vorsteheramt der Israeliten,
Fulda." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1924:
"Für die durch Versetzung des Lehrers frei gewordene Lehrerstelle an
der israelitischen Volksschule zu Eiterfeld wird sofort ein orthodoxer
Nachfolger gesucht, der gleichzeitig Vorbeter und Schächter sein soll.
Bewerber mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Referenzen sind bis
spätestens 14. September zu richten an das Vorsteheramt der Israeliten,
Fulda." |
Lehrer Isaak Fauerbach wird
nach seinem Eintritt in den Ruhestand ausgezeichnet (1904)
Anmerkung: Isaak Fauerbach ist am 7. August 1838 in
Rhina als Sohn des Lehrers Emanuel Fauerbach
und seiner Frau Giedchen geb. Schaumberg geboren. Er war seit Mai 1864
verheiratet mit Emilie geb. Wertheim, die am 15. Januar 1844 geboren ist
in Erdmannrode als Tochter des Lehrers
Levi Wertheim und seiner Frau Minchen geb. Huhn. Die beiden hatten elf Kinder.
Isaak Fauerbach war von August 1861 bis 1. Oktober 1904 Lehrer, Kantor und
Schochet in Eiterfeld. Ein Sohn der beiden - Moritz (Moses) Fauerbach - starb am
3. April 1892; Grab in Burghaun siehe https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/juf/id/4030.
Ein Foto des Grabsteines des am 22. November 1929 in Mönchengladbach gestorbenen
Isaak Fauerbach in der Dokumentation des Friedhofes bei epidat
http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=e26-4130. Genealogische
Informationen (noch unvollständig) siehe auch
https://www.geni.com/people/Isaak-Fauerbach/6000000078508509702. Die Tochter
Bertha Winter geb. Fauerbach (geb. 1870) ist 1942 nach der Deportation
umgekommen. Für sie liegt in Mönchengladbach ein Stolperstein in der
Gasthausstraße 8.
 Mitteilung in "Der Gemeindebote" vom 30. Dezember 1904: "Dem
emeritierten Lehrer Isaak Fauerbach zu Mönchengladbach, bisher zu
Eiterfeld im Kreise Hünfeld, ist der Adler der Inhaber des königlichen
Hausordens von Hohenzollern verliehen worden. " Mitteilung in "Der Gemeindebote" vom 30. Dezember 1904: "Dem
emeritierten Lehrer Isaak Fauerbach zu Mönchengladbach, bisher zu
Eiterfeld im Kreise Hünfeld, ist der Adler der Inhaber des königlichen
Hausordens von Hohenzollern verliehen worden. " |
Lehrer Simon Strauß aus
Burghaun
unterrichtet (in der Kriegszeit) auch in Eiterfeld (1915)
 Artikel in "Neue jüdische Presse / Frankfurter Israelitisches Familienblatt"
vom 10. Dezember 1915: "Fulda. Der in letzter Nummer erwähnte Fall
der zeitweiligen Auflösung der israelitischen Schulstelle zu
Wehrda steht
nicht vereinzelt da, sondern bildet im Bezirk Fulda die Regel. Artikel in "Neue jüdische Presse / Frankfurter Israelitisches Familienblatt"
vom 10. Dezember 1915: "Fulda. Der in letzter Nummer erwähnte Fall
der zeitweiligen Auflösung der israelitischen Schulstelle zu
Wehrda steht
nicht vereinzelt da, sondern bildet im Bezirk Fulda die Regel.
Auch die
Stelle zu Mansbach hat dasselbe Schicksal ereilt, und hat der
Lehrer Stein
die evangelische Schule in Oberbreitenbach übernommen, während seine
Schüler der Ortsschule überwiesen sind und von ihm nur noch in Religion
unterrichtet werden. Genauso ist es in Tann, wo auch Lehrer Hecht wandern
muss, während in Burghaun Lehrer Strauß
außer an seiner Schule an der Ortsschule unterrichtet und auch nach
Rothenkirchen muss. Dieser Herr
verrichtet, da er außerdem Religionsunterricht in Eiterfeld und
Hünfeld
und die Schechita für den ganzen Bezirk hat, eine kaum zu bewältigende
Arbeit." |
Lehrer Julius Schuster verlässt die Gemeinde (1924)
Anmerkung: Julius
Schuster konnte nach seiner Zeit in Groß-Krotzenburg 1939 mit seiner Familie
nach England emigrieren.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. August 1924: "Eiterfeld,
28. Juli (1924). Nach 20jähriger segensreicher Tätigkeit verlässt
leider Herr Lehrer Schuster unsere Gemeinde, in der er sich ein Denkmal
der Verehrung und Hochachtung gesetzt hat, um seinen Wirkungskreis nach
Groß-Krotzenburg zu verlegen. Wehmütig lassen wir ihn von uns scheiden,
begleitet mit den besten Wünschen. Hat er doch eine Schule geschaffen,
die als Vorbild für alle jüdischen Schulen dienen kann. Voll
Begeisterung lauschen Schüler und Schülerinnen seinen Worten, in
innigster Verehrung blicken sie zu ihm empor und so gelang es ihm leucht,
seine ihm anvertrauten Schüler in die Lehren der heiligen Tora
einzuführen. Wie innig und treu er mit seiner Gemeinde verbunden, das
zeigten seine von Herzen zu Herzen gehenden Abschiedsworte (hebräisch und
deutsch:) Seid fernerhin stark und fest zu Gott und
untereinander. Diese Worte seien der Treueid, mit dem die Gemeinde das
Andenken ihres scheidenden Lehrers achten und ehren will. Möge es dem
pflichteifrigen Lehrer vergönnte sei, mit Gottes Hilfe auch im
neuen Wirkungskreis die Herzen aller zu erschließen, recht viele, viele
Jahre im Kreise seiner Lieben und seiner Gemeinde für die Gemeinde
und für die Öffentlichkeit zu wirken!" Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. August 1924: "Eiterfeld,
28. Juli (1924). Nach 20jähriger segensreicher Tätigkeit verlässt
leider Herr Lehrer Schuster unsere Gemeinde, in der er sich ein Denkmal
der Verehrung und Hochachtung gesetzt hat, um seinen Wirkungskreis nach
Groß-Krotzenburg zu verlegen. Wehmütig lassen wir ihn von uns scheiden,
begleitet mit den besten Wünschen. Hat er doch eine Schule geschaffen,
die als Vorbild für alle jüdischen Schulen dienen kann. Voll
Begeisterung lauschen Schüler und Schülerinnen seinen Worten, in
innigster Verehrung blicken sie zu ihm empor und so gelang es ihm leucht,
seine ihm anvertrauten Schüler in die Lehren der heiligen Tora
einzuführen. Wie innig und treu er mit seiner Gemeinde verbunden, das
zeigten seine von Herzen zu Herzen gehenden Abschiedsworte (hebräisch und
deutsch:) Seid fernerhin stark und fest zu Gott und
untereinander. Diese Worte seien der Treueid, mit dem die Gemeinde das
Andenken ihres scheidenden Lehrers achten und ehren will. Möge es dem
pflichteifrigen Lehrer vergönnte sei, mit Gottes Hilfe auch im
neuen Wirkungskreis die Herzen aller zu erschließen, recht viele, viele
Jahre im Kreise seiner Lieben und seiner Gemeinde für die Gemeinde
und für die Öffentlichkeit zu wirken!" |
Lehrer Karl Oppenheimer wird Nachfolger von Lehrer Schuster (1924)
Anmerkung: Karl (Carl)
Oppenheimer ist am 8. Februar 1889 in Gersfeld geboren als Sohn von Salomon
Oppenheimer und seiner Frau Mathilde (Madel). Er war verheiratete mit Bella geb.
Kissinger (siehe Verlobungsanzeige unten), eine Tochter des Lehrers in
Urspringen Simon Kissinger und seiner Frau Babette. Die beiden hatten zwei
Kinder: Siegbert (Schlomo) Oppenheimer und Alfred Oppenheimer. Carl Oppenheimer
starb im Juli 1970 in New York N.Y./USA. Genealogische Informationen (mit Foto)
siehe
https://www.geni.com/people/Carl-Oppenheimer/6000000039620353182.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Dezember 1924:
"Eiterfeld, 1. Dezember (1924). Durch die Regierung ist Herr Lehrer
Oppenheim von Lichenroth nach hier versetzt worden. Die Gemeinde hofft in
ihm einen würdigen Nachfolger für Herrn Lehrer Schuster, der nach
Groß-Krotzenburg versetzt wurde, gefunden zu
haben." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Dezember 1924:
"Eiterfeld, 1. Dezember (1924). Durch die Regierung ist Herr Lehrer
Oppenheim von Lichenroth nach hier versetzt worden. Die Gemeinde hofft in
ihm einen würdigen Nachfolger für Herrn Lehrer Schuster, der nach
Groß-Krotzenburg versetzt wurde, gefunden zu
haben." |
Errichtung einer privaten jüdischen Volksschule in Burghaun - auch für die
Kinder aus Eiterfeld (1937!)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. August 1937: "Burghaun,
9. August (1937). Dieser Tage ist die Errichtung einer privaten jüdischen
Volksschule in unserer Gemeinde vom Ministerium unter Gewährung eines
Staatszuschusses genehmigt worden. Die Schule soll am 1. September
eröffnet und von den Kindern der Gemeinden Burghaun,
Hünfeld und Eiterfeld besucht werden. Der Unterricht wird durch
den Lehrer Hermann Adler aus Nürnberg erteilt
werden." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. August 1937: "Burghaun,
9. August (1937). Dieser Tage ist die Errichtung einer privaten jüdischen
Volksschule in unserer Gemeinde vom Ministerium unter Gewährung eines
Staatszuschusses genehmigt worden. Die Schule soll am 1. September
eröffnet und von den Kindern der Gemeinden Burghaun,
Hünfeld und Eiterfeld besucht werden. Der Unterricht wird durch
den Lehrer Hermann Adler aus Nürnberg erteilt
werden." |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Ergebnisse von Kollekten in der Gemeinde (1871 / 1879
/ 1887)
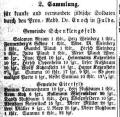 Mitteilung in "Die jüdische Presse" vom 17. Februar 1871: "Sammlung
für kranke und verwundete jüdische Soldaten durch den Provinzial-Rabbiner
Dr. Enoch in Fulda. Mitteilung in "Die jüdische Presse" vom 17. Februar 1871: "Sammlung
für kranke und verwundete jüdische Soldaten durch den Provinzial-Rabbiner
Dr. Enoch in Fulda.
...
Gemeinde Eiterfeld. Bonum Tannenbaum 10 sgr., Levi Nußbaum 1 thlr.,
Aron Katz 6 sgr., Kallmann Wiesenfelder 20 sgr., David Nußbaum 1 thlr., Herz
Wiesenfelder 10 sgr., Abraham Rosenstock 15 sgr., Meier Müller 20 sgr., Levi
Müller 9 sgr., K. Rapp 25 sgr., Meier Nußbaum 1 thlr.
Summe 0 thlr, 22 sgr." |
| |
 Mitteilung in "Der Israelit" vom 23. Juli 1879: "Eiterfeld.
Durch Lehrer Fauerbach, Challah-Geld von nachfolgenden Frauen: Minchen
Wertheim 1.30, Bräunchen Rapp 1, Hannchen Wiesenfelder 1.20, Jettchen Katz
1.15, Mathilde Nußbaum 1.03, Rebecka Tannenbaum 1.50, Delzchen Wiesenfelder
1.47, Minna Müller 1, Betti Müller 1.63, Babette Müller 0.50, Jettchen
Nußbaum 1.65, Nani Wiesenfelder 1.50, Minna Rosenstock 2.05, Regine
Rosenstock 0.70, Rebecka Nußbaum 2.35, Emilie Fauerbach 1, zusammen 21.03 M."
Mitteilung in "Der Israelit" vom 23. Juli 1879: "Eiterfeld.
Durch Lehrer Fauerbach, Challah-Geld von nachfolgenden Frauen: Minchen
Wertheim 1.30, Bräunchen Rapp 1, Hannchen Wiesenfelder 1.20, Jettchen Katz
1.15, Mathilde Nußbaum 1.03, Rebecka Tannenbaum 1.50, Delzchen Wiesenfelder
1.47, Minna Müller 1, Betti Müller 1.63, Babette Müller 0.50, Jettchen
Nußbaum 1.65, Nani Wiesenfelder 1.50, Minna Rosenstock 2.05, Regine
Rosenstock 0.70, Rebecka Nußbaum 2.35, Emilie Fauerbach 1, zusammen 21.03 M." |
| |
 Mitteilung in "Der Israelit" vom 1. Dezember 1887: "Eiterfeld.
Durch Lehrer J. Fauerbach, Challah-Geld von nachgenannten Frauen: Rebecka
Nußbaum 1.50, Fanni Rapp 2.50, Babette Müller 1, Emilie Fauerbach 1, Mina
Rosenstock 3, Jettchen und Clara Nußbaum 4, Delzchen Wiesenfelder 2.30, Mina
Müller 0.85, Mathilde Nußbaum 3, Nanni Wiesenfelder 1.15, Bräunchen Rapp 3,
Rebecka Tannenbaum 1.509, zusammen abzüglich Porto 24.50 Mark, wovon 1.50 M.
für ... und 3 M. für R IV." Mitteilung in "Der Israelit" vom 1. Dezember 1887: "Eiterfeld.
Durch Lehrer J. Fauerbach, Challah-Geld von nachgenannten Frauen: Rebecka
Nußbaum 1.50, Fanni Rapp 2.50, Babette Müller 1, Emilie Fauerbach 1, Mina
Rosenstock 3, Jettchen und Clara Nußbaum 4, Delzchen Wiesenfelder 2.30, Mina
Müller 0.85, Mathilde Nußbaum 3, Nanni Wiesenfelder 1.15, Bräunchen Rapp 3,
Rebecka Tannenbaum 1.509, zusammen abzüglich Porto 24.50 Mark, wovon 1.50 M.
für ... und 3 M. für R IV."
|
Die Synagogengemeinde Erdmannrode wird aufgehoben - die
Gemeinde Eiterfeld übernimmt die Vermögensverwaltung (1927)
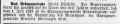 Artikel
in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 15. Juli 1927: "Aus Erdmannrode (Kreis
Hünfeld). Der Regierungspräsident hat zunächst auf die Dauer von drei
Jahren angeordnet, dass vom 1. Juli 1927 ab die Synagogengemeinde Erdmannrode
aufgehoben und die Verwaltung des Vermögens der Synagogengemeinde Eiterfeld
übertragen wird." Artikel
in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 15. Juli 1927: "Aus Erdmannrode (Kreis
Hünfeld). Der Regierungspräsident hat zunächst auf die Dauer von drei
Jahren angeordnet, dass vom 1. Juli 1927 ab die Synagogengemeinde Erdmannrode
aufgehoben und die Verwaltung des Vermögens der Synagogengemeinde Eiterfeld
übertragen wird." |
Ritualmordhetze nach einem Kindesmord in Eiterfeld (1928)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. September 1928: "Ritualmordhetze
an der Arbeit. Über den von der Tagespresse mitgeteilten Fall eines
Kindesmordes in Eiterfeld, Kreis Fulda, erfrecht sich der hier (Frankfurt)
erscheinende völkische 'Frankfurter Beobachter' unter der Überschrift:
'Ritualmord in Eiterfeld' wie folgt zu berichten: Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. September 1928: "Ritualmordhetze
an der Arbeit. Über den von der Tagespresse mitgeteilten Fall eines
Kindesmordes in Eiterfeld, Kreis Fulda, erfrecht sich der hier (Frankfurt)
erscheinende völkische 'Frankfurter Beobachter' unter der Überschrift:
'Ritualmord in Eiterfeld' wie folgt zu berichten:
'Im Kreis Fulda liegen drei Ortschaften: Rhina,
Burghaun und Eiterfeld, in
denen fast die ganze Bevölkerung sich aus Juden zusammensetzt. Ich habe
gelegentlich einer Wahlversammlung in Eiterfeld am 29. April 1928 die
Juden von Eiterfeld kennen gelernt, die damals ein paar Dutzend Arbeiter
eines benachbarten Steinbruches auf mich hetzten, sodass es nahe daran
lag, dass ich nicht mehr gesund aus diesem Judenkaff herausgekommen wäre.
Was hat nun die jüdische Bevölkerung von Eiterfeld ein Interesse daran,
dass der Mord nicht aufgeklärt wird? Wir behaupten nicht, dass es sich
hier um einen Ritualmord handelt. Aber die amtlichen Stellen sollten so was
nicht als Märchen betrachten, sondern den Fall einmal von diesem
Gesichtspunkt aus betrachten. Wer sind die, die da bei der Untersuchung
Schwierigkeiten machen? Sind es Juden? Was wird geschehen, um die Sache
aufzuklären? Die christliche Bevölkerung hat ein Recht, zu verlangen,
dass die Angelegenheit nicht in der Vergesslichkeit verschwindet, sondern
dass radikal durchgegriffen wird.'
Der Fall ist bekanntlich inzwischen von der Kriminalpolizei als Lustmord
aufgeklärt worden. Davon hat der 'Frankfurter Beobachter' bisher noch
nichts beobachtet." |
| |
 Artikel in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des Central-Vereins)
vom 5. Oktober 1928: "So sehen Ritualmorde aus! In
letzter Zeit mehren sich die Fälle, in denen völkische Zeitschriften und
rechtsstehende Blätter unaufgeklärte Mordfälle und vor allem
Sexualverbrechen dazu benutzen, um Ritualmordgerüchte auszustreuen. Wir
unterlassen es, alle die Fälle aufzuzählen, in denen in den letzten
Monaten so verfahren wurde, und wo auch wir eingreifen musste. Wir wollen hier
nur eingehen auf den Mord an einem vierjährigen Mädchen Anfang
September dieses Jahres in Eiterfeld bei Hanau. Kurz nach Bekannt werden
dieses Mordes schrieb der völkische 'Frankfurter Beobachter' vom
2. September 1928 wie folgt: '...Im Kreis Fulda liegen drei
Ortschaften, Rhina, Burghaun und Eiterfeld, in denen fast die ganze
Bevölkerung sich aus Juden zusammensetzt... Was hat nun die jüdische
Bevölkerung von Eiterfeld für ein Interesse daran, dass der Mord nicht
aufgeklärt wird? Wir behaupten nicht, dass es sich hier um einen Ritualmord
handelt. Aber die amtlichen Stellen sollten so was nicht als Märchen
betrachten, sondern den Fall einmal von diesem Gesichtspunkt aus
betrachten. Wer sind die, die da bei der Untersuchung Schwierigkeiten
machen? Sind es Juden?...' Die amtlichen Stellen haben sich dieses
Märchens angenommen und die Pressestelle des Oberstaatsanwalts in
Hanau ließ einer großen Anzahl von Zeitungen des dortigen Bezirks
folgende Berichtigung zugehen: 'Zu dem Lustmord an einem vierjährigen
Mädchen in Eiterfeld. Gegenüber Erörterungen im 'Frankfurter
Beobachter' teilt der Oberstaatsanwalt in Hanau mit, dass nach dem
Ergebnis der bisherigen Ermittlungen, insbesondere der Leichenöffnung,
die Tat aus geschlechtlichen Beweggründen begangen und der Tod durch
Erwürgen eingetreten ist, sodass zweifellos Lustmord vorliegt.'
Wir haben bisher nicht feststellen können, dass der 'Frankfurter
Beobachter' diese Berichtigung in seinen Spalten veröffentlicht
hätte". Artikel in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des Central-Vereins)
vom 5. Oktober 1928: "So sehen Ritualmorde aus! In
letzter Zeit mehren sich die Fälle, in denen völkische Zeitschriften und
rechtsstehende Blätter unaufgeklärte Mordfälle und vor allem
Sexualverbrechen dazu benutzen, um Ritualmordgerüchte auszustreuen. Wir
unterlassen es, alle die Fälle aufzuzählen, in denen in den letzten
Monaten so verfahren wurde, und wo auch wir eingreifen musste. Wir wollen hier
nur eingehen auf den Mord an einem vierjährigen Mädchen Anfang
September dieses Jahres in Eiterfeld bei Hanau. Kurz nach Bekannt werden
dieses Mordes schrieb der völkische 'Frankfurter Beobachter' vom
2. September 1928 wie folgt: '...Im Kreis Fulda liegen drei
Ortschaften, Rhina, Burghaun und Eiterfeld, in denen fast die ganze
Bevölkerung sich aus Juden zusammensetzt... Was hat nun die jüdische
Bevölkerung von Eiterfeld für ein Interesse daran, dass der Mord nicht
aufgeklärt wird? Wir behaupten nicht, dass es sich hier um einen Ritualmord
handelt. Aber die amtlichen Stellen sollten so was nicht als Märchen
betrachten, sondern den Fall einmal von diesem Gesichtspunkt aus
betrachten. Wer sind die, die da bei der Untersuchung Schwierigkeiten
machen? Sind es Juden?...' Die amtlichen Stellen haben sich dieses
Märchens angenommen und die Pressestelle des Oberstaatsanwalts in
Hanau ließ einer großen Anzahl von Zeitungen des dortigen Bezirks
folgende Berichtigung zugehen: 'Zu dem Lustmord an einem vierjährigen
Mädchen in Eiterfeld. Gegenüber Erörterungen im 'Frankfurter
Beobachter' teilt der Oberstaatsanwalt in Hanau mit, dass nach dem
Ergebnis der bisherigen Ermittlungen, insbesondere der Leichenöffnung,
die Tat aus geschlechtlichen Beweggründen begangen und der Tod durch
Erwürgen eingetreten ist, sodass zweifellos Lustmord vorliegt.'
Wir haben bisher nicht feststellen können, dass der 'Frankfurter
Beobachter' diese Berichtigung in seinen Spalten veröffentlicht
hätte". |
| |
 Artikel
in "Der Israelit" vom 22. Oktober 1928: "Amtliche
Stellungnahme gegen Ritualmord Hitze in Deutschland. " Artikel
in "Der Israelit" vom 22. Oktober 1928: "Amtliche
Stellungnahme gegen Ritualmord Hitze in Deutschland. "
Berlin,
4. Oktober.
In letzter Zeit mehren sich die Fälle, in denen völkische
Zeitschriften und rechtsstehende Blätter unaufgeklärte Mordfälle und vor
allem Sexualverbrechen dazu benutzen, um Ritualmordgerüchte auszustreuen. Der Central-Verein
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens hat in
den letzten Monaten in mehreren solchen Fällen eingreifen müssen. So auch
anlässlich des Mordes an einem vierjährigen Mädchen Anfang September dieses
Jahres in Eiterfeld bei Hanau. Kurz nach Bekanntwerden dieses Mordes brachte,
wie wir seinerzeit berichteten, der völkische 'Frankfurter Beobachter' Hetzartikel gegen die Juden.
Die Pressestelle des Oberstaatsanwalts in Hanau
hat nun einer großen Anzahl von Zeitungen des dortigen Bezirkes folgende
Berichtigung zu gehen lassen: 'Zu dem Lustmord an einem vierjährigen Mädchen
in Eiterfeld. Gegenüber Erörterungen im 'Frankfurter Beobachter' teilt der
Oberstaatsanwalt in Hanau mit, dass nach dem Ergebnis der bisherigen
Ermittlungen, insbesondere der Leichenöffnung, die Tat aus geschlechtlichen
Beweggründen begangen und der Tod durch Erwürgen eingetreten ist, so dass
zweifellos Lustmord vorliegt.'"
|
Berichte zu einzelnen Personen
aus der Gemeinde
Magnus Heller wurde im
deutsch-französischen Krieg schwer verwundet (1870)
 Mitteilung in "Der Israelit" vom 16. November 1870:
"2. Nassauisches Infanterie-Regiment Nr. 88. Mitteilung in "Der Israelit" vom 16. November 1870:
"2. Nassauisches Infanterie-Regiment Nr. 88.
Musketier Simon Löb aus Villmar, Kreis
Oberlahn, tot.
Musketier Wolff, leicht verwundet, Schuss ins Bein.
Musketier Isaac Isselbächer aus Isselbach,
Kreis Unterlahn, tot.
Musketier Gefreiter (Einjährig-Freiwilliger Magnus Heller aus
Eiterfeld, Kreis Hünfeld, schwer verwundet, Schuss in den Oberschenkel." |
| |
 Mitteilung in "Im deutschen Reich" vom Januar 1896 S. 40: "Heller,
Magnus, Einjährig-Freiwilliger, Gefreiter, Infanterie-Regiment 88,
Wörth, Schuss in den Oberschenkel, aus Eiterfeld." Mitteilung in "Im deutschen Reich" vom Januar 1896 S. 40: "Heller,
Magnus, Einjährig-Freiwilliger, Gefreiter, Infanterie-Regiment 88,
Wörth, Schuss in den Oberschenkel, aus Eiterfeld."
|
Zum Tod von Wolf Goldberg in
Buchenau im Alter von 106 Jahren (1872)
 Artikel in "Der Israelit" vom 6. November 1872: "Kassel. Am 2. Oktober starb zu
Buchenau der älteste Mann des Amtsgerichts Eiterfeld und
wahrscheinlich auch von ganz Kurhessen, der Israeliten Wolf Goldberg,
im seltenen Alter von 106 Jahren an Altersschwäche bei völlig klarem
Bewusstsein. Derselbe durchreiste noch bis vor wenigen Jahren ganz
Deutschland - Almosen sammelnd - zu Fuß. Er war seit 15 Jahren Witwer. Sein
einziger Sohn, dermalen 70 Jahre alt, wohnt in London." Artikel in "Der Israelit" vom 6. November 1872: "Kassel. Am 2. Oktober starb zu
Buchenau der älteste Mann des Amtsgerichts Eiterfeld und
wahrscheinlich auch von ganz Kurhessen, der Israeliten Wolf Goldberg,
im seltenen Alter von 106 Jahren an Altersschwäche bei völlig klarem
Bewusstsein. Derselbe durchreiste noch bis vor wenigen Jahren ganz
Deutschland - Almosen sammelnd - zu Fuß. Er war seit 15 Jahren Witwer. Sein
einziger Sohn, dermalen 70 Jahre alt, wohnt in London." |
Der Geheime Sanitätsrat Dr.
Benedikt Stilling, sollte in Eiterfeld eine Stelle antreten, was er jedoch
ausschlug (1879)
Anmerkung: Zur Person von Dr. Benedikt Stilling siehe auf einer
Seite zu Kassel (interner Link).
 Artikel in "Der Israelit" vom 12. Februar 1879: "Aus
Kurhessen, 8. Februar. Die jüngste Nummer ihres geschätzten Blattes
brachte eine Korrespondenz aus Kassel über den verstorbenen geheimen
Sanitätsrat Dr. Stilling, wonach derselbe in den 1830er-Jahren zur
ärztlichen Praxis zugelassen worden sei. Es ist dies indes nicht ganz
richtig; es war für die Herren an der Kasseler Regierung vielmehr keine
Wahl, ihn an der Ausübung der ärztlichen Praxis zu hindern, so gern dies
geschehen wäre.
Artikel in "Der Israelit" vom 12. Februar 1879: "Aus
Kurhessen, 8. Februar. Die jüngste Nummer ihres geschätzten Blattes
brachte eine Korrespondenz aus Kassel über den verstorbenen geheimen
Sanitätsrat Dr. Stilling, wonach derselbe in den 1830er-Jahren zur
ärztlichen Praxis zugelassen worden sei. Es ist dies indes nicht ganz
richtig; es war für die Herren an der Kasseler Regierung vielmehr keine
Wahl, ihn an der Ausübung der ärztlichen Praxis zu hindern, so gern dies
geschehen wäre.
Über den Verstorbenen ist in der letzten Zeit so viel geschrieben worden,
dass es unnütz wäre, auch in ihrem Blatte noch über seinen Ruhm etwas zu
bringen, aber in den Rahmen desselben dürften doch die nachstehenden Zeilen
passen, namentlich was der Verewigte vom lieben Rischus (Judenhass,
Antisemitismus) zu ertragen hatte, und wie er es mit wahrem Kiddusch
Haschem (Heiligung des Gottesnamens, gemeint Bekenntnis zu seinem Glauben)
ertragen hat.
Nachdem in Kurhessen die Emanzipation der Israeliten schon verfassungsmäßig
garantiert war, machte Stilling ein sehr glänzendes Examen und konnte man
nicht umhin, ihm eine Staatsstelle zu geben, was auch geschah, in dem er als
Landgerichtswundarzt für das linke Fuldaufer in Kassel angestellt wurde.
Bald hatte er dortselbst infolge seiner Geschicklichkeit die stärkste
ärztliche Praxis, wodurch er seinen christlichen Kollegen, mit wenigen
Ausnahmen sehr im Wege war, was auch wohl die Veranlassung wurde, dass er
plötzlich, ohne seinen Willen und Wissen, als Physikus nach Eiterfeld
einem kleinen Städtchen in der Provinz Fulda versetzt wurde.
Da ihm indess von dem Vater des letzten Kurfürsten schon früher die Ausübung
der ärztlichen Praxis durch ganz Kurhessen gestattet worden war, wovon die
Herren am Kasseler Obermedizinalkollegium wohl keine Kenntnis hatten, schlug
er die neue Stelle aus, und praktizierte in Kassel fort, indem er auf seinen
Staatsgehalt verzichtete.
In der ersten Zeit seiner Anstellung wollte Stilling eine wissenschaftliche
Reise nach Paris machen, um Einrichtungen der dortigen Spitäler etc. kennen
zu lernen und bat bei seinem Gesuche um Urlaub die Regierung um einen
Staatszuschuss zu seinen Reisekosten; das Rischus (Judenhass,
Antisemitismus) war aber so groß, dass ihm, als er auf den Zuschuss aus
Staatsmitteln verzichtete, und die Reise auf eigene Kosten unternehmen
wollte, Schwierigkeiten bereitet wurden, indem man ihm längere Zeit den
Urlaub verweigerte.
Als sein Ruhm im Ausland schon begründet war, und als er auf alle mögliche
Weise durch Diplome als Ehrenmitglied von Akademien, Orden, unter anderem
vom Kaiser von Österreich, vom König Louis Philipp von Frankreich, vom König
von Belgien etc. ausgezeichnet worden, offerierte ihm der bekannte Minister
Hassenpflug, welcher auch in den 1830er-Jahren ein Ministerportfeuille in
Kurhessen inne hatte, eine Professur an der Landesuniversität Marburg oder
Sitz im Obermedizinalkollegium zu Kassel, natürlich unter der schönen
Bedingung, dass er Christ werden solle, was er mit Entrüstung zurückwies,
indem er sagte, dass sein größter Stolz der sei, Jude zu sein.
Bei mehreren Vakanzen im Obermedizinalkollegium wurde Stilling dem
Kurfürsten vorgeschlagen, aber weil Jude nicht angenommen. Trotz allem
diesen sah Stilling im Kurfürsten doch stets den Landesherrn und verehrte
ihm sei eines seiner besten Werke, welches er demselben mit einem
prachtvollen und kunstreichen Einband versehen, überreichte.
Als in den letzten Regierungsjahren des Kurfürsten ein demselben sehr
nahestehendes Familienmitglied erkrankte und die behandelnden Ärzte keine
Heilung verschaffen konnten, Stilling mit der Behandlung betraut wurde, und
diesem nach verhältnismäßig kurzer Zeit die Heilung gelang, bei ihm
angefragt wurde, was ihm am genehmsten sei, ob ihm Seine Königliche Hoheit
einen Orden gebe oder ihn als Obermedizinalrat ernenne, war er stolz genug,
Orden sowohl wie Titel auszuschlagen und nichts anzunehmen.
Wo es galt, für das Judentum einzutreten, schreckte Geheimer Rat Stilling
vor nichts zurück und wusste dafür einzutreten; so hatte er sich nach dem
1870er-Kriege bei Gelegenheit eines ausgeübten Judenhasses direkt an Seine
Majestät den deutschen Kaiser Wilhelm gewandt, der auch in seiner bekannten
Gerechtigkeitsliebe die höchste Entscheidung nach Stilling's Wunsche traf." |
Unter den Gefallenen des Ersten Weltkrieges ist auch
Lehrer Benno Rosenstock in Wiesbaden (geb. 1883 in Eiterfeld, gefallen 1914)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 16. Oktober 1914: "Von jüdischen Beamten, die in den Krieg
gezogen, sind auf dem Felde der Ehre gefallen: Lehrer Max Strauß
von der Israelitischen Religionsgesellschaft in München (aus Hofheim
stammend); Lehrer H. Isenberg von Andernach
am Rhein; Lehrer Benno Rosenstock, Lehrer und Kantor in Wiesbaden;
Lehrer Ludwig Neumann an der städtischen Gemeindeschule in
Frankfurt am Main; Lehrer John Horwitz in Koesfeld, Westfalen. Der
Sekretär der Berliner jüdischen Reformgemeinde, Lehrer H. Blumenthal,
wurde in den Kämpfen an der Ostgrenze leicht verwundet."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 16. Oktober 1914: "Von jüdischen Beamten, die in den Krieg
gezogen, sind auf dem Felde der Ehre gefallen: Lehrer Max Strauß
von der Israelitischen Religionsgesellschaft in München (aus Hofheim
stammend); Lehrer H. Isenberg von Andernach
am Rhein; Lehrer Benno Rosenstock, Lehrer und Kantor in Wiesbaden;
Lehrer Ludwig Neumann an der städtischen Gemeindeschule in
Frankfurt am Main; Lehrer John Horwitz in Koesfeld, Westfalen. Der
Sekretär der Berliner jüdischen Reformgemeinde, Lehrer H. Blumenthal,
wurde in den Kämpfen an der Ostgrenze leicht verwundet."
|
Zum Tod von David Rosenstock (1927)
 Artikel in "Der Israelit" vom 7. April 1927: "Eiterfeld,
18. März. Nach einer zehnwöchigen Krankenhausbehandlung ist David
Rosenstock, Eiterfeld, von uns gegangen, nachdem er noch drei Tage zu
Hause im Kreise seiner Lieben und Freunde hat verweilen dürfen. In einer
kleinen Gemeinde bedeutet das Hinscheiden eines Mitgliedes ein wirkliches
Absterben der Gemeinde. David Rosenstock war ein treues Glied der Gemeinde,
der in echtjüdischer Weise seinem Leben die Weihe gab, der in Frieden in
seiner Familie lebte und Frieden erstrebte in der Gemeinde, der in höchster
Achtung bei allen stand und ein froher Diener seines Gottes war. An seiner
Bahre schilderte Lehrer Oppenheimer - Eiterfeld in bewegten und formschönen
Worten das Lebensbild des Dahingeschiedenen und rühmte dessen weithin
bekannten Ehrennamen. Artikel in "Der Israelit" vom 7. April 1927: "Eiterfeld,
18. März. Nach einer zehnwöchigen Krankenhausbehandlung ist David
Rosenstock, Eiterfeld, von uns gegangen, nachdem er noch drei Tage zu
Hause im Kreise seiner Lieben und Freunde hat verweilen dürfen. In einer
kleinen Gemeinde bedeutet das Hinscheiden eines Mitgliedes ein wirkliches
Absterben der Gemeinde. David Rosenstock war ein treues Glied der Gemeinde,
der in echtjüdischer Weise seinem Leben die Weihe gab, der in Frieden in
seiner Familie lebte und Frieden erstrebte in der Gemeinde, der in höchster
Achtung bei allen stand und ein froher Diener seines Gottes war. An seiner
Bahre schilderte Lehrer Oppenheimer - Eiterfeld in bewegten und formschönen
Worten das Lebensbild des Dahingeschiedenen und rühmte dessen weithin
bekannten Ehrennamen.
Lehrer Schuster - Großkrotzenburg
sprach von des Verstorbenen Gemeinschaftsgefühl, Gemeinschaftswillen und
Gemeinschaftsgesinnung innerhalb seiner Familie, innerhalb der jüdischen und
politischen Gemeinde und von dessen Verbundensein mit unserem deutschen
Vaterland.
Eine große Beteiligung bezeugte das Ansehen des dahingegangenen Mannes. Der
Kriegerverein erwies seinem Kameraden die letzte Ehre. Seine Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zum Beisetzung von Fanny Rapp (1935)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Dezember 1935: "Burghaun, 8.
Dezember. Heute kam hier Frau Fanny Rapp aus Eiterfeld unter außerordentlich
großer Beteiligung zur Bestattung. Herr Rabbiner Dr. Cahn und Lehrer
Schuster, früher Eiterfeld, gedachten ihrer Tugenden in ehrenden Worten.
Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Dezember 1935: "Burghaun, 8.
Dezember. Heute kam hier Frau Fanny Rapp aus Eiterfeld unter außerordentlich
großer Beteiligung zur Bestattung. Herr Rabbiner Dr. Cahn und Lehrer
Schuster, früher Eiterfeld, gedachten ihrer Tugenden in ehrenden Worten.
Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Hinweis: in Eiterfeld geboren ist Lehrer Markus Rapp (1870-1936), siehe
Seite zu Merzhausen.
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige von M. Wiesenfelder (1889 / 1891 / 1899)
 Anzeige in "Der Israelit" vom 24. Dezember 1889: "Für
mein an Sabbat und Feiertagen geschlossenes Eisengeschäft suche per sofort
einen angehenden Kommis. Anzeige in "Der Israelit" vom 24. Dezember 1889: "Für
mein an Sabbat und Feiertagen geschlossenes Eisengeschäft suche per sofort
einen angehenden Kommis.
M. Wiesenfelder, Eisenhandlung, Eiterfeld. "
|
| |
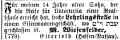 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. März 1891: "Für
meinen 14 Jahre alten Sohn, der die Reife für Untertertia einer
Realschule erreicht hat, suche Lehrlingsstelle in einem
Eisenwarengeschäft, wo Schabbat und Feiertag geschlossen ist. M.
Wiesenfelder, Eiterfeld (Hessen-Nassau)." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. März 1891: "Für
meinen 14 Jahre alten Sohn, der die Reife für Untertertia einer
Realschule erreicht hat, suche Lehrlingsstelle in einem
Eisenwarengeschäft, wo Schabbat und Feiertag geschlossen ist. M.
Wiesenfelder, Eiterfeld (Hessen-Nassau)." |
| |
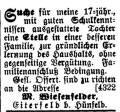 Anzeige in "Der Israelit" vom 22. Juni 1899: "Suche
für meine 17-jährige, mit mit guten Schulkenntnissen ausgestattete Tochter
eine Stelle in einer besseren Familie, zur gründlichen Erlernung des
Haushalts, ohne gegenseitige Vergütung. Familienanschluss Bedingung. Anzeige in "Der Israelit" vom 22. Juni 1899: "Suche
für meine 17-jährige, mit mit guten Schulkenntnissen ausgestattete Tochter
eine Stelle in einer besseren Familie, zur gründlichen Erlernung des
Haushalts, ohne gegenseitige Vergütung. Familienanschluss Bedingung.
Gefällige Offerten sind zu richten an die Adresse
M. Wiesenfelder, Eiterfeld bei Hünfeld."
|
Anzeige von Herz Wiesenfelder
(1890)
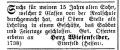 Anzeige in "Der Israelit" vom 27. März 1890: "Suche
für meinen 15 Jahre alten Sohn, welcher zwei Klassen von der Realschule
durchgemacht hat, auf Ostern Stelle als Lehrling in einem Geschäft, das
Sabbat und Feiertage geschlossen. Gefällige Offerten erbeten an Anzeige in "Der Israelit" vom 27. März 1890: "Suche
für meinen 15 Jahre alten Sohn, welcher zwei Klassen von der Realschule
durchgemacht hat, auf Ostern Stelle als Lehrling in einem Geschäft, das
Sabbat und Feiertage geschlossen. Gefällige Offerten erbeten an
Herz Wiesenfelder, Eiterfeld (Hessen)." |
Anzeige von David Rosenstock (1911)
 Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 12. März
1911: "Suche für meine Tochter, 15 Jahre alt, welche die
Handelsschule besucht, per 1. oder 15. April dieses Jahres Stellung als Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 12. März
1911: "Suche für meine Tochter, 15 Jahre alt, welche die
Handelsschule besucht, per 1. oder 15. April dieses Jahres Stellung als
angehende
Buchhalterin. Samstags und Feiertage geschlossen.
David Rosenstock.
Eiterfeld, Kreis Hünfeld." |
Anzeige von Schuhmachermeister Selig Wiesenfelder
(1912)
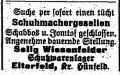 Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15.
November 1912: Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15.
November 1912:
"Suche per sofort einen tüchtigen Schuhmachergesellen.
Schabbos und Jomtof (Feiertage) geschlossen. Angenehme dauernde
Stellung.
Selig Wiesenfelder. Schuhwarenlager. Eiterfeld, Kreis
Hünfeld". |
Hochzeitsanzeige von Else Adler und Max Lomnitz
(1925)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Oktober 1925: "Gott
sei gepriesen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Oktober 1925: "Gott
sei gepriesen.
Else Adler - Max Lomnitz. Verlobte.
Fulda, Rhönstraße 17 - Eiterfeld." |
Hochzeitsanzeige von Hanna geb.
Rapp und Karl Kann (1925)
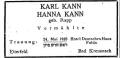 Anzeige in "Der Israelit" vom 21. Mai 1925: Anzeige in "Der Israelit" vom 21. Mai 1925:
"Karl Kann - Hanna Kann geb. Rapp.
Vermählte.
Trauung: 24. Mai 1925 - Rosch Chodesch Siwan.
Hotel Deutsches Hans Fulda.
Eiterfeld - Bad Kreuznach." |
Verlobungsanzeige von Bella
Kissinger und Karl Oppenheimer (1926)
 Anzeige in "Der Israelit" vom 1. Januar 1926: "Gelobt
sei Gott. Anzeige in "Der Israelit" vom 1. Januar 1926: "Gelobt
sei Gott.
Bella Kissinger - Karl Oppenheimer Volksschullehrer.
Verlobte
Urspringen Dezember 1925 Tewet 5686 Eiterfeld -
Gersfeld." |
Verlobungsanzeige von Rosa
Rosenstock und Samuel Fichtelberger (1926)
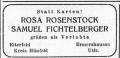 Anzeige in "Israelitisches
Familienblatt" vom 19. August 1926: "Statt Karten! Anzeige in "Israelitisches
Familienblatt" vom 19. August 1926: "Statt Karten!
Rosa Rosenstock - Samuel Fichtelberger grüßen als Verlobte
Eiterfeld Kreis Hünfeld -
Ermershausen Unterfranken." |
|
Kennkarte
aus der NS-Zeit |
| |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |
| |
Kennkarte
für den in Eiterfeld
geborenen Seelig Wiesenfelder |
 |
|
| |
Kennkarte (ausgestellt in
Dieburg 1939) für Seelig Wiesenfelder (geb. 16. April 1877 in
Eiterfeld),
Kaufmann, wohnhaft in Frankfurt am Main, am 22. November 1941 deportiert
ab Frankfurt
nach Kowno (Kauen) Fort IX, wo er am 25. November 1941 ermordet
wurde |
|
Sonstiges
Bericht von K. Wetzell (Witwe von
Dr. W. Wetzell) über die Zeit in Eiterfeld in der NS-Zeit (1971)
 Artikel in der Zeitschrift "Yediot shel Irgun Ole Breslau" vom April 1971:
Artikel in der Zeitschrift "Yediot shel Irgun Ole Breslau" vom April 1971:
"Sehr geehrter Herr Lewin...
Wir, d.h. mein Mann und ich Dr. W. Wetzell, waren Verfolgte des
Nazi-Regimes, weil wir in Eiterfeld bei Fulda die jüdische Gemeinde
geschützt haben. Rabbiner Dr. Oppenheimer (gemeint: Lehrer Oppenheimer),
von ihm oder einem anderen Eiterfelder wüsste ich gerne die Adresse, hatte
uns nach unsren Umzug (dem Fürsteneck Bewohner, einem schrecklichen Nazi
wollten wir aus den Augen kommen), nach Schlesien einen Dank Brief
geschrieben, den wir aber vernichteten, weil uns Haussuchung drohte. Als wir
ein Arbeitskommando von Buchenwald, das unser Kranichfelder Oberschloß
aufbauen sollte, jahrelang recht unbequem für die Behörden - Erleichterungen
durchsetzten, wurden wir zum KZ eingegeben. Doch unser Vorsitzender der
Ärztekammer erklärte, er könne uns keinesfalls entbehren. Wir abgekämpften
Schlanken hätten es auch nicht ausgehalten. Ob sie jemanden aus der
jüdischen Gemeinde Eiterfeld Rhön ausfindig machen könnten,
vielleicht zufällig?... Ihre K. Wetzell.
" |
Zur Geschichte der Synagoge
Die Synagoge in Eiterfeld, ein Fachwerkbau, ist zwischen 1827
und 1830 erbaut worden. Sie hatte 52 Plätze für Männer und 24 für Frauen. Es
bestand bereits vor 1827 eine Synagoge, die in diesem Jahr als baufällig
bezeichnet wurde und durch einen Neubau ersetzt werden sollte. Der Bau
wurde durch Maurermeister Sebastian Kehl aus Oberufhausen ausgeführt. Mit ihm
wurde am 7. Mai ein Vertrag unterzeichnet, den er sowie die damaligen
Synagogenältesten unterzeichneten. 1830 wurde der Bau fertiggestellt; die
Schulchronik des Ortes erwähnt in diesem Jahr einen Synagogenneubau.
In den kommenden Jahrzehnten wurde mehrfach die Synagoge renoviert, erstmals
schon im September 1849 am Dach der Synagoge. Am 17. Januar 1884 konnte mit
einem Festzug eine neue Torarolle in die Synagoge gebracht werden.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge zerstört
und zum Einsturz gebracht. Noch brauchbare Steine wurden von Nachbarn
abtransportiert und andersweitig verwendet. Auf dem Synagogengrundstück wurde in
den 1950er-Jahren ein Kolonialwarenladen (Flachdachbau) erstellt. Diese
Flachdachbau wurde im Mai 2011 abgebrochen. An der Stelle wurde daraufhin ein
Parkplatzes angelegt.
Die zur Erinnerung an die jüdische Gemeinde am 22. November 2005 in
Anwesenheit von Martin Löwenberg angebrachte kleine Gedenktafel wurde
zwischen Gründonnerstag und Ostersamstag 2008 abgeschraubt und in einen
Container geworfen. In der Tatortnähe wurden damals Flugblätter der
"NPD" gefunden. Drei Jugendliche aus der rechten Szene konnten
ausfindig gemacht und im August 2008 in Hünfeld vor Gericht gestellt werden.
Die Gedenktafel wurde wieder angebracht. Eine neue Gedenk- und
Hinweistafel erinnert seit dem November 2018 an die jüdische Gemeinde
und ihre Synagoge.
Adresse/Standort der Synagoge: Fürstenecker
Straße 3
Fotos
Die Synagoge in
Eiterfeld
(Fotos aus juden-in-eiterfeld.de) |
 |
 |
| |
Foto vor 1938: die
Synagoge ist links zu sehen
(Giebel in der Mitte der Häuser ragt in die Straße hinein) |
Noch erhalten:
der Schlüssel zur Synagoge |
| |
|
|
Bebauung des
Synagogengrundstückes
in den 1960er-Jahren
(Foto aus juden-in-eiterfeld.de) |
 |
|
| |
Der Flachbau eines
Einkaufsmarktes
wurde auf dem Grundstück erstellt. |
|
Gedenken vor Ort
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 6.4.2009) |
|
|
 |
 |
 |
| Die (kaum
erkennbare) kleine Gedenktafel in Eiterfeld "Zur Erinnerung an die
jüdische Gemeinde Eiterfeld 1701-1939" |
| |
|
|
Namenstafel (seit
2009)
(Foto: Margaretha Reifert-Lutz) |
 |

 |
| |
2009 wurde die
bisherige Gedenktafel (links) durch eine Namenstafel (rechts) ergänzt mit
dem Text: "Wir gedenken unserer jüdischen Mitbürger. Katz - Lomnitz
- Müller - Nussbaum - Oppenheimer - Rapp - Rosenstock - Schuster -
Strauss - Weinberg - Wiesenfelder". |
| |
|
Gedenktafel von 2018
(Foto: juden-in-eiterfeld.de) |
 |
| |
Die
Gedenktafel von 2018 mit dem Text: "Ehemalige jüdische Synagoge. Hier stand
die Synagoge der jüdischen Gemeinde Eiterfeld von 1830 bis 1938. In der
Nacht vom 9. zum 10. November wurde die Synagoge durch die von den
Nationalsozialisten in ganz Deutschland organisierte Pogromnacht zerstört.
Heute erinnert diese Gedenktafel an den Standort der ehemaligen Synagoge von
Eiterfeld. Heimat und Geschichtsverein Eiterfeld e.V." |
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| Mai 2012:
In Buchenau werden "Stolpersteine"
verlegt |
Artikel in der "Hersfelder
Zeitung" vom 29. Mai 2012: "Künstler Gunter Demnig verlegt
Stolpersteine gegen das Vergessen in Buchenau. Verbeugung vor
Opfern.
Buchenau. Vor 70 Jahren, im Jahr 1942 wurden von den Nazis fünf
jüdische Buchenauer verschleppt. Zum Gedenken sind jetzt vor ihrem
ehemaligen Wohnhaus an der Hermann Lietz Straße 3 Stolpersteine verlegt
worden - fünf Gedenksteine mit der Namen der später Ermordeten wurden in
den Boden gepflastert: Helene, Feilchen, Berta, Malchen und Levi
Rosenstock..."
Link
zum Artikel |
| |
|
November 2018:
Neue Gedenktafel zur Erinnerung an
die jüdische Gemeinde und ihre Synagoge |
Artikel von Christa Desoi in der "Hersfelder
Zeitung" vom 12. November 2018: "Verwüstet und abgerissen. Neue
Gedenktafel erinnert an Synagoge und jüdische Gemeinde in Eiterfeld
Eiterfeld. Etwa 100 Eiterfelder waren gekommen, als am Freitagabend am
Platz der ehemaligen Synagoge eine Gedenktafel angebracht und der
Eiterfelder Juden gedacht wurde.
Die Reichspogromnacht, in der deutschlandweit Synagogen, Geschäfte und
Häuser jüdischer Bürger angezündet und verwüstet wurden, liegt 80 Jahre
zurück. Sie gilt als der Auftakt zur systematischen Verfolgung der Juden
durch die Nationalsozialisten. Monatelang hatte der Heimat- und
Geschichtsverein recherchiert. Was war aus den ehemaligen jüdischen
Eiterfelder Bürgern geworden? Hatten sie das Grauen des Nationalsozialismus
überlebt? Margaretha Reifert-Lutz war es gelungen, Kontakt zu Isaac Levy in
Amerika herzustellen. Dessen Großvater Isaac Müller betrieb auf dem Gelände
der heutigen Bäckerei an der Fürstenberger Straße bis 1936 ein kleines
Lebensmittelgeschäft. Unmittelbar daneben stand von 1701 bis 1939 die
Synagoge. 1936 verkaufte die Familie Levy Haus und Grundstück und wanderte
gezwungenermaßen aus in die USA. Heute dient das einstmalige
Synagogengrundstück als Parkplatz. Genau dort, an einer Gabionenwand, wurde
die Gedenktafel befestigt. Von Isaac Levy erhielt Margaretha Reifert-Lutz
den ehemaligen Eingangsschlüssel zur Synagoge. Diesen hatten die Müllers bei
ihrer Auswanderung als Erinnerungsstück mitgenommen. 'In der Nacht vom 9.
und 10. November 1938, in der von den Nationalsozialisten in ganz
Deutschland organisierten Pogromnacht, wurde die Eiterfelder Synagoge wegen
der Nachbargebäude nicht abgebrannt, sondern verwüstet und später
abgerissen', erklärte Alfred Henning, der Vorsitzende des Heimat- und
Geschichtsvereins Eiterfeld. Sehr einfühlsam umrahmte Clemens Lutz die Feier
mit drei alten jüdischen Liedern auf seiner Klarinette. Dechant Markus
Blümel sprach das Kaddisch, das Totengebet der Juden. Bürgermeister
Hermann-Josef Scheich erinnerte an die Verfolgung der jüdischen Bewohner:
'Die Hetzkampagnen mit Worten und Taten waren insbesondere gesteuert vom
NS-Kreisbauernführer und Domänenpächter Salzmann in Fürsteneck. Ein
Höhepunkt der Judenverfolgung war der berüchtigte Galgen, den Salzmann am 1.
April 1933 in der Ortsmitte hat aufstellen lassen. 1936 lebten noch 44 Juden
im Dorf, 1938 noch sechs Juden, 1939 existierte die jüdische Gemeinde nicht
mehr.' Scheich erinnerte an die Allgegenwärtigkeit von Rassismus,
Antisemitismus und Rechtspopulismus gerade in der heutigen Zeit. Weitere
Hinweisschilder an anderen für die Ortsgeschichte wichtigen Orten sollen mit
Blick auf die 1175-Jahrfeier Eiterfelds im Jahr 2020 folgen."
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Quellen:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 153-154. |
 | Keine Artikel bei Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 und dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 12. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 363-364. |
 | Hartmut Dönch: Über die israelitische Gemeinde und
die israelitische Schule in Eiterfeld. In: Rudolf Christl (Hrsg.): 1150
Jahre Dorf und Markt Eiterfeld. S. 312-317. |
 | Elisabeth Sternberg-Siebert: Jüdisches Leben im
Hünfelder Land - Juden in Burghaun. Petersberg 2001. online:
Seite zu
Eiterfeld mit Fotos, dazu
Liste
der Opfer des Holocaust. |
 | 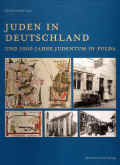 Juden in Deutschland und 1000 Jahre Judentum in Fulda.
Juden in Deutschland und 1000 Jahre Judentum in Fulda.
hrsg. von Michael Imhof. Zukunft Bildung Region Fulda e. V.
Erschienen im Michael Imhof Verlag
Petersberg 2011.
24 x 30 cm, 440 Seiten, 700 S/W und 200 Farbabbildungen, Hardcover. ISBN 978-3-86568-673-2
(D) 44,00 € CHF 62,90 (A) 45,25 €
Zu Eiterfeld Beitrag von Elisabeth Sternberg-Siebert S. 291-297. Zu
Buchenau Beitrag von ders.. S. 283. |
 | 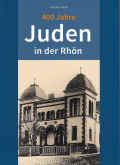 Michael
Imhof: 400 Jahre Juden in der Rhön. Herausgegeben von Zukunft Bildung Region Fulda e. V. Michael
Imhof: 400 Jahre Juden in der Rhön. Herausgegeben von Zukunft Bildung Region Fulda e. V.
21 x 29 cm, 344 Seiten, 562 Farb- und 59 S/W-Abbildungen, Klappenbroschur. ISBN 978-3-7319-0476-2
(D) 39,95 €, (A) 41,10 €, CHF 45,90.
Erschienen im Michael Imhof-Verlag.
Informationsseite
zur Publikation mit Downloads und "Blick ins Buch"
Seit 400 Jahren waren Juden in den Landstädten und Dörfern der hessischen Rhön urkundlich verbürgt. Ende des Mittelalters und noch zu Beginn der Frühen Neuzeit aus ihren angestammten Wohngebieten vertrieben, fanden viele von ihnen auf den Territorien von Ritterschaften und der Universität Würzburg auch in der Rhön eine neue Bleibe. Erst mit der rechtlichen Gleichstellung der Juden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte für sie ein wirtschaftlicher und sozialer Prozess ein, der den Namen Emanzipation verdient. In den Gemeinden der Rhön wurden sie zu wesentlichen Wegbereitern der Moderne. Dieser Entwicklung stellte sich ein zunehmender Antisemitismus schon in der Kaiserzeit entgegen. Als mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 der Judenhass zum Regierungsprogramm wurde, begann auch für die in der Rhön lebenden Juden eine Zeit der Demütigungen und Verfolgungen mit dem Ziel ihrer Vertreibung und
Vernichtung. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Eiterfeld
Hesse-Nassau. The Jewish community, numbering 105 (18 % of the total) in 1885,
maintained an elementary school (1861-1933) and absorbed the last Jews in
Buchenau and Erdmannrode, shouldering the burden of their debts (1928). The once
larger Erdmannrode community - numbering 1928 in 1861 - dwindled to one
family in 1927. Owing to Nazi persecution, Eiterfeld's expanded community
disbanded ten years later und by November 1938 most of the Jews had left.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|