|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge
in Offenbach
Offenbach am Main
(Kreisstadt,
Hessen)
Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte der Stadt
Hier: Berichte zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde (1850-1938)
Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit
Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Offenbach wurden in jüdischen Periodika
gefunden.
Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.
Hinweis: die Texte wurden
dankenswerterweise von Susanne Reber (Mannheim) abgeschrieben.
Übersicht:
Berichte
zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Über
den "Baron Offenbach" bzw. "Baron von Frank", den jüdischen
Sektierer Jakob Frank
(Jankiew Lejbowitz, 1726 in Galizien - 1791 in Offenbach am Main)
vgl. den Wikipedia-Artikel
"Jakob Frank"
beim Verfasser "Leonhard" handelt es sich um den Mineralogen Karl Cäsar
von Leinhard (1779-1862).
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. November 1855: "In
diesen Tagen las ich die Memoiren des rühmlichst bekannten Mineralogen
von Leonhard ('Aus unsrer Zeit in meinem Leben. Stuttgart. 1854'.)
Derselbe, in Hanau seine Kindheit verlebend, spricht S. 26 aus eigener
Anschauung über den berüchtigten Sektierer Jakob Frank (nicht:
Joseph Frank), der in dem nahen Offenbach eine so glänzende, aber kurze
(1788-1791) Rolle spielte. Er war Schabbathaier, gab Schabbathai Zewi für
Christus aus und betete zu ihm, so Judentum und Christentum zugleich belügend.
Die Schilderung Leonhards als eines Augenzeugen ist umso interessanter,
als sie auch einiges Persönliche enthält, und folge daher anbei.
'In der Zeit, von welcher ich rede, 1788, tauchte im nahen
Offenbach die allerseltsamste, geheimnisvollste Erscheinung auf; sie wurde
Brennpunkt der Neugierde, des Erstaunens und hatte in der Tat etwas Phänomenhaftes.
Man würde mir vielleicht Unvollständigkeit vorwerfen, wenn ich die Sache
aufzuführen vergäße. Mit Bewilligung des Fürsten von Isenburg siedelte
sich ein Baron Frank in der Stadt an. Einige nannten ihn Graf, manche
wollten sogar einen Fürsten aus dem Manne machen. Er bezog ein
schlossartiges Gebäude, lebte auf glanzvollem, prächtigem Fuße, seine
Haus-Einrichtung war die kostbarste, üppigste, die Treppen mit weichen
Teppichen belegt; alles hatte ein festliches Ansehen. Frank hielt sich
eine Leibwache und bald mehrte sich das Gefolge, sodass es bis zu tausend
Personen anwuchs, Männer, Weiber, Jungfrauen, Kinder. Seine Anhänger
fanden hier einen zuverlässigen Sammelort, freundliche Aufnahme und
reichliche Unterstützung. Für alle trug Frank Sorge, alle lebten, ruhig
und friedsam, auf ihres Oberhauptes Kosten. Sie bildeten eine kleine,
nicht geschäftige, nur genießende Welt; keiner dieser Menschen trieb
irgendeinen Nahrungszweig. Schabbathaische Juden, Geschenke bringend,
wallfahrteten in Menge aus dem Osten nach Offenbach; die Stadt gewann
durch solche Besuche und durch vorübergehende Niederlassungen. Das
Ereignis machte tiefen Eindruck, von Mund zu Munde pflanzte sich die Kunde
fort. Wenige Tage gingen vorüber, ohne dass mein Vater nicht Briefe
erhielt von Offenbacher Befreundeten; einzelne Wahrnehmungen, Bemerkungen,
Vermutungen wurden mitgeteilt; von allem wusste niemand Rechenschaft zu
geben. Mit seinen Kindern, einer Tochter und zwei Söhnen, lebte Frank
sehr zurückgezogen. Wenigen war der geheimnisvolle Ansiedler zugänglich;
in der Regel wurde niemand vorgelassen; selbst die Blicke Neugieriger
suchte er zu meiden. Mit gezogenem Säbel hielten zwei Gardisten am
Hauseingange Wache, zwei andere vor des Barons Zimmertür; dem Arzt allein
blieb freier Zutritt gestattet. Übrigens genossen Vater, Kinder und Anhänger
den unbescholtensten Ruf; nie hörte man von Unfrieden mit den Nachbarn.
Sonntags, wenn Frank mit einem Gepränge, jenem der Großen des Orients
vergleichbar, zur Messe nach dem Dorf Bürgel fuhr, zeigte er sich. Jeder
bewunderte bei solcher Gelegenheit die gemessene Haltung, das begeisterte,
zugleich stolze, gebieterische Wesen; die Miene war streng, unbiegsam,
fast bös, man sah, er verstand Achtung und Gehorsam einzuflößen.
Lebhafte Erinnerungen bewahre ich von mehreren solcher
Feieraufzüge. Vom üblichen Kirchengebrauche abweichend, behielt
Frank, das Haupt nicht entblößend, sein rotes Mützchen auf. Er betete
weder kniend, noch stehend, noch sitzend, sondern nach orientalischer
Weise, auf den Boden hingestreckt, mit zur Erde gewendetem Angesicht. Ein
reicher Teppich wurde ausgebreitet für solche Andachts-Verrichtung. Zur
Ergänzung dieser Mitteilung muss ich erzählen, was wir nach und nach über
Einzelheiten aus dem früheren Leben Franks hörten. Polen war das
Heimatland des Abenteurers. In seiner Jugend trieb er Branntwein-Brennerei
und machte sich später als Kabbalist, als jüdischer Geheimnis-Lehrer in
der Krim berühmt und in gewissen Gegenden der Türkei. Etwa dreißig
Jahre früher, als Frank nach Offenbach kam, wurde von ihm in Podolien der
Schabbathaismus, das judaisierende Christentum verkündigt. Man rühmte,
dass er nicht gleich seinen Vorgängern, sich durch Gaukelspiel angekündigt,
sondern vermittelst der ihm verliehenen Beredungs- und Überredungsgabe
gewirkt. Sein vornehmes Wesen machte ihn geltend, dadurch erhielt er den
überwiegenden Einfluss: ganze Gemeinden gingen über. Mit heftigster
Erbitterung, wütig, verfolgten die Rabbinen den Sekten-Häuptling und
dessen Anhänger. Strenge Befehle ergingen gegen die neuen Glaubenszünftler;
selbst Flammentod drohte ihnen. Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. November 1855: "In
diesen Tagen las ich die Memoiren des rühmlichst bekannten Mineralogen
von Leonhard ('Aus unsrer Zeit in meinem Leben. Stuttgart. 1854'.)
Derselbe, in Hanau seine Kindheit verlebend, spricht S. 26 aus eigener
Anschauung über den berüchtigten Sektierer Jakob Frank (nicht:
Joseph Frank), der in dem nahen Offenbach eine so glänzende, aber kurze
(1788-1791) Rolle spielte. Er war Schabbathaier, gab Schabbathai Zewi für
Christus aus und betete zu ihm, so Judentum und Christentum zugleich belügend.
Die Schilderung Leonhards als eines Augenzeugen ist umso interessanter,
als sie auch einiges Persönliche enthält, und folge daher anbei.
'In der Zeit, von welcher ich rede, 1788, tauchte im nahen
Offenbach die allerseltsamste, geheimnisvollste Erscheinung auf; sie wurde
Brennpunkt der Neugierde, des Erstaunens und hatte in der Tat etwas Phänomenhaftes.
Man würde mir vielleicht Unvollständigkeit vorwerfen, wenn ich die Sache
aufzuführen vergäße. Mit Bewilligung des Fürsten von Isenburg siedelte
sich ein Baron Frank in der Stadt an. Einige nannten ihn Graf, manche
wollten sogar einen Fürsten aus dem Manne machen. Er bezog ein
schlossartiges Gebäude, lebte auf glanzvollem, prächtigem Fuße, seine
Haus-Einrichtung war die kostbarste, üppigste, die Treppen mit weichen
Teppichen belegt; alles hatte ein festliches Ansehen. Frank hielt sich
eine Leibwache und bald mehrte sich das Gefolge, sodass es bis zu tausend
Personen anwuchs, Männer, Weiber, Jungfrauen, Kinder. Seine Anhänger
fanden hier einen zuverlässigen Sammelort, freundliche Aufnahme und
reichliche Unterstützung. Für alle trug Frank Sorge, alle lebten, ruhig
und friedsam, auf ihres Oberhauptes Kosten. Sie bildeten eine kleine,
nicht geschäftige, nur genießende Welt; keiner dieser Menschen trieb
irgendeinen Nahrungszweig. Schabbathaische Juden, Geschenke bringend,
wallfahrteten in Menge aus dem Osten nach Offenbach; die Stadt gewann
durch solche Besuche und durch vorübergehende Niederlassungen. Das
Ereignis machte tiefen Eindruck, von Mund zu Munde pflanzte sich die Kunde
fort. Wenige Tage gingen vorüber, ohne dass mein Vater nicht Briefe
erhielt von Offenbacher Befreundeten; einzelne Wahrnehmungen, Bemerkungen,
Vermutungen wurden mitgeteilt; von allem wusste niemand Rechenschaft zu
geben. Mit seinen Kindern, einer Tochter und zwei Söhnen, lebte Frank
sehr zurückgezogen. Wenigen war der geheimnisvolle Ansiedler zugänglich;
in der Regel wurde niemand vorgelassen; selbst die Blicke Neugieriger
suchte er zu meiden. Mit gezogenem Säbel hielten zwei Gardisten am
Hauseingange Wache, zwei andere vor des Barons Zimmertür; dem Arzt allein
blieb freier Zutritt gestattet. Übrigens genossen Vater, Kinder und Anhänger
den unbescholtensten Ruf; nie hörte man von Unfrieden mit den Nachbarn.
Sonntags, wenn Frank mit einem Gepränge, jenem der Großen des Orients
vergleichbar, zur Messe nach dem Dorf Bürgel fuhr, zeigte er sich. Jeder
bewunderte bei solcher Gelegenheit die gemessene Haltung, das begeisterte,
zugleich stolze, gebieterische Wesen; die Miene war streng, unbiegsam,
fast bös, man sah, er verstand Achtung und Gehorsam einzuflößen.
Lebhafte Erinnerungen bewahre ich von mehreren solcher
Feieraufzüge. Vom üblichen Kirchengebrauche abweichend, behielt
Frank, das Haupt nicht entblößend, sein rotes Mützchen auf. Er betete
weder kniend, noch stehend, noch sitzend, sondern nach orientalischer
Weise, auf den Boden hingestreckt, mit zur Erde gewendetem Angesicht. Ein
reicher Teppich wurde ausgebreitet für solche Andachts-Verrichtung. Zur
Ergänzung dieser Mitteilung muss ich erzählen, was wir nach und nach über
Einzelheiten aus dem früheren Leben Franks hörten. Polen war das
Heimatland des Abenteurers. In seiner Jugend trieb er Branntwein-Brennerei
und machte sich später als Kabbalist, als jüdischer Geheimnis-Lehrer in
der Krim berühmt und in gewissen Gegenden der Türkei. Etwa dreißig
Jahre früher, als Frank nach Offenbach kam, wurde von ihm in Podolien der
Schabbathaismus, das judaisierende Christentum verkündigt. Man rühmte,
dass er nicht gleich seinen Vorgängern, sich durch Gaukelspiel angekündigt,
sondern vermittelst der ihm verliehenen Beredungs- und Überredungsgabe
gewirkt. Sein vornehmes Wesen machte ihn geltend, dadurch erhielt er den
überwiegenden Einfluss: ganze Gemeinden gingen über. Mit heftigster
Erbitterung, wütig, verfolgten die Rabbinen den Sekten-Häuptling und
dessen Anhänger. Strenge Befehle ergingen gegen die neuen Glaubenszünftler;
selbst Flammentod drohte ihnen. |
 Sie zerstoben in alle Winde. Frank wurde verhaftet auf einer
Wallfahrt-Reise nach Saloniki. Als Christen, der sich zu seinem
Juden-Anhang hielt und Proselyten machte, führte man ihn nach Czenstochau
an der Warthe. Hier blieb er mehrere Jahre in enger Haft und erhielt seine
Freiheit erst wieder, als die Russen diese Festung eroberten. Angefeuert
durch den früher erlangten Beifall, immer höher strebend, durchzog unser
Glücksritter Polen, Böhmen und Mähren, überall seine Religionslehre
verbreitend. Gleichgesinnte, Anhänger brandschatzte er und trieb nach und
nach die bedeutendsten Summen auf, sodass derselbe zuletzt, wie ein Fürst,
mit zahlreichem Gefolge reiste. Seine Begleiter, vom Geheimschreiber bis
zum Stallknecht, waren ohne Ausnahme getaufte Juden. In Wien, wo Frank
1778 anlangte, entfaltete er einen Prunk, machte einen Aufwand, das Vermögen
eines Privatmannes weit übersteigend. Niemand kannte die Quelle seiner
Geld-Zuflüsse und so erachtete die Polizei für rätlich, den Mann
auszuweisen, ohne dass man übrigens sonst was von ihm gefürchtet hätte.
Nun – wählte das Oberhaupt der 'Nicht-Juden' Brünn zum Aufenthalt
und die 'Brüder' bedachten ihn so reichlich, dass ihm oft ganze Fässer
mit Geld zugeführt wurden. Hier verrichtete Frank seine Andacht stets auf
freiem Felde. Er fuhr dahin in prachtvollem Wagen, umgeben mit Reitern, grün
und rot, wie Uhlanen gekleidet, von Gold strotzend. An ihren Lanzenspitzen
hatten sie als Feldzeichen Sonne und Mond, Adler und Hirsche. Eine ganz
eigene Zeremonie fand nach dem gebet statt: Ein Reiter, der auf
stattlichem, mit zahllosen Schellen behangenem Rosse dem Herren-Wagen
gefolgt, goss auf die Bodenstelle, wo das Gebet verrichtet worden war,
Wasser aus einem Schlauche. Ein abermaliger Versuch, in Wien den Sitz zu
nehmen, lief, dem ersten gleich, fruchtlos ab. Frank wurde von der Polizei
nicht geduldet, obwohl er manche Kunstgriffe anwendete, unter anderem
vorgab, eine Fürstin im Norden unterstütze ihn. Vier Jahre nach
erfolgter Niederlassung in Offenbach brach der Tod aufs Unerwartetste alle
Verhältnisse. Frank starb plötzlich am Schlagfluss. Dies war der verhängnisvolle
Wendepunkt für die Familien-Beziehungen; die Hoffnungen der Kinder gingen
nicht in Erfüllung, sie wurden hinabgeschleudert vom Ungemach in Sorgen
und Bekümmernisse, sie gerieten in Not. Die Geld-Zuflüsse versiegten,
man war genötigt, Schulden zu machen. Schwand jede Täuschung mit dem
Helden des Schauspiels, oder hatten seine Stellvertreter ihre Rollen nicht
zum Besten eingelernt? Die Sekte verlor den Halt in Deutschland.
Achthundert Menschen betrauerten ihren Schutzherrn, ihren Wohltäter, dem
sie fast göttliche Ehrfurcht erwiesen, der ihnen für unsterblich
gegolten. Der letzte glanzvolle Aufzug war das Leichenbegängnis.
Totenstille herrschte in den Straßen Offenbachs, obgleich man vom Gewühl
fortgedrängt wurde. Voran zweihundert Frauen und Jungfrauen, weiß
gekleidet, das Haar durchflochten mit weißen Bändern, brennende
Wachskerzen in der Hand. Ihnen folgte die Leiche in rotseidenem Talar mit
Hermelin besetzt; den Sarg, ausgeschlagen mit weißem Atlas, geziert mit
Gold-Fransen und Quasten, trug die Dienerschaft. Daran schlossen sich, von
Wehmut und Tränen ergriffen, die drei Kinder, endlich siebzig Mann
Leibgarde und alle männlichen Anhänger der Glaubenszunft, brennende
Fackeln tragend, die Haare mit weißen Bändern gebunden, an den Armen weißen
Flor. Als man die Gruft erreicht hatte, erhob das ganze Geleit ein
schmerzvolles Jammergeschrei. Zuletzt warf jeder Anwesende eine Hand voll
Erde ins Grab. Ob es gegründet, dass die 'Polen-Fürstin', wie man
sich erzählte, gedrängt von ihren Gläubigern, bei Nacht und Nebel in Männertracht
entfliehen musste, dies bleibe dahin gestellt.'" Sie zerstoben in alle Winde. Frank wurde verhaftet auf einer
Wallfahrt-Reise nach Saloniki. Als Christen, der sich zu seinem
Juden-Anhang hielt und Proselyten machte, führte man ihn nach Czenstochau
an der Warthe. Hier blieb er mehrere Jahre in enger Haft und erhielt seine
Freiheit erst wieder, als die Russen diese Festung eroberten. Angefeuert
durch den früher erlangten Beifall, immer höher strebend, durchzog unser
Glücksritter Polen, Böhmen und Mähren, überall seine Religionslehre
verbreitend. Gleichgesinnte, Anhänger brandschatzte er und trieb nach und
nach die bedeutendsten Summen auf, sodass derselbe zuletzt, wie ein Fürst,
mit zahlreichem Gefolge reiste. Seine Begleiter, vom Geheimschreiber bis
zum Stallknecht, waren ohne Ausnahme getaufte Juden. In Wien, wo Frank
1778 anlangte, entfaltete er einen Prunk, machte einen Aufwand, das Vermögen
eines Privatmannes weit übersteigend. Niemand kannte die Quelle seiner
Geld-Zuflüsse und so erachtete die Polizei für rätlich, den Mann
auszuweisen, ohne dass man übrigens sonst was von ihm gefürchtet hätte.
Nun – wählte das Oberhaupt der 'Nicht-Juden' Brünn zum Aufenthalt
und die 'Brüder' bedachten ihn so reichlich, dass ihm oft ganze Fässer
mit Geld zugeführt wurden. Hier verrichtete Frank seine Andacht stets auf
freiem Felde. Er fuhr dahin in prachtvollem Wagen, umgeben mit Reitern, grün
und rot, wie Uhlanen gekleidet, von Gold strotzend. An ihren Lanzenspitzen
hatten sie als Feldzeichen Sonne und Mond, Adler und Hirsche. Eine ganz
eigene Zeremonie fand nach dem gebet statt: Ein Reiter, der auf
stattlichem, mit zahllosen Schellen behangenem Rosse dem Herren-Wagen
gefolgt, goss auf die Bodenstelle, wo das Gebet verrichtet worden war,
Wasser aus einem Schlauche. Ein abermaliger Versuch, in Wien den Sitz zu
nehmen, lief, dem ersten gleich, fruchtlos ab. Frank wurde von der Polizei
nicht geduldet, obwohl er manche Kunstgriffe anwendete, unter anderem
vorgab, eine Fürstin im Norden unterstütze ihn. Vier Jahre nach
erfolgter Niederlassung in Offenbach brach der Tod aufs Unerwartetste alle
Verhältnisse. Frank starb plötzlich am Schlagfluss. Dies war der verhängnisvolle
Wendepunkt für die Familien-Beziehungen; die Hoffnungen der Kinder gingen
nicht in Erfüllung, sie wurden hinabgeschleudert vom Ungemach in Sorgen
und Bekümmernisse, sie gerieten in Not. Die Geld-Zuflüsse versiegten,
man war genötigt, Schulden zu machen. Schwand jede Täuschung mit dem
Helden des Schauspiels, oder hatten seine Stellvertreter ihre Rollen nicht
zum Besten eingelernt? Die Sekte verlor den Halt in Deutschland.
Achthundert Menschen betrauerten ihren Schutzherrn, ihren Wohltäter, dem
sie fast göttliche Ehrfurcht erwiesen, der ihnen für unsterblich
gegolten. Der letzte glanzvolle Aufzug war das Leichenbegängnis.
Totenstille herrschte in den Straßen Offenbachs, obgleich man vom Gewühl
fortgedrängt wurde. Voran zweihundert Frauen und Jungfrauen, weiß
gekleidet, das Haar durchflochten mit weißen Bändern, brennende
Wachskerzen in der Hand. Ihnen folgte die Leiche in rotseidenem Talar mit
Hermelin besetzt; den Sarg, ausgeschlagen mit weißem Atlas, geziert mit
Gold-Fransen und Quasten, trug die Dienerschaft. Daran schlossen sich, von
Wehmut und Tränen ergriffen, die drei Kinder, endlich siebzig Mann
Leibgarde und alle männlichen Anhänger der Glaubenszunft, brennende
Fackeln tragend, die Haare mit weißen Bändern gebunden, an den Armen weißen
Flor. Als man die Gruft erreicht hatte, erhob das ganze Geleit ein
schmerzvolles Jammergeschrei. Zuletzt warf jeder Anwesende eine Hand voll
Erde ins Grab. Ob es gegründet, dass die 'Polen-Fürstin', wie man
sich erzählte, gedrängt von ihren Gläubigern, bei Nacht und Nebel in Männertracht
entfliehen musste, dies bleibe dahin gestellt.'" |
|
|
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Juni
1869: "Eine Kontroverse über 'Baron von Frank' Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Juni
1869: "Eine Kontroverse über 'Baron von Frank'
Am 12. Dezember 1791 starb zu Offenbach am Main eine mysteriöse
Persönlichkeit, die einen fürstlichen Hof im dortigen Städtchen hielt, und
welchen in jüngster Zeit Gegenstand eines literarischen Streites geworden
ist.
Schenck-Rinck, dessen Großvater Verwalter des fürstl.
Isenburg-Birstein’sche Schlosses war,
das dem sogenannten Baron von Frank vom alten Fürsten zu Isenburg-Birstein
zur Wohnung eingeräumt worden, hat im Jahr 1867 eine Schrift, 'die Polen in
Offenbach', veröffentlicht, in welcher er nach Berichten seiner Familie das
Oberhaupt der dortigen Polen, Frank, wie auch die mysteriöse Eva von Frank
verherrlichte. Diese Eva soll nach Schenck-Rinck eine natürliche Tochter der
Kaiserin Elisabeth von Russland gewesen sein, welche der Obhut Franks
anvertraut, vom russischen Hofe ferngehalten wurde. Daher sollten sich auch
die bedeutenden Geldmittel erklären, die von St. Petersburg aus nach
Offenbach hin reichlich flossen.
Das Programm des Breslauer Seminars (1868) brachte aus der Feder des Herrn
Graetz eine gelehrte Abhandlung 'Frank und die Frankisten, eine
Sektengeschichte aus der letzten Hälfte des Jahrhunderts, in welcher an der
Hand von Dokumenten mit überzeugender Schärfe nachgewiesen wird, dass Frank
nicht ein gewöhnlicher, sondern ganz abgefeimter Schwindler und Betrüger
gewesen, der ursprünglich Jankiw Leibowicz geheißen, vom Judentum zum Islam,
von diesem dann zum Katholizismus übergetreten ist, nachdem er lange Zeit in
der russischen Festung, Czenstochau, in Haft gewesen war. Es war ihm während
seiner Wanderjahre in Russland, dadurch, dass er sich mit kabbalistischen
Formen umgab, gelungen, einen bedeutenden Anhang um sich zu sammeln; waren
ja die Gemüter, die der Sabbatianismus so sehr aufgeregt hatte, noch nicht
zur Ruhe gelangt, und der Boden daher noch zu sehr empfänglich für neue
Abenteurer. Die schöne Erscheinung seiner Tochter Eva (Graetz hält sie für
seine wirkliche Tochter) soll auch ein nicht unbedeutender Anziehungspunkt
für Anhänger der von Frank und seinen Helfershelfern neu aufgestellten
Glaubenslehre gewesen sein. In Offenbach nahm Frank in besagtem Schlosse
Wohnung, richtete dort einen fürstlichen Hofstaat ein, unterhielt
mystisch-kabbalistische Zusammenkünfte, während er sich äußerlich zum
Katholizismus bekannte. Allerdings flossen von den Anhängern Franks in
Russland und Polen reichliche Spenden, doch reichten diese allein nicht hin,
fürstlichen Aufwand, den Frank entfaltete, zu decken, sondern auch reiche
Subsidien vom Petersburger Hofe für, wie Graetz meint, Dienste, die sich der
Öffentlichkeit entziehen, mussten helfen, den fürstlichen Aufwand zu
bestreiten. Gegen die eben erwähnte Schrift von Graetz tritt nun
Schenck-Rinck mit einer Broschüre, 'Die Polen in Offenbach am Main. Zur
Beleuchtung der von Herrn Dr. Graetz erschienenen Abhandlung. Breslau 1868.
Verlag von Heinrich Keller. Frankfurt
a. M. ' auf, durch welche er den Baron und dem Fräulein von Frank
entwundenen Totenkranz wieder zurückzugewinnen hofft.
Vor allen Dingen gibt er zu, dass er 'aus (?) dem Bereiche seiner Tätigkeit
liege', den 'sicherlich hohen Wert' der in lateinischer, italienischer,
polnischer und russischer Sprache geschriebenen Dokumente (aus den Jahren
1757 – 61 und 1796) zu beurteilen und entzieht sich eigentlich durch dieses
Bekenntnis das Recht, als Kämpfer gegen die gelehrten Forschungen des Herrn
Graetz anzutreten, denn mit einem vornehmen Ignorieren ist es nicht getan.
Wir wollen es dahingestellt sein lassen, wer eigentlich das Fräulein Eva von
Frank gewesen, ob dem hohen russischen Kaiserhause entsprossen, oder eine
Tochter des alten 'Baron', vielleicht wird einmal die Geschichte den
Schleier, der über dieser Persönlichkeit liegt, lüften. Wir wollen hier nur
einige Punkte in Betracht ziehen, die sich auf den Baron Frank selbst
beziehen.
Vor allem ist es Schenck-Rinck darum zu tun, die jüdische Abkunft Franks zu
leugnen, 'auch nicht das geringste Zeichen', schreibt er, 'ließ sich
entdecken, was auf jüdische Abkunft schließen ließ' (S. 7); und doch steht
es unzweifelhaft fest, dass Frank Jude gewesen, durch Beweise aufrecht zu
erhalten suchen, weil wir es uns etwa zur besonderen Ehre anrechnen, in
Frank einen Juden zu erblicken, wir würden recht gern auf die Genossenschaft
verzichten, es ist uns hier nur einige Punkte in Betracht ziehen, die sich
auf den Baron Frank selbst beziehen.
Vor allem ist es Schenck-Rinck darum zu tun, die jüdische Abkunft Franks zu
leugnen, 'auch nicht das geringste Zeichen', schreibt er, 'ließ sich
entdecken, was auf jüdische Abkunft schließen ließ' (S. 7); und doch steht
es unzweifelhaft fest, dass Frank Jude gewesen. Wir wollen aber sogleich
bemerken, dass wir nicht deshalb die Behauptung, Frank sei Jude gewesen,
durch Beweise aufrecht zu erhalten suchen, weil wir es uns etwa zur
besonderen Ehre anrechnen, in Frank einen Juden zu erblicken, wir würden
recht gern auf die Genossenschaft verzichten, es ist uns hier nur darum zu
tun, eine geschichtliche Wahrheit festzustellen.
Hören wir, wie Schenck-Rinck beweist: Ein Schlagfluss machte Franks Leben am
10. Dez. 1791 ein Ende, die Offenbacher Ärzte und ein Frankfurter Arzt
wurden herbeigerufen; 'doch alle Belebungsversuche blieben erfolglos. Das
gänzliche Entkleiden des Körpers konnte dabei nicht umgangen werden, wobei
die Beschneidung nicht unentdeckt bleiben konnte, und doch hat es nirgends
verlautet, dass dies lautsprechende Zeugnis jüdischer Abkunft vor den Augen
der tiefblickenden Ärzte sich herausgestellt (S. 8) Herr
Anmerkungen: - Schabbathaier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sabbatianismus
- Schabbathai Zewi:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schabbtai_Zvi
- Fürst zu Isenburg:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Ernst_II._zu_Isenburg_und_Büdingen
- Kabbalist:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kabbala
- Podolien:
https://de.wikipedia.org/wiki/Podolien
- Proselyt:
https://de.wiktionary.org/wiki/Proselyt
- Czenstochau:
https://de.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
- Uhlanen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ulanen
- Schlagfluss:
https://de.wiktionary.org/wiki/Schlagfluss
- Kaiserin Elisabeth von Russland:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_(Russland)
- Graetz:
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Graetz
- Frankisten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankismus_(religiöse_Bewegung
- Jacob Leibowicz:
https://www.spektrum.de/lexikon/juedische-philosophen/jakob-leibowicz-frank/93
- Sabbatianismus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sabbatianismus
- Eva von Frank:
https://de.wikipedia.org/wiki/Eva_Frank
- Schloss:
https://de.wikipedia.org/wiki/Isenburger_Schloss |
Zur
Erinnerung an Wolf Breidenbach (geb. 1750 Breitenbach am Herzberg, gest. 1829 in Offenbach, Artikel
von Rechtsanwalt Dr. Guggenheim, 1914)
Anmerkung: vgl. Wikipedia-Artikel
"Wolf Breidenbach".
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. Februar
1914: "Zu Ehren eines Vergessenen. Von Rechtsanwalt Dr.
Guggenheim Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. Februar
1914: "Zu Ehren eines Vergessenen. Von Rechtsanwalt Dr.
Guggenheim
Man sagt uns Juden besondere Dankbarkeit für empfangene Wohltaten nach.
Darum scheint es mir unsere Pflicht zu sein, auch in unserer schnelllebigen
Zeit keine zu vergessen, der sich um uns und unsere Gleichberechtigung
verdient gemacht hat, zumal, wenn er bescheiden genug war, sich nicht in den
Vordergrund zu drängen und sich feiern zu lassen.
Ein solcher Mann, dessen Namen Graetz 1)
der Vergangenheit entrissen hat, dessen Verdienste aber heute noch viel zu
wenig gewürdigt werden, war Wolf Breidenbach.2)
In seiner 'Geschichte der Juden' führt uns Graetz eingehend in das Leben und
Wirken dieses Mannes vor Augen, der würdig ist als einer der edelsten und
erfolgreichsten Vorkämpfer für die Gleichberechtigung der Juden genannt zu
werden.
Das große Verdienst Breidenbachs, der allgemeine Bildung mit seinem
jüdischen Wissen und schöpferischer wissenschaftlicher Tätigkeit verband,
besteht darin, dass er in den meisten Staaten Mittel- und Westdeutschlands
die Aufhebung des Juden-Leibzolls erwirkt hat. 3)
Der Leibzoll, der ursprünglich wohl als eine Art Geleitzoll für
Handeltreibende gedacht war, hatte sich, im Laufe der Zeit, besonders in
Deutschland, zu einer beträchtlichen Einnahmequelle der deutschen Fürsten
entwickelt. 4)
An jeder Zollschranke der kleineren mitteldeutschen Staaten drohten die
Zollstöcke mit der schmachvollen Inschrift:
'Juden-Leibzoll'
Durch diese Art der Verzollung wurden die reisenden Juden tatsächlich dem
Vieh gleichgestellt.
Dazu kam noch die oft unmenschliche Härte, mit er die Erheber diesen Zoll
auch von den Ärmsten der Armen beitrieben.5)
Obgleich schon Ludwig XVI. in seinem Edikt vom 12. Januar 1784 den Leibzoll
für Frankreich abgeschafft hatte
6), nachdem auch
weiterhin Österreich, Bayern und Preußen 7)
die Juden von der erniedrigsten Abgabe befreit hatten, dachten die kleineren
Staaten Mittel- und Westdeutschlands noch immer nicht daran, diese nicht
geringen Einnahmequellen aufzugeben: Da war es Wolf Breidenbach, der sich
der entehrten Glaubensgenossen annahm und mit Mut, Entschlossenheit und
edlem Eifer der Gerechtigkeit zum Siege verhalf.
Ein zeitgenössischer christlicher Schriftsteller
8) rühmte Breidenbachs Wirken, der, 'mit Aufopfern von
Zeit, Mühe und Kosten sich ein unsterbliches Verdienst um die Juden
erwirbt.'
Es kann nicht meine Aufgabe sein, innerhalb eines kurzen Aufsatzes die
mühselige Tätigkeit Wolf Breidenbachs zu schildern und die Kleinarbeit
dieses bescheidenen Mannes aufzudecken. Ich verweise auf die angegeben
Literatur. Nur darauf sei hingedeutet, dass Wolf Breidenbach durch seine
Stellung als Hoffaktor bei den Fürsten von
Isenburg, Beziehungen zu den benachbarten fürstlichen Höfen hatte und so
bewirkte, dass die Schmach des Juden-Leibzolls nach und nach in den
einzelnen Staaten beseitigt wurde.
Der hochherzige, auch sonst als tolerant bekannte Fürst Karl zu Isenburg,
der in Offenbach residierte, gewährte als Erster unter den Fürsten Mittel-
und Westdeutschlands die seinem 'inneren Gefühle ganz entsprechende Bitte'
des Wolf Breidenbach, indem er im September 1903 den Leibzoll im Fürstentum
Isenburg-Birstein abschaffte.
Die edle Tat des Isenburger Fürsten spornte Wolf Breidenbach zu weiteren
Bemühungen an, und es gelang ihm, die Aufhebung des Juden-Leibzolls im
genannten fürstlichen und gräflichen Hause Isenburg, Kurfürstentum Hessen,
im Kurfürstentum Solms,
Rödelheim, Kurfürstentum
Homburg, in Hohenlohe,
Neuwied, Wied-Runkel,
Braunfels,
Nassau,
Usingen (19. Januar 1805) und
Regensburg9) zu erwirken.
Auch ist es lediglich seiner Bittschrift zu danken, dass am 24. August 1804
der Leibzoll in der freien Reichsstadt
Frankfurt aufgehoben wurde. Wolf Breidenbach hatte das Glück, zu
erleben, dass in allen deutschen Staaten der Leibzoll aufgehoben
10) und so die Bahn frei wurde für
die Erringung der lang ersehnten Gleichberechtigung der Juden als
Staatsbürger.
Wolf Breidenbach starb, wo er gelebt und von wo aus er gewirkt hat, zu
Offenbach a. M. am 27. Februar 1829.11)
Seine Gebeine sind auf dem neuen Friedhof
in Offenbach bestattet.12)
Anmerkungen: 1) Graetz, 'Geschichte der Juden', Band 11, Seite 253 und
Note 5.
2) Vgl. Dr. Silberstein: 'Wolf Breidenbach und die Aufhebung des Leibzolls
in Deutschland' in der 'Zeitschrift für die Geschichte der Juden' 1891.
3) Nachstehend in deutscher Übersetzung, die bei Graetz, 11, Seite 628, in
hebräischer Sprache abgedruckten Worte Wolf Heidenheims im Vorwort zu 'Machsor':
'Der mächtig weise Mann, der hochangesehene Wolf Breidenbach, der ruhmvolle,
der viel Gutes getan und bewirkt für das Haus Israel, der Mann, der alles
tat, und die Schmach des Leibzolls, der seit vielen Jahrhunderten alle
unsere Schritte hemmte,von uns zu nehmen. Der Ewige gab ihm Gunst in den
Augen der Völker und Fürsten, und sie taten ihm, was er verlangte. Und so
steht er in seinem freiwillig zu Berufe, ein Fürsprecher für Israel zu sein,
um ihnen Ruhe zu bereiten. Das ist der edle Mann, dessen Hand mich
unterstützte. Er selbst bereitete auch Köstliches durch Übersetzung einiger
Pijutim (poetischer Gebete), wie 'Ich komme Dich anzuflehen' (2. Rosch
Haschono), des Silluk (Schlussstück) des 7. Passah und Selichoth (Bussgebete)
in Kolnidre.
Wo ich schrieb, sie seien mir geliefert von einem meiner Freunde, der stammt
es von ihm, und seine Hände haben es bereitet.'
4) In Hessen-Darmstadt, zum Beispiel,
brachte der Zoll jährlich nach Graetz a. a. O., Seite 620, 25.000 bis 28.000
Gulden, nach Silberstein a. a. O. 11.000 bis 12.000 Gulden.
5) Vgl. Silberstein a. a. O.
6) Das Edikt begründet dies: 'Da es unserer Denkungsart höchst zuwider ist
gegen irgendeinen unserer Untertanen eine Anlage existieren zu lassen,
welche den Stand der Menschen schändet.'
7) Friedrich Wilhelm II. sprach sich missbilligend über seine Räte aus, dass
diese ihn nicht früher auf diese unwürdige Aufgabe aufmerksam gemacht
hatten. Vgl. Silberstein.
8) Scheppler, 1805.
9) Der Reichskanzler Karl von Dalberg, dem im Lüneburger Frieden
Regensburg zugefallen war,
unterstützte die Bemühungen Wolf Breidenbachs aufs Eifrigste und stellte ihm
das Zeugnis aus, 'daß seine menschenfreundliche persönliche Verwendung ihm
zum Ruhm und zur Ehre gereiche.' Vgl. Graetz a. a. O., Seite 618.
10) Zuletzt in Sachsen merkwürdigerweise infolge eines russischen
Gouvernementpatents, am 28. September 1813. Man vergleiche hierzu die
heutigen Passvorschriften Russlands!
11) Das Chewrabuch der israelitischen Gemeinde zu Offenbach enthält
folgenden, hier wohl zum ersten Mal veröffentlichten Eintrag unter Nr. 2149:
'5589 (1829) die Nacht auf Sabbat, den 25. Adar, beerdigt. Er ruht neben dem
verstorbenen Löb Elsaß.'
12) Die von Graetz 1, Seite 618, in hebräischer Sprache angeführten
Grabinschrift lautet: 'Der geachtete und hochgeschätzte Mann und berühmte
geachtete Vermittler (Faktor).'
Nicht allgemein bekannt und wohl zum ersten Mal hier veröffentlicht ist
Folgendes: Als im Jahre 1860 infolge der Gleisverlegung der
Offenbach-Hanauer Bahn große Stücke des alten Offenbacher jüdischen
Friedhofs zu Bahnzwecken hergegeben werden mussten, viele Gräber des alten
Friedhofs ausgegraben und die Gebeine auf den neuen jüdischen Friedhof
übergeführt. Die zugehörigen Grabsteine wurden am Eingang des neuen
Friedhofs in Form einer Pyramide zusammengestellt, während die Gebeine in
besonderen Gräbern bestattet wurden, soweit sich Angehörige oder sonstige
Beteiligte ihrer annahmen. So kam es, dass der Grabstein Wolf Breidenbachs,
der die vorstehende Inschrift trägt, ein Teil der Pyramide geworden, jetzt
mit dichtem Efeu umrankt und kaum leserlich ist, während das Grabmal
auf dem neuen jüdischen Friedhof folgende, etwas modernere Inschrift
enthält: 'Hier ruht der fürstlich isenburgische Rat Wolf Breidenbach,
geboren am 10. Januar 1751, gestorben am 27. Februar 1829, und neben ihm
seine Gattin Marianne geb. Israel, geboren am 12. Februar 1768, gestorben am
15. März 1827.
Die israelitische Männerkrankenkasse zu Offenbach a.M., welcher Wolf
Breidenbach 100 Gulden gestiftet hat, lässt noch heute am Sterbetage ein
Kaddischgebet für den Verstorbenen verrichten.
13) Er ließ auf seine Kosten das Innere der Synagoge erneuern und
ausschmücken. Vgl. Graetz Seite 617. |
 Er
hat genug getan, um für alle Zeit zu leben. Wir Nachkommen aber sollte uns
einer Pflicht der Dankbarkeit nicht entziehen und der Mahnung von Graetz
nachkommen, den Namen Wolf Breidenbach nicht der Vergessenheit verfallen zu
lassen. Er
hat genug getan, um für alle Zeit zu leben. Wir Nachkommen aber sollte uns
einer Pflicht der Dankbarkeit nicht entziehen und der Mahnung von Graetz
nachkommen, den Namen Wolf Breidenbach nicht der Vergessenheit verfallen zu
lassen.
Die israelitische Gemeinde in Offenbach baut zurzeit eine neue Synagoge. In
dem großen Vorhofe derselben ist ein geeigneter Platz zur Aufstellung eines
Gedenksteins´vorgesehen, der Kunde davon geben soll, dass wir Juden in
dankbarer Erinnerung derer gedenken, die uns Gerechtigkeit widerfahren
ließen und die im Kampfe für unser Recht, uns in edler Pflichterfüllung, in
treuer Liebe und Opferfreudigkeit Beistand geleistet haben. Kein Bildnis der
edlen Männer soll den Denkstein zieren, aber die Namen des Fürsten Karl von
Isenburg und Wolf Breidenbachs sollen in leuchtenden Lettern unserer
Dankbarkeit Zeugen sein.
Wie einst Wolf Breidenbach die alte Synagoge schmückte, so soll, hundert
Jahre nach der endgültigen Aufhebung des Leibzolls, die neue Synagoge den
Namen Wolf Breidenbachs rühmend tragen, in dem sie ihn mit dem ewig wahren
Worte unserer Weisen verbindet: 'Die Denkmale der Frommen sind ihre Werke.'
Ein Brunnen zum Gedächtnis der Edlen soll inmitten des Vorhofes aufgestellt
werden. Die Mittel zur Errichtung dieses Denkmals sollten von den Enkeln und
Urenkeln jener deutschen Juden im Deutschen Reich gestiftet werden, denen
durch Wolf Breidenbach Befreiung ward von schwerer Schmach.
Man bittet, Geldsendungen an den Verfasser oder an das Bankhaus S.
Merzbach in Offenbach a. M., Konto: Wolf-Breidenbach-Brunnen zu richten.
Anmerkungen: - Gleichberechtigung:
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdische_Emanzipation
- Graetz:
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Graetz
- Ludwig XVI.:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_XVI.
- Hoffaktor:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hoffaktor
- Fürst Karl zu Isenburg:
https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_(Isenburg-Birstein)
- Wolf Heidenheim:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolf_Heidenheim
- Machsor:
https://de.wikipedia.org/wiki/Machsor
- Israel: Judenheit
- Pijutim:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pijjut
- Rosch Haschono:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosch_ha-Schana
- Passah:https://de.wikipedia.org/wiki/Pessach
- Selichoth:
https://de.wikipedia.org/wiki/Slichot
- Kolnidre:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kol_Nidre
- Karl von Dalberg:
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Theodor_von_Dalberg
- Chewrabuch: Buch der Chewra Kadischa
https://de.wikipedia.org/wiki/Chewra_Kadischa
- Sabbat:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schabbat
- Adar:
https://de.wikipedia.org/wiki/Adar_(Monat)
- Bankhaus S. Merzbach: vgl.
Artikel von 1911
- Begründer des Bankhauses Merzbach:
https://www.geni.com/people/Selig-Merzbach/6000000000151914947
https://jschultheis.de/seiten/elektrische-strassenbahn/
|
Zur
Erinnerung an Wolf Breitenbach (weitere Artikel von 1929)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Februar
1929: "Zum Gedächtnis Wolf Breidenbachs - Das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Februar
1929: "Zum Gedächtnis Wolf Breidenbachs - Das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen
(Gest. am 28. Februar 1829 - in der Nacht zum Heiligen Schabbat am 25.
Adar zu Offenbach). Von L. Horwitz in
Kassel.
Es obliegt dem Leser die Pflicht, Leben und Taten eines einst berühmten,
jetzt fast vergessenen Namens sich vor Augen zu halten und als Mann sich zu
bemühen, wo es an Männern jetzt fehlt. Den Lebensinhalt Wolf Breidenbachs
könnten seine kurze Grabinschrift und das noch den harten Stein überdauernde
Denkmal Wolf Breidenbachs wiedergeben, letzteres in der Machsor-Ausgabe
1806. Man lese sie:
(Hebräischer Text der alten Grabinschrift)
Im Machsor vom 2. Tag Rosch Haschanah bemerkt Wolf Heidenheim
zu ...: 'Diese Übersetzung erhielt ich von meinem ehrwürdigen Freunde; seine
Bescheidenheit erlaubt es mir nicht, seinen Namen zu nennen.' -
Besonders in der Gegend zwischen Main und Rhein, in Süddeutschland wie im
Westen sollte man am 28. Februar oder 28. Adar es der Jugend und dem Alter
recht eindringlich verkünden, was Breidenbach seinen Glaubensbrüdern gewesen
ist – ein schtrln, ein Anwalt, ein Fürsprecher. Unsere Geschichte
nennt nur noch Joselmann von Rosbehn so. Wenn anderen größere Verdienste
beigelegt werden, so lag dieses darin, dass seine stille, aber nicht minder
kräftigen Persönlichkeit meist hinter der Szene sich hielt. Jede Eitelkeit
lag ihm fern, er tat das Gute (für den Namen = für G"tt), um des
Guten Willen.
Wolf Breidenbach ist im Dörfchen
Breitenbach 1751 geboren. Damals lebte dort ein hervorragender Talmudist,
der sich der Jugend besonders annahm. Er erkannte die hervorragende
Geistesgaben des jungen Wolf und förderte ihn derart, dass er bald nach
Frankfurt a. M. auf die
Jeschiwah konnte, wo er neben talmudischem Wissen sich allgemeine
Bildung aneignete. Bei einem Buchbinder lernte Breidenbach einen Grafen
kennen, mit welchem er durch seine Meisterschaft im Schachspiel bald eng
befreundet wurde. Diese Freundschaft war für Breidenbachs Leben
entscheidend. Der Graf lieh ihm größere Summen zur Eröffnung eines Bank- und
Juwelengeschäftes. Das Beit Hamidrasch (= Talmudschule) wurde bald
mit dem Kontor vertauscht, - und für unsere Glaubensbrüder war dies von
hoher Bedeutung. Durch strenge Rechtlichkeit seines Benehmens und Glück
erweiterte sich sein Kundenkreis und erstreckte sich auf die vielen
Fürstenhöfe und Standesherren in der Nähe von Frankfurt und im Nassauischen.
Mit den geschäftlichen Erfolgen kamen bald die damaligen Titel als Hofagent,
Hoffaktor und dergleichen. In besonders freundschaftlichem Verhältnis stand
Breidenbach zum Fürsten von Isenburg-Birstein. Großherzog Ludwig I. zu
Darmstadt, dessen Bruder Emil in seinem Hause verkehrte. Doch Glanz und
Reichtum machten ihn nicht blind für das Leid seiner Brüder; er suchte und
fand sie. Mit ihnen musste er den harten Leibzoll ertragen, jene lästige
Abgabe, die der Reiche oder Bettler an der Grenze eines jeden Amtes
entrichten musste. Mit welcher Härte diese Abgabe erhoben wurde, kann hier
nicht geschildert werden, sie kehren in allen Eingaben Breidenbachs und
Jacobsons wieder und bieten ein trauriges Bild der Lage. Die Bemühungen
hatten in Braunschweig, Mecklenburg und Baden und nun setzte Breidenbach das
begonnene Werk fort. In dem Reichskanzler Karl von Dalberg, dem durch den
Frieden von Luneville, Regensburg,
Aschaffenburg und
Wetzlar zugefallen war, fand er einen
warmherzigen Förderer seines Vorhabens. Mit seinem Beistande dachte
Breidenbach in allen deutschen Staaten durchzuführen. Für diesen Zweck waren
große Summen aufzubringen, die Breidenbach allein nicht beschaffen konnte;
er erließ deshalb einen Aufruf an die Gesamtjudenheit, der bei W. Heidenheim
zwischen 19. und 25. September 1803 mit hebräischen Lettern gedruckt wurde
und als Überschrift Kol kore leacheinu bnei Israel = eine Stimme spricht
zu unseren Brüdern, die Israeliten führt. Der Schlusssatz lautete:
'Einer eurer Brüder, aufgefordert von einem großen und ansehnlichen Teil
unserer Nation, ist es, der um Beiträge zu dieser schönen und löblichen
Stiftung zur Befreiung der Kosten und Opfer – euch allesamt als Menschen,
als Kaufleute und Familienväter auffordert.' Wohl half Br. Dalbergs
Empfehlung, der ihn in einer Urkunde 'Vertreter seiner Nation' nennt, der
ihm die Wege bahnte. Aber von Humanitätsgedanken waren sie den Juden
gegenüber weit entfernt, wenn die Staatskasse darunter litt, betrug doch die
Einnahme 1805 in Darmstadt jährlich 25 – 28.000 Gulden. Die Feststellung der
Entschädigungssummen bedarf einer Spezialforschung. Der große Erfolg sei
durch folgende Daten kurz gezeichnet: Der Leibzoll hörte auch auf am 1.
November 1803 in Hessen – Homburg,
Januar 1804 in Aschaffenburg, 24.
August 1804 in Frankfurt a. M.,
1804 auch in Kurhessen, 19. Januar 1805 in
Darmstadt, im gleichen Jahr folgten
die Höfe von Nassau-Usingen,
Weilburg,
Löwenstein,
Leiningen und den Häusern Erbach.
Breidenbach muss durch diese Taten für alle Zeiten leben. Sein Name ist mit
ehernen Lettern im Buch der Zeitgeschichte eingeschrieben. Wo der Feind der
Jetztzeit steht, wissen wir nur zu genau. Möchte uns im Zeitalter Hamans
auch der Mordechai und die Ester nicht fehlen."
Anmerkungen: - Machsor:
https://de.wikipedia.org/wiki/Machsor
- Rosch Haschanah:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosch_ha-Schana
- Wolf Heidenheim:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolf_Heidenheim
- Joselmann von Rosheim:
https://de.wikipedia.org/wiki/Josel_von_Rosheim
- Jeschiwah:
https://de.wikipedia.org/wiki/Jeschiwa
- Hofagent:
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Hofagent
- Hoffaktor:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hoffaktor
- Großherzog Ludwig I. zu Darmstadt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_I._(Hessen-Darmstadt)
- Karl von Dalberg:
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Theodor_von_Dalberg
- Frieden von Lunéville:
https://de.wikipedia.org/wiki/Friede_von_Lunéville
- W. Heidenheim:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolf_Heidenheim
- Haman:
https://de.wikipedia.org/wiki/Haman
- Mordechai:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mordechai
- Ester:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ester_(Bibel) |
| |
|
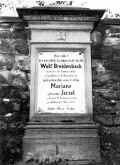 |
Links: Grabstein für den Fürstlich
Ysenburgischen Rat Wolf Breidenbach, geb. 1751, gest. 27. Februar
1829.
Das Grab von Wolf Breidenbach befand sich auf dem alten jüdischen
Friedhof an der Groß-Hasenbachstraße (heute Bismarckstraße). Beim Bau
der Bahnlinie musste ein Teil des Geländes an die Stadt abgetreten werden
(1871/72); die alten Grabsteine sind teilweise auf den neuen jüdischen
Friedhof (Teil des städtischen Friedhofes) überführt worden. Für Wolf
Breidenbach wurde bereits 1885 ein neues Grabmal errichtet; der alte
Stein - stark verwittert - befindet sich als einer der untersten in der
Pyramide am Eingang zum jüdischen Friedhof. |
| |
|
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck"
vom 22. Februar 1929: "Zum Gedächtnis Wolf Breidenbachs
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck"
vom 22. Februar 1929: "Zum Gedächtnis Wolf Breidenbachs
Anlässlich der hundertjährigen Wiederkehr seines Todestags am 28. Februar
1929. S. Freudenberger
Es wirkt mit Macht der edle Mann
Jahrhunderte auf seinesgleichen.
Denn was ein guter Mensch erreichen kann,
Ist nicht im engen Raum des Lebens zu erreichen.
Drum lebt er auch nach seinem Tode fort,
Und ist so wirksam, als er lebt,
Die gute Tat, das schöne Wort,
Es strebt unsterblich, wie er sterblich strebt.
Goethe.
Jahrhundertelang hatten unsere Vorfahren unter Ausnahmegesetzen
geschmachtet. Im finstern Mittelalter waren sie die Parias der menschlichen
Gesellschaft. Man zwängte sie in die engen Gassen, sogenannte Ghettos, ein.
Sobald sie sich andersweit blicken ließen, mussten sie sich durch den gelben
Fleck bemerkbar machen. Wehe, wenn es jemand versäumte, sich mit diesem
Ehrenmal zu dekorieren.
Kaiser, Könige und Ritter betrachteten die Juden als eine einträgliche
Quelle zur Verbesserung ihrer Einkünfte. Zu der schimpflichen Besteuerung,
die man den Ärmsten der Armen auferlegte, zählt
unstreitig der 'Leibzoll'. Zu der schimpflichen Besteuerung sobald sie sich
in das Gebiet einer fremden Herrschaft, und es gab damals in Deutschland
über hundert Reichsstände, begaben, mussten sie bis Ende des 18.
Jahrhunderts diesen 'Geleitzoll' oder Leibzoll entrichten. Da traten große
Männer an die Bildfläche, die es sich zur Lebensaufgabe machten, ihre
Glaubensgenossen von diesen sie entwürdigenden Ausnahmegesetzen zu befreien.
Zu den eifrigsten Vorkämpfern für unsere bedrängten Glaubensgenossen in
dieser bewegten Zeit zählt unstreitig Wolf Breidenbach in Hessen.
Derselbe wurde 1751 im kleinen Dörfchen
Breitenbach bei Kassel in den
ärmlichsten Verhältnissen geboren. Der aufgeweckte begabte Knabe besuchte
gleich seinen Altersgenossen die damals sehr überfüllte evangelische
Volksschule seines Heimatortes. Der arme Knabe musste schwer unter den
Plackereien seiner christlichen Mitschüler leiden, und mögen diese
Quälereien der Impuls gewesen sein, der den gereiften Mann veranlasste, für
die Erlangung der Menschenrechte seiner Glaubensgenossen Gut und Blut
einzusetzen.
Nachdem der Knabe die Volksschule verlassen hatte, begab er sich nach
Frankfurt am Main, um an
der damals dort blühenden Jeschiwoh Tora zu lernen. Die Mittel zum
Unterhalte in Frankfurt verschafften ihm Freunde und Gönner. Auch gewährte
man ihm als armen Bochur die nötigen Freitische. Mit Eifer widmete sich der
wissensdurstige Jüngling dem Torastudium. Doch widmete er sich dem Zuge der
Zeit folgend, auch heimlich dem Studium der profanen Wissenschaften. In
seinen freien Stunden befasste er sich in Gesellschaft einiger Freunde mit
Schachspiel und brachte es darin zu einer wahren Meisterschaft. Dieser
Umstand brachte ihn zu einer vollständigen Änderung seines Lebensganges. Er
lernte nämlich durch Schachspiel einen Baron kennen. Der junge Breidenbach
trat in nähere Beziehungen zu dem reichen Baron und erwarb sich durch treue
und gewissenhafte Verwaltung der Gelder des Barons dessen unumschränktes
Vertrauen, sodass Letzterer seinem treuen Verwalter größere Darlehen gegen
geringen Zinsfuß entlieh. Dadurch wurde es Breidenbach ermöglicht, in
Frankfurt ein Bank- und Wechselgeschäft zu begründen, dass sich durch
Empfehlung es ihm wohlgesinnten Barons aufs Glänzendsten entwickelte.
Breidenbach entfaltete sich zu einem Geschäftsgenie und betrieb alsbald
neben seinem Bankgeschäft auch noch einen ausgebreiteten Handel mit Juwelen
und Schmuckgegenständen. Dadurch bahnte er sich den Zutritt zu den Höfen
verschiedener kleiner Fürsten in der Nähe Frankfurts, z. B. des Landgrafen
von Kassel, des Fürsten von Isenburg-Birstein
und des späteren Großherzogs Ludwig I. von Hessen-Darmstadt.
Diese weittragenden Beziehungen zum Adel und Fürstenstande nutzte
Breidenbach in edelster Weise im Interesse seiner noch allenthalben
bedrückten Glaubensgenossen aus. Vor allen Dingen verwandte er sich mit
größter Zähigkeit für Abschaffung des entehrenden Leibzolls, und es ist ihm
auch gelungen, dass dieses Überbleibsel aus dem finstern Mittelalter aus
Süddeutschland vollständig verschwand. Später siedelte der angesehene,
beliebte Geschäftsmann nach dem nahegelegenen Offenbach über, wo er
auf eigene Kosten das dortige Gotteshaus restaurieren ließ. Hier starb der
allgemein geachtete Mann, hochbetagt und allgemein betrauert am 28. Februar
1829. Von seinen drei Frauen hinterließ er eine Tochter Sara, die sich in
die hessische Residenzstadt verheiratete, außerdem noch zwei Söhne, Moritz
und Isaak, die nach dem Tode des frommen Vaters die Fahne des Judentums
verließen und später bei der hessisch-darmstädtischen Regierung hohe Ämter
bekleideten.
Breidenbach hat sich durch die Mitwirkung, zur Beseitigung des Leibzolls
große Verdienste um die Judenheit Süddeutschlands erworben. Durch die
Geradheit, Treue und Klarheit seines Charakters und durch seine
Anhänglichkeit an sein Judentum fesselte er seine Zeitgenossen, die ihm als
edlen Typus des echten Juden und Deutschen verehrten.
Es wäre Vermessenheit, an den Manen des großen Mannes, wollte ich behaupten,
mit diesem kurzen Abriss die Verdienste unseres hervorragenden Landsmannes
voll und ganz gewürdigt zu haben. Wir Hessen sind stolz auf diesen
unermüdlichen, wackeren Kulturkämpfer und halten sein Andenken allezeit in
Ehren.
'Wer den Besten seiner Zeit gelebt,
der hat gelebt für alle Zeit.' Nach Graetz"
Anmerkungen: - Reichsstände:
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsstände
- Jeschiwoh:
https://de.wikipedia.org/wiki/Jeschiwa
- Bochur: Bachur (Student an einer Jeschiwa)
- Freitische: Kostenlose Verpflegung
- Leibzoll:
https://de.wikipedia.org/wiki/Leibzoll
- Manen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Manen
- Graetz:
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Graetz |
Ungedruckte Briefe Wolf Breitenbachs (Artikel von 1909)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Dezember
1909: "Kleines Feuilleton Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Dezember
1909: "Kleines Feuilleton
Ungedruckte Briefe Wolf Breidenbachs. Von ...tz.
Das Andenken Wolf Breidenbachs wird für alle Zeiten ein gesegnetes sein;
sein Name ist mit ehernem Griffel in dem Buch der Zeitgeschichte
eingezeichnet, denn er verwendete seine großen geistigen Gaben und
bedeutenden materiellen Güter, um das Joch des Leibzolles von seinen Brüdern
zu nehmen. Wie ihm dieses gelang, ist von berufener Seite ausführlich
geschildert worden, auch wie er durch sein Sendschreiben kol kore
leacheinu benei Jisrael (eine Stimme ruft zu unseren Brüdern, den
Israeliten) zur Mithilfe aufforderte.
Dass ihn die hessischen Standesherren auch mit dem üblichen Titel Hof- und
Kammeragent auszeichneten, ist ja bekannt. Jedoch genügten ihm die
Ernennungen nicht; sein kurhessischer Landesherr sollte seinen ehemaligen
Untertanen mit einer Standeserhöhung bedenken; und hierauf beziehen sich
nachstehende Briefe, deren Originale im Königlichen Staatsarchiv in Marburg
unter Kasseler Geheime Ratsakten Nr. 2253 sich befinden.
'Durchlauchtigster Landgraf!
Gnädigster Fürst und Herr!
Euer Hochfürstlichen Durchlaucht durch ebenso eifrige als uneigennützige
Dienste die unauslöschlichsten Gesitzungen (?) eines gehorsamen Unterthans
in tiefster Ehrfurcht bewahren zu können und Höchstdenenselben auch in einem
anderen Lande noch auf einige andere Weise anzugehören, war längst mein
sehnlichster Wunsch und der vornehmste Beweggrund, weshalb ich vor einigen
Monaten nach dem Glücke strebte und erhielte, Höchstdenenselben mich mit
einem Theil meines Inventarvorrathes in Höchstdero Residenz auf der Bellevue
zu Füßen zu legen. Huldreichst sicherten Höchstdieselben mir als geborener
hessischer Unterthan den Schutz in Höchstdero Staaten insofern zu, als er
mein Comerc zuließ, welches letztere leider nicht leicht thunlich ist.
Dieser Wunsch, den ich bisher in meinem schüchternen Herzen verschlossen
gehalten, wird durch die dermaligen Zeitläufe vorzüglich belegt (?), da Euer
Hochfürstliche Durchlaucht den Staaten das Glück des Friedens und jedem der
Höchstdenenselben anzugehören, die Gnade hat, persönliche Sicherheit zu
verschaffen gewusst haben...
In diesen Gesinnungen, wage ich die unterthänigste Bitte um gnädigste
Ertheilung des Titels eines Hofs- und Kammer-Agenten zu Füßen zu legen.
Diese anhoffende höchste Gnade würde ich durch alle in meinen Kräften
stehende unterthänigsten Dienste ohne Eigennutz zu verdienen suchen
In allertiefster Ehrfurcht ersterbend
Offenbach, den 18. Sept. 1795
Euer Hochfürstlichen Durchlaucht unterthänigster Knecht Wolf Breidenbach'
Die Ernennung zum Hoffaktor erfolgte am 30. September 1795. Doch Breidenbach
musste noch auf andere Pläne sinnen, denn in den Akten ist noch Folgendes
enthalten:
'Einer Hochfürstlich Hochlöblichen Geheimen Land Canzley!
Sollte ich nebst hierbey folgenden 45 Stück Laubthaler mit Ehrfurchtsvollen
Bezug auf den sämtlichen Inhalt |
 meines
unterm Stern dieses an Hochdieselben erlassenen Pro Memoria annoch
unterthänig beifügen, Hochdieselben wollen geruhen in dem Gewährungsfall
meiner devotest dargelegten Wünsche auch auf die bei mir Leuten auf Reißen
gnädigst Bezug nehmen. meines
unterm Stern dieses an Hochdieselben erlassenen Pro Memoria annoch
unterthänig beifügen, Hochdieselben wollen geruhen in dem Gewährungsfall
meiner devotest dargelegten Wünsche auch auf die bei mir Leuten auf Reißen
gnädigst Bezug nehmen.
Diese gnädigste Verwilligung würden mir vorzüglich bei die ganz den
gegenwärtigen kritischen Zeiten den huldreichsten Schutz und Schirm Sr.
Hochfürstlichen Durchlaucht, meines gnädigsten Landesherrn für mich und die
Meinigen genießen machen, womit Allerhöchst dieselben Ihre sämtlichen Staate
durch den Frieden zu sichern gewusst haben, mit schuldigster Ehrfurcht
harrend.
Einer Hochfürstlichen Hochlöblichen Geheimen Land Canzley unterthäniger Wolf
Breidenbach Fürstl. Hessischer Hof Factor.'
Offenbach, den 17. Oktober 1795.
Das Pro Memoria, von dem in der Eingabe die Rede ist, hat folgenden
Wortlaut:
'Unterthäniger Pro Memoria an Eine Hochfürstliche Hochlöbliche Geheime
Land-Canzley
In Gnädigkeit erhaltener verehrlicher Weisung, säume ich nicht mit dem
nächsten Montag in Frankfurt
abgehenden Hessischen Postwagen 45 Stück Laubthaler einzusenden, welche nach
Hessischer Währung 4 Laubthaler zu 6 Reichsthaler, gerechnet die Summe von
67 ½ Thaler ausmachen und für die gnädigst angesetzte 50 Reichsthaler zur
Werkhaus-Kasse (unleserlich) 15 Reichsthaler Taxe und endlich (unleserlich)
2 ½ Thaler als ein (unleserlich) Douceur für den geheimen Rats-Pedell
hoch-(unleserlich) ... einzuteilen bitte.
Anbei wage ich die unterthänige Bitte, Eine Hochlöbliche Geheime
Land-Canzley wollte geruhen, bei Ausfertigung des gnädigst resolvirten
Hof-Factors-Patent auf meine dem Hochfürstlichen Hause geleisteten
ersprießlichen und redlichen Dienste (: welche wenn sie gleich noch zur Zeit
sehr gering sind, indem ich vorerst nur nach der rühmlichen Einnahme von
Frankfurth Gelegenheit gehabt habe, meinem Hessischen Patriotismus mittelst
einer beträchtlichen Brotlieferung zu bewähren, womit ich jedoch den
schmeichelhaftesten Beifall der Herren Officiers sowohl als die
vollkommenste Zufriedenheit der Soldaten erhalten zu haben mich rühmen darf,
ich jedoch in der Zukunft auf alle mir mögliche Art, als treuer geborener
Hessischer Landes-Unterthan und nun doppelt als schuldigster Diener zu
vermehren so schuldig als bereit sein werde :) hochgefälligst mit einigen
Worten Bezug zu nehmen, und eine Art von Requisition beizufügen, damit ich
zur Beschleunigung der künftighin aufhabenden herrschaftlichen Geschäfte
allenthalben frei und ungehindert paß und repassiren möge.
Dieser Beisatz ist niemand schädlich, für mich aber von großer
Bequemlichkeit. Die mir hierunter erweisende und wie ich glaube, ganz von
Derselben Einleitung abhengen dürfende hohe Gewogenheit werde ich nach
Empfang des gnädigsten Patents mit besonderem vielen Dank zu erkennen
ohnemangeln.
Übrigens wurde ich die gnädigste Gewährung meiner unterthänigsten Bitte um
den Titel eines Hof und Cammer Agenten allerdings als eine ganz besondere
Höchste Gnade angesehen haben.
Ich verehre indessen Sr. Hochfürstlichen Durchlaucht gefassten gnädigen
Entschluß mit allzu tiefer Ehrfurcht, als daß ich es wagen wollte, jene
unterthänige Bitte so sehr sie mir außerdem am Herzen liegt - dermalen zu
wiederholen.
Sollte jedoch die Erhörung jener Bitte durch hohe Verwendung Einer
Hochlöblichen Geheimen-Land-Canzlei annoch möglich sein; so würde meine so
schuldige, als devoteste Erkenntlichkeit der Größe der erhaltenden Gnade
gleich sein.
Mit schuldiger Devotion die Gnade zu verharren
Einer Hochfürstlichen Hochlöblichen Geheimen Land-Canzley unterthäniger
Wolff Breidenbach. Fürstl. Hessischer Hof Factor'
Den 9. October 1795.'
Die Ernennung zum Hof- und Kammeragenten ist nicht erfolgt, was jedoch
Breidenbach nicht hinderte, für seine Glaubensgenossen bis an sein
Lebensende tätig zu sein. Mit Recht konnte es auf der Grabinschrift heißen:
'Der geachtete und hochgeschätzte Mann und berühmte geachtete Vermittler'.
Und Wolf Heidenheim schreibt über ihn: (Hebräischer Text)."
Anmerkungen: - Griffel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Griffel
- Leibzoll:
https://de.wikipedia.org/wiki/Leibzoll
- Laubthaler:
https://www.mgmindex.de/index.php?title=Laubtaler
- Reichsthaler:
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichstaler
- Wolf Heidenheim:https://de.wikipedia.org/wiki/Wolf_Heidenheim
- Hoffaktor:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hoffaktor. |
Fahndung
nach Abraham Igersheim von Offenbach und Konrad Volker von Frankfurt
(1836)
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" von 1836 S. 187 (Quelle: Stadtarchiv
Donaueschingen): "Fahndung. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" von 1836 S. 187 (Quelle: Stadtarchiv
Donaueschingen): "Fahndung.
Auf die unten beschriebenen zwei Juden, Abraham Igersheim von Offenbach am
Main und Konrad Volker von Frankfurt am Main, haftet der höchste
Verdacht, dass sie in der Nacht vom 13. auf den 14. zu
Basel bei einem
Goldschmiede unter den erschwerendsten Umständen einen Einbruch
versuchten, von welchem sie mit Zurücklassung ihrer Mäntel, und indem
der Größere von ihnen mit einer Feile eine Stichwunde in der Rücken
erhielt, abgetrieben wurden. Auf Requisition der Polizeidirektion in Basel
ersuchen wir um Fahndung auf dieselben und Anzeige, wenn sie handfest
geworden sind.
Lörrach, den 16. Februar 1836. Großherzoglich badisches
Bezirksamt. Deurer.
Signalement des Igersheim: Der Größere, welcher wahrscheinlich die
Stichwunde erhalten hat, ist ungefähr 43 Jahre alt, 5' 3" bis
4" groß, von gesunder Gesichtsfarbe; sein großer, schwarzer Bart
geht um das Kinn herum; sein Pass muss das Bisa des Polizeikommissars von
Mühlhausen vom 14. d. M. tragen. Kleidung: dunkelgrüne Anglaise
mit schwarzem Sammetkragen, dunkle Hosen, schwarzer Hut.
Signalement des Volker: Der Kleinere Volkes, ist ungefähr 38 Jahre alt,
wie der Größere gekleidet. Ihm fehlt der an jenem beschriebene Bart. Er ist
ungefähr 5' 1" groß und gibt sich für einen Tabakspinner aus." |
| |
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom (Quelle: Stadtarchiv
Donaueschingen): "Zurückgenommene Fahndung Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom (Quelle: Stadtarchiv
Donaueschingen): "Zurückgenommene Fahndung
In Bezug auf das diesseitige Ausschreiben vom 18. vorigen Monats wird die
Fahndung auf die beiden Juden Abraham Igersheim von Offenbach und Konrad
Volker von Frankfurt a. M. zurückgenommen, da beide beigefangen worden sind.
Lörrach, am 9. Mai 1836. Großherzogl. bad. Bezirksamt. v. Chrismar." |
Zur Trauerfeier für den Kaufmann Heinrich Sugenheim mit
evangelischer und katholischer Beteiligung (1842)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1842: "Offenbach,
6. Dezember. Bei der heute dahier stattgehabten Beerdigung des im Alter von
64 Jahren ganz plötzlich hingeschiedenen Kaufmanns Heinrich Sugenheim,
an welchem der hiesige Stadtvorstand eines seiner gediegensten Mitglieder
und somit die Stadt einen sehr tüchtigen Vertreter verloren, hat sich die
Hochachtung, welche dem Verblichenen von seinen Mitbürgern zuteil geworden
ist, auf eine ganz entschiedene Weise kundgegeben. Nicht nur sehr viele
Glieder der israelitischen Gemeinde, welcher er angehörte, nebst ihrem
Religionslehrer, Herrn Dr. Formstecher, sondern auch der
Bürgermeister mit dem größten Teile der Gemeinderatsmitglieder, mehrere
Beamten, einige Lehrer der Kommunalschule, viele der angesehensten Bürger
und, was wohl besonders bemerkt zu werden verdient, der katholische
Geistliche, Herr Dekan Gresser, und der evangelische Geistliche, Herr
Pfarrer Kuhl, bildeten den Leichenzug, der augenfällig zeigte, dass
das Rechte und Gute, von wem es auch geübt werde, in der heutigen Welt, in
welcher leider der Egoismus mit seinem sittenverderbenden Gefolge das Zepter
führt, immer noch Anerkennung findet; eine tröstende Aufmunterung für die
Gerechten, zugleich auch eine ernste Ermahnung für die vielen, welche zwar
berufen, aber nicht auserwählt sind. Auf dem Friedhofe hielt zuerst Herr Dr.
Formstecher und hierauf Herr Pfarrer Kuhl eine Rede. Es war
wohltuend und erhebend, hier zwei Religionslehrer von so verschiedener Art
nebeneinander zu sehen, die in ihren vortrefflichen Reden im Allgemeinen
dahin übereinstimmten: dass der Hingeschiedene, über jede Form erhaben und
nur im Geiste wirkend, den Christen in demselben Grade wie den Genossen
seines Glaubens geliebt und diese seine Menschenliebe insbesondere auch
gegen die Armen und Notleidenden betätigt habe; dass er in jedem ohne
Unterschiede des Standes nur allein den Menschen geachtet, dessen Glaube ihm
stets heilig gewesen, und dass er sein Leben nicht für sein Ich,
sondern nur für die Menschheit gelebt habe und somit ein Mensch
im schönsten Sinne des Wortes gewesen sei. Ja, er, der Heimgegangene, war in
der Tat, wie ihn seine Vertrautesten auch sehr treffend bezeichneten (dies
sei hier zu sagen uns erlaubt), ein 'Nathan der Weise'. " Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1842: "Offenbach,
6. Dezember. Bei der heute dahier stattgehabten Beerdigung des im Alter von
64 Jahren ganz plötzlich hingeschiedenen Kaufmanns Heinrich Sugenheim,
an welchem der hiesige Stadtvorstand eines seiner gediegensten Mitglieder
und somit die Stadt einen sehr tüchtigen Vertreter verloren, hat sich die
Hochachtung, welche dem Verblichenen von seinen Mitbürgern zuteil geworden
ist, auf eine ganz entschiedene Weise kundgegeben. Nicht nur sehr viele
Glieder der israelitischen Gemeinde, welcher er angehörte, nebst ihrem
Religionslehrer, Herrn Dr. Formstecher, sondern auch der
Bürgermeister mit dem größten Teile der Gemeinderatsmitglieder, mehrere
Beamten, einige Lehrer der Kommunalschule, viele der angesehensten Bürger
und, was wohl besonders bemerkt zu werden verdient, der katholische
Geistliche, Herr Dekan Gresser, und der evangelische Geistliche, Herr
Pfarrer Kuhl, bildeten den Leichenzug, der augenfällig zeigte, dass
das Rechte und Gute, von wem es auch geübt werde, in der heutigen Welt, in
welcher leider der Egoismus mit seinem sittenverderbenden Gefolge das Zepter
führt, immer noch Anerkennung findet; eine tröstende Aufmunterung für die
Gerechten, zugleich auch eine ernste Ermahnung für die vielen, welche zwar
berufen, aber nicht auserwählt sind. Auf dem Friedhofe hielt zuerst Herr Dr.
Formstecher und hierauf Herr Pfarrer Kuhl eine Rede. Es war
wohltuend und erhebend, hier zwei Religionslehrer von so verschiedener Art
nebeneinander zu sehen, die in ihren vortrefflichen Reden im Allgemeinen
dahin übereinstimmten: dass der Hingeschiedene, über jede Form erhaben und
nur im Geiste wirkend, den Christen in demselben Grade wie den Genossen
seines Glaubens geliebt und diese seine Menschenliebe insbesondere auch
gegen die Armen und Notleidenden betätigt habe; dass er in jedem ohne
Unterschiede des Standes nur allein den Menschen geachtet, dessen Glaube ihm
stets heilig gewesen, und dass er sein Leben nicht für sein Ich,
sondern nur für die Menschheit gelebt habe und somit ein Mensch
im schönsten Sinne des Wortes gewesen sei. Ja, er, der Heimgegangene, war in
der Tat, wie ihn seine Vertrautesten auch sehr treffend bezeichneten (dies
sei hier zu sagen uns erlaubt), ein 'Nathan der Weise'. " |
| |
 Artikel
in der
"Allgemeinen Zeitung des Judentums" am 21. Mai 1842: "Aus
Mittelfranken. 21. April (1842). Eines der letzten Kreis-Intelligenzblätter
enthält eine Bekanntmachung der königlichen Regierung, nach welcher der
israelitische Kaufmann Heinrich Sugenheim in Offenbach, seinen Geburtsort
Markt
Sugenheim, königlich bayerisches Landgericht Markt Bibart, letztwillig mit 500
Gulden bedacht hat, von welchen die Zinsen alljährlich an dem ersten Sonntag
nach dem 1. Dezember unter den Armen, ohne Unterschied der Konfession,
verteilt werden sollen. Artikel
in der
"Allgemeinen Zeitung des Judentums" am 21. Mai 1842: "Aus
Mittelfranken. 21. April (1842). Eines der letzten Kreis-Intelligenzblätter
enthält eine Bekanntmachung der königlichen Regierung, nach welcher der
israelitische Kaufmann Heinrich Sugenheim in Offenbach, seinen Geburtsort
Markt
Sugenheim, königlich bayerisches Landgericht Markt Bibart, letztwillig mit 500
Gulden bedacht hat, von welchen die Zinsen alljährlich an dem ersten Sonntag
nach dem 1. Dezember unter den Armen, ohne Unterschied der Konfession,
verteilt werden sollen. |
Über das rätselhafte Verschwinden eines jüdischen
Jungen aus Offenbach (1862)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Oktober
1862: "Offenbach, 16. Sept. Viel Stoff zu allerlei Gespräch
gibt hier das rätselhafte Verschwinden des in
Seligenstadt bei einem Schuhmacher
in Arbeit gewesenen Sohn eines hiesigen Israeliten. Der Vater, eines Tages
benachrichtigt, dass sein Sohn im Begriff stehe, zur katholischen Kirche
überzutreten, eilte zu ihm, um ihn mit hierher zurückzunehmen. Der Meister,
bei dem er in Arbeit stand, wollte ihn jedoch nicht sofort freigeben,
versprach aber, ihn in einigen Tagen zu entlassen. Dies geschah auch; der
junge Israelit zog ab, kam aber nicht nach Offenbach, sondern – verschwand!
Seitdem sind Wochen vergangen, und noch hat sich keine Spur von ihm gezeigt;
alle Nachforschungen blieben bis jetzt vergebens. Der katholische Pfarrer in
Seligenstadt hat dem Vater erklärt, dass er seinen Sohn nicht kenne; bei der
nach seinem Verschwinden am dortigen Landgericht eingeleiteten Untersuchung
ergab sich jedoch mindestens so viel, dass der junge Mann bereits seit
einiger Zeit römisch-katholischen Religionsunterricht genossen hat." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Oktober
1862: "Offenbach, 16. Sept. Viel Stoff zu allerlei Gespräch
gibt hier das rätselhafte Verschwinden des in
Seligenstadt bei einem Schuhmacher
in Arbeit gewesenen Sohn eines hiesigen Israeliten. Der Vater, eines Tages
benachrichtigt, dass sein Sohn im Begriff stehe, zur katholischen Kirche
überzutreten, eilte zu ihm, um ihn mit hierher zurückzunehmen. Der Meister,
bei dem er in Arbeit stand, wollte ihn jedoch nicht sofort freigeben,
versprach aber, ihn in einigen Tagen zu entlassen. Dies geschah auch; der
junge Israelit zog ab, kam aber nicht nach Offenbach, sondern – verschwand!
Seitdem sind Wochen vergangen, und noch hat sich keine Spur von ihm gezeigt;
alle Nachforschungen blieben bis jetzt vergebens. Der katholische Pfarrer in
Seligenstadt hat dem Vater erklärt, dass er seinen Sohn nicht kenne; bei der
nach seinem Verschwinden am dortigen Landgericht eingeleiteten Untersuchung
ergab sich jedoch mindestens so viel, dass der junge Mann bereits seit
einiger Zeit römisch-katholischen Religionsunterricht genossen hat." |
Zum Soldatentod von Eugen Berg (1870)
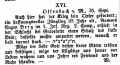 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Oktober
1870: "XVI. Offenbach am Main, 25. Sept. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Oktober
1870: "XVI. Offenbach am Main, 25. Sept.
Auch hier hat der Krieg seine Opfer gefordert; ein hoffnungsvoller Jüngling,
23 Jahre alt, namens Eugen Berg im 1. Infanterie Regiment 2. Compagnie,
erhielt in der Schlacht bei Gravelotte einen Schuss ins linke Bein; dasselbe
musste amputiert werden, wonach er bald darauf starb.
Seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens.
Möge der liebe Gott dessen brave Eltern trösten und kräftigen; möge der
Allgütige uns ferner vor Leiden wahren und uns Jahre des Friedens und der
Ruhe schenken.
M.
Anmerkung: - Gravelotte:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Gravelotte |
Lob
der (jüdischen) Weißgerberei Mayer und Feistmann in Offenbach durch
(nichtjüdische) Familien in Ober-Roden (1870)
Anmerkung: Nichtjüdische Familienväter aus Nieder-Roden, die normalerweise
bei der Weißgerberei Mayer und Feistmann in Offenbach arbeiteten, waren zum
Kriegseinsatz an der Front; in dieser Zeit wurden ihre Familien von der Firma
offenbar großzügig unterstützt.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. November 1870: "Nieder-Roden,
20. Oktober (1870). Von den vielen Edlen, die genannt oder ungenannt,
öffentlich oder im Stillen Gutes tun, verdient gewiss die Weißgerberei
Mayer und Feistmann in Offenbach eine laute Anerkennung, welche zu
zollen wir nicht versäumen wollen. Vier hiesige Familien von ihm Krieg
stehenden Soldaten, wovon die Männer in diesem Geschäftshaus früher in Arbeit
standen, wurden bisher per Woche unterstützt. Wenngleich es dafür
bürgt, dass sich diese Militärs durch ihren Fleiß und ihr Betragen die
Liebe und das Vertrauen ihrer Arbeitgeber erwarben, so ist's aber doch
auch ein klarer Beweis von dem guten Sinn dieses Geschäftshauses, zumal
außer den hier genannten 18 Familien, wie man hört, von demselben in
gleicher Weise unterstützt
werden." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. November 1870: "Nieder-Roden,
20. Oktober (1870). Von den vielen Edlen, die genannt oder ungenannt,
öffentlich oder im Stillen Gutes tun, verdient gewiss die Weißgerberei
Mayer und Feistmann in Offenbach eine laute Anerkennung, welche zu
zollen wir nicht versäumen wollen. Vier hiesige Familien von ihm Krieg
stehenden Soldaten, wovon die Männer in diesem Geschäftshaus früher in Arbeit
standen, wurden bisher per Woche unterstützt. Wenngleich es dafür
bürgt, dass sich diese Militärs durch ihren Fleiß und ihr Betragen die
Liebe und das Vertrauen ihrer Arbeitgeber erwarben, so ist's aber doch
auch ein klarer Beweis von dem guten Sinn dieses Geschäftshauses, zumal
außer den hier genannten 18 Familien, wie man hört, von demselben in
gleicher Weise unterstützt
werden." |
Benennung einer Straße nach J. Speyer (1876)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. September
1876: "Offenbach, 24. Aug. Die Stadtverordneten haben um das
Andenken des Herrn J. Speyer dahier zu ehren, dem seiner Zeit die
Naumann’sche Besitzung zustand und der durch milde Stiftungen, die er zu
Gunsten der israelitischen Gemeinde Offenbachs und
Bürgels gemacht, sich ein bleibendes
Denkmal gesetzt hat, in ihrer letzten Sitzung beschlossen, dass künftig die
Stiftstraße den Namen 'Speyerstraße' führen soll. Aus Anerkennung hierfür
hat Herr Isaak Ruben Ellisen, ein in
Frankfurt wohnender Enkel des Genannten, den Armen Offenbachs ein
Geschenk von 300 Mark gemacht." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. September
1876: "Offenbach, 24. Aug. Die Stadtverordneten haben um das
Andenken des Herrn J. Speyer dahier zu ehren, dem seiner Zeit die
Naumann’sche Besitzung zustand und der durch milde Stiftungen, die er zu
Gunsten der israelitischen Gemeinde Offenbachs und
Bürgels gemacht, sich ein bleibendes
Denkmal gesetzt hat, in ihrer letzten Sitzung beschlossen, dass künftig die
Stiftstraße den Namen 'Speyerstraße' führen soll. Aus Anerkennung hierfür
hat Herr Isaak Ruben Ellisen, ein in
Frankfurt wohnender Enkel des Genannten, den Armen Offenbachs ein
Geschenk von 300 Mark gemacht."
Anmerkung: - Isaak Ruben Ellisen: Hierbei handelt es sich um einen
Verwandten von Lazard Speyer-Ellissen
https://de.wikipedia.org/wiki/Lazard_Speyer-Ellissen |
Über den Bettler Ludwig Eichel aus Offenbach
(1878)
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1878: "Das
Bettlergewerbe. Wie lukrativ das Bettlergewerbe ist, wenn es geschickt
betrieben wird, beweist die Lebensgeschichte eines früheren Schneiders,
namens Ludwig Eichel aus Offenbach, welcher innerhalb der letzten fünfzehn
Jahre ein Vermögen von circa 16.000 Mark zusammengebettelt hatte und vor
Kurzem wegen Bettelns etc. in Baden verhaftet worden ist. Eichel hat ganz
Deutschland, Belgien, Schweden, Norwegen, Ungarn etc. bettelnd durchzogen
und unter den verschiedensten Vorspiegelungen (meist gibt es sich für
einen ehemaligen israelitischen Lehrer aus) besonders jüdische Familien
heimgesucht. Dabei hat er sich ein ansehnliches Vermögen
zusammengebettelt, nach seiner eigenen Angabe ca. 16.000 Mark. Schon im
Jahre 1864 wurden ihm bei einer Verhaftung in Springe 3.000 Mark
abgenommen und heißt es darüber in den Akten: 'dass er diese 1829
Gulden 22 Kreuzer zusammengebettelt, Beleg genug, dass er sein Geschäft
nicht schlecht betrieben.' Ein weiterer charakteristischer Zug des
Eichel ist, dass er die in Baden zusammengebettelten Gelder, soweit er sie
nicht zu seinem Lebensunterhalt (und er lebte ganz gut) bedurfte, sofort
zinstragend bei der dortigen Sparkasse des Vorschussvereins anlegte." Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1878: "Das
Bettlergewerbe. Wie lukrativ das Bettlergewerbe ist, wenn es geschickt
betrieben wird, beweist die Lebensgeschichte eines früheren Schneiders,
namens Ludwig Eichel aus Offenbach, welcher innerhalb der letzten fünfzehn
Jahre ein Vermögen von circa 16.000 Mark zusammengebettelt hatte und vor
Kurzem wegen Bettelns etc. in Baden verhaftet worden ist. Eichel hat ganz
Deutschland, Belgien, Schweden, Norwegen, Ungarn etc. bettelnd durchzogen
und unter den verschiedensten Vorspiegelungen (meist gibt es sich für
einen ehemaligen israelitischen Lehrer aus) besonders jüdische Familien
heimgesucht. Dabei hat er sich ein ansehnliches Vermögen
zusammengebettelt, nach seiner eigenen Angabe ca. 16.000 Mark. Schon im
Jahre 1864 wurden ihm bei einer Verhaftung in Springe 3.000 Mark
abgenommen und heißt es darüber in den Akten: 'dass er diese 1829
Gulden 22 Kreuzer zusammengebettelt, Beleg genug, dass er sein Geschäft
nicht schlecht betrieben.' Ein weiterer charakteristischer Zug des
Eichel ist, dass er die in Baden zusammengebettelten Gelder, soweit er sie
nicht zu seinem Lebensunterhalt (und er lebte ganz gut) bedurfte, sofort
zinstragend bei der dortigen Sparkasse des Vorschussvereins anlegte." |
Goldene Hochzeit von Ehepaar Moses Cahn
(1887)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. November
1887: "Offenbach a. M., 17. Nov. Heute feierten Herr und
Frau Moses Cahn das so seltene Fest der goldenen Hochzeit. Herr Moses
Cahn, welcher sein 79. Lebensjahr vor 8 Tagen zurückgelegt und dessen
Ehegattin, welche der Jahre 77 zählt, begehen diesen Tag im Kreise ihrer
Kinder- und Enkelschar in seltener Frische und Rüstigkeit. Am Vorabend wurde
dem Ehepaar von dem Gesangsverein 'Sumser', sowie von einer
Frankfurter Gesellschaft ein
Ständchen gebracht. Heute in frühester Morgenstunde wurden dem Jubelpaar von
vielen Seiten sinnreiche Geschenke und Glückwünsche, deren große Anzahl uns
den Beweis geliefert, wie beliebt und hochgeachtet die Gefeierten sind,
überreicht. Mittags findet im Logensaale die eigentliche Famiienfeier statt
welche sich zu einem echten Familienfest gestalten wird. Nicht unerwähnt
möchten wir lassen, dass Herr Cahn an diesem Freudentag durch die Spende
einer namhaften Summe auch der Armen unserer Stadt gedachte. Möge es dem
Jubelpaar vergönnt sein, vereint auch die diamantene Hochzeit zu feiern." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. November
1887: "Offenbach a. M., 17. Nov. Heute feierten Herr und
Frau Moses Cahn das so seltene Fest der goldenen Hochzeit. Herr Moses
Cahn, welcher sein 79. Lebensjahr vor 8 Tagen zurückgelegt und dessen
Ehegattin, welche der Jahre 77 zählt, begehen diesen Tag im Kreise ihrer
Kinder- und Enkelschar in seltener Frische und Rüstigkeit. Am Vorabend wurde
dem Ehepaar von dem Gesangsverein 'Sumser', sowie von einer
Frankfurter Gesellschaft ein
Ständchen gebracht. Heute in frühester Morgenstunde wurden dem Jubelpaar von
vielen Seiten sinnreiche Geschenke und Glückwünsche, deren große Anzahl uns
den Beweis geliefert, wie beliebt und hochgeachtet die Gefeierten sind,
überreicht. Mittags findet im Logensaale die eigentliche Famiienfeier statt
welche sich zu einem echten Familienfest gestalten wird. Nicht unerwähnt
möchten wir lassen, dass Herr Cahn an diesem Freudentag durch die Spende
einer namhaften Summe auch der Armen unserer Stadt gedachte. Möge es dem
Jubelpaar vergönnt sein, vereint auch die diamantene Hochzeit zu feiern." |
Zum Tod des Stadtverordneten und Gemeindevorstehers Theodor
Maynz (1888)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25.
Oktober 1888: "Bonn, 21. Oktober (1888). Man schreibt uns
aus Offenbach am Main, 14. Oktober: Montag, den 8. dieses Monats
verstarb dahier Herr Theodor Maynz, Stadtverordneter und
israelitischer Gemeindevorsteher. Ein langer Zug Leidtragender, wie
ihn unsere Stadt wohl selten sieht, folgte dem mit zahlreichen
Blumen und Kränzen geschmückten Sarge und legte beredtes Zeugnis davon
ab, welch hoher Achtung und Liebe sich der Verstorbene in allen Kreisen
der Bevölkerung zu erfreuen hatte. Die Grabrede, welcher die Worte
Davids: 'Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan, ich habe viel
Freude und Wonne an dir gehabt!' zu Grunde lagen, hielt Herr Kantor Vogel.
Im Namen der Stadtverordnetenversammlung widmete sodann Herr Oberbürgermeister
Brink dem Entschlafenen für seine jederzeit opferwillige und treue
Hingabe, sein rastloses und selbstloses Streben zum Wohle der Vaterstadt
waren Worte des Abschiedes und des Dankes, ihn als leuchtendes Vorbild
eines städtischen Vertreters schildernd. Die mit Rührung gesprochenen
Worte machen auf alle Teilnehmenden einen tiefen Eindruck. Wir haben Alle
in dem teuren Entschlafenen Vieles verloren. Die Lücke, welche er in
seinem Wirkungskreise, besonders aber in der jüdischen Gemeindevertretung
und dem Stadtvorstand hinterlässt, wird schwer auszufüllen
sein." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25.
Oktober 1888: "Bonn, 21. Oktober (1888). Man schreibt uns
aus Offenbach am Main, 14. Oktober: Montag, den 8. dieses Monats
verstarb dahier Herr Theodor Maynz, Stadtverordneter und
israelitischer Gemeindevorsteher. Ein langer Zug Leidtragender, wie
ihn unsere Stadt wohl selten sieht, folgte dem mit zahlreichen
Blumen und Kränzen geschmückten Sarge und legte beredtes Zeugnis davon
ab, welch hoher Achtung und Liebe sich der Verstorbene in allen Kreisen
der Bevölkerung zu erfreuen hatte. Die Grabrede, welcher die Worte
Davids: 'Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan, ich habe viel
Freude und Wonne an dir gehabt!' zu Grunde lagen, hielt Herr Kantor Vogel.
Im Namen der Stadtverordnetenversammlung widmete sodann Herr Oberbürgermeister
Brink dem Entschlafenen für seine jederzeit opferwillige und treue
Hingabe, sein rastloses und selbstloses Streben zum Wohle der Vaterstadt
waren Worte des Abschiedes und des Dankes, ihn als leuchtendes Vorbild
eines städtischen Vertreters schildernd. Die mit Rührung gesprochenen
Worte machen auf alle Teilnehmenden einen tiefen Eindruck. Wir haben Alle
in dem teuren Entschlafenen Vieles verloren. Die Lücke, welche er in
seinem Wirkungskreise, besonders aber in der jüdischen Gemeindevertretung
und dem Stadtvorstand hinterlässt, wird schwer auszufüllen
sein."
Anmerkung: - Oberbürgermeister Brink:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Brink |
Stiftungen
jüdischer Gemeindeglieder (1907)
Anmerkung: zu Kommerzienrat Ludo Mayer siehe Anmerkungen bei nachfolgendem
Artikel von 1911.
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 19. Juli 1907:
"Zur Feier ihres 50-jährigen Geschäftsjubiläums überwiesen die
Herren J. Mayer und Sohn dem Pensionsfonds der Witwen und Waisen
ihrer Arbeiter 100.000 Mark. - Außerdem stiftete Herr Kommerzienrat Ludo
Mayer seiner Vaterstadt zirka 200.000 Mark zur Freilegung des Schlossplatzes
und Herstellung eines monumentalen Renaissancebrunnens, umgeben von
Parkanlagen". Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 19. Juli 1907:
"Zur Feier ihres 50-jährigen Geschäftsjubiläums überwiesen die
Herren J. Mayer und Sohn dem Pensionsfonds der Witwen und Waisen
ihrer Arbeiter 100.000 Mark. - Außerdem stiftete Herr Kommerzienrat Ludo
Mayer seiner Vaterstadt zirka 200.000 Mark zur Freilegung des Schlossplatzes
und Herstellung eines monumentalen Renaissancebrunnens, umgeben von
Parkanlagen". |
Nach Kommerzienrat Ludo Mayer wird eine Straße benannt
(1911)
Anmerkung: Ludo Mayer wurde am 28. April 1845 in Offenbach geboren. Sein
Vater hatte die Lederfabrik Mayer & Feistmann (später Mayer & Sohn)
mitgegründet. Auf Grund großzügiger Spenden konnte u.a. der
"Ernst-Ludwigs-Brunnen" auf dem Schlosshof
("Ludo-Mayer-Brunnen") finanziert werden. Ludo Mayer - seit 1915
Ehrenbürger der Stadt Offenbach am Main - starb am 14. November 1917 während
eines Kuraufenthaltes in Bad Nauheim. Die Ludo-Mayer-Straße besteht bis heute
in Offenbach.
Zur Geschichte der Firma von Ludo Mayer siehe Wikipedia-Artikel
über J. Mayer & Sohn.
Foto des Grabmals in Offenbach.
Goldene Hochzeit von Fabrikbesitzer Louis Wallerstein
und Frau (1911)
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. September 1911: "Der
Fabrikbesitzer Louis Wallerstein in Offenbach am Main, Mitinhaber der
Firma Eugen Wallerstein & Co., feierte in seltener körperlicher und
geistiger Frische mit seiner Gemahlin das Fest der goldenen Hochzeit." Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. September 1911: "Der
Fabrikbesitzer Louis Wallerstein in Offenbach am Main, Mitinhaber der
Firma Eugen Wallerstein & Co., feierte in seltener körperlicher und
geistiger Frische mit seiner Gemahlin das Fest der goldenen Hochzeit."
Anmerkung: -
https://de.wikipedia.org/wiki/Schuhfabrik_Hassia_Gebr._Liebmann
|
Zum Tod von Kommerzienrat und Bankier Heinrich
Merzbach (1911)
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. November 1911: "Kommerzienrat Heinrich
Merzbach, der Seniorchef des Bankhauses S.
Merzbach und langjähriger erster Vorstand der israelitischen Gemeinde in
Offenbach am Main, ist dieser Tage infolge eines Asthmaleidens im 71.
Lebensjahr gestorben. Merzbach trat anfangs der 1860er-Jahre unter seinem
Vater, dem Begründer des Bankhauses, in dieses ein und übernahm im Jahre
1870 mit seinem vor einigen Jahren verstorbenen Bruder Hermann die Leitung
der Geschäfte, die er seitdem bis vor einiger Zeit als Seniorchef führte." Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. November 1911: "Kommerzienrat Heinrich
Merzbach, der Seniorchef des Bankhauses S.
Merzbach und langjähriger erster Vorstand der israelitischen Gemeinde in
Offenbach am Main, ist dieser Tage infolge eines Asthmaleidens im 71.
Lebensjahr gestorben. Merzbach trat anfangs der 1860er-Jahre unter seinem
Vater, dem Begründer des Bankhauses, in dieses ein und übernahm im Jahre
1870 mit seinem vor einigen Jahren verstorbenen Bruder Hermann die Leitung
der Geschäfte, die er seitdem bis vor einiger Zeit als Seniorchef führte." |
| |
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 3. November
1911: "Offenbach a. M. Mit Kommerzienrat Heinrich Merzbach,
der im 70. Lebensjahre verschieden ist, hat die jüdische Gemeinde ihren
Präses, die Stadt einen ihrer besten Bürger verloren. Offenbach verdankt
seine hervorragende Entwicklung als Industriestadt zum guten Teil dem, von
dem Verstorbenen geleiteten Bankhause. Aber auch als Mensch hinterlässt er
ein gesegnetes Andenken, denn seine Menschenliebe hat gar manchem
Geschäftsmann und Fabrikanten Offenbachs über kritische Momente
uneigennützig hinweggeholfen." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 3. November
1911: "Offenbach a. M. Mit Kommerzienrat Heinrich Merzbach,
der im 70. Lebensjahre verschieden ist, hat die jüdische Gemeinde ihren
Präses, die Stadt einen ihrer besten Bürger verloren. Offenbach verdankt
seine hervorragende Entwicklung als Industriestadt zum guten Teil dem, von
dem Verstorbenen geleiteten Bankhause. Aber auch als Mensch hinterlässt er
ein gesegnetes Andenken, denn seine Menschenliebe hat gar manchem
Geschäftsmann und Fabrikanten Offenbachs über kritische Momente
uneigennützig hinweggeholfen."
Anmerkung: - Heinrich Merzbach:
https://www.ancestry.com/genealogy/records/heinrich-merzbach-24-5wcyrd
|
Vermächtnis des Josef Meyer an die israelitische
Gemeinde (1910)
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Februar 1910: "Der im
Dezember vorigen Jahres in Offenbach verstorbene Rentier Josef Meyer hat
der israelitischen Gemeinde 30.000 Mark testamentarisch hinterlassen." Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Februar 1910: "Der im
Dezember vorigen Jahres in Offenbach verstorbene Rentier Josef Meyer hat
der israelitischen Gemeinde 30.000 Mark testamentarisch hinterlassen." |
Rechtsanwalt Dr. Guggenheim wird stellvertretender
Vorsitzender des Kaufmanns- und Gewerbegerichts (1910)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. August 1910: "Zum
stellvertretenden Vorsitzenden des Kaufmanns- und Gewerbegerichts in
Offenbach am Main wurde auf die Dauer von sechs Jahren Rechtsanwalt Dr.
Guggenheim gewählt." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. August 1910: "Zum
stellvertretenden Vorsitzenden des Kaufmanns- und Gewerbegerichts in
Offenbach am Main wurde auf die Dauer von sechs Jahren Rechtsanwalt Dr.
Guggenheim gewählt."
Anmerkung: - Rechtsanwalt Dr. Guggenheim:
https://de.wikipedia.org/wiki/Siegfried_Guggenheim
|
Auszeichnung
für Kommerzienrat Ludwig Mayer (1913)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. April 1913: "Geheimer Kommerzienrat Ludwig Mayer in
Offenbach erhielt das Komturkreuz 2. Klasse des Verdienstordens Philipps
des Großmütigen". Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. April 1913: "Geheimer Kommerzienrat Ludwig Mayer in
Offenbach erhielt das Komturkreuz 2. Klasse des Verdienstordens Philipps
des Großmütigen". |
Bedeutende
Stiftungen von Fabrikant Louis Feistmann, u.a. zugunsten des Synagogenneubaus
(1911 / 1914)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 1.
November 1911: "Offenbach. Louis Feistmann hat für
eine zu erbauende Synagoge 10.000 Mark gespendet". Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 1.
November 1911: "Offenbach. Louis Feistmann hat für
eine zu erbauende Synagoge 10.000 Mark gespendet".
|
| |
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 26. September
1913: "Offenbach am Main. Das Ehepaar Louis
Feistmann hat aus Anlass seiner Silberhochzeit unserer Stadt
die Summe von 20.000 Mark zur Stärkung der vor 10 Jahren ins Leben
gerufenen Josef und Friederike Feistmann-Stiftung überwiesen. Aus den
Zinsen des Stiftungskapitals werden dauernde oder vorübergehende
Unterstützungen an bedürftige ältere Männer oder Frauen ohne
Rücksicht auf die Konfession gewährt. Der simultane Hilfsverein
wurde mit 5000 Mark und die israelitische Hilfskasse mit dem
gleichen Betrag bedacht." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 26. September
1913: "Offenbach am Main. Das Ehepaar Louis
Feistmann hat aus Anlass seiner Silberhochzeit unserer Stadt
die Summe von 20.000 Mark zur Stärkung der vor 10 Jahren ins Leben
gerufenen Josef und Friederike Feistmann-Stiftung überwiesen. Aus den
Zinsen des Stiftungskapitals werden dauernde oder vorübergehende
Unterstützungen an bedürftige ältere Männer oder Frauen ohne
Rücksicht auf die Konfession gewährt. Der simultane Hilfsverein
wurde mit 5000 Mark und die israelitische Hilfskasse mit dem
gleichen Betrag bedacht." |
| |
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. Februar
1914: "Aus Offenbach am Main wird geschrieben. Der Großherzig
genehmigte folgende, in hiesiger Stadt gemachte Stiftungen: Fabrikant
Louis Feistmann und Frau schenkten der Stadt aus Anlass der 25.
Wiederkehr des Hochzeitstages 20.000 Mark zur Verwendung der
Jos.-Friederik-Feistmann-Stiftung. L. Feistmann schenkte der
israelitischen Religionsgemeinde 50.000 Mark zur Verwendung für den
Neubau der Synagoge. 40.000 Mark davon sind lebenslänglich dem Geber,
nach seinem Tode dessen Ehefrau im Fall ihres Überlebens zu 4 Prozent zu
verzinsen." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. Februar
1914: "Aus Offenbach am Main wird geschrieben. Der Großherzig
genehmigte folgende, in hiesiger Stadt gemachte Stiftungen: Fabrikant
Louis Feistmann und Frau schenkten der Stadt aus Anlass der 25.
Wiederkehr des Hochzeitstages 20.000 Mark zur Verwendung der
Jos.-Friederik-Feistmann-Stiftung. L. Feistmann schenkte der
israelitischen Religionsgemeinde 50.000 Mark zur Verwendung für den
Neubau der Synagoge. 40.000 Mark davon sind lebenslänglich dem Geber,
nach seinem Tode dessen Ehefrau im Fall ihres Überlebens zu 4 Prozent zu
verzinsen."
Anmerkung: - Louis Feistmann (Portrait):
https://offenbacher-wirtschaft.de/die-praesidentin-und-die-praesidenten-der-ihk-offenbach-am-main/ |
Ingenieur
Gustav Gabriel ist Vorsitzender des Ortsausschusses für die gesetzliche
Gesellenprüfung (1912)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 20. Dezember 1912: "Offenbach. Ingenieur Gustav
Gabriel wurde zum Vorsitzenden des Ortsausschusses für die
gesetzliche Gesellenprüfung bestimmt." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 20. Dezember 1912: "Offenbach. Ingenieur Gustav
Gabriel wurde zum Vorsitzenden des Ortsausschusses für die
gesetzliche Gesellenprüfung bestimmt." |
Zur
Beisetzung des gefallenen Unteroffiziers Willi Strauß
(1914)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Oktober
1914: "Offenbach am Main. Vergangenen Sonntag morgen strömte
eine unübersehbare Menschenmenge nach dem hiesigen Friedhof, um der
Beerdigung des Unteroffiziers Willi Strauß beizuwohnen. Am 22.
August wurde er in der Schlacht bei Neuschâteau so schwer verwundet, dass
er drei Tage darauf im Feldlazarett verstarb und mit einigen anderen
Kameraden in fremder Erde bestattet wurde. Nach vieler Mühe gelang es
endlich den Angehörigen, die irdischen Reste des Verstorbenen hierher zu
überführen und den Toten neben der Ruhestätte seiner kürzlich
verstorbenen Mutter beizusetzen. Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Oktober
1914: "Offenbach am Main. Vergangenen Sonntag morgen strömte
eine unübersehbare Menschenmenge nach dem hiesigen Friedhof, um der
Beerdigung des Unteroffiziers Willi Strauß beizuwohnen. Am 22.
August wurde er in der Schlacht bei Neuschâteau so schwer verwundet, dass
er drei Tage darauf im Feldlazarett verstarb und mit einigen anderen
Kameraden in fremder Erde bestattet wurde. Nach vieler Mühe gelang es
endlich den Angehörigen, die irdischen Reste des Verstorbenen hierher zu
überführen und den Toten neben der Ruhestätte seiner kürzlich
verstorbenen Mutter beizusetzen.
Zu dieser letzten Fahrt des Kriegers hatte sich ein großes Trauergefolge
eingefunden. Eine Musikkapelle eröffnete den Zug. Hierauf kamen die
hiesigen Militär- und Kriegervereine, Vertreter der Stadt und zahlreiche
Freunde des Verstorbenen. Nachdem die Ehrensalve verhallt war, hielt Rabbiner
Dr. Goldschmidt eine tief empfundene Grabrede, in der er den Heldentod
fürs Vaterland pries und dem Abgeschiedenen warme Worte der Ehre
nachrief. Zahlreiche Kräne wurden am Grabe niedergelegt, ein Zeichen,
welch großer Beliebtheit sich der Verstorbene überall erfreute. Die
Kapelle spielte darauf 'Wie sie so sanft ruhen', und langsam nahm die
große Trauergemeinde von der stillen Ruhestatt
Abschied." |
| |
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 30. Oktober 1914: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 30. Oktober 1914:
Derselbe Artikel wie oben im "Frankfurter Israelitischen
Familienblatt" |
Im Krieg gefallen: stellvertretender Amtsrichter Dr. Max Dreyfuß
(1914)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 27. November 1914: "Offenbach. Auf dem Felde der Ehre
fiel Gerichtsassessor, stellvertretender Amtsrichter Dr. jur. Max Dreyfuß,
Leutnant der Reserve und Ritter des Eisernen
Kreuzes." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 27. November 1914: "Offenbach. Auf dem Felde der Ehre
fiel Gerichtsassessor, stellvertretender Amtsrichter Dr. jur. Max Dreyfuß,
Leutnant der Reserve und Ritter des Eisernen
Kreuzes." |
Eisernes Kreuz für Simon Gutmann (1916)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 29. Dezember
1916: "Offenbach am Main. Simon Gutmann, Sohn des Kaufmanns
Ch. Gutmann, erhielt das Eiserne Kreuz." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 29. Dezember
1916: "Offenbach am Main. Simon Gutmann, Sohn des Kaufmanns
Ch. Gutmann, erhielt das Eiserne Kreuz." |
Zum Tod von Elise Devries (1918)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 6. September 1918: "Offenbach a. M., 1. Sept. Heute Nacht
entschlief im Alter von nahezu 72 Jahren Frau Elise Devries. Die langjährige
Vorsitzende unseres Frauenvereins und unserer Chewra Kadischa. Sie war eines
der verdienstvollsten Mitglieder unserer Gemeinde und stets zur Stelle, wenn
es galt, Not zu lindern, so dass unsere Armen durch ihren Heimgang einen
großen Verlust zu beklagen haben." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 6. September 1918: "Offenbach a. M., 1. Sept. Heute Nacht
entschlief im Alter von nahezu 72 Jahren Frau Elise Devries. Die langjährige
Vorsitzende unseres Frauenvereins und unserer Chewra Kadischa. Sie war eines
der verdienstvollsten Mitglieder unserer Gemeinde und stets zur Stelle, wenn
es galt, Not zu lindern, so dass unsere Armen durch ihren Heimgang einen
großen Verlust zu beklagen haben."
Anmerkung: - Chewra Kadischa:
https://de.wikipedia.org/wiki/Chewra_Kadischa |
Zum Tod von Hermann Hirsch (1918)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 25. Oktober
1918: "Offenbach. Dieser Tage verstarb ganz plötzlich Hermann
Hirsch dahier im 72. Lebensjahre. Er war ein hervorragendes Mitglied bei dem
Institut der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Offenbach und mehrmals durch
Verleihung der Verdienstmedaille vom Großherzog ausgezeichnet. Im März
kommenden Jahres hätte er sein 50jähriges Jubiläum feiern können, es war ihm
jedoch nicht vergönnt. Bei seiner Bestattung zeigte es sich deutlich, in
welch hohem Ansehen er stand, und Rabb. Dr. Goldschmidt zeigte dies in
seiner Grabrede, indem er in beredten Worten darauf hinwies. Auch
Kreisfeuerwehrinspektor Müller widmete ihm einen warmen Nachruf." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 25. Oktober
1918: "Offenbach. Dieser Tage verstarb ganz plötzlich Hermann
Hirsch dahier im 72. Lebensjahre. Er war ein hervorragendes Mitglied bei dem
Institut der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Offenbach und mehrmals durch
Verleihung der Verdienstmedaille vom Großherzog ausgezeichnet. Im März
kommenden Jahres hätte er sein 50jähriges Jubiläum feiern können, es war ihm
jedoch nicht vergönnt. Bei seiner Bestattung zeigte es sich deutlich, in
welch hohem Ansehen er stand, und Rabb. Dr. Goldschmidt zeigte dies in
seiner Grabrede, indem er in beredten Worten darauf hinwies. Auch
Kreisfeuerwehrinspektor Müller widmete ihm einen warmen Nachruf."
Anmerkung: - Rabbiner Dr. Goldschmidt: vgl.
Artikel von 1901 |
Über die Olympiasiegerin Helene Mayer aus Offenbach
(1928)
 Artikel
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des Central-Vereins)
vom 17. August 1928: "Helene Mayer, die Olympiasiegerin. Artikel
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des Central-Vereins)
vom 17. August 1928: "Helene Mayer, die Olympiasiegerin.
Ein köstlicher Beitrag zur 'Rassenwissenschaft'.
Ja, wenn
Lächerlichkeiten wirklich töten könnten! Alle die Verschrobenheiten
gewisser Rassentheorien wären in dieser Woche mit einem Schlage erledigt
worden. In Amsterdam siegte als Meisterin der ganzen Welt im
Florettflechten die Primanerin Helene Mayer aus Offenbach. Die
deutsche |
 Presse
aller Richtungen ist voll von Lobeshymnen. Der 'Fridericus', also
ein ganz unverdächtiger Zeuge, feiert die Weltmeisterin Helene Mayer im
höchsten Brustton arischer Seligkeit. Er schreibt, also: '...Hochachtung
vor diesem blonden deutschen Mädel, das inmitten der schwarzhaarigen
internationalen Meschpoche, die in Amsterdam den Ton anzugeben sich
bemühte, sich treu zu ihrer Gesinnung und zum verratenen und verfemten Schwarz-Weiß-Rot
bekannte.' Im ersten Siegestaumel hat Helene Mayer die Farben ihres
Fechtklubs, die Schwarz-Weiß-Rot sind, geschwungen. Ähnliche
Lobeslieder singen gerade alle die Blätter, die sonst deutlich oder
verschämt gern ihr 'arisches Deutschtum' betonen. Ja, die Bilderbeilagen deutschnationaler
Zeitungen weisen das ganzseitige Bild der Offenbacher Primanerin
auf, um ihren Lesern die Weltmeisterin darzustellen, um wahrscheinlich
nicht minder die im Textteil gemeldeten blauen Augen und blonden Flechten
Helene Mayers, soweit möglich, im Bilde vorzuführen. Presse
aller Richtungen ist voll von Lobeshymnen. Der 'Fridericus', also
ein ganz unverdächtiger Zeuge, feiert die Weltmeisterin Helene Mayer im
höchsten Brustton arischer Seligkeit. Er schreibt, also: '...Hochachtung
vor diesem blonden deutschen Mädel, das inmitten der schwarzhaarigen
internationalen Meschpoche, die in Amsterdam den Ton anzugeben sich
bemühte, sich treu zu ihrer Gesinnung und zum verratenen und verfemten Schwarz-Weiß-Rot
bekannte.' Im ersten Siegestaumel hat Helene Mayer die Farben ihres
Fechtklubs, die Schwarz-Weiß-Rot sind, geschwungen. Ähnliche
Lobeslieder singen gerade alle die Blätter, die sonst deutlich oder
verschämt gern ihr 'arisches Deutschtum' betonen. Ja, die Bilderbeilagen deutschnationaler
Zeitungen weisen das ganzseitige Bild der Offenbacher Primanerin
auf, um ihren Lesern die Weltmeisterin darzustellen, um wahrscheinlich
nicht minder die im Textteil gemeldeten blauen Augen und blonden Flechten
Helene Mayers, soweit möglich, im Bilde vorzuführen.
Als Helene Mayer vor wenigen Monaten beim Londoner Fechtturnier mehrere
der europäischen Meisterinnen besiegte, da schlug sogar ein echt
deutscher Mann in der 'Anhaltischen Rundschau' also die
Harfe:
'Mit einmal ändert sich die Szene! Ein deutsches Mädel, blond und nett,
Steht - dreimal Siegerin - Helene, Den weißen Handschuh am Florett;
Blauäugig und von frohen Sinnen. Vom Kampfe noch die Wangen rot,
Die ganz Europas Fechterinnen Die Spitze ihres Degens
bot.
Der Neuzeit weibliche Geschöpfe Besiegt sie schlicht im
Sportgewand
Und, denkt euch, sie trägt - blonde Zöpfe! Und schlingt
darum ein weißes Band.
Ein blaues Aug', ein deutscher Schädel Der Jugend Anmut im
Gesicht,
Ein gut gewachsen rheinisch' Mädel - Und ficht, als wie der Teufel
ficht!"
Wir sind der Meinung, dass Abstammung und Religion gewiss recht wenig mit
sportlicher Tüchtigkeit oder Untüchtigkeit zu tun haben. Helene Mayer
kämpfte in der Amsterdamer Olympiade lediglich für den Sieg der
deutschen Farben.
Aber dieses wundervolle Beispiel der verstiegenen 'arischen Rassenlehre'
musste hier angeführt werden, denn diese blauäugige und blondhaarige
Helene Mayer ist die Tochter unseres Offenbacher Mitgliedes, der Arztes Dr.
Mayer, und damit jüdische Deutsche." |
Die
Weltmeisterin im Fechten Helene Mayer gewinnt die Meisterschaft in Amerika
(1933)
Über die Sedergeräte in der Sammlung Dr. Guggenheim in
Offenbach (Artikel von 1934)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. April
1934: "Ein Sedertisch in unseren Tagen Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. April
1934: "Ein Sedertisch in unseren Tagen
Die Sedergeräte in der Sammlung Dr. Guggenheim in Offenbach a. M.
Von Dr. Martha Wertheimer
In jedem Jahr wird in Hunderttausenden von jüdischen Häusern der Seder
gefeiert, in der ganzen Welt. Dass hier von einem Hause die Rede sein soll,
indem er seine besondere gegenwärtige, in Deutschland heimatliche Form hat,
das soll nur so gewertet werden wie es dort der Hausvater selbst meint: Ihr
alle habt die Kraft in euch die Bräuche unserer Vater in frommer Liebe
zueinander und zu eurer Umwelt entspricht, lebendiger Seder! Seder, der
Haggadah, der Gastlichkeit, der Gastlichkeit und der Hoffnung auf die
Strahlkraft von Liebe und Glauben – das spürt, wer von diesem Seder weiß.
Das atmen auch noch im profanen Jahr die Geräte, die eigens für diesen Abend
von Künstlern geschaffen wurden, die dem Hausvater als Freunde nahestehen.
Für seinen Seder hat Dr. Guggenheim in Offenbach am Main sein Haus schmücken
und edle Geräte fertigen lassen, sodass im Laufe von Jahren sich in seinem
Hause eine Fülle von Köstlichkeiten angesammelt hat, die man heute allgemein
als seine 'Sammlung' bezeichnet.
Die Sammlung von Dr. Guggenheim ist eigentlich gar keine. Sie hat ein
Programm und keinen Ehrgeiz. Sie ist einfach geworden weil Dr. Guggenheim
ein Freund der Künstler Rudolf Koch und des Meisters selbst ist, weil er mit
ihrem Schaffen lebte, ehe sie berühmt waren, weil er die Freude an dem Werk
hatte und schöne Stücke, die er liebte, für sich haben wollte. Die
Sedergeräte aber sind wirklich auf seine Bestellung hin gemacht, und gerade
an ihnen wird deutlich, wie hier der Geist, in dem der Kunstfreund lebt,
formschaffend auf den Künstler gewirkt hat.
Es ist von unsagbarem Reiz, wenn man Kunstgegenstände fernab von allem l’art
pour l’art nicht in einem Museum, nicht in einer Sammlung, sondern lebendig
an dem Ort sieht, für den sie geschaffen wurden. An einem hellen Mittag im
Februar wurde mir eine stille Stunde im Hause Guggenheim geschenkt, in der
ich allein zwischen den Büchern und Geräten saß und mich in mich aufnehmen
durfte, was sie mir sagen sollten.
Der volle Klang, der durch diese Stunde tönte, kam mir von der Sederschüssel,
die ich als erstes von allen Geräten sah, die liebevolle Haufrauenhände aus
der Umhüllung schälten und vor mich hinstellten. Sie ist nach Angaben von
Rudolf Koch im Jahre 1919 von Carl Schäfer in Holz geschnitzt worden, in
einem schwärzlichen Grün, schwingt ihr vollkommenes Kreisrund, das die
Mazzot umschließen soll, hinter einem Deckel, der sich geheimnisvoll über
sie legt. Die zarte Riefelung |
 in
einer Art aufgelöstem Palmettenmuster, die strenge vertikale Gliederung der
äußeren Träger, die zur Aufnahme der Schüsselchen für das Moror, das Ei und
den Knochen, Salzwasser, Meerrettich usw. bestimmt sind, geben zusammen mit
dem Schwingen des Gefässes und des Deckels und mit der Farbe, der ganzen
Erscheinung das Pflanzliche, die Illusion des Gewachsenseins, das Unbedingte
und Wahrhaftige, das allen diesen Geräten anhaftet. Da hängen an der Wand
zwei mächtige Teppiche, die ebenfalls aus der Werkstätte stammen; auf rauhem
handgewebten Leinen von grauer Grundfarbe sind mit handgefärbten Fäden
Spruchbänder in Blockanordnung gestickt, die die ganze Fläche überziehen.
Auf dem einen steht in deutscher Übersetzung der 118. Psalm. 'Aus der Tiefe
rief ich zu dir..', die Schriftbänder wechseln als Reihen in der grauen
Grundfarbe, in einem holzigen Braun und einem ruhigen Blau. Die gestrickte
Schrift ist auf den braunen und blauen Reihen in der grauen Grundfarbe, in
einem holzigen Braun und einem ruhigen Blau. Die gestickte Schrift ist auf
den braunen und blauen Reihen , auf der grundfarbigen in dunkelstem Braun
gehalten. Den unteren Raum schließen in starken Buchstaben der hebräischen
Quadratschrift die Sinnworte des Festes, 'Pessach, Mazzo, Moror' ab. Der
andere Teppich ist, wie sein Text, bewegter in der Anordnung der Bänder
gehalten, was dadurch erreicht wird, dass die farbigen Zeilen breiter, die
in der Grundfarbe schmäler gehalten sind. in
einer Art aufgelöstem Palmettenmuster, die strenge vertikale Gliederung der
äußeren Träger, die zur Aufnahme der Schüsselchen für das Moror, das Ei und
den Knochen, Salzwasser, Meerrettich usw. bestimmt sind, geben zusammen mit
dem Schwingen des Gefässes und des Deckels und mit der Farbe, der ganzen
Erscheinung das Pflanzliche, die Illusion des Gewachsenseins, das Unbedingte
und Wahrhaftige, das allen diesen Geräten anhaftet. Da hängen an der Wand
zwei mächtige Teppiche, die ebenfalls aus der Werkstätte stammen; auf rauhem
handgewebten Leinen von grauer Grundfarbe sind mit handgefärbten Fäden
Spruchbänder in Blockanordnung gestickt, die die ganze Fläche überziehen.
Auf dem einen steht in deutscher Übersetzung der 118. Psalm. 'Aus der Tiefe
rief ich zu dir..', die Schriftbänder wechseln als Reihen in der grauen
Grundfarbe, in einem holzigen Braun und einem ruhigen Blau. Die gestrickte
Schrift ist auf den braunen und blauen Reihen in der grauen Grundfarbe, in
einem holzigen Braun und einem ruhigen Blau. Die gestickte Schrift ist auf
den braunen und blauen Reihen , auf der grundfarbigen in dunkelstem Braun
gehalten. Den unteren Raum schließen in starken Buchstaben der hebräischen
Quadratschrift die Sinnworte des Festes, 'Pessach, Mazzo, Moror' ab. Der
andere Teppich ist, wie sein Text, bewegter in der Anordnung der Bänder
gehalten, was dadurch erreicht wird, dass die farbigen Zeilen breiter, die
in der Grundfarbe schmäler gehalten sind.
Auf grauem Grunde erscheinen die deutschen Worte des Psalms 114, 'Als Israel
aus Ägypten zog…', die bunten Bänder jubeln in der heiligen Sprache: 'Haudu
l’audanoi ki tauw' und tragen als Sinnschmuck ein Band mit vier Trauben, dem
Gleichnis für die vier Becher Wein des Sederabends, und als Abschluss eine
Ranke mit fünf Granatäpfeln als Gleichnis für die fünf Bücher der Tora.
Berthold Wolpe, der die Reinheit und Wahrhaftigkeit kunsthandwerklichen
Schaffens mit der Innigkeit seines jüdischen Wissens und Fühlens verbindet,
hat die Teppiche entworfen und ist auch der Schöpfer der wundervollen
Schüssel und Kanne für das feierliche Händewaschen des Hausherrn zum Anfang
der Feier. Rotleuchtendes getriebenes Kupfer trägt um die reine Kreisform
der Schüssel den hebräischen Segensspruch nach dem Händewaschen, und es ist
wundervoll zu sehen, wie sich die Buchstaben der alten Schrift zum edlen
Ornament gestalten ließen. Die Kanne wiederholt die Kreisform in ihrem
breiten Henkel und bereitet seinen Rhythmus durch die nach hinten geschrägte
und geschwungene Form der Kannenöffnung vor.
Greift dann der sedergebende Hausvater nach dem Kidduschbecher, so lässt er
die alte Form des Sturzbechers, der keinen Schmuck hat als sich selbst und
ein zartes Schriftband der Worte aus dem Sch’mah 'Mit ganzem Herzen – mit
ganzer Seele – mit ganzer Kraft.' Die Hausmarke des Hauses Guggenheim, die
in allen Büchern und auf vielen Geräten der Sammlung wiederkehrt, die
behandschuhte Hand, die die Gewürzbüchse auf einem Pokalstiel trägt,
zeichnet den Becher als Weihegerät. Dieser Becher ist in seiner Form einem
150 Jahre alten Becher der Chewrakadischa in Worms https://www.alemannia-judaica.de/worms_synagoge.htm,
der Heimatstadt Dr. Guggenheims, nachgebildet, auf dem die Namen der
Vorväter des Hauses Guggenheim verzeichnet stehen.
Der Seder, der Jahr für Jahr die gleichen frommen Sinnzeichen vor uns
hinstellt und holde Stunden darauf verwendet, sie immer wieder neu und tief
zu deuten, will mit der Formenfülle unserer eigenen Umwelt die uralte
mythische Feier nah und gegenwärtig machen. Damit ist aber schon der Zweck
der feinsten Pessachgabe ausgesagt, die Dr. Guggenheim den jüdischen
Menschen unserer Tage gemacht hat: Der Offenbach Haggadah.1)
Sie will das Gebot 'Du sollst erzählen' erfüllen. Wie es selbst an seinem
Sedertisch die alten Bräuche und die Segenssprüche, die Vorschriften und die
haggadischen Geschichten mit Deutung und Ausschmückung umrankt, so hat er
sie in diesem Buche niedergelegt. Nicht zünftige Gelehrsamkeit, die Kawonnoh,
das liebreiche Glühen eines liebenden Herzens schuf die innere Form, die
hier Lieder und Segenssprüche, Legende und Lobpreisung vereinigt und sie wie
Blütenranken durch die innere Form, die hier Lieder und Segenssprüche,
Legende und Lobpreisung vereinigt und sie wie Blütenranken durch die
vorgeschriebenen Bräuche webt. So erscheinen sie auch in der Buchgestaltung:
Roter Druck hebt die Erwähnung der Handlungen aus dem deutschen Text hervor,
der in einer bibelgotisch geschnittenen Schrift von Rudolf Koch erscheint.
Schwarz stehen auch die edlen hebräischen Buchstaben; die Noten der Lieder
erscheinen, mit ihren eckigen Notenköpfen den alten Missalnoten ähnlich,
schwarz auf roten Linien: Bunt wie die geschaffene Welt sind die Bilder,
ganzseitige Holzschnitte von Fritz Kredel, die mit Herzenseinfalt empfangen
und mit wundervollen Können gestaltet sind. Die Karte von Erez Israel ist
allein schon eine Köstlichkeit. Den gesamten Druck hat Max Dorn in Offenbach
gestaltet und die schwierige Aufgabe erstaunlich klar gelöst, das Vielerlei
die Texte, und der Bilder in ein geschlossenes Ganzes zu bringen.
Die Welt ist tausendfältig und Gott ist Eins. Gelingt es einem Menschen,
dies ewige Wunder uns sinnfällig zu machen, so müssen wir ihm dafür danken
und die Kraft seines Beispiels in uns wirken lassen. Hier ist es geschehen.
Künstler, Gelehrte, Freunde, alle des einen Menschen, wirkten beim Schaffen
dieser Geräte zusammen und der Friede ihrer Liebe wirkt aus ihrem Werk zu
unserer Erkenntnis. Um die Fülle in der Einheit geht es, um den Sinn den
alle Dinge haben. Unsere Väter empfingen seine Offenbarung. Wir nennen in
Jichud, die Einheit alles Geschaffenen in Gott."
1) Erschienen im Verlag des Herausgebers und von ihm zu beziehen. Preis
broschiert RM 60.-
Anmerkungen: - Sedergeräte: Sederteller, Sederschüssel, Kidduschbecher
https://de.wikipedia.org/wiki/Kiddusch
- Seder:
https://de.wikipedia.org/wiki/Seder
- Dr. Guggenheim:
https://de.wikipedia.org/wiki/Siegfried_Guggenheim und
Artikel von 1910
- Haggadah:
https://de.wikipedia.org/wiki/Haggada
- Rudolf Koch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Koch_(Schriftkünstler )
- Mazzot:
https://de.wikipedia.org/wiki/Matze)
- Palmette:
https://de.wikipedia.org/wiki/Palmette
- Moror:
https://de.wikipedia.org/wiki/Maror
- Mazzo:
https://de.wikipedia.org/wiki/Matze)
- Berthold Wolpe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_Wolpe
- Schm’ah:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schma_Jisrael
- Offenbacher Haggadah:
https://www.lbi.org/collections/jewish-holidays-lbi-collections/passover-lbi-collections/offenbacher-haggadah/
- Gewürzbüchse:
https://de.wikipedia.org/wiki/Besamimbüchse
- Chewrakadischa:
https://de.wikipedia.org/wiki/Chewra_Kadischa
- Missal:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schriftgrad
- Fritz Kredel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Kredel
- Erez Israel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Eretz_Israel
-
https://www.fnp.de/kultur/teppich-legt-sich-klingspor-museum-10520899.html |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige der Metzgerei J. Hahn (1879)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Januar
1879: "Koscher - Echte Offenbacher
Wurst Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Januar
1879: "Koscher - Echte Offenbacher
Wurst
versendet gegen Nachnahme à 90 Pfennig pro Pfund, en gros billiger,
J. Hahn, Karlstraße 18, Offenbach am Main." |
Lehrlingssuche des Manufakturwarengeschäftes
Gebr. Eskeles (1883)
 Anzeige in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. März 1883: "Lehrling. Anzeige in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. März 1883: "Lehrling.
Für unser Tuch- und Manufakturwarengeschäft en detail
suchen einen Lehrling mit guter Schulbildung.
Gebr. Eskeles, Offenbach am
Main." |
Anzeige
des Metzgermeisters Max Fried (1901)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 9. Dezember 1901:
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 9. Dezember 1901:
"Suche einen kräftigen
Lehrjungen,
der die Metzgerei und Wurstlerei erlernen will, zum baldigen
Eintritt.
Max Fried, Offenbach am Main, Waldstraße 8". |
Anzeigen
des Tuch- und Maßgeschäftes von Julius Weinberg (1907)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Mai 1904: "Lehrling Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Mai 1904: "Lehrling
gesucht zu Pfingsten, mit guten Schulkenntnissen, bei freier Station, für
mein Tuch-, Schneiderei- und Herrenmodegeschäft.
Julius Weinberg, Offenbach am Main." |
| |
 Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 26. Juli
1907: "Lehrling Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 26. Juli
1907: "Lehrling
mit guter Schulbildung für mein Tuch- und Maßgeschäft gegen
Vergütung baldigst gesucht.
Julius Weinberg, Offenbach am Main."
|
Anzeige
des Herrengarderobegeschäftes Hermann Hirschen (1906)
 Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14.
Dezember 1906: "Lehrling. Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14.
Dezember 1906: "Lehrling.
Suche zum Schulaustritt 1907 für mein Herrengarderobe-Geschäft einen
Lehrling. 3-jährige Lehrzeit. Kost und Logis frei im Hause. Offerten an Hermann
Hirschen, Offenbach am Main". |
Verlobungsanzeige von Irene Meyer und Dr. Julius Reis (1935)
 Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 14. Februar 1935:
Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 14. Februar 1935:
"Irene Meyer - Dr. med. Julius Reis
Verlobte
Offenbach a.M. / Weiskirchen
- Offenbach a.M., Kaiserstr. 55 /
Allendorf (Eder)" |
Verlobungsanzeige von Sala Krakowsky und Ludwig Haas
(1936)
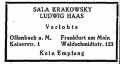 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juni
1936: "Sala Krakowsky - Ludwig Haas. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juni
1936: "Sala Krakowsky - Ludwig Haas.
Verlobte.
Offenbach am Main - Kaiserstraße 1 / Frankfurt am Main
Waldschmidtstraße 123.
Kein Empfang." |
Sonstiges
Erinnerung an die Auswanderungen im 19.
Jahrhundert - Grabstein für Josephine Kuhn geb. Koch aus Offenbach in New
Orleans (1848-1909)
Anmerkung: das Foto wurde von Rolf Hofmann (Stuttgart) im April 1994 im 1860
eröffneten Hebrew Rest Cemetery in New Orleans, 2100 Pelopidas at Frenchman
Street, near Elysian Fields and Gentilly Blvd.,
aufgenommen
 Grabstein im "Hebrew Rest Cemetery" in New Orleans
für Grabstein im "Hebrew Rest Cemetery" in New Orleans
für
"Josephine Koch
beloved Wife of Wolf Kuhn
born in Offenbach Germany
August 20, 1848.
Died in New Orleans
December 8, 1909 Kislew 25 5670." |
Hinweis auf Walter Katz (1913 in Offenbach - 1938
in Spanien)
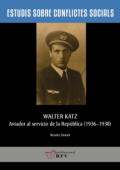 Hinweis auf eine Publikation in spanischer Sprache: Renato Simoni:
WALTER KATZ - aviador al servicio de la República (1936-1938; deutsch:
Flieger im Dienst der Republik). Erschien 2020. Verlag Publicacions URV
Collecció Estudis sobre Conflictes Socials Bd. 8. 152 S. ISBN:
978-84-8424-832-3. Hinweis auf eine Publikation in spanischer Sprache: Renato Simoni:
WALTER KATZ - aviador al servicio de la República (1936-1938; deutsch:
Flieger im Dienst der Republik). Erschien 2020. Verlag Publicacions URV
Collecció Estudis sobre Conflictes Socials Bd. 8. 152 S. ISBN:
978-84-8424-832-3.
Online ist das Buch lesbar über
http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/download/441/459/1033-1?inline=1
Walter Katz ist am 27. April 1913 als Sohn von Rechtsanwalt Dr.
Bernhard Katz (auch langjähriger SPD-Stadtverordneter, Kaiserstraße 82) und Antonia Luise Katz geb. Strauss in Offenbach am
Main geboren, wo er aufgewachsen ist und das Lessing-Gymnasium besuchte. Als
Universitätsstudent (seit 1931 in Freiburg im Breisgau, 1932/33 in München,
dann Gießen) kämpfte er bereits Anfang der 1930er-Jahre gegen den Aufstieg
der Nationalsozialisten. 1933 musste er seine akademische Laufbahn aufgeben
und wanderte nach Spanien aus, wo er sein Studium an der Universität Madrid
abschloss und die spanische Staatsangehörigkeit erhielt. Bei Ausbruch des
spanischen Bürgerkriegs trat er als Flieger ein und trainierte im
Luftfahrtzentrum von Los Alcázares (Murcia). Seit 1937 nahm er an den
wichtigsten Luftschlachten teil. Als Leiter der Nachtflüge der
republikanischen Luftwaffe verteidigte er insbesondere die Mittelmeerküste
(Levante und Katalonien) gegen die Bombenanschläge der faschistischen und
nationalsozialistischen Luftfahrt. Kapitän Walter Katz wurde als letzter
internationaler Jagdflieger am 11. (oder 20.?) November 1938 bei einem
Einsatz am Segre-Fluss über Katalonien abgeschossen.
Die Publikation über Walter Katz wurden unter Verwendung der im
Familienarchiv aufbewahrten Primärquellen erarbeitet. Dabei wurden unter
anderem hunderte von Briefen ausgewertet.
Weitere Hinweise zur Publikation
http://publicacions.urv.cat/cataleg/47-conflictes/855-walter-katz:
Walter Katz (1913-1938), judío alemán, luchó como estudiante
universitario contra el ascenso del nazismo desde principio de los años
treinta. Por motivos raciales, en 1933 tuvo que abandonar su carrera
académica y llegó a España, donde completó sus estudios en la Universidad de
Madrid y obtuvo la nacionalidad española. Al estallar la Guerra Civil se
alistó como aviador y se formó en el centro aeronáutico de Los Alcázares (Murcia).
Desde 1937 participó en las principales batallas aéreas. Como jefe de vuelos
nocturnos defendió en particular el litoral mediterráneo (Levante y Cataluña)
contra los bombardeos de la aviación fascista y nazi al servicio de Franco.
El capitán Katz murió combatiendo con su Chato CA-155 en el frente de Serós
el 11 de noviembre de 1938. La biografía de Walter y la de su madre Antonia
Katz se hallan meticulosamente trazadas gracias a las fuentes primarias
conservadas en el archivo familiar. Pasados más de 80 años, centenares de
cartas han permitido reconstruir un perfil del hombre y del aviador que dio
su vida para proteger de la agresión enemiga a la República y a su indefensa
población civil. " |
Vgl. auch die Publikationen: Michael
Berger: Sie kämpften für Spaniens Freiheit. Deutsche und Österreichische
Juden im Spanischen Bürgerkrieg. In: Jüdische Soldaten - Jüdischer
Widerstand. Ferdinand Schöningh Verlag.
ders.: Für Kaiser, Reich und Vaterland. Jüdische Soldaten. Eine Geschichte
vom 19. Jahrhundert bis heute. Orelli Füssli Verlag AG. Zürich.
www.ofv.ch
Arno Lustiger: Schalom Libertad! Juden im spanischen Bürgerkrieg.
Aufbau Taschenbuch Verlag.
In allen genannten Publikationen wird auch die Geschichte von Walter Katz
genannt. |
| Presseartikel in der spanischen Tageszeitung
"Heraldo" vom 15. September 2020: "Walter Katz, el vigilante de la noche.
Renato Simoni publica la biografía de un piloto alemán encargado de repeler
los ataques nocturnos contra Barcelona durante la Guerra Civil", Link zum
Artikel
https://amp.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2020/09/15/walter-katz-el-vigilante-de-la-noche-1395327.html
. |
| Presseartikel auf das Buch von Elio
Canevascini: CON I PARTIGIANI IN MONTENEGRO – RICORDI DI UNA MISSIONE
DELLA CENTRALE SANITARIA SVIZZERA (1944-1945) di Elio Canevascini, a cura di
Danilo Baratti, Patrizia Candolfi e Renato Simoni. 2020 in:
https://fpct.ch/con-i-partigiani-in-montenegro-ricordi-di-una-missione-della-centrale-sanitaria-svizzera-1944-1945/
|
Nach der Emigration: Todesanzeigen in der amerikanisch-jüdischen Zeitschrift
"Der Aufbau"
Anmerkung: Beim "Aufbau" handelt es sich um eine deutsch-jüdische
Exilzeitung, die 1934 gegründet wurde und bis 2004 in New York erschien. Der
Aufbau entwickelte sich in der NS-Zeit rasch zur wichtigsten Informationsquelle
und Anlaufstelle für jüdische und andere deutschsprachige Flüchtlinge in den
USA. Vgl. Wikipedia-Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Aufbau_(jüdische_Zeitung).
Der Aufbau kann online gelesen werden:
https://archive.org/details/aufbau.
 |
|
|
Traueranzeige
für Paul Goldsmith
früher Offenbach am Main
"Aufbau" vom 3. Dezember 1948 |
|
|
|