|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Marktheidenfeld (Main-Spessart-Kreis)
Jüdische Geschichte / Betsaal
(Seite erstellt unter Mitarbeit von Martin Harth
und Leonhard Scherg, beide Marktheidenfeld)
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Marktheidenfeld bestand eine kleine jüdische Gemeinde
von 1910 bis 1942. Möglicherweise haben bereits im 16. Jahrhundert am Ort
jüdische Personen/Familien gelebt: in einem Schreiben des Rothenfelser Amtmanns
Hans-Wilhelm von Riedern von 1573 wird angefragt, ob der aus Urspringen
stammende Jude Salomon, der inzwischen in Mainz lebte, in das wertheimische Dorf
Heidenfeld (Marktheidenfeld) übersiedeln dürfe (Quelle im Staatsarchiv
Wertheim). Es ist nicht bekannt, ob er sich dort niederlassen durfte.
Erst nach 1871 hatten sich - zuerst durch Familie
Blumenthal aus Kirchbracht 1875, danach vor allem durch Zuzüge
aus den benachbarten Orten Homburg (Familien
Freimark und Heimann) und Karbach (Familie Guttmann) - einige jüdische Familien
niedergelassen.
Die Zahl der jüdischen
Einwohner entwickelte sich bis 1933 wie folgt: 1880 6 jüdische Einwohner (0,2 %
von insgesamt 2.423 Einwohnern), 1900 19 (1,0 % von 1.942), 1910 25 (1,3 %
von 1.973), 1925 14 (0,7 % von 2.030), 1933 17 (0,8 % von 2.232).
1910 konnte eine selbständige Gemeinde begründet werden, die dem
Rabbinatsbezirk Würzburg zugeteilt wurde (bis Frühjahr 1937, dann zum
Bezirksrabbinat Aschaffenburg). An
Einrichtungen war ein Betsaal vorhanden (s.u., der Betraum war zunächst ab
1909 im Haus Mainkai 7, dann bis in die 1930er-Jahre im Haus Glasergasse 5). Die Toten der Gemeinde wurden im
jüdischen Friedhof in Karbach
beigesetzt.
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Simon Levy (geb.
28.4.1882 in Neubrunn, gef. 5.1.1917). Sein Name steht auf dem Mahnmal für die Kriegstoten des Ortes
jenseits der Brücke auf der Anhöhe auf der der Stadt gegenüberliegenden
Mainseite oberhalb des König-Ludwig-Denkmals (auf diesem Mahnmal stehen auch
die Namen der ermordeten Juden der Stadt während der
NS-Zeit).
Seit Mitte oder Ende der 1920er-Jahre wurde die religiöse Betreuung der
Gemeinde Marktheidenfeld durch den jüdischen Lehrer in Urspringen
übernommen.
1933 lebten noch 17 jüdische Personen im Marktort, 1937 waren es
noch 16. In den folgenden beiden Jahren verließen sieben von ihnen
Marktheidenfeld. Drei emigrierten (zwei in die USA, einer nach Holland), vier zogen in andere
deutsche Orte (Frankfurt, München), einer verstarb am Ort. Am 1. Oktober 1938
wurden bei einem Überfall auf ein jüdisches Wohnhaus die Fenster
eingeschlagen. Auch beim Novemberpogrom 1938 kam es zu Ausschreitungen:
nach den Ermittlungs- und Gerichtsakten zu den Vorgängen im damaligen Landkreis
Marktheidenfeld [Staatsarchiv Würzburg] kam es zu Aktionen gegen die Anwesen
der jüdischen Familien. Im Februar 1942 lebten noch neun jüdische Personen
am Ort. Sie wurden 1942 über Würzburg nach Krasnystaw bei Lublin (Polen) deportiert
und wurden ermordet.
Von den in Marktheidenfeld geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Berthold Adler (1921*), Rosa Regina Adler geb. Freimark (1887), William Adler (1888),
Bernhard Freimark (1880), Emanuel Freimark (1888), Friedrich Freimark (1902), Getta Freimark geb. Bierig
(1879), Hermina Freimark geb. Adler (1876), Regina Freimark (1879), Rosa
Gut(t)mann geb. Löwenstein (1888), Samuel Gut(t)mann (1889), Albert Heimann
(1880), Helene Heimann geb. Löwenstein (1886), Lina Katz geb.
Blumenthal (1876), Leopold Levy
(1881), Regina Levy (1884), Fanny Simon
geb. Blumenthal (1882), Lina Wahler geb. Freimark (1892).
* Berthold Adler ist auf dem Gedenkstein der Opfer von Krieg und Gewalt
gleichfalls genannt: er fiel als amerikanischer Soldat 1945 im Raum Aachen (vgl.
unten).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Jüdischer Wanderlehrer gesucht (1926)
 Anzeige
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7.
Oktober 1926: "Der Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden
beabsichtigt in Unterfranken für die Gemeinden Karbach, Marktheidenfeld
und Homburg einen Wanderlehrer anzustellen, der den
Religionsunterricht und die Schechita in diesen drei Gemeinden zu
übernehmen und abwechselnd in jeder dieser Gemeinden als Vorbeter zu
wirken hat. Seminaristische Vorbildung, wenn auch ohne
Anstellungsprüfung, wird verlangt. Die Besoldung erfolgt nach den
Leitsätzen des Verbandes in Anlehnung an die Reichsbesoldungsordnung. Die
durch die Betreuung mehrerer Gemeinden erwachsenden Unkosten werden
gesondert vergütet. Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnissen an den
Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden, München, Herzog-Max-Str.
7/I." Anzeige
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7.
Oktober 1926: "Der Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden
beabsichtigt in Unterfranken für die Gemeinden Karbach, Marktheidenfeld
und Homburg einen Wanderlehrer anzustellen, der den
Religionsunterricht und die Schechita in diesen drei Gemeinden zu
übernehmen und abwechselnd in jeder dieser Gemeinden als Vorbeter zu
wirken hat. Seminaristische Vorbildung, wenn auch ohne
Anstellungsprüfung, wird verlangt. Die Besoldung erfolgt nach den
Leitsätzen des Verbandes in Anlehnung an die Reichsbesoldungsordnung. Die
durch die Betreuung mehrerer Gemeinden erwachsenden Unkosten werden
gesondert vergütet. Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnissen an den
Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden, München, Herzog-Max-Str.
7/I." |
Ausschreibung der Lehrerstelle in Urspringen mit Betreuung der Gemeinde
Marktheidenfeld (1929)
 Zeitschrift "Der
Israelit" am 13. Juni 1929: "Die Israelitische Kultusgemeinde
Urspringen (Unterfranken) beabsichtigt möglichst sofort ihre frei
gewordene Lehrerstelle wieder zu besetzen. Bewerber, die der
gesetzestreuen Richtung angehören, die Schlussprüfung an einem
staatlichen anerkannten Lehrerseminar abgelegt haben und das Kantorat
sowie den Schächtdienst zu übernehmen in der Lage sind, werden ersucht
Bewerbungen unter Vorlage von Zeugnissen bei dem unterfertigten Vorstand
einzureichen. Der Gehalt bemisst sich nach der Besoldungsordnung des
Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden. Dem Beamten obliegt neben
dienstlichen Verpflichtungen in der Gemeinde Urspringen auch der
Religionsunterricht, die Schechita sowie die religiöse Betreuung der
Gemeinden Karbach und Marktheidenfeld nach Maßgabe näherer Vereinbarung. Zeitschrift "Der
Israelit" am 13. Juni 1929: "Die Israelitische Kultusgemeinde
Urspringen (Unterfranken) beabsichtigt möglichst sofort ihre frei
gewordene Lehrerstelle wieder zu besetzen. Bewerber, die der
gesetzestreuen Richtung angehören, die Schlussprüfung an einem
staatlichen anerkannten Lehrerseminar abgelegt haben und das Kantorat
sowie den Schächtdienst zu übernehmen in der Lage sind, werden ersucht
Bewerbungen unter Vorlage von Zeugnissen bei dem unterfertigten Vorstand
einzureichen. Der Gehalt bemisst sich nach der Besoldungsordnung des
Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden. Dem Beamten obliegt neben
dienstlichen Verpflichtungen in der Gemeinde Urspringen auch der
Religionsunterricht, die Schechita sowie die religiöse Betreuung der
Gemeinden Karbach und Marktheidenfeld nach Maßgabe näherer Vereinbarung.
Urspringen, den 7. Juni 1929. Der Vorstand der Israelitischen
Kultusgemeinde Urspringen. Bernhard Dillenberger. |
| |
 Dieselbe
Ausschreibung in der "Bayerischen Israelitischen
Gemeindezeitung" vom 15. Juni 1929. Dieselbe
Ausschreibung in der "Bayerischen Israelitischen
Gemeindezeitung" vom 15. Juni 1929. |
Aus dem jüdischen
Gemeindeleben
Gründung der Israelitischen Kultusgemeinde
Marktheidenfeld (1910)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Juli 1910:
"Die seitens der israelitischen Bevölkerung in Marktheidenfeld
(Bayern) schon so lange angestrebte Gründung einer Kultusgemeinde wurde
vom Königlichen Bezirksamte genehmigt, und als Vorsitzender Herr Albert
Heimann hier gewählt." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Juli 1910:
"Die seitens der israelitischen Bevölkerung in Marktheidenfeld
(Bayern) schon so lange angestrebte Gründung einer Kultusgemeinde wurde
vom Königlichen Bezirksamte genehmigt, und als Vorsitzender Herr Albert
Heimann hier gewählt." |
Informationen
und Dokumente zu einzelnen jüdischen Familien und Personen sowie zum Betsaal
der jüdischen Gemeinde
(Quelle: wenn nicht anders angegeben: Sammlung Martin Harth)
| Familie
Adler und der Betsaal der Gemeinde |
| Der
unten in US-Uniform abgebildete Berthold Adler wurde am 28. Juli 1921 in Marktheidenfeld
geboren als Sohn des späteren Vorsitzenden der jüdischen Kultusgemeinde und Viehhändlers
William Adler (geb. 12. August 1888 in Neuhof-Opperz) und seiner Frau
Regina (Rosa) geb. Freimark (geb. 29. Dezember 1887 in Marktheidenfeld).
Im Anwesen der Familie Adler in der Glasergasse befand sich der Betsaal der
Gemeinde (siehe unten). William Adler wurde beim Novemberpogrom 1938 festgenommen und bis zum 14. Dezember 1938 im KZ Dachau inhaftiert.
Berthold Adler war 1935 nach München und zwei Jahre später nach Frankfurt umgezogen. Er emigrierte später über die Sowjetunion in die USA und fiel 1945 als Soldat der US-Army im Raum Aachen. Seine Schwester
Hertha (geb. 21. August 1915 in Marktheidenfeld) emigrierte 1937 nach New York.
William und Regina Adler wurden am 25. April 1942 von Würzburg nach
Krasnystaw deportiert und sind umgekommen. |
 |

 |
|
Berthold Adler
(Quelle: Stadtarchiv
Marktheidenfeld, Sammlung Eschenbacher) |
William
Adler und Regina geb. Freimark
(Quelle: Staatsarchiv Würzburg LRA Mar 3410) |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
Eintrag von Hertha
Adler in das Poesiealbum ihrer
Schulkameradin Anneliese Ludwig aus dem Jahr 1929
(Quelle: Sammlung Armin Hospes)
|
Mädchenklasse
im Hof der Marktheidenfelder
Obertorschule (2. Hälfte 1920er-Jahre). Erste Reihe Mitte:
Hertha Adler, rechts neben ihr Ruth Heimann
(Quelle: Stadtarchiv Marktheidenfeld, Sammlung Eschenbacher) |
Anzeige
der Auswanderung von Hertha Adler
nach New York im Juli 1937
(Quelle: Stadtarchiv Marktheidenfeld,
Ordner Juden 1933-1946) |
| |
|
|
| |
|
Erster Betraum im Haus der
Familie Stumpf
am (Oberen) Mainkai |
Zweiter Betraum im Haus der Familie
Adler
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum September 2006) |
|
 |

 |
 |
Plan des
Marktheidenfelder Baumeisters Max Ludwig für einen
Betraum im Obergeschoss des Hauses von Andreas Stumpf
(heute Mainkai 7) aus dem Jahr 1909; der Betraum ist
untergliedert in Männer- und Frauenbereich
(Quelle: Scherg S. 34) |
Das Anwesen in der
Glasergasse 5, das bis in die 1930er-Jahre
der jüdischen Familie Adler
gehörte und in dem sich der
Betsaal der Gemeinde befand. Unklar ist, wann der Betsaal vom Haus am Mainkai
in das Wohnhaus der Familie Adler verlegt wurde. |
Text der Hinweistafel:
"In diesem Haus befand
sich in der Zeit der Weimarer Republik der
Gebetssaal der Jüdischen Gemeinde"
|
| |
|
|
|
Zur Geschichte der Beträume der jüdischen Gemeinde: Nachdem 1910
eine eigene Gemeinde gegründet werden konnte, war zunächst in einem Haus
am Mainkai, später und bis zur Auflösung der jüdischen Gemeinde und der
Deportation ihrer letzten Mitglieder 1942 im Anwesen der Familie Adler in
der Glasergasse 5 ein Betsaal eingerichtet. 1934 wurde das Gebäude
mit antisemitischen Parolen beschmiert.
Das Gebäude mit dem früheren Betsaal ist bis heute erhalten. Es wird als
Wohnhaus genutzt.
|
| |
|
|
| |
|
|
| Familie
Blumenthal |
Isaak Blumenthal
stammte aus Kirchbracht
in Hessen und war seit 1875 verheiratet mit Sarah geb. Thalmann aus Neubrunn.
In diesem Jahr war das Ehepaar nach Marktheidenfeld gezogen und eröffnete hier
eine Manufakturwarenhandlung. Isaak Blumenthal war Kriegsteilnehmer von 1870/71,
erhielt 1898 die Gedenkmedaille für Kaiser Wilhelm I. und war Gründungsmitglied
des Kriegervereins Marktheidenfeld (1874), ab 1881 in der Vorstandschaft,
Mitglied der Festausschusses für die Jubiläumsfeier des Kriegervereins 1899
(25 Jahre). 1920 wurde Blumenthal Ehrenmitglied des Kriegervereins, erhielt 1924
das Ehrenzeichen für 50-jährige Mitgliedschaft. Isaak Blumenthal betrieb
verschiedene Handelsgeschäfte, wohnte vorübergehend auch im benachbarten
Erlenbach und verlieh Geld. Unter anderem hatte sich die Feuerwehr bei ihm
verschuldet (1906)
1909 verzog die Familie Blumenthal nach Lohr, wo
sie im Jahr zuvor eine Gemischtwarenhandlung eröffnet hatte. Wenige Jahre
später zog die Familie nach Frankfurt. Dort lebte offenbar inzwischen der Sohn Simon
Blumenthal (geb. 3. Juli 1887 in Marktheidenfeld), der 1907 kurzzeitig das
Geschäft in Marktheidenfeld geführt hatte. Er war im Januar 1939 noch in
Frankfurt ansässig. Über Simon Blumenthals weitere Geschichte ist nichts
bekannt (möglicherweise emigriert; nach SSDI ist in Los Angeles ein am 3. Juli
1885 geborener Simon Blumenthal gestorben).
Der Neubrunner Händler Gustav Levy erwarb 1906 die Schnittwaren- und
Zigarrenhandlung der Blumenthals und betrieb sie weiter (zur Familie Gustav Levy
siehe Weiteres unten). |
| |
|
|
Anzeigen der
Manufakturwarenhandlung
von Isaak Blumenthal (1886)
(erhalten von Martin Harth
Quelle: Stadtarchiv Marktheidenfeld,
Sammlung Eschenbacher) |
 |
 |
| |
Anzeige aus dem
"Marktheidenfelder Boten"
vom Oktober 1886 |
Annonce zur
Geschäftseröffnung in der Obertorstraße aus
dem "Marktheidenfelder Boten" vom November 1886 |
| |
|
|
Auszeichnung
von Isaak Blumenthal für
25-jährige Dienstzeit
bei der Feuerwehr (1901)
Anmerkung: Isaak
Blumenthal war seit 1876
Mitglied
der Freiwilligen Feuerwehr in Marktheidenfeld |
 Meldung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Januar 1901: "Sonderhofen.
Die Herren J. Blumenthal (für Blumenfeld) in Marktheidenfeld am Main
und Herr Simon Oppenheimer in Aub erhielten das königliche Ehrenzeichen
für 25jährige Dienstzeit bei der freiwilligen Feuerwehr." Meldung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Januar 1901: "Sonderhofen.
Die Herren J. Blumenthal (für Blumenfeld) in Marktheidenfeld am Main
und Herr Simon Oppenheimer in Aub erhielten das königliche Ehrenzeichen
für 25jährige Dienstzeit bei der freiwilligen Feuerwehr." |
| |
|
|
Kennkarte für
Fanny Simon
geb. Blumenthal |
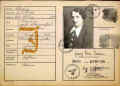 |
|
Fanny Simon geb. Blumenthal
war eine
Tochter von Isaak Blumenthal und seiner Frau Sarah geb. Thalmann
(siehe oben). Das Geburtsdatum von Fanny war nach obigem Ausweis 1.
November 1882, in anderen Unterlagen finden sich auch als Geburtsdaten 1. November
1885 oder 1. November 1887. Fanny Simon wohnte später in Mainz, von wo sie am 25. März 1942 über
Darmstadt in das Ghetto Piaski deportiert wurde. Sie ist umgekommen.
Gleichfalls umgekommen ist die ältere Schwester Lina Katz geb.
Blumenthal, geb. 10. September 1876 in Marktheidenfeld, die später in
Fürth wohnhaft war. Sie wurde am 10. September 1942 ab Nürnberg in das
Ghetto Theresienstadt deportiert, von hier aus am 29. September 1942 in
das Vernichtungslager Treblinka.
Anmerkung: Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt. Nach der
Namensänderungsverordnung vom 17. August 1938 mussten zusätzlich die
Zwangsvornamen "Sara" oder "Israel" angenommen werden.
Quelle der Kennkarte: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de . |
| |
|
|
| |
|
|
|
Familie
Abraham Freimark |
|
|
1887 eröffnete der am 7. September 1846 in
Homburg am Main geborene Abraham Freimark eine Schlachterei in der Marktheidenfelder Herrngasse. Im Juni 1837 hatte er
Sophia geb. Fleischmann (geb. 17. Oktober 1857 in Reckendorf) geheiratet. Dieser Ehe entstammte die ledige Damenschneiderin
Regina Freimark, die später zeitweise in der Petzoltstraße arbeitete und mehrmals ihren Wohnsitz nach Düsseldorf und Frankfurt verlegte. Am 25. April 1942 wurde sie aus Marktheidenfeld über Würzburg nach Krasnystaw deportiert wurde und kam ums Leben.
Nachdem Abraham Freimarks erste Frau am 10. November 1883 gestorben war, heiratete der Metzger und Viehhändler im Herbst 1887 Jetta
geb. Freund (geb. 1858 in Kleinwallstadt).
Aus dieser zweiten Ehe stammt der später in Düsseldorf lebende Sohn Emanuel
Freimark (geb. 18. März 1888 in Marktheidenfeld), der im Februar 1915 im Ersten Weltkrieg als Soldat schwer verwundet worden war.
Beruflich war er als Schreiner tätig; er wurde 1942 im Vernichtungslager Kulmhof (Chelmno) ermordet.
Emanuels Ehefrau Henriette geb. Spier (geb. 9. Januar 1891 in Sontra) und Sohn
Alfred Ludwig Freimark (geb. 28. Juli 1923 in Düsseldorf) wurden 1942 im Getto Litzmannstadt/Lodz ermordet.
Der zweite Sohn Bernhard Freimark (geb. 11. April 1889 in Marktheidenfeld) war Eigentümer des Anwesens Karbacher Straße 341/Hindenburgstraße (heute Petzoltstraße), das 1938 ein Schauplatz des Novemberpogroms war und kurz darauf veräußert werden musste. Er lebte ab 1919/20 ebenso in Düsseldorf und wanderte (1940?) vermutlich in die USA aus.
Die Tochter Karoline genannt Lina Freimark (geb. 17. Juni 1892 in Marktheidenfeld) war Damenschneiderin oder Modistin. Sie lebte später verheiratet mit dem Namen
Lina Wahler in Frankfurt und wurde über Theresienstadt (16. September 1942) nach Auschwitz deportiert (23. Januar 1943) und dort ermordet. Ihr Ehemann
Siegmund Wahler (geb. 8. März 1871) starb bereits am 10. Dezember 1942 in
Theresienstadt. |
| |
 |
 |
 |
Im Oktober 1887
kündigte der Homburger Metzger
und Viehhändler Abraham Freimark die Eröffnung
einer Schlachterei in Marktheidenfeld an
(Quelle: Marktheidenfelder Bote, Oktober 1887) |
Genehmigungsplan
aus dem Jahr 1887 von
Johann Adam Ries für das Schlachthaus von
Abraham Freimarkt in der Herrngasse
(Quelle: Staatsarchiv Würzburg LRA Mar 1664) |
Bild
"Straße mit Pferdefuhrwerk und Omnibus" von Alfred
Ludwig Freimark aus dem Kunstunterricht des 1943 in Auschwitz
ermordeten expressionistischen Malers Julo Levin an der
Privaten Jüdischen Volksschule in Düsseldorf (Quelle) |
| |
|
|
| |
 |
|
| |
Tanzkurs
im Jahre 1910, oben links: Lina Freimark
(Quelle. Stadtarchiv Marktheidenfeld, Sammlung Eschenbacher) |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Familie Adolf
Freimark |
|
|
 |
 |

 |
|
Schuhhändler
Adolf Freimark (geb. 8. September 1877 in Homburg
am Main) war seit 1903 verheiratet mit Babette geb. Hüchberger (geb. 10. November 1872 in Großlangheim
als Tochter von Abraham Hüchberger und Lena geb. Wolfheimer).
Adolf Freimark erwarb in der Marktheidenfelder Obertorstraße 1 ein Anwesen
und betrieb
dort einen Schuhladen (oben Gemälde des Hauses von Willy Armstark). Adolf
Freimark war in zahlreichen Vereinen in Marktheidenfeld aktiv, unter
anderem im Fußballclub Bavaria Marktheidenfeld, im Turnverein 1884
Marktheidenfeld (TVM), im Kleinkaliber-Schützenverein (KKS)
Marktheidenfeld.
Das Ehepaar Freimark emigrierte 1934 mit den Kindern Recha (geb. 19. Mai
1906, verh. Eichenbronner) und Justin (geb. 6. März 1911, gest. 15. April 2002
NY) nach New York in die USA. Hier waren bereits
die Kinder Arthur (geb. 8. September 1904, gest. Juli 1986 NY) und Leo (geb. 21. Juli 1907, gest. 26. Februar
1996 NY). Oben rechts: Anzeige im Adressbuch 1929 und Briefkopf von 1934.
Vgl. Artikel von Michael Deubert in der "Main-Post" vom 6. November
2019: "Trotz bester Integration: Wie Adolf Freimark 1934 aus
Marktheidenfeld floh. Die Familie des Schuhhändlers jüdischen
Glaubens konnte 1934 noch nach New York auswandern und entkam so der
Vernichtung durch die Nazis..."
Link zum Artikel |
| |
|
|
 |
 |
 |
Die Geschwister Arthur,
Recha, Leo und Justin Freimark
(von links; Foto etwa am Ende des Ersten Weltkrieges)
(Quelle: Stadtarchiv Marktheidenfeld, Sammlung Eschenbacher) |
Im
März 1930 bildete der Turnverein Marktheidenfeld 1884 drei
Arbeitskolonnen, um einen neuen Sportplatz einzuebnen. An der
Spitze der Kolonne I stand der spätere NSDAP-Kreisleiter Max Sorg.
Sein Stellvertreter war der jüdische Kaufmann Adolf Freimark
(Quelle: Archiv TV Marktheidenfeld) |
Foto
des Fußballclubs "Bavaria Marktheidenfeld" (etwa 1924),
hintere Reihe links außen: Justin Freimark,
zweite Reihe Mitte: dessen Cousin Siegbert Freimark.
(Quelle: Stadtarchiv Marktheidenfeld, Sammlung Eschenbacher)
|
| |
| |
|
|
 |

 |
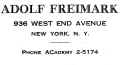 |
Schützenscheibe, die Adolf
Freimarkt 1931
dem Kleinkaliberschützenverein Marktheidenfeld schenkte |
Schuhlöffel aus dem
Laden
von Adolf Freimark |
Briefkopf aus dem Jahr
1935
nach der Emigration in die USA |
| |
|
|
| |
|
|
|
Familie Salomon Freimark |
|
|
Salomon Freimark (geb. 5. April 1873 in Homburg
am Main, gest. 1911) war verheiratet mit Hermine geb. Adler aus Urspringen
(Tochter des dortigen Viehhändlers Isaak Joseph Leser Adler; 1851-1923).
Salomon Freimarkt eröffnete 1901 in der Oberen Gasse in Marktheidenfeld
eine Schmiede. Das Ehepaar hatte vier zwischen 1900 und 1906 geborene Söhne Leopold, Ludwig, Friedrich,
Siegbert:
hierzu ein Artikel in der "Main-Post": "Die
leidvolle Geschichte der Familie Freimark".
Weiterer Artikel in der "Main-Post" vom 31. August 2017: "Das
jähe Ende der Schmiede Freimark"
Hermine Freimark wanderte im März 1938 zur
Familie ihres Sohnes Friedrich nach Geleen in den Niederladen aus. Von
dort wurde sie über das Lager
Westerbork ins Vernichtungslager Sobibor deportiert und 1943 ermordet. |
| |
|
|
 |
 |

 |
|
Salomon
Freimark und seine Frau Hermine geb. Adler
(Quelle: Stadtarchiv Marktheidenfeld, Sammlung Eschenbacher)
|
Das Ladenschild
aus Eisenblech von Salomon Freimarks
Schmiede ist verändert erhalten geblieben |
| |
|
 |
 |

 |
Grabstein im jüdischen
Friedhof Karbach für den 1911
gestorbenen Salomon Freimark
(in der Reihe links erster Stein); auf der Rückseite
steht eine Gedenkinschrift für Hermine Freimark.
|
Friedrich Freimark (geb. 27.10.1902) betrieb nach seiner
Emigration im niederländischen Geleen eine Wäscherei. Mit seiner
Frau Gertrud geb. May (geb. 1902 in Niedermendig)
und den
beiden Söhnen Ernst (1936) und Kurt (1939) kam er 1942 in
das Lager
Westerbork, später nach Auschwitz, wo die Familie ermordet
wurde.
(Quelle: Yad Vashem, Jerusalem) |
Blick
in die Obere Gasse im Jahr 1926:
die Witwe Hermine Freimark wirbt mit einem
Auslegerschild für ihr "Kurz-, Weiss-, Wollwaren-Geschäft"
(Quelle: Historischer Verein Marktheidenfeld)
|
| |
|
|
 Über
den Rabbiner Ludwig Freimark (links als Student um 1920;
nachfolgende Sätze von Martin Harth): Ludwig Freimark wurde am 27. März 1901 als zweiter von vier Söhnen des Schmieds Salomon Freimark und seiner Frau
Hermine geb. Adler, in Marktheidenfeld geboren. Im Jahr 1914 feierte Ludwig Freimark seine Bar Mitzwa in der Synagoge in
Urspringen. Nach seinem Examen an der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in Würzburg im Jahr 1920 wurde er Lehrer und war vor seiner Emigration in die USA in der NS-Zeit zuletzt in Mainz tätig. 1925 heiratete er Klara Mayerfeld. Nach der Emigration siedelte sich Ludwig Freimark in Vineland, New Jersey, an. Dort war er als Schächter, Kantor und Rabbiner tätig. In seinem Wohnhaus befand sich eine Synagoge, die seinen heute
(sc. 2015) in New York lebenden Neffen Steven Freimark stark an die Synagoge von
Urspringen erinnerte. Steven Freimark pflegt seit Jahren den Kontakt in die frühere Heimat seiner Familie. Ihm verdankt der Förderkreis Synagoge Urspringen einen regen Austausch von Zeugnissen aus der Familiengeschichte. Ludwig Freimark verbrachte seinen Lebensabend in New York City. 1985 starb der streng orthodoxe Rabbiner in
Brooklyn. Über
den Rabbiner Ludwig Freimark (links als Student um 1920;
nachfolgende Sätze von Martin Harth): Ludwig Freimark wurde am 27. März 1901 als zweiter von vier Söhnen des Schmieds Salomon Freimark und seiner Frau
Hermine geb. Adler, in Marktheidenfeld geboren. Im Jahr 1914 feierte Ludwig Freimark seine Bar Mitzwa in der Synagoge in
Urspringen. Nach seinem Examen an der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in Würzburg im Jahr 1920 wurde er Lehrer und war vor seiner Emigration in die USA in der NS-Zeit zuletzt in Mainz tätig. 1925 heiratete er Klara Mayerfeld. Nach der Emigration siedelte sich Ludwig Freimark in Vineland, New Jersey, an. Dort war er als Schächter, Kantor und Rabbiner tätig. In seinem Wohnhaus befand sich eine Synagoge, die seinen heute
(sc. 2015) in New York lebenden Neffen Steven Freimark stark an die Synagoge von
Urspringen erinnerte. Steven Freimark pflegt seit Jahren den Kontakt in die frühere Heimat seiner Familie. Ihm verdankt der Förderkreis Synagoge Urspringen einen regen Austausch von Zeugnissen aus der Familiengeschichte. Ludwig Freimark verbrachte seinen Lebensabend in New York City. 1985 starb der streng orthodoxe Rabbiner in
Brooklyn.
Vgl. Artikel im "Main-Echo": "Sie
leben noch in meiner Erinnerung". Pogromnacht: Ein amerikanischer
Rabbiner blickt auf das jüdische Urspringen vor 1938 zurück..."
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Familie Heimann |
|
|
| Albert
Heimann (geb. 16.
November 1880 in
Homburg am Main) war seit 1908 verheiratet mit Helene Heimann geb.
Löwenstein geb. 11. Mai 1886 in Laudenbach
bei Weikersheim als Tochter von Lippmann Löwenstein und Anna geb. Löwenstein)
6. Er war Inhaber einer Eisenhandlung am Marktheidenfelder Marktplatz 6. Das
Geschäft war ein Schauplatz des Novemberpogroms 1938 in der Stadt. Albert
Heimann wurde festgenommen und bis zum 19. November 1938 im
Gerichtsgefängnis von Lohr in "Schutzhaft" festgehalten. 1939
verzog das Ehepaar mit Tochter Ruth (geb. 15. Juni 1916 in Würzburg) nach Frankfurt. Albert und Helene Heimann wurden
1942 von
Frankfurt aus deportiert und sind umgekommen. |
 |
 |
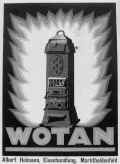 |
|
Albert Heimann und seine Frau
Helene geb. Löwenstein
(Quelle der Fotos: Staatsarchiv Würzburg, LRA Mar 4310)
|
Werbepostkarte der
Eisenhandlung Heimann
für einen Wotan Gußofen |
| |
|
|
 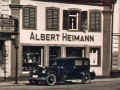 |
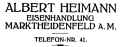
 |
 |
Das Geschäft
von Albert Heimann - zentral am
Marktheidenfelder Marktplatz (Quelle: Stadtarchiv
Marktheidenfeld, Sammlung Historischer Verein)
|
Briefkopf
der Eisenhandlung Albert Heimann,
daneben Messer aus der Eisenhandlung
(Quelle: Sammlung Martin Harth)
|
Montage
einer Postkarte: Diese Karte schrieb Helene Heimann
Ende 1941 aus
Frankfurt an eine Bekannte in Marktheidenfeld.
Sie klagt darüber, dass
sie von der kurz zuvor in die USA
emigrierten Tochter Ruth keine
Nachricht habe |
| |
|
|
| |
|
|
|
Familie Levy |
|
|
|
Der Neubrunner Händler
Gustav Levy (1854-1937, beigesetzt im Friedhof in
Karbach) erwarb 1909 die Schnittwaren- und Zigarrenhandlung der Blumenthals in
Marktheidenfeld (siehe oben). Der Witwer war im gleichen Jahr Gründungsmitglied der jüdischen Gemeinde. Sohn
Simon Levy (geb. 29. April 1882 in Neubrunn) fiel als Soldat im Ersten Weltkrieg am
5. Januar
1917 bei Langemark/Belgien. Sein Grab ist in der Kriegsgräberstätte in
Langemark/Belgien (Block B Grab 17681).
Gustav Levys Sohn Leopold Levy (geb. 29. April 1882 in Neubrunn) führte mit seiner Schwester
Regina Levy (geb. 26. 5. 1884 in Neubrunn) nach dem Tod des Vaters das Geschäft bis zum Novemberpogrom 1938 weiter.
Bereits am 1. Oktober 1938 waren am Anwesen Levy nachts Scheiben eingeworfen worden. Beim Novemberpogrom wurde der Laden nach Zeugenaussagen zerstört und geplündert. Regina Levy wurde durch einen Steinwurf am Kopf verletzt. Leopold Levy wurde verhaftet und bis zum 2. Dezember 1938 im Gerichtsgefängnis Lohr in
"Schutzhaft" festgehalten. 1939 musste das Geschwisterpaar Levy seinen Besitz verkaufen und wohnten ein Jahr später im Anwesen von Bernhard Freimark in der Untertorstraße. Ein Spaziergang des Geschwisterpaars Levy an einem Sabbat bot im November 1940 Anlass für den Landrat, ein allgemeines Ausgehverbot für die Juden in Marktheidenfeld zu erlassen, das von der GeStaPo in Würzburg später als widerrechtlich bezeichnet und aufgehoben wurde.
Vergeblich versuchten Leopold und Regina vor ihrer Deportation am 25. April 1942 in die USA
auszuwandern. Beide
wurden am 25. April 1942 ab Würzburg nach Krasnystaw deportiert und sind
umgekommen. |
| |
|
|
 |
 |
|
| Leopold
Levy und Regina Levy (Bildquelle: Staatsarchiv Würzburg LRA Mar 4310). |
|
| |
|
|
Das Mahnmal
für die "Opfer von Krieg und Gewalt"
(Fotos von 2005: Martin Harth) |
|
|
 |
 |
 |
Das
Mahnmal für die "Opfer von Krieg und Gewalt" befindet sich
jenseits der Brücke auf der Anhöhe der der Stadt gegenüberliegenden
Mainseite oberhalb des König-Ludwig-Denkmals.
2005 war es zu einem Anschlag auf das Denkmal gekommen. Auf dem Foto in
der Mitte ist auf der rechten Gedenktafel noch der Schatten eines
Hakenkreuzes zu erkennen. |
| |
|
|
 |
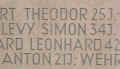 |
 |
| Auf
der Tafel für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges steht auch der Namen
von Simon Levy (Fotos links und Mitte). Auf der Tafel rechts steht:
"Verfolgt aus rassischen Gründen verloren ihr Leben: Adler William
geb. 12.8.1888, Adler Regina geb. Freimark geb. 29.12.1887. Freimark
Bernhard geb. 7.3.1990. Freimark Getta geb. Bierich geb. 14.5.1879.
Freimark Regina geb. 15.11.1879. Guttmann Samuel geb. 4.4.1889. Guttmann
Rosa geb. Löwenstein geb. 10.11.1888. Levy Leopold geb. 18.5.1881. Levy
Regina geb. 26.5.1884. Freimark Hermine geb. 12.12.1876. Heimann Albert
geb. 16.11.1880. Heimann Helene geb. 11.5.1886. Als Soldat der US-Army
i.J. 1944 Bertold Adler 23.J." |
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| Oktober 2009:
Vortrag in Marktheidenfeld über Judenwege und
andere Flurnamen |
 Artikel
von Martin Harth im "Lohrer Echo" vom 14. Oktober 2009 Artikel
von Martin Harth im "Lohrer Echo" vom 14. Oktober 2009
(Artikel wurde von Fred G. Rausch zur Verfügung gestellt):
"Auf den Spuren der 'Judenwege'. Kulturwissenschaft:
Barbara Rösch erklärte Flurnamen.
Marktheidenfeld. Die Berliner Kulturwissenschaftlerin Barbara Rösch
befasste sich am Mittwochabend in der Marktheidenfelder Volkshochschule
mit den so genannten Judenwegen und erläuterte ihren spezifischen
Forschungsansatz zur deutsch-jüdischen
Alltagsgeschichte.
Die Autorin der wissenschaftlichen Arbeit 'Der Judenweg' erforschte
Wegebezeichnungen außerhalb geschlossener Ortschaften und verwandte
Flurnamen wie Judenstein, -baum, -brunnen, -pfad, -steig, -acker und
ähnliches. Von Interesse sei dabei, wie solche Toponyme zustande kämen
und sich mündlich oder schriftlich überlieferten. Mit den Begriffen gehe
oft neben der reinen Sachinformation auch ein Werturteil einher. Früheste
Belege fänden sich im 15. und 16. Jahrhundert.
Schwerpunkt um Marktheidenfeld. Ein Schwerpunkt ihrer auf den gesamten
deutschsprachigen Raum ausgeweiteten Arbeit sei der 'Waldsassengau' sagte
Rösch und meint mit diesem etwas altertümlichen Begriff die Region um
Marktheidenfeld zwischen Gemünden/Karlstadt und Wertheim. Die Forscherin
konnte auf eine in der Qualität höchst unterschiedliche
Flurnamensammlung aus dem ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts in
Bayern zurückgreifen. Weitere Belege lieferten historische Katasterpläne
für Grundsteuern oder Hypotheken. Im bereich um Marktheidenfeld ließen
sich 132 Einzelbelege für etwa 20 Wegstrecken finden, 16 Judenpfade,
fünf Judenwege, drei Judenstraßen und drei Judengassen. Oft liefen diese
parallel zu wichtigen Handelswegen durch die früher
gemischtherrschaftliche Region..."
Zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken. |
| |
| Mai 2011: Marktheidenfeld
beteiligt sich am Gedenkmarsch in Würzburg |
Artikel von Martin Harth in der
"Main-Post" vom 26. April 2011 (Artikel):
"URSPRINGEN. Gedenkmarsch auf dem Weg der Opfer
Förderkreis und Main-Spessart-Gemeinden unterstützen Aktion – Schilder erinnern an Deportierte
(maha) Am 10. Mai soll in Würzburg unter dem Titel 'Wir wollen uns
erinnern' ein Gedenkmarsch auf dem Weg der größten Deportation von Juden aus Unterfranken am 25. April 1942 von der ehemaligen Gaststätte
'Platz'scher Garten' am Friedrich-Ebert-Ring zum früheren Güterbahnhof Aumühle stattfinden.
Dabei soll auch der großen Anzahl von Opfern der nationalsozialistischen Rassenideologie aus dem heutigen Landkreis Main-Spessart gedacht werden. Der Förderkreis Synagoge Urspringen unterstützt diese Gedenkveranstaltung, wie dies der Vorsitzende Leonhard Scherg bei der Hauptversammlung des Vereins deutlich machte.
Für die Aktion 'Wir wollen uns erinnern' wurden die Daten der Deportationsopfer vom 25. April 1942 aus einigen jüdischen Gemeinden überprüft und zusammengestellt. Über den Stand der Vorbereitungen für den Gedenkmarsch
'Wir wollen uns erinnern' am 10. Mai in Würzburg wurde bei der Hauptversammlung berichtet.
So haben sich die Stadt Marktheidenfeld und die Gemeinde Karbach bereits um Teilnehmer bemüht, welche die Namenstafeln der neun, beziehungsweise 27 Opfer aus den Gemeinden beim Gedenkmarsch tragen werden. Auch Triefenstein wird sicher mit fünf Vertretern für die Opfer aus Homburg dabei sein.
Für Urspringen will Bürgermeister Heinz Nätscher Verbindung mit den Schulen in
Marktheidenfeld aufnehmen, um Vertreter für die 42 Opfer aus seiner Gemeinde nach Würzburg schicken zu können. Georg Schnabel berichtete über den Stand der Vorbereitungen in Laudenbach.
Bürgermeister Kurt Kneipp aus Karbach will sich um zwei Busse bemühen, die für Vertreter aus dem ehemaligen Landkreis Marktheidenfeld eingesetzt werden, um die Aktion, die von 14 bis etwa 19 Uhr dauern könnte, gemeinsam abzuwickeln.
Josef Laudenbacher (Karbach) holt die Namensschilder für die vier Gemeinden vorher in Würzburg ab und verteilt sie in den Bussen. Bemerkenswert ist, dass im Fall von Karbach auch Nachkommen jüdischer Opfer zu dem Gedenkmarsch aus Israel nach Deutschland kommen wollen." |
| |
|
März 2016:
Vortrag über "Judenwege" in der
Region |
Artikel von Martin Harth in der "Main-Post"
vom 3. März 2016: "MARKTHEIDENFELD. Den Judenwegen nachspüren.
Im Jahr 2009 rief die Potsdamer Historikerin Barbara Rösch mit ihrem Buch
'Der Judenweg' eine kulturhistorische Besonderheit in Erinnerung, die in
unserer Region lange in Vergessenheit geraten war. Auf Einladung des
Förderkreises Synagoge Urspringen stellte die Forscherin noch im gleichen
Jahr ihre Erkenntnisse bei einem Vortrag an der Volkshochschule (vhs) in
Marktheidenfeld vor. Am Montagabend wurden die Judenwege erneut zum Inhalt
eines Vortrags an gleicher Stelle, zu dem der Vorsitzende der vhs sowie des
Förderkreises, Leonhard Scherg, knapp 20 interessierte Zuhörer begrüßen
konnte. Der Karlstadter Alfred Dill ist als ausgebildeter Landschafts- und
Naturführer beim Naturpark Spessart engagiert und sucht für seine
Wanderungen neben Fauna, Flora und Geologie auch kulturhistorische
Besonderheiten, die er seinen Gästen vermitteln kann. Er wurde auf die
jüdische Vergangenheit in der Region aufmerksam und versuchte bald schon,
die von Barbara Rösch aufgezeigten Wege in der Natur aufzuspüren. Teilweise
kann er heute solche Routen für Wanderfreunde anbieten und dabei auf Relikte
der Kultur der einstigen jüdischen Minderheit hinweisen. Dill legte zunächst
die bekannten Fakten dar. Sogenannte Judenwege waren ein Zeichen der
eingeschränkten Mobilität und Diskriminierung. Es gab bedeutsame und
beschwerliche Wege von den Kultusgemeinden zu Friedhöfen, zum Beispiel zum
großen jüdischen Distriktsfriedhof nach Laudenbach. Es gab Wege, die
einzelne Juden und Angehörige kleiner Gemeinden an Sabbat zum Gottesdienst
in einer Nachbargemeinde bewältigen konnten, da nicht überall ein Minjan aus
zehn religionsmündigen Männern zur Verrichtung der Gebete gebildet werden
konnte. Es gab Wege, die es Juden erlaubten, am Sabbat bis an die Grenzen
des Sabbatbezirks zu spazieren. Eine große Rolle spielten die Handelswege,
so die Wege für den Viehtrieb und die jüdischen Händler. Wege führten
beispielsweise nach Karlstadt, wo jüdische Viehhändler lange Zeit das
Geschehen auf dem großen Viehmarkt prägten. Besondere Wege waren für die
Hausierhändler, die von Dorf zu Dorf zogen, wesentlich, bis hin zu den so
genannten 'Betteljuden', die aus ihrer polnischen Heimat kommend saisonal
ihr Glück bis ins Fränkische suchten.
Verbindungen im Verborgenen. Dabei nutzten die Juden meist keine
neuen Wege, oft aber Verbindungen, die abseits der großen Straßen etwas im
Verborgenen liefen. Sie waren gezwungen, verbotene Territorien wie das des
Hochstifts Würzburg zu umgehen. Oft verliefen solche Wege entlang der
Grenzen der in Franken stark zersplitterten Territorien. Die jeweiligen
Landesherren belegten die durchreisenden Juden mit eigenen Abgaben und ein
Sprung über eine Grenze konnte vor den Ansprüchen der jeweiligen
Wegezoll-Eintreiber bewahren. Die Judenwege verloren mit zunehmender
rechtlicher Gleichstellung der Minderheit und der Entwicklung moderner
Verkehrsmittel an Bedeutung und gerieten durch die nationalsozialistische
Vernichtungspolitik weitestgehend in Vergessenheit. Die Flurbereinigung
setzte vielen Wegebeziehungen seit den 1970er Jahren ein Ende, da die
Neuordnung landwirtschaftlicher Flächen auf kulturhistorische Zusammenhänge
kaum Rücksicht nahm. Mit Fotografien und Kartenausschnitten zeigte Alfred
Dill den Verlauf von Judenwegen auf. Etwa von
Wiesenfeld über Steinfeld nach
Laudenbach oder von Steinfeld und
Urspringen nach
Karbach. Von
Urspringen führte eine Route über
Stadelhofen nach Karlstadt oder von
Thüngen und
Arnstein über
Himmelstadt nach
Laudenbach. Zwischen
Lohr und
Marktheidenfeld gab es eine
Wegebeziehung, die auch von den Leinreitern als Abkürzung für den Rückritt
auf den Pferden mainabwärts genutzt wurde.
Erinnerungen am Wegesrand. Manches erinnert heute am Wegesrand an die
jüdische Kultur, so die Friedhöfe in Karbach
und Laudenbach an etwas entlegenen
Orten. Man kann die Ritualbäder (Mikwen) einiger Kultusgemeinden entdecken
sowie deren Synagogen und Betsäle. In Karbach
wurde die Synagoge zum Rathaus, in
Urspringen zur Gedenkstätte und zum Museum. In
Wiesenfeld wurde ein kleines
dörfliches Kulturzentrum im einstigen Gotteshaus gestaltet. Lediglich in
Laudenbach ist die frühere
Synagoge noch in einem ruinösen Zustand und wartet auf eine baldige
Sanierung."
Link zum Artikel |
| |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 358-359. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 87. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 515. |
 |  Leonhard
Scherg/Martin Harth: Juden im Landkreis Marktheidenfeld. Hrsg.
Historischer Verein Marktheidenfeld und Umgebung e.V. Nr. 13. 1993. Leonhard
Scherg/Martin Harth: Juden im Landkreis Marktheidenfeld. Hrsg.
Historischer Verein Marktheidenfeld und Umgebung e.V. Nr. 13. 1993. |
 |  Leonhard Scherg: Jüdisches
Leben im Main-Spessart-Kreis. Reihe: Orte, Schauplätze, Spuren. Verlag
Medien und Dialog. Haigerloch 2000 (mit weiterer Literatur). S. 34. Leonhard Scherg: Jüdisches
Leben im Main-Spessart-Kreis. Reihe: Orte, Schauplätze, Spuren. Verlag
Medien und Dialog. Haigerloch 2000 (mit weiterer Literatur). S. 34. |
 |  "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Teilband
III: Unterfranken, Teil 1.
Erarbeitet von Axel Töllner, Cornelia Berger-Dittscheid,
Hans-Christof Haas und Hans Schlumberger. Hg.
von Wolfgang Kraus, Hans-Christoph Dittscheid und Gury Schneider-Ludorff
in Verbindung mit Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern. 1. Auflage 2015. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im
Allgäu (mit umfassenden Quellen- und
Literaturangaben) "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Teilband
III: Unterfranken, Teil 1.
Erarbeitet von Axel Töllner, Cornelia Berger-Dittscheid,
Hans-Christof Haas und Hans Schlumberger. Hg.
von Wolfgang Kraus, Hans-Christoph Dittscheid und Gury Schneider-Ludorff
in Verbindung mit Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern. 1. Auflage 2015. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im
Allgäu (mit umfassenden Quellen- und
Literaturangaben)
ISBN 978-3-89870-449-6.
Hinweis: die Forschungsergebnisse dieser Publikation wurden in dieser Seite
von "Alemannia Judaica" noch nicht eingearbeitet.
Abschnitt zu Marktheidenfeld S. 272-276.
|
n.e.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|