|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"
Wiesenfeld (Stadt
Karlstadt, Main-Spessart-Kreis)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Wiesenfeld bestand eine
jüdische Gemeinde bis 1938/42. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17.
Jahrhunderts zurück. Erstmals werden Juden am Ort 1630 genannt. 1655
waren es vier jüdische Einwohner
(beziehungsweise vier jüdische Familien), 1699 bereits
14. Die jüdischen Familien standen unter adligem Schutz, insbesondere der Voite
von Rieneck und der Freiherren Hutten von Steinbach.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1813 107 jüdische Einwohner (in 22 Familien, 13,9 % der Gesamteinwohnerschaft), 1816
111 (14,9 % von insgesamt 747 Einwohnern), 1837 160 (15,7 % von 1.017), 1867
119 (in 26 Familien, 10,7 % von 1.107), 1871 104 (9,4 % von 1.108). 1880 94 (8,1 % von 1.154),
1900 66 (6,0 % von 1.092).
Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 wurden die folgenden 25
Matrikelplätze nachstehender jüdischer Familienvorstände für Wiesenfeld
festgehalten (mit neuem Familiennamen und Erwerbszweig): Maier Salomon
Rosenberger (Viehhandel), Moses Abraham Hanauer (Viehhandel), Abraham Moses
Hanauer (Viehhandel und Ellenwaren), Samuel Loew Schloß (Spezereihandel und
Ellenwaren), Abraham Jos Bamberger (Handel mit Viel, Spezerei, Ellen), Joß
Abraham Bamberger (Viehhandel, Schlachten), Jacob Abraham Gutmann (Viehhandel,
Schlachten), Nosen Jacob Löwenthal (Handel mit Vieh und Ellen), Hajum Abraham
Heilmann (Schächten, Viehmakeln), Löw Salomon Steigerwald (Viehhandel), Oscher
Kallmann Frank (Viehhandel und Makeln), Kallmann Kaufmann Frank (ohne
Erwerbszweig, vom Sohn Oscher ernährt), Abraham Hirsch Grünebaum (Warenhandel
mit Kram), Moses Salomon Brenner (Lumpenhandel), Seligmann Süß Stern
(Viehhandel), Wolf Seligmann Stern (Viehhandel), Abraham Loeser Leisinger (ohne
Erwerb), Meier Loew Leisinger (Viehhandel), Isaac Meyer Hecht (Viehhandel und
Botengehen), Marx Alexander Baum (Viehhandel), Moses Alexander Grünewald
(Viehhandel), Breune, Witwe von Samuel Abraham Linjenthal (Handel mit Ellenwaren
und Tüchern), Jacob Süß Löwenthal (ohne Erwerb), Santilla, Witwe von Gotz Jöß
Braunold (Handel mit Ellen und Töchter), Num Jacob Haas (ohne Erwerbszweig).
Sechs der 25 Matrikelstellen sind in den Jahren nach 1817 durch Tod der Inhaber
erloschen.
1820 lebten drei der jüdischen Familien in eigenen, auf gutsherrlichem
Grund erbauten Häusern. 22 Familien lebten damals in Wohnungen, die im Besitz
der Gutsherrschaft waren. Die jüdischen Familien lebten bis Mitte des 19.
Jahrhunderts überwiegend vom Handel mit Waren und Vieh. Danach kamen einige
Handwerker und für das wirtschaftliche Leben am Ort wichtige
Gewerbebetriebe/Handlungen am Ort dazu. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
verzogen mehrere Familien nach Karlstadt, Würzburg
und in andere Städte. Andere Familien wanderten nach Nordamerika aus.
An Einrichtungen hatte die Gemeinde eine Synagoge (s.u.), ein Schulhaus
mit einer Lehrerwohnung sowie ein rituelles Bad. Das jüdische Schulhaus
wurde neben der Synagoge 1841 erbaut. Es wurde 1881 renoviert und noch 1913
erweitert. Neben dem jüdischen Schulhaus befand sich das 1828 erbaute rituelle
Bad. Die Toten der Gemeinde wurden auf dem jüdischen Friedhof in Laudenbach
beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schächter tätig war. Die Stelle
wurde bei anstehenden Neubesetzungen immer wieder ausgeschrieben (vgl. unten
Ausschreibungstext).
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das Verhältnis zwischen
christlichen und jüdischen Einwohnern noch zeitweise angespannt, wie
Ereignisse aus dem Jahr 1866 zeigen. Es war die Zeit des Abschlusses der
rechtlichen Gleichstellung der Juden mit den Christen:
 Antijüdische
Ausschreitungen in Wiesenfeld 1866 - Artikel in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 6. Juni 1866: "Wiesenfeld. Dieser Tage
hatten auch wir eine Art Judenexzess durchzumachen. Lärmend und tobend durchzog
ein aufgeregter Volkshaufen die Straßen und wurden dabei sieben
Israeliten die Fenster eingeworfen. Was die Ursache dieses Aufruhrs war,
stellte sich Tags darauf heraus, wo die Exzedenten von den Juden
verlangten, sie sollten den Anteil an den Gemeinderechten schriftlich
abtreten. Es war nämlich dieser Punkt schon seit Jahren ein Zankapfel
zwischen den jüdischen und christlichen Einwohnern Wiesenfelds. Als
jedoch das Gericht zu Gunsten der Juden entschied, mussten sich die
Unzufriedenen in das Unvermeidliche ergeben. Bei dieser aufgeregten Zeit
nun glaubten die guten Wiesenfelder das Recht des Stärkeren handhaben zu
dürfen und zwangen also die Juden förmlich, die betreffende
Verzichtleistung auszustellen. Wahrscheinlich haben die guten Leute
übersehen, dass das Gesetz einen solchen Akt nicht anerkennt und dass die
Beteiligten einer strengen Strafen zu gewärtigen haben." Antijüdische
Ausschreitungen in Wiesenfeld 1866 - Artikel in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 6. Juni 1866: "Wiesenfeld. Dieser Tage
hatten auch wir eine Art Judenexzess durchzumachen. Lärmend und tobend durchzog
ein aufgeregter Volkshaufen die Straßen und wurden dabei sieben
Israeliten die Fenster eingeworfen. Was die Ursache dieses Aufruhrs war,
stellte sich Tags darauf heraus, wo die Exzedenten von den Juden
verlangten, sie sollten den Anteil an den Gemeinderechten schriftlich
abtreten. Es war nämlich dieser Punkt schon seit Jahren ein Zankapfel
zwischen den jüdischen und christlichen Einwohnern Wiesenfelds. Als
jedoch das Gericht zu Gunsten der Juden entschied, mussten sich die
Unzufriedenen in das Unvermeidliche ergeben. Bei dieser aufgeregten Zeit
nun glaubten die guten Wiesenfelder das Recht des Stärkeren handhaben zu
dürfen und zwangen also die Juden förmlich, die betreffende
Verzichtleistung auszustellen. Wahrscheinlich haben die guten Leute
übersehen, dass das Gesetz einen solchen Akt nicht anerkennt und dass die
Beteiligten einer strengen Strafen zu gewärtigen haben." |
Im Krieg 1870/71 waren unter den 38 Kriegsteilnehmern
aus Wiesenfeld auch die beiden jüdischen bayerischen Soldaten Michael
Rosenberger und Markus Baum. Ihre Namen stehen auf einem Denkmal an der Südwand
der Pfarrkirche von Wiesenfeld.
Bis 1910 war die Zahl der jüdischen Einwohner auf 63 zurückgegangen
(6,0 % von insgesamt 1.057).
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Friedrich Hanauer
(geb. 11.4.1893 in Wiesenfeld, vor 1914 in Würzburg wohnhaft, gef.
30.8.1915).
Um 1924, als 65 Personen der jüdischen Gemeinde angehörten (5,9 % von
insgesamt etwa 1.100), waren die Vorsteher der Gemeinde Hugo Stern und Jakob
Steigerwald. Als Lehrer, Kantor und Schochet wirkte Hirsch Oppenheimer. Er
unterrichtete im Schuljahr 16 Kinder an der Religionsschule der Gemeinde. Die
Gemeinde war dem Rabbinatsbezirk in Würzburg zugeteilt. 1932 waren die
Vorsteher David Bamberger (1. Vors.) und Ferdinand Bamberger. Als Schatzmeister
ist Louis Bamberger eingetragen. Die Repräsentanz hatte 15 Mitglieder, womit
alle jüdischen Familien in der Repräsentanz vertreten waren. Als Lehrer wirkte
nun S. Strauß. Er hatte noch 8 jüdischen Kindern Religionsunterricht zu
erteilten. An Stiftungen war die "Schul-Dotations-Kasse" erhalten
(Vorsitzender war David Bamberger).
1933 lebten noch 55 jüdische Personen (in 13 Familien) in Wiesenfeld. Trotz der
zunehmenden Restriktionen und der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts ging die
Zahl der jüdischen Einwohner zunächst nur langsam zurück. Der Rückgang verstärkte sich
jedoch nach den Ereignissen im November 1938. 1939 wurden noch 29
jüdische Einwohner gezählt. Beim Novemberpogrom 1938 kamen 30 SA-Leute
aus Karlstadt nach Wiesenfeld. Unter reger Beteiligung durch Ortsbewohner drangen sie in die
jüdischen Häuser ein und zerstörten die Wohnungen. Aus einem Geschäft holten
sie sämtliche Stoffe und Textilien heraus und verbrannten diese außerhalb des
Dorfes. Anfang Februar 1942 waren noch 25, überwiegend ältere jüdische
Personen in Wiesenfeld. Im April 1942 wurden 19 von ihnen über Würzburg nach
Izbica deportiert, sechs wurden im Juni und September in das Ghetto
Theresienstadt verbracht.
Von den in Wiesenfeld geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Arthur Bamberger (1925), David Bamberger (1889), Jette (Jettchen) Bamberger geb. Ring (1895), Joseph Bamberger (1871),
Siegfried Bamberger (1896), Ernestine Baum (1881), Hedwig Baum (1885), Max Baum (1879), Moses Baum (1892),
Bernhard Baumann (1892), Julius Baumann (1894), Marga Baumann (1924), Selma Baumann geb. Langgut
(1896), Jenny Blumenbaum geb. Hanauer (1878), Frieda Frank geb. Hanauer (1882),
Inge Frank (1925), Paula Frankenberg geb. Hanauer (1875), Laura Liane Frankenfelder geb.
Bamberger
(1893)*, Karoline (Lina) Hamburger geb. Rosenberger (1898), Alfred Otto Hanauer (1893), Arthur Hanauer (1913), Felix Hanauer (1882), Ida
Hanauer (1917), Mira Mirjam Hanauer (1882), Moses Hanauer I (1875, in Wiesenfeld),
Moses Hanauer II (1875, später in Bendorf), Pauline Hanauer geb. Steinheimer
(1874), Philipp Hanauer (1883), Rosa Hanauer geb. Goldschmidt (1874), Sali Hanauer geb.
Dillenburger (1887), Sally Hanauer (1881), Jette (Jettchen) Heppenheimer geb.
Braunold (1851), Elsa Jung geb. Wellisch (1889), Mina Kahn (1892), Emilie Rosenberger
geb. Löwentritt (1880), Joseph Schlossmann (1860), Irma Siegel geb. Hanauer
(1903), Julius Arnold Siegel (1900), Berta Steigerwald (1923), Julius Steigerwald (1909), Minna Steigerwald
(1912), Emanuel Stern (1878), Fanny Flora Stern (1891), Hugo Heinemann Stern
(1881), Mathilde Stern geb. Michel (1923), Mathilde (Thilde)
Stern geb. Sichel (1887), Hugo (Heinemann, Chaim) Stern (1881), Amalie Strauss
geb. Bamberger (1878).
Für 22 der genannten Personen wurden im Januar 2010 "Stolpersteine"
in Wiesenfeld verlegt (siehe Pressebericht unten).
*Anmerkung zu Laura Liane Frankenfelder
(nach Angabe von Maria Becker vom 14.8.2025): Laura war eine gebürtige Bamberger
und seit 1913 in erster Ehe verheiratet mit Martin Mondschein. Nach dessen Tod
heiratete sie in zweiter Ehe Rafael Frankenfelder. In einigen Listen ist ihr
Geburtsname falsch mit "Mondschein" eingetragen. Aus erster Ehe entstammte
Lauras Sohn Kurt Mondschein, der 1993 in Südafrika gestorben ist
https://www.geni.com/people/Kurt-Mondschein/6000000206362119821.
1945 kam ein überlebendes Ehepaar aus Theresienstadt zurück nach
Wiesenfeld (gestorben im Juni 1946 beziehungsweise im September 1959).
Berichte
aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der
Geschichte der jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Lehrers, Vorbeters und
Schochet 1884 / 1895
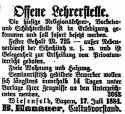 Anzeige in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 21. Juli 1884: "Offene
Lehrerstelle. Anzeige in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 21. Juli 1884: "Offene
Lehrerstelle.
Die hiesige Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle
ist in Erledigung gekommen und soll sofort besetzt werden. Fester Gehalt
M. 725 - außer Nebenverdienst der Schechitah usw. und ist
Gelegenheit zur Erteilung von Privatunterricht geboten. Freie Wohnung und
Heizung. Seminaristisch gebildete Bewerber vollen sich längstens
innerhalb 14 Tagen unter Vorlage ihrer Zeugnisse an den Unterzeichneten
wenden.
Wiesenfeld, Bayern, 17. Juli 1884.
B. Hanauer,
Kultusvorstand". |
| |
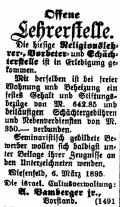 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1895: "Offene
Lehrerstelle. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1895: "Offene
Lehrerstelle.
Die hiesige Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle ist in Erledigung
gekommen.
Mit derselben ist bei freier Wohnung und Beheizung ein festes Gehalt und
Stiftungsbezüge von Mark 642.85 und beiläufigen Schächtergebühren und
Nebenverdiensten von Mark 350.- verbunden.
Seminaristisch gebildete Bewerber wollen sich baldigst unter Beilage ihrer
Zeugnisse an den Unterzeichneten wenden.
Wiesenfeld, 6. März 1895.
Die israelitische Kultusverwaltung:
A. Bamberger jr., Vorstand." |
Zum Tod von Lehrer Moses Nußbaum (1930, Lehrer in Wiesenfeld 1886 - 1895)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.
Oktober 1930: "Moses Nußbaum gestorben. Nach kurzem
Krankenlager verstarb vor einigen Wochen unser lieber und treuer Kollege
Moses Nußbaum, pensionierter Volksschullehrer, im Alter von 65 Jahren. Er
war ein gemütvoller, äußerst strebsamer Kollege, der neun Jahre in Wiesenfeld
als Religionslehrer, und fünfzehn Jahre in Maßbach
bei Kissingen als Volksschullehrer seine segensreiche Tätigkeit
entfaltet hat. Leider haben seine Kräfte den Anforderungen, die er an
sich selbst gestellt hat, nicht Stand gehalten, sodass er schon im Jahre
1910 in seinem 45. Lebensjahre in Pension gehen musste. Doch gründete er
sich nach überstandener Krankheit in Kissingen mit großer Energie und
erstaunlicher Anpassungskraft eine neue Existenz als Kaufmann und verstand
es sich neben der Verehrung aller Kreise der Stadt eine dominierende
Stellung in seinem Berufe zu erobern. Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.
Oktober 1930: "Moses Nußbaum gestorben. Nach kurzem
Krankenlager verstarb vor einigen Wochen unser lieber und treuer Kollege
Moses Nußbaum, pensionierter Volksschullehrer, im Alter von 65 Jahren. Er
war ein gemütvoller, äußerst strebsamer Kollege, der neun Jahre in Wiesenfeld
als Religionslehrer, und fünfzehn Jahre in Maßbach
bei Kissingen als Volksschullehrer seine segensreiche Tätigkeit
entfaltet hat. Leider haben seine Kräfte den Anforderungen, die er an
sich selbst gestellt hat, nicht Stand gehalten, sodass er schon im Jahre
1910 in seinem 45. Lebensjahre in Pension gehen musste. Doch gründete er
sich nach überstandener Krankheit in Kissingen mit großer Energie und
erstaunlicher Anpassungskraft eine neue Existenz als Kaufmann und verstand
es sich neben der Verehrung aller Kreise der Stadt eine dominierende
Stellung in seinem Berufe zu erobern.
An seinem Grabe vereinigte sich eine große Trauergemeinde. Neben den
jüdischen Kollegen des Bezirks waren die hiesigen Volksschullehrer sehr
zahlreich erschienen, die die Beerdigungsfeier mit einem ergreifenden
Grabgesang eröffneten. Nach der tief empfundenen Grabrede des Herrn
Rabbiners Dr. S. Bamberger, widmete ihm Ludwig Steinberger warme
Abschiedsworte als Freund und Kollege und sprach Dank und Verehrung im
Namen des Jüdischen Lehrervereins für Bayern aus. Nach einigen Abschiedsworten
des eigenen Bruders, des Herrn Hauptlehrers Nußbaum (Neumarkt), sprach
der Vorstand des Bezirkslehrervereins Kissingen im Namen des Bayerischen
Lehrervereins herzliche Worte ehrenden Gedenkens. Herr Gustav Neustädter
brachte im Namen der Gemeinde Maßbach, die sehr zahlreich am Grabe
erschienen war, Verehrung und Dankbarkeit derselben zum Ausdruck.
Mit Moses Nußbaum ist ein vorbildliches Lehrerleben verhaucht. Sein
Andenken wird in unserem Verein hoch in Ehren bleiben." |
Berichte zu einzelnen
Personen aus der Gemeinde
Zum Tod des "sehr verdienten, würdigen
Lehrerveterans" Joseph Silbermann (1817-1896)
Anmerkung: Lehrer Joseph Silbermann starb "bei seinen Kindern"
in Wiesenfeld, gemeint vor allem seine Tochter Therese Bamberger geb. Silbermann
(siehe Berichte unten).
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1896:
"Aus Unterfranken. Ein sehr verdienter, würdiger Lehrerveteran ist
in dem vergangene Woche zu Wiesenfeld verblichenen Lehrer Joseph
Silbermann zu Grabe getragen worden. Fast achtzigjährig hatte derselbe
erst vor wenigen Wochen sich auf dem Berufsleben zurückgezogen und war
von Altenschönbach, seinem letzten Wirkungskreis, nach Wiesenfeld zu
seinen Kinder übergesiedelt, wo ihm nur noch eine kurze Frist der
wohlverdienten Ruhe beschieden war. 60 Jahre lang stand er mit vollem
Eifer und ungeteilter Hingabe im Dienste des religiösen Erzieherberufes.
Die Resultate, die er erzielte, waren an jeder Stätte seiner Wirksamkeit
außerordentlich erfreulich. In Westheim bei Haßfurt
geboren, hat der
Verblichene bei verschiedenen, bedeutenden Lehrern und Rabbinern, unter
anderem auch in Höchberg, sich hervorragende Kenntnisse in Tanach
(Bibel) und Talmud (wörtlich abgekürzt: sechs Ordnungen)
angeeignet. Er fungierte hierauf 10 Jahre als Lehrer in Weimarschmieden,
Oberstreu und Schwebheim, dann,
nachdem er mit ausgezeichneten Noten sein staatliches Lehrerexamen
abgelegt hatte, volle 50 noch in den beiden Gemeinden Gochsheim und Altenschönbach. Ein tüchtiger Pädagoge, von seinen Vorgesetzten, den
Rabbinern und den staatlichen Inspektoren, zu allen Zeiten geehrt und
ausgezeichnet, war er ein sprechender Beweis dafür, dass die, die mit der
Jugend leben, stets jung bleiben. Vor dem Ärger und Kummer, den ihm in
früheren Jahren oftmals missliche Gemeindeverhältnisse bereiteten,
flüchtete er sich in das Heiligtum seiner Schule, die ihm stets wieder
frischen Mut und Lebensfreudigkeit gewährte; in diesem Heiligtum verwand
er auch den Schmerz über den Tod der ihn um viele Jahre früher
entrissenen Gattin. Die Betrachtung des Werkes des Verblichenen
erschöpfen wir keineswegs mit dem Hinweis, dass derselbe auch in allen Elementarfächern,
in kaufmännischen Disziplinen, in Realien etc. großes Wissen besaß, die
ihn befähigten, eine große Reihe von Zöglingen, die sich jetzt in
hervorragenden Stellen befinden, für alle Mittelschulen mit Erfolg
vorzubereiten, sondern wir legen unbedingt den Nachdruck darauf, dass er
als Lehrer ein Lamden gewesen, eine Verbindung zweier
Eigenschaften, die wir in unserer Tora-armen Zeit leider nur zu selten
antreffen. Seine ganze freie Zeit widmete Silbermann dem 'Lernen' zumal in
den letzten Jahren, da seine bereits sehr dezimierte Schule ihm viel freie
Zeit gewährte, konnte man ihn immer über der Gemara oder dem Midrasch
antreffen. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1896:
"Aus Unterfranken. Ein sehr verdienter, würdiger Lehrerveteran ist
in dem vergangene Woche zu Wiesenfeld verblichenen Lehrer Joseph
Silbermann zu Grabe getragen worden. Fast achtzigjährig hatte derselbe
erst vor wenigen Wochen sich auf dem Berufsleben zurückgezogen und war
von Altenschönbach, seinem letzten Wirkungskreis, nach Wiesenfeld zu
seinen Kinder übergesiedelt, wo ihm nur noch eine kurze Frist der
wohlverdienten Ruhe beschieden war. 60 Jahre lang stand er mit vollem
Eifer und ungeteilter Hingabe im Dienste des religiösen Erzieherberufes.
Die Resultate, die er erzielte, waren an jeder Stätte seiner Wirksamkeit
außerordentlich erfreulich. In Westheim bei Haßfurt
geboren, hat der
Verblichene bei verschiedenen, bedeutenden Lehrern und Rabbinern, unter
anderem auch in Höchberg, sich hervorragende Kenntnisse in Tanach
(Bibel) und Talmud (wörtlich abgekürzt: sechs Ordnungen)
angeeignet. Er fungierte hierauf 10 Jahre als Lehrer in Weimarschmieden,
Oberstreu und Schwebheim, dann,
nachdem er mit ausgezeichneten Noten sein staatliches Lehrerexamen
abgelegt hatte, volle 50 noch in den beiden Gemeinden Gochsheim und Altenschönbach. Ein tüchtiger Pädagoge, von seinen Vorgesetzten, den
Rabbinern und den staatlichen Inspektoren, zu allen Zeiten geehrt und
ausgezeichnet, war er ein sprechender Beweis dafür, dass die, die mit der
Jugend leben, stets jung bleiben. Vor dem Ärger und Kummer, den ihm in
früheren Jahren oftmals missliche Gemeindeverhältnisse bereiteten,
flüchtete er sich in das Heiligtum seiner Schule, die ihm stets wieder
frischen Mut und Lebensfreudigkeit gewährte; in diesem Heiligtum verwand
er auch den Schmerz über den Tod der ihn um viele Jahre früher
entrissenen Gattin. Die Betrachtung des Werkes des Verblichenen
erschöpfen wir keineswegs mit dem Hinweis, dass derselbe auch in allen Elementarfächern,
in kaufmännischen Disziplinen, in Realien etc. großes Wissen besaß, die
ihn befähigten, eine große Reihe von Zöglingen, die sich jetzt in
hervorragenden Stellen befinden, für alle Mittelschulen mit Erfolg
vorzubereiten, sondern wir legen unbedingt den Nachdruck darauf, dass er
als Lehrer ein Lamden gewesen, eine Verbindung zweier
Eigenschaften, die wir in unserer Tora-armen Zeit leider nur zu selten
antreffen. Seine ganze freie Zeit widmete Silbermann dem 'Lernen' zumal in
den letzten Jahren, da seine bereits sehr dezimierte Schule ihm viel freie
Zeit gewährte, konnte man ihn immer über der Gemara oder dem Midrasch
antreffen.
Und dieses beständige Aufgehen in den Quellen, gab auch seinem einfachen Religionsunterricht
einen eigenen Reiz und verlieh ihm seltenen Wert.
Es braucht nicht erwähnt zu werden, dass die gleiche Gewissenhaftigkeit,
wie bei der Ausübung seines Lehrerberufes, ihn auch in seinem Amte als Schochet
und Schaliach Zibbur auszeichnete. Gerade als Baal Tefilla
war er würdig, wie irgend einer: Jeder, auch der es nicht verstand,
konnte bei seinem Gebetsvortrag fühlen, wie sein Vortrag auf richtigem
Verständnis beruhte und aus dem Quell tiefsinniger Andacht
hervordrang.
Sein Heimgang bedeutet auch für die Allgemeinheit einen Verlust, da
solche Männer, solche Lehrer eben leider auszusterben drohen, er ist vor
allem für die Gemeinden seiner Wirksamkeit schmerzvoll, da man durch die
Bande aufrichtiger Dankbarkeit sich mit ihm verbunden fühlte. Sein
Andenken wird stets ein gesegnetes sein!" |
Silberne Hochzeit des langjährigen Vorstandes der Gemeinde Abraham
Bamberger (1902)
 Artikel in der Zeitschrift "Der
Israelit" vom 3. Februar 1902: "Wiesenfeld. Der langjährige
hiesige Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Herr Abraham Bamberger,
feierte am vergangenen Sabbat das Fest seiner silbernen Hochzeit, wobei er
besonders der Armen gedachte. Von einem größeren Feste sah Bamberger
seinem Charakter entsprechend ab." Artikel in der Zeitschrift "Der
Israelit" vom 3. Februar 1902: "Wiesenfeld. Der langjährige
hiesige Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Herr Abraham Bamberger,
feierte am vergangenen Sabbat das Fest seiner silbernen Hochzeit, wobei er
besonders der Armen gedachte. Von einem größeren Feste sah Bamberger
seinem Charakter entsprechend ab." |
Zum Tod von Flora Adler geb. Hanauer (1908)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November 1908: "Wiesenfeld bei
München (??),
5. November 1908. Am Mittwoch Paraschat Bereschit, entschlief hier
nach kurzem, aber schwerem Leiden eine Ischa jekara (teure Frau),
Frau Flora Adler geb. Hanauer im Alter von 36 Jahren, nach 9-jähriger,
glücklicher Ehe. Die Verstorbene war ein Eschet Chajal im wahrsten
Sinne des Wortes. Ihr ganzes Leben war eine fortgesetzte Bestätigung vom Gebot
zu guten Werken. Aus echt altjüdischem Hause stammend, hielt sie auch
als Frau, die ihr im Elternhause eingepflanzten jüdischen Grundsätze
hoch. Kein Armer verließ ungetröstet ihre gastliche Schwelle. Welcher
Wertschätzung die edle Heimgegangene sich in weitem Umkreise zu erfreuen
hatte, zeigte sich bei der Beerdigung, die eine Beteiligung aufwies, wie
es Jahre vorher nicht mehr der Fall war. Den Hesped (Trauerrede)
hielt Herr Lehrer Becholer (falsch, verschrieben für Wechsler)
aus Aschbach, ein Schwager der Verblichenen. Ihre
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November 1908: "Wiesenfeld bei
München (??),
5. November 1908. Am Mittwoch Paraschat Bereschit, entschlief hier
nach kurzem, aber schwerem Leiden eine Ischa jekara (teure Frau),
Frau Flora Adler geb. Hanauer im Alter von 36 Jahren, nach 9-jähriger,
glücklicher Ehe. Die Verstorbene war ein Eschet Chajal im wahrsten
Sinne des Wortes. Ihr ganzes Leben war eine fortgesetzte Bestätigung vom Gebot
zu guten Werken. Aus echt altjüdischem Hause stammend, hielt sie auch
als Frau, die ihr im Elternhause eingepflanzten jüdischen Grundsätze
hoch. Kein Armer verließ ungetröstet ihre gastliche Schwelle. Welcher
Wertschätzung die edle Heimgegangene sich in weitem Umkreise zu erfreuen
hatte, zeigte sich bei der Beerdigung, die eine Beteiligung aufwies, wie
es Jahre vorher nicht mehr der Fall war. Den Hesped (Trauerrede)
hielt Herr Lehrer Becholer (falsch, verschrieben für Wechsler)
aus Aschbach, ein Schwager der Verblichenen. Ihre
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zum Tod des aus Wiesenfeld stammenden und vor allem in
Nürnberg wirkenden Abraham Grünbaum (geb. 1863 in Wiesenfeld, gest. 1921 in Jerusalem)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 25. März 1921: "A. Grünbaum seligen Andenkens, Nürnberg. Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 25. März 1921: "A. Grünbaum seligen Andenkens, Nürnberg.
Die bayrische Judenheit, insbesondere die Orthodoxie, hat einen ihrer
bedeutendsten Männer verloren. Man ist fast versucht zu sagen, dass sie
verwaist und führerlos dasteht durch den Tod des Herrn Abraham Grünbaum,
Nürnberg. Tragik und wunderbarer Abschluss seines reichen Lebens bildet
sein Tod in Jerusalem, wo er mit seiner Gattin auf einer Studienreise
durch Erez Israel weilte.
Gerade seine Liebe und Arbeit für Erez Israel bildet die Quintessenz
seines großen Schaffens und Wirkens, sie war der Zentralpunkt seines
großen Schaffens und Wirkens, sie war der Zentralpunkt seines jüdischen
Denkens und Empfindens, mit Erez Israel war er zeitlebens innerlich
verbunden durch seelische Bande und in einer Hingebung von ganz
ungewöhnlicher Kraft und Tiefe. Außerordentlich und ungewöhnlich war
überhaupt die ganze Persönlichkeit, vielseitig, originell,
schöpferisch, wie es nur wenigen Menschen beschieden ist. Sein ganzer
Werdegang führte ihn zu jener tiefen Jüdischkeit, die wir zeitlebens an
ihm bewundern konnten.
In Wiesenfeld in Unterfranken vor 68 Jahren (am 27. Sch'wat)
geboren, genoss er schon in frühester |
 Jugend
durch seinen unvergesslichen Lehrer Rosenbaum seligen Andenkens,
dem er ein treues Andenken bewahrte, eine ausgezeichnete jüdische
Erziehung und Einführung in Tanach und Talmud. Und wenn der Würzburger
Raw, R. Seligmann Bär Bamberger seligen Andenkens zur Schulprüfung nach Wiesenfeld
kam, so nahm er sich den jungen Abraham Grünbaum besonders vor mit einem
Blatt Gemoro, und wie glücklich und begeistert erzählt uns Abraham
Grünbaum davon, wie ihn der Raw in seiner berühmten liebenswürdigen und
herzlichen Art ermunterte und aneiferte, wie tief er auf ihn gewirkt und
ihn zeitlebens in seinem ganzen jüdischen Denken und Handeln beeinflusst
hat. Und das wurde noch verstärkt, als Abraham Grünbaum die Realschule
in Würzburg besuchte und im Hause von R. Jizchok Schlenker seligen
Andenkens erzogen wurde. Jugend
durch seinen unvergesslichen Lehrer Rosenbaum seligen Andenkens,
dem er ein treues Andenken bewahrte, eine ausgezeichnete jüdische
Erziehung und Einführung in Tanach und Talmud. Und wenn der Würzburger
Raw, R. Seligmann Bär Bamberger seligen Andenkens zur Schulprüfung nach Wiesenfeld
kam, so nahm er sich den jungen Abraham Grünbaum besonders vor mit einem
Blatt Gemoro, und wie glücklich und begeistert erzählt uns Abraham
Grünbaum davon, wie ihn der Raw in seiner berühmten liebenswürdigen und
herzlichen Art ermunterte und aneiferte, wie tief er auf ihn gewirkt und
ihn zeitlebens in seinem ganzen jüdischen Denken und Handeln beeinflusst
hat. Und das wurde noch verstärkt, als Abraham Grünbaum die Realschule
in Würzburg besuchte und im Hause von R. Jizchok Schlenker seligen
Andenkens erzogen wurde.
Seine kaufmännische Lebensbahn führte ihn dann nach Schwabach,
wo er trotz seiner beruflichen Pflichten noch ein fleißiger Schüler von R.
Löb Wißmann seligen Andenkens und vor allem von R. Hile Wechsler seligen
Andenkens war. In diesen Jünglings- und Mannesjahren hat er sich, dank
seiner ganz ausgezeichneten Geistesgaben, jene tiefgründige talmudische
Bildung verschafft, die ihm Leitstern seines Lebens war.
Hier hat er im Alter von 21 Jahren im Verein mit seiner ebenbürtigen
Gattin, Frau Leah geb. Goldschmidt aus Zell
bei Würzburg ein jüdisches Haus gegründet, das in seiner Innigkeit
und Hilfsbereitschaft, seinem lebensfrohen und gesunden Optimismus, seiner
grenzenlosen Hingebung für alles Jüdische und Menschliche nicht leicht
zu überbieten sein dürfte. Und bald war Grünbaum in Schwabach
der Mittelpunkt des jüdischen und allgemeinen politischen Lebens. Er war
ebenso berufen, Kultusvorstand zu sein, wie es kein politisches und
kommunales Amt gab, das man ihm nicht anvertrauen konnte. Überall war er
Meister und souveräner Herr der Situation, schlagfertig und weitblickend
wie ein Weltmann. Und der ist er auch bald geworden. Rasch wuchs er hinaus
über Schwabachs Grenzen in allen
Dingen, jüdischen wie allgemein menschlichen.
Schon mit 26 Jahren unternahm er für die Amsterdamer Palästinaverwaltung
(im Verein mit dem seligen R. Benjamin Roos, später in Werneck
in Unterfranken) eine Studienreise nach Erez Israel, und eine seiner
mächtigsten Wirkungen dort galt der Ereneuerung des Schaare
Zedek-Spitals, und eine wunderbare Fügung des Himmels hat ihm die Gnade
gewährt, hier in diesem Hause einzugehen auf heiliger Erde zur ewigen
Ruhe, die er sich bin an sein Ende nicht gegönnt hat.
Als er vor etwa 30 Jahren nach Nürnberg übersiedelte, fand er hier einen
Wirkungskreis für seinen Schaffensdrang und seine unerschütterliche,
ewig jugendliche Arbeitskraft vor, den er bearbeitete und ausdehnte, wie
es nur solch außerordentlichen Menschen möglich ist. Ganz von selbst
fiel ihm die Führung der Adas Israel zu, die damals noch ganz in ihren
Anfängen steckte. Was Grünbaum da leistete, das allein könnte ein
Menschenleben ausfüllen. Nacheinander schuf er im Verein mit treu
ergebenen Weggenossen eine Religionsschule, eine Synagoge mit allen
mustergültigen Einrichtungen und das Rabbinat! Was das für die
bayerischen Verhältnisse überhaupt und insbesondere in Nürnberg
bedeutet, kann nicht überschätzt werden. Seinem unerschöpflichen und
sicheren Optimismus, gegründet auf seltene Erfassung der Lebensverhältnisse
und der Beherrschung der Menschen, ist es gelungen, die Adas Israel
zu
einer kraftvollen Gemeinde zu gestalten.
Grünbaum wuchs ebenso selbstverständlich in alle Aufgaben der
Gesamtgemeinde hinein; es gibt keine Institution, in der er nicht
schaffend und führend mitwirkte. |
 So
war er seinerzeit ein Gründungsmitglied er Maimonides-Loge, und er hat
von Anfang an deren Unterstützungstätigkeit geleitet. Ferner gehörte er
sämtlichen gemeindlichen Wohltätigkeitsvereinen an, in denen er
gleichfalls führend und schaffend tätig war. Dabei hatte der ungemein
vielseitige Mann noch Zeit, als Vorsitzender des Ku- So
war er seinerzeit ein Gründungsmitglied er Maimonides-Loge, und er hat
von Anfang an deren Unterstützungstätigkeit geleitet. Ferner gehörte er
sämtlichen gemeindlichen Wohltätigkeitsvereinen an, in denen er
gleichfalls führend und schaffend tätig war. Dabei hatte der ungemein
vielseitige Mann noch Zeit, als Vorsitzender des Ku- |
 ratoriums
der Talmud-Thora in Schwabach, als
Mitglied der Kuratoriums der israelitischen
Lehrerbildungsanstalt in Würzburg mit aller Energie und Kraft tätig
zu sein. Der Freien Vereinigung für die Interessen des orthodoxen
Judentums, der Agudas Jsrael, dem Kurhospiz in Bad
Kissingen, der neuen Jeschibah in Nürnberg ebenso warm zu
dienen. ratoriums
der Talmud-Thora in Schwabach, als
Mitglied der Kuratoriums der israelitischen
Lehrerbildungsanstalt in Würzburg mit aller Energie und Kraft tätig
zu sein. Der Freien Vereinigung für die Interessen des orthodoxen
Judentums, der Agudas Jsrael, dem Kurhospiz in Bad
Kissingen, der neuen Jeschibah in Nürnberg ebenso warm zu
dienen.
Und damit erschöpfte sich seine Lebensarbeit immer noch nicht. Was
Grünbaum an persönlicher Liebestätigkeit, Gemilus Chased, Zedokoh
(Wohltätigkeit) getan hat, ist gar nicht zu schildern. Er hat aus eigener
Kraft eine Darlehenskasse für die Ostjuden geschaffen und diesen zu jeder
Stunde in Rat und Tat, als wäre es seine persönliche Angelegenheit, zur
Seite gestanden. Dabei war Grünbaum ein vielbegehrter Mohel
(Beschneider), die beschwerlichsten Reisen bei Sturm und Wetter spielten
in seinen Jahren keine Rolle, alles, alles hat er unternommen und spielend
bewältigt. Schwierigkeiten hat er nicht gescheit, kein Opfer für Tora
und Aboda (Gottesdienst) war ihm zu schwer. Wie hat er Talmide Chachamim
(Toragelehrte) behandelt und gewürdigt, wie hat er seinen Lehrern und
ihren Hinterbliebenen die Treue gehalten!
Dieser logisch scharfe Mann, so streng und energisch in der Verfolgung
seiner Ziele, konnte weich und zart sein mit Armen und Gedrückten, mit
Sorgen Beladenen und Bekümmerten. Sein Haus stand ihnen allen offen,
buchstäblich Tag und Nacht.
Uns eine Zartsinnigkeit in seiner Familie! Schon wie und woher er sich die
Gattin holte! Zell bei Würzburg,
- das entsprach seinem Programm und Lebensstil. Diese Ehe und dieses
Familienleben! Sie sind wirklich einzigartig und übten auf jeden
Beschauer einen tiefen Eindruck aus. Seine Gastfreundschaft sucht
ihresgleichen und die Art, wie man die Mizwath hachnosoth Orchim
(Gastfreundschaft) übte, erst recht. Das war lebendiges Judentum wie
Grünbaums ganzes Leben ein jüdisches Tatenleben aus einem Guss
darstellte.
Was die Persönlichkeit des Heimgegangenen bedeutete, kam in der letzten
Ehrung zum Ausdruck. Nach dem Hesped (Trauerrede) des Rabbiners Dr.
Klein in der Synagoge fand eine Trauerfeier im großen Saale des
Kulturvereins statt. 1.600 Menschen hatten sich eingefunden, und jeder
einzelne Redner rühmte, dass gerade seiner Organisation Grünbaums Kraft
geweiht war. Da wurde man sich so recht der ungeheuren Arbeitskraft,
Vielseitigkeit und geistigen Energie bewusst, die diesem einzigen Manne
innewohnte. Er trug eine Last, die über Menschenkraft weit hinausragte.
In diesen Gedanken mündeten alle Kundgebungen ein.
Don Sichel, 1. Vorstand des Vereins Ada Israel, würdigte
Grünbaum als Vorstandsmitglied. Rabbiner Horovicz - Jerusalem
sprach für die deutsch-holländische Palästinaverwaltung, Jacob
Rosenheim - Frankfurt für die Agudas Jsrael, Rabbiner Dr. Stein
- Schweinfurt für das Kurhospiz Kissingen und in besonders inniger
herzlicher Art für die israelitische Lehrerbildungsanstalt Würzburg,
Kommerzienrat Metzger für die Kultusverwaltung Nürnberg,
Rechtsanwalt Dr. Max Feuchtwanger für die Ohel Jakob-Gemeinde
München, Justizrat Dr. Erlanger für die Maimonides-Loge,
Hugo Bärmann für die gemeindlichen Vereine, H. Weißmann für
zwei Chewraus, Alfred Klugmann zeichnete Grünbaum als Lehrer der Chebrath
Bachurim und zum Schlusse würdigte Rabbiner Dr. Klein
Grünbaums Verdienste um die jüngste Gründung der Adas, die Jeschibah
und teilte mit, dass Freunde Grünbaums in seinem Geiste der Tat eine Abraham
Grünbaum-Stiftung begründeten.
Wie diese Kundgebung sich tief in die Herzen aller senkte, so wird das
Lebensbild Grünbaums im Gedächtnis der ganzen Gemeinde fortleben und
fortwirken, so wie er im Leben auf alle wirkte und ihn so all seine
großen Erfolge auf diesem Wege erreichen ließ für alles Jüdische und
alle jüdisch erziehlich beeinflusste und das auch weiterhin zu
ermöglichen suchte in seiner letzten Programmrede, die er kürzlich
anlässlich einer Mitgliederversammlung der Adas Jsrael entwickelte. Die
große Gesamtgemeinde war sein Resonanzboden und sollte er auch fernerhin
bleiben, getragen von seiner heiligen Lebensaufgabe, m'sakka horabbim zu
sein." |
75. Geburtstag von Therese Bamberger
geb. Silbermann (1928)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober 1928: "Wiesenfeld,
8. Oktober (1928). Ihren 75. Geburtstag begeht am 14. Oktober in voller
Rüstigkeit und geistigen Frische Frau Therese Bamberger geb. Silbermann
dahier." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober 1928: "Wiesenfeld,
8. Oktober (1928). Ihren 75. Geburtstag begeht am 14. Oktober in voller
Rüstigkeit und geistigen Frische Frau Therese Bamberger geb. Silbermann
dahier." |
80. Geburtstag von Therese Bamberger geb. Silbermann (1933)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. November 1933: "Wiesenfeld,
10. November (1933). In würdiger Weise wurde am 14. Oktober der 80.
Geburtstag unseres ältesten Gemeindemitglieds, der Frau Therese Bamberger
Witwe begangen. Frau Bamberger erfreut sich einer herrlichen körperlichen
und geistigen Frische, die dem wahren jüdischen Idealismus zugute kommt.
Gottesfurcht mit Menschenliebe gepaart, sind die Eigenschaften, die sie
vom Elternhaus, einer altehrwürdigen Lehrerfamilie in Gochsheim,
ererbt und die sie beseelen. So ist es kein Wunder, dass unsere
Israelitische Gemeinde sowie die ganze Ortsgemeinde an ihrem Geburtstage
innigen Anteil nahm. Jeder zur Tora Aufgerufene ehrte sie am Schabbat
Bereschit durch einen besonderer Mischeberach, und am Schabbatnachmittag
sprach Lehrer Adler in der Synagoge Worte des Dankes zu ihr für
ihr Wirken in der Synagoge, die sie noch immer in den Selichot-Tagen
alltäglich und allwöchentlich am Schabbat besucht und die sie
erst vor wenigen Jahren mit neuem herrlichem Almemor, mit Pultdecke und
mit in gleicher Farbe gehaltenem Porauches (Toraschreinvorhang) zierte. am
Sonntag, den 15. Oktober, versammelte sich in ihrem Heime, das fast alle
Ortsbewohner in einen Blumengarten verwandelt hatten, ihre Familie fast
vollzählig, und in ihrem Namen sowie im Namen ihrer Freunde sprach Herr Lehrer
Rosenfelder in beredten Worten den Glückwunsch sowie die Hoffnung
aus, dass es der Jubilarin vergönnt sein möge, einen noch recht langen
freundvollen Lebensabend in gleicher Frische zu genießen. (Alles Gute) bis
120 Jahre." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. November 1933: "Wiesenfeld,
10. November (1933). In würdiger Weise wurde am 14. Oktober der 80.
Geburtstag unseres ältesten Gemeindemitglieds, der Frau Therese Bamberger
Witwe begangen. Frau Bamberger erfreut sich einer herrlichen körperlichen
und geistigen Frische, die dem wahren jüdischen Idealismus zugute kommt.
Gottesfurcht mit Menschenliebe gepaart, sind die Eigenschaften, die sie
vom Elternhaus, einer altehrwürdigen Lehrerfamilie in Gochsheim,
ererbt und die sie beseelen. So ist es kein Wunder, dass unsere
Israelitische Gemeinde sowie die ganze Ortsgemeinde an ihrem Geburtstage
innigen Anteil nahm. Jeder zur Tora Aufgerufene ehrte sie am Schabbat
Bereschit durch einen besonderer Mischeberach, und am Schabbatnachmittag
sprach Lehrer Adler in der Synagoge Worte des Dankes zu ihr für
ihr Wirken in der Synagoge, die sie noch immer in den Selichot-Tagen
alltäglich und allwöchentlich am Schabbat besucht und die sie
erst vor wenigen Jahren mit neuem herrlichem Almemor, mit Pultdecke und
mit in gleicher Farbe gehaltenem Porauches (Toraschreinvorhang) zierte. am
Sonntag, den 15. Oktober, versammelte sich in ihrem Heime, das fast alle
Ortsbewohner in einen Blumengarten verwandelt hatten, ihre Familie fast
vollzählig, und in ihrem Namen sowie im Namen ihrer Freunde sprach Herr Lehrer
Rosenfelder in beredten Worten den Glückwunsch sowie die Hoffnung
aus, dass es der Jubilarin vergönnt sein möge, einen noch recht langen
freundvollen Lebensabend in gleicher Frische zu genießen. (Alles Gute) bis
120 Jahre." |
Joseph Schloßmann (1860-1942)
Unter den Persönlichkeiten der Gemeinde ist
insbesondere Joseph Schloßmann zu nennen (der nachfolgende Abschnitt
ist von Fred G. Rausch formuliert): Joseph Schloßmann wurde am 17. April 1860 in
Wiesenfeld geboren. Vier Jahre später siedelte die Familie nach Lohr, wo sein Vater eine Lederwarenhandlung in der Stadtmitte am Oberen Merkt eröffnete. Sein Sohn Joseph Schloßmann verließ 1882 Lohr und ging als Kleiderhändler über Landshut von 1886 bis 1898 in die USA, wo er in verschiedenen Unternehmen als Kaufmann arbeitete. Nach seiner Rückkehr aus Amerika wohne er in Berlin. Mit seiner Frau Minna hatte er fünf Kinder. Mit der Stadt Lohr und ihren bedürftigen Bürgern hielt der am 16. Januar 1930 zum Ehrenbürger ernannte Joseph Schlossmann regen Kontakt und unterstützte sie finanziell sehr großzügig (seit 1904). Am 27. April 1934 entzog die Lohrer Nazi-Stadtregierung Schloßmann das Ehrenbürgerrecht. 1941 musste er sein Haus in Berlin räumen und in das Judenhaus in der Bamberger Straße ziehen. Am 17. August 1942 wurde er von der Gestapo
'abgeholt' und mit einem Alterstransport mit weiteren 1000 Juden in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Dort verstarb er am 4. Januar 1943 im Alter von 82 Jahren. Seine Frau Minna ist bereits 1926 verstorben und im jüdischen Friedhaof Berlin-Weißensee beerdigt. Auf dem von Joseph Schloßmann errichteten Grabstein ist auch der Name
'Geh. Kommerzienrat Jos. Schlossmann' eingraviert (geb. 1860 in Wiesenfeld),
der als "Geheimer Kommerzienrat" in Berlin lebte, aber weiterhin
besondere Beziehungen zu seiner Heimat pflegte. Die Stadt Lohr ernannte ihn
1930 zu ihrem Ehrenbürger. 1942 wurde Schloßmann von Berlin aus nach
Theresienstadt deportiert.
| Juni
2013: Für den in Wiesenfeld geborenen
Lohrer Ehrenbürger Joseph Schloßmann wird in Berlin ein
"Stolperstein" verlegt |
Rechts: Artikel im
"Lohrer Echo" (online
"Main-Netz") vom 24. Mai 2013: "'Stolperstein'
in Berlin für Lohrer Ehrenbürger. NS-Opfer:
Künstler Gunter Demnig verlegt am 6. Juni
Gedenkstein für Joseph Schloßmann an der
Claudiusstraße 5 im Hauptstadtbezirk
Tiergarten..." |
 |
 |
Hinweis auf Dr. Ruth Westheimer
(geb. 1928 in Wiesenfeld, gest. 2024 in New York City)
 Die
bekannte Sozialogin, Sexualtherapeutin und Sachbuchautorin Dr. Ruth Karola
Westheimer geb. Siegel ist am 4. Juni 1928 in Wiesenfeld als Tochter von Julius
Arnold Siegel (aus Frankfurt; 1900-1942) und der Irma Siegel geb. Hanauer (aus
Wiesenfeld; 1903-1941) geboren. Im Alter von zehn Jahren wurde sie mit einem
Kindertransport von Frankfurt-Nordend in die Schweiz geschickt. Ihre Eltern
wurden in nach der Deportation ermordet. Die
bekannte Sozialogin, Sexualtherapeutin und Sachbuchautorin Dr. Ruth Karola
Westheimer geb. Siegel ist am 4. Juni 1928 in Wiesenfeld als Tochter von Julius
Arnold Siegel (aus Frankfurt; 1900-1942) und der Irma Siegel geb. Hanauer (aus
Wiesenfeld; 1903-1941) geboren. Im Alter von zehn Jahren wurde sie mit einem
Kindertransport von Frankfurt-Nordend in die Schweiz geschickt. Ihre Eltern
wurden in nach der Deportation ermordet.
Weiteres zu ihrer Biographie siehe den Wikipedia-Artikel (von hier auch das Foto
links):
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruth_Westheimer
Genealogische Informationen siehe
https://www.geni.com/people/Dr-Ruth-Westheimer/6000000009656651728
 |
 |
 |
|
| Oben: Elternhaus von Dr.
Ruth Westheimer in Wiesenfeld in der Eckartshofer Straße 7 mit Erinnerungstafel zu ihrer Biographie und
zur Geschichte der Juden in Wiesenfeld (Fotos: Elisabeth Boehrer).
|
Dazu Artikel von
Felix Hain in der "Main-Post" vom 12. Januar 2010: "WIESENFELD.
US-Sexaufklärerin Ruth Westheimer stammt aus Franken
Hinter Dr. Ruth oder Dr. Sex, wie sie in den USA genannt wird, verbirgt sich
Dr. Ruth Westheimer, Professorin für Soziologie und Psychologie an den
Universitäten Yale und Columbia und 'weltbekannte, prominente
deutsch-amerikanische Sexualtherapeutin und Sachbuchautorin', heißt es im
Internet-Lexikon Wikipedia.
Mehr Einträge als Beckstein. Wer googelt, findet mehr Einträge über
sie als zu Günther Beckstein und Karl-Theodor zu Guttenberg zusammen. Dieser
'Super-Promi' ist eine Weltberühmtheit und wurde in Wiesenfeld bei Karlstadt
geboren. Ruth Westheimer ist mit ihren 81 Jahren eine faszinierende,
quirlige und lebenslustige Frau, deren Energie sich auf 1,40 Meter
Körpergröße verteilen. 'Kommen wir gleich zur Sache', sagt sie bei einem
Treffen – mit einem unwiderstehlich verschmitzten Lächeln, gepaart mit
Urfrankfurter Schlappmaul, reinstes Hessisch. Mit 81 ist sie so fit wie eine
Dreißigjährige. 'Das Wasserskifahren musste ich letzten Winter aufgeben. Das
geht dann doch nicht mehr', erzählt sie. Ruth Westheimer fühlt sich als 'citizen
of the world', Weltbürger und amerikanische Staatsbürgerin mit
deutsch-jüdischer Abstammung. Als sie am 4. Juni 1928 als Karola Ruth Siegel
auf die Welt kommt, ist ihre Mutter zufällig bei ihren Eltern in der
Eckartshofer-Straße 7 in Wiesenfeld. Dort bleibt sie nach der Geburt einige
Monate. Ruths Vater kommt jedes Wochenende aus Frankfurt nach Wiesenfeld.
Danach zieht die ganze Familie wieder zurück nach Frankfurt, wo Ruth
aufwächst. Ihre Sommerferien verbrachte sie immer auf dem Bauernhof der
Großeltern Hanauer in Wiesenfeld. 'Ich wurde da immer sehr verwöhnt, weil
ich das einzige Enkelkind war', erinnert sich Frau Westheimer und blüht
richtig auf: 'Ich habe noch herrliche Erinnerungen an Wiesenfeld. Ich weiß
noch, wie ich die Gänse freigelassen habe und die dann durchs ganze Dorf
gerannt sind. Hinterher mussten wir sie alle wieder einsammeln.' Die
Stationen ihres Lebens sind beeindruckend und von der Hand des Schicksals
gelenkt zugleich. Mit dem Kindertransport in ein Schweizer Waisenhaus, dann
nach Palästina, wo sie im Kibbuz arbeitete und im Krieg eingesetzt wurde.
'Ich kann immer noch Handgranaten werfen.' 1948 wurde sie bei einem
Bombenabwurf verletzt. In Paris studierte sie Psychologie an der Sorbonne
und heiratete ihren ersten Mann. 1956 emigrierte sie allein in die USA, wo
sie 1961 Manfred Westheimer heiratete. An der Columbia Universität von New
York promovierte sie im Fach Soziologie. Sie zog zwei Kinder groß. Danach
erlebte sie in der wahrscheinlich prüdesten Nation der Welt einen
kometenhaften Aufstieg zum Radio- und Fernsehstar mit ihren Sendungen über
sexuelle Aufklärung. Seit ungefähr 25 Jahren kommt sie jährlich zur
Frankfurter Buchmesse – keinesfalls 'nur aus Business', wie sie sagt,
sondern wegen der Atmosphäre, der Menschen und nicht zuletzt, weil Frankfurt
ihre Heimatstadt ist. Ihre Bücher sind gefragt, nicht nur in den Vereinigten
Staaten. Ihre Einstellung zu den Deutschen formuliert sie so: 'Ich habe kein
Problem mit jüngeren Menschen. Bei älteren Menschen frage ich nicht nach, wo
und in welcher Funktion sie während des Dritten Reiches waren.' Über die
Emigranten sagt sie: 'Jeder hat das nach seiner Façon gehandhabt. Vielen
fiel es schwer, Fuß zu fassen in der amerikanischen Kultur und Sprache.
Andere haben nie wieder ein Wort Deutsch gesprochen und ihre Wurzeln
verdrängt.' Sie selbst besucht jedes Jahr die Gräber der Eltern ihres
verstorbenen Mannes in Frankfurt. Auch in Wiesenfeld war sie vor einiger
Zeit – allerdings mehr oder weniger inkognito.
Hitler heimgezahlt. Auf die Frage, wie sie denn mit all dem Leid
ihrer Kindheit zurechtgekommen sei und es geschafft habe, ihre persönliche
Geschichte nicht als Grundlage eines Hasses auf Deutschland zu nehmen,
antwortet sie: Hitler habe nicht gewollt, dass sie, die kleine Karola Rut
Siegel aus Wiesenfeld, es so weit bringt. Damit habe sie es ihm heimgezahlt.
Sie ist allerdings äußerst besorgt wegen der extrem aufkommenden
Nationalgefühle in ihrem Geburtsland. 'Es macht mir Angst wenn ich von
Neonazis höre.' Einen 'Stolperstein' vor ihrem Geburtshaus will sie nicht.
'Es macht keinen Sinn, dass auf den Namen wieder und wieder herumgetreten
wird.' Und grinsend fügt sie hinzu: 'Über eine kleine Tafel würde ich mich
natürlich freuen.' Sie greift ihren Gedanken vom Anfang wieder auf: 'Wenn
wir uns alle als ,citizens of the world‘ fühlten, als Kinder, die in der
Welt zu Hause sind, dann wäre vieles einfacher, und viel Leid könnte
vermieden werden.'"
Link zum Artikel |
Artikel von
Christina Horsten zum Tod von Ruth Westheimer in der "Jüdischen
Allgemeinen" vom 14. Juli 2024: "RUTH WESTHEIMER. Die Grande Dame
der Sex-Therapie ist tot
'Dr. Ruth' wurde in Frankfurt geboren und wohl zur bekanntesten Therapeutin
der USA.
Gerade einmal 1,44 Meter war Ruth Westheimer groß. Aber 'wenn Größe in Mut,
Entschlossenheit und harter Arbeit gemessen würde, müsste diese kleine Frau
2,50 Meter groß sein', schrieb der 'Newsday' einmal. Die in Deutschland
geborene Westheimer überlebte die Schoa und wurde in den USA zu 'Dr. Ruth',
der wohl berühmtesten Sex-Therapeutin der Welt. Am Freitag ist Westheimer im
Alter von 96 Jahren in Anwesenheit ihrer beiden Kinder gestorben, bestätigte
Sprecher Pierre Lehu, mit dem sie auch mehrere Bücher gemeinsam schrieb, der
Deutschen Presse-Agentur dpa.
Noch im vergangenen Jahr präsentierte sich Westheimer voller Energie. In
Cleveland im US-Bundesstaat Ohio gab es ein Theaterstück über ihr Leben,
2020 erschien der Dokumentarfilm 'Fragen Sie Dr. Ruth' und kurz zuvor hatte
der deutsche Generalkonsul David Gill ihr in New York das
Bundesverdienstkreuz verliehen. Westheimer habe ein 'abenteuerliches,
unglaublich buntes Leben' und 'die Gesellschaft bereichert', sagte Gill
damals.
Ihre Eltern wurden in Auschwitz ermordet. Geboren wird Karola Ruth
Siegel 1928 in Wiesenfeld in der Nähe von Frankfurt in eine jüdische Familie
hinein. Als Zehnjährige, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, wird sie
mit einem Kindertransport in die Schweiz gebracht. So entkommt sie dem
Holocaust, ihre Eltern und die geliebte Großmutter aber sieht sie nie
wieder. Ihre Eltern werden von den Nationalsozialisten im
Konzentrationslager Auschwitz ermordet.
Nach dem Krieg, noch als Teenager, zieht Ruth nach Palästina, wird zur
Scharfschützin ausgebildet und kämpft im Untergrund für ein freies Israel.
Dabei wird sie von einer Granate schwer verletzt. Danach beginnt sie ein
Studium an der Sorbonne in Paris. Ein Scheck der Bundesregierung über 5.000
Mark zur Entschädigung für erlittenes Leid ermöglicht es ihr 1956, in die
USA umzusiedeln. Dort setzt sie das Studium fort, heiratet Manfred
Westheimer und bekommt zwei Kinder. 1965 nimmt sie die US-Staatsbürgerschaft
an.
Durchbruch mit Radio-Show in den 80er Jahren. Den Durchbruch schafft
Westheimer Anfang der 80er Jahre mit einer Radio-Show. Mit ansteckendem
Rumpelstilzchen-Kichern gibt 'Dr. Ruth' Sex-Tipps und jongliert ohne
jegliche Hemmung mit Begriffen wie Ejakulation und Masturbation. Dem
15-minütigen Frage- und Antwort-Programm 'Sexually Speaking' bei einem New
Yorker Lokalsender folgen Einladungen von Fernsehstationen in aller Welt.
Hunderttausende suchen im Schutz der Anonymität den Rat der mütterlichen
Expertin. 'Ihr Name und der ausgeprägte Klang ihrer Stimme sind untrennbar
mit dem Thema Sex verbunden', schrieb die 'New York Times' einmal.
'Die Fragen sind überall die gleichen', sagte Westheimer einmal der
Deutschen Presse-Agentur. Zwar brüste sich jedes Land damit, die besseren
Liebhaber zu haben. Sie aber könne beileibe keinen Weltbesten erkennen.
Purer 'Quatsch' sei auch das Bild vom angeblich so puritanischen Amerika im
Vergleich zu einem sexuell sehr viel freieren Europa. Mehr als 30
Sex-Ratgeber hat Westheimer verfasst, viele davon sind auch auf Deutsch
erschienen.
Jedes Jahr kehrte sie nach Frankfurt zurück. In ihre Heimatstadt
Frankfurt kehrte 'Dr. Ruth' jedes Jahr zur Buchmesse zurück. 'Um den Bahnhof
mache ich einen großen Bogen. Aber in meiner alten Wohnung in der
Brahmsstraße 8, im Nordend, habe ich mich noch einmal umgeschaut', erzählte
sie einmal. 'Es ist schwierig für mich, aber ich gehe stolz und mit geradem
Rücken. Hitler hat nicht gewonnen! Er wollte, dass ich sterbe. Stattdessen
habe ich jetzt Kinder und Enkelkinder. Damals war es eine Flucht. Jetzt
schlafe ich im 'Frankfurter Hof'. Wer hätte das gedacht?'
Noch zu ihrem 95. Geburtstag sagte sie auf die Frage, wie sie noch so fit
und fröhlich bleibe: 'Mein Geheimnis ist, dass ich mich jeden Tag frage: Was
kann ich heute Abend machen? Und dann rufe ich jemanden an und wir
unternehmen etwas.' Sie habe kein Auto mehr, sondern fahre Taxi, und sie
organisiere alle ihre Verabredungen per Telefon, sagte sie damals. 'E-Mail
benutze ich nicht, aber ich telefoniere den ganzen Tag.'"
Link zum Artikel |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige von Jacob Steigerwald (1925)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Februar 1925: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Februar 1925:
"Suche für meinen Sohn, 16 Jahre alt, in einem
Manufakturwarengeschäft,
Schabbat und Feiertag geschlossen,
Lehrstelle.
Jacob Steigerwald. Wiesenfeld bei Lohr." |
Verlobungsanzeige von Gerta Katz und Max Bamberger (1929)
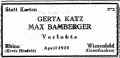 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April 1929:
"Statt Karten - Gott sei gepriesen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April 1929:
"Statt Karten - Gott sei gepriesen.
Gerta Katz - Max Bamberger.
Verlobte.
Rhina (Kreis Hünfeld) - Wiesenfeld (Unterfranken). April
1929." |
Zur Geschichte der Synagoge
Eine erste Synagoge war bereits vor 1700 vorhanden
beziehungsweise eingerichtet. Ende des 18. Jahrhundert wurde in der Karlstadter
Straße eine Synagoge erbaut, die 1860 wegen Baufälligkeit geschlossen
wurde. Das Gebäude ist jedoch noch erhalten.
1861-1863 wurde eine neue Synagoge erbaut. Über ihre
Baugeschichte und die Einweihung (1863) liegen noch keine Berichte vor. Diese
Synagoge blieb bis 1938 Zentrum des jüdischen Gemeindelebens am Ort. An
außergewöhnlichen Ereignissen liest man 1884 in einem Presseartikel über die
Auswirkungen eines Blitzschlages:
 Zerstörungen in der Synagoge durch Blitzeinschlag im Juli 1884 -
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Juli 1884:
"Wiesenfeld (Bayern), 18. Juli (1884). Das Gewitter, das am Montag
Morgen über unsere Gegend zog, hat auch den hiesigen Platz nicht
verschont. 1/2 Stunde nach dem Frühgottesdienst schlug der Blitz in die
hiesige, vor mehreren Jahren neuerbaute Synagoge und zündete sofort.
Rasche Hilfe war in den ersten Minuten am Platze, wodurch größeres
Unglück verhütet wurde; dem Ewigen sei Dank, dass das Gewitter nicht
etwas früher kam, als die ganze Gemeinde versammelt war, und ein
unberechenbares Unglück hätte entstehen können. Der Blitz zündete ein
Dachstuhl und zerschlug den Almemor in viele Stücke."
Zerstörungen in der Synagoge durch Blitzeinschlag im Juli 1884 -
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Juli 1884:
"Wiesenfeld (Bayern), 18. Juli (1884). Das Gewitter, das am Montag
Morgen über unsere Gegend zog, hat auch den hiesigen Platz nicht
verschont. 1/2 Stunde nach dem Frühgottesdienst schlug der Blitz in die
hiesige, vor mehreren Jahren neuerbaute Synagoge und zündete sofort.
Rasche Hilfe war in den ersten Minuten am Platze, wodurch größeres
Unglück verhütet wurde; dem Ewigen sei Dank, dass das Gewitter nicht
etwas früher kam, als die ganze Gemeinde versammelt war, und ein
unberechenbares Unglück hätte entstehen können. Der Blitz zündete ein
Dachstuhl und zerschlug den Almemor in viele Stücke." |
1929
wurde die Synagoge noch einmal umfassend renoviert. Während der Arbeiten wurde
die Gottesdienste im Wohnhaus des Hugo Stern abgehalten. Anfang Oktober 1929 war
die feierliche Wiedereinweihung der Synagoge durch Lehrer Behrendt aus
Veitshöchheim im Auftrag des Bezirksrabbiners.
 Die Wiedereinweihung der Synagoge nach der Restaurierung 1929.
Artikel in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom
15. Oktober 1929: "Wiesenfeld, 5. Oktober (1929). Dieser Tage fand
die Einweihung der in ihrem Innern völlig erneuerten Synagoge statt. In
seinem neuen Gewand macht das Gotteshaus, an und für sich ein schöner
stattlicher Bau, einen überaus schönen, harmonischen und würdigen
Eindruck. Die wohlgelungene Ausführung der Arbeiten macht dem Bauleiter, Bezirksbaumeister
Hußlein in Karlstadt, und den Ausführern alle Ehre. Eine besondere
Zierde des Gotteshauses sind der herrliche Vorhang vor der heiligen Lade
und die Decken auf dem Vorlese- und Vorbeterpult, sämtlich von Witwe
Therese Bamberger, der Mutter des Vorstandes der Kultusgemeinde
gestiftet.
Die Wiedereinweihung der Synagoge nach der Restaurierung 1929.
Artikel in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom
15. Oktober 1929: "Wiesenfeld, 5. Oktober (1929). Dieser Tage fand
die Einweihung der in ihrem Innern völlig erneuerten Synagoge statt. In
seinem neuen Gewand macht das Gotteshaus, an und für sich ein schöner
stattlicher Bau, einen überaus schönen, harmonischen und würdigen
Eindruck. Die wohlgelungene Ausführung der Arbeiten macht dem Bauleiter, Bezirksbaumeister
Hußlein in Karlstadt, und den Ausführern alle Ehre. Eine besondere
Zierde des Gotteshauses sind der herrliche Vorhang vor der heiligen Lade
und die Decken auf dem Vorlese- und Vorbeterpult, sämtlich von Witwe
Therese Bamberger, der Mutter des Vorstandes der Kultusgemeinde
gestiftet.
Die Einweihungsfeier, der auch der Pfarrer, die Lehrer und der
Bürgermeister des Ortes sowie Bezirksbaumeister Hußlein und andere
auswärtige Gäste beiwohnten, begann mit dem Einholen der Torarollen, die
unter den üblichen Umzügen und Gesängen in die heilige Lade
zurückgebracht wurden. Dann hielt der Vorstand der Kultusgemeinde
Wiesenfeld, David Bamberger, die Begrüßungsansprache, in der er der
Freude über das gelungene Werk der Wiederherstellung Ausdruck gab. dem
Bauleiter und den Bauhandwerkern für die gute Ausführung der Arbeiten,
dem Verbang Bayerischer Israelitischer Gemeinden für seinen namhaften
Zuschuss zu den Baukosten und dem Ehepaar Hugo Stern für die
bereitwillige Überlassung zweier Räume zur Abhaltung des Gottesdienstes
während der Bauzeit dankte und die Synagoge dem Schutze Gottes
anvertraute. Hierauf hielt Lehrer Behrendt aus Veitshöchheim in
Vertretung des verhinderten Bezirksrabbiners Dr. Hanover die Festrede, in
der er in gedankenreichen Ausführungen die Bedeutung des Gotteshauses
schilderte, auch den Opfersinn und die Opferfreudigkeit der kleinen
Gemeinde und die Verdienste ihres rührigen Vorstandes um das
Zustandekommen des Werkes hervorhob, worauf er dann die Wiedereinweihung
des Gotteshauses vornahm. Mit einem Schlussgesang der Lehrers Behrendt
schloss die eindrucksvolle Feier, die noch lange in den Herzen der
Mitglieder der Kultusgemeinde nachhallen wird.
Derselbe Bericht zur Wiedereinweihung der Synagoge findet sich in der
Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Oktober 1929. |
Wenige Monate vor der Schändung der Synagoge beim
Novemberpogrom 1938 konnte die jüdische Gemeinde Wiesenfeld am 27. Februar
1938 noch das 75-jährige Bestehen ihres Gotteshauses feiern. Dieses Mal war
Bezirksrabbiner Dr. Siegmund Hanover aus Würzburg anwesend.
 Feier
des 75jährigen Bestehens der Synagoge am 27. Februar 1938 - Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. März 1938:
"Wiesenfeld, 10. März. Zu einer schlichten, aber eindrucksvollen
Feier versammelten sich am Sonntag, den 27. Februar, die Mitglieder der
Kultusgemeinde Wiesenfeld anlässlich des 75jährigen Bestehens ihres
G'tteshauses. Nach Beendigung des Minchah-Gebetes verlieh Herr
Bezirksrabbiner Dr. Hanover, Würzburg, der Bedeutung des Gedenktages in
längeren Ausführungen Ausdruck. Ausgehend vom 84. Psalm, dessen tiefen
Gehalt er den Zuhörern nahe zu bringen verstand, zeichnete er die Aufgabe
eines G'tteshauses als ein Beit-Tefilah, ein Haus des Gebetes und
der Läuterung, als ein Beit-HaMidrasch, ein Haus der Belehrung und
Ermahnung und als ein Beit-Haknesset, Haus der Versammlung und
Sammlung. Er schloss mit der Bitte um Hilfe des Allmächtigen für die
Zukunft der Gemeinde. - Umrahmt war die Feier von erhebenden Gesängen des
Lehrers Lewkowitz, Laudenbach, der den Gruß und Danke der Gemeinde an
Rabbiner Dr. Hanover aussprach und zu Opfermut und Zusammenhalt
ermahnte." Feier
des 75jährigen Bestehens der Synagoge am 27. Februar 1938 - Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. März 1938:
"Wiesenfeld, 10. März. Zu einer schlichten, aber eindrucksvollen
Feier versammelten sich am Sonntag, den 27. Februar, die Mitglieder der
Kultusgemeinde Wiesenfeld anlässlich des 75jährigen Bestehens ihres
G'tteshauses. Nach Beendigung des Minchah-Gebetes verlieh Herr
Bezirksrabbiner Dr. Hanover, Würzburg, der Bedeutung des Gedenktages in
längeren Ausführungen Ausdruck. Ausgehend vom 84. Psalm, dessen tiefen
Gehalt er den Zuhörern nahe zu bringen verstand, zeichnete er die Aufgabe
eines G'tteshauses als ein Beit-Tefilah, ein Haus des Gebetes und
der Läuterung, als ein Beit-HaMidrasch, ein Haus der Belehrung und
Ermahnung und als ein Beit-Haknesset, Haus der Versammlung und
Sammlung. Er schloss mit der Bitte um Hilfe des Allmächtigen für die
Zukunft der Gemeinde. - Umrahmt war die Feier von erhebenden Gesängen des
Lehrers Lewkowitz, Laudenbach, der den Gruß und Danke der Gemeinde an
Rabbiner Dr. Hanover aussprach und zu Opfermut und Zusammenhalt
ermahnte." |
Beim Novemberpogrom 1938 wurde durch SA-Leute aus
Karlstadt unter Mithilfe von Ortsbewohnern die gesamte Inneneinrichtung der
Synagoge und die Ritualien zerstört beziehungsweise ausgeplündert. Sieben
Torarollen wurden auf der Straße verbrannt. Das Gebäude der Synagoge blieb
insgesamt erhalten, war aber durch die schlimme Schändung und die Zerstörung
der Inneneinrichtung als Gotteshaus nicht mehr benutzbar.
Mit Erlaubnis der Gestapo konnten die letzten jüdischen Familien seit
Februar 1939 ihre Gottesdienst noch in einem der jüdischen Häuser
abhalten.
Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Synagogengebäude als Schuhfabrik
zweckentfremdet.
Nach 1945 beziehungsweise nach der Abwicklung des Restitutionsverfahrens
in den 1950er-Jahren kam die ehemalige Synagoge in den Besitz eines Landwirtes,
der das Gebäude als Schuppen, Pferde- und Hühnerstall sowie als Holzlagerplatz
und Aufbewahrungsort für landwirtschaftliche
Erzeugnisse verwendete.
Im Mai 1949 fand in Würzburg ein Prozess gegen 15 der an dem Pogrom in
Wiesenfeld im November 1938 Beteiligten statt. Zehn erhielten Gefängnisstrafen
von drei Monaten bis ein einem Jahr und zwei Monaten. Fünf wurden
freigesprochen.
1961 wurde erstmals eine Abbruchgenehmigung für die Synagoge erteilt,
jedoch nicht vollzogen. Ein erneuter Abbruchantrag von 1975 wurde 1980
mit rechtskräftigem Bescheid abgelehnt. 1990 wurde Wiesenfeld in das
bayerische Dorferneuerungsprogramm aufgenommen. Auf diesem Hintergrund wurde 1993
die ehemalige Synagoge von der Stadt Karlstadt erworben. Im Rahmen der
Dorferneuerung wurde das Gebäude saniert. Seit Abschluss der Sanierung im Juli
1997 wird das Gebäude als Bürgerhaus für kulturelle Zwecke genutzt (Besichtigung über
die Stadt Karlstadt möglich, Tel. 0-9353-79020).
Adresse/Standort der Synagoge: Erlenbacher Straße
/ Schloßmannstraße).
Fotos
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum September 2006)
 |
 |
 |
| Ansichten der
restaurierten Synagoge |
| |
 |
 |
 |
| Eingangstüren
(links von der West, rechts von der Südseite) |
|
| |
|
 |
 |
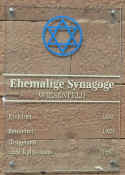 |
| Westliche Fassade |
Hinweistafeln am
Gebäude |
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| Januar 2010:
In Wiesenfeld werden "Stolpersteine"
verlegt - Abschluss der Aktion in Karlstadt und Stadtteilen |
 Links:
Plan zur Verlegung der "Stolpersteine" in Wiesenfeld. Links:
Plan zur Verlegung der "Stolpersteine" in Wiesenfeld.
Artikel in der "Main-Post" vom 21. Januar 2010 (Artikel):
"WIESENFELD - Abschluss der Stolperstein-Aktion
Der Kölner Künstler Gunter Demnig kommt am Samstag nach Wiesenfeld – Verlegung zum Gedenken an 22 jüdische Opfer.
Die letzten 22 Stolpersteine im Stadtgebiet Karlstadt wird der Künstler Gunter Demnig am Samstag, 23. Januar, ab 9 Uhr in Wiesenfeld verlegen. Der erste Verlegeort ist vor dem ehemaligen Anwesen Bertha Steigerwald am Kirchberg 6. Elke Kulawek aus Mühlbach und ihre Tochter Anna werden zum Auftakt jiddische Lieder auf Klarinette und Akkordeon spielen.
Mit der Wiesenfelder Verlegung ist die Aktion 'Stolpersteine' in Karlstadt abgeschlossen. Dieser Besuch ist bereits der dritte des Kölner Künstlers in Karlstadt. Wie berichtet, hat Demnig Mitte März 2008 die ersten 17 Stolpersteine an je vier Standorten in Karlstadt und Laudenbach verlegt. Im September folgten zwölf Steine vor neun Anwesen in Laudenbach. Nun kommen die 22 Steine an neun Standorten in Wiesenfeld dazu. Damit werden insgesamt 51 solcher Steine in Karlstadt, Laudenbach und Wiesenfeld einen Platz haben.
Georg Schnabel, Mitglied des Arbeitskreises 'Stolpersteine' unter dem Dach der Volkshochschule, hat die Geschichte der 22 jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in Wiesenfeld erforscht und überprüft. Für alle Steine sind Paten gefunden.
'Die Bereitschaft war sehr groß', erklärt Georg Schnabel. Im Vorfeld fand eine Informationsveranstaltung in der ehemaligen Synagoge in Wiesenfeld statt. Auch wurden Gespräche mit den jetzigen Hauseigentümern geführt, um das Einverständnis für die Verlegung einzuholen.
Die Messing-glänzenden Steine, die vor der letzten freigewählten Wohnung des Opfers in den Straßen- und Gehsteigbelag eingelassen werden, sollen die Erinnerung an die früheren Bewohner lebendig erhalten. Künstler Demnig fertigt einen Würfel, der mit einer Messingplatte abschließt. Darauf steht in der Regel der Schriftzug
'Hier wohnte', Name, Geburtsjahr, meist das Datum der Deportation oder des Todes. Finanziert werden die
'Stolpersteine' durch Patenschaften.
Am 23. Januar wird Gunter Demnig die 22 Steine in Wiesenfeld an folgenden Verlegeorten einlassen: Für Bertha Steigerwald am Kirchberg 6, für Mina Kahn am Kirchberg 4, für Bernhard Baumann, Selma Baumann, Marga Baumann und Julius Baumann am Kirchberg 2. Vor dem Anwesen Schätzleinsgasse 1 werden Steine an Heinemann Stern, Mathilde Stern und Flora Stern erinnern. Zum Gedenken an Max Baum, Moses Baum und Ernestine Baum werden in der Karlstadter Straße 16
'Stolpersteine' verlegt.
In der Lohrer Straße 5 liegt künftig ein Stein für Emilie Rosenberger, in der Lohrer Straße 4 werden die
'Stolpersteine' das Gedenken an David Bamberger, Jette Bamberger und Arthur Bamberger lebendig erhalten. In der Lohrer Straße 2 wird Philipp Hanauer, Sali Hanauer und Ida Hanauer gedacht, in der Eckartshofer Straße 7 an Moses Hanauer, Pauline Hanauer und Rosa Hanauer erinnert." |
| |
| Oktober/November
2010: Foto-Ausstellung in der
ehemaligen Synagoge |
Artikel in der "Main-Post" vom 17.
Oktober 2010 (Artikel):
"Mit Fotos die Erinnerung wach halten.
Wiesenfeld. (cs). Um Spurensuche und die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus ging es den beiden Fotografen Herbert Liedel und Helmut Dollhopf. Herausgekommen ist eine interessante Fotodokumentation über die (Nachkriegs-)Geschichte der Synagogen und Friedhöfe im ländlichen Franken. Ein Teil der bemerkenswerten Fotos ist vom 22. Oktober bis 7. November in der Wiesenfelder Synagoge zu sehen.
Herbert Liedel und Helmut Dollhopf haben in ihrer langzeitlichen Betrachtung den Zustand der Synagogen und Friedhöfe vor 25 Jahren mit dem heutigen Erscheinungsbild verglichen. Mit der Gegenüberstellung von Einstigem und Heutigem förderten sie Aufschlussreiches über den Umgang mit den geschichtsträchtigen Gebäuden zutage.
Auch die Synagoge in Wiesenfeld wurde in ihre Betrachtung einbezogen. Zunächst wurde diese als Pferdestall, später als Abstellraum zweckentfremdet, bevor sie umfangreich restauriert wurde und nun vom Gesangverein genutzt wird. Andere jüdische Häuser werden heute noch als Lagerräume genutzt und sind als Gotteshäuser nicht mehr zu erkennen.
Gerade durch die Gegenüberstellung der Fotos schafft es die Ausstellung, mit den Mitteln der Fotografie Geschichtsbewusstsein zu erzeugen und die Erinnerung an den Holocaust wach zu halten. Mit ihrer eindringlichen Bildsprache legen die Aufnahmen ein eigenes Zeugnis ab und regen zum Nachdenken an.
Die Ausstellung ist von Freitag, 22. Oktober, bis Sonntag, 7. November, freitags und samstags von 14 bis 18 Uhr sowie sonntags und am Montag, 1. November, von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr geöffnet.
Ergänzt wird die Ausstellung mit einem Klezmer-Konzert um 19 Uhr am Dienstag, 9. November, dem Tag der Pogrom-Nacht. In der Synagoge in Wiesenfeld wird das aus Würzburg stammende Trio
'Klez'amore' aus Würzburg in die Welt der Klezmermusik einführen und lässt mit ihr sowie jiddischen Liedern die untergegangene Welt im osteuropäischen Schtetl wieder lebendig werden. Dabei verknüpfen die Musiker mit ihrem reichen Instrumentarium die traditionellen Stücke und Tänze mit jazzigen Elementen und entwickeln sie in Richtung Swing in immer wieder überraschende Arrangements weiter.
Karten im Vorverkauf gibt es an der Stadtkasse, Zum Helfenstein 2, 97753 Karlstadt, Tel. (0 93 53) 79 02 25." |
| |
| November 2010:
Veranstaltung in der ehemaligen Synagoge zum
Gedenktafel des Novemberpogroms 1938 |
Artikel von Josef Riedmann in der "Main-Post" vom 11. November
2010 (Artikel):
"WIESENFELD. Einblick in jiddische Seele und Humor vermittelt.
Formation Klez'amore bot ein mitreißendes Konzert in der ehemaligen Synagoge in Wiesenfeld.
Am Gedenktag der Pogromnacht 1938 und zur Erinnerung an die durch den Holocaust untergegangene jüdische Volksmusiktradition veranstaltete das Kulturamt der Stadt Karlstadt in der ehemaligen Synagoge Wiesenfeld ein Konzert mit Klezmermusik und jiddischen Liedern, dargeboten von der Würzburger Formation
Klez'amore.
Das Konzert bildete auch den Abschluss der Bilderausstellung unter dem Titel
'Jerusalem lag in Franken', die über drei Wochenenden in der Synagoge zu sehen war. Die Ausstellungstafeln an den Wänden umrahmten nun nochmals die Konzertbesucher in der Synagoge.
Mit einigen Gedanken zu der wegen der zahlreichen zerstörten Fensterscheiben als Reichkristallnacht bezeichneten Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 leitete Bürgermeister Paul Kruck die Veranstaltung ein. Die von den Nationalsozialisten bewusst gesteuerten Ausschreitungen, bei denen auch die Wiesenfelder Synagoge zerstört und entweiht wurde, sei der Beginn von der Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung zur systematischen Verfolgung gewesen, so Kruck. Mit dem Auslöschen jüdischen Lebens sei auch die Kultur und die Musik der Jahrhunderte hier lebenden Juden für lange Zeit verloren gegangen. Erst seit den 70er Jahren sei über Amerika kommend die Klezmermusik auch in Deutschland wieder bekannt und populär geworden.
Die Gruppe Klez'amore pflegt die ursprünglich aus dem osteuropäischen Raum stammende Volksmusiktradition, die bei Hochzeiten und Feiern der aschkenasischen Juden gespielt wurde. Über Jahrhunderte durch zahlreiche Strömungen beeinflusst wird die Klezmermusik bis heute weiterentwickelt. Auch die Instrumentalformation Klez'amore aus Würzburg mit Ernst-Martin Eras an der Oboe, Armin Höfig an der Gitarre und Stefan Kraneburg am Kontrabass bearbeitet selbst ihr Repertoire, und die Musiker verknüpfen die traditionellen Stücke und Tänze mit jazzigen Einlagen und Swingelementen.
Die von der Gruppe Klez'amore aufgeführten Stücke bestechen durch überaus melodiöse Folgen, die an den menschlichen Gesang erinnern. Liedhaft schmeichelnde Passagen steigern sich zu stakkatoartigen Einwürfen, Tempi variieren mehrfach innerhalb eines Stückes, von langsam getragen bis zu atemberaubend schnellen Tonfolgen. Orientalisch klingende Weisen oder auch Anklänge der Zigeunermusik der Roma sind herauszuhören. Die Stücke scheinen Leben in sich zu haben, sie erzählen förmlich eine Geschichte. Auf dem Programm standen auch Instrumentalstücke mit liturgischem Charakter wie
'Shalom Alechem' mit einer an Gesang erinnernden Melodie, denen meist ein Psalmtext als Thema zu Grunde liegt.
Beeindruckend dargeboten wurden die zahlreichen Hochzeitstänze, die vor Lebensfreude sprühen, meist eine melancholische, an menschliche Verzweiflung erinnernde Passage enthalten, aber dann wieder im Tempo steigen und die Begeisterung ausgelassener Tänzer förmlich spüren lassen.
'The Klezmer Freilach' ist auch im Repertoire des Argentiniers Giora Feidman enthalten, der als einer der populärsten Vertreter der Klezmermusik in Deutschland gilt. Der Freilach, ein fröhliches Stückchen, ist ein Tanz im Zweivierteltakt.
Die drei Interpreten von Klez'amore führten die Konzertbesucher in die Thematik der Klezmermusik ein und erläuterten die Besonderheiten der Stücke. Das Konzertprogramm vermittelte ein stimmiges Bild der Vielfalt der Klezmermusik. Mit sichtlicher Spielfreude und Humor boten sie ihr Repertoire dar. Den Melodiepart übernahm der ausgebildete Oboist Eras, der die schnellen Läufe, die schwierigen Sprünge in den Tonlagen souverän meisterte, gleichzeitig die melodiösen Teile ausdrucksstark interpretierte. Höfig und Kraneburg untermalten die Melodien ihres Kollegen mit routiniertem Gitarrenspiel beziehungsweise mitreißendem Zupfbassspiel.
Bürgermeister Kruck meinte in seinen Schlussworten, 'wir haben drei Meister an ihren Instrumenten erlebt, die uns einen Einblick die jiddische Seele, den Humor und die Kultur der Landjuden vermittelt
haben'." |
| |
|
September 2022:
Nachfahren aus Schweden auf
Spurensuche in Wiesenfeld |
Aus einem Artikel von Wolfgang Dehm in der
"Main-Post" vom 23. September 2022: "Wiesenfeld. Nachfahren aus Schweden
auf Joseph Schloßmanns Spuren in Wiesenfeld.
Im Jahr 1860 wurde der Jude Joseph Schloßmann in Wiesenfeld geboren. Am
Mittwoch besuchte seine in Schweden lebende Urenkelin Maude Schlossmann, die
eigens zur Übergabe des 'Schloßmannblicks' in Sendelbach angereist waren, in
Begleitung ihres Mannes Gösta Kärlin und ihrer Nichte Suzanne Sederowsky den
Geburtsort ihres Urgroßvaters. Dass sie sich Schlossmann schreibt, liegt
daran, dass es in Schweden kein 'ß' gibt. Arrangiert hat das Treffen der
Vorsitzende des Lohrer Geschichtsvereins, Wolfgang Vorwerk.
Vor Ort begrüßte Stadtrat Theo Dittmaier die Gäste aus Schweden sowie einige
Vertreter des Lohrer Geschichtsvereins, mehrere Wiesenfelder und Karlstadts
Bürgermeister Michael Hombach. Dorfchronist Hermann Schaub führte die
Besuchergruppe durch den Ort, wobei er schwerpunktmäßig auf die in früheren
Zeiten in Wiesenfeld lebenden Juden und ihre Gebäude einging. Vorwerk
übersetzte für die schwedischen Gäste ins Englische...
Beim Rundgang durch Wiesenfeld zeigte Schaub der Besuchergruppe nicht nur
die Synagoge, sondern viele weitere Spuren ehemaligen jüdischen Lebens im
Ort, wie beispielsweise das frühere jüdische Lehrerwohnhaus, das Ritualbad,
das heute eine Garage ist sowie verschiedene 'Stolpersteine', von denen es
in Wiesenfeld 22 gibt. Natürlich führte Schaub seine Gäste auch an die
Stelle an der Schloßmannsgasse, wo einst das Haus stand, in dem Joseph
Schloßmann geboren wurde; das Geburtshaus selbst existiert nicht mehr, es
wurde durch einen Neubau ersetzt..."
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 429-430. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 128. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 471-472. |
 |  Leonhard Scherg: Jüdisches
Leben im Main-Spessart-Kreis. Reihe: Orte, Schauplätze, Spuren. Verlag
Medien und Dialog. Haigerloch 2000 (mit weiterer Literatur). Zu Wiesenfeld
S. 27-29. Leonhard Scherg: Jüdisches
Leben im Main-Spessart-Kreis. Reihe: Orte, Schauplätze, Spuren. Verlag
Medien und Dialog. Haigerloch 2000 (mit weiterer Literatur). Zu Wiesenfeld
S. 27-29. |
 | Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen
Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche
Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.
Würzburg 2008. S. 173-174. |
 |  "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Teilband
III: Unterfranken, Teil 1.
Erarbeitet von Axel Töllner, Cornelia Berger-Dittscheid,
Hans-Christof Haas und Hans Schlumberger. Hg.
von Wolfgang Kraus, Hans-Christoph Dittscheid und Gury Schneider-Ludorff
in Verbindung mit Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern. 1. Auflage 2015. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im
Allgäu (mit umfassenden Quellen- und
Literaturangaben) "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Teilband
III: Unterfranken, Teil 1.
Erarbeitet von Axel Töllner, Cornelia Berger-Dittscheid,
Hans-Christof Haas und Hans Schlumberger. Hg.
von Wolfgang Kraus, Hans-Christoph Dittscheid und Gury Schneider-Ludorff
in Verbindung mit Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern. 1. Auflage 2015. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im
Allgäu (mit umfassenden Quellen- und
Literaturangaben)
ISBN 978-3-89870-449-6.
Hinweis: die Forschungsergebnisse dieser Publikation wurden in dieser Seite
von "Alemannia Judaica" noch nicht eingearbeitet.
Abschnitt zu Wiesenfeld S. 359-381.
|
 | The Hanauer Family. Before, During and After the
Holocaust. 3rd Edition. 232 S. 2018. Die
Publikation ist als ppt-Datei downloadbar (ca. 95 MB).
Anmerkung: in der Publikation findet sich ein Beitrag über die
"Hanauers Of Wiesenfeld" p. 10-p. 22. Erstmals ist Abraham
[Hanauer] in Wiesenfeld genannt; er ist hier etwa 1727 geboren und war der
Vater von Moses Hanauer, geb. 1757. Dessen Sohn wiederum war der in der
Matrikelliste von 1817 (siehe oben) genannte Abraham Moses Hanauer (geb.
1783 in Wiesenfeld). |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Wiesenfeld Lower Franconia.
A Jewish community is known from the mid-17th century. The Jewish population
declined from 160 in 1837 to 66 in 1900 (total 1.092) after many left for nearby
Karlstadt in the last third of the 19th century. In 1933, 55 Jews remained. On Kristallnacht
(9-10 November 1938), the synagogue and Jewish homes were vandalized and Jews
arrested and held for six weeks. In 1933-40, 23 Jews emigrated, including 14 to
the United States. Of the 25 remaining in 1942, mostly aged 50-70, 19 were
deported to Izbica in the Lublin district (Poland) via Wuerzburg on 24 April and
six to Theresienstadt ghetto in September.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|