|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"
Werneck (Marktgemeinde,
Kreis Schweinfurt)
mit Orten der unmittelbaren Umgebung (heute Ortsteile von Werneck)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Werneck bestand eine jüdische Gemeinde bis zu ihrer Auflösung
im November 1904. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17. Jahrhunderts
zurück. 1677 werden in Werneck die drei jüdischen Familien des Simon,
Abraham und Löw genannt (erster Nachweis).
Im 17./18. Jahrhundert waren durchschnittlich vier bis fünf jüdische
Familien in der Marktgemeinde: 1699 vier Familien (Familien des Joseph, Amsell,
Jacob und Joseph, zusammen mit Frauen, Kindern und Dienstknechten/-boten 26
Personen), 1725 fünf Familien (des Joseph, Jacob alt, Jacob jung, David und
Samuel), 1731 vier, 1746 drei, 1763 vier, 1803 sechs Familien (mit zusammen 28
Personen).
Auch in den heute zur Marktgemeinde Werneck gehörenden Orten Ettleben,
Schraudenbach, Vasbühl
und Zeuzleben lassen sich im 17./18.
Jahrhundert einzelne oder auch mehrere jüdische Personen / Familien nachweisen.
Der älteste Nachweis über Juden im Raum Werneck dürfte aus Schraudenbach
vorliegen, wo 1677/78 Moysed Judt genannt wird, der sich bereits "viele
Jahre" am Ort aufgehalten und 1678 hier ein Haus gekauft hat. Zur
selben Zeit werden genannt: in Zeuzleben Jud Sand (Sander). 1699 leben in
Ettleben Jud Jacob mit seiner Familie, in Schraudenbach die Juden Isacc und
Moyses mit ihren Familien. 1725 sind es in Schraudenbach die Familien des
Pfeufer und Löser, in Ettleben die des Jacob und Michael. 1763 werden
genannt: in Ettleben Moyses Aaron, in Schraudenbach Faust und Wolf Löser, in
Vasbühl Jacob und Meyer.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1817 sieben jüdische Familien (mit 29 Personen), 1839 39 jüdische
Einwohner (10 % der Einwohnerschaft), 1861 sieben Familien, 1871 sieben Familien
(52 jüdische Einwohner, 9,1 % der Einwohnerschaft). Die jüdischen Gewerbetreibenden lebten vom Handel mit Waren und Vieh. Die 1814
beziehungsweise bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 genannten jüdischen Familien waren
vermutlich* Löb Weglein (Warenhändler, gestorben
April 1851), Itzig Kleemann (geb. 1753, Viehhändler, verheiratet, sechs
Kinder), die Brüder Isaak und Lazarus Kleemann (1826/31 als Viehhändler
genannt; Lazarus Kleemann starb 1870/71), die Witwe von Moses Aron Weglein (Warenhandel, vermutlich Mutter von
Moses Weglein), Itzig Federlein (Warenhandel, verheiratet), Berla, die Witwe von
Anschel Moses Friedlich (Hausierhandel), Joel Weglein (verheiratet, zwei
Kinder).
*Die Matrikelliste für Werneck ist abhanden gekommen. Rosenstock
rekonstruierte die Liste aus den jüdischen Familienregistern (Hinweis von E.
Böhrer).
Weitere detaillierte Angaben zu allen jüdischen Familien des 19./20.
Jahrhunderts siehe in der Publikation von Manfred Fuchs (s.Lit.).
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge
(s.u.), eine Religionsschule und ein rituelles Bad. Das Bad stand einige
Meter links der Synagoge unmittelbar neben dem "alten Werngraben". Das
Badhäuschen wurde im 20. Jahrhundert noch als Werkstatt und Ablage benutzt und
1976/77 abgebrochen. Die Toten der jüdischen Gemeinde wurden im jüdischen
Friedhof in Schwanfeld beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war zeitweise ein
Lehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (siehe unten:
Ausschreibung der Stelle 1845). Von Bedeutung - auch überregional als Gründer
und Förderer des bayerischen Landeslehrervereins und in seinem Engagement für
die jüdischen Insassen der "Landesirrenanstalt" (Heil- und
Pflegeanstalt) in Werneck und des jüdischen Hospitals in Würzburg - war der 28
Jahre lang in Werneck tätige Lehrer Elieser J. Roos (siehe Beitrag zu
seinem Tod 1907 unten).
In der 1855 im Schloss Werneck Heil- und Pflegeanstalt waren bis zum
Anfang des 20. Jahrhunderts auch jüdische Patienten untergebracht. Nach
Gründung des "Fürsorgevereins für israelitische Nerven- und
Geisteskranke" (1915) wurden diese jedoch in die Anstalt in Lohr
überführt, damit dort durch den Verein u.a. eine zentrale Versorgung mit
koscherer Verpflegung ermöglicht werden konnte.
Auch wenn nach Auflösung der Gemeinde 1904 nur noch wenige jüdische Personen
in Werneck lebten, sind von den in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am
Ort geborenen jüdischen Personen aus anderen Orten mehrere deportiert worden:
Von den in Werneck geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Johanna Heinemann geb. Adler (1887), Fanny
Kleemann (1862), Gustav (Gdalja) Sim Kleemann (1881), Max Kleemann (1887), Simon
Kleemann (1864), Jenny Levi geb. Kleemann (1871), Hermine (Nina) Maier geb.
Kleemann (1886), Jacob Roos (1873), Sara Thalheimer geb. Kleemann (1865),
Jeanette Ullmann geb. Kleemann (1857), Josef Weglein (1867), Mina Wiesengrund
geb. Kleemann (1854).
Zur Biographie von Max Kleemann siehe Seite
zu den "Stolpersteinen" in Würzburg.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Wolf Aron Kohn sucht einen jüdischen Lehrer (1845)
 Anzeige in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Februar 1845: "Avertissement.
Zu drei Knaben wird auf künftige Ostern ein geprüfter Elementar- und
Religionslehrer gesucht. Unterrichtsfähigkeit in französischer oder
englischer Sprache wird dabei gewünscht. Nähere Auskunft auf frankierte
Anmeldungen gibt W. A. Kohn in Werneck bei Schweinfurt." Anzeige in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Februar 1845: "Avertissement.
Zu drei Knaben wird auf künftige Ostern ein geprüfter Elementar- und
Religionslehrer gesucht. Unterrichtsfähigkeit in französischer oder
englischer Sprache wird dabei gewünscht. Nähere Auskunft auf frankierte
Anmeldungen gibt W. A. Kohn in Werneck bei Schweinfurt."
|
Dem "Schuldienst-Exspektanten" Nathan
Friedenhain in Werneck wird die Religionslehrer- und Vorsängerstelle in
Gnodstadt übertragen (1867)
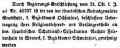 Anzeige im "Königlich Bayerischen Kreis-Amtsblatt von
Unterfranken und Aschaffenburg" vom 6. November 1867:
"Durch Regierungs-Entschließung vom 31. Oktober laufenden Jahres ad
Nr. 40707 ist die von der israelitischen Kultusgemeinde Gnodstadt,
königlichen Bezirksamts Ochsenfurt, beschlossene Übertragung ihrer
Religionslehrer- und Vorsängerstelle an den israelitischen
Schuldienst-Exspektanten Nathan Friedenhain in Werneck,
königlichen Bezirksamts Schweinfurt, genehmigt
worden."
Anzeige im "Königlich Bayerischen Kreis-Amtsblatt von
Unterfranken und Aschaffenburg" vom 6. November 1867:
"Durch Regierungs-Entschließung vom 31. Oktober laufenden Jahres ad
Nr. 40707 ist die von der israelitischen Kultusgemeinde Gnodstadt,
königlichen Bezirksamts Ochsenfurt, beschlossene Übertragung ihrer
Religionslehrer- und Vorsängerstelle an den israelitischen
Schuldienst-Exspektanten Nathan Friedenhain in Werneck,
königlichen Bezirksamts Schweinfurt, genehmigt
worden." |
Zum Tod von Elieser Roos - 28 Jahre jüdischer Lehrer in Werneck
(1907)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Januar 1907: "Frankfurt am Main,
30. Januar (1907). Ein Mann von seltenem Werte, ein Talmid Chacham (Gelehrter)
in der tiefsten Bedeutung des Wortes ist uns entrissen worden: Elieser
Roos, der Sohn des weit bekannten Sekretärs der Pekidim in Amsterdam,
Rabbi Jakob Roos – das Andenken an den Gerechten ist zum Segen – hat
am 11. Schwat das Zeitliche gesegnet. In Amsterdam geboren, war es dem
Heimgegangenen vergönnt, zu den Füßen der Größten seiner Zeit.
Rabbiner Jakob Ettlingers und Rabbiner Israel Hildesheimer zum wahrhaften
‚Schüler der Weisen’ zu reifen, und als ein lebendiges Exempel auf
die Weisheit und Charaktergröße zeitigende Macht der jüdischen Lehre
hat sich Elieser Roos in einem geräuschlosen und doch reich gesegneten
Leben bewährt. Achtundzwanzig Jahre hat er in einem bayerischen Landstädtchen,
in Werneck, als Lehrer gewirkt, in seiner Gemeinde nicht nur, sondern darüber
hinaus im Kreise seiner Kollegen ein Mittelpunkt lebendigen geistigen
Strebens, Gründer und Förderer des bayerischen Landeslehrervereins, der
eigentliche Schöpfer des jüdischen Hospitals in Würzburg, vor allem
aber Vater eines jüdischen Hauses, in dem die Menschenliebe in Person ihre Stätte genommen zu haben schien. Die Unglücklichsten aller Unglücklichen,
die jüdischen Insassen der Landesirrenanstalt in Werneck, wissen davon zu
erzählen. In der Atmosphäre seines Hauses sind unter der Obhut einer des
Gatten würdigen Mutter dem Heimgegangenen Söhne und Töchter
herangewachsen, die es im Leben verstanden haben, des Vaters Ideale
weiterzutragen. Um ihnen nahe zu sein, zog der Heimgegangene vor acht
Jahren hierher nach Frankfurt, wo er in dem gleich gesinnten Kreise der
Israelitischen Religionsgesellschaft als einer der besten und
hervorragendsten Träger echten Torageistes geliebt und geehrt ward. Nun
ist er, nach einer glücklich gelungenen Operation, im Begriffe, geheilt
in sein Heim zurückzukehren, plötzlich abberufen worden. An seiner Bahre
kennzeichnete Herr Rabbiner Dr. Breuer in ergreifenden Worten die
Bedeutung des Heimgegangenen als Sohn der Tora, als Charakter, als einen
aus dem Kreise der auserwählten Frommen (?), deren leider bei uns
immer weniger werden. Herr Rektor Falk widmete namens des bayerischen
Landeslehrervereins Worte der Verehrung und des Dankes.
Seine Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Januar 1907: "Frankfurt am Main,
30. Januar (1907). Ein Mann von seltenem Werte, ein Talmid Chacham (Gelehrter)
in der tiefsten Bedeutung des Wortes ist uns entrissen worden: Elieser
Roos, der Sohn des weit bekannten Sekretärs der Pekidim in Amsterdam,
Rabbi Jakob Roos – das Andenken an den Gerechten ist zum Segen – hat
am 11. Schwat das Zeitliche gesegnet. In Amsterdam geboren, war es dem
Heimgegangenen vergönnt, zu den Füßen der Größten seiner Zeit.
Rabbiner Jakob Ettlingers und Rabbiner Israel Hildesheimer zum wahrhaften
‚Schüler der Weisen’ zu reifen, und als ein lebendiges Exempel auf
die Weisheit und Charaktergröße zeitigende Macht der jüdischen Lehre
hat sich Elieser Roos in einem geräuschlosen und doch reich gesegneten
Leben bewährt. Achtundzwanzig Jahre hat er in einem bayerischen Landstädtchen,
in Werneck, als Lehrer gewirkt, in seiner Gemeinde nicht nur, sondern darüber
hinaus im Kreise seiner Kollegen ein Mittelpunkt lebendigen geistigen
Strebens, Gründer und Förderer des bayerischen Landeslehrervereins, der
eigentliche Schöpfer des jüdischen Hospitals in Würzburg, vor allem
aber Vater eines jüdischen Hauses, in dem die Menschenliebe in Person ihre Stätte genommen zu haben schien. Die Unglücklichsten aller Unglücklichen,
die jüdischen Insassen der Landesirrenanstalt in Werneck, wissen davon zu
erzählen. In der Atmosphäre seines Hauses sind unter der Obhut einer des
Gatten würdigen Mutter dem Heimgegangenen Söhne und Töchter
herangewachsen, die es im Leben verstanden haben, des Vaters Ideale
weiterzutragen. Um ihnen nahe zu sein, zog der Heimgegangene vor acht
Jahren hierher nach Frankfurt, wo er in dem gleich gesinnten Kreise der
Israelitischen Religionsgesellschaft als einer der besten und
hervorragendsten Träger echten Torageistes geliebt und geehrt ward. Nun
ist er, nach einer glücklich gelungenen Operation, im Begriffe, geheilt
in sein Heim zurückzukehren, plötzlich abberufen worden. An seiner Bahre
kennzeichnete Herr Rabbiner Dr. Breuer in ergreifenden Worten die
Bedeutung des Heimgegangenen als Sohn der Tora, als Charakter, als einen
aus dem Kreise der auserwählten Frommen (?), deren leider bei uns
immer weniger werden. Herr Rektor Falk widmete namens des bayerischen
Landeslehrervereins Worte der Verehrung und des Dankes.
Seine Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens." |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Judenfreundliche Gesinnung eines
Landrichters (1869)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Dezember 1869: "Werneck
(Bayern), Ende November (1869). Bei der jüngsten Landtagswahl redete Herr
Landrichter Fuller die israelitischen Wähler mit folgenden Worten an
(hebräisch und deutsch): 'Auch wenn Berge und Hügel wanken, wird
meine Liebe und mein Bund von euch nicht weichen.' (Zitat aus Jesaja
54,10). Der Herr Landrichter sprach diese Worte hebräisch, ohne die
Übersetzung beizufügen. Dieser gelehrte Mann, welcher fünf fremde
Sprachen geläufig spricht, zeichnet sich ebenso durch seine
Gerechtigkeit, seine Humanität, durch seine Menschenfreundlichkeit und
Wohltätigkeit aus. Er wird daher in unserer ganzen Gegend ebenso geliebt
wie geachtet. Namentlich sind ihm die Israeliten in inniger Liebe und
Verehrung zugetan." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Dezember 1869: "Werneck
(Bayern), Ende November (1869). Bei der jüngsten Landtagswahl redete Herr
Landrichter Fuller die israelitischen Wähler mit folgenden Worten an
(hebräisch und deutsch): 'Auch wenn Berge und Hügel wanken, wird
meine Liebe und mein Bund von euch nicht weichen.' (Zitat aus Jesaja
54,10). Der Herr Landrichter sprach diese Worte hebräisch, ohne die
Übersetzung beizufügen. Dieser gelehrte Mann, welcher fünf fremde
Sprachen geläufig spricht, zeichnet sich ebenso durch seine
Gerechtigkeit, seine Humanität, durch seine Menschenfreundlichkeit und
Wohltätigkeit aus. Er wird daher in unserer ganzen Gegend ebenso geliebt
wie geachtet. Namentlich sind ihm die Israeliten in inniger Liebe und
Verehrung zugetan." |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Die Verdienste des Kaufmannes Wolf Aron Kohn beim Aufbau einer
Distrikts-Sparkasse in Werneck 1839-1843
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. Mai 1843: "Ehren-Lohn.
Im Bezirke des königlichen Landgerichts Werneck wurde zu Anfang des
Jahres 1839 eine Distrikts-Sparkasse gegründet, welche ohne weitere
Fonds, als welche die Einlagen und der Kredit des haftenden Bezirkes
darboten, in der erfreulichsten Weise ihre Wirksamkeit entfaltete, und am
Schlusse des vorigen Jahres mit einem Einlagenkapitale von 26.903 Gulden 9
Kreuzer, dann mit einem Aktivstande von 27.611 Gulden 11 Kreuzer, sonach
mit einem Aktiv-Überschusse von 708 Gulden 2 Kreuzer abschloss. Diesen
erfreulichen Stand der wohltätigen Anstalt verdankte das Landgericht
vorzugsweise – einem Juden, nämlich dem israelitischen Kaufmanne Wolf
Aron Kohn in Werneck, welcher bei Einführung der Sparkasse von Seite der
Plenarversammlung des Distrikts-Armen-Pflegschaftsrates auf ihn als
Kassierer gefallene Wahl ohne alle Vergütung, bloß zur Förderung der
guten Sache, auf drei Jahre annahm, und während dieser Periode seine
Stelle mit der größten Sorgfalt, Pünktlichkeit und Uneigennützigkeit
versah, und außer der Mühe und Sorge auch vielfältige Störungen seines
Handelsgeschäftes zum Opfer brachte. Nach Verlauf der drei Jahre wurde
dem Kassierer Kohn ein angemessenes Honorar für die Verwaltung, wenn er
zu deren Fortführung sich verstehe, angeboten, er lehnte aber jede Vergütung
ab, und übernahm unentgeltlich noch für ein weiteres Jahr die in gleich
rühmlicher Weise fortgeführte Verwaltung. Diesem Ehrenmann wurde der
alljährliche Dank der Plenarversammlung des Bezirkes und die rühmlichste
Anerkennung von Seite der Bezirksobrigkeit und der vorgesetzten königlichen
Kreisregierung zu Teil, und jetzt wo er nach vier
Jahren treuen und uneigennützigen Wirkens mit dem erwähnten günstigen
Resultate die Kassaverwaltung in andere Hände übergab, gebührt ihm auch
die öffentliche dankbare Anerkennung, welche der unterzeichnete Vorstand
der Sparkasse-Anstalt hiermit auszusprechen, für Pflicht hält. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. Mai 1843: "Ehren-Lohn.
Im Bezirke des königlichen Landgerichts Werneck wurde zu Anfang des
Jahres 1839 eine Distrikts-Sparkasse gegründet, welche ohne weitere
Fonds, als welche die Einlagen und der Kredit des haftenden Bezirkes
darboten, in der erfreulichsten Weise ihre Wirksamkeit entfaltete, und am
Schlusse des vorigen Jahres mit einem Einlagenkapitale von 26.903 Gulden 9
Kreuzer, dann mit einem Aktivstande von 27.611 Gulden 11 Kreuzer, sonach
mit einem Aktiv-Überschusse von 708 Gulden 2 Kreuzer abschloss. Diesen
erfreulichen Stand der wohltätigen Anstalt verdankte das Landgericht
vorzugsweise – einem Juden, nämlich dem israelitischen Kaufmanne Wolf
Aron Kohn in Werneck, welcher bei Einführung der Sparkasse von Seite der
Plenarversammlung des Distrikts-Armen-Pflegschaftsrates auf ihn als
Kassierer gefallene Wahl ohne alle Vergütung, bloß zur Förderung der
guten Sache, auf drei Jahre annahm, und während dieser Periode seine
Stelle mit der größten Sorgfalt, Pünktlichkeit und Uneigennützigkeit
versah, und außer der Mühe und Sorge auch vielfältige Störungen seines
Handelsgeschäftes zum Opfer brachte. Nach Verlauf der drei Jahre wurde
dem Kassierer Kohn ein angemessenes Honorar für die Verwaltung, wenn er
zu deren Fortführung sich verstehe, angeboten, er lehnte aber jede Vergütung
ab, und übernahm unentgeltlich noch für ein weiteres Jahr die in gleich
rühmlicher Weise fortgeführte Verwaltung. Diesem Ehrenmann wurde der
alljährliche Dank der Plenarversammlung des Bezirkes und die rühmlichste
Anerkennung von Seite der Bezirksobrigkeit und der vorgesetzten königlichen
Kreisregierung zu Teil, und jetzt wo er nach vier
Jahren treuen und uneigennützigen Wirkens mit dem erwähnten günstigen
Resultate die Kassaverwaltung in andere Hände übergab, gebührt ihm auch
die öffentliche dankbare Anerkennung, welche der unterzeichnete Vorstand
der Sparkasse-Anstalt hiermit auszusprechen, für Pflicht hält.
Werneck in Unterfranken am 4. Mai 1843. Ihl, königliche
bayerischer Landrichter." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Frau N. Friedenhain vertriebt Weine aus dem Heiligen
Land (1872)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1872: "Koscherer
Wein zu Pessach aus der Heiligen Stadt Jerusalem - sie möge gebaut und
errichtet werden -. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1872: "Koscherer
Wein zu Pessach aus der Heiligen Stadt Jerusalem - sie möge gebaut und
errichtet werden -.
Da die Weinlese in ganz Deutschland dieses Jahr missglückte, wurden
mir von Jerusalem einige Fässer Wein zum Verkauf zugeschickt, welche
unter Aufsicht der Mitglieder des Rabbinatsgerichtes unserer Gemeinde
angestochen und in Flaschen abgelassen werden. Jede einzelne Falsche ist
mit dem Siegel der hiesigen Mitglieder des Rabbinatsgerichtes
versehen. Damit jeder, der Gewicht darauf legt, die Weisungen zu
erfüllen und vier Becher mit gutem Wein und noch dazu von den
Früchten des Heiligen Landes sich denselben anschaffen kann, habe ich
den Preis pro Flasche bloß auf 1 Gulden festgestellt. In Anbetracht, dass
die Zeit bis Pessach kurz ist, wird jeder gebeten, seine
Bestellungen portofrei bald möglichst per Adresse A.J. Roos jr.
Amsterdam, Papenburgerstraat V,433 zu machen. Ferner nehmen Bestellungen
entgegen die Herren J. Kaufmann, Buchhändler, Frankfurt am Main und
Salomon Levy, Weinhändler, Peterstraße 25, Hamburg und Frau N.
Friedenhain in Werneck, Bayern).
(Der Unterzeichnete bezeugt auf Verlangen, dass ihm das Koscher-Zertifikat
des rühmlichst bekannten Rabbiner Mayer Auerbach - sein Licht leuchte,
Oberhaupt des Rabbinatsgerichtes in der heiligen Stadt Jerusalem - sie
möge gebaut und errichtet werden, schnell, in unseren Tagen - in
Abschrift vorliegt). Dr. Lehmann." |
Über
die Betreuung der jüdischen Patienten der Anstalt Werneck
Diskussion um die Einführung einer koscheren Küche und
die seelsorgerliche Betreuung der jüdischen Patienten in der
Anstalt Werneck für die dortigen jüdischen Patienten (1877)
In Werneck wurde 1853/55 das barocke Schloss zu einer Heil- und Pflegeanstalt für
psychisch Kranken umgebaut. Am 1. Oktober 1855 konnte die Heil- und
Pflegeanstalt unter ihrem ersten Direktor Dr. Bernhard von Gudden ihre Arbeit
aufnehmen. Damit ist Werneck Sitz eine der ältesten psychiatrischen Klinken
Deutschlands. 1940 wurden die rund 800 Patienten der Heil- und Pflegeanstalt im
Rahmen der "Euthanasie"-Aktionen der NS-Zeit ermordet. Heute ist die
Psychiatrische Klinik in einem modernen Neubau untergebracht. Im Schloss
befindet sich eine Orthopädische Fachklinik.
1877 erschien in der Zeitschrift "Der Israelit" ein Artikel, in dem
die Frage nach der Einrichtung einer koscheren Küche und die seelsorgerliche
Betreuung der jüdischen
Patientinnen und Patienten der Heil- und Pflegeanstalt diskutiert wurde:
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1877: "Werneck. Ich komme nun
zur Besprechung des von Herrn Rosenbaum gemachten Vorschlages, ‚eine Küche
mit koscherer Einrichtung in der Anstalt zu Werneck zu errichten’. Die
Erlaubnis hierzu, glaubt Herr Rosenbaum, ‚dürfte bei der allgemein
anerkannten humanen Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg zu
erlangen sein und zwar umso mehr, als der Herr Direktor der Anstalt
Werneck die Zweckmäßigkeit einer solche Einrichtung hoffentlich
begutachten wird usw.’. Von der Humanität des Direktoriums der hiesigen
Anstalt hatte ich oft Gelegenheit, mich persönlich zu überzeugen und
auch der jüngste Pessach (Pessachfest) lieferte mir neue Beweise davon.
Wenn ein nichtjüdisches Direktorium für seine jüdischen Insassen sich
Mazzot (Mazzen) kommen lässt, wenn es ferner sein Wärterpersonal gerne
zur Begleitung einzelner jüdischer Kranken in die Synagoge und in die
Privathäuser, in welch’ letztere jene Kranken während des Pesachfestes
die koschere Kost bekamen, zur Verfügung stellt, so kann es wohl keinem
Zweifel unterliegen, dass ein solches Direktorium es im vollsten Maße
verdient, human genannt zu werden. Jedoch die Humanität der
Kreis-Regierung in dieser Beziehung müsste mir erst erweisen werden, wenn
ich darauf Projekte bauen soll. Während für die Angehörigen
katholischer und protestantischer Konfession je ein Geistlicher von der
Kreisregierung in der Anstalt angestellt ist und von ihr ihre Besoldung
erhalten, geschieht, trotzdem die hiesige Kultusgemeinde stets im Besitze
eines Religionslehrers war und ist und die Funktion eines jüdischen
Geistlichen für die Anstalt leicht mit dieser Stelle in Verbindung zu
bringen wäre, für die Seelsorge der jüdischen Kranken gar nichts. Ich
verweise auf das Kreisamtsblatt pro 76 Nr. 149 Seite 30, Absatz 8, wo es
heißt: ‚Von den Einnahmsposten wurde hiernach nur noch der Betrag von
Mark 394 97 Pfennig Zuschuss aus der Pfarrunterstützungskasse in Nürnberg
für den protestantischen Hausgeistlichen beanstandet. Auf Antrage des
Ausschusses usw. wurde auf diesen Zuschuss verzichtet, da die
Kirchenkollekte für den protestantischen Hausgeistlichen in Werneck, weil
für einen Kreisbeamten bestimmt, allenthalben und mit Recht sehr
unbeliebt sei, und bei ihrer Beseitigung ein reicheren Zufluss aus der jährlichen
Hauskollekte für arme Irre zu erwarten stehe.’ Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1877: "Werneck. Ich komme nun
zur Besprechung des von Herrn Rosenbaum gemachten Vorschlages, ‚eine Küche
mit koscherer Einrichtung in der Anstalt zu Werneck zu errichten’. Die
Erlaubnis hierzu, glaubt Herr Rosenbaum, ‚dürfte bei der allgemein
anerkannten humanen Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg zu
erlangen sein und zwar umso mehr, als der Herr Direktor der Anstalt
Werneck die Zweckmäßigkeit einer solche Einrichtung hoffentlich
begutachten wird usw.’. Von der Humanität des Direktoriums der hiesigen
Anstalt hatte ich oft Gelegenheit, mich persönlich zu überzeugen und
auch der jüngste Pessach (Pessachfest) lieferte mir neue Beweise davon.
Wenn ein nichtjüdisches Direktorium für seine jüdischen Insassen sich
Mazzot (Mazzen) kommen lässt, wenn es ferner sein Wärterpersonal gerne
zur Begleitung einzelner jüdischer Kranken in die Synagoge und in die
Privathäuser, in welch’ letztere jene Kranken während des Pesachfestes
die koschere Kost bekamen, zur Verfügung stellt, so kann es wohl keinem
Zweifel unterliegen, dass ein solches Direktorium es im vollsten Maße
verdient, human genannt zu werden. Jedoch die Humanität der
Kreis-Regierung in dieser Beziehung müsste mir erst erweisen werden, wenn
ich darauf Projekte bauen soll. Während für die Angehörigen
katholischer und protestantischer Konfession je ein Geistlicher von der
Kreisregierung in der Anstalt angestellt ist und von ihr ihre Besoldung
erhalten, geschieht, trotzdem die hiesige Kultusgemeinde stets im Besitze
eines Religionslehrers war und ist und die Funktion eines jüdischen
Geistlichen für die Anstalt leicht mit dieser Stelle in Verbindung zu
bringen wäre, für die Seelsorge der jüdischen Kranken gar nichts. Ich
verweise auf das Kreisamtsblatt pro 76 Nr. 149 Seite 30, Absatz 8, wo es
heißt: ‚Von den Einnahmsposten wurde hiernach nur noch der Betrag von
Mark 394 97 Pfennig Zuschuss aus der Pfarrunterstützungskasse in Nürnberg
für den protestantischen Hausgeistlichen beanstandet. Auf Antrage des
Ausschusses usw. wurde auf diesen Zuschuss verzichtet, da die
Kirchenkollekte für den protestantischen Hausgeistlichen in Werneck, weil
für einen Kreisbeamten bestimmt, allenthalben und mit Recht sehr
unbeliebt sei, und bei ihrer Beseitigung ein reicheren Zufluss aus der jährlichen
Hauskollekte für arme Irre zu erwarten stehe.’
Deutlich ist aus obiger Stelle ersichtlich, dass auch der protestantische
Geistliche, trotzdem die katholische Konfession hier vorherrschend und die
protestantische die Minorität bildet, nunmehr gänzlich von der
Kreis-Regierung besoldet wird. Und fragen wir uns, warum geschieht denn für
unsere jüdischen Glaubensgenossen in dieser Beziehung gar nichts, bildet
sie etwa eine ganz verschwindende Minorität? Ich glaube leider diese
Frage verneinen zu dürfen. Denn, wenn ich es auch gerne vermied, jene von
mir im engeren Kreise aufgestellte Behauptung, als seien an 90 jüdische
Kranke in der hiesigen Anstalt, der Öffentlichkeit wiederzugeben, da jene
Behauptung bloß der Äußerung eines Arztes entnommen, ich selbst aber
die Zahl der Kranken nicht kenne, da ich von dem Hier sein eines jüdischen
Kranken erst dann in Kenntnis gesetzt werde, wenn sein trauriges Dasein
schon geendet und seine Bestattung nach jüdischem Ritus erforderlich
wird, eine gedruckte Statistik mir aber nicht zu Gebote steht. So bin ich
dennoch überzeugt, dass ihre Anzahl eine beträchtliche zu nennen ist.
Ich verweise hier auf Nr. 199, Seite 30, Absatz 12, des Kreisamtsblattes
pro 76, woraus hervorgeht, dass im Jahre 76 drei Einprüfungen in die
hiesige Anstalt stattgefunden, wovon wir mir bekannt ist, wenigstens einer
dieser Pfründer ein Glaubensgenossen ist. Aus obiger Stelle ist ferner
ersichtlich, dass für das Jahr 77 ebenfalls drei Einpfründungen
beantragt sind, wovon 1 abschlägig beschieden, 2 dagegen genehmigt,
darunter die ‚des 44 Jahre alten Elias Stern von Brünau’, der mir
zwar unbekannt, aber dem Namen nach Jude zu sein scheint. Es ist mithin
zur Evidenz bewiesen, dass sohl in 76 als 77 von 3 Pfründen einer Jude
ist, welches Verhältnis immer auffallend erscheinen muss.
Ich will nun durchaus mit dem oben gesagten der Kreisregierung keinen
Vorwurf gemacht haben, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass wenn die
Besoldung oder wenigstens doch die Genehmigung zur Anstellung eines jüdischen
Geistlichen für die hiesige Anstalt von kompetenter Stelle angeregt würde,
eine bejahende Antwort zu erwarten wäre. Es wäre sogar sehr wünschenswert
selbst dann, wenn, was ich nicht bezweifle, unser Projekt zur Ausführung
gelangt und Würzburg ein jüdisches Spital erhält, für die in der
Anstalt verbleibenden |
 Kranken,
die Anstellung eines jüdischen Geistlichen bei der Kreis-Regierung zu
beantragen. Dass man aber der Kreis-Regierung zumuten soll, zur Errichtung
einer Küche mit koscherer Einrichtung in ihrer Anstalt ihre Genehmigung
herzugeben, das ist meines Erachtens ihrer Humanität zuviel zugemutet. Außerdem
aber lässt sich dieser Projekt hier schwerer ausführen, als sich’s
Herr Rosenbaum denkt, schon deswegen, weil kein Arzt es gestatten wird,
dass man seinen Patienten Fleisch, das mehrere Tage alt ist (da wir das
Fleisch von Theilheim beziehen, dort aber höchstens zweimal in der Woche
geschlachtet wird), verabreicht. Aber selbst wenn alle dieser
Schwierigkeiten für uns nicht vorhanden wären, so weiß doch Herr
Rosenbaum als wohl geschulter Talmudist, was es heißt … und dieses ist
auch hier anwendbar. Wenn wir ein jüdisches Spital bauen, worin auch Gemütskranke
Aufnahme finden, so ist dadurch sowohl den bisherigen Insassen des
Juliusspitals als auch denen der hiesigen Anstalt geholfen, wenn wir aber
hier eine koschere Küche errichten, wird dann auch die
Juliusspitalverwaltung ihre Genehmigung zur Errichtung einer koscheren Küche
in ihrer Anstalt geben? So weit glaube ich doch nicht, dass sich Herr
Rosenbaum versteigt! Und man kann doch eher Geisteskranke in einem jüdischen
Spital unterbringen, als dass man, unserer koscheren Küche wegen, Kranke
mit gesundem Verstande in einer Irrenanstalt unterbringt. Und wie
beseitigt Herr Rosenbaum meine Bedenken wegen der Selektion und der
Abgeschlossenheit von der jüdischen Welt, selbst in dem Augenblicke, wenn
sich die Seele vom Körper verabschiedet und es dem Sterbenden wohl tun würde,
‚die Tröstungen seiner Religion’, wie es andere Konfessionen nennen,
zu erhalten? Kranken,
die Anstellung eines jüdischen Geistlichen bei der Kreis-Regierung zu
beantragen. Dass man aber der Kreis-Regierung zumuten soll, zur Errichtung
einer Küche mit koscherer Einrichtung in ihrer Anstalt ihre Genehmigung
herzugeben, das ist meines Erachtens ihrer Humanität zuviel zugemutet. Außerdem
aber lässt sich dieser Projekt hier schwerer ausführen, als sich’s
Herr Rosenbaum denkt, schon deswegen, weil kein Arzt es gestatten wird,
dass man seinen Patienten Fleisch, das mehrere Tage alt ist (da wir das
Fleisch von Theilheim beziehen, dort aber höchstens zweimal in der Woche
geschlachtet wird), verabreicht. Aber selbst wenn alle dieser
Schwierigkeiten für uns nicht vorhanden wären, so weiß doch Herr
Rosenbaum als wohl geschulter Talmudist, was es heißt … und dieses ist
auch hier anwendbar. Wenn wir ein jüdisches Spital bauen, worin auch Gemütskranke
Aufnahme finden, so ist dadurch sowohl den bisherigen Insassen des
Juliusspitals als auch denen der hiesigen Anstalt geholfen, wenn wir aber
hier eine koschere Küche errichten, wird dann auch die
Juliusspitalverwaltung ihre Genehmigung zur Errichtung einer koscheren Küche
in ihrer Anstalt geben? So weit glaube ich doch nicht, dass sich Herr
Rosenbaum versteigt! Und man kann doch eher Geisteskranke in einem jüdischen
Spital unterbringen, als dass man, unserer koscheren Küche wegen, Kranke
mit gesundem Verstande in einer Irrenanstalt unterbringt. Und wie
beseitigt Herr Rosenbaum meine Bedenken wegen der Selektion und der
Abgeschlossenheit von der jüdischen Welt, selbst in dem Augenblicke, wenn
sich die Seele vom Körper verabschiedet und es dem Sterbenden wohl tun würde,
‚die Tröstungen seiner Religion’, wie es andere Konfessionen nennen,
zu erhalten?
Datum betone ich’s nochmals: zersplittern wir unsere Kräfte nicht,
geben wir uns nicht Illusionen hin, um die Hauptsache dadurch zu
vergessen. Vereinigen wir vielmehr unsere Kräfte und vereinigen wir uns
mit dem Gedanken, dass der Bau eines jüdischen Spitals in Würzburg möglich
und ausführbar ist, dann werden wir gerne über alle Schwierigkeiten
hinweg energisch unser Vorhaben ausführen. Wir dürfen unser jetziges
Vorhaben nicht mit dem Schomer HaDat-Verein vergleichen, der durch
Mangel an Energie einschlief, oder besser gesagt, nicht zum Leben kam. Hätte
Herr Rosenbaum damals dafür gesammelt und die Sammlung hätte keinen
Anklang gefunden, dann wäre er vielleicht berechtigt gewesen, daraus zu
argumentieren, dass unsere Zeit für religiöse Projekte nicht fassbar
sei, aber, soviel mir davon bekannt ist, existierte der Verein bloß auf
dem Papiere, zur Inanspruchnahme der Tatkraft unserer Glaubensgenossen hat
man die Energie nicht besessen. Ich gebe gerne zu, dass wir nicht in der
guten alten Zeit leben, wo jeder für Tora und Gottesfurcht begeistert
war, aber in Bezug auf Wohltätigkeit glaube ich stet die Jetztzeit der
guten alten Zeit nicht nach! Man muss nur ein Projekt richtig behandeln
und uns die Eigenschaft des
Patriarchen Abraham vor Augen halten – wenig sprechen und viel tun! Jede
Sache hat ihre Licht- und Schattenseite und je mehr wir die Schattenseite
betrachten, umso schwieriger wird uns aller Anfang werden.
Darum! Seien wir nicht müßig und sehen es ruhig mit an, dass deshalb,
weil es uns an Energie fehlt, große Verstöße gegen unsere heilige
Religion vorkommen! Bieten wir uns vielmehr die brüderliche Hand zur
gemeinsamen Unterstützung unseres Projektes, dann werden die
vorzunehmenden Sammlungen auch das gewünschte Resultat liefern, so wird Würzburg
ein jüdisches Spital erhalten und Mit- und Nachwelt werden unser Händewerk
anerkennen! Das walte Gott! E.J.
Roos, Lehrer." |
Die jüdischen Patienten in der
Anstalt Werneck werden in die Anstalt in Lohr überführt (1915) und von einem
neu gegründeten Verein betreut
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juli 1915:
"Würzburg, 14. Juli (1915). Die zuständigen Rabbinate für Werneck
und Lohr unterbreiteten, unter Verständigung und Zustimmung aller
unterfränkischen Rabbiner, der Königlichen Regierung das Ansuchen, dass
diejenigen Insassen der Anstalt Werneck, die rituell verköstigt zu
sein wünschen, nach Lohr übergeführt werden, dass ferner in Zukunft
sämtliche israelitische Geisteskranke des Kreises Unterfranken, die
entweder selbst den Antrag auf rituelle Verpflegung stellen, oder für die
seitens ihrer Familien ein solcher Antrag gestellt wird, gleich bei ihrer
Aufnahme der Anstalt in Lohr zugewiesen werden. Dieses Gesuch wurde durch
Regierungs-Entschließung vom 14. März 1915 genehmigt. Um die Einrichtung
in Lohr auf eine feste Basis zu stellen, sind beträchtliche Mittel
erforderlich, die nur durch Gründung eines Vereins und Inanspruchnahme
des jüdischen Wohltätigkeitssinnes aufgebracht werden können. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juli 1915:
"Würzburg, 14. Juli (1915). Die zuständigen Rabbinate für Werneck
und Lohr unterbreiteten, unter Verständigung und Zustimmung aller
unterfränkischen Rabbiner, der Königlichen Regierung das Ansuchen, dass
diejenigen Insassen der Anstalt Werneck, die rituell verköstigt zu
sein wünschen, nach Lohr übergeführt werden, dass ferner in Zukunft
sämtliche israelitische Geisteskranke des Kreises Unterfranken, die
entweder selbst den Antrag auf rituelle Verpflegung stellen, oder für die
seitens ihrer Familien ein solcher Antrag gestellt wird, gleich bei ihrer
Aufnahme der Anstalt in Lohr zugewiesen werden. Dieses Gesuch wurde durch
Regierungs-Entschließung vom 14. März 1915 genehmigt. Um die Einrichtung
in Lohr auf eine feste Basis zu stellen, sind beträchtliche Mittel
erforderlich, die nur durch Gründung eines Vereins und Inanspruchnahme
des jüdischen Wohltätigkeitssinnes aufgebracht werden können.
Am 20. Juni 1915 wurde nun in Würzburg ein 'Verein zur Ermöglichung
der rituellen Verpflegung israelitischer Nerven- und Geisteskranker im
Regierungsbezirke Unterfranken und Aschaffenburg' gegründet und die
Eintragung des Vereins in das Vereinsregister beschlossen. Zweck des
Vereins ist nach § 1 der Statuten die Fürsorge für die jüdischen
Nerven- und Geisteskranken, welche in den im Regierungsbezirk Unterfranken
und Aschaffenburg bestehenden Kreisanstalten untergerbacht sind, im Sinne
der Versorgung mit ritueller Kost und die Ermöglichung derselben durch
die notwendigen Schritte bei der Königliche Behörde, durch die
Bereitstellung der notwendigen Mittel und durch Bestellung von Organen zur
geeigneten Ausführung. Die Verpflegung muss in strengster Wahrung der
Vorschriften des Schulchan Aruch erfolgen. Mitglieder des Vereins
können nach $ 2 der Statuten einzelne Personen, Vereine und Gemeinden
werden. Der Mitgliederbeitrag beträgt für eine einzelne Person
mindestens 2 Mark fürs Jahr. Der Beitrag der Vereine und Gemeinden ist in
das Belieben derselben gestellt, beträgt bei Gemeinden jedoch mindestens
10 Mark. In die Vorstandschaft wurden gewählt: Distriktsrabbiner Dr.
Breuer in Aschaffenburg als Vorsitzender, Distriktsrabbiner Dr. Stein in Schweinfurt
als stellvertretender Vorsitzender, Lehrer Israel Wahler in Hörstein
als Schriftführer, Kaufmann Bernhard Hirsch in Lohr als Kassier, Kaufmann
Samuel Gundersheimer in Würzburg als Beisitzer, Fabrikbesitzer Nathan
Mayer in Aschaffenburg und Kaufmann Hermann Weichselbaum in Dettelbach als
Ersatzmänner. - Wenn auch in dieser schweren Zeit die jüdische
Wohltätigkeit stark in Anspruch genommen ist, so ist doch anzunehmen,
dass die Einrichtung in Lohr im Hinblick auf ihre Wichtigkeit des
wohlwollenden Interesses weiter Kreise gewiss sein dürfte, zumal sie
insofern in das Gebiet der Kriegsfürsorge fällt, als infolge des Krieges
- wie dies von sachverständiger Seite bestätigt wird - leider eine sich
vergrößernde Zahl von Nervenkranken zu gewärtigen sein
dürfte." |
| |
| Weitere Texte zu dem oben genannten, 1915
gegründeten Verein, später unter dem Namen "Fürsorgeverein für
israelitische Nerven- und Geisteskranke" siehe bei Aschaffenburg - Texte
zur Geschichte der jüdischen Gemeinde. |
Bericht von 1934
Werneck gehört zu den "ausgestorbenen" jüdischen
Gemeinden
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.
September 1934:
"So sind die jüdischen Gemeinden in Bonnland,
Bischwind, Werneck,
Euerbach und in anderen Orten ganz ausgestorben. Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.
September 1934:
"So sind die jüdischen Gemeinden in Bonnland,
Bischwind, Werneck,
Euerbach und in anderen Orten ganz ausgestorben.
In langsamer Fahrt durchquere ich diese Dörfer. Ich suche nach einstigen
jüdischen Häusern und finde sie. Auch wenn ich nicht die Stelle am Türpfosten
sehe, wo früher die Mesusah befestigt war. Vor solchen Häusern schlägt mein
Gefühl aus wie die Wünschelrute, wenn sie auf wertvolle Erzadern stößt. Mein
sicheres Gefühl sagt mir deutlich, dass dort jüdisches Leid gewohnt und da in
stiller Freude Sabbatruhe gehalten wurde. Die alten Zeiten rühren mich
geisterhaft an. Und mein Blick trübt sich und mein Herz flattert." |
Zur Geschichte der Synagoge
Ein Betraum in einem der jüdischen Häuser war in Werneck vorhanden.
Nach Angaben von E. Böhrer (recherchiert auf Grund eines Dokumentes von 1817 im
Staatsarchiv Würzburg; Mitteilung vom 10.5.2018) wurde ein
"Bethzimmer" um 1767 eingerichtet und war 1817 in einem "sehr
elenden und baufälligen" Zustand. Möglicherweise wurde der Betraum
daraufhin erneuert oder ein anderer Betraum eingerichtet, jedoch sind dazu keine
Angaben vorhanden. Dieser war bis um 1900
Zentrum des jüdischen Gemeindelebens am Ort. Nach Auflösung der jüdischen
Gemeinde 1904 wurde auch die Synagoge geschlossen. Der aus Sandstein gefertigte
und in Ölfarbe gefasste Aron-Ha-Kodesch (Toraschrein) der Synagoge Werneck kam
in die 1906/07 neu erbaute Synagoge nach Geroda,
die am 16. August 1907 feierlich eingeweiht wurde. Bei der Zerstörung der
Inneneinrichtung der Synagoge in Geroda dürfte der Wernecker Toraschrein
vermutlich zerstört worden sein.
Adresse/Standort der Synagoge: Auf dem Grundstück
hinter dem heutigen Gebäude Schönbornstraße 3 (ehemalige Hauptstraße 23)
Fotos
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988. 1992 2. Aufl. S. 135. |
 | "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust". First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel. S. 427.
|
 | Dirk Rosenstock (Bearbeiter): Die unterfränkischen
Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche
Quelle. Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Bd. 13. Würzburg
2008 S. 245. |
 |  Manfred
Fuchs: Chronik der jüdischen Gemeinde von Werneck. Spuren jüdischen
Lebens. 1677-1904. Hrsg. vom Historischen Verein Markt Werneck e.V. 2010. (=
Band 19 der Landeskundlichen Schriftenreihe zur Geschichte des Oberen
Werntals). Manfred
Fuchs: Chronik der jüdischen Gemeinde von Werneck. Spuren jüdischen
Lebens. 1677-1904. Hrsg. vom Historischen Verein Markt Werneck e.V. 2010. (=
Band 19 der Landeskundlichen Schriftenreihe zur Geschichte des Oberen
Werntals).
Die Broschüre ist in Werneck bei der Gemeindeverwaltung oder der
Buchhandlung Lesezeichen erhältlich bzw. kann direkt beim Historischen
Verein von Werneck bestellt werden (E-Mail). |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|