|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"
Bonnland (heute
Übungsdorf innerhalb des
Truppenübungsplatzes Hammelburg, Kreis Bad Kissingen)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Bonnland bestand eine jüdische
Gemeinde um 1930. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 16./17. Jahrhunderts
zurück. Erstmals werden 1575 Juden am Ort genannt ("Natta Jud zuo
Bonlant").
Ihre Blütezeit erlebte die Gemeinde Ende des 18./Anfang des 19. Jahrhunderts. 1816
wurden noch 73 jüdische Einwohner (18,6 % von insgesamt 393 Einwohnern) gezählt,
1833 65.
Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden für Bonnland auf 16
beziehungsweise 17 Matrikelplätzen die folgenden jüdischen Familienvorstände
genannt (es liegen zwei verschiedene Listen vom März und Juni 1817 vor). Die
Inhaber der Matrikelstellen waren (mit bereits neuem Familiennamen, Erwerbszweig
und Familienverhältnissen): Gerson Frank (Viehhändler, 66 Jahre, vier
Personen), Abraham Frank (Viehhändler, 32 Jahre, Sohn des Gerson, mit Frau und
einem Kind), Joseph Stern (Schnittwarenhändler, Vertrieb von Materialwaren, 59
Jahre, mit Frau, einer Tochter und der 93-jährigen Mutter), Aron Dessauer (Schächter
und Viehhändler, mit Frau, einem Kind, Magd und drei Geschwistern,
Hausbesitzer), Benedict Hecht (Schlachter, 73 Jahre, fünf Personen), Löb Hecht
(Unterhändler, Mäkler und Schmuser, 48 Jahre, acht Personen), Moses Schild
(Schnittwarenhändler, 63 Jahre, mit Frau), Mendel Goldbach (Schnittwarenhandel
und Viehhandel, 37 Jahre, vier Personen), Joseph Fleischhauer (Schächter,
Viehhandel, Schlachten, 35 Jahre, mit Frau, Magd und zwei Schwestern), Jacob Reiß
(Schmuser, Unterhändler), Bär Älter (Schmuser, Mäkler, 75 Jahre, mit Frau),
Isaac Schön (Schnittwaren, 37 Jahre, sechs Personen), Maier Schloß
(Kleinwarenhändler (48 Jahre, fünf Personen), Seligmann Katz (Kleinigkeitenhändler,
81 Jahre, ein Sohn), Salomon Klein (Lumpen- und Eisenhandel, 42 Jahre, mit Frau
und vier Kindern), Maier Nußbaum (Ölhändler, 52 Jahre, sieben Personen); ohne
Matrikelstelle: Isaac Feigenbaum (Judenschulmeister und Schächter, 62 Jahre, fünf
Personen).
Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte nach sich seit der Mitte des 19.
Jahrhunderts wie folgt: 1867 50 jüdische Einwohner (13,1 % von 481), 1871 38
(10,4 % von 366), 1894 sieben Familien, 1897 26 (in sechs Familien), 1899 25 (in
sechs Haushaltungen), 1900 27 (8,4 % von 321). Die Zahl der jüdischen Familien ging
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem durch die Abwanderung nach
Würzburg zurück.
Eine charakteristische Familiengeschichte ist die der Familie Hecht: Um
1850/70 wird Jonas Hecht als Metzgermeister in Bonnland genannt. Sein
Sohn Bernhard Hecht (geb. 1857 in Bonnland) hatte später eine Wein- und
Spirituosenhandlung in Würzburg, der Sohn Jakob Hecht (geb. 1854 in Bonnland)
übernahm ebenda eine Versicherungsagentur. Der Vater des in der NS-Zeit
umgekommenen Ludwig Hecht (s.u.) war Wolfgang Hecht (geb. 1828 in Bonnland, 1871
nach Würzburg, Immobilienagent, gest. 1907 in Würzburg); Bruder von Ludwig
Hecht war der einige Jahre in Werneck als
Arzt tätige und früh verstorbene Dr. Berthold Hecht (geb. 1857 in Bonnland,
gest. 1891 in Werneck).
In Spendenlisten der jüdischen Gemeinde in der Zeitschrift "Der Israelit"
werden ab 1866 folgende Personen aus der jüdischen Gemeinde genannt: Abraham
Goldbach (1871 auch als Kultusvorsteher der Gemeinde erwähnt) mit Söhnen
Emanuel Goldbach und Jonas Goldbach, Jonas Hecht, Babette Hecht, S. Dessauer, G.
Frank.
Um 1897 war Gemeindevorsteher E. Goldbach (vermutlich Emanuel Goldbach,
Sohn von Abraham Goldbach). 1899 bildeten den Gemeindevorstand E. Goldbach und
S. Hecht.
Im Ersten Weltkrieg kämpften drei jüdische Männer aus Bonnland an den
Fronten. Von ihnen ist keiner gefallen.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde Bonnland einen
Betsaal oder eine Synagoge (s.u.), dazu vermutlich auch einen Schulraum und ein
rituelles Bad. Die Toten der Gemeinde wurden im jüdischen Friedhof Pfaffenhausen
beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war zeitweise ein Lehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (nach den Begräbnislisten
des jüdischen Friedhofes Pfaffenhausen wurde 1772 ein "Schulmeister aus
Bonnland Kind" beigesetzt). Bereits 1817 (s.o. Matrikelliste) wird als
"Judenschulmeister und Schächter" Isaac Feigenbaum genannt. Im
"Statistischen Jahrbuch des Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes" wird um
1887/1892 als Lehrer und Kantor A. Goldbach genannt, möglicherweise identisch
mit dem o.g. Kultusvorsteher Abraham Goldbach. Ab 1892 war Lehrer in Bonnland J.
Bierschild aus Heßdorf; als Schochet wird um
1892/1897 Herr Reuß genannt (in der Liste 1899 der vermutlich identische C.
Reis). In Bonnland erhielten 1894 sechs jüdische Kinder Religionsunterricht. Um
1897/1899 unterrichtete in Bonnland die damals wieder zehn, dann sechs
schulpflichtigen Kinder Lehrer Anfänger aus
Heßdorf. Die
Gemeinde gehörte zum Bezirksrabbinat Schweinfurt.
An jüdischen Vereinen gab es den Wohltätigkeitsverein Gemiluth
chassodim (um 1898 unter Leitung von E. Goldbach).
Um 1925 war Vorsteher der jüdischen Gemeinde H. Dessauer.
1933 lebten noch acht jüdische Personen in Bonnland (2,9 % von 273).
Zwischen April 1937 und Mai 1938 konnten drei von ihnen in die USA emigrieren.
1938 wurden alle Einwohner Bonnlands umgesiedelt, damit der Ort in den
Truppenübungsplatz Hammelburg integriert werden konnte. Spätestens dann haben
auch die letzten jüdischen Einwohner Bonnland verlassen.
Nach 1945 entstand der Ort vorübergehend aufs Neue, insbesondere durch
Einquartierung von Vertriebenen (darunter keine jüdischen Personen). 1956 wurde
allerdings der Truppenübungsplatz wieder errichtet. Bis 1964/65 mussten
wiederum alle Einwohner den Ort verlassen.
Von den in Bonnland geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen
Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Hermann Dessauer
(1882), Ernestine Hahn geb. Frank (geb. 1892 in Bonnland, verheiratet mit Benno
Hahn aus Nenzenheim; beide wurden am 17.
Juni 1943 nach Auschwitz deportiert und ermordet), Ludwig Hecht (geb. 1866 in
Bonnland, später als Arzt in Ulm tätig,
umgekommen Ghetto Theresienstadt 1943), Regina Katzmann geb. Hecht (geb. 1877 in
Bonnland, später verheiratet in Gersfeld,
umgekommen Ghetto Theresienstadt 1943/44), Sendy Stein geb. Dessauer (geb. 1910
in Bonnland, später verheiratet in Theilheim,
umgekommen Ghetto Izbica).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Stellensuche von S. Dessauer (1925)
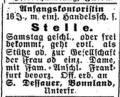 Anzeige
in "Der Israelit" vom 23. Juli 1925: "Anfangskontoristin Anzeige
in "Der Israelit" vom 23. Juli 1925: "Anfangskontoristin
16 J., m. einjähriger Handelsschule sucht
Stelle. Samstag geschlossen oder frei bekommt, geht eventuell als
Stütze oder zur Gesellschaft der Frau oder einzelner 'Dame, mit
Familien-Anschluss Frankfurt bevorzugt.
Offerten erbeten an S. Dessauer, Bonnland, Unterfranken." |
In
einem jüdischen Reisebericht durch Unterfranken aus dem Jahr 1934 wird
Bonnland unter den "ganz ausgestorbenen" jüdischen Gemeinden erwähnt:
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.
September 1934:
"So sind die jüdischen Gemeinden in Bonnland, Bischwind,
Werneck,
Euerbach und in anderen Orten ganz ausgestorben. Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.
September 1934:
"So sind die jüdischen Gemeinden in Bonnland, Bischwind,
Werneck,
Euerbach und in anderen Orten ganz ausgestorben.
In langsamer Fahrt durchquere ich diese Dörfer. Ich suche nach einstigen
jüdischen Häusern und finde sie. Auch wenn ich nicht die Stelle am Türpfosten
sehe, wo früher die Mesusah befestigt war. Vor solchen Häusern schlägt mein
Gefühl aus wie die Wünschelrute, wenn sie auf wertvolle Erzadern stößt. Mein
sicheres Gefühl sagt mir deutlich, dass dort jüdisches Leid gewohnt und da in
stiller Freude Sabbatruhe gehalten wurde. Die alten Zeiten rühren mich
geisterhaft an. Und mein Blick trübt sich und mein Herz flattert." |
Zur Geschichte der Synagoge
Ein Betsaal oder eine Synagoge war auf Grund der relativ hohen
Zahl der jüdischen Einwohner noch im 19. Jahrhundert sicher vorhanden. Über
ihren Standort liegen keine Informationen vor. Israel Schwierz (s.Lit.) hat
Anfang der 1980er-Jahre mit Einverständnis der zuständigen Dienststellen der
Bundeswehr jedes Haus sorgfältig und gründlich untersucht, jedoch keine
Hinweise auf das Vorhandensein einer Synagoge gefunden. Möglicherweise ist ein
früheres Synagogengebäude nach 1938 absichtlich zerstört worden.
Weitere Informationen bitte an den Webmaster von "Alemannia Judaica",
Adresse siehe Eingangsseite.
Adresse/Standort der Synagoge: unbekannt
Fotos
Es liegen keine
Fotos vor, zumal auch der Standort einer ehemaligen Synagoge oder eines
Betsaales unbekannt ist;
über Hinweise freut sich der Webmaster von
"Alemannia Judaica", Adresse siehe Eingangsseite
|
|
| |
|
|
Links und Literatur
Links:
 | Website www.bonnland.de:
Informationen zur Ortskampfanlage und zum Truppenübungsplatz
Hammelburg |
Literatur:
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 272-273. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 43. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 426.
|
 | Reiner Strätz: Biographisches Handbuch -
Würzburger Juden 1900-1945. I. Teilband. 1989 (Mitglieder der Familie Hecht
S. 241-243).
|
 | Volker Rieß: Sie gehören dazu...
Erinnerungen an die jüdischen Schüler der Lateinschule und des
Progymnasiums – verbunden mit einigen Aspekten zur Geschichte der Juden in
der Stadt Hammelburg und ihren Stadtteilen (Frobenius-Gymnasium Hammelburg.
Festschrift zum Schuljubiläum 1994), Hammelburg 1994, S. 83-102. |
 | Ders.: Jüdisches Leben in und um Hammelburg.
Katalog zur Ausstellung im Stadtmuseum Herrenmühle 12. Oktober – 10.
Dezember 2000, Hammelburg 2001.
|
 | Cornelia Binder und Michael (Mike) Mence: Last Traces /
Letzte Spuren von Deutschen jüdischen Glaubens im Landkreis Bad Kissingen.
Schweinfurt 1992. |
 | dieselben: Nachbarn der Vergangenheit / Spuren von
Deutschen jüdischen Glaubens im Landkreis Bad Kissingen mit dem Brennpunkt
1800 bis 1945 / Yesteryear's Neighbours. Traces of German Jews in the administrative district of Bad Kissingen focusing on the period
1800-1945. Erschienen 2004. ISBN 3-00-014792-6. Zu beziehen bei den
Autoren/obtainable from: E-Mail.
Info-Blatt
zu dieser Publikation (pdf-Datei). |
 | Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen
Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche
Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.
Würzburg 2008. S. 88-89. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Bonnland Lower Franconia. Jews
numbered 73 in 1816 and eight in 1933 (total 273); three are known to have
emigrated to the United States in 1937/38.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|