|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"
Geroda (Kreis
Bad Kissingen)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Geroda bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/42.
Ihre Entstehung geht mindestens in die Zeit des 17. Jahrhunderts zurück. Durch
die Vertreibung der Juden aus dem Hochstift Fulda 1671 dürften mehrere
Familien nach Geroda gekommen sein.
Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Geroda auf
insgesamt 15
Matrikelstellen die folgenden jüdischen Familienvorstände genannt (mit neuem Familiennamen und Erwerbszweig): Salomon Heß (Vieh- und
Schnittwarenhandel), Samuel Heß (Vieh- und Schnittwarenhandel), Nathan Heß
(Vieh- und Schnittwarenhandel), Samuel Stern (Lehrer und Schlachter), Maier
Straus (Schlachten und Kramwarenhandel), Löb Neumann (Viehhandel und Schmusen),
Nathan Stern (Schnittwarenhandel) Abraham Gärtner (Schmusen), Menke Straus
(Schlachten und Schnittwarenhandel), Maier Kalmann (Schnittwarenhandel), Jacob
Schiff (Viehhandel), Maier Goldschmied (Schmusen), Manes Hecht (Lumpensammler),
Laser Hofmann (Viehhandel), Männlein Schiff (Ackerbau, Matrikel seit
1824).
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Zahl der
jüdischen Einwohner wie folgt: 1839 73 (in 17 Familien), 1867 59 jüdische Einwohner (8,8 % von
insgesamt 674 Einwohnern), 1880: 63 (9,1 % von 691), 1900 55 (8,8 % von 624),
1910 49 (7,7 % von 637).
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.),
eine Religionsschule mit Schulhaus, eine Mikwe sowie seit 1911 einen eigenen
Friedhof. Um 1910 wurden nicht nur die Synagoge neu erbaut, das Schulhaus
umgebaut, sondern auch ein neuer Friedhof angelegt. Über diese Maßnahmen
informiert ein Bericht in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. März
1911:
 "Geroda
(Unterfranken), 20. Februar 1911. Die großen materiellen Anforderungen, mit der
die hiesige Gemeinde den Neubau einer Synagoge und den Umbau des Schulhauses
bewerkstelligte, hielten sie doch nicht ab, auch für eine würdige Grabstätte
zu sorgen. Die Überführung der Metim (Toten) nach dem ca. 6 Stunden
entfernten Pfaffenhausen war mit großen Opfern verbunden. Nach den neuen
Bestimmungen des Begräbnisplatzes Pfaffenhausen wurden den Gemeinden noch
größere Anforderungen gestellt, die namentlich für die entlegenen Gemeinden
im Winter nicht leicht zu erfüllen waren. Deshalb entschloss sich die hiesige
Gemeinde in Verbindung mit der Kultusgemeinde Unterriedenberg, ein eigenes Beit
Chajiim (Friedhof) anzulegen, das am Mittwoch, 1. Februar (1911) seiner
Bestimmung übergeben wurde. Nachdem man zu Schacharit (Morgengebet) die Slichot
von Scheni Kama gesagt hatte, war Mittags die eigentliche Weiherede in
der Synagoge. Die herrlichen Ausführungen des Herrn Distriktsrabbiner Dr. S.
Bamberger aus Bad Kissingen machten auf die Gemeinde den tiefsten Eindruck. Die
Einweihung des Beit Olam (Friedhof) war im Anschluss an diese Synagogenfeier
gleichzeitig mit der Beerdigung der Frau Mirjam Fleischhacker von Platz, einer
wahren Eschet Chajal (tüchtigen Frau), die als erste den Boden
weihte. Nach einer tiefdurchdachten Rede des Herrn Distriktsrabbiners wurden die
sterblichen Überreste dem frisch geweihten Boden übergeben. Unter Vornahme der
üblichen Hakefot schloss die ernste eindrucksvolle Weihe." "Geroda
(Unterfranken), 20. Februar 1911. Die großen materiellen Anforderungen, mit der
die hiesige Gemeinde den Neubau einer Synagoge und den Umbau des Schulhauses
bewerkstelligte, hielten sie doch nicht ab, auch für eine würdige Grabstätte
zu sorgen. Die Überführung der Metim (Toten) nach dem ca. 6 Stunden
entfernten Pfaffenhausen war mit großen Opfern verbunden. Nach den neuen
Bestimmungen des Begräbnisplatzes Pfaffenhausen wurden den Gemeinden noch
größere Anforderungen gestellt, die namentlich für die entlegenen Gemeinden
im Winter nicht leicht zu erfüllen waren. Deshalb entschloss sich die hiesige
Gemeinde in Verbindung mit der Kultusgemeinde Unterriedenberg, ein eigenes Beit
Chajiim (Friedhof) anzulegen, das am Mittwoch, 1. Februar (1911) seiner
Bestimmung übergeben wurde. Nachdem man zu Schacharit (Morgengebet) die Slichot
von Scheni Kama gesagt hatte, war Mittags die eigentliche Weiherede in
der Synagoge. Die herrlichen Ausführungen des Herrn Distriktsrabbiner Dr. S.
Bamberger aus Bad Kissingen machten auf die Gemeinde den tiefsten Eindruck. Die
Einweihung des Beit Olam (Friedhof) war im Anschluss an diese Synagogenfeier
gleichzeitig mit der Beerdigung der Frau Mirjam Fleischhacker von Platz, einer
wahren Eschet Chajal (tüchtigen Frau), die als erste den Boden
weihte. Nach einer tiefdurchdachten Rede des Herrn Distriktsrabbiners wurden die
sterblichen Überreste dem frisch geweihten Boden übergeben. Unter Vornahme der
üblichen Hakefot schloss die ernste eindrucksvolle Weihe."
|
Für die Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein
Religionslehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schächter tätig
war. 1817 wird bei der Erstellung der Matrikelliste Lehrer Samuel Stern
genannt. Immer wieder war die Stelle neu zu besetzen (siehe die Stellenanzeigen unten;
aus den Anzeigen gehen u.a. auch die Namen einiger Vorsteher der jüdischen Gemeinde hervor: um 1872 Wolf Strauß, um 1878 Jonas
Hoffmann, um 1902 J. Sussmann Heß, um 1904 M. Strauß).
Die Gemeinde gehörte bis 1892/93 zum Rabbinatsbezirk Gersfeld,
danach zum
Distriktsrabbinat in Bad Kissingen.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Gustav Katzmann
(geb. 1.7.1886 Schondra, gef. 24.12.1918),
Isak Hess (geb. 29.8.1892 in Geroda, gef. 20.9.1917), Nathan Hess (geb.
22.8.1894 in Geroda, gef. 10.9.1917) und Max Strauss (geb. 23.6.1896 Geroda, gef.
5.9.1916; Schüler der
Israelitischen Lehrerbildungsanstalt Würzburg, siehe Bericht unten). Ihre Namen stehen auf einer zusätzlich
angebrachten Tafel auf dem Denkmal für die Gefallenen der Weltkriege vor der
Kirche.
Um 1924, als zur Gemeinde noch 54 Personen gehörten (8,3 % von insgesamt
etwa 650 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde Moses Strauß, Simon
Goldschmidt, Samuel Frank, Bernhard Strauß und Max Mandelbaum, letzterer aus Platz.
Die damals 12 in Platz und die 3 in Schondra
lebenden jüdischen Personen gehörten auch zur Gemeinde in Geroda. An jüdischen
Vereinen bestanden der Verein Ez Chaijim (1924 Leiter: Karl Strauß) und der
Israelitische Frauenverein (Leiterin 1924: Benjamina Goldschmidt). Als Lehrer,
Kantor und Schochet wirkte Siegfried Strauß. Er erteilte damals 13 jüdischen
Kindern den Religionsunterricht.
1933 lebten noch 43 jüdische Personen am Ort (7,5 % von 575). Bis 1938
verzogen nur wenige von ihnen vom Ort. Fünf konnten in die USA auswandern, drei
nach England, fünf weitere verzogen in Ort in Deutschland. Ende März 1938 wurden
noch 34 jüdische Gemeindeglieder gezählt. Beim Novemberpogrom 1938
wurden von SS-Leuten aus Geroda und Mithelfern die Inneneinrichtungen von
Synagoge und jüdischem Gemeindehaus zerstört, sämtliche jüdischen Wohnungen
wurden überfallen und verwüstet. Am 10. September 1939 fand ein weiterer
Pogrom statt: die jüdischen Familien wurden im Schlaf überfallen, aus
ihren Häusern gezerrt und brutal geschlagen. Fünf von ihnen erlitten schwere
Verletzungen und wurden nur dank der raschen Hilfe des nichtjüdischen Arztes
Dr. Staab aus Burkardroth gerettet, der unter persönlicher Gefährdung dafür
sorgte, dass sie in das jüdische Krankenhaus von Würzburg überführt wurden.
Die übrigen, auch unter ihnen drei Verletzte, flohen aus dem Ort, um ihr Leben
zu retten. Unter dem Eindruck dieses Pogroms zogen fünf jüdische
Gemeindeglieder Anfang 1940 in andere deutsche Orte, zwei konnten noch im Mai
1941 in die USA emigrieren. 16 jüdische Personen wohnten im Februar 1942 noch
in Geroda. Von ihnen wurden neun Ende April über Würzburg nach Izbica bei
Lublin deportiert. Fünf weitere kamen im September 1942 in das Ghetto Theresienstadt.
Von den in Geroda geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Meta Frank geb. Hess (1889), Samuel Frank
(1886), Selma Frank (1914), Babetta Frey geb. Frank (geb. 1888), Benjamina Goldschmidt geb. Strauss
(1874), Regine Goldschmidt geb. Strauss (1866), Simon Goldschmidt (1870), Jette
Hamburger geb. Kallmann (1875), Abraham Hess (1895), Berta Hess (1910), Berthold Hess (1933), Fanni Hess
geb. Rauh (1873), Gidda (Gitta) Hess geb. Goldschmidt (1913), Gustav
Hess (1898), Hilde Hess (1902), Isaak Hess (1893), Jakob Julius Hess (1892), Karl Hess (1902),
Leo Hess (1935), Lina Hess geb. Hahn (1896),
Meta Hess (1898), Meta Hess (1911), Paula Hess (1900), Regina Hess (1897),
Samuel Hess (1863), Selma Hess (1896), Siegbert
Hess (1929), Lina Katz geb. Strauß (1904), Abraham Katzmann (1878), Emanuel Katzmann
(1884), Max Katzmann (1889), Moritz
Katzmann (1880), Rosa Katzmann geb. Hess (1894), Berta Nussbaum (1873), Minna
Nussbaum geb. Edelstein (1888), Thekla Lehmann (1897), Adelheid Schlössinger geb.
Katzmann (1882), Klara Schlössinger (1889), Fanny Stern geb. Strauß (1905),
Siegfried Strauss (1900, Lehrer siehe unten).
Berichte
aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Allgemeine Berichte
Beschreibung der Gemeinde (1839)
 Artikel
in "Israelitische Annalen" vom 20. Dezember 1839: "Geroda.
Landgerichtsbezirk Brückenau, 17 Familien, 73 Seelen. Vier betreiben
Landwirtschaft und einer ist Handwerker. Innerhalb zehn Jahren haben vier
ihre Ansässigmachung erhalten, während fünf Matrikel erledigt wurden. Die
Unterhaltungskosten der Schule, wozu auch die wenigen Juden in
Platz und
Schondra beizutragen haben, betragen 184 fl., des Kultus mehr als 120
fl. und Schutzgelder teils an das Rentamt, teils an den Gutsherrn 76 fl. 10
Kr." Artikel
in "Israelitische Annalen" vom 20. Dezember 1839: "Geroda.
Landgerichtsbezirk Brückenau, 17 Familien, 73 Seelen. Vier betreiben
Landwirtschaft und einer ist Handwerker. Innerhalb zehn Jahren haben vier
ihre Ansässigmachung erhalten, während fünf Matrikel erledigt wurden. Die
Unterhaltungskosten der Schule, wozu auch die wenigen Juden in
Platz und
Schondra beizutragen haben, betragen 184 fl., des Kultus mehr als 120
fl. und Schutzgelder teils an das Rentamt, teils an den Gutsherrn 76 fl. 10
Kr." |
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers, Vorbeters
und Schochet 1872 / 1878 / 1900 / 1901 / 1902 /
1904
 Anzeige in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 15. Mai 1872: "Die Religionslehrer- und
Schächterstelle in Geroda bei Kissingen ist erledigt. Dieselbe trägt 274
Gulden Gehalt; 70 Gulden für Schächterfunktion wird garantiert, nebst
sehr schöner freier Wohnung und Garten, sowie 600 Dez. Grasgarten mit
vielen Obstbäumen, auch kann auf 100 Gulden Nebenverdienste gerechnet und
15 Gulden aus einer Stiftung jährlich dazu gegeben werden. Bewerber
wollen sich an Kultus-Vorsteher Wolf Strauß wenden." Anzeige in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 15. Mai 1872: "Die Religionslehrer- und
Schächterstelle in Geroda bei Kissingen ist erledigt. Dieselbe trägt 274
Gulden Gehalt; 70 Gulden für Schächterfunktion wird garantiert, nebst
sehr schöner freier Wohnung und Garten, sowie 600 Dez. Grasgarten mit
vielen Obstbäumen, auch kann auf 100 Gulden Nebenverdienste gerechnet und
15 Gulden aus einer Stiftung jährlich dazu gegeben werden. Bewerber
wollen sich an Kultus-Vorsteher Wolf Strauß wenden." |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 30. Januar 1878: "Die israelitische
Religionslehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle der kombinierten
Gemeinden Geroda, Platz und Schondra (Bayern), mit dem Sitze in Geroda,
ist seit 1. Januar dieses Jahres vakant und wird hierdurch zur
Wiederbesetzung ausgeschrieben. Die Stelle trägt an fixem Gehalt M. 514
29 Pf., Vergütung für Beheizung M. 34. 29 Pf. sowie ca. M. 200 an
Nebenverdiensten. Qualifizierte Bewerber wollen sich gefälligst innerhalb
4 Wochen mit Einsendung ihrer Zeugnisse an unterzeichneten Vorstand
wenden. Gerade in Bayern (Unterfranken), 22. Januar 1878. Jonas Hoffmann,
Kultusvorstand." Anzeige in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 30. Januar 1878: "Die israelitische
Religionslehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle der kombinierten
Gemeinden Geroda, Platz und Schondra (Bayern), mit dem Sitze in Geroda,
ist seit 1. Januar dieses Jahres vakant und wird hierdurch zur
Wiederbesetzung ausgeschrieben. Die Stelle trägt an fixem Gehalt M. 514
29 Pf., Vergütung für Beheizung M. 34. 29 Pf. sowie ca. M. 200 an
Nebenverdiensten. Qualifizierte Bewerber wollen sich gefälligst innerhalb
4 Wochen mit Einsendung ihrer Zeugnisse an unterzeichneten Vorstand
wenden. Gerade in Bayern (Unterfranken), 22. Januar 1878. Jonas Hoffmann,
Kultusvorstand." |
| |
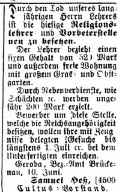 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juni 1900:
"Durch den Tod unseres langjährigen Herrn Lehrers ist die hiesige Religionslehrer-
und Vorbeterstelle neu zu besetzen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juni 1900:
"Durch den Tod unseres langjährigen Herrn Lehrers ist die hiesige Religionslehrer-
und Vorbeterstelle neu zu besetzen.
Der Lehrer bezieht einen fixen Gehalt von 520 Mark und außerdem freie
Wohnung mit großem Gras- und Obstgarten.
Durch Nebenverdienste, wie Schächten etc. werden ungefähr 200 Mark
erzielt.
Bewerber um diese Stelle, welche die Reichsangehörigkeit besitzen, wollen
ihre mit Zeugnissen belegten Gesuche bis längstens 1. Juli dieses Jahres
bei dem Unterfertigten einreichen.
Geroda, Bezirksamt Brückenau, 10. Juni Samuel Heß,
Kultus-Vorstand." |
| |
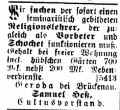 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Juli 1900:
"Wir suchen per sofort einen seminaristisch gebildeten Religionslehrer,
der zugleich als Vorbeter und Schochet funktionieren muss. Gehalt
bei freier Wohnung inklusive hübschen Gärten 700 Mark nebst 200 Mark
Nebenverdienste. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Juli 1900:
"Wir suchen per sofort einen seminaristisch gebildeten Religionslehrer,
der zugleich als Vorbeter und Schochet funktionieren muss. Gehalt
bei freier Wohnung inklusive hübschen Gärten 700 Mark nebst 200 Mark
Nebenverdienste.
Geroda bei Brückenau. Samuel Heß,
Kultusvorstand." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Mai 1901:
"Wir suchen per sofort einen Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Mai 1901:
"Wir suchen per sofort einen
Religionslehrer,
welcher den Kantor- und Schächterdienst mit zu versehen
hat. Gehalt 700 Mark, Nebenverdienst 300 Mark, nebst hübscher Wohnung und
schönem großen Garten.
Der Vorstand: Süßmann Heß, Geroda
(Unterfranken)." |
| |
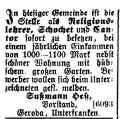 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. August 1901:
"In hiesiger Gemeinde ist die Stelle als Religionslehrer, Schochet
und Kantor sofort zu besetzen, bei einem jährlichen Einkommen
von 1000-1100 Mark nebst schöner Wohnung mit hübschem großen Garten.
bewerber wollen sich beim Unterzeichneten gefälligst melden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. August 1901:
"In hiesiger Gemeinde ist die Stelle als Religionslehrer, Schochet
und Kantor sofort zu besetzen, bei einem jährlichen Einkommen
von 1000-1100 Mark nebst schöner Wohnung mit hübschem großen Garten.
bewerber wollen sich beim Unterzeichneten gefälligst melden.
Sußmann Heß, Vorstand, Geroda,
Unterfranken." |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 23. Januar 1902: "In unserer Gemeinde
ist die Stelle eines Anzeige in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 23. Januar 1902: "In unserer Gemeinde
ist die Stelle eines
Lehrers,
verbunden mit Schächter- und Kantordienst
zu besetzen. Einkommen 1000-1100 Mark nebst schöner Wohnung mit
hübschem, großen Garten.
J. Sussmann Heß, Vorstand, Geroda,
Unterfranken". |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 25. Juli 1904: "Die hiesige
Religionslehrer-, Kantor- und Schochetstelle ist zu besetzen. Der Gehalt
beträgt bei freier Wohnung, sehr hübschen und großen Garten, 700 Mark
fix und cirka 400 Mark Nebenverdienste. Reflektanten wollen sich an den
Unterzeichneten wenden. Anzeige in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 25. Juli 1904: "Die hiesige
Religionslehrer-, Kantor- und Schochetstelle ist zu besetzen. Der Gehalt
beträgt bei freier Wohnung, sehr hübschen und großen Garten, 700 Mark
fix und cirka 400 Mark Nebenverdienste. Reflektanten wollen sich an den
Unterzeichneten wenden.
Geroda, 20. Juli. M. Strauss. Kultusvorstand" |
| |
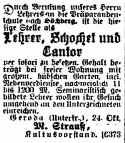 Anzeige in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 27. Oktober 1904: "Durch Berufung
unseres Herrn Lehrers an die Präparandenschule nach
Höchberg, ist die hiesige
Stelle als Lehrer, Schochet und Kantor per sofort zu besetzen. Gehalt
beträgt bei freier Wohnung mit großem, hübschen Garten, incl.
Nebenverdienste, nachweislich 11 bis 1200 Mark. Seminaristisch gebildete
Lehrer wollen ihr Gesuch umgehend an den Unterzeichneten einreichen. Anzeige in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 27. Oktober 1904: "Durch Berufung
unseres Herrn Lehrers an die Präparandenschule nach
Höchberg, ist die hiesige
Stelle als Lehrer, Schochet und Kantor per sofort zu besetzen. Gehalt
beträgt bei freier Wohnung mit großem, hübschen Garten, incl.
Nebenverdienste, nachweislich 11 bis 1200 Mark. Seminaristisch gebildete
Lehrer wollen ihr Gesuch umgehend an den Unterzeichneten einreichen.
Geroda (Unterfr.), 24. Oktober (1904) M. Strauß,
Kultusvorstand." |
Lehrer Leopold Freudenberger wechselt von Geroda nach Hammelburg (1906)
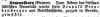 Meldung
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 9. November
1906: "Hammelburg
(Bayern). Zum Lehrer der hiesigen jüdischen Gemeinde wurde Herr Leopold
Freudenberger aus Veitshöchheim,
zurzeit in Geroda, gewählt". Meldung
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 9. November
1906: "Hammelburg
(Bayern). Zum Lehrer der hiesigen jüdischen Gemeinde wurde Herr Leopold
Freudenberger aus Veitshöchheim,
zurzeit in Geroda, gewählt". |
Zum Tod von Jettchen Strauß geb. Katz, Frau
des Lehrers Siegfried Strauß (1928)
Anmerkung: Jettchen Strauß geb. Katz starb wenige
Tage, nachdem sie ihren ersten Sohn geboren hatte. Ihr Mann, Lehrer Siegfried
Strauß ist am 18. Mai 1900 in Geroda geboren und war nach seiner
Lehrerausbildung zunächst 1919/20 Lehrer in Willmars, später in seinem
Geburtsort Geroda. Spätestens ab 1932 und noch bis 1938 war er Lehrer in
Mittelsinn. Am 20. Oktober 1941 wurde
Siegfried Strauß von Frankfurt aus deportiert. Der Zug sollte ursprünglich ins
Ghetto Litzmannstadt führen, dann verliert sich die Spur.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1928: "Geroda,
10. Juni (1928). Am Erew Schawuoth (Tag von der Wochenfest
Schawuoth = 24. Mai 1928) verschied, nachdem sie einige Tage vorher ihrem
ersten Kinde, einem Jungen, das Leben gegeben, Frau Jettchen Strauß - sie
ruhe in Frieden, die Gattin des Lehrers Siegfried Strauß in Geroda.
Eine Stunde vor Beginn des Festes der Tora hauchte sie, deren ganze
Lebenstätigkeit auf die Formel eingestellt war: 'alles, was Gott
gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören' ihre edle Seele aus und
einige Stunden, nachdem eine fromm betende Gemeinde die Verbindlichkeit
der 613 Gebote anerkannte, wurde das, was sterblich an ihr, deren
Lebensziel auf das 'Aufrichten aller Worte der Tora' gerichtet war,
dem kühlen Boden anvertraut. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1928: "Geroda,
10. Juni (1928). Am Erew Schawuoth (Tag von der Wochenfest
Schawuoth = 24. Mai 1928) verschied, nachdem sie einige Tage vorher ihrem
ersten Kinde, einem Jungen, das Leben gegeben, Frau Jettchen Strauß - sie
ruhe in Frieden, die Gattin des Lehrers Siegfried Strauß in Geroda.
Eine Stunde vor Beginn des Festes der Tora hauchte sie, deren ganze
Lebenstätigkeit auf die Formel eingestellt war: 'alles, was Gott
gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören' ihre edle Seele aus und
einige Stunden, nachdem eine fromm betende Gemeinde die Verbindlichkeit
der 613 Gebote anerkannte, wurde das, was sterblich an ihr, deren
Lebensziel auf das 'Aufrichten aller Worte der Tora' gerichtet war,
dem kühlen Boden anvertraut.
Frau Jettchen Strauß - sie ruhe in Frieden - entstammt dem als
fromm bekannten Hause Katz in Rhina. Ihr Gottvertrauen und ihre
Frömmigkeit war ein Erbteil ihres Vaterhauses. Die frommen Lehren, die
ihr von ihrer frühestens Kindheit an zuteil wurden, das fromme Leben, das
sie stets vor sich sah, gruben sich tief in ihr empfängliches Herz und
bildeten einen Menschen, der in Freud und Leid, im Glück und Unglück, in
Gottesfurcht und Liebe sein Leben verbrachte. Die drei
Geschenke, die dem jüdischen Volk geworden: Barmherzige,
Verschämte, Wohltätige - besaß sie in großem Maße. Dass sie besonders zu
den Wohltätigen gehörte, das werden viele Arme bestätigen, die
sie in Liebe verpflegt und unterstützt hat, das werden alle die sagen,
die mit ihr je in Berührung gekommen waren. Ihre Liebe zu Gott und zu den
Menschen blieb nicht Theorie, sondern sie wurde zur heiligen Tat. Nie
fehlte sie, wo es galt, Tränen zu trocknen, Leid zu trösten, Liebestaten
an Lebenden und an Toten zu vollbringen. Die gottgewollte Tat leitete und
beeinflusste ihr ganzes Leben. Den Gerechten wird der reinste Lohn in
jener Welt zuteil, dort werden sie die Früchte ihrer guten Taten
genießen. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1928:
"Danksagung. Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme beim
Heimgange unserer geliebten, unvergesslichen Frau Jettchen Strauß geb.
Katz - seligen Andenkens - sagen wir nur auf diesem Wege
unseren allerherzlichsten Dank. Geroda bei Brückenau. Lehrer S. Strauß
und Angehörige." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1928:
"Danksagung. Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme beim
Heimgange unserer geliebten, unvergesslichen Frau Jettchen Strauß geb.
Katz - seligen Andenkens - sagen wir nur auf diesem Wege
unseren allerherzlichsten Dank. Geroda bei Brückenau. Lehrer S. Strauß
und Angehörige." |
| |
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Juli
1928: "Personalien. In tiefe Trauer wurde Kollege Strauß (Geroda)
durch den Verlust seiner Gattin versetzt, die ihm nach kurzer Ehe am
Erev Schewuos, nachdem sie einige Tage zuvor einem Söhnchen das Leben
geschenkt hatte, durch den Tod entrissen worden ist. Dem schwer geprüften
Kollegen sei auch an dieser Stelle die herzlichste Teilnahme zum Ausdruck
gebracht." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Juli
1928: "Personalien. In tiefe Trauer wurde Kollege Strauß (Geroda)
durch den Verlust seiner Gattin versetzt, die ihm nach kurzer Ehe am
Erev Schewuos, nachdem sie einige Tage zuvor einem Söhnchen das Leben
geschenkt hatte, durch den Tod entrissen worden ist. Dem schwer geprüften
Kollegen sei auch an dieser Stelle die herzlichste Teilnahme zum Ausdruck
gebracht." |
Berichte zu einzelnen
Personen aus der Gemeinde
Zum Soldatentod von Max Strauß,
gefallen 5. September 1916
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Oktober 1916:
"Geroda, 6. Oktober (1916). Vom Kultusvorstand der
Synagogengemeinde Geroda geht uns nachstehende Abschrift mit dem Ersuchen
zu, dieselbe als Bericht zu veröffentlichen: 'Im Felde, 16. September
1916. Abschrift. An das hochwohllöbliche Bürgermeisteramt Geroda. Es ist
mir ein dringendes Bedürfnis, der Gemeinde Geroda mitzuteilen, welch
schmerzlichen, unersetzlichen Verlust die Batterie durch den Heldentod des
Kanoniers Max Strauß, eines Mitgliedes ihrer Gemeinde, erlitten
hat. Ich fühle mich umso eher dazu verpflichtet, indem ich dem Helden
noch den letzten Liebesdienst erweisen kann, indem ich der gesamten
Gemeinde klarlege, wie stolz sie auf ihren Angehörigen sein darf. Max
Strauß war einer der unerschrockensten, tapfersten Leute meiner Batterie.
Er war ein ganzer Mann, furchtlos und treu wie Gold, ein Mann mit hochanständigem
Charakter, mit einwandfreier Gesinnung, mit kindlich anhänglichem Gemüt,
ein Musterbeispiel für die ganze Batterie in Bezug auf strengste
Pflichterfüllung, auf tadellose kameradschaftliche Führung. So steht er
noch vor mir, so habe ich ihn gern gehabt, so habe ich ihm vertraut als
einem meiner Besten, so werde ich ihn in treuer Erinnerung behalten,
dankbar für das, was er mir, meiner Batterie und damit dem ganzen
Vaterlande geleistet hat. Schon manchem habe ich den letzten Gruß und
Dank nachgerufen, noch nie aber ist mir der Abschied, das Bewusststein der
endgültigen Trennung so schwer gefallen. Er starb, mir mehr als Kanonier.
Er empfing den Schicksalsstreich, als er während eines schweren
französischen Angriffs der stark unter Feuer liegenden Batterie die
nötige Munition über freies Gelände herantrug, und so die Feuerkraft
aufrecht hielt. Er gab uns allen, Offizieren wie Mannschaften, nochmals
ein Beispiel deutschen Mutes; dann ging er von uns und ließ uns mit
blutendem Herzen zurück. Seine Verdienste wurden auch von höherer Seite
anerkannt. Er ist der einzige Angehörige der Batterie, der gleichzeitig
zum Eisernen Kreuz zweiter Klasse und zum Bayerischen Militärverdienstkreuz
vorgeschlagen wurde. Ersteres ist seinen Angehörigen bereits zugegangen,
das Besitzzeugnis zum letzteren wird demnächst zugeleitet werden können.
Sie aber, hochverehrter Herr Bürgermeister, bitte ich, der Gemeinde Geroda
Kenntnis geben zu wollen, welchen Verlust sie erlitten hat. Möge die
Erinnerung an Max Strauß in Geroda fortleben als die eines tüchtigen,
edlen, lieben Menschen. Mögen die jungen Männer ihrer Gemeinde an seinem
Beispiel lernen die Liebe und Treue zu Kaiser und Reich, den
rücksichtslosen Einsatz für unsere große, heilige Sache, treueste
Pflichterfüllung bis zum letzten Atemzug. Gez. Hollidth, Hauptmann und
Batteriechef.'" Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Oktober 1916:
"Geroda, 6. Oktober (1916). Vom Kultusvorstand der
Synagogengemeinde Geroda geht uns nachstehende Abschrift mit dem Ersuchen
zu, dieselbe als Bericht zu veröffentlichen: 'Im Felde, 16. September
1916. Abschrift. An das hochwohllöbliche Bürgermeisteramt Geroda. Es ist
mir ein dringendes Bedürfnis, der Gemeinde Geroda mitzuteilen, welch
schmerzlichen, unersetzlichen Verlust die Batterie durch den Heldentod des
Kanoniers Max Strauß, eines Mitgliedes ihrer Gemeinde, erlitten
hat. Ich fühle mich umso eher dazu verpflichtet, indem ich dem Helden
noch den letzten Liebesdienst erweisen kann, indem ich der gesamten
Gemeinde klarlege, wie stolz sie auf ihren Angehörigen sein darf. Max
Strauß war einer der unerschrockensten, tapfersten Leute meiner Batterie.
Er war ein ganzer Mann, furchtlos und treu wie Gold, ein Mann mit hochanständigem
Charakter, mit einwandfreier Gesinnung, mit kindlich anhänglichem Gemüt,
ein Musterbeispiel für die ganze Batterie in Bezug auf strengste
Pflichterfüllung, auf tadellose kameradschaftliche Führung. So steht er
noch vor mir, so habe ich ihn gern gehabt, so habe ich ihm vertraut als
einem meiner Besten, so werde ich ihn in treuer Erinnerung behalten,
dankbar für das, was er mir, meiner Batterie und damit dem ganzen
Vaterlande geleistet hat. Schon manchem habe ich den letzten Gruß und
Dank nachgerufen, noch nie aber ist mir der Abschied, das Bewusststein der
endgültigen Trennung so schwer gefallen. Er starb, mir mehr als Kanonier.
Er empfing den Schicksalsstreich, als er während eines schweren
französischen Angriffs der stark unter Feuer liegenden Batterie die
nötige Munition über freies Gelände herantrug, und so die Feuerkraft
aufrecht hielt. Er gab uns allen, Offizieren wie Mannschaften, nochmals
ein Beispiel deutschen Mutes; dann ging er von uns und ließ uns mit
blutendem Herzen zurück. Seine Verdienste wurden auch von höherer Seite
anerkannt. Er ist der einzige Angehörige der Batterie, der gleichzeitig
zum Eisernen Kreuz zweiter Klasse und zum Bayerischen Militärverdienstkreuz
vorgeschlagen wurde. Ersteres ist seinen Angehörigen bereits zugegangen,
das Besitzzeugnis zum letzteren wird demnächst zugeleitet werden können.
Sie aber, hochverehrter Herr Bürgermeister, bitte ich, der Gemeinde Geroda
Kenntnis geben zu wollen, welchen Verlust sie erlitten hat. Möge die
Erinnerung an Max Strauß in Geroda fortleben als die eines tüchtigen,
edlen, lieben Menschen. Mögen die jungen Männer ihrer Gemeinde an seinem
Beispiel lernen die Liebe und Treue zu Kaiser und Reich, den
rücksichtslosen Einsatz für unsere große, heilige Sache, treueste
Pflichterfüllung bis zum letzten Atemzug. Gez. Hollidth, Hauptmann und
Batteriechef.'" |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9.
März 1917 (nur der Anfang dieses Artikels wird zitiert): "Würzburg,
2. März (1917). Die Israelitische Lehrerbildungsanstalt in Würzburg
versendet den Rechenschaftsbericht für das zweiundfünfzigste Jahr ihres
Bestehens (1915/16), dem wir die folgenden Mitteilungen entnehmen: Fast
alle Schüler der sechsten Klasse sowie ein großer Teil der fünften
Klasse stehen noch im Felde, mehrere von ihnen liegen teilweise schwer,
teilweise leicht verwundet in verschiedenen Lazaretten. Tief zu beklagen
hat die Anstalt den Tod eines braven, fleißigen, im Schul- und
Militärleben besonders beliebten Schülers, Max Strauß aus Geroda,
der vor einigen Monaten auf dem Felde der Ehre gefallen ist...." Artikel
in der Zeitschrift "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9.
März 1917 (nur der Anfang dieses Artikels wird zitiert): "Würzburg,
2. März (1917). Die Israelitische Lehrerbildungsanstalt in Würzburg
versendet den Rechenschaftsbericht für das zweiundfünfzigste Jahr ihres
Bestehens (1915/16), dem wir die folgenden Mitteilungen entnehmen: Fast
alle Schüler der sechsten Klasse sowie ein großer Teil der fünften
Klasse stehen noch im Felde, mehrere von ihnen liegen teilweise schwer,
teilweise leicht verwundet in verschiedenen Lazaretten. Tief zu beklagen
hat die Anstalt den Tod eines braven, fleißigen, im Schul- und
Militärleben besonders beliebten Schülers, Max Strauß aus Geroda,
der vor einigen Monaten auf dem Felde der Ehre gefallen ist...." |
Moses Strauß ist 25 Jahre Gemeindevorsteher (1929)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Januar 1929: "Geroda,
7. Januar (1929). Herr Moses Strauß sieht auf eine 25jährige
Amtswirksamkeit als zuverlässiger Gemeindevorsteher der Gemeinde
zurück. Was dieser treffliche Mann zur Erhaltung des gutreligiösen
Charakters der Gemeinde in diesem Vierteljahrhundert geleistet hat, wird
ihm an diesem Tage von seinen Freunden aufrichtig gedankt. (Alle Gute) bis
100 Jahre." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Januar 1929: "Geroda,
7. Januar (1929). Herr Moses Strauß sieht auf eine 25jährige
Amtswirksamkeit als zuverlässiger Gemeindevorsteher der Gemeinde
zurück. Was dieser treffliche Mann zur Erhaltung des gutreligiösen
Charakters der Gemeinde in diesem Vierteljahrhundert geleistet hat, wird
ihm an diesem Tage von seinen Freunden aufrichtig gedankt. (Alle Gute) bis
100 Jahre." |
80. Geburtstag von Fanni Halle (1930)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1930: "Geroda
(Unterfranken), 14. Januar (1930). In voller Rüstigkeit feiert am 21.
Januar Frau Fanni Halle, früher wohnhaft in Hanau, im Kreise ihrer
Angehörigen ihren 80. Geburtstag. Wir wünschen der Jubilarin einen recht
frohen Lebensabend! (Alles Gute) bis 120 Jahre." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1930: "Geroda
(Unterfranken), 14. Januar (1930). In voller Rüstigkeit feiert am 21.
Januar Frau Fanni Halle, früher wohnhaft in Hanau, im Kreise ihrer
Angehörigen ihren 80. Geburtstag. Wir wünschen der Jubilarin einen recht
frohen Lebensabend! (Alles Gute) bis 120 Jahre." |
Zum Tod von Fanni Halle (1930)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Mai 1930: "Geroda,
2. Mai (1930). In unserer Gemeinde wurde am Pessach-Fest die Feiertags-Stimmung
in trauriger Weise durchbrochen- Frau Fanni Halle verschied am siebenten
Festtage (= 19. April 1930), nachdem sie vor drei Monaten noch ihren 80.
Geburtstag hatte begehen könnten. Seit drei Jahren lebte sie in unserer
Mitte im Hause ihres Neffen, des Kultusvorstandes M. Strauss. Die ganze
Gemeinde blickte mit heiliger Ehrfurcht zu dieser frommen Erscheinung
empor. Sie war in Poppenlauer
(Unterfranken) geboren und eine Schwester des Rabbiners Hirsch, des
noch heute in Bayern und darüber hinaus unvergesslichen Begründers der
Präparandenschule Burgpreppach.
Verheiratet war sie mit dem Lehrer Simon Halle in Hanau, der ihr im Jahre
1919 ins Jenseits vorausgegangen... Am Tag nach dem Fest kam
die edle Frau an der Seite ihres Gatten hier in Geroda zur ewigen Ruhe.
Lehrer Siegfried Strauß konnte ihr in Hinsicht auf diesen Tag nur wenige
Worte des Nachrufes widmen. Die Anteilnahme der Gemeinde aber war
allgemein. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Mai 1930: "Geroda,
2. Mai (1930). In unserer Gemeinde wurde am Pessach-Fest die Feiertags-Stimmung
in trauriger Weise durchbrochen- Frau Fanni Halle verschied am siebenten
Festtage (= 19. April 1930), nachdem sie vor drei Monaten noch ihren 80.
Geburtstag hatte begehen könnten. Seit drei Jahren lebte sie in unserer
Mitte im Hause ihres Neffen, des Kultusvorstandes M. Strauss. Die ganze
Gemeinde blickte mit heiliger Ehrfurcht zu dieser frommen Erscheinung
empor. Sie war in Poppenlauer
(Unterfranken) geboren und eine Schwester des Rabbiners Hirsch, des
noch heute in Bayern und darüber hinaus unvergesslichen Begründers der
Präparandenschule Burgpreppach.
Verheiratet war sie mit dem Lehrer Simon Halle in Hanau, der ihr im Jahre
1919 ins Jenseits vorausgegangen... Am Tag nach dem Fest kam
die edle Frau an der Seite ihres Gatten hier in Geroda zur ewigen Ruhe.
Lehrer Siegfried Strauß konnte ihr in Hinsicht auf diesen Tag nur wenige
Worte des Nachrufes widmen. Die Anteilnahme der Gemeinde aber war
allgemein. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zum Tod von Sara Heß (1935)
Anmerkung: es handelt sich um Sara Hess geb. Weigersheimer, geb. 23. April 1864
in Hessdorf, war verheiratet mit Viehhändler Lazarus Hess (geb. 21. Dezember
1866 in Geroda, gest. 29. November 1934 in Geroda). Die beiden waren die Eltern
des späteren Lehrers Benno Hess (siehe unten).
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Dezember 1935: "Geroda
Ufr., 24. November. Im Alter von 71 Jahren ging Frau Sara Heß von uns.
Sie war Vorbild der ganzen Gemeinde in ihrer Schlichtheit, tiefen
Frömmigkeit und echt jüdischen Häuslichkeit. Anspruchslos und
genügsam, war sie Anderen gegenüber stets opferbereit und überaus
wohltätig. Viele und schwere Prüfungen waren ihr auferlegt, aber alle
hatte sie, wie unsere Stammmutter Sara, mit Heldenmut und Standhaftigkeit
ertragen; nie kam ein lauter Klageton über ihre Lippen. Der Heimgang
dieser überaus geachteten und liebevollen Frau bedeutet einen schweren
Verlust für die Familie und für die Gemeinde. Möge ihre sechut
(ihr Verdienst) ihren 8 Kindern und uns allen beistehen. Ihre
Seele sei eingebunden in den Bund des Leben. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Dezember 1935: "Geroda
Ufr., 24. November. Im Alter von 71 Jahren ging Frau Sara Heß von uns.
Sie war Vorbild der ganzen Gemeinde in ihrer Schlichtheit, tiefen
Frömmigkeit und echt jüdischen Häuslichkeit. Anspruchslos und
genügsam, war sie Anderen gegenüber stets opferbereit und überaus
wohltätig. Viele und schwere Prüfungen waren ihr auferlegt, aber alle
hatte sie, wie unsere Stammmutter Sara, mit Heldenmut und Standhaftigkeit
ertragen; nie kam ein lauter Klageton über ihre Lippen. Der Heimgang
dieser überaus geachteten und liebevollen Frau bedeutet einen schweren
Verlust für die Familie und für die Gemeinde. Möge ihre sechut
(ihr Verdienst) ihren 8 Kindern und uns allen beistehen. Ihre
Seele sei eingebunden in den Bund des Leben. |
Zum Tod von Moses Strauß im September 1937 - 30 Jahre lang Gemeindevorsteher
 Artikel
aus der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung vom 15. September 1937:
"Moses Strauß s.A. Geroda. Am 2. September haben wir Moses
Strauß, den Vorstand unserer Gemeinde, zu Grabe gebracht. Eine der
markantesten Persönlichkeiten der unterfränkischen Kleingemeinden ist
mit ihm dahingegangen, ein wahrhaft frommer und charaktersvoller Mensch,
der jede freie Minute seines Lebens seiner Gemeinde, die er über 30 Jahre
lang leitete, widmete. Zeugen seiner Wirksamkeit in Geroda sind die neue
Synagoge, der Friedhof und die Mikwoh, die er geschaffen, bevor der
Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden seine segensreiche Tätigkeit
entfaltete. Solche Einrichtungen in einem kleinen Rhöndorfe zu schaffen,
ohne Unterstützungen von Verbänden und Organisationen, das erfordert
Energie und ein unbeugsames Vertrauen. Diese Eigenschaften besaß Moses Strauß;
sie erwiesen sich als Segen für seine Gemeinde und für den Bezirk Bad
Kissingen, dessen Kassier er lange Jahre war. Zu seiner Beerdigung waren
von nah und fern die Freunde herbeigeeilt, um ihm die letzte Ehre zu
erweisen. An seinem Grabe sprachen Worte des Schmerzes und der Erinnerung:
Rabbiner Dr. Ephraim, Bad Kissingen, Rabbiner Dr. Weinberg, Würzburg, ein
Verwandter der Familie, Hauptlehrer Adler, München, der Neffe des
Heimgegangenen, Lehrer Strauß, Mittelsinn, der Sohn und Lehrer Katz,
Frankfurt, der Schwiegersohn des Verstorbenen, Lehrer Kahn, Geroda und ein
Vertreter der Gemeinde Mittelsinn, Herr Herz. Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. Artikel
aus der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung vom 15. September 1937:
"Moses Strauß s.A. Geroda. Am 2. September haben wir Moses
Strauß, den Vorstand unserer Gemeinde, zu Grabe gebracht. Eine der
markantesten Persönlichkeiten der unterfränkischen Kleingemeinden ist
mit ihm dahingegangen, ein wahrhaft frommer und charaktersvoller Mensch,
der jede freie Minute seines Lebens seiner Gemeinde, die er über 30 Jahre
lang leitete, widmete. Zeugen seiner Wirksamkeit in Geroda sind die neue
Synagoge, der Friedhof und die Mikwoh, die er geschaffen, bevor der
Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden seine segensreiche Tätigkeit
entfaltete. Solche Einrichtungen in einem kleinen Rhöndorfe zu schaffen,
ohne Unterstützungen von Verbänden und Organisationen, das erfordert
Energie und ein unbeugsames Vertrauen. Diese Eigenschaften besaß Moses Strauß;
sie erwiesen sich als Segen für seine Gemeinde und für den Bezirk Bad
Kissingen, dessen Kassier er lange Jahre war. Zu seiner Beerdigung waren
von nah und fern die Freunde herbeigeeilt, um ihm die letzte Ehre zu
erweisen. An seinem Grabe sprachen Worte des Schmerzes und der Erinnerung:
Rabbiner Dr. Ephraim, Bad Kissingen, Rabbiner Dr. Weinberg, Würzburg, ein
Verwandter der Familie, Hauptlehrer Adler, München, der Neffe des
Heimgegangenen, Lehrer Strauß, Mittelsinn, der Sohn und Lehrer Katz,
Frankfurt, der Schwiegersohn des Verstorbenen, Lehrer Kahn, Geroda und ein
Vertreter der Gemeinde Mittelsinn, Herr Herz. Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. |
| |
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. September 1937:
"Geroda, 3. September (1937). Am 27. Elul haben wir
Moses Strauß zu Grabe gebracht, diesen edlen, charaktervollen und klugen
Menschen, der als Vorsteher seiner Gemeinde allen
Mitgliedern stets mit Rat und Tat und Hilfe zur Seite stand und der jede
freie Minute seines Lebens die ganze Kraft seines Körpers und Geistes
seiner Gemeinde widmete. In seiner mehr als dreißigjährigen
Tätigkeit als Vorsteher der Gemeinde Geroda schuf er eine neue Synagoge,
einen Friedhof und eine neue Mikwe und das alles zu einer
Zeit, als der Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden seine
segensreiche Tätigkeit noch nicht entfaltet. Aber er stellte nicht nur
eine Synagoge hin, er sorgte auch dafür, dass in ihr Tag für Tag
gebetet wurde. Es ist sicher vor allem sein Werk, dass Geroda eine
vorbildlich fromme Gemeinde wurde und blieb. Sein Beispiel riss die
Gemeinde mit, wohl nie versäumte er einen Gottesdienst, wenn seine Körperkräfte
gerade noch ausreichten, dass er sich ins Gotteshause schleppen konnte. So
sorgte er für seine Gemeinde, so sorgte er als Kassier der
Bezirksgemeinden Bad Kissingen für seinen Bezirk, so sorgte er auch für
jedes einzelne Mitglied seiner Gemeinde. Er war der Freund und Berater
jedes Einzelnen, an dessen Freude und an dessen Leiden er den regesten
Anteil nahm. Wahrlich, solange noch eine jüdische Seele in Geroda haust,
wird man von Moses Strauß sprachen und mit Stolz von ihm
erzählen.
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. September 1937:
"Geroda, 3. September (1937). Am 27. Elul haben wir
Moses Strauß zu Grabe gebracht, diesen edlen, charaktervollen und klugen
Menschen, der als Vorsteher seiner Gemeinde allen
Mitgliedern stets mit Rat und Tat und Hilfe zur Seite stand und der jede
freie Minute seines Lebens die ganze Kraft seines Körpers und Geistes
seiner Gemeinde widmete. In seiner mehr als dreißigjährigen
Tätigkeit als Vorsteher der Gemeinde Geroda schuf er eine neue Synagoge,
einen Friedhof und eine neue Mikwe und das alles zu einer
Zeit, als der Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden seine
segensreiche Tätigkeit noch nicht entfaltet. Aber er stellte nicht nur
eine Synagoge hin, er sorgte auch dafür, dass in ihr Tag für Tag
gebetet wurde. Es ist sicher vor allem sein Werk, dass Geroda eine
vorbildlich fromme Gemeinde wurde und blieb. Sein Beispiel riss die
Gemeinde mit, wohl nie versäumte er einen Gottesdienst, wenn seine Körperkräfte
gerade noch ausreichten, dass er sich ins Gotteshause schleppen konnte. So
sorgte er für seine Gemeinde, so sorgte er als Kassier der
Bezirksgemeinden Bad Kissingen für seinen Bezirk, so sorgte er auch für
jedes einzelne Mitglied seiner Gemeinde. Er war der Freund und Berater
jedes Einzelnen, an dessen Freude und an dessen Leiden er den regesten
Anteil nahm. Wahrlich, solange noch eine jüdische Seele in Geroda haust,
wird man von Moses Strauß sprachen und mit Stolz von ihm
erzählen.
Aber in der großen Arbeit für die jüdische Gesamtheit
vergaß er doch nie daran, dass der jüdische Mensch auch Pflichten gegen
sich selbst hat, nämlich zu lernen'. In jeder freien Minute nahm er sein Sefer
(Buch, Tora) und lernte, und wenn ihm schon vor vielen Jahren der Chower-Titel
(Ehrenrabbiner) verliehen wurde, so beweist das mehr als alle
Ausführungen es vermögen, wie ernst er dies Lernen genommen
hatte.
Aus nah und fern waren die Freunde herbeigeeilt. Vor seinem Hause, in dem
er seine segensreiche Tätigkeit entfaltet, sprachen der Lehrer der
Gemeinde Geroda, Herr Kahn, der Sohn Lehrer (Siegfried) Strauß, Mittelsinn,
Herr Rabbiner Dr. Weinberg, Würzburg, und der Schwiegersohn Lehrer Katz
in Frankfurt Worte des Dankes und der Erinnerung. Auf dem Friedhof, den
der Heimgegangene ja selbst geschaffen, widmeten ihm Nachrufe Herr
Bezirksrabbiner Dr. Ephraim, Bad Kissingen für den Bezirk und den
Verband, der Neffe Herr Hauptlehrer Adler, München, für die Familie und
Herr Herz, Mittelsinn, für die Gemeinde Mittelsinn. Seine Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens."
|
Hinweise auf die aus Geroda
stammenden Lehrer Abraham Heß und Benno Heß
Quellen: Reiner Strätz: Biographisches Handbuch der Würzburger
Juden Bd. 1 S. 258; zu Abraham Heß
https://www.bllv.de/projekte/geschichte-bewahren/erinnerungsarbeit/datenbank-jued-lehrer/datenbank;
ergänzende Informationen von Hans-Ulrich Dillmann; zu Benno Heß: Historisches
Handbuch der jüd. Gemeinden in Niedersachsen und Bremen II S. 1257-1258 sowie
https://spurenimvest.de/2020/10/14/kywi-valeska/.
| Abraham Heß: geb. am 5. Juli 1895 in Geroda als Sohn des Viehhändlers Salomon Heß und seiner Frau Therese
geb. Silberthau; die
Israelitische Präparandenschule Burgpreppach
und studierte anschließend an der Israelitischen
Lehrerbildungsanstalt (ILBA) in Würzburg. Nach dem Ersten Weltkrieg
(Kriegsteilnehmer) war er
Lehrer und Kantor mit rabbinischer Funktion in
Miltenberg/Ufr. von 1919
bis 1939. Am 2. April 1920 trat Abraham Heß dem Bayerischen Lehrerverein bei.
Seine Frau Nanny geb. Freudenberger (geb. 14. August 1896 in
Memmelsdorf), die er am 15. März 1922 in Aschaffenburg geheiratet hatte, war
ebenfalls Lehrerin. Ihre Kinder Bella und Siegfried wurden am 27. September 1923
bzw. am 18. November 1930 in Miltenberg geboren. Ab 1939 wohnten sie in
Würzburg, zuletzt in der Bibrastraße 6. Auswanderungsversuche sind gescheitert.
Abraham Heß wurde am 29. November 1941 mit seiner Frau Nanny und den Kindern
Bella und Siegfried aus Würzburg nach Riga-Jungfernhof deportiert und im
Alter von 46 Jahren ermordet. |
| |
 Benno
Heß: geb. am 31. August 1900 in Geroda als Sohn von Viehhändler Lazarus
Heß und seiner Frau Sara geb. Weigersheimer (vgl. oben Artikel zum Tod von
Sara Heß 1935); war zur Ausbildung an der
Präparandenschule in Höchberg,
danach Seminarist an der Israelitischen
Lehrerbildungsanstalt in Würzburg; im Juni 1918 zum Militär eingezogen;
danach in Karlsruhe tätig; am 25. Januar 1930 von Karlsruhe nach
Lüdenscheid, wo er als Religionslehrer und Kantor angestellt wurde; erste
Eheschließung mit Frieda (Friedel) geb. Bacharach, mit er einen Sohn Joseph
hatte (geb. 13. August 1933); ab 1937 Lehrer in Papenburg (Ems; Abbildung
links Artikel zur Amtseinführung von Benno Heß in Papenburg am 17. Oktober
1937 in "Israelitisches Familienblatt" vom 28. Oktober 1937); nach dem
Novemberpogrom 1938 emigriert nach Kolumbien, ab 1955 in den USA, zweite
Eheschließung 1952 mit Valeska geb. Kywi; beide gest. in den USA:
https://de.findagrave.com/memorial/247904500/benno-hess; (Grab von Benno
Hess, gest. 12. November 1979)
https://de.findagrave.com/memorial/247904501/valeska-hess (Grab von
Valeska Hess, gest. 25. August 1995); weitere Informationen und Fotos siehe
https://spurenimvest.de/2020/10/14/kywi-valeska/ (u.a. Foto von Benno
Hess und mit einer Schulklasse in Lüdenscheid). Benno
Heß: geb. am 31. August 1900 in Geroda als Sohn von Viehhändler Lazarus
Heß und seiner Frau Sara geb. Weigersheimer (vgl. oben Artikel zum Tod von
Sara Heß 1935); war zur Ausbildung an der
Präparandenschule in Höchberg,
danach Seminarist an der Israelitischen
Lehrerbildungsanstalt in Würzburg; im Juni 1918 zum Militär eingezogen;
danach in Karlsruhe tätig; am 25. Januar 1930 von Karlsruhe nach
Lüdenscheid, wo er als Religionslehrer und Kantor angestellt wurde; erste
Eheschließung mit Frieda (Friedel) geb. Bacharach, mit er einen Sohn Joseph
hatte (geb. 13. August 1933); ab 1937 Lehrer in Papenburg (Ems; Abbildung
links Artikel zur Amtseinführung von Benno Heß in Papenburg am 17. Oktober
1937 in "Israelitisches Familienblatt" vom 28. Oktober 1937); nach dem
Novemberpogrom 1938 emigriert nach Kolumbien, ab 1955 in den USA, zweite
Eheschließung 1952 mit Valeska geb. Kywi; beide gest. in den USA:
https://de.findagrave.com/memorial/247904500/benno-hess; (Grab von Benno
Hess, gest. 12. November 1979)
https://de.findagrave.com/memorial/247904501/valeska-hess (Grab von
Valeska Hess, gest. 25. August 1995); weitere Informationen und Fotos siehe
https://spurenimvest.de/2020/10/14/kywi-valeska/ (u.a. Foto von Benno
Hess und mit einer Schulklasse in Lüdenscheid). |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeigen des Schneidermeisters Sal. Heß jr. (1901 / 1904)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. März 1901:
"Suche für meine an Schabbat und Feiertage geschlossene
Maßschneiderei bis Mai einen Lehrling. Garantiert gute Ausbildung,
sowie sofort einen Gehilfen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. März 1901:
"Suche für meine an Schabbat und Feiertage geschlossene
Maßschneiderei bis Mai einen Lehrling. Garantiert gute Ausbildung,
sowie sofort einen Gehilfen.
Salomon Heß junior, Schneidermeister, Geroda,
Unterfranken." |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 9. Mai 1904: "Zwei Schneidergehilfen suche per
sofort. Schabbos und Feiertage geschlossen. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 9. Mai 1904: "Zwei Schneidergehilfen suche per
sofort. Schabbos und Feiertage geschlossen.
Sal. Heß, Geroda (Bayern)." |
Verlobungsanzeige für Meta Weinberg und dem aus
Geroda stammenden Lehrer Willi Strauss (1928)
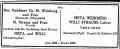 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1928: "Gott
sei gepriesen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1928: "Gott
sei gepriesen.
Bezirksrabbiner Dr. M. Weinberg und Frau, Neumarkt
(Oberpfalz) - M. Strauss und Frau, Geroda, beehren sich die
Verlobung ihrer Kinder Meta und Willi bekannt zu geben: Meta
Weinberg - Willi Strauss, Lehrer. Verlobte. Neumarkt (Oberpfalz) -
Frankfurt-Main, Zobelstraße 9II. Juni 1928 / Siwan 5688." |
| |
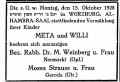 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober 1928:
"Die - so Gott will - Montag, den 15. Oktober 1928 - 1. Cheschwan
5689 - in Würzburg, Alhembra-Saal stattfindende Vermählung ihrer
Kinder Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober 1928:
"Die - so Gott will - Montag, den 15. Oktober 1928 - 1. Cheschwan
5689 - in Würzburg, Alhembra-Saal stattfindende Vermählung ihrer
Kinder
Meta und Willi beehren sich anzuzeigen
Bezirksrabbiner Dr. M. Weinberg und Frau Neumarkt
(Oberpfalz) -
Moses Strauss und Frau Geroda
(Unterfranken)." |
Verlobungsanzeige von Rosa Hess und Abraham Katzmann (1923)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. November 1923:
"Statt Karten. Rosa Hess - Abraham Katzmann. Verlobte. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. November 1923:
"Statt Karten. Rosa Hess - Abraham Katzmann. Verlobte.
Geroda, Kislew 5684 - 18. November 1923." |
Stellensuche von Samuel Frank für seine Tochter (1929)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. November 1929:
"Suche für meine Tochter, geprüfte Kindergärtnerin 2. Klasse mit
guten Zeugnissen passende Stelle. Samuel Frank, Geroda bei Bad
Kissingen." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. November 1929:
"Suche für meine Tochter, geprüfte Kindergärtnerin 2. Klasse mit
guten Zeugnissen passende Stelle. Samuel Frank, Geroda bei Bad
Kissingen." |
Heiratsanzeige von Isaak Hess und Lina Hahn
(1928)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1928:
"Isaak Hess - Lina Hess geb. Hahn. Vermählte. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1928:
"Isaak Hess - Lina Hess geb. Hahn. Vermählte.
Geroda - Nenzenheim /Bayern.
Trauung, 16. Dezember, Hotel Katzmann, Würzburg." |
Verlobungsanzeige von Ilse Katzmann und Esra Stein (1934)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober 1934:
"Gott sei gepriesen.
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober 1934:
"Gott sei gepriesen.
Ilse Katzmann - Esra Stein. Verlobte.
Geroda - 1. Cheschwan (= 10. Oktober 1934) - Schwäbisch
Hall." |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war eine erste Synagoge unbekannten Baujahres
vorhanden. 1840 musste sie dringend repariert werden, gleichfalls stand
der Bau eines jüdischen Schulhauses an. Die jüdischen Familien in Geroda waren
mit diesen Aufgaben finanziell überfordert und beantragten bei der Regierung die
Durchführung einer Kollekte. Diese erbracht 583 fl. So konnten die Bauprojekte
noch 1840/41 durchgeführt werden.
Kollekte zum Bau des jüdischen Schulhauses und die
Reparatur der Synagoge in Geroda (1840)
 Artikel
im "Intelligenzblatt von Unterfranken und Aschaffenburg des Königreichs
Bayern 4. Juni 1840: "29. Mai 1840. Artikel
im "Intelligenzblatt von Unterfranken und Aschaffenburg des Königreichs
Bayern 4. Juni 1840: "29. Mai 1840.
(Die Bitte der israelitischen Kultusgemeinde zu Geroda und Platz um
Bewilligung einer Kollekte bei allen jüdischen Gemeinden des Königreichs zum
Baue eines Schulhauses und zur Reparatur der Synagoge betreffend).
Im Namen Seiner Majestät des Königs. Die der israelitischen
Kultusgemeinde zu Geroda-Platz zum Zwecke der Erbauung eines Schulhauses und
der Reparatur zu Geroda allergnädigst bewilligte Kollekte hat den aus
nachstehenden Übersicht ersichtlichen Ertrag geliefert, was hiermit zu
öffentlichen Kenntnis gebracht wird. Würzburg, den 24. Mai 1840. Königliche Regierung von Unterfranken
und Aschaffenburg, Kammer des Innern. Stenglein, Direktor
c. Hübner.
Ertrag der Kollekte für die israelitische Kultusgemeinde zu Geroda und Pltaz
zum Baue eines Schulhauses und zur Reparatur der Synagoge..."
Nachstehend werden die aus den einzelnen Behörden und Ämtern
eingegangenen Beträge aufgeführt. Insgesamt erhielt die Gemeinde 583 fl. 33
1/2 Kr.
|
1904 wurde vom Kultusvorstand Moses Strauß per Anzeige eine gut
erhaltene Torarolle gesucht, die noch für den Gottesdienst in der alten Synagoge
benötigt wurde. Ob eine neue gefunden und - wie üblich - mit einem großen
Fest und einer Prozession eingeweiht werden konnte, ist nicht bekannt:
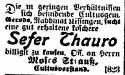 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Januar 1904: "Die
in geringen Verhältnissen sich befindende Kultusgemeinde Geroda, Rabbinat
Kissingen, sucht eine gut erhaltene koschere Sefer Thauro (Torarolle) billigst zu
kaufen. Offerten an Herrn Moses Strauß, Kultusvorstand." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Januar 1904: "Die
in geringen Verhältnissen sich befindende Kultusgemeinde Geroda, Rabbinat
Kissingen, sucht eine gut erhaltene koschere Sefer Thauro (Torarolle) billigst zu
kaufen. Offerten an Herrn Moses Strauß, Kultusvorstand." |
Die alte Synagoge wurde nach dem Neubau der Synagoge 1907
an den Geschäftsmann
Bernhard Strauss "Manufakturwaren und Maschinen" verkauft und von
diesem nach einem Um- und Anbau als Geschäftshaus genutzt. In den 1970er-Jahren
wurde das Gebäude abgebrochen und durch ein neues Wohnhaus ersetzt. Im Blick
auf die Renovierung oder den Bau einer neuen Synagoge und einer neuen Schule
erschienen 1904 Spendenaufrufe in jüdischen Periodika:
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
25. April 1904: "Werte Glaubensgenossen! Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
25. April 1904: "Werte Glaubensgenossen!
Die hiesige israelitische Kultusgemeinde, bestehend aus 19
Mitgliedern, befindet sich jetzt in großer Verlegenheit. Sie muss
nämlich die Synagoge sowie auch das Schulhaus vom Grunde auf renovieren
oder beide durch Neubauten ersetzen. Da es nun der Gemeinde, wie Sie aus
den unten abgedruckten Zeugnissen ersehen können, unmöglich ist, diesen
bedeutenden Kostenaufwand zu leisten, so ist erstere gezwungen, an den
Wohltätigkeitssinn edler Glaubensgenossen zu appellieren.
Wir bitten Sie deshalb ergebenst, uns durch einen Zuschuss oder durch Sammlungen
für diesen hehren und heiligen Zweck unterstützen zu wollen. Indem wir
Sie ersuchen, von den unten abgedruckten Zeugnissen gefälligst Notiz
nehmen zu wollen, zeichnen, Ihnen im Voraus besten Dank
sagend
Die Verwaltung der israelitischen Kultusgemeinde Geroda.
M. Strauss, Vorstand.
---
Bad Kissingen, 12. Februar 1904. Distrikts-Rabbinat Bad Kissingen.
Der Wahrheit gemäß wird andurch bezeugt, dass die Kultusgemeinde
Geroda-Platz-Schondra größtenteils aus Mitgliedern besteht, die
teilweise ganz unvermögend, teilweise wenig leistungsfähig sind. Nur mit
großer Anstrengung vermag die genannte Gemeinde die regelmäßigen
jährlichen Bedürfnisse aufzubringen. Gegenwärtig ist jedoch die
Gemeinde gezwungen, große Reparaturen bezw. Neubauten auszuführen, die
einen Kostenaufwand von ca. 10.000 Mark erfordern, weshalb dieselbe
gezwungen ist, an größere Gemeinden um Beihilfe sich zu wenden. Das
Distriktsrabbinat. Dr. S. Bamberger.
---
Zeugnis.
Auf Wunsch wird gerne bezeugt, dass sowohl die Synagoge, als auch das
Schulhaus der israelitischen Kultusgemeinde Geroda in einem sehr
baufälligen Zustande sich befinden und dass die Mitglieder der
israelitischen Kultusgemeinde absolut nicht im Stande sind, die Kosten
für Herrichtung obiger Gebäude aus eigenen Mitteln aufzubringen.
Geroda, den 1. Februar 1904.
Die Gemeindeverwaltung. Kohl, Bürgermeister." |
Die neue Synagoge wurde 1906/07 erbaut und am 16. August 1907 feierlich
eingeweiht. Der Aron-Ha-Kodesch stammte aus der ehemaligen Synagoge von Werneck
und war aus Sandstein gefertigt und in Ölfarbe gefasst. Über die Synagoge und
die anderen Einrichtungen wird 1927 berichtet:
Über den guten Zustand der Gemeinde und
ihrer Einrichtungen (1927)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. August 1927: "Geroda
(Unterfranken), 10. August (1927). Aus unserem ruhigen, in einem
lieblichen Talkessel gelegenen Rhöndorfe an der Strauße Bad Kissingen -
Brückenau dringt nur selten ein Bericht in die große Welt. Die kleine
jüdische Gemeinde zählt ungefähr 60 Seelen. Trotzdem pulsiert hier
wahres jüdisches Leben. Mustergültig sind alle Einrichtungen. Die neue,
hübsche ausgestattete Synagoge, abseits vom Lärm des Tages, ist von
einem blühenden Garten umgeben. Nur wenige Schritte davon entfernt
befindet sich das Schulhaus, neu hergerichtet und praktisch eingerichtet
mit einer neuen, zeitgemäß eingerichteten Mikwah. Der neue, vor
fünfzehn Jahren angelegte Friedhof, von
schattigem Laubwald umrauscht, ist etwa 15 Minuten vom Orte entfernt.
Früher wurden die Leichen nach dem ca. 20 Kilometer von hier entfernten
jüdischen Friedhof Pfaffenhausen bei
Hammelburg überführt. Alle diese Institutionen verkünden den
Opfersinn der kleinen, in Frieden und Eintracht lebenden Gemeinde. Das
hervorragendste Verdienst an ihrer Errichtung gebührt dem langjährigen,
unermüdlichen, tatkräftigen und selbstlosen Kultusvorstand Herrn Moses Strauß, der die Förderung seiner Gemeinde als das Ziel seines Lebens
betrachtet." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. August 1927: "Geroda
(Unterfranken), 10. August (1927). Aus unserem ruhigen, in einem
lieblichen Talkessel gelegenen Rhöndorfe an der Strauße Bad Kissingen -
Brückenau dringt nur selten ein Bericht in die große Welt. Die kleine
jüdische Gemeinde zählt ungefähr 60 Seelen. Trotzdem pulsiert hier
wahres jüdisches Leben. Mustergültig sind alle Einrichtungen. Die neue,
hübsche ausgestattete Synagoge, abseits vom Lärm des Tages, ist von
einem blühenden Garten umgeben. Nur wenige Schritte davon entfernt
befindet sich das Schulhaus, neu hergerichtet und praktisch eingerichtet
mit einer neuen, zeitgemäß eingerichteten Mikwah. Der neue, vor
fünfzehn Jahren angelegte Friedhof, von
schattigem Laubwald umrauscht, ist etwa 15 Minuten vom Orte entfernt.
Früher wurden die Leichen nach dem ca. 20 Kilometer von hier entfernten
jüdischen Friedhof Pfaffenhausen bei
Hammelburg überführt. Alle diese Institutionen verkünden den
Opfersinn der kleinen, in Frieden und Eintracht lebenden Gemeinde. Das
hervorragendste Verdienst an ihrer Errichtung gebührt dem langjährigen,
unermüdlichen, tatkräftigen und selbstlosen Kultusvorstand Herrn Moses Strauß, der die Förderung seiner Gemeinde als das Ziel seines Lebens
betrachtet." |
Beim Novemberpogrom 1938 wurde von SS-Leuten aus Geroda
und Helfern in die Synagoge und das jüdische Gemeindehaus eingebrochen und die
Inneneinrichtung zerstört. Die Torarollen und die Ritualien wurden im Garten
der Synagoge verbrannt. Es konnte nur eine Megilla (Rolle des Buches Ester) und
ein Schofar gerettet werden.
Das Gebäude der Synagoge blieb nach 1945 bestehen. Der Gesamteindruck
des Gebäudes, u.a. mit den Rundbogenfenster ist trotz einiger Umbauten (zuletzt
einer gelungenen Renovierung 1998/99 und dem dabei erfolgten Umbau zu einem
Gemeindehaus) weitgehend erhalten geblieben (nach kurzer Baubeschreibung des
Denkmalamtes: "tonnengewölbter Saalbau mit Satteldach"). Am Gebäude
befindet sich eine Gedenktafel mit folgendem Text: "Dieses Gebäude,
erbaut im Jahre 1907, die Inneneinrichtung wurde 1938 in der Pogromnacht
zerstört, diente der Jüdischen Kultusgemeinde Geroda als Synagoge. Zur
Erinnerung und Mahnung".
Nach 1945 wurden einige ehemalige SS-Leute aus Geroda wegen ihrer
Beteiligung beim Novemberpogrom 1938 vor Gericht gestellt. Sie wurden zu
Gefängnisstrafen verurteilt.
Adresse/Standort der Synagoge:
 | alte Synagoge in der Dorfstraße 11 (abgebrochen) |
 | die neue Synagoge von 1907 Kirchberg 6, zu erreichen über
das Grundstück Kirchberg 3 (= ehemaliges jüdisches Gemeindehaus mit
Schulräumen, Lehrerwohnung, daneben die Mikwe) |
Über den alten
Toraschrein der Synagoge Geroda (erstellt mit Hilfe von
Recherchen von Manfred Fuchs, Werneck): In der Synagoge in Geroda ist nach
dem Neubau 1907 vermutlich der Toraschrein aus Werneck
und nicht der Toraschrein aus der alten Synagoge Geroda aufgestellt
worden. Dieser alte Toraschrein (beziehungsweise Toraschrank) aus Geroda
kam in das damalige Fränkische Luitpoldmuseum in Würzburg (heute
Mainfränkisches Museum):
Quelle: August Stöhr: Bericht über die Neuerwerbungen des Fränkischen
Luitpoldmuseums zu Würzburg für die Jahre 1914 und 1915 S. 19: "Die
israelitische Gemeinde der Rhönorte Geroda, Platz und Schondra übergaben
als Geschenk einen reich geschnitzten, bunt gemalten und vergoldeten
Toraschrank vom Ende des 17. Jahrhunderts aus der Synagoge in Geroda".
Die Angabe, dass es sich um den Schrein aus der alten Synagoge in Geroda
gehandelt hat, ist allerdings nicht ganz eindeutig. Möglicherweise war
dies doch der Toraschrank aus Werneck, nachdem er einige Jahre in der
Synagoge Geroda gestanden hat. Im damaligen Fränkischen
Luitpoldmuseum befand sich auch der Toraschrein aus Platz
- oder ist mit der Angabe von Stör die Übergabe des Toraschreines aus
Platz und nicht die Übergabe eines Toraschrankes aus Geroda
gemeint? Der oder die Toraschränke sind bei den Luftangriffen auf
Würzburg im Zweiten Weltkrieg verbrannt. Die beiden Fotos auf den Seiten
zu Geroda und Platz zeigen jedenfalls
unterschiedliche Toraschränke. |
Fotos
Historisches Foto des
Toraschrankes
(ursprünglich aus Werneck?)
(Quelle Foto links: The Encyclopedia of
Jewish Life s. Lit. Bd. 1 S.
427) |
 |
| |
|
| |
|
|
Fotos aus den 1980er-Jahren
(Quelle: Schwierz s.Lit. S. 56-57) |
 |
 |
| |
Die ehemalige
Synagoge |
Das Gebäude der ehemaligen
Schule |
| |
|
|
Neueres Foto von 2004
(Foto: Jürgen Hanke, Kronach
aus www.synagogen.info) |
 |
|
| |
|
|
| |
|
|
Fotos von 2007
(Fotos: Hahn,
Aufnahmedatum 31.5.2007) |
 |
| |
Blick auf das
Gebäude Dorfstraße 11 (mit Balkonen), an dessen Stelle sich
bis 1907 die
alte Synagoge befand. |
| |
|
 |
 |
 |
| |
Heutiges Eingangsportal |
Seitenfenster |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Blick auf die
ehemalige Synagoge |
Das Foto zeigt die
unmittelbare Nähe
zwischen evangelischer Kirche (links)
und ehemaliger
Synagoge (rechts) |
| |
| |
|
| |
|
Die ehemalige
jüdische
Schule |
 |
 |
|
Blick auf die ehemalige
jüdische Schule |
|
| |
|
|
Das jüdische Bad
(Mikwe) |
 |
 |
| |
Blick auf das
jüdische Badehaus (Mikwe) |
| |
|
Vor der Kirche:
Gefallenendenkmal |
 |
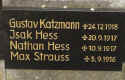 |
| |
Die Namen der vier
jüdischen Gefallenen sind ergänzt |
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
September 2007:
Bericht über die Lebensgeschichte von Heinz
Katzmann / Harry Katzman
Anmerkung: Heinz Katzmann war in der Dorfstraße 7 aufgewachsen. Seine
Familie konnte auf Grund von Warnhinweisen rechtzeitig in die USA
emigrieren. Heinz Katzmann - inzwischen Harry Katzman kam 1945 mit den
US-Soldaten nach Deutschland, verhinderte eine Bombardierung von Geroda
und war als amerikanischer Captain nach Kriegsende für den Altlandkreis
Brückenau zuständig. Hans Wirth aus Geroda, der seit Kindheit mit Heinz
Katzmann befreundet war, hielt am Kontakt fest (Artikel erhalten von
Gerhard Kreile). |
 Artikel
in der "Saale-Zeitung" vom 29. September 2007: "Sie
blieben Freunde in harter Zeit. Als langjährige Nachbarn plötzlich
bedroht und verfolgt wurden - Lehrerprügel und Schülerspott. Artikel
in der "Saale-Zeitung" vom 29. September 2007: "Sie
blieben Freunde in harter Zeit. Als langjährige Nachbarn plötzlich
bedroht und verfolgt wurden - Lehrerprügel und Schülerspott.
GERODA-PLATZ. Wenn Hans Wirth an seine Jugend zurückdenkt, überkommt den
83-Jährigen Bitterkeit. Noch heute quälen ihn Erinnerungen an das, was
sein Schulfreund Heinz und dessen Familie in Geroda aushalten mussten. Wie
sie, die seit Generationen in bester Nachbarschaft in der kleinen Gemeinde
gelebt hatten, plötzlich diffamiert, geschlagen und bedroht wurden, nur
weil sie Juden waren. Und dennoch hat einer von ihnen Geroda kurz vor
Kriegsende vor der Bombardierung und Vernichtung gerettet...".
(zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken) |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 297-298. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 55-58. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 442-445.
|
 | Cornelia Binder und Michael (Mike) Mence: Last Traces /
Letzte Spuren von Deutschen jüdischen Glaubens im Landkreis Bad Kissingen.
Schweinfurt 1992. |
 | dieselben: Nachbarn der Vergangenheit / Spuren von
Deutschen jüdischen Glaubens im Landkreis Bad Kissingen mit dem Brennpunkt
1800 bis 1945 / Yesteryear's Neighbours. Traces of German Jews in the administrative district of Bad Kissingen focusing on the period
1800-1945. Erschienen 2004. ISBN 3-00-014792-6. Zu beziehen bei den
Autoren/obtainable from: E-Mail.
Info-Blatt
zu dieser Publikation (pdf-Datei).
|
 | Dirk Rosenstock (Bearbeiter): Die unterfränkischen
Judenmatrikeln von 1817. Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg.
Band 13. Würzburg 2008. S. 98. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Geroda Lower Franconia. The
Jewish community numbered 63 in 1880 (total 691) and 43 in 1933, mostly engaged
in farming. The community maintained a synagogue, rebuilt in 1907, and a
cemetery, consecrated in 1910, which served other communities as well. On Kristallnacht
(9-10 November 1938), jews were severely beaten and two were murdered in the Dachau
concentration camp and the synagogue was wrecked. In all 29 Jews managed to
leave Geroda in 1936-1941, ten emigrating from Germany. The rest were went to
the Dachau and Buchenwald concentration camps, Izbica in the Lublin district
(Poland) and the Theresienstadt ghetto in 1941-42.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|