|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge
in Zweibrücken
Zweibrücken (Rheinland-Pfalz)
Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte der Stadt
Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit
Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Zweibrücken wurden in jüdischen Periodika
gefunden.
Bei Gelegenheit werden weitere Texte ergänzt. Neueste Ergänzung vom
11.4.2015.
Übersicht:
Aus
der Geschichte der Lehrer / Vorbeter / Schächter und der jüdischen Schule
Ausschreibung
der Stelle des Religionslehrers, Kantors und Schochet (1889)
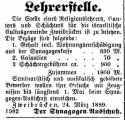 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1889: "Lehrerstelle. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1889: "Lehrerstelle.
Die
Stelle eines Religionslehrers, Kantors und Schächters für die
israelitische Kultusgemeinde Zweibrücken ist zu besetzen. Die Bezüge
sind folgende:
1. Gehalt inklusive Wohnungsentschädigung aus der
Synagogenkasse 830 Mark,
2.
Kasualien 70 Mark,
3. Schächtergebühren
ca. 900 Mark.
Zusammen 1.800 Mark.
Seminaristisch und musikalisch
gebildete Bewerber wollen ihre Gesuche mit Zeugnissen bis längstens 1.
Mai beim Synagogen-Ausschuss einreichen. Zweibrücken, 24. März 1889. Der
Synagogenausschuss." |
Zum Tod des Lehrers Salomon Reitlinger
(Lehrer in
Zweibrücken 1857-1889)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni 1892: "Zweibrücken. 20. Mai
(1892). Unser greiser Mitbürger Herr Salomon Reitlinger, israelitischer
Lehrer in Pension, welcher noch vor einigen Tagen unter allgemeiner
Anteilnahme seiner zahlreichen Freunde und Bekannten aus Nah und Fern in
aller erfreulicher Frische seinen 80. Geburtstag beging, ist gestern
Nachmittag nach kurzem Krankenlager entschlafen. Mit seinem Dahinscheiden
hat ein arbeitsames, im Beruf, wie in der Familie reich gesegnetes Leben
seinen Abschluss gefunden. Geboren am 12. Mai 1812 zu Wallerstein bei Nördlingen,
widmete sich Herr Reitlinger dem Lehrerberuf und kam 1849 von Feuchtwangen
in die Pfalz, wo er in Pirmasens, Edenkoben,
Brücken, Thaleischweiler,
Essingen und von 1857 bis 1889 in unserer Stadt mit hingebender Treue des
Amtes eines israelitischen Lehrers und Kantors waltete. Einen ergreifenden
Beweis von der großen Liebe und Achtung, welche er sich während der
langen Zeit seiner Wirksamkeit in hiesiger Stadt zu erwerben verstand,
bildeten die herzlichen Kundgebungen zu seinem 80. Geburtsfeste, des
Tates, welcher sich für den alten Herrn zu einem Ehrentage gestaltete." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni 1892: "Zweibrücken. 20. Mai
(1892). Unser greiser Mitbürger Herr Salomon Reitlinger, israelitischer
Lehrer in Pension, welcher noch vor einigen Tagen unter allgemeiner
Anteilnahme seiner zahlreichen Freunde und Bekannten aus Nah und Fern in
aller erfreulicher Frische seinen 80. Geburtstag beging, ist gestern
Nachmittag nach kurzem Krankenlager entschlafen. Mit seinem Dahinscheiden
hat ein arbeitsames, im Beruf, wie in der Familie reich gesegnetes Leben
seinen Abschluss gefunden. Geboren am 12. Mai 1812 zu Wallerstein bei Nördlingen,
widmete sich Herr Reitlinger dem Lehrerberuf und kam 1849 von Feuchtwangen
in die Pfalz, wo er in Pirmasens, Edenkoben,
Brücken, Thaleischweiler,
Essingen und von 1857 bis 1889 in unserer Stadt mit hingebender Treue des
Amtes eines israelitischen Lehrers und Kantors waltete. Einen ergreifenden
Beweis von der großen Liebe und Achtung, welche er sich während der
langen Zeit seiner Wirksamkeit in hiesiger Stadt zu erwerben verstand,
bildeten die herzlichen Kundgebungen zu seinem 80. Geburtsfeste, des
Tates, welcher sich für den alten Herrn zu einem Ehrentage gestaltete." |
Anzeige der Frau von Lehrer Max Bachenheimer (1901)
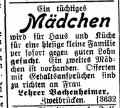 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. April 1901: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. April 1901:
"Ein tüchtiges
Mädchen
wird für Haus und Küche für eine hiesige kleine Familie per sofort
gegen guten Lohn gesucht. Ein zweites Mädchen ist vorhanden.
Offerten mit Gehaltsansprüchen sind zu richten an Frau
Lehrer Bachenheimer, Zweibrücken." |
Zum 40jährigen Dienstjubiläum von Max Bachenheimer
(Lehrer in Zweibrücken 1889-1929)
 Artikel in
der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 11. Januar 1929.
"Zweibrücken.
Ein allgemein bekannter Kultusbeamter, Lehrer und Kantor Max Bachenheimer,
tritt nach jahrzehntelanger Berufsarbeit am 1. Oktober in den
wohlverdienten Ruhestand. In diesen Tagen sind gerade 40 Jahre verflossen,
seitdem er im September 1889 seine Wirksamkeit in Zweibrücken begann.
Bereits vorher hatte er sechs Jahre Dienst als Volksschullehrer getan. In Zweibrücken, seiner zweiten Heimat war der nun aus dem Amt Scheidende während
der ganzen Zeit als israelitischer Religionslehrer an den Volksschulen tätig,
ferner über 30 Jahre an der Oberrealschule, 16 Jahre am humanistischen
Gymnasium. Daneben versah er den Kantordienst in seiner Kultusgemeinde,
den er unter dem inzwischen gestorbenen Bezirksrabbiner Dr. Mayer begann.
Für seine Verdienste im Seelsorgerdienst während der Kriegsjahre erhielt
er das König-Ludwig-Kreuz. Auf schwierigem Posten hat er ein Lebenswerk
geschaffen, das ihm reiche Anerkennung einbrachte. Möge ihm noch ein
langer, glücklicher Ruhestand beschieden sein." Artikel in
der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 11. Januar 1929.
"Zweibrücken.
Ein allgemein bekannter Kultusbeamter, Lehrer und Kantor Max Bachenheimer,
tritt nach jahrzehntelanger Berufsarbeit am 1. Oktober in den
wohlverdienten Ruhestand. In diesen Tagen sind gerade 40 Jahre verflossen,
seitdem er im September 1889 seine Wirksamkeit in Zweibrücken begann.
Bereits vorher hatte er sechs Jahre Dienst als Volksschullehrer getan. In Zweibrücken, seiner zweiten Heimat war der nun aus dem Amt Scheidende während
der ganzen Zeit als israelitischer Religionslehrer an den Volksschulen tätig,
ferner über 30 Jahre an der Oberrealschule, 16 Jahre am humanistischen
Gymnasium. Daneben versah er den Kantordienst in seiner Kultusgemeinde,
den er unter dem inzwischen gestorbenen Bezirksrabbiner Dr. Mayer begann.
Für seine Verdienste im Seelsorgerdienst während der Kriegsjahre erhielt
er das König-Ludwig-Kreuz. Auf schwierigem Posten hat er ein Lebenswerk
geschaffen, das ihm reiche Anerkennung einbrachte. Möge ihm noch ein
langer, glücklicher Ruhestand beschieden sein." |
Erhöhung des Zuschusses der Stadt zum
Gehalt des Religionslehrers (1911)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 24. März
1911: "Zweibrücken. Die Stadt erhöhte den Zuschuss zum
Gehalt des jüdischen Religionslehrers von 400 Mark auf 800 Mark. Dieser
Zuschuss ist ein Äquivalent für die Umlagen, die die jüdischen Bürger
für die allgemeinen Schulzwecke zahlen, zumal ja aus den Umlagen der
Juden auch der Religionsunterricht der Katholiken und der Protestanten
mitbezahlt wird." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 24. März
1911: "Zweibrücken. Die Stadt erhöhte den Zuschuss zum
Gehalt des jüdischen Religionslehrers von 400 Mark auf 800 Mark. Dieser
Zuschuss ist ein Äquivalent für die Umlagen, die die jüdischen Bürger
für die allgemeinen Schulzwecke zahlen, zumal ja aus den Umlagen der
Juden auch der Religionsunterricht der Katholiken und der Protestanten
mitbezahlt wird." |
Lehrer
Bernstein übernimmt die jüdische "Sonderklasse" in Kaiserslautern
(1936)
Anmerkung:
Lazar Bernstein ist am 20. Mai 1903 in München geboren als Sohn des Kaufmanns
Jakob Bernstein und seiner Frau Witte (Victoria) geb. Obstfeld. Lazar Bernstein
war zunächst Religionslehrer in Aub. Nach seinem
Wechsel nach Wilhermsdorf heiratete er
hier am 20. März 1929 Martha geb. Uhlfelder (geb. 21. Dezember 1908 in
Burgpreppach als Tochter des Lehrers
Jonathan Uhlfelder und seiner Frau Eva Erna geb. Frießner. Die beiden hatten
drei Kinder. Lazar Bernstein wurde nach 1930 Lehrer in Zweibrücken, im
Zusammenhang mit den Ereignissen beim Novemberpogrom 1938 wurde er verhaftet,
kam jedoch mit Hilfe des späteren Kriegsverbrechers Curt Trimborn (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Curt_Trimborn#) frei und konnte über
Frankreich in die USA emigrieren (Geschichte siehe
https://www.marksalter.org/historys-true-warning/?print=print). Hier ist
Lazar Bernstein am 3. Juli 1988 in Miami FL verstorben; seine Frau ist ebd.
schon am 30. Dezember 1983 verstorben. Seine in Deutschland geborenen Söhne
waren als Ingenieure tätig, seine Tochter als Lehrerin. Genealogische
Informationen mit Fotos siehe
https://www.geni.com/people/Eleazar-Bernstein/6000000022501542508.
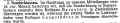 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
Dezember 1936: "Sonderklassen. Im Nachtrage zu unseren
Mitteilungen vom 15. vorigen Monats berichten wir, dass die Sonderklasse
in Kaiserslautern nunmehr dem
Kollegen Bernstein in Zweibrücken übertragen worden ist,
während die zweite Stelle in Ludwigshafen
vom Kollegen Langstädter in Venningen
übernommen wurde." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
Dezember 1936: "Sonderklassen. Im Nachtrage zu unseren
Mitteilungen vom 15. vorigen Monats berichten wir, dass die Sonderklasse
in Kaiserslautern nunmehr dem
Kollegen Bernstein in Zweibrücken übertragen worden ist,
während die zweite Stelle in Ludwigshafen
vom Kollegen Langstädter in Venningen
übernommen wurde." |
Religionsprüfung
in der jüdischen Schule (1938)
 Artikel
in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der Rheinpfalz" vom
11. Mai 1938: "Zweibrücken (Religionsprüfung). Am 8. April
nahm Herr Bezirksrabbiner Dr. Nellhaus im Auftrage des
Verbandsausschusses und im Beisein des Vorstandes die Religionsprüfung
von 5 Knaben und 5 Mädchen der israelitischen Kultusgemeinde Zweibrücken
vor. Der in den Händen von Herrn Lehrer Bernstein liegende
Religionsunterricht hat auch in dem abgelaufenen Schuljahre erfreulich
Ergebnisse gezeitigt. Die Schüler wiesen gute Fortschritte im
Hebräisch-Lesen und im Übersetzen des Pentateuch und der Gebete, sowie
hinreichende Kenntnisse in der biblischen und jüdischen Geschichte und in
der Religionslehre auf. Herr Lehrer Bernstein und seinen Zöglingen wurde
darum auch seitens des Rabbiners und des Vorstandes die wohlverdiente
Anerkennung
zuteil." Artikel
in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der Rheinpfalz" vom
11. Mai 1938: "Zweibrücken (Religionsprüfung). Am 8. April
nahm Herr Bezirksrabbiner Dr. Nellhaus im Auftrage des
Verbandsausschusses und im Beisein des Vorstandes die Religionsprüfung
von 5 Knaben und 5 Mädchen der israelitischen Kultusgemeinde Zweibrücken
vor. Der in den Händen von Herrn Lehrer Bernstein liegende
Religionsunterricht hat auch in dem abgelaufenen Schuljahre erfreulich
Ergebnisse gezeitigt. Die Schüler wiesen gute Fortschritte im
Hebräisch-Lesen und im Übersetzen des Pentateuch und der Gebete, sowie
hinreichende Kenntnisse in der biblischen und jüdischen Geschichte und in
der Religionslehre auf. Herr Lehrer Bernstein und seinen Zöglingen wurde
darum auch seitens des Rabbiners und des Vorstandes die wohlverdiente
Anerkennung
zuteil." |
Die Zeitschrift "Der Israelit" macht sich über
die neue, liberale Synagogenordnung von 1879 lustig
Vorbemerkung: Die Zeitschrift "Der
Israelit" war das Organ der orthodox-geprägten jüdischen Gemeindeglieder.
Heftig wurden von ihr die liberalen Gemeinde-, Synagogen- und
Gottesdienstordnungen kritisiert; Orgel, gemischte Chöre u.a.m. waren
verpönt.
Der nachstehende Artikel ist in der Abschrift nicht ganz vollständig
wiedergegeben. Einige hebräische Wendungen sind noch nicht (teilweise eventuell
nicht ganz korrekt) übersetzt, bitte bei Interesse den Originalartikel vergleichen!
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Dezember 1879: "Von den Ufern
des Erlbachs. Die jüdische Literatur ist in den jüngsten Monaten durch
ein Werk bereichert worden, das es wohl lediglich seinem bescheidenen Äußern
verdankt, wenn es bis jetzt noch nicht die Würdigung gefunden hat, die es
in hohem Grade verdient; 'Die Synagogen- und Gebetordnung der
israelitischen Kultusgemeinde zu Zweibrücken!' Es hat nur 15
Oktavseiten, aber die Größe respektive Länge macht's ja bei
klassischen Schriften nicht aus. Und klassisch ist der Unsinn, der da
geboten wird. Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Dezember 1879: "Von den Ufern
des Erlbachs. Die jüdische Literatur ist in den jüngsten Monaten durch
ein Werk bereichert worden, das es wohl lediglich seinem bescheidenen Äußern
verdankt, wenn es bis jetzt noch nicht die Würdigung gefunden hat, die es
in hohem Grade verdient; 'Die Synagogen- und Gebetordnung der
israelitischen Kultusgemeinde zu Zweibrücken!' Es hat nur 15
Oktavseiten, aber die Größe respektive Länge macht's ja bei
klassischen Schriften nicht aus. Und klassisch ist der Unsinn, der da
geboten wird.
Die Zeiten sind ernst, und der Zweibrückener Gemeindeausschuss verdient
alle Anerkennung, dass er ein wenig für die Erheiterung besorgt ist.
Folgen wir diesem Winke durch einige Glossen, mit denen wir die blühendsten
Teile dieser Synagogenordnung einem größeren Publikum zugänglich machen
möchten; sie verdient es. Dass wir es nur gleich sagen, wir haben es mit
keiner Synagogen-, sondern mit einer Reformsynagogen-Ordnung zu tun.
Die Zweibrückener haben nämlich ein neues so genanntes Gotteshaus mit
Orgel, zeitgemäßem Singsang, einem Breslauer Rabbiner und sonstigem
Luxus, warum sollten sie nicht auch eine neue Gebetordnung haben? In dem
Schlusssatz des § 3 der vorliegenden Synagogenordnung heißt es: 'Der
an manchen Orten übliche Gebrauch, dass einjährige Kinder die so
genannte Wimpel oder Mappe in die Synagoge tragen, ist untersagt.'
Warum? Was haben die Kleinen verbrochen, auf deren Hauch Gott die Zeiten
und Menschen gewinnende Macht der Tora so fest gegründet hat, dass die
sinnige jüdische Sitte durch ihre zarten Händchen das Band reichen lässt,
das unsere Tora zusammenhält?
Nein, das kann kein fanatischer Hass gegen jüdische Bräuche sein, denn
die tiefe Innigkeit gerade dieses Brauches musste selbst vor dem
fanatischsten Reformjudentum Gnade finden, wenn nicht aller Sinn für Tora
und ihre jugendlichen Träger aus dem Herzen der Zweibrückener
Synagogenausschussmitglieder geschwunden ist, also waren?
In § 8 wird dekretiert: 'Während der Vorlesung der Tora bleibt die
Gemeinde sitzen, beim Vortrage der zehn Gebote aber hat sie sich zu
stellen etc.' Das jüdische Gesetz und die Zweibrückener
Synagogenordnung kollidieren in diesen Bestimmungen. Ersteres spricht sich
wörtlich so aus: 'Man muss beim Vorlesen aus der Tora nicht stehen.
Einige legen jedoch die Erschwerung auf, zu stehen; so tat es auch unser
Lehrer R. Meir.' (Schulchan Aruch O.Ch. 146,4). Die für die
religionsgesetzliche Entscheidung maßgebenden Kodizes bemerken noch
hierzu, dass während der Segenssprüche über der Tora die Gemeinde
jedenfalls eine stehende Haltung einzunehmen habe.
Der Zweibrückener Ausschuss dekretiert dagegen: Die Gemeinde bleibt
sitzen! Haben die Herren Diktatoren bei dieser Weisung an die
religionsgesetzliche Seite der Bestimmung gedacht, so möchten wir uns die
bescheidene Frage gestatten: Wie kommt ein Statuten dekretierenden
Ausschuss dazu, es den etwaigen Machmirim seiner Gemeinde unmöglich zu machen, eine ihren Wünschen entsprechende
Stellung beim Vorlesen aus der Tora einzunehmen? War er sich aber gar
nicht bewusst, dass er sich hier auf religionsgesetzlichem Gebiete bewegt,
wird wie in einem Wachsfigurenkabinett in der Zweibrückener Synagoge
gestanden und gesessen, je nachdem an dem Schnürchen dieses oder jenes
Paragraphen gezogen wird, sind die Synagogenbesucher nichts als Statisten,
als bloße Staffage, die auf Kommando sitzt und aufsteht, um das ganze
Ensemble der Szenerie noch harmonischer zum Ausdruck zu bringen, wie will
man dann die Entwürdigung rechtfertigen, die in diesem Paradespiel liegt,
nicht nur für die Gemeinde sondern auch für die gewissenhafte Observanz
des jüdischen Religionsgesetzes?
'Beim Vortrag der Zehngeboten aber hat sie sich zu stellen.' Von wann
stammt diese Weisung? Unsere Weisen haben die sog. Zehngebote nicht ins
Gebet aufgenommen, um dem Wahn der Minim keinen Vorschub zu leisten, die
zu jeder Zeit in den Dekalog einen bevorzugteren Teil unserer Tora
erblickten, |
 um so die
übrige Tora noch tiefer herabwürdigen zu können. So lange es eine Tora
gibt, besaß jeder Satz derselben eine gleich große Heiligkeit, sind z.B.
die Worte aus Esau's Geschlechtsregister 'und die Schwester Lotans
Timna' (1. Mose 36,22) nicht weniger heilig als der
Dekalog ist, warum muss in der Zweibrückener Reform-Synagoge die Gemeinde
während des Vorlesens der Zehn Gebote sich stellen? um so die
übrige Tora noch tiefer herabwürdigen zu können. So lange es eine Tora
gibt, besaß jeder Satz derselben eine gleich große Heiligkeit, sind z.B.
die Worte aus Esau's Geschlechtsregister 'und die Schwester Lotans
Timna' (1. Mose 36,22) nicht weniger heilig als der
Dekalog ist, warum muss in der Zweibrückener Reform-Synagoge die Gemeinde
während des Vorlesens der Zehn Gebote sich stellen?
Alle derartigen Vorschriften in den modernen Tempeln, die über die
diesbezüglichen religionsgesetzlichen Bestimmungen hinausgehen und ein
Stehen und Sitzen, womöglich nach dem Takte vorschreiben, machen ja diese
Vornahmen nicht von dem inneren Gehalte der Gebete abhängig, nicht einmal
von der Bequemlichkeit der Gemeinde, sondern lediglich von Anstandsrücksichten,
die man törichter Weise den nichtjüdischen Besuchern des jüdischen
Gotteshauses schuldig zu sein glaubt. Noch hat kein Christ oder Mohammedaner
die Gebetordnung seiner Kirche oder Moschee mit Rücksicht
drauf eingerichtet, dass sie den Beifall jüdischer Besucher habe, warum
soll denn für unsere Synagogen unjüdische Geschmacksrichtung maßgebend
sein? Diese Mittelchen helfen auch nichts. In vielen Synagogen hat man
sich Wunder welche Erfolge versprochen von der Ausmerzung unserer jüdischen
Bräuche und Gebete, was haben wir damit erreicht? Wir? Nichts. Das Rischuß
(Antisemitismus) aber hat einen Höhepunkt erreicht, der mit den Orgeln, gemischten Chören,
deutschen Gebeten, mit denen man alle Rischußgeister bannen zu können
vermeinte, in einem gar merkwürdigen Gegensatz steht.
Kehren wir zu der Zweibrückener Synagogenordnung zurück: 'Es ist
niemandem gestattet, auch dem Kantor und dem Hilfsvorbeter nicht, am 9. Aw
und Versöhnungstage die Schuhe oder Stiefel auszuziehen; ebenso wenig ist
es gestattet, sich mit dem Totenhemd zu bekleiden.'
Warum! Nun, der Ausschuss will es so. Aber etwas Sinn musste doch
eigentlich auch in diesem kindlichen Spiele liegen. Fürchtet man eine Erkältung
der Gemeinde? Am 9. Aw dürfte das doch nicht zu befürchten sein, und
dass es die Zweibrückener in Tekufat Tamus selbst frieren sollte, ist
eine Zumutung, die ein einigermaßen anständiger Ausschuss doch nicht
voraussetzen dürfte. Ist etwa der bekannte liebe Friede mit ihm Spiel,
der eben möchte, dass die ganze Gemeinde auf gutem Fuße steht, und
deshalb die Schuhe und Stiefel selbst an den Füßen des Kantors und
Hilfsvorbeters nicht missen will? Aber warum wäre dann das Totenhemd am
Versöhnungstag verpönt, dieses ergreifende Symbol des keine feindlichen
Gegensätze mehr kennenden Todes?
Es bleibt kein Ausweg, man scheint in Zweibrücken das Entschuhen der Füße
und das Anlegen des Totenhemdes für etwas Unanständiges, gegen den guten
Ton verstoßendes, den christlichen Synagogenbesuchern unangenehm Berührendes
zu halten. Ohne Zweifel werden die Verstorbenen der Zweibrücker
Kultusgemeinden in Frack und Glacéhandschuhen beerdigt, damit sie einst
salonfähig vor ihrem himmlischen Richter erscheinen, denn was für die
Lebenden recht ist, ist für die Toten billig. Ohne Zweifel weiß man dort
nichts mehr von dem Wissen Moses und Israels, in welchem Gottes heiliger
Wille die Entschuhung sogar gesetzlich vorschreibt, z.B. bei dem
Chalizah-Akte, was doch nicht gut möglich wäre, wenn es wirklich eine
Unanständigkeit wäre. Gewiss weiß man dort ebenso wenig davon, dass ein
Moses, ein Josua gerade in besonders gehobenen Momenten die Schuhe vom Fuße
lösten, das Alles muss man dort vergessen haben, denn sonst müsste man
sich doch in die Seele hinein schämen, sich einer Verrichtung zu schämen,
die der größte Mensch auf Erden zu verrichten nicht nur nicht unter
seiner Würde hielt, sondern mit welche er gerade der Heiligkeit des
Augenblicks den entsprechenden Ausdruck gab." |
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Dezember 1879: "Von den Ufern
des Erlbaches (Schluss). Besonders belehrend ist der § 5 dieser
Synagogenordnung: 'Während des Gottesdienstes dürfen sich nur der
Kantor und die zur Tora zu Rufenden mit dem Gebetmantel (Talit) bekleiden,
und können nur Diejenigen zur Tora gerufen werden, die anständig
gekleidet sind.' Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Dezember 1879: "Von den Ufern
des Erlbaches (Schluss). Besonders belehrend ist der § 5 dieser
Synagogenordnung: 'Während des Gottesdienstes dürfen sich nur der
Kantor und die zur Tora zu Rufenden mit dem Gebetmantel (Talit) bekleiden,
und können nur Diejenigen zur Tora gerufen werden, die anständig
gekleidet sind.'
Nach § 17 dürfen auch die Leidtragenden oder die den Todestag ihrer
Eltern Feiernden mit einem Gebetmantel bedeckt sein. Aus der Fülle
dessen, was der denkende Jude bei solchen bestimmungen einer sich
Synagogen-Ordnung nennenden Synagogen-Unordnung empfindet, möge hier
folgendes seine Stelle finden.
Gottes heiliger Wille schreibt Fäden für jeden Zipfel eines viereckigen
Gewandes vor. Der Zweibrückener Synagogen-Ausschuss verbietet es, sogar während
des Gottesdienstes. Warum? Nun, die Bestimmung der Zizoth ist: durch ihren
Anblick sich Gottes Gesetze in Erinnerung zu rufen und das ist in Zweibrücken
störend oder mindestens überflüssig. Zizoth mahnen den Juden, nicht
seinem Auge und Herzen zu folgen; wer aber herzlos ist, kann seinem Herzen
ohnedies nicht folgen, und wem der ganze Gottesdienst nur Ohrenschmaus und
Augenweide ist, der muss gerade beim Gottesdienst seinen Augen folgen.
Freilich lehrt der Talmud, wer auf das Gebot der Zizoth achtet, zieht
Gottes Schechinah in seinen Kreis. Der Talmud? Der macht dem wohllöblichen
Ausschuss der israelitischen Zweibrücker Kultusgemeinde wenig Skrupel,
aber es ist dort doch auch ein Rabbiner, ein Breslauer sogar, von dem
freilich nur ein Parteiorgan erzählt hat, dass er orthodoxe Reformen
eingeführt habe? Nach dem Wortlaut dieser Synagogenordnung darf ja selbst
der Rabbiner nicht einmal während des Gottesdienstes ein Tallit tragen!
Hier hält nicht einmal jene Universalausrede für Alles, der bekannte 'liebe Friede' her, dass der Herr Rabbiner etwa hinterher zu dem
talithlose Gottesdienste hätte deshalb Amen und Plazet sagen müssen, um
eben kein Wässerchen zu trüben.
Die Synagogenordnung ist nämlich, wie das Datum ausweist, älter als die
Amtszeit des Rabbiners, er hätte also, wenn er wirklich so orthodox fühlt,
dem Frieden mit seiner orthodoxen Überzeugung, dem Frieden mit seiner
Gemeinde gar nicht besser dienen können, als wenn er dieser seiner Überzeugung
Rechnung tragend, auf eine Stelle verzichtet hätte, in der er sich dem
Verdachte der Heuchelei umso sicherer aussetzt, je stärker der Geruch der
Orthodoxie ist, den man um ihn verbreitete.
Bei solchen Zuständen ist er erklärlich, dass ein Breslauer in Zweibrücken
Rabbiner wird, ein anderer bekäme ein solches Kunststück nicht fertig,
orthodox mit einer solchen Synagogen- und Gebetordnung zu sein oder doch
gelten zu wollen. Als Frankel wegen seiner Auffassung von Tora vom Himmel
bekämpft wurde, wurde unter anderem zu seinen Gunsten geltend gemacht,
dass er das Talit doch über den Kopf ziehe. Dieser armselige Trost fällt
bei seinen Schülern Bipontini generis also auch weg!
Die Vorschrift, anständig gekleidet zu sein, wenn man zur Tora gerufen
wird, enthält, indem sie voraussetzt, dass die Gemeindemitglieder unanständig
gekleidet die Synagoge besuchen, eine so flagrante Beleidigung der ganzen
Gemeinde, dass man es der letzteren überlassen kann, sich deshalb mit
ihrem Ausschuss auseinander zu setzen.
Die neue Zweibrückener Tora scheint jedenfalls noch nicht so allgemein
von der Gemeinde anerkannt zu sein, dass man ohne weiteres auf ein anständiges
Entgegenkommen seitens der einzelnen Mitglieder rechnen durfte, und man
muss dies ganz natürlich finden.
Man irrt nämlich sehr, wenn man auf Grund der bisher mitgeteilten Proben,
die neue Zweibrückener Tora nun für ein alltägliches Duodez-Torachen
hielt. Mag sie auch an Geist und Sinn mit der Tora
Moses und Israels wenig gemeinsam haben, an Ausdehnung scheint sie
ihr, soweit diese Synagogen-Ordnung eine vernünftige Folgerung zulässt,
ums Dreifache überlegen zu sein. Sie brauchen nämlich dort drei Jahre um
ihre Tora zu Ende zu lesen, oder wie man das vornehm |
 nennt,
der dreijährige Zyklus ist dort eingeführt. Der betreffende Passus
lautet: 'Das Vorlesen der Tora hat von Schabbat
Bereschit 640 (wohl an 1879 gedacht, insofern nach der
neuen Regelung der Schabbat Bereschit zu Beginn des neuen jüdischen
Jahres sein soll) an nach dreijährigem Zyklus zu geschehen'. Wir haben dem
Leser den Wortlaut nicht vorenthalten zu sollen geglaubt, weil man doch
selten eine solche Ankündigung von einem salbungsvollen … begleitet zu
finden pflegt. – Gegen solche pastoralkluge Ausschussweisheit sind doch
selbst die Breslauer Stümper! In dem 'der Gottesdienst Kol
Nidrei'
überschriebenen
Schlusskapitel wird übrigens zur allgemeinen Beruhigung beigefügt, dass
trotz des dreijährigen Zyklus, dennoch alljährlich Simchat Tora stattfinden kann. Aus dieser Gruppierung scheint
hervorzugehen, dass das Simchat-Tora-Fest in Zweibrücken am Kol-Nidre-Abend gefeiert wird. Das ist eine sehr praktische Idee. Die
Beschwerden des Fastens machen sich einerseits an diesem Abend noch nicht
so fühlbar, während man andererseits wahrscheinlich an diesem Abend in
Zweibrücken die Geschäfte geschlossen und so die nötige Zeit zur
Simchat Tora-Feier hat. – Wieso es aber bei dreijährigem Zyklus trotz
alledem möglich ist, alljährlich Simchat Tora zu halten, ist hier nicht angegeben. Ich denke, dem
Ausschuss hat eine Abhandlung von Lichtenberg vorgeschwebt, in welcher
diejenigen, welche am 29. Februar geboren und daher in der traurigen
Meinung sind, nur alle vier Jahre einen Geburtstag zu haben, mit ihrem
Schicksal durch den Beweis ausgesöhnt werden, dass sie dennoch alljährlich
den Tag ihrer Geburt feiern können. nennt,
der dreijährige Zyklus ist dort eingeführt. Der betreffende Passus
lautet: 'Das Vorlesen der Tora hat von Schabbat
Bereschit 640 (wohl an 1879 gedacht, insofern nach der
neuen Regelung der Schabbat Bereschit zu Beginn des neuen jüdischen
Jahres sein soll) an nach dreijährigem Zyklus zu geschehen'. Wir haben dem
Leser den Wortlaut nicht vorenthalten zu sollen geglaubt, weil man doch
selten eine solche Ankündigung von einem salbungsvollen … begleitet zu
finden pflegt. – Gegen solche pastoralkluge Ausschussweisheit sind doch
selbst die Breslauer Stümper! In dem 'der Gottesdienst Kol
Nidrei'
überschriebenen
Schlusskapitel wird übrigens zur allgemeinen Beruhigung beigefügt, dass
trotz des dreijährigen Zyklus, dennoch alljährlich Simchat Tora stattfinden kann. Aus dieser Gruppierung scheint
hervorzugehen, dass das Simchat-Tora-Fest in Zweibrücken am Kol-Nidre-Abend gefeiert wird. Das ist eine sehr praktische Idee. Die
Beschwerden des Fastens machen sich einerseits an diesem Abend noch nicht
so fühlbar, während man andererseits wahrscheinlich an diesem Abend in
Zweibrücken die Geschäfte geschlossen und so die nötige Zeit zur
Simchat Tora-Feier hat. – Wieso es aber bei dreijährigem Zyklus trotz
alledem möglich ist, alljährlich Simchat Tora zu halten, ist hier nicht angegeben. Ich denke, dem
Ausschuss hat eine Abhandlung von Lichtenberg vorgeschwebt, in welcher
diejenigen, welche am 29. Februar geboren und daher in der traurigen
Meinung sind, nur alle vier Jahre einen Geburtstag zu haben, mit ihrem
Schicksal durch den Beweis ausgesöhnt werden, dass sie dennoch alljährlich
den Tag ihrer Geburt feiern können.
Wenn ich vom dreijährigen Zyklus höre, wundere ich mich immer, dass
seine Gevattern, diesen Gedanken nicht konsequent durchgeführt haben,
dass sie z.B. Jom Kippur, Rosch Haschana kurz alle Feiertage nicht ebenfalls nur alle drei
Jahre zu feiern empfehlen, Schabbat
alle drei Wochen etc. etc. - Ich
muss jedoch gestehen, dass die Zweibrücker Manier, wie sie sich aus der
Synagogen-Ordnung ergibt, nämlich mehrere Feiertage auf einen zu
vereinigen, noch viel praktischer ist.
Aber ich sehe, dass meine Bemerkungen schon fast so lange sind, wie die
ganze Synagogen- und Gebetordnung zusammen, und ich habe noch nicht einmal
die Hälfte des Köstlichen vorgeführt, ja ich fühle es, dass ein
solches Werk so zu schildern, dass jeder eine treue Vorstellung des Ganzen
erhält, meine Feder zu schwach ist. – Habe ich doch selber die ganze
Zeit geglaubt, der Kultus in Zweibrücken bestehe aus Gebet, Toralesen,
Orgelspiel; Predigt etc. und ersehe soeben aus dem § 20, dass die
Kultusgemeinde-Mitglieder selber zum Kultus gehören.
'Jedem Kultusmitgliede soll ein Exemplar der Synagogen- und Gebetordnung
zur Danachordnung zugestellt werden.' Wahrlich: die ganze Gemeinde, es
sind alles Geweihte. Also, nur das Allergröbste!
Der Freitagabend-Gottesdienst beginnt mit dem Orgelspiel, in der Mitte
ebenfalls Orgelspiel, während der Schmone Esre
(Achtzehnbittengebet) sanftes Orgelspiel. Anmerkung: nach
Schma Jisrael spricht der Kantor
laut weahawta…, dann sanftes
Orgelspiel.' Es möge gestattet sein zu dieser Anmerkung, folgende
bescheidene Frage anzumerken: wenn die Ankündigung des dreijährigen
Zyklus mit einem gottesfürchtigen … verbrämt wird, wäre dann zwischen
weahawta und dem sanften
Orgelspiel, nicht ein sanftes lehawdil am Platze gewesen.
Magen awot fällt aus; haben die
Zweibrücker scheint's nicht mehr nötig.
Lechu nirannena, Lecha dodi und
bama madlikin, die dasselbe Schicksal teilen, befinden sich also in
guter Gesellschaft.
Vom 'Gottesdienst am Sabbatmorgen' genügen die zwei einleitenden Sätze,
um sich den übrigens Nonsens von selbst ausmalen zu können. 'Schacharit wird in der Frühe allein gebetet. (d.h. gar nicht
gebetet). Der Hauptgottesdienst Musaf
beginnt mit Orgelspiel.'
Nun heißt Musaf aber
Zusatz-Gottesdienst in Zweibrücker Ausschussdeutsch: Nebengottesdienst, während
Schacharit der eigentliche
Morgengottesdienst ist. Der Gottesdienst an Sabbatmorgen besteht also in
Zweibrücken darin, dass der eigentliche Morgengottesdienst nicht
abgehalten wird, dagegen nennen sie den Zusatz-Gottesdienst zu dem nicht
abgehaltenen und also auch nicht zusetzungsfähigen Morgengottesdienst,
Hauptgottesdienst und last not least – beginnen ihn mit Orgelspiel. Dann
folgt noch ein wenig laute und stille Andacht mit lautem und sanftem
Orgelspiel, und schließlich wird von den Leidragenden ein Kaddisch
auf diesen Singsang gesagt.
Hallel hat noch ein Plätzchen
in Musaf gefunden, (was sich die
verehrlichen Kultusmitglieder wohl bei den Worten denken: Lobet den Herrn,
all ihr Völker?), dagegen ist das Jozer
der Razzia des hochweißlichen Ausschusses sämtlich erlegen. Das muss
eine Jagd gewesen sein, so wild, dass die sonst so langatmigen Sätze
nicht nur den Atem, sondern sogar Prädikat resp. Subjekt verloren haben.
Man überzeuge sich:
'Anmerkung. An keinem der Sabbate, an welchen früher ein Jozer gesagt wurde, wird mehr ein solches gebetet. Auch Eloheichem
(euer Gott) nicht.'"
|
Aus der Geschichte des Rabbinates Zweibrücken
Ausschreibung der Stelle des Bezirksrabbiners 1879
 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Mai 1879: "Bekanntmachung.
Anstellung eines Rabbiners für den Rabbinatsbezirk Zweibrücken
(Rheinbayern) betr. die
Rabbinerstelle für den Rabbinatsbezirk Zweibrücken, umfassend die
israelitischen Kultusgemeinden der drei Bezirksämter Homburg, Pirmasens
und Zweibrücken, ist durch den Tod des bisherigen Rabbiners in Erledigung
gekommen und soll nunmehr wieder besetzt werden. Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Mai 1879: "Bekanntmachung.
Anstellung eines Rabbiners für den Rabbinatsbezirk Zweibrücken
(Rheinbayern) betr. die
Rabbinerstelle für den Rabbinatsbezirk Zweibrücken, umfassend die
israelitischen Kultusgemeinden der drei Bezirksämter Homburg, Pirmasens
und Zweibrücken, ist durch den Tod des bisherigen Rabbiners in Erledigung
gekommen und soll nunmehr wieder besetzt werden.
I. Der Rabbiner hat seinen Wohnsitz in der Stadt Zweibrücken zu
nehmen.
II. Der jährliche fixe Gehalt des Rabbiners beträgt
Mark 1.100, wozu die Kultusgemeinde Zweibrücken noch einen jährlichen
Beitrag als Gehaltszulage von Mark 50 bewilligt hat.
Außerdem bezieht der Rabbiner einen jährlichen Zuschuss aus der
Staatskasse von Mark 540.
Summa Mark 1.690.
Auf den Staatszuschuss hat der Rabbiner jedoch nur solange
Anspruch, als die Mittel zu solchen staatlichen Aufbesserungszuschüssen
gewährt werden.
III. Zu dem vorbemerkten fixen Gehalte kommen nun noch die auf mindestens
600 Mark jährlich anzuschlagenden Kasualien. Bewerber um die
Rabbinatsstelle haben ihre Gesuche samt Zeugnissen innerhalb vier Wochen
bei der unterfertigten Behörde einzureichen. Zweibrücken, 1. Mai 1879. Königliches
Bezirksamt. Damm, königlicher Regierungsrat." |
Rundschreiben von Rabbiner Dr.
Israel Mayer an seine Gemeinden
(1884)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30.
September 1884: "Korrespondenz. Ein sehr zu empfehlender Brauch wäre
es, das die Rabbiner, die einem Sprengel vorstehen, an die Gemeinden
desselben zu jedem hohen Festtage einen sog Hirtenbrief richteten, der in
den Synagogen zum Festtage verlesen würde. Allerdings wäre es
angemessen, dieses Rundschreiben nicht bloß aus schönen Phrasen bestehen
zu lassen, sondern darin auch praktische Ratschläge zu geben. Als ein
Beispiel dessen folgt hier ein solcher, uns zugekommener Erlass.
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30.
September 1884: "Korrespondenz. Ein sehr zu empfehlender Brauch wäre
es, das die Rabbiner, die einem Sprengel vorstehen, an die Gemeinden
desselben zu jedem hohen Festtage einen sog Hirtenbrief richteten, der in
den Synagogen zum Festtage verlesen würde. Allerdings wäre es
angemessen, dieses Rundschreiben nicht bloß aus schönen Phrasen bestehen
zu lassen, sondern darin auch praktische Ratschläge zu geben. Als ein
Beispiel dessen folgt hier ein solcher, uns zugekommener Erlass.
Brief der Buße. Worte der Ermahnung an meine Gemeinden. Da in der
Bußwoche das Ohr der Israeliten besonders geneigt ist, Belehrung
anzunehmen, und das Herz willfährig, gute Vorsätze zu fassen, so möchte
ich am heutigen Tage die Gemeinden meines Bezirks auf einen Übelstand
aufmerksam machen, und hoffe ich, dass meine Worte ihre Wirkung nicht
verfehlen mögen.
Es heißt in der Haphtorah (Prophetischer Abschnitt), welche am
Jom-Kippur zu Schachris (Morgengebet) gelesen wird: 'Wenn du zurückhältst
am Schabbat deinen Fuße, dass du nicht ausübest dein Gelüste an meinem
heiligen Tage, wenn du nennest den Schabbat eine Lust, dem heiligen Gotte
zu Ehren, wenn du ihn ehrest, nicht auszuführen an ihm deine Wege, nicht
aufzusuchen deine Lust und nicht davon zu reden, dann wirst du Lust haben
an dem Ewigen.' (Jesaja 58,13-14).
Der Schabbat wird genannt ein Bundeszeichen zwischen Gott und seinem Volke
Israel; allein dieser Bund wird leider auch in meinem Rabbinatsbezirk gar
mannigfach verletzt. Aus dem vielen Schabbatsünden will ich dieses Mal
das Spielen in Wirtshäusern hervorheben. Die Stunden aber, die der
Schabbat nicht durch Gottesdienst in Anspruch nimmt, sollten eine andere
und edlere Bestimmung haben. Im Midrasch heißt es: 'Die Tora sprach zu
Gott: 'Herr der Welt! Wenn das Volk Israel das heilige Land in Besitz
nimmt, was wird da aus mir werden? Jeder Einzelne wird sein Feld pflügen
und besäen und für mich keine Zeit haben!' Da sprach Gott zur Tora: 'Ich
gebe dir den Sabbat zum Genossen; an diesen Tage verrichten die Israeliten
keine Arbeit, sondern besuchen die Gottes- und Lehrhäuser und
beschäftigen sich mit der Tora.' In diesen Worten ist ausgesprochen, wie
wir die freie Zeit des Schabbat ausfüllen sollen. Nicht durch
Kartenspiel, welches eine Entweihung das Sabbat ist, sondern durch Lesen
in der heiligen Schrift. Ich empfehle darum, den alten gebrauch nicht
untergehen zu lassen, am Schabbat den Wochenabschnitt (Sidroh) des
betreffen Schabbat sowohl im Urtexte als auch in deutscher Übersetzung
genau und aufmerksam durchzulesen, damit so die Kenntnis der heiligen Schrift
nicht schwinde aus den Gemeinden Israels und der Schabbat zu seinem Rechte
komme. Ebenso sollten die Mütter, statt auf Luxus ihr Augenmerk zu
richten, am Schabbat ebenfalls den Wochenabschnitt in deutscher
Übersetzung lesen, und Vater und Mutter die Kinder zu gleichem Tun
veranlassen.
Weiterhin möchte ich empfehlen, dass in den Gemeinden meines Bezirks sich
Chebros (Lehr- und Lesevereine) bilden, und dass in denselben am Schabbat
aus irgend einer anständigen und belehrenden jüdischen Zeitung
vorgelesen wird, damit Jeder mit der laufenden Geschichte seiner
Glaubensgenossen vertraut wird, Anregung erhält, bald an diesem, bald an
jenem guten Werke sich beteiligen und die dort gebotene Belehrung in sich
aufzunehmen. Zu solcher Lektüre |
 empfehle
ich: 'Allgemeine Zeitung des Judentums' von Dr. Philippson, die 'Jüdische
Presse' von Dr. Hildesheimer, 'Israelitische Wochenschrift' von Dr. Rahmer
und 'Jeschurun' von Hirsch, welche bei jeder Postanstalt bezogen werden
können. empfehle
ich: 'Allgemeine Zeitung des Judentums' von Dr. Philippson, die 'Jüdische
Presse' von Dr. Hildesheimer, 'Israelitische Wochenschrift' von Dr. Rahmer
und 'Jeschurun' von Hirsch, welche bei jeder Postanstalt bezogen werden
können.
Wenn Ihr, meine lieben Gemeinden, meiner Ermahnung folgend, Eure Gelüste
zähmet und dem Schabbat statt dessen wieder eines seiner alten Urrechte
zurückgebet, wenn Ihr, statt am Schabbat dem Spiele zu frönen, mit dem
Psalmisten saget: 'Deine Zeugnisse, o Gott, seien mir Lust', wenn Ihr
nicht ausübet Euer Gelüste, sondern Lust haben an Gott und an seinen
heiligen Worten, dann wird wahre Sabbatlust wieder in Eure Häuser
einkehren und der Segen Gottes möge Euch dafür zu Teil werden!
Leschana towa tekatewu! (Zu einem guten Jahr möget ihr eingeschrieben
sein!).
Zweibrücken, zu Rosch-Haschonoh 5645 (1884). (Datum hebräisch).
Dr. J. Mayer, Bezirksrabbiner.
An sämtliche Gemeinden des Bezirksrabbinats zum Vorlesen in der Synagoge
am ersten Tage Rosch-Haschonoh vor Mussaph." |
Rundschreiben von Rabbiner Dr. Mayer zu Jom Kippur (1886)
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. Oktober 1886: "Zweibrücken,
30. Oktober (1886). Der hiesige Bezirksrabbiner, Herr Dr. J. Mayer,
versendet jährlich einen 'Bußbrief zum Verlesen seines Bezirks am Kol
Nidre (sc. zum Versöhnungstag Jom Kippur). Das ist interessant genug, um
hier wiedergegeben zu werden. Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. Oktober 1886: "Zweibrücken,
30. Oktober (1886). Der hiesige Bezirksrabbiner, Herr Dr. J. Mayer,
versendet jährlich einen 'Bußbrief zum Verlesen seines Bezirks am Kol
Nidre (sc. zum Versöhnungstag Jom Kippur). Das ist interessant genug, um
hier wiedergegeben zu werden.
Etwas über häuslichen Gottesdienst. 'Gewöhne den Knaben nach seiner
Weise, auch wenn er alt wird, weicht er nicht davon.' (Sprüche Salomos
22,7). In meinem vorjährigen 'Bußbriefe' habe ich über
Synagogenbesuch und Synagogenzucht zu Euch geredet und euch aufgefordert,
die Jugend zum besuche des Gotteshauses anzuhalten, damit sie dem
Gotteshause nicht entfremdet werde. Heute will ich ergänzend auf die noch
bedeutsamere Wichtigkeit des häuslichen Gottesdienstes für die Jugend
aufmerksam machen.
Auf meinen Rundreisen durch den Rabbinatsbezirk tönt vielfach die Klage
der Familienväter an mein Ohr, dass die Kinder im Gebethause sich nicht
zurechtfinden, dass sie die einzelnen Ereignisse im leben nicht religiös
zu behandeln verstehen, dass überhaupt Knaben sowohl als Mädchen nicht
gehörig vorbereitet in das Jahr der religiösen Mündigkeit eintreten.
Einer allgemeinen menschlichen Schwäche nachgebend, sucht man die
Ursachen dieser betrübenden Erscheinung nicht bei sich, sondern schiebt
die volle Schul der Schule zu. Allein, selbst der gewissenhafteste, in
seinem Lehramt von heiligstem Eifer erglühte Lehrer vermag nur zu lehren,
nicht aber das Kind zum Tun anhalten. 'Wichtiger aber als das Lehren,
ist die Betätigung der religiösen lehren' (Talmud Berachot 7).
Letztere aber herbeizuführen, ist die Aufgabe des Elternhauses; dieses
muss die Jugend zum religiösen Tun heranziehen, dieselbe daran gewöhnen,
durch sorgfältige Handhabung des häuslichen Gottesdienstes. 'Mit den
ersten Sprechversuchen des Kindes beginne auch schon der Unterricht des
Vaters' (Talmud Sukkah 42). Auf Schritt und Tritt bietet dann die
Religion dem Vater Gelegenheit, das Kind an Gott und seine heilige Lehre
zu erinnern und zu gewöhnen. Die Natur mit ihren Wundern, die
Pflanzenpracht der Erde, der Himmel mit seiner Sternenwelt, die Genüsse
des Lebens, die Erfüllung der göttlichen Gebote, die besondere Fürsorge
Gottes für den Menschen – all dieses bietet Anlass zur Belehrung des
Kindes, wobei man es je nach Alter und Fassungskraft mit den einschlägigen
religiösen Gebräuchen und Segenssprüchen bekannt macht. Mit zunehmendem
Alter wird das Kind in das Gebetbuch einzuführen sein. Wohl kann ihm die
Schule die Kenntnis und Bedeutung der Gebete beibringen, nicht aber die völlige
Gewandtheit und Sicherheit, sich in den verschiedenen Gebetbüchern
zurechtzufinden. Aus diesem Grunde dürfte auch die in verschiedenen
Synagogen der Ordnung wegen getroffene Einrichtung der Absonderung der
Kinder nicht zu empfehlen sein. Wer soll da die Kinder im richtigen
Gebrauch des Gebetbuchs unterweisen? Es soll der Vater das Kind bei sich
haben, damit er ihm seine Führung angedeihen lassen kann. Und wie
erhebend wäre es weiterhin für den Vater, wenn er an Sabbat- und
Festtage, anstatt die freien Nachmittage zu unerlaubten und unedlen Vergnügungen
zu missbrauchen, mit den Kindern die Wochenabschnitte durchlese, um
lehrend zu lernen und verwirklichen das Wort des Schema-Gebetes: 'du
sollst die Lehre deinen Kindern einschärfen!' – Ebenso ist es heilige
Pflicht der Mutter, die Mädchen zu ihrem künftigen Berufe als jüdische
Hausfrauen anzuleiten, indem sie dieselben mit den verschiedenen, dem
Pflichtenkreise des Weibes obliegenden Betätigungen religiöser
Vorschriften vertraut macht. 'Wie das Tun der Mutter, wird dann das Tun
der Tochter sein' (Talmud Ketubot 63).
Pflege des häuslichen Gottesdienstes ist eines der wirksamsten Mittel zur
Förderung des religiösen Sinnes und Lebens unserer Jugend. Entsprechend
dem talmudischen Erziehungsgrundsatze: 'Erst lernen, dann verstehen',
wird das also der Jugend angewöhnte Leben derselben zur zweiten Natur
werden, um allmählich auch den Verstand des reiferen Menschen zu
befriedigen und gefangen zu nehmen. Darum rufe ich Euch am heutigen Versöhnungstage
zu: 'Gewöhnt den Knaben nach seiner Weise, auch wenn er alt wird,
weicht er nicht davon.' Dr.
Israel Mayer, Bezirksrabbiner." |
Rundschreiben von Rabbiner Dr. Mayer zur Gründung eines israelitischen
Zufluchtshauses für die Pfalz (1887)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. August 1887:
"Zweibrücken, 7. August (1887). Von hier aus ist folgendes
Zirkular versandt worden: 'In einer am 20. April dieses Jahres hier
stattgehabten Versammlung der israelitischen Kultusvorstände des
Rabbinatsbezirkes Zweibrücken wurde auf Anregung des Unterzeichneten
beschlossen, die Gründung eines israelitischen Zufluchtshauses für die
Pfalz ins Leben zu rufen, in welchem erwerbsunfähige, hilfsbedürftige
und würdige Israeliten der Pfalz beiderlei Geschlechts - Waisen
inbegriffen - Aufnahme finden sollen. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. August 1887:
"Zweibrücken, 7. August (1887). Von hier aus ist folgendes
Zirkular versandt worden: 'In einer am 20. April dieses Jahres hier
stattgehabten Versammlung der israelitischen Kultusvorstände des
Rabbinatsbezirkes Zweibrücken wurde auf Anregung des Unterzeichneten
beschlossen, die Gründung eines israelitischen Zufluchtshauses für die
Pfalz ins Leben zu rufen, in welchem erwerbsunfähige, hilfsbedürftige
und würdige Israeliten der Pfalz beiderlei Geschlechts - Waisen
inbegriffen - Aufnahme finden sollen.
Eine solche Anstalt wird mit jedem Tage mehr ein Bedürfnis besonders für
die kleineren Gemeinden, die in Folge der Übersiedlung ihrer reicheren
Mitglieder in die Städte kaum imstande sind, ihre notwendigsten
Kultusbedürfnisse zu bestreiten, geschweige solchen hilfsbedürftigen
Personen in ihrer Mitte die unerlässliche Unterstützung zu gewähren.
Solche Anstalten bestehen zwar bereits in der Pfalz, die jedoch, weil
konfessionell, dem Israeliten nicht zugänglich sind. Außerdem würde
für streng religiöse Israeliten das Leben in denselben nach den
Anforderungen unserer Religion kaum zu ermöglichen sein. durch Gründung
einer solchen Anstalt für die Israeliten der Pfalz würden wir in solchen
Werken tätiger Nächstenliebe unseren Mitbürgern anderen Bekenntnissen
nicht mehr nachstehen, unseren Armen ein Asyl bieten und zugleich ein
einigendes Band für alle Israeliten der Pfalz herstellen.
Zur Ausführung der notwendigsten Vorarbeiten wurde zunächst aus der
Mitte der Versammlung ein engerer Ausschuss, bestehend aus den Herren L.
Bloch, Kultusvorsteher in Rodalben, W. Kahn, Kultusvorsteher in St.
Ingbert, M. Mai, Kultusvorsteher in Zweibrücken und dem Unterzeichneten
gewählt. Dieser engere Ausschuss soll nach Bewältigung der
unerlässlichen Vorarbeiten zu einem geschäftsführenden Ausschuss,
bestehend aus gewählten Vertrauensmännern aus den vier Rabbinatsbezirken
der Pfalz, erweitert werden.
In Verfolg der uns obliegenden Vorarbeiten richten wir an sämtliche
Gemeindevorstände der Pfalz folgende Fragen, um deren bald gefällige
Beantwortung an die Adresse des unterzeichneten Bezirksrabbiners Dr. Mayer
in Zweibrücken wir bitten.
1. Ist Ihre Gemeinde, respektive Ihr Synagogen-Ausschuss überhaupt
einverstanden mit der Gründung eines derartigen Zufluchtshauses?
2. Wie viele hilfsbedürftige Personen im oben angegebenen Sinne befinden
sich in Ihrer Gemeinde und deren Filialen? Wie viele ältere
hilfsbedürftige Personen und welches Geschlechts? Wie viele Doppelwaisen
und welches Geschlechts?
3. Ist Ihr Synagogen-Ausschuss bereit, sich auf einer allgemeinen
Versammlung (etwa in Neustadt als dem
geeignetsten Mittelpunkte der Pfalz) vertreten zu lassen, behufs Beratung
über den Sitz der Anstalt, über die Geldbeschaffungsfrage und zur
Vornahme der Wahl des geschäftsführenden Ausschusses?
Im Auftrage des engeren Ausschusses: Dr. J. Mayer, Bezirksrabbiner in
Zweibrücken.'
Dass wir dem schönen Werke den besten und baldigsten Erfolg wünschen,
brauchen wir nicht erst hinzuzufügen." |
| |
| Die Idee des Israelitischen Altersheimes
wurde 27 Jahre später in Neustadt an der
Weinstraße realisiert (Einweihung des Heimes 1914). |
Rundschreiben von Rabbiner Dr. Mayer zu den hohen Feiertagen
(1890)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. September 1890:
"Zweibrücken, 10. September (1890). Herr Dr. Mayer, Bezirksrabbiner
in Zweibrücken, versendet an die Gemeinden seiner Bezirks ein
Rundschreiben, indem er sich über das Thema 'unsere Umgangssprache' also
ergeht: Eine talmudische Vorschrift verlangt, dass wir Gott für das Böse
nicht minder loben sollen als für das Gute. Auch das, was uns böse
erscheint, trägt oft Keime zu unserer Besserung und Veredlung in sich.
Einen schmerzlichen, aber triftigen Beweis für diese Wahrheit liefert uns
die schon seit Jahren in unserem Vaterlange Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. September 1890:
"Zweibrücken, 10. September (1890). Herr Dr. Mayer, Bezirksrabbiner
in Zweibrücken, versendet an die Gemeinden seiner Bezirks ein
Rundschreiben, indem er sich über das Thema 'unsere Umgangssprache' also
ergeht: Eine talmudische Vorschrift verlangt, dass wir Gott für das Böse
nicht minder loben sollen als für das Gute. Auch das, was uns böse
erscheint, trägt oft Keime zu unserer Besserung und Veredlung in sich.
Einen schmerzlichen, aber triftigen Beweis für diese Wahrheit liefert uns
die schon seit Jahren in unserem Vaterlange |
 gegen
uns gerichtete feindliche Bewegung. Dieselbe hat das eingeschlummerte
jüdische Bewusstsein wieder geweckt und gekräftigt und reinigend und
läuternd nach verschiedenen Richtungen gewirkt. Auch schlecht Werkzeuge
fertigen oft gutes und brauchbares. Die Erreger und Führer dieser
judenfeindlichen Bewegung sannen auf unser Verderben, aber Gott wird es zu
unserem Heil sein lassen. (hebräisch und deutsch:) 'Ihr habt es böse
gemeint, Gott aber gut (1. Mose 50,20).' Makellose Lebensführung,
sittliche Veredlung werden feindlicher Rede und Tat stets am wirksamsten
begegnen. Aber auch manche Äußerlichkeiten, welche geeignet sind, uns
verächtlich erscheinen zu lassen, und uns gar oft Spott und Hohn
zuziehen, müssen weichen, damit wir auch hierin vor Gott und Menschen
rein und tadellos erscheinen. Ich meine besonders die mannigfachen
Missbräuche, welche wir uns in unserer Umgangssprache zuschulden kommen
lassen. gegen
uns gerichtete feindliche Bewegung. Dieselbe hat das eingeschlummerte
jüdische Bewusstsein wieder geweckt und gekräftigt und reinigend und
läuternd nach verschiedenen Richtungen gewirkt. Auch schlecht Werkzeuge
fertigen oft gutes und brauchbares. Die Erreger und Führer dieser
judenfeindlichen Bewegung sannen auf unser Verderben, aber Gott wird es zu
unserem Heil sein lassen. (hebräisch und deutsch:) 'Ihr habt es böse
gemeint, Gott aber gut (1. Mose 50,20).' Makellose Lebensführung,
sittliche Veredlung werden feindlicher Rede und Tat stets am wirksamsten
begegnen. Aber auch manche Äußerlichkeiten, welche geeignet sind, uns
verächtlich erscheinen zu lassen, und uns gar oft Spott und Hohn
zuziehen, müssen weichen, damit wir auch hierin vor Gott und Menschen
rein und tadellos erscheinen. Ich meine besonders die mannigfachen
Missbräuche, welche wir uns in unserer Umgangssprache zuschulden kommen
lassen.
Indem wir in meist unrichtiger und geschmackloser Form die Sprache der
heiligen Schrift und unsere Landessprache durcheinander mengen,
versündigen wir uns in gleicher Weise an dem Geiste dieser Sprachen, an
unserer und unserer Religion Würde und an den Geboten des Anstandes und
der Schicklichkeit. Die Sprache ist das Kleid des Gedankens. So aber ein
Mensch sich hüllen würde in Kleidungsstücke, welche verschiedene
Nationaltrachten oder Geschmackrichtungen angehören -, würde er da nicht
dem Fluche der Lächerlichkeit verlassen? Und wir wollten dasselbe mit der
Einkleidung unserer Gedanken tun und uns dadurch versündigen an uns
selbst und zugleich an der Reinheit und dem Wohllaut der deutschen und an
der Keuschheit und einfachen Hoheit der hebräischen Sprache! Man ist
jetzt mehr denn früher bestrebt, den Besitzstand der deutschen Sprache zu
wahren und zu mehren und gerade wir sollten diesen Bestrebungen nicht auch
entgegenkommen, indem wir einer reinen Sprache uns befleißen? Die Zeiten
und Verhältnisse, unter welchen unser Sprachgemengsel entstand, sind
Gottlob vorüber, und darum wollen wir auch unserer Zeit hierin den
schuldigen Tribut nicht länger vorenthalten und nur deutsch sprechen. Und
wenn wir noch das hebräische rein und richtig sprächen! So aber wie wir
diese Sprache, die uns doch so heilig sein sollte, sprechen, verzerren und
verrenken wir dieselbe in so geschmackloser und gesetzwidriger Weise, dass
der unkundige Hörer nur ein abfälliges Urteil über sie fällen kann.
Die Sprache, in der uns unsere höchsten Religionslehren offenbart wurden,
in der wir zu Gott beten, missbrauchen wir zu hässlichen, unangemessenen
Ausdrücken, die Sprache der Tora wird zum Dolmetsch niedriger
Denkweise, |
 zur
Magd der Märkte. Und welchen Eindruck muss es auf Unkundige machen, wenn
wir in ihrer Gegenwart und Gesellschaft Ausdrücke gebrauchen, die ihnen
unverständlich sind? Werden sie sich nicht von uns abgestoßen fühlen
und daraus ein Recht herleiten, uns als Fremde zu betrachten und von ihrer
Gesellschaft auszuschließen? Es ist ein Zeichen mangelnden
Schicklichkeitsgefühls, wenn wir als Deutsche unter Deutschen nicht
reindeutsch reden, sondern unsere Gedanken zu verhüllen trachten. Wahre
Duldung besteht in der Anerkennung auch der Ungleichheiten, so dieselben
berechtigt sind. Niemand aber wird behaupten wollen, dass diese
Ungleichheit ein Recht auf Duldung habe. Darum lasst uns dieses Erbstück
früherer uns auferlegten Abgeschlossenheit ablegen eingedenk der
talmudischen Mahnung: 'Immer befleiße sich der Mensch einer reinen
Sprache!'" zur
Magd der Märkte. Und welchen Eindruck muss es auf Unkundige machen, wenn
wir in ihrer Gegenwart und Gesellschaft Ausdrücke gebrauchen, die ihnen
unverständlich sind? Werden sie sich nicht von uns abgestoßen fühlen
und daraus ein Recht herleiten, uns als Fremde zu betrachten und von ihrer
Gesellschaft auszuschließen? Es ist ein Zeichen mangelnden
Schicklichkeitsgefühls, wenn wir als Deutsche unter Deutschen nicht
reindeutsch reden, sondern unsere Gedanken zu verhüllen trachten. Wahre
Duldung besteht in der Anerkennung auch der Ungleichheiten, so dieselben
berechtigt sind. Niemand aber wird behaupten wollen, dass diese
Ungleichheit ein Recht auf Duldung habe. Darum lasst uns dieses Erbstück
früherer uns auferlegten Abgeschlossenheit ablegen eingedenk der
talmudischen Mahnung: 'Immer befleiße sich der Mensch einer reinen
Sprache!'" |
Rabbiner Dr. Mayers Stammbaum (Beitrag von 1898)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Februar 1898:
"Zweibrücken.
(Die Familie des Hauptmann Dreyfus) stammt aus dem Dorfe Rixheim bei Mülhausen
im Elsass. Dort lebte der Großvater des Hauptmanns als armer Händler.
Ein Bruder desselben war der vor etwa einem Jahrzehnte verstorbene
Rabbiner Emanuel Dreyfus in Sulzburg (Baden), der Verfasser des
Orach Meischorim; eine ältere Schwester war nach Müllheim (Baden)
verheiratet; diese ist meine Großmutter väterlicherseits. Eine weitere
Schwester war an den Rabbiner Raphael Wurmser in Sultz (Oberelsass)
verheiratet und ein Sohn derselben war der vor etwa zwei Jahren
verstorbene Rabbiner Wurmser in Thann (Oberelsass). Der Vater des
Hauptmanns, der vor einigen Jahren gestorben, siedelte in jungen Jahren
als armer Mensch nach dem nahen Mülhausen über, wo er durch Intelligenz,
Tatkraft und Ausdauer es aus sehr kleinen Anfängen allmählich zum Großfabrikaten
brachte. Dieser, Raphael Dreyfus hieß er, war noch Jude durch und durch,
seine Söhne jedoch, der Hauptmann sowohl wie die beiden Inhaber der
Fabrik, Matthieu und Léon, sind nur dem Namen nach Juden. In alter Zeit
war in der Familie immer Tora-Gelehrsamkeit zu Hause, und in diesem
Jahrhundert entstammten derselben, wie aus obigem zu ersehen, vier
Rabbiner. Dr. Mayer, Bezirksrabbiner." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Februar 1898:
"Zweibrücken.
(Die Familie des Hauptmann Dreyfus) stammt aus dem Dorfe Rixheim bei Mülhausen
im Elsass. Dort lebte der Großvater des Hauptmanns als armer Händler.
Ein Bruder desselben war der vor etwa einem Jahrzehnte verstorbene
Rabbiner Emanuel Dreyfus in Sulzburg (Baden), der Verfasser des
Orach Meischorim; eine ältere Schwester war nach Müllheim (Baden)
verheiratet; diese ist meine Großmutter väterlicherseits. Eine weitere
Schwester war an den Rabbiner Raphael Wurmser in Sultz (Oberelsass)
verheiratet und ein Sohn derselben war der vor etwa zwei Jahren
verstorbene Rabbiner Wurmser in Thann (Oberelsass). Der Vater des
Hauptmanns, der vor einigen Jahren gestorben, siedelte in jungen Jahren
als armer Mensch nach dem nahen Mülhausen über, wo er durch Intelligenz,
Tatkraft und Ausdauer es aus sehr kleinen Anfängen allmählich zum Großfabrikaten
brachte. Dieser, Raphael Dreyfus hieß er, war noch Jude durch und durch,
seine Söhne jedoch, der Hauptmann sowohl wie die beiden Inhaber der
Fabrik, Matthieu und Léon, sind nur dem Namen nach Juden. In alter Zeit
war in der Familie immer Tora-Gelehrsamkeit zu Hause, und in diesem
Jahrhundert entstammten derselben, wie aus obigem zu ersehen, vier
Rabbiner. Dr. Mayer, Bezirksrabbiner." |
Zum Tod von Rabbiner Dr. Israel Mayer (1898)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Mai 1898. "Zweibrücken, 24. Mai
(1898). Die Pfälzische Presse schreibt: Dieser Tage verschied nach kurzem
Krankenlager infolge einer schweren Lungenentzündung Bezirksrabbiner Dr.
Israel Mayer. Der Trauerfall ruft hier in allen Kreisen die größte
Teilnahme hervor, zumal der Verblichene allgemein hoch geschätzt und ein
sehr toleranter Mensch war. Der Verstorbene erreichte ein Alter von 55
Jahren. Er war geboren am 14. Januar 1843 in Müllheim in Baden, besuchte
die Mittelschule und das Lyceum in Karlsruhe, bezog dann die Universität
in Breslau, machte 1869 das Doktorexamen in Freiburg im Breisgau und wurde
1870 Rabbiner in Meisenheim. 1879 wurde er nach Zweibrücken berufen und
verblieb dann daselbst als Bezirksrabbiner. Er war Mitarbeiter
verschiedener wissenschaftlicher und populärer Zeitschriften,
Ehrenvorsitzender und Ehrenmitglied mehrerer von ihm begründeter Wohltätigkeitsvereine.
Zahlreiche Beileidsbekundungen
auswärtiger Korporationen und Freunde sind bereits Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Mai 1898. "Zweibrücken, 24. Mai
(1898). Die Pfälzische Presse schreibt: Dieser Tage verschied nach kurzem
Krankenlager infolge einer schweren Lungenentzündung Bezirksrabbiner Dr.
Israel Mayer. Der Trauerfall ruft hier in allen Kreisen die größte
Teilnahme hervor, zumal der Verblichene allgemein hoch geschätzt und ein
sehr toleranter Mensch war. Der Verstorbene erreichte ein Alter von 55
Jahren. Er war geboren am 14. Januar 1843 in Müllheim in Baden, besuchte
die Mittelschule und das Lyceum in Karlsruhe, bezog dann die Universität
in Breslau, machte 1869 das Doktorexamen in Freiburg im Breisgau und wurde
1870 Rabbiner in Meisenheim. 1879 wurde er nach Zweibrücken berufen und
verblieb dann daselbst als Bezirksrabbiner. Er war Mitarbeiter
verschiedener wissenschaftlicher und populärer Zeitschriften,
Ehrenvorsitzender und Ehrenmitglied mehrerer von ihm begründeter Wohltätigkeitsvereine.
Zahlreiche Beileidsbekundungen
auswärtiger Korporationen und Freunde sind bereits |
Wahl von Rabbinatskandidat Dr. Eugen Meyer zum
Bezirksrabbiner (1898)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Juli 1898: "Der
Rabbinatskandidat Dr. Eugen Meyer vom Breslauer jüdisch-theologischen
Seminar, der nach dem Tode des Rabbiners Dr. Perles in München während
der Sedisvakanz das Predigtamt der Gemeinde verwaltet hatte, ist zum
Bezirksrabbiner in Zweibrücken gewählt worden". Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Juli 1898: "Der
Rabbinatskandidat Dr. Eugen Meyer vom Breslauer jüdisch-theologischen
Seminar, der nach dem Tode des Rabbiners Dr. Perles in München während
der Sedisvakanz das Predigtamt der Gemeinde verwaltet hatte, ist zum
Bezirksrabbiner in Zweibrücken gewählt worden". |
1901
- 1911:
Der Konflikt zwischen Rabbiner Dr. Eugen Meyer und der
Israelitischen Gemeinde
Eine für
die jüdische Gemeinde und den Rabbinatsbezirk Zweibrücken jahrelange schwere
Belastung war der Streit zwischen Bezirksrabbiner Dr. Meyer und Mitgliedern der
Gemeinde beziehungsweise des Gemeindevorstandes. Diese Streit eskalierte seit
1901 immer mehr eskalierte und wurde schließlich nur noch vor Gericht
verhandelt. Sehr schwierig scheint sich insbesondere die Beziehung zwischen dem
Bezirksrabbiner und dem damaligen Lehrer der Gemeinde Max Bachenheimer gestaltet
zu haben, die offenbar überhaupt nicht zusammen arbeiten konnten. Dass es mehr
um persönliche Schwierigkeiten zwischen einzelnen Personen und nicht um ein
grundsätzliches Problem gegangen ist, wird daran deutlich, dass der
Rabbinatsbezirk insgesamt zu Rabbiner Dr. Meyer stand und die Lösung des
Problems schließlich darin gefunden wurde, den Rabbinatssitz von Zweibrücken
nach Pirmasens zu verlegen, von wo aus Dr. Meyer noch bis in die 1920er-Jahre
gute Arbeit als Bezirksrabbiner geleistet hat. Die jüdische Öffentlichkeit
nahm großen Anteil an dem Streit, was sich in ausführlichen Artikeln in den jüdischen
Periodika von 1903 bis 1911 zeigte.
Bericht über den Streit im November 1903
 Artikel im
"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 6. November 1903: "Zweibrücken.
Ein eigenartiger, äußerst seltener Rechtsstreit schwebt zurzeit vor dem
hiesigen Landgericht. Die israelitische Gemeinde Zweibrücken, vertreten
durch Herrn Rechtsanwalt Justizrat Rosenberger hat gegen den
Bezirksrabbiner Dr. E. Meyer die Klage auf Auflösung des Dienstvertrages
angestellt, weil nach Behauptung der Gemeinde der Herr Bezirksrabbiner die
ihm obliegenden dienstlichen Verpflichtungen nicht erfüllt und auch
andere nicht näher gegebene Gründe für die Lösung des Vertragsverhältnisses
vorliegen. Wie wir der 'Pfälzischen Presse' entnehmen, hat die
Kultusgemeinde sich zunächst beschwerdeführend an die königliche
Regierung und an das Kultusministerium gewandt, woraufhin die königliche
Regierung dem Bezirksrabbiner ihre entschiedene Missbilligung kundgegeben
und schließlich auch angedroht habe, dass die Genehmigung zur eventuellen
Dienstentlassung nicht versagen werde. Dabei wurde aber von Seiten der
Verwaltungsbehörden zugleich entschieden, dass das zwischen dem
Bezirksrabbiner und den Kultusgemeinden bestehende Vertragsverhältnis
rein zivilrechtlicher Natur sei und dass die Dienstentlassung nur nach den
zivilrechtlichen Normen erfolgen könne. Die Kultusgemeinde hat darauf dem
Bezirksrabbiner die Dienstentlassung erklärt und, da derselbe nicht
hiermit einverstanden war, Auflösungsklage beim Zivilgericht erhoben." Artikel im
"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 6. November 1903: "Zweibrücken.
Ein eigenartiger, äußerst seltener Rechtsstreit schwebt zurzeit vor dem
hiesigen Landgericht. Die israelitische Gemeinde Zweibrücken, vertreten
durch Herrn Rechtsanwalt Justizrat Rosenberger hat gegen den
Bezirksrabbiner Dr. E. Meyer die Klage auf Auflösung des Dienstvertrages
angestellt, weil nach Behauptung der Gemeinde der Herr Bezirksrabbiner die
ihm obliegenden dienstlichen Verpflichtungen nicht erfüllt und auch
andere nicht näher gegebene Gründe für die Lösung des Vertragsverhältnisses
vorliegen. Wie wir der 'Pfälzischen Presse' entnehmen, hat die
Kultusgemeinde sich zunächst beschwerdeführend an die königliche
Regierung und an das Kultusministerium gewandt, woraufhin die königliche
Regierung dem Bezirksrabbiner ihre entschiedene Missbilligung kundgegeben
und schließlich auch angedroht habe, dass die Genehmigung zur eventuellen
Dienstentlassung nicht versagen werde. Dabei wurde aber von Seiten der
Verwaltungsbehörden zugleich entschieden, dass das zwischen dem
Bezirksrabbiner und den Kultusgemeinden bestehende Vertragsverhältnis
rein zivilrechtlicher Natur sei und dass die Dienstentlassung nur nach den
zivilrechtlichen Normen erfolgen könne. Die Kultusgemeinde hat darauf dem
Bezirksrabbiner die Dienstentlassung erklärt und, da derselbe nicht
hiermit einverstanden war, Auflösungsklage beim Zivilgericht erhoben." |
| |
 Ähnlicher
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. November
1903. Ähnlicher
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. November
1903. |
Schwierige juristische Wege zur Entlassung des
Rabbiners (1904)
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1904: "Zweibrücken,
26. Dezember (1903). Der Konflikt zwischen Rabbiner und Gemeinde, von dem
ich Ihnen jüngst berichtet, ist leider noch nicht beigelegt. Die Klage
der Gemeinde Zweibrücken gegen den Bezirksrabbiner Dr. Eugen Meyer wegen
Vertragsauflösung wurde zwar durch Urteil der ersten Zivilkammer des königlichen
Landgerichts dahier wegen Unzulässigkeit des Rechtsweges zurückgewiesen.
Leider aber wird gegen dieses Urteil von Seiten der Kultusgemeinde
Berufung beim königlichen Oberlandesgerichte dahier eingelegt werden.
Entscheidet das letztere gleich dem Landgerichte, so liegt der Fall vor,
dass die Verwaltungsbehörde – Regierung und Ministerium – sich für
unzuständig erklärt haben, weil die Sache zivilrechtlicher Natur und
deshalb den Gerichten unterstellt sei, während andererseits die Gerichte
wieder entschieden hätten, dass nicht sie, sondern die Verwaltungsbehörden
zuständig seien. Es müsste alsdann von Seiten der Klägerin bei dem
Kompetenz-Konfliktshofe in München beantragt werden, dass dieser die
Stelle bezeichnet, welche in der Sache Recht zu sprechen hat. Diese also
bestimmte Stelle hätte dann endgültig über den Rechtsstreit zu
entscheiden. (Ist denn eine friedliche Einigung absolut unmöglich? Die
Red.)." Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1904: "Zweibrücken,
26. Dezember (1903). Der Konflikt zwischen Rabbiner und Gemeinde, von dem
ich Ihnen jüngst berichtet, ist leider noch nicht beigelegt. Die Klage
der Gemeinde Zweibrücken gegen den Bezirksrabbiner Dr. Eugen Meyer wegen
Vertragsauflösung wurde zwar durch Urteil der ersten Zivilkammer des königlichen
Landgerichts dahier wegen Unzulässigkeit des Rechtsweges zurückgewiesen.
Leider aber wird gegen dieses Urteil von Seiten der Kultusgemeinde
Berufung beim königlichen Oberlandesgerichte dahier eingelegt werden.
Entscheidet das letztere gleich dem Landgerichte, so liegt der Fall vor,
dass die Verwaltungsbehörde – Regierung und Ministerium – sich für
unzuständig erklärt haben, weil die Sache zivilrechtlicher Natur und
deshalb den Gerichten unterstellt sei, während andererseits die Gerichte
wieder entschieden hätten, dass nicht sie, sondern die Verwaltungsbehörden
zuständig seien. Es müsste alsdann von Seiten der Klägerin bei dem
Kompetenz-Konfliktshofe in München beantragt werden, dass dieser die
Stelle bezeichnet, welche in der Sache Recht zu sprechen hat. Diese also
bestimmte Stelle hätte dann endgültig über den Rechtsstreit zu
entscheiden. (Ist denn eine friedliche Einigung absolut unmöglich? Die
Red.)." |
Prozess vor dem Gericht im März 1904
(dieser Artikel ist auf Grund der beleidigenden Vorwürfe gegen Rabbiner Dr.
Meyer nur teilweise wiedergegeben)
 Artikel im
"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 30. März 1904: "Zweibrücken,
22. März (1904). Unter starkem Andrange des Publikums fanden heute die
Verhandlungen in Sachen der Privatklage des Bezirksrabbiners Dr. Meyer
dahier gegen drei Mitglieder der hiesigen jüdischen Kultusgemeinde statt.
Die israelitische Kultusgemeinde hat zuerst beim Bezirksamte und der
Regierung und dann beim Verwaltungsgerichtshofe gegen Dr. Meyer auf Auflösung
des zwischen beiden Parteien bestehenden Vertrages geklagt. Der
Verwaltungsgerichtshof hat sich dann für unzuständig erklärt, und die
Sache an das Landgericht Zweibrücken verwiesen. Letzteres hat sich jedoch
auch für unzuständig erklärt. Nun steht die Gemeinde mit dem Rabbiner
auf gespanntem Fuße. Etliche Mitglieder erlaubten sich dann während
der letzten Zeit anderen Personen gegenüber beleidigende Äußerungen,
was den Herrn Bezirksrabbiner zu den Privatklagen veranlasste..." Artikel im
"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 30. März 1904: "Zweibrücken,
22. März (1904). Unter starkem Andrange des Publikums fanden heute die
Verhandlungen in Sachen der Privatklage des Bezirksrabbiners Dr. Meyer
dahier gegen drei Mitglieder der hiesigen jüdischen Kultusgemeinde statt.
Die israelitische Kultusgemeinde hat zuerst beim Bezirksamte und der
Regierung und dann beim Verwaltungsgerichtshofe gegen Dr. Meyer auf Auflösung
des zwischen beiden Parteien bestehenden Vertrages geklagt. Der
Verwaltungsgerichtshof hat sich dann für unzuständig erklärt, und die
Sache an das Landgericht Zweibrücken verwiesen. Letzteres hat sich jedoch
auch für unzuständig erklärt. Nun steht die Gemeinde mit dem Rabbiner
auf gespanntem Fuße. Etliche Mitglieder erlaubten sich dann während
der letzten Zeit anderen Personen gegenüber beleidigende Äußerungen,
was den Herrn Bezirksrabbiner zu den Privatklagen veranlasste..." |
Zum
Stand der Rabbinatsangelegenheit (1904)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 11. April 1904: "Zweibrücken. In letzter Zeit wurden
bezüglich der Angelegenheiten des Bezirks-Rabbinats dahier und zwar
insbesondere in auswärtigen Blättern Nachrichten verbreitet, welche
einer Richtigstellung bedürfen. Zunächst ist es unrichtig, dass die
Sache überhaupt bei dem Verwaltungsgerichtshofe anhängig gewesen und von
diesem an das königliche Landgericht dahier verwiesen worden ist. Die
Sache war bisher nur bei der königlichen Regierung, sowie dem
königlichen Kultusministerium und andererseits bei dem königlichen
Landgerichte dahier anhängig. Die Verwaltungsbehörden hatten sich für
unzuständig erklärt, ebenso aber auch das königliche Landgericht,
weshalb die Sache in dem Instanzenwege fortgesetzt und zu dem
Kompetenz-Konfliktshofe gebracht werden sollte. Aus diesem Grund wurde
auch gegen das Urteil des königlichen Landgerichtes Berufung zum
königlichen Oberlandesgerichte eingelegt. Mittlerweise hat aber auf eine
neuerliche Vorstellung der israelitischen Kultusgemeinde Zweibrücken das
königliche Kultusministerium und zwar zu Folge seiner Entschließung vom
17. Januar 1904 erkannt, dass in eine Würdigung der einschlägigen
Verhältnisse einzutreten sei. Die königliche Regierung hat deshalb über
die Sachlage zu befinden und die Entscheidung des Oberlandesgerichts ist
bis dahin zurückgestellt. Im Verlaufe der durchgeführten Klagesachen hat
sich aber auch ergeben, dass die Anstellung des derzeitigen Rabbiners in
ungesetzlicher Weise erfolgt ist, indem seine Wahl nicht, wie
vorgeschrieben, durch die steuerpflichtigen Mitglieder der einzelnen
Gemeinden, sondern nur durch die Vorstände dieser Gemeinden erfolgt ist.
Die hiesige Kultusgemeinde hat deshalb auch den Antrag auf Aufhebung der
Wahl und Zurücknahme der Bestätigung bei der königlichen Regierung
eingebracht, welche hierüber gleichfalls zu befinden hat. Die leidige
Angelegenheit, welche schon seit der im Jahre 1899 erfolgten definitiven
Anstellung des derzeitigen Rabbiners spielt, wird somit in Bälde auf die
eine oder andere Weise ihre Erledigung finden. Im allseitigen Interesse
wäre es gelegen, wenn hierdurch die Sache ein für allemal aus der Welt
geschaffen würde, da die derzeitigen Zustände geradezu unhaltbar
sind." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 11. April 1904: "Zweibrücken. In letzter Zeit wurden
bezüglich der Angelegenheiten des Bezirks-Rabbinats dahier und zwar
insbesondere in auswärtigen Blättern Nachrichten verbreitet, welche
einer Richtigstellung bedürfen. Zunächst ist es unrichtig, dass die
Sache überhaupt bei dem Verwaltungsgerichtshofe anhängig gewesen und von
diesem an das königliche Landgericht dahier verwiesen worden ist. Die
Sache war bisher nur bei der königlichen Regierung, sowie dem
königlichen Kultusministerium und andererseits bei dem königlichen
Landgerichte dahier anhängig. Die Verwaltungsbehörden hatten sich für
unzuständig erklärt, ebenso aber auch das königliche Landgericht,
weshalb die Sache in dem Instanzenwege fortgesetzt und zu dem
Kompetenz-Konfliktshofe gebracht werden sollte. Aus diesem Grund wurde
auch gegen das Urteil des königlichen Landgerichtes Berufung zum
königlichen Oberlandesgerichte eingelegt. Mittlerweise hat aber auf eine
neuerliche Vorstellung der israelitischen Kultusgemeinde Zweibrücken das
königliche Kultusministerium und zwar zu Folge seiner Entschließung vom
17. Januar 1904 erkannt, dass in eine Würdigung der einschlägigen
Verhältnisse einzutreten sei. Die königliche Regierung hat deshalb über
die Sachlage zu befinden und die Entscheidung des Oberlandesgerichts ist
bis dahin zurückgestellt. Im Verlaufe der durchgeführten Klagesachen hat
sich aber auch ergeben, dass die Anstellung des derzeitigen Rabbiners in
ungesetzlicher Weise erfolgt ist, indem seine Wahl nicht, wie
vorgeschrieben, durch die steuerpflichtigen Mitglieder der einzelnen
Gemeinden, sondern nur durch die Vorstände dieser Gemeinden erfolgt ist.
Die hiesige Kultusgemeinde hat deshalb auch den Antrag auf Aufhebung der
Wahl und Zurücknahme der Bestätigung bei der königlichen Regierung
eingebracht, welche hierüber gleichfalls zu befinden hat. Die leidige
Angelegenheit, welche schon seit der im Jahre 1899 erfolgten definitiven
Anstellung des derzeitigen Rabbiners spielt, wird somit in Bälde auf die
eine oder andere Weise ihre Erledigung finden. Im allseitigen Interesse
wäre es gelegen, wenn hierdurch die Sache ein für allemal aus der Welt
geschaffen würde, da die derzeitigen Zustände geradezu unhaltbar
sind." |
Der Rabbiner findet die Synagoge verschlossen vor -
Oktober 1905
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. November 1905: "In
Zweibrücken dauert der Konflikt zwischen Rabbiner und Gemeinde fort.
Eines Morgens fanden die Mitglieder der Gemeinde die Synagoge geschlossen,
weil der Vorstand nicht die Schlüssel herausgeben wollte. Wie die 'Zweibrückener Volkszeitung' hierzu bemerkt, dürfte die Ursache in
einem zwischen dem Rabbiner und einzelnen Gemeindemitgliedern schwebenden
Streit zu suchen sein. Unerhört!" Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. November 1905: "In
Zweibrücken dauert der Konflikt zwischen Rabbiner und Gemeinde fort.
Eines Morgens fanden die Mitglieder der Gemeinde die Synagoge geschlossen,
weil der Vorstand nicht die Schlüssel herausgeben wollte. Wie die 'Zweibrückener Volkszeitung' hierzu bemerkt, dürfte die Ursache in
einem zwischen dem Rabbiner und einzelnen Gemeindemitgliedern schwebenden
Streit zu suchen sein. Unerhört!" |
Stand des Konflikts Anfang 1906
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 9. Februar
1906: "München. Verwaltungsgerichtshof. Der Bezirksrabbiner
Dr. Meyer von Zweibrücken verweigerte der dortigen israelitischen
Kultusgemeinde die Bezahlung der Umlage, weil dieselbe ihm die
vertragsmäßige Gehaltsaufbesserung nicht gewährt und auch nicht ein
rituelles Bad eingerichtet habe. Das Bezirksamt Zweibrücken und nunmehr
auch der Verwaltungsgerichtshof verurteilten ihn zur Zahlung der
Kultusumlage, nachdem diese als eine öffentlich rechtliche Leistung mit
den auf Privatverträgen beruhenden Gehaltsansprüchen nicht kompensiert
werden könne." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 9. Februar
1906: "München. Verwaltungsgerichtshof. Der Bezirksrabbiner
Dr. Meyer von Zweibrücken verweigerte der dortigen israelitischen
Kultusgemeinde die Bezahlung der Umlage, weil dieselbe ihm die
vertragsmäßige Gehaltsaufbesserung nicht gewährt und auch nicht ein
rituelles Bad eingerichtet habe. Das Bezirksamt Zweibrücken und nunmehr
auch der Verwaltungsgerichtshof verurteilten ihn zur Zahlung der
Kultusumlage, nachdem diese als eine öffentlich rechtliche Leistung mit
den auf Privatverträgen beruhenden Gehaltsansprüchen nicht kompensiert
werden könne." |
Stand des Konflikts Januar 1907
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Januar 1907: "München, 4.
Januar. Das Ministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten
hat am 29. November 1906 betreffs der israelitischen Kultusgemeinden und
ihrer Rabbiner eine Entschließung erlassen, welche in einer viel erörterten
Frage Klarheit geschaffen hat und für alle israelitischen Kultusgemeinden
Bayerns von größter Wichtigkeit ist. Bekanntlich hat die Kultusgemeinde
Zweibrücken schon vom Jahre 1899 an die Entlassung des von dem
Rabbinatsbezirke Zweibrücken angestellten Bezirksrabbiners angestrebt.
Die Königliche Regierung der Pfalz hat sich für unzuständig erklärt
und die Gemeinde auf den ordentlichen Rechtsweg der Zivilgerichte
verwiesen. Das Königliche Landgericht Zweibrücken hat aber die Klage
wegen Unzulässigkeit des Rechtsweges gleichfalls zurückgewiesen und die
Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde betont. Gegen dieses Urteil wurde
Berufung zum Königlichen Oberlandesgerichte Zweibrücken eingelegt. Noch
vor der Entscheidung dieses Gerichts hat die Gemeinde sich an das Königliche
Staatsministeriums des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten um
Abhilfe gewendet. Dieses hat mit Erlass vom 29. November 1906, wie der Pfälzischen
Presse berichtet wird, im wesentlichen folgende Grundsätze aufgestellt:
Die Königliche Regierung kann, wenn sich Gründe hierfür ergeben,
jederzeit die von ihr erteilte Bestätigung des Rabbiners zurücknehmen.
Es kann dies selbst gegen den Willen der Gemeinden verfügt werden. Im
vorliegenden Falle wurden die vorgebrachten Gründe für genügend
erachtet, dass die beteiligten 16 Gemeinden, bzw. deren Mitglieder die
Entlassung erklären. Da die Mehrheit dieser Mitglieder sich aber gegen
die Entlassung ausgesprochen hat, so konnte dem Antrage der Gemeinde
Zweibrücken eine Folge nicht gegeben werden. Bezüglich des von dieser
Gemeinde eingebrachten Eventualantrages, die Entlassung nur für ihren
Teil er erklären, wurde die Verfügung der Königlichen Regierung, welche
hierzu ihre Zustimmung versagte, aufgehoben. Zugleich wurde die Königliche
Regierung angewiesen, falls die Gemeinde Zweibrücken auf ihrem Antrage
bestehe, neuen Beschluss zu fassen. Der Antrag der Gemeinde hat durch die
stimmberechtigten Gemeindemitglieder unter amtlicher Leitung zu erfolgen.
Das Königliche Staatsministerium hat ausdrücklich betont, dass vor der
Zurücknahme der Bestätigung eine Auflösung des Vertragsverhältnisses
durch die Zivilgerichte nicht zu erfolgen brauche. Es ist somit im Prinzip
entschieden, dass für ähnliche Fälle die Verwaltungsbehörden zuständig
sind." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Januar 1907: "München, 4.
Januar. Das Ministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten
hat am 29. November 1906 betreffs der israelitischen Kultusgemeinden und
ihrer Rabbiner eine Entschließung erlassen, welche in einer viel erörterten
Frage Klarheit geschaffen hat und für alle israelitischen Kultusgemeinden
Bayerns von größter Wichtigkeit ist. Bekanntlich hat die Kultusgemeinde
Zweibrücken schon vom Jahre 1899 an die Entlassung des von dem
Rabbinatsbezirke Zweibrücken angestellten Bezirksrabbiners angestrebt.
Die Königliche Regierung der Pfalz hat sich für unzuständig erklärt
und die Gemeinde auf den ordentlichen Rechtsweg der Zivilgerichte
verwiesen. Das Königliche Landgericht Zweibrücken hat aber die Klage
wegen Unzulässigkeit des Rechtsweges gleichfalls zurückgewiesen und die
Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde betont. Gegen dieses Urteil wurde
Berufung zum Königlichen Oberlandesgerichte Zweibrücken eingelegt. Noch
vor der Entscheidung dieses Gerichts hat die Gemeinde sich an das Königliche
Staatsministeriums des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten um
Abhilfe gewendet. Dieses hat mit Erlass vom 29. November 1906, wie der Pfälzischen
Presse berichtet wird, im wesentlichen folgende Grundsätze aufgestellt:
Die Königliche Regierung kann, wenn sich Gründe hierfür ergeben,
jederzeit die von ihr erteilte Bestätigung des Rabbiners zurücknehmen.
Es kann dies selbst gegen den Willen der Gemeinden verfügt werden. Im
vorliegenden Falle wurden die vorgebrachten Gründe für genügend
erachtet, dass die beteiligten 16 Gemeinden, bzw. deren Mitglieder die
Entlassung erklären. Da die Mehrheit dieser Mitglieder sich aber gegen
die Entlassung ausgesprochen hat, so konnte dem Antrage der Gemeinde
Zweibrücken eine Folge nicht gegeben werden. Bezüglich des von dieser
Gemeinde eingebrachten Eventualantrages, die Entlassung nur für ihren
Teil er erklären, wurde die Verfügung der Königlichen Regierung, welche
hierzu ihre Zustimmung versagte, aufgehoben. Zugleich wurde die Königliche
Regierung angewiesen, falls die Gemeinde Zweibrücken auf ihrem Antrage
bestehe, neuen Beschluss zu fassen. Der Antrag der Gemeinde hat durch die
stimmberechtigten Gemeindemitglieder unter amtlicher Leitung zu erfolgen.
Das Königliche Staatsministerium hat ausdrücklich betont, dass vor der
Zurücknahme der Bestätigung eine Auflösung des Vertragsverhältnisses
durch die Zivilgerichte nicht zu erfolgen brauche. Es ist somit im Prinzip
entschieden, dass für ähnliche Fälle die Verwaltungsbehörden zuständig
sind." |
| |
 Ähnlicher
Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 25.
Januar 1907. Ähnlicher
Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 25.
Januar 1907. |
Stand des Konfliktes im Sommer 1907
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Juli 1907: "Zweibrücken,
im Juli (1907). Die Verhältnisse in unserer Gemeinde spitzen sich immer
mehr zu. Der Synagogenausschuss glaubte sich berechtigt, dem Rabbiner Dr.
E. Meyer die Ausübung seiner Funktion in der Synagoge zu untersagen; er
tut auch alles, um ihn an der Ausübung seines Amtes zu verhindern. Es
wurde sogar der Amtsplatz aus der Synagoge entfernt. Vor dem 12. März
dieses Jahres – Prinzregentengeburtstag – teilte der Rabbiner mit, er
werde an diesem Tage Festgottesdienst abhalten. Als er sich nun an dem erwähnten
Tage in die Synagoge begeben wollte, fand er die Tür verschlossen. Dieses
Vorkommnis gab dem Lehrer der israelitischen Gemeinde, Bachenheimer,
Anlass zur Veröffentlichung eines Artikels in den hiesigen Zeitungen, der
dann auch in verschiedene auswärtige Blätter übernommen wurde. 'Das Königliche
Bezirksamt hat laut Beschlusses vom 28. Februar dieses Jahres dem
Bezirksrabbiner jegliche Ausübung seiner Funktion in der Synagoge
untersagt, auch die Regierungsentschließung vom 6. März 1907 hob auf
eine diesbezügliche Beschwerde hin den bezirksamtlichen Beschluss nicht
auf. Trotzdem versuchte der Rabbiner in dem am gestrigen Tage angesetzten
Festgottesdienst die Predigt zu halten. Um Ruhestörungen vorzubeugen und
zu vermeiden, wurde die Synagoge nicht geöffnet, und als der Rabbiner im
Talar erschien, fand er dann geschlossene Türen. Hoffentlich wird jetzt
die Behörde diesen Zuständen ein Ende bereiten.' Der Rabbiner
erblickte hierin, da die Darstellung nicht den tatsächlichen Verhältnissen
entspreche, eine Beleidigung und erhob gegen den Verfasser, den Lehrer
Bachenheimer, Privatklage, die nun vor dem Schöffengericht dahier zur
Verhandlung gelangte. Wie sich in der Verhandlung herausstellte, hat der
Bezirksrabbiner bereits im März vorigen Jahres bei der Königlichen
Regierung darum nachgesucht, dass in der Synagoge sein Amtsstuhl, der vom
Synagogenausschuss entfernt worden war, wieder angebracht werde. Die
Regierung hat auch diesem Nachsuchen stattgegeben. Trotzdem weigerte sich
der Synagogenausschuss, der Weisung nachzukommen. Dr. Meyer wandte sich
dann im Februar 1907 an das königliche Bezirksamt hier, damit dieses mit
Zwangsmaßregeln gegen den Synagogenausschuss vorgehe und der Amtsstuhl
wieder angebracht werde, da er beabsichtige, am 12. März Gottesdienst zu
halten. Das Bezirksamt wies dieses Ansuchen zurück mit der Begründung,
dass, da zurzeit wieder Ruhe in der israelitischen Kultusgemeinde sei,
diese nicht gestört werden solle, also aus Zweckmäßigkeitsgründen. Die
von Dr. Meyer gegen diese Entscheidung eingelegte Beschwerde wurde mit
Entscheidung vom 6. März 1907 von der Königlichen Regierung gleichfalls
zurückgewiesen, da das Gesetz keine Anhaltspunkte dafür gebe, gegen den
Synagogenausschuss mit Zwangsmitteln vorzugehen; allein von einer
Untersagung der Verrichtung der Funktion seitens des Rabbiners enthält
keine der Entscheidungen etwas. – Der Angeklagte Bachenheimer bestreitet
heute, eine beleidigende Absicht gehabt zu haben; er macht geltend, er
habe sich für berechtigt gehalten, als Religionslehrer die Sache der Öffentlichkeit
beziehungsweise Kultusgemeinde mitzuteilen, insbesondere auch, da er
Berichterstatter der betreffenden Zeitung sei. Er beruft sich auf Wahrung
berechtigter Interessen und will in gutem Glauben gehandelt haben, da von
dem Synagogenausschuss immer gesagt worden sei, die Regierung habe
entschieden, dass dem Rabbiner die Ausübung seiner Funktion untersagt
worden sei seitens der Regierung. Die betreffende Entscheidung will er nur
oberflächlich gelesen haben. Die Synagogenausschussmitglieder sprachen
sich auch dahin aus als Zeugen, dass sie mit dem Passus, der in der
Entscheidung enthalten sei, 'dass dem Rabbiner die Ausübung seines
Amtes zu ermöglichen sei', gemeint hätten, es sei ihnen überlassen,
dem Rabbiner sein Amt ausüben zu lassen oder nicht. Der Rechtsbeistand
des Privatklägers, Rechtsanwalt Dr. Rau, beantragte Bestrafung des
Angeklagten, der Verteidiger des Angeklagten, Rechtsanwalt König, plädierte
auf Freisprechung. Das Urteil lautete auf Freisprechung des Angeklagten.
In den Gründen wurde ausgeführt, es liege zwar eine objektive
Beleidigung vor, es hätte jedoch keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass
dieselbe wider besser Wissen gemacht worden sei, dem Angeklagten müsse
auch der Schutz des § 192 Strafgesetzbuch – Wahrung berechtigter
Interessen – zugebilligt werden, da Bachenheimer als Religionslehrer die
Befugnis hatte, über den Grund des Ausfallens des Gottesdienstes der
Gemeinde Mitteilung zu machen, auch weder in den Umständen, noch in der
Form des Artikels zu weit gegangen sei. – Das sind doch geradezu unerhörte
Zustände in einer jüdischen Gemeinde!" Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Juli 1907: "Zweibrücken,
im Juli (1907). Die Verhältnisse in unserer Gemeinde spitzen sich immer
mehr zu. Der Synagogenausschuss glaubte sich berechtigt, dem Rabbiner Dr.
E. Meyer die Ausübung seiner Funktion in der Synagoge zu untersagen; er
tut auch alles, um ihn an der Ausübung seines Amtes zu verhindern. Es
wurde sogar der Amtsplatz aus der Synagoge entfernt. Vor dem 12. März
dieses Jahres – Prinzregentengeburtstag – teilte der Rabbiner mit, er
werde an diesem Tage Festgottesdienst abhalten. Als er sich nun an dem erwähnten
Tage in die Synagoge begeben wollte, fand er die Tür verschlossen. Dieses
Vorkommnis gab dem Lehrer der israelitischen Gemeinde, Bachenheimer,
Anlass zur Veröffentlichung eines Artikels in den hiesigen Zeitungen, der
dann auch in verschiedene auswärtige Blätter übernommen wurde. 'Das Königliche
Bezirksamt hat laut Beschlusses vom 28. Februar dieses Jahres dem
Bezirksrabbiner jegliche Ausübung seiner Funktion in der Synagoge
untersagt, auch die Regierungsentschließung vom 6. März 1907 hob auf
eine diesbezügliche Beschwerde hin den bezirksamtlichen Beschluss nicht
auf. Trotzdem versuchte der Rabbiner in dem am gestrigen Tage angesetzten
Festgottesdienst die Predigt zu halten. Um Ruhestörungen vorzubeugen und
zu vermeiden, wurde die Synagoge nicht geöffnet, und als der Rabbiner im
Talar erschien, fand er dann geschlossene Türen. Hoffentlich wird jetzt
die Behörde diesen Zuständen ein Ende bereiten.' Der Rabbiner
erblickte hierin, da die Darstellung nicht den tatsächlichen Verhältnissen
entspreche, eine Beleidigung und erhob gegen den Verfasser, den Lehrer
Bachenheimer, Privatklage, die nun vor dem Schöffengericht dahier zur
Verhandlung gelangte. Wie sich in der Verhandlung herausstellte, hat der
Bezirksrabbiner bereits im März vorigen Jahres bei der Königlichen
Regierung darum nachgesucht, dass in der Synagoge sein Amtsstuhl, der vom
Synagogenausschuss entfernt worden war, wieder angebracht werde. Die
Regierung hat auch diesem Nachsuchen stattgegeben. Trotzdem weigerte sich
der Synagogenausschuss, der Weisung nachzukommen. Dr. Meyer wandte sich
dann im Februar 1907 an das königliche Bezirksamt hier, damit dieses mit
Zwangsmaßregeln gegen den Synagogenausschuss vorgehe und der Amtsstuhl
wieder angebracht werde, da er beabsichtige, am 12. März Gottesdienst zu
halten. Das Bezirksamt wies dieses Ansuchen zurück mit der Begründung,
dass, da zurzeit wieder Ruhe in der israelitischen Kultusgemeinde sei,
diese nicht gestört werden solle, also aus Zweckmäßigkeitsgründen. Die
von Dr. Meyer gegen diese Entscheidung eingelegte Beschwerde wurde mit
Entscheidung vom 6. März 1907 von der Königlichen Regierung gleichfalls
zurückgewiesen, da das Gesetz keine Anhaltspunkte dafür gebe, gegen den
Synagogenausschuss mit Zwangsmitteln vorzugehen; allein von einer
Untersagung der Verrichtung der Funktion seitens des Rabbiners enthält
keine der Entscheidungen etwas. – Der Angeklagte Bachenheimer bestreitet
heute, eine beleidigende Absicht gehabt zu haben; er macht geltend, er
habe sich für berechtigt gehalten, als Religionslehrer die Sache der Öffentlichkeit
beziehungsweise Kultusgemeinde mitzuteilen, insbesondere auch, da er
Berichterstatter der betreffenden Zeitung sei. Er beruft sich auf Wahrung
berechtigter Interessen und will in gutem Glauben gehandelt haben, da von
dem Synagogenausschuss immer gesagt worden sei, die Regierung habe
entschieden, dass dem Rabbiner die Ausübung seiner Funktion untersagt
worden sei seitens der Regierung. Die betreffende Entscheidung will er nur
oberflächlich gelesen haben. Die Synagogenausschussmitglieder sprachen
sich auch dahin aus als Zeugen, dass sie mit dem Passus, der in der
Entscheidung enthalten sei, 'dass dem Rabbiner die Ausübung seines
Amtes zu ermöglichen sei', gemeint hätten, es sei ihnen überlassen,
dem Rabbiner sein Amt ausüben zu lassen oder nicht. Der Rechtsbeistand
des Privatklägers, Rechtsanwalt Dr. Rau, beantragte Bestrafung des
Angeklagten, der Verteidiger des Angeklagten, Rechtsanwalt König, plädierte
auf Freisprechung. Das Urteil lautete auf Freisprechung des Angeklagten.
In den Gründen wurde ausgeführt, es liege zwar eine objektive
Beleidigung vor, es hätte jedoch keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass
dieselbe wider besser Wissen gemacht worden sei, dem Angeklagten müsse
auch der Schutz des § 192 Strafgesetzbuch – Wahrung berechtigter
Interessen – zugebilligt werden, da Bachenheimer als Religionslehrer die
Befugnis hatte, über den Grund des Ausfallens des Gottesdienstes der
Gemeinde Mitteilung zu machen, auch weder in den Umständen, noch in der
Form des Artikels zu weit gegangen sei. – Das sind doch geradezu unerhörte
Zustände in einer jüdischen Gemeinde!" |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. August 1907: "Zweibrücken,
30. Juli (1907). Die gespannten Verhältnisse zwischen der hiesigen
israelitischen Kultusgemeinde und dem Bezirksrabbiner Dr. Meyer, die schon
seit Jahren bestehen, haben wie schon oft auch kürzlich wieder zu einem
recht unliebsamen Zwischenfall geführt. Am 12. März, dem Geburtstag des
Prinzregenten, gedachte der Rabbiner, einen Festgottesdienst abzuhalten,
fand aber, als er sich zur Synagoge begab, trotz vorheriger
Benachrichtigung des Synagogenausschusses den Eingang verschlossen. Der
Ausschuss hatte schon früher den Amtsstuhl Dr. Meyers aus der Synagoge
entfernen lassen. Über den Vorfall vom 12. März berichtete der Lehrer
der israelitischen Gemeinde, Bachenheimer, in der Presse, machte dabei
aber die nicht den Tatsachen entsprechende Mitteilung, das Königliche
Bezirksamt habe dem Rabbiner die Ausübung seiner Funktionen in der
Synagoge untersagt. Durch diese Angabe fühlte sich Dr. Meyer beleidigt
und erhob Privatklage, deren Verhandlung vor dem Schöffengericht jedoch
mit der Freisprechung Bachenheimers endete, da, wie das Gericht ausführte,
zwar eine objektive Beleidigung vorliege, jedoch der Angeklagte in Wahrung
berechtigter Interessen, unter dem Schutz des § 193 gehandelt habe, wenn
er als Religionslehrer der Gemeinde Mitteilung über den Grund des
Ausfalls des Gottesdienstes machte. Gegen dieses Urteil legte der Kläger
Berufung ein, die am 25. Juli vor der hiesigen Strafkammer verhandelt
wurde. Es waren 13 Zeugen geladen und die Verhandlungen dehnten sich bis
in die Nachmittagsstunden aus. Die Verkündigung des Urteils erfolgt am
31. Juli." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. August 1907: "Zweibrücken,
30. Juli (1907). Die gespannten Verhältnisse zwischen der hiesigen
israelitischen Kultusgemeinde und dem Bezirksrabbiner Dr. Meyer, die schon
seit Jahren bestehen, haben wie schon oft auch kürzlich wieder zu einem
recht unliebsamen Zwischenfall geführt. Am 12. März, dem Geburtstag des
Prinzregenten, gedachte der Rabbiner, einen Festgottesdienst abzuhalten,
fand aber, als er sich zur Synagoge begab, trotz vorheriger
Benachrichtigung des Synagogenausschusses den Eingang verschlossen. Der
Ausschuss hatte schon früher den Amtsstuhl Dr. Meyers aus der Synagoge
entfernen lassen. Über den Vorfall vom 12. März berichtete der Lehrer
der israelitischen Gemeinde, Bachenheimer, in der Presse, machte dabei
aber die nicht den Tatsachen entsprechende Mitteilung, das Königliche
Bezirksamt habe dem Rabbiner die Ausübung seiner Funktionen in der
Synagoge untersagt. Durch diese Angabe fühlte sich Dr. Meyer beleidigt
und erhob Privatklage, deren Verhandlung vor dem Schöffengericht jedoch
mit der Freisprechung Bachenheimers endete, da, wie das Gericht ausführte,
zwar eine objektive Beleidigung vorliege, jedoch der Angeklagte in Wahrung
berechtigter Interessen, unter dem Schutz des § 193 gehandelt habe, wenn
er als Religionslehrer der Gemeinde Mitteilung über den Grund des
Ausfalls des Gottesdienstes machte. Gegen dieses Urteil legte der Kläger
Berufung ein, die am 25. Juli vor der hiesigen Strafkammer verhandelt
wurde. Es waren 13 Zeugen geladen und die Verhandlungen dehnten sich bis
in die Nachmittagsstunden aus. Die Verkündigung des Urteils erfolgt am
31. Juli." |
| |
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Oktober 1907: "München, 12.
Oktober (1907). Zwischen dem weitaus größten Teile der Mitglieder der
Kultusgemeinde Zweibrücken und dem Bezirksrabbiner Dr. Eugen Meyer in
Zweibrücken bestehen seit mehreren Jahren ernste Differenzen. Die
Erbitterung stieg immer mehr und zeitigte schließlich den Entschluss, Dr.
Meyer die Ausübung seiner Funktionen als Rabbiner in der Synagoge unmöglich
zu machen. Schon im Oktober 1905 kam es während des Gottesdienstes zu
einer erregten Szene zwischen dem Rabbiner und dem Kantor, Religionslehrer
und Schächter Max Bachenheimer wegen der Berechtigung zur Vornahme
gewisser Handlungen, was sogar ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren
zur Folge hatte, das jedoch eingestellt wurde. Am 14. März dieses Jahres
erschien in den Zweibrückener Blättern eine vom 13. März datierte Notiz
folgenden Inhalts: 'Wie unhaltbar das Verhältnis zwischen der
israelitischen Kultusgemeinde Zweibrücken und dem Bezirksrabbiner Meyer
ist, zeigte wieder der gestrige Tag. Die Synagoge musste an diesem Tage
wegen der Befürchtung, dass das unerwünschte Amtieren des Rabbiners Störungen
verursachen würde, geschlossen werden. Das Bezirksamt hatte laut
Beschluss vom 28. Februar dem Bezirksrabbiner jegliche Ausübung v0on
Funktionen in der Synagoge untersagt. Auch die Regierungsentscheidung vom
6. März hob auf eine diesbezügliche Beschwerde hin den bezirksamtlichen Beschluss
nicht auf. Trotzdem versuchte der Bezirksrabbiner, im gestrigen
Festgottesdienste Predigt zu halten. Um eine Ruhestörung zu vermeiden,
wurde die Synagoge nicht geöffnet und als der Rabbiner im Talar erschien,
fand er geschlossene Türen. Hoffentlich wird jetzt die Behörde diesen
traurigen Zuständen ein Ende bereiten.' Wegen dieses Artikels stellte
Dr. Meyer gegen den Verfasser, Kantor Bachenheimer, Privatklage und
Strafantrag wegen Beleidigung; er fühlte sich beleidigt, dass ihm
Auflehnen gegen ein behördliches Verbot vorgeworfen und dass er selbst in
einer Situation dargestellt wurde, die ihn lächerlich machen müsse. Ein
behördliches Verbot der Ausübung seiner Funktionen in der Synagoge ist
nicht ergangen. Die Behauptung des Artikels, dass der Rabbiner trotz eines
solchen Verbots im Festgottesdienste vom 12. März (Geburtstag des
Regenten) zu erscheinen und zu predigen versucht habe, entbehrt der
Wahrheit. Der Rabbiner ist überhaupt nicht an die Synagoge gekommen,
konnte also keine geschlossenen Türen finden. Kantor Bachenheimer wusste,
dass das Bezirksamt dem Rabbiner nicht die Ausübung jeglicher Funktionen
in der Synagoge untersagt habe. Das Schöffengericht sowohl als die
Strafkammer sprechen den Beklagten trotzdem frei, da sie ihm den Schutz
des § 193 Strafgesetzbuch zubilligten. Nun legte der Kläger Revision
beim Obersten Landesgericht ein; er ergriff in unzulässiger Weise die
Feststellungen der Vorinstanz an. Der Strafsenat erkannte auf kostenfällige
Verwerfung der Revision, da diese, soweit sie nicht unzulässig ist, als
unbegründet erscheint."
Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Oktober 1907: "München, 12.
Oktober (1907). Zwischen dem weitaus größten Teile der Mitglieder der
Kultusgemeinde Zweibrücken und dem Bezirksrabbiner Dr. Eugen Meyer in
Zweibrücken bestehen seit mehreren Jahren ernste Differenzen. Die
Erbitterung stieg immer mehr und zeitigte schließlich den Entschluss, Dr.
Meyer die Ausübung seiner Funktionen als Rabbiner in der Synagoge unmöglich
zu machen. Schon im Oktober 1905 kam es während des Gottesdienstes zu
einer erregten Szene zwischen dem Rabbiner und dem Kantor, Religionslehrer
und Schächter Max Bachenheimer wegen der Berechtigung zur Vornahme
gewisser Handlungen, was sogar ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren
zur Folge hatte, das jedoch eingestellt wurde. Am 14. März dieses Jahres
erschien in den Zweibrückener Blättern eine vom 13. März datierte Notiz
folgenden Inhalts: 'Wie unhaltbar das Verhältnis zwischen der
israelitischen Kultusgemeinde Zweibrücken und dem Bezirksrabbiner Meyer
ist, zeigte wieder der gestrige Tag. Die Synagoge musste an diesem Tage
wegen der Befürchtung, dass das unerwünschte Amtieren des Rabbiners Störungen
verursachen würde, geschlossen werden. Das Bezirksamt hatte laut
Beschluss vom 28. Februar dem Bezirksrabbiner jegliche Ausübung v0on
Funktionen in der Synagoge untersagt. Auch die Regierungsentscheidung vom
6. März hob auf eine diesbezügliche Beschwerde hin den bezirksamtlichen Beschluss
nicht auf. Trotzdem versuchte der Bezirksrabbiner, im gestrigen
Festgottesdienste Predigt zu halten. Um eine Ruhestörung zu vermeiden,
wurde die Synagoge nicht geöffnet und als der Rabbiner im Talar erschien,
fand er geschlossene Türen. Hoffentlich wird jetzt die Behörde diesen
traurigen Zuständen ein Ende bereiten.' Wegen dieses Artikels stellte
Dr. Meyer gegen den Verfasser, Kantor Bachenheimer, Privatklage und
Strafantrag wegen Beleidigung; er fühlte sich beleidigt, dass ihm
Auflehnen gegen ein behördliches Verbot vorgeworfen und dass er selbst in
einer Situation dargestellt wurde, die ihn lächerlich machen müsse. Ein
behördliches Verbot der Ausübung seiner Funktionen in der Synagoge ist
nicht ergangen. Die Behauptung des Artikels, dass der Rabbiner trotz eines
solchen Verbots im Festgottesdienste vom 12. März (Geburtstag des
Regenten) zu erscheinen und zu predigen versucht habe, entbehrt der
Wahrheit. Der Rabbiner ist überhaupt nicht an die Synagoge gekommen,
konnte also keine geschlossenen Türen finden. Kantor Bachenheimer wusste,
dass das Bezirksamt dem Rabbiner nicht die Ausübung jeglicher Funktionen
in der Synagoge untersagt habe. Das Schöffengericht sowohl als die
Strafkammer sprechen den Beklagten trotzdem frei, da sie ihm den Schutz
des § 193 Strafgesetzbuch zubilligten. Nun legte der Kläger Revision
beim Obersten Landesgericht ein; er ergriff in unzulässiger Weise die
Feststellungen der Vorinstanz an. Der Strafsenat erkannte auf kostenfällige
Verwerfung der Revision, da diese, soweit sie nicht unzulässig ist, als
unbegründet erscheint." |
Entlassung von Rabbiner Dr. Meyer als Stadtrabbiner, aber nicht als
Bezirksrabbiner - November 1907
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. November 1907: "Zweibrücken,
12. November (1907). Die von der israelitischen Kultusgemeinde Zweibrücken
im Februar dieses Jahres beschlossene Entlassung des Rabbiners Dr. Eugen
Meyer ist nunmehr von der Königlichen Regierung durch Schreiben vom 27.
Oktober bestätigt worden. Es ergibt sich damit der eigenartige Zustand,
dass die Funktionen von Dr. Meyer als Rabbiner für die Stadt Zweibrücken
aufgehört haben, während er für den übrigen Bezirk Zweibrücken auch
weiterhin als Rabbiner tätig bleibt." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. November 1907: "Zweibrücken,
12. November (1907). Die von der israelitischen Kultusgemeinde Zweibrücken
im Februar dieses Jahres beschlossene Entlassung des Rabbiners Dr. Eugen
Meyer ist nunmehr von der Königlichen Regierung durch Schreiben vom 27.
Oktober bestätigt worden. Es ergibt sich damit der eigenartige Zustand,
dass die Funktionen von Dr. Meyer als Rabbiner für die Stadt Zweibrücken
aufgehört haben, während er für den übrigen Bezirk Zweibrücken auch
weiterhin als Rabbiner tätig bleibt." |
Angedachte Verlegung des Rabbinatssitzes von Zweibrücken
nach Homburg (1908)
Anmerkung: Ob dieser Beschluss der Synagogenvorstände des
Rabbinatsbezirkes umgesetzt wurde, ist nicht wahrscheinlich. Tatsächlich wurde
der Sitz des Rabbinates Zweibrücken 1911 nach Pirmasens verlegt.
 Artikel
in "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. Februar
1908: "Zweibrücken. Die Synagogenvorstände des Rabbinatsbezirks
genehmigten einstimmig den Antrag des Bezirksrabbiners Dr. Meyer auf
Verlegung des Rabbinatssitzes nach Homburg
(Pfalz). - Der Beschluss bedarf noch der Genehmigung der
Regierung." Artikel
in "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. Februar
1908: "Zweibrücken. Die Synagogenvorstände des Rabbinatsbezirks
genehmigten einstimmig den Antrag des Bezirksrabbiners Dr. Meyer auf
Verlegung des Rabbinatssitzes nach Homburg
(Pfalz). - Der Beschluss bedarf noch der Genehmigung der
Regierung." |
Stand des Konfliktes im Mai 1908
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Mai 1908: "Zweibrücken,
29. April (1908). Zu der Meldung über die Belassung des Rabbinats in Zweibrücken
teilt der dortigen Synagogenausschuss mit. Durch ministerielle
Entschließung ist die Sache aus lediglich nicht entsprechend angewendeten
Rechtsbestimmungen an die königliche Regierung zur anderweitigen
Erledigung zurückgewiesen worden; die Entschließung liegt noch bei der
königlichen Regierung. Es ist durchaus unrichtig, dass Rabbiner Dr. Meyer
durch Ministerialentschließung gerechtfertigt sei, oder dass die Gemeinde
Zweibrücken beim hiesigen königlichen Bezirksamte beantragt habe, dass
der Rabbinatssitz nicht nach Homburg verlegt wird, ebenso dass Dr. Mayer
seine Funktionen hier wieder aufnehmen möge. Laut Regierungsbeschluss
muss der Sitz des Rabbinatssitzes längstens am 1. Oktober nach Homburg
erfolgt sein." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Mai 1908: "Zweibrücken,
29. April (1908). Zu der Meldung über die Belassung des Rabbinats in Zweibrücken
teilt der dortigen Synagogenausschuss mit. Durch ministerielle
Entschließung ist die Sache aus lediglich nicht entsprechend angewendeten
Rechtsbestimmungen an die königliche Regierung zur anderweitigen
Erledigung zurückgewiesen worden; die Entschließung liegt noch bei der
königlichen Regierung. Es ist durchaus unrichtig, dass Rabbiner Dr. Meyer
durch Ministerialentschließung gerechtfertigt sei, oder dass die Gemeinde
Zweibrücken beim hiesigen königlichen Bezirksamte beantragt habe, dass
der Rabbinatssitz nicht nach Homburg verlegt wird, ebenso dass Dr. Mayer
seine Funktionen hier wieder aufnehmen möge. Laut Regierungsbeschluss
muss der Sitz des Rabbinatssitzes längstens am 1. Oktober nach Homburg
erfolgt sein." |
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 17. Juli 1908: "Zweibrücken. Der Synagogenausschuss
der jüdischen Gemeinde, sowie zwei weitere Mitglieder derselben, hatten gegen
Bezirksrabbiner Dr. Meyer Privatklage wegen Beleidigung erhoben. Dr.
Meyer wurde beschuldigt, die Privatkläger dadurch beleidigt zu haben,
dass er in einem von dem Schreiner Schmidt unter seiner angeblichen
Mitwirkung und Anstiftung geschriebenen Briefe, der vervielfältigt und in
größerer Anzahl an Mitglieder der israelitischen Kultusgemeinde versandt
wurde, die Mitglieder des Synagogenausschusses in ironischem Sinne als
unparteiisch und gerecht bezeichnete und ihr Vorgehen gegen den Beklagten
als solches bezeichnete, durch welches sie dem Gespötte und dem Abscheu
der Christen anheim fielen; ferner, dass er einzelnen Mitgliedern der Kultusgemeinde
schwer beleidigende Vorwürfe machte. Dr. Meyer bestritt vor dem
Schöffengericht entschieden, irgendwie auf Schmidt eingewirkt oder ihn
angestiftet zu haben Schmidt verweigert die Aussage. Das Gericht gelangt
nac dreistündiger Beratung zur Freisprechung des Dr.
Meyer." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 17. Juli 1908: "Zweibrücken. Der Synagogenausschuss
der jüdischen Gemeinde, sowie zwei weitere Mitglieder derselben, hatten gegen
Bezirksrabbiner Dr. Meyer Privatklage wegen Beleidigung erhoben. Dr.
Meyer wurde beschuldigt, die Privatkläger dadurch beleidigt zu haben,
dass er in einem von dem Schreiner Schmidt unter seiner angeblichen
Mitwirkung und Anstiftung geschriebenen Briefe, der vervielfältigt und in
größerer Anzahl an Mitglieder der israelitischen Kultusgemeinde versandt
wurde, die Mitglieder des Synagogenausschusses in ironischem Sinne als
unparteiisch und gerecht bezeichnete und ihr Vorgehen gegen den Beklagten
als solches bezeichnete, durch welches sie dem Gespötte und dem Abscheu
der Christen anheim fielen; ferner, dass er einzelnen Mitgliedern der Kultusgemeinde
schwer beleidigende Vorwürfe machte. Dr. Meyer bestritt vor dem
Schöffengericht entschieden, irgendwie auf Schmidt eingewirkt oder ihn
angestiftet zu haben Schmidt verweigert die Aussage. Das Gericht gelangt
nac dreistündiger Beratung zur Freisprechung des Dr.
Meyer." |
Wieder ist die Synagogentüre verschlossen - September 1908
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober 1908: "Zweibrücken, 2.
Oktober (1908). Der Streit in der israelitischen Gemeinde dahier scheint
aufs Neue entbrannt zu sein. Am Rosch-Haschonoh (Neujahrstag) fanden der
Rabbiner und seine Anhänger, als sie in die Synagoge wollten,
verschlossene Türen. Dieser ließ die Synagoge durch einen Schlosser
gewaltsam öffnen, wobei sich stürmische Szenen abspielten. Die
Lokalzeitungen berichten alle über diesen Vorfall. Wer diesen Chilul
Haschem (Entweihung des göttlichen Namens) heraufbeschworen, hat eine
große Verantwortung auf sich geladen." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober 1908: "Zweibrücken, 2.
Oktober (1908). Der Streit in der israelitischen Gemeinde dahier scheint
aufs Neue entbrannt zu sein. Am Rosch-Haschonoh (Neujahrstag) fanden der
Rabbiner und seine Anhänger, als sie in die Synagoge wollten,
verschlossene Türen. Dieser ließ die Synagoge durch einen Schlosser
gewaltsam öffnen, wobei sich stürmische Szenen abspielten. Die
Lokalzeitungen berichten alle über diesen Vorfall. Wer diesen Chilul
Haschem (Entweihung des göttlichen Namens) heraufbeschworen, hat eine
große Verantwortung auf sich geladen." |
| |
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16. Oktober 1908: "Der Streit
in der israelitischen Gemeinde Zweibrücken scheint aufs Neue entbrannt zu
sein. Anlässlich des Neujahrsfestes war die Synagoge verschlossen, und
zwar vermutlich, um den Rabbiner an der Ausübung seiner Funktion zu
hindern. Dieser in Gemeinschaft mit einer großen Anzahl Israeliten ließ
die Synagoge an beiden Feiertagen durch einen Schlosser gewaltsam öffnen,
und es soll hierbei zu stürmischen Szenen gekommen sein. Wird denn dieser
Chilul-Haschem kein Ende nehmen?" Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16. Oktober 1908: "Der Streit
in der israelitischen Gemeinde Zweibrücken scheint aufs Neue entbrannt zu
sein. Anlässlich des Neujahrsfestes war die Synagoge verschlossen, und
zwar vermutlich, um den Rabbiner an der Ausübung seiner Funktion zu
hindern. Dieser in Gemeinschaft mit einer großen Anzahl Israeliten ließ
die Synagoge an beiden Feiertagen durch einen Schlosser gewaltsam öffnen,
und es soll hierbei zu stürmischen Szenen gekommen sein. Wird denn dieser
Chilul-Haschem kein Ende nehmen?" |
Suspendierung von Bezirksrabbiner Dr. Meyer im August
1909
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. September 1909: "Zweibrücken, 28.
August (1909). Laut Entschließung der Königlichen Regierung vom 24.
August ist der Bezirksrabbiner von seiner Tätigkeit für Zweibrücken und
Bezirk suspendiert worden." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. September 1909: "Zweibrücken, 28.
August (1909). Laut Entschließung der Königlichen Regierung vom 24.
August ist der Bezirksrabbiner von seiner Tätigkeit für Zweibrücken und
Bezirk suspendiert worden." |
Herbst 1909: Eine Lösung des Konfliktes bahnt sich an
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. November 1909: "Zweibrücken, 10.
November (1909). In der unerquicklichen Angelegenheit des Rabbiners Dr.
Meyer ist nun neuerdings eine Ministerialentscheidung ergangen, die in der
Hauptsache folgendes besagt: Die königliche Regierung, Kammer des Innern,
hat mit Verfügung vom 24. August dieses Jahres in Anbetracht der
Erbitterung und Missstimmung, die eine weitere Amtstätigkeit des
Bezirksrabbiners Dr. Meyer von Zweibrücken insbesondere während der
hohen israelitischen Festtage hervorrufen könnte, und im Hinblick auf die
Schwere der ihm zur Last fallenden Verfehlungen die Regierungsentschließung
vom 20. Juni 1909 vorläufig in Vollzug gesetzt und demgemäß dem
Rabbiner bis zur Entscheidung über seine Beschwerde die Vornahme von
Amtshandlungen untersagt. Nunmehr hat Dr. Meyer unterm 7. dieses Monats
bei dem königlichen Staatsministerium des Innern für Kirchen- und
Schulangelegenheiten die Erklärung zu Protokoll gegeben, dass er bis zur
Entscheidung über seine Beschwerde gegen die Regierungsentschließung vom
20. Juni 1909 auf die Ausübung aller Funktionen eines Rabbiners in der
Synagoge zu Zweibrücken verzichte, sich auch verpflichte, die dortige
Synagoge nicht in Amtskleidung zu besuchen, und sich überhaupt in der
Kultusgemeinde Zweibrücken aller öffentlichen Amtshandlungen als
Rabbiner enthalten werde. Solange Dr. Meyer die in dieser Erklärung übernommenen
Verpflichtungen gewissenhaft beobachtet, dürfte der Friede in der
Kultusgemeinde Zweibrücken vorläufig gesichert sein, zumal da auch von
der Partei des Synagogenausschusses bestimmt erwartet werden muss, dass
bis zur endgültigen Entscheidung über die von der königlichen
Regierung, Kammer des Innern, ausgesprochene Zurücknahme der Bestätigung
des Dr. Meyer als Bezirksrabbiner alles vermieden werden wird, was zur
weiteren Verschärfung der Gegensätze beitragen würde. Die gegen Dr.
Meyer erhobenen Beschuldigungen sind allerdings ernster Natur und können
geeignet sein, die Zurücknahme der Bestätigung zu rechtfertigen. Es
kommt aber in Betracht, dass Dr. Meyer jede Schuld mit Entschiedenheit
bestreitet und dass er ungeachtet der schwerwiegenden Verdachtsgründe
nicht als überführt gelten kann, da er gegen die Regierungsentschließung
vom 20. Juni 1909 Beschwerde erhoben hat und die Entscheidung über diese
Beschwerde noch nicht erfolgt ist. Aus diesen Erwägungen wird die vorläufige
Verfügung der königlichen Regierung, Kammer des Innern, vom 24. August
1909 im Hinblick auf die durch Dr. Meyers Erklärung veränderte Sachlage
hiermit außer Wirksamkeit gesetzt." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. November 1909: "Zweibrücken, 10.
November (1909). In der unerquicklichen Angelegenheit des Rabbiners Dr.
Meyer ist nun neuerdings eine Ministerialentscheidung ergangen, die in der
Hauptsache folgendes besagt: Die königliche Regierung, Kammer des Innern,
hat mit Verfügung vom 24. August dieses Jahres in Anbetracht der
Erbitterung und Missstimmung, die eine weitere Amtstätigkeit des
Bezirksrabbiners Dr. Meyer von Zweibrücken insbesondere während der
hohen israelitischen Festtage hervorrufen könnte, und im Hinblick auf die
Schwere der ihm zur Last fallenden Verfehlungen die Regierungsentschließung
vom 20. Juni 1909 vorläufig in Vollzug gesetzt und demgemäß dem
Rabbiner bis zur Entscheidung über seine Beschwerde die Vornahme von
Amtshandlungen untersagt. Nunmehr hat Dr. Meyer unterm 7. dieses Monats
bei dem königlichen Staatsministerium des Innern für Kirchen- und
Schulangelegenheiten die Erklärung zu Protokoll gegeben, dass er bis zur
Entscheidung über seine Beschwerde gegen die Regierungsentschließung vom
20. Juni 1909 auf die Ausübung aller Funktionen eines Rabbiners in der
Synagoge zu Zweibrücken verzichte, sich auch verpflichte, die dortige
Synagoge nicht in Amtskleidung zu besuchen, und sich überhaupt in der
Kultusgemeinde Zweibrücken aller öffentlichen Amtshandlungen als
Rabbiner enthalten werde. Solange Dr. Meyer die in dieser Erklärung übernommenen
Verpflichtungen gewissenhaft beobachtet, dürfte der Friede in der
Kultusgemeinde Zweibrücken vorläufig gesichert sein, zumal da auch von
der Partei des Synagogenausschusses bestimmt erwartet werden muss, dass
bis zur endgültigen Entscheidung über die von der königlichen
Regierung, Kammer des Innern, ausgesprochene Zurücknahme der Bestätigung
des Dr. Meyer als Bezirksrabbiner alles vermieden werden wird, was zur
weiteren Verschärfung der Gegensätze beitragen würde. Die gegen Dr.
Meyer erhobenen Beschuldigungen sind allerdings ernster Natur und können
geeignet sein, die Zurücknahme der Bestätigung zu rechtfertigen. Es
kommt aber in Betracht, dass Dr. Meyer jede Schuld mit Entschiedenheit
bestreitet und dass er ungeachtet der schwerwiegenden Verdachtsgründe
nicht als überführt gelten kann, da er gegen die Regierungsentschließung
vom 20. Juni 1909 Beschwerde erhoben hat und die Entscheidung über diese
Beschwerde noch nicht erfolgt ist. Aus diesen Erwägungen wird die vorläufige
Verfügung der königlichen Regierung, Kammer des Innern, vom 24. August
1909 im Hinblick auf die durch Dr. Meyers Erklärung veränderte Sachlage
hiermit außer Wirksamkeit gesetzt." |
Der Rabbinatsbezirk Zweibrücken wird nach Pirmasens
verlegt (1911)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni 1911: "Zweibrücken, 4.
Juni. Der mehrjährige Konflikt zwischen dem Synagogenausschuss der
israelitischen Gemeinde Zweibrücken und dem hier ansässigen
Bezirksrabbiner Dr. Meyer ist soeben endgültig erledigt worden. Nach
eingehender Prüfung und Würdigung aller gegen Dr. Meyer vorgebrachten Gründe
erließ das Königliche Kultusministerium unterm 19. dieses Monats eine
Entschließung, wonach die Entschließung der Königlichen Regierung vom
20. Juni 1909 endgültig aufgehoben ist, die, wie bekannt, die Bestätigung
Dr. Meyers zum Bezirksrabbiner zurücknahm. Aus freier Entschließung hat
Dr. Meyer, der durch den Entscheid des Ministeriums sich nunmehr für
rehabilitiert hält, den Antrag gestellt, den Rabbinatssitz von Zweibrücken
nach der Hauptgemeinde des Bezirks Pirmasens zu verlegen. Im Auftrag des
Kultusministeriums hat die Königliche Regierung der Pfalz, Kammer des
Innern, über diesen Antrag zu entscheiden." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni 1911: "Zweibrücken, 4.
Juni. Der mehrjährige Konflikt zwischen dem Synagogenausschuss der
israelitischen Gemeinde Zweibrücken und dem hier ansässigen
Bezirksrabbiner Dr. Meyer ist soeben endgültig erledigt worden. Nach
eingehender Prüfung und Würdigung aller gegen Dr. Meyer vorgebrachten Gründe
erließ das Königliche Kultusministerium unterm 19. dieses Monats eine
Entschließung, wonach die Entschließung der Königlichen Regierung vom
20. Juni 1909 endgültig aufgehoben ist, die, wie bekannt, die Bestätigung
Dr. Meyers zum Bezirksrabbiner zurücknahm. Aus freier Entschließung hat
Dr. Meyer, der durch den Entscheid des Ministeriums sich nunmehr für
rehabilitiert hält, den Antrag gestellt, den Rabbinatssitz von Zweibrücken
nach der Hauptgemeinde des Bezirks Pirmasens zu verlegen. Im Auftrag des
Kultusministeriums hat die Königliche Regierung der Pfalz, Kammer des
Innern, über diesen Antrag zu entscheiden." |
| |
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Oktober 1911: "Pirmasens, 13.
September (1911). Die Verlegung des Bezirks-Rabbinatssitzes von Zweibrücken
nach Pirmasens ist jetzt durch die Regierung verfügt worden.
Bezirksrabbiner Dr. Eugen Meyer wird jetzt seinen Wohnsitz in Pirmasens
nehmen." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Oktober 1911: "Pirmasens, 13.
September (1911). Die Verlegung des Bezirks-Rabbinatssitzes von Zweibrücken
nach Pirmasens ist jetzt durch die Regierung verfügt worden.
Bezirksrabbiner Dr. Eugen Meyer wird jetzt seinen Wohnsitz in Pirmasens
nehmen." |
| |
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. Oktober 1911: "Durch
Entschließung der Königlichen Regierung der Pfalz vom 14. September Nr.
29 750 T. ist der Sitz des Rabbinatsbezirks Zweibrücken nach Pirmasens
verlegt worden. Die Zuständigkeit des Rabbiners sowie die Zugehörigkeit
der israelitischen Kultusgemeinde Zweibrücken zum Rabbinat und die
Aufsicht über die dortigen Kultusinstitutionen und Kultusdiener bleibt
ausdrücklich aufrechterhalten. Hiermit sind die zehnjährigen Differenzen
in befriedigender Weise erledigt." Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. Oktober 1911: "Durch
Entschließung der Königlichen Regierung der Pfalz vom 14. September Nr.
29 750 T. ist der Sitz des Rabbinatsbezirks Zweibrücken nach Pirmasens
verlegt worden. Die Zuständigkeit des Rabbiners sowie die Zugehörigkeit
der israelitischen Kultusgemeinde Zweibrücken zum Rabbinat und die
Aufsicht über die dortigen Kultusinstitutionen und Kultusdiener bleibt
ausdrücklich aufrechterhalten. Hiermit sind die zehnjährigen Differenzen
in befriedigender Weise erledigt." |
Aus dem jüdischen
Gemeinde- und Vereinsleben
Gemeinde-Sederabend
zum Pessachfest (1938)
 Artikel
in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der Rheinpfalz" vom
11. Juni 1938: "Aus Zweibrücken. Ein Seder in Zweibrücken. Am
zweiten Pessachabend vereinte sich fast unsere ganze Gemeinde zur
Sederfeier in unserem neuen, geräumigen Heim. Unser verehrter Herr
Lehrer Bernstein hatte in bewundernswerter Weise alles dazu
angeordnet, um diesen harmonischen Seder unter seiner Leitung so feierlich
zu gestalten, dass ein jedes Gemeindemitglied, ob einst fern oder nah,
sich immer in Dankbarkeit dieser erhebenden Feier erinnern wird. Das Motto
des Abends: Wer hungrig ist, komme und esse mit uns, wer bedürftig ist,
komme und feiere mit uns Pessach dieses Jahr hier, künftiges Jahr in Erez
Israel - (oder, wie viele wehmütig dachten, in Amerika oder sonst wo in
der Ferne) wird innigst empfunden. Auch besondere Dankbarkeit sei den
Damen bezeugt, die sich in liebenswürdiger Weise zur Bereitung des
vorzüglichen Essens zur Verfügung stellten, das allen in gastlicher
Weise kostenlos geboten wurde. In tiefem Pessacherleben verrannen die
Stunden und dankerfüllten Herzens trennten wir uns, als die letzten
Melodien verklungen waren in mitternächtlicher Stunde. B.E." Artikel
in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der Rheinpfalz" vom
11. Juni 1938: "Aus Zweibrücken. Ein Seder in Zweibrücken. Am
zweiten Pessachabend vereinte sich fast unsere ganze Gemeinde zur
Sederfeier in unserem neuen, geräumigen Heim. Unser verehrter Herr
Lehrer Bernstein hatte in bewundernswerter Weise alles dazu
angeordnet, um diesen harmonischen Seder unter seiner Leitung so feierlich
zu gestalten, dass ein jedes Gemeindemitglied, ob einst fern oder nah,
sich immer in Dankbarkeit dieser erhebenden Feier erinnern wird. Das Motto
des Abends: Wer hungrig ist, komme und esse mit uns, wer bedürftig ist,
komme und feiere mit uns Pessach dieses Jahr hier, künftiges Jahr in Erez
Israel - (oder, wie viele wehmütig dachten, in Amerika oder sonst wo in
der Ferne) wird innigst empfunden. Auch besondere Dankbarkeit sei den
Damen bezeugt, die sich in liebenswürdiger Weise zur Bereitung des
vorzüglichen Essens zur Verfügung stellten, das allen in gastlicher
Weise kostenlos geboten wurde. In tiefem Pessacherleben verrannen die
Stunden und dankerfüllten Herzens trennten wir uns, als die letzten
Melodien verklungen waren in mitternächtlicher Stunde. B.E." |
Berichte zu einzelnen Personen in der Gemeinde
Über den in Zweibrücken geborenen Psychiater Gustav Aschaffenburg (geb. 1866
in Zweibrücken, gest. 1944 in Baltimore;
zusätzlich eingestellter Bericht von 2009)
(Artikel erhalten von Fred G. Rausch)
 Artikel
im "Lohrer Echo" vom 2. September 2009 (online
im "Main-Netz.de" vom 2.9.2009): "Acht Gramm für
die moderne Zeitungsforschung. Jubiläen: Heute vor 65 Jahren starb der
Psychiater Gustav Aschaffenburg - Pionier der Kriminologie und ganz
nebenbei Visionär von Mediennutzung. Artikel
im "Lohrer Echo" vom 2. September 2009 (online
im "Main-Netz.de" vom 2.9.2009): "Acht Gramm für
die moderne Zeitungsforschung. Jubiläen: Heute vor 65 Jahren starb der
Psychiater Gustav Aschaffenburg - Pionier der Kriminologie und ganz
nebenbei Visionär von Mediennutzung.
Aschaffenburg. Die Vermutung liegt nahe, dass die Wurzeln dieses Mannes in
der Stadt liegen: Warum sonst sollte seine Familie deren Namen tragen?
Gustav Aschaffenburg kam Aschaffenburg aller Voraussicht nach aber nie
näher als bis Würzburg. Dort studierte der am 23. Mai 1866 in
Zweibrücken Geborene zeitweise Medizin, hier begann seine Karriere als
ein Pionier der Forensischen Psychiatrie und der Kriminologie.
Dass der Todestag von Gustav Aschaffenburg heute vor 65 Jahren - am 2.
September 1944 - nahezu vergessen ist, begründet sich im Elend des
Dritten Reichs: Der Sohn eines Talmud-Lehrers wurde 1934 wegen seiner
jüdischen Vorfahren aus dem Dienst an der Uniklinik Köln
entlassen...." zum
weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken oder oben angegebenem Link
folgen. |
Hinweis: Artikel
zu Gustav Aschaffenburg bei Wikipedia
weiterer Hinweis: Gustav Aschaffenburg ist (wann?) zur evangelischen
Konfession konvertiert. |
Der
Redakteur eines Antisemitenblattes wird wegen Beleidigung des Fabrikanten Stern
(Zweibrücken) verurteilt (1883)
 Artikel in der Zeitschrift "Jeschurun"
vom März 1883 S. 155: "Mannheim, 27. Februar (1883). In der
heutigen Sitzung des Großherzoglichen Schöffengerichts, schreibt die
'Pfälzische Presse', wurde der Redakteur des in Mannheim erscheinenden
Antisemitenblattes wegen Beleidigung des Fabrikanten Stern zu Zweibrücken
in eine Geldstrafe von 50 Mark und zu den Kosten verurteilt. Der
Gegenstand der Beleidigung ist in Kürze folgender: Am 10. Dezember
vorigen Jahres wurde in neustadt der Delegiertentag der Pfälzischen
Gewerbevereine abgehalten, bei welchem der Verein Frankenthal durch die
Kaufleute Haschott und Perron (beide Christen), der Verein Zweibrücken
durch Fabrikant Stern (Israelit) vertreten waren. Wenige Tage darauf
brachte nun der 'Mannheimer Bote' in seinem redaktionellen Teile folgende
Notiz: 'Judenspiegel. Bei der am Sonntag zu Neustadt a.H. im Saalbau
abgehaltenen Delegierten-Versammlung der Pfälzischen Gewerbevereine waren
die Vereine Zweibrücken und Frankenthal durch je einen Handelsjuden
vertreten; es wurden die Vorlagen der Reichsregierung, das Kranken- und
Unfallgesetz beraten. Ist das kein Hohn auf die Gesellschaft?' - Während
nun die beiden Frankenthaler Herren diese gemeine Auslassung einfach
ignorierten, strengte Herr Stern jenen Beleidigungsprozess gegen die
Redaktion an, welcher den obererwähnten Ausgang hatte." Artikel in der Zeitschrift "Jeschurun"
vom März 1883 S. 155: "Mannheim, 27. Februar (1883). In der
heutigen Sitzung des Großherzoglichen Schöffengerichts, schreibt die
'Pfälzische Presse', wurde der Redakteur des in Mannheim erscheinenden
Antisemitenblattes wegen Beleidigung des Fabrikanten Stern zu Zweibrücken
in eine Geldstrafe von 50 Mark und zu den Kosten verurteilt. Der
Gegenstand der Beleidigung ist in Kürze folgender: Am 10. Dezember
vorigen Jahres wurde in neustadt der Delegiertentag der Pfälzischen
Gewerbevereine abgehalten, bei welchem der Verein Frankenthal durch die
Kaufleute Haschott und Perron (beide Christen), der Verein Zweibrücken
durch Fabrikant Stern (Israelit) vertreten waren. Wenige Tage darauf
brachte nun der 'Mannheimer Bote' in seinem redaktionellen Teile folgende
Notiz: 'Judenspiegel. Bei der am Sonntag zu Neustadt a.H. im Saalbau
abgehaltenen Delegierten-Versammlung der Pfälzischen Gewerbevereine waren
die Vereine Zweibrücken und Frankenthal durch je einen Handelsjuden
vertreten; es wurden die Vorlagen der Reichsregierung, das Kranken- und
Unfallgesetz beraten. Ist das kein Hohn auf die Gesellschaft?' - Während
nun die beiden Frankenthaler Herren diese gemeine Auslassung einfach
ignorierten, strengte Herr Stern jenen Beleidigungsprozess gegen die
Redaktion an, welcher den obererwähnten Ausgang hatte." |
Zum Tod von Rechtsanwalt Dr. Stern (1894)
 Meldung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. September
1894: "In Zweibrücken ist Rechtsanwalt Dr. Stern, ein bekannter
juristischer Schriftsteller, Vorstand des freisinnigen Vereins, 42 Jahre
alt, gestorben." Meldung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. September
1894: "In Zweibrücken ist Rechtsanwalt Dr. Stern, ein bekannter
juristischer Schriftsteller, Vorstand des freisinnigen Vereins, 42 Jahre
alt, gestorben." |
Der
seitherige Rat am Königlichen Oberlandesgericht in Zweibrücken Theodor Meyer -
jüdischer Abstammung - wurde zum Reichsgerichtsrat ernannt (1906)
Anmerkung (von Paul Theobald, Frankenthal): Theodor Ludwig Meyer (geb. 2. September 1853 in
Edenkoben, gest. 13. Juli 1936 in
Leipzig; beigesetzt in einem nichtjüdischen Friedhof in Leipzig) war seit
dem 3. Mai 1888 in Frankenthal verheiratet mit Hermine Eleonore geb. David
(geb. 15. Juli 1869 in Frankenthal, gest. 18. Juli 1942 in Ludwigshafen am Rhein;
in LU erinnert seit dem 13. Oktober 2015 ein Stolperstein an sie). Hermine
Eleonore Meyer hatte an ihrem 73. Geburtstag die Aufforderung erhalten, sich zur Deportation nach Theresienstadt zu melden. Sie nahm sich mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben. Da die
Beisetzung in der Stadt Ludwigshafen am Rhein nicht genehmigt wurde, musste sie auf dem
Jüdischen Friedhof Mannheim beerdigt werden.
Theodor Ludwig Meyer, königlicher Staatsanwalt in Frankenthal wurde 1891 zum Landgerichtsrat ernannt und an das Kgl. Oberlandesgericht der Pfalz in
Zweibrücken versetzt. Deshalb verzog die Familie Theodor Ludwig Meyer im November 1891 von Frankenthal nach
Zweibrücken.
Aus der Ehe Theodor Ludwig und Hermine Eleonore Meyer geb. David gingen drei
Kinder hervor, und zwar:
- Dr. Marie Regina, Chemikerin (geb. 5. März 1890 in Ludwigshafen am Rhein, verheiratet mit Dr. Curt Eduard Schuster,
umgekommen am 14. März 1944 im KZ Auschwitz; für die Familie Schuster wurden am 13. Oktober 2015 in Ludwigshafen am Rhein Stolpersteine
verlegt).
- Dr. Elise Franziska, Ärztin (geb. 12. April 1892 in Zweibrücken, gest. 26. Oktober 1972 in London)
- Dr. Hedwig Luise (geb. 29. Februar 1896 in Zweibrücken, starb am 25. Februar 1977 in Freiburg im
Breisgau).
Die gesamte Familie Meyer (also auch die Kinder) hatten die evangelische Konfession.
Von 1906 bis 1923 war Theodor Ludwig Meyer Richter am Reichsgericht in Leipzig. Als er dorthin berufen wurde, verzog die Familie von Zweibrücken nach Leipzig, wo er dann auch verstarb. Nach dem Tode ihres Ehemannes zog seine Witwe zu ihrer Tochter Marie Regina Schuster nach Ludwigshafen am Rhein, wo sie sich
1942 das Leben
nahm.
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 11. Dezember 1891: "Der zweite Staatsanwalt am
Landgerichte Frankenthal, Herr Mayer, ist zum Landgerichtsrat
ernannt worden". Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 11. Dezember 1891: "Der zweite Staatsanwalt am
Landgerichte Frankenthal, Herr Mayer, ist zum Landgerichtsrat
ernannt worden". |
| |
|
 Grabsteinplatte
für Hermine Meyer geb. David 15. Juli 1869 - 18. Juli 1942 (jüdischer
Friedhof Mannheim). Grabsteinplatte
für Hermine Meyer geb. David 15. Juli 1869 - 18. Juli 1942 (jüdischer
Friedhof Mannheim). |
 |
|
|
|
| |
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. April 1906:
"München, 30. März (1904). Zum zweitenmal seit Bestehen des
Reichsgerichts ist ein Jude zum Reichsgerichtsrat ernannt worden;
abgesehen selbstverständlich von dem seinerzeit vom
Reichsoberhandelsgerichte übernommenen berühmten Handelsrechtslehrer und
Professor Goldschmidt, war Professor Behrendt der erste jüdische
Reichsgerichtsrat. Jetzt ist der seitherige Rat am Königlichen
Oberlandesgericht Zweibrücken, Theodor Meyer, zum Reichsgerichtsrat
ernannt worden. Leider ist dieser Herr aber seit etwa vier Jahren nur
noch der Abstammung nach Jude, nachdem er durch Übertritt zum Christentum
dieses Hindernis seiner Beförderung beseitigt
hat." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. April 1906:
"München, 30. März (1904). Zum zweitenmal seit Bestehen des
Reichsgerichts ist ein Jude zum Reichsgerichtsrat ernannt worden;
abgesehen selbstverständlich von dem seinerzeit vom
Reichsoberhandelsgerichte übernommenen berühmten Handelsrechtslehrer und
Professor Goldschmidt, war Professor Behrendt der erste jüdische
Reichsgerichtsrat. Jetzt ist der seitherige Rat am Königlichen
Oberlandesgericht Zweibrücken, Theodor Meyer, zum Reichsgerichtsrat
ernannt worden. Leider ist dieser Herr aber seit etwa vier Jahren nur
noch der Abstammung nach Jude, nachdem er durch Übertritt zum Christentum
dieses Hindernis seiner Beförderung beseitigt
hat." |
| Anmerkung: Theodor Meyer wird genannt als
Mitglied im VI.
Zivilsenat des Reichsgerichts (Wikipedia-Artikel), dem er bis zu
seinem Ruhestand 1923 angehörte. |
Staatsanwalt
Dr. Silberschmidt wird Oberlandesgerichtsrat (1906)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 27. April 1906: "München. Dem Staatsanwalt Dr.
Silberschmidt in Zweibrücken ist unter Belassung in diesem
Amte der Rang und Gehalt eines Oberlandesgerichtsrates verliehen
worden. Er ist zurzeit der einzige Jude, der in Bayern als Staatsanwalt
tätig ist."
Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 27. April 1906: "München. Dem Staatsanwalt Dr.
Silberschmidt in Zweibrücken ist unter Belassung in diesem
Amte der Rang und Gehalt eines Oberlandesgerichtsrates verliehen
worden. Er ist zurzeit der einzige Jude, der in Bayern als Staatsanwalt
tätig ist." |
Ernennung von Dr. Hermann Oppenheimer zum Professor an der
Realschule Zweibrücken (1913)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. August 1913: "Herr Dr.
Hermann Oppenheimer in Neustadt a. Haardt ist zum Professor an der
Realschule Zweibrücken ernannt worden." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. August 1913: "Herr Dr.
Hermann Oppenheimer in Neustadt a. Haardt ist zum Professor an der
Realschule Zweibrücken ernannt worden." |
Zum 80. Geburtstag des langjährigen
Gemeindevorsitzenden Ludwig Marcus (1934)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 17. September
1934: "Zweibrücken. Am 19. August (1934) fand in der Synagoge der
hiesigen israelitischen Kultusgemeinde im Rahmen des
Sabbat-Morgengottesdienstes eine erhebende Feier zu Ehren des früheren
Vorsitzenden Herrn Ludwig Marcus statt, welcher an diesem Tage sein 80.
Lebensjahr vollendete. Nach dem Einheben würdigte Herr Lehrer Bernstein
die Verdienste des Jubilars um die seit 1920 unter seiner Leitung stehende
Gemeinde und überreichte ihm als Zeichen des Dankes und der Verehrung außer
einem Tallis mit Silbertresse eine die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden
aussprechende Urkunde. Daran anschließend hielt Herr Bezirksrabbiner Dr.
Nellhaus die Festrede, in welcher er auf die Forderungen hinwies, welche
an Führer und Gemeinde gestellt werden müssen, damit das rechte
Vertrauensverhältnis und eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen beiden
herbeigeführt werde. Herrn Marcus wurde in Anerkennung seines
segensreichen Wirkens im Dienste des Judentums der Chowertitel verliehen.
Mit einer Ansprache des Jubilars selbst, in welcher er tief bewegt den
Dank für die mannigfachen Ehrungen aussprach, schloss die würdige Feier,
an welche er und alle Gemeindemitglieder sich stets gern erinnern werden." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 17. September
1934: "Zweibrücken. Am 19. August (1934) fand in der Synagoge der
hiesigen israelitischen Kultusgemeinde im Rahmen des
Sabbat-Morgengottesdienstes eine erhebende Feier zu Ehren des früheren
Vorsitzenden Herrn Ludwig Marcus statt, welcher an diesem Tage sein 80.
Lebensjahr vollendete. Nach dem Einheben würdigte Herr Lehrer Bernstein
die Verdienste des Jubilars um die seit 1920 unter seiner Leitung stehende
Gemeinde und überreichte ihm als Zeichen des Dankes und der Verehrung außer
einem Tallis mit Silbertresse eine die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden
aussprechende Urkunde. Daran anschließend hielt Herr Bezirksrabbiner Dr.
Nellhaus die Festrede, in welcher er auf die Forderungen hinwies, welche
an Führer und Gemeinde gestellt werden müssen, damit das rechte
Vertrauensverhältnis und eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen beiden
herbeigeführt werde. Herrn Marcus wurde in Anerkennung seines
segensreichen Wirkens im Dienste des Judentums der Chowertitel verliehen.
Mit einer Ansprache des Jubilars selbst, in welcher er tief bewegt den
Dank für die mannigfachen Ehrungen aussprach, schloss die würdige Feier,
an welche er und alle Gemeindemitglieder sich stets gern erinnern werden." |
80.
Geburtstag von Frau H. Altschüler (1937)
Anmerkung: im Adressbuch für die Westpfalz 1911 wird genannt: Henriette
Altschüler, Privatiere, Witwe von Kaufmann Isidor Altschüler, Lammstraße 8 (Quelle).
 Artikel
in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der Rheinpfalz" vom
6. Oktober 1937: "Zweibrücken. Frau H. Altschüler feierte
am 5. Oktober ihren 80. Geburtstag. Wir wünschen der Jubilarin einen
weiteren gesegneten Lebensabend. (Alles Gute) bis 120 Jahre." Artikel
in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der Rheinpfalz" vom
6. Oktober 1937: "Zweibrücken. Frau H. Altschüler feierte
am 5. Oktober ihren 80. Geburtstag. Wir wünschen der Jubilarin einen
weiteren gesegneten Lebensabend. (Alles Gute) bis 120 Jahre." |
Zum Tod des
langjährigen Gemeindedieners David Anathan (1937)
Anmerkung: David Anathan war beruflich als Schneider und Versicherungsagent
tätig und lebte nach dem Adressbuch für die Westpfalz 1911 zusammen mit
(seiner Frau?) der Kleidermacherin Berta Anathan in der Lammstraße 3 (Quelle).
 Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der
Rheinpfalz" vom 1. November 1937: "Zweibrücken. Am 21.
Oktober, eine Woche vor seinem 86. Geburtstage, verschied hier nach
schwerem Leiden unser treuer Gemeindediener Herr David Anathan.
Viele Jahre hindurch hat der Verstorbene in gewissenhafter Weise seine
Obliegenheiten erfüllt, bis das hohe Alter und körperliche Gebrechen ihn
zwangen, seinen Dienst aufzugeben. Herr Anathan erfreute sich in unserer
Gemeinde dank der Gradheit und Zuverlässigkeit seines Charakters
allgemeiner Wertschützung und Beliebtheit. Davon legte auch die große
Beteiligung der Gemeindemitglieder an seiner Beerdigung Zeugnis ab, die am
25. Oktober hierselbst stattfand, und bei welcher Herr Bezirksrabbiner Dr.
Nellhaus dem Verewigten einen ehrenvollen Nachruf hielt. Die Gemeinde wird
ihrem treuen Diener ein dankbares Andenken
bewahren."
Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der
Rheinpfalz" vom 1. November 1937: "Zweibrücken. Am 21.
Oktober, eine Woche vor seinem 86. Geburtstage, verschied hier nach
schwerem Leiden unser treuer Gemeindediener Herr David Anathan.
Viele Jahre hindurch hat der Verstorbene in gewissenhafter Weise seine
Obliegenheiten erfüllt, bis das hohe Alter und körperliche Gebrechen ihn
zwangen, seinen Dienst aufzugeben. Herr Anathan erfreute sich in unserer
Gemeinde dank der Gradheit und Zuverlässigkeit seines Charakters
allgemeiner Wertschützung und Beliebtheit. Davon legte auch die große
Beteiligung der Gemeindemitglieder an seiner Beerdigung Zeugnis ab, die am
25. Oktober hierselbst stattfand, und bei welcher Herr Bezirksrabbiner Dr.
Nellhaus dem Verewigten einen ehrenvollen Nachruf hielt. Die Gemeinde wird
ihrem treuen Diener ein dankbares Andenken
bewahren." |
Zum
Tod des langjährigen Gemeindevorsitzenden Ludwig Marcus (1938)
 Artikel
in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der Rheinpfalz"
vom 1. November 1938: "Zweibrücken. Am 13.
Oktober verschied nach kurzem Leiden der frühere langjährige Vorsitzende
unserer Gemeinde, Herr Ludwig Marcus, im gesegneten Alter von 84
Jahren. Für seine hervorragende Bewährung in der Leitung der Gemeinde
war ihm an seinem 80. Geburtstag von dem Vorstand der Titel eines
Ehrenvorsitzenden, von dem Bezirksrabbiner der Chowertitel verliehen
worden. Die allgemeine Beliebtheit und Verehrung, die der Heimgegangene ob
seiner großen Vorzüge als Mensch und als Jude genoss, zeigte sich noch
einmal gelegentlich seiner Beerdigung, welche am 14. Oktober unter der
Teilnahme fast aller Gemeindemitglieder auf dem Friedhof in Zweibrücken
stattfand. Herr Bezirksrabbiner Dr. Nellhaus widmete dem
Verstorbenen einen herzlichen Nachruf, in welchem er ihm im Namen der
Gemeinde, des Rabbinatsbezirks und des Verbandes für seine Bemühungen
und Verdienste um das Gemeinwohl dankte. Herrn Marcus bleibt ein
ruhmvolles Blatt in der Geschichte der Gemeinde Zweibrücken für alle
Zeiten gesichert. Ehre seinem
Andenken!" Artikel
in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der Rheinpfalz"
vom 1. November 1938: "Zweibrücken. Am 13.
Oktober verschied nach kurzem Leiden der frühere langjährige Vorsitzende
unserer Gemeinde, Herr Ludwig Marcus, im gesegneten Alter von 84
Jahren. Für seine hervorragende Bewährung in der Leitung der Gemeinde
war ihm an seinem 80. Geburtstag von dem Vorstand der Titel eines
Ehrenvorsitzenden, von dem Bezirksrabbiner der Chowertitel verliehen
worden. Die allgemeine Beliebtheit und Verehrung, die der Heimgegangene ob
seiner großen Vorzüge als Mensch und als Jude genoss, zeigte sich noch
einmal gelegentlich seiner Beerdigung, welche am 14. Oktober unter der
Teilnahme fast aller Gemeindemitglieder auf dem Friedhof in Zweibrücken
stattfand. Herr Bezirksrabbiner Dr. Nellhaus widmete dem
Verstorbenen einen herzlichen Nachruf, in welchem er ihm im Namen der
Gemeinde, des Rabbinatsbezirks und des Verbandes für seine Bemühungen
und Verdienste um das Gemeinwohl dankte. Herrn Marcus bleibt ein
ruhmvolles Blatt in der Geschichte der Gemeinde Zweibrücken für alle
Zeiten gesichert. Ehre seinem
Andenken!" |
Anzeigen jüdischer
Gewerbebetriebe
Anzeige
des Manufaktur- und Konfektionsgeschäftes L. Hené (1901)
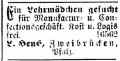 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. August 1901: "Ein
Lehrmädchen gesucht Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. August 1901: "Ein
Lehrmädchen gesucht
für Manufaktur- und Konfektionsgeschäft. Kost und Logis frei.
L. Hené, Zweibrücken, Pfalz." |
Anzeige von Fa. Neu & Blumenthal (1903)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Dezember 1903:
"Koscher Palmbutter Koscher - Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Dezember 1903:
"Koscher Palmbutter Koscher -
feinstes Pflanzenfett. Vielfach prämiiert
- ärztlich empfohlen. Bestes, gesündestes Koch-, Brat- und Backfett. 50
% Ersparnis.
Ein Viertel weniger erforderlich, als von Kochbutter oder
sonstigen Speisefetten. General Depót für Deutschland:
Neu &
Blumenthal, Zweibrücken (Pfalz)." |
Sonstiges
Bezirksrabbiner J. Oppenheimer (Pirmasens) lehnte eine Trauerrede am Feiertag in
Zweibrücken ab (1870)
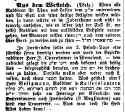 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit " vom 25. Mai 1870: "Aus dem Westrich
(Pfalz). Wenn alle Rabbinen ihr tun und Lassen dem Schulchan
Aruch unterordnen und für Gott und seine heilige Religion wirken würden,
ja dann würde es im Judentume noch nicht so traurig aussehen, wie es
leider jetzt der Fall ist, wo selbst Rabbiner mit dem unlöblichen
Beispiele vorangehen, des Mammons willen einen Din
(Vorschrift) nach dem anderen über Bord zu werfen und zu tun, was nicht dem Willen Gottes
entspricht. Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit " vom 25. Mai 1870: "Aus dem Westrich
(Pfalz). Wenn alle Rabbinen ihr tun und Lassen dem Schulchan
Aruch unterordnen und für Gott und seine heilige Religion wirken würden,
ja dann würde es im Judentume noch nicht so traurig aussehen, wie es
leider jetzt der Fall ist, wo selbst Rabbiner mit dem unlöblichen
Beispiele vorangehen, des Mammons willen einen Din
(Vorschrift) nach dem anderen über Bord zu werfen und zu tun, was nicht dem Willen Gottes
entspricht.
In Zweibrücken sollte am 2. Pessach-Tage eine jüdische Frau beerdigt
werden und ward der Bezirksrabbiner Herr J. Oppenheimer in Pirmasens, dem
nebenbei gesagt die Bestimmungen des
Schulchan Aruch noch bekannt und heilig sind – telegraphisch
berufen, am Feiertag die Leichenrede zu halten. Derselbe wollte aber weder
nach L. reisen, noch die Trauerrede
halten. Was geschah aber? Herr Seligmann, Rabbiner in Kaiserslautern …
fuhr am Feiertage per Eisenbahn von Kaiserslautern nach Zweibrücken 8
Wegstunden) und hielt eine Trauerrede. – Was man doch für Geld alles
haben kann!" |
Konferenz der Lehrer des Rabbinatsbezirkes Zweibrücken (1890)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1890: "Aus
den Lehrervereinen. Aus der Pfalz. Post festum. Am 25. Dezember 1889
versammelten sich die israelitischen Lehrer des Rabbinatsbezirks
Zweibrücken zu einer freien Konferenz. Ein allgemeiner israelitischer
pfälzischer Lehrerverein besteht bisher noch nicht. Hier stehen sich
überhaupt die Lehrer aus den verschiedenen Rabbinatsbezirken fremd
gegenüber. Der Eine kennt den Andern nicht, und es ist deshalb
wünschenswert, vielleicht auch möglich, dass der Lehrerverein sich über
die ganze Pfalz ausdehne. Doch gut Ding will Weile haben; der Anhang ist
gemacht und - so Gott will - wird es schon gelingen. - Um 11 Uhr
wurde die Konferenz eröffnet, und mit herzlichen Worten begrüßte unser
allverehrter Rabbiner Dr. Mayer die anwesenden Lehrer, sowie die Vertreter
der israelitischen Kultusgemeinde Zweibrücken. In der Begrüßungsrede
stellte Herr Bezirksrabbiner sich gleichsam als Kollege vor, indem
derselbe in seiner humorvollen Rede mit treffenden und kernigen Worten
bemerkte, dass ja auch ein großer Teil der Wirksamkeit des Rabbiners der
Neuzeit der Schule angehöre. Der Zweck der heutigen Konferenz sei, so
führte Herr Bezirksrabbiner Dr. Mayer weiter aus. 1. Feststellung eines
Lehrplanes für den israelitischen Religionsunterricht an der Volksschule.
2. gegenseitiges Kennenlernen der Lehrer des Rabbinatsbezirkes selbst,
(was bisher größtenteils noch nicht der Fall war). 3. Mittel und Wege
zur Befestigung der Stellung der Religionslehrer. Dieser Punkt konnte
nicht mehr in der heutigen Beratung zur Erledigung kommen, musste deshalb
für eine der nächsten Konferenzen aufgeschoben werden. - Das Thema,
welches sodann besprochen wurde, was ein 'Normallehrplan für den
jüdischen Religionsunterricht'. Die Referate hierzu hatten die Herren
Moses, Rodalben und Bachenheimer,
Zweibrücken übernommen; jene zeugten von großem Fleiß und tiefem
Verständnis der Sache. Die sich an die Vorträge knüpfenden
Verhandlungen waren äußerst lebhaft und führten zu dem Ergebnisse, dass
es einem Ausschusse von vier Mitgliedern bestehend aus dem Herrn
Bezirksrabbiner Dr. Mayer als Vorsitzenden, den Herren Lehrern Moses Rodalben,
Bachenheimer Zweibrücken und Wolf Blieskastel aufgegeben wurde, auf Grund
der heutigen Beschlüssen einen entgültigen Lehrplan festzustellen und
der nächsten Konferenz zur Genehmigung vorzulegen. Ein Weiteres über den
Lehrplan, erlaube ich mir nach definitiver Feststellung desselben zu
berichten. Ein gemeinsames Mittagessen vereinigte die Teilnehmer noch auf
einige vergnügte Stunden, wobei Herr Bezirksrabbiner Dr. Mayer ein
begeistert aufgenommenes Hoch auf Seiner Königlichen Hoheit den Prinzregenten
Luitpold ausbrachte. - Obgleich bis jetzt dem Verein nur Lehrer aus dem
Rabbinat Zweibrücken beigetreten sind, so hoffen wir doch, dass bei der
nächsten Konferenz sich auch Kollegen aus den übrigen Bezirken
beteiligen. Concordia res parvae crescunt." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1890: "Aus
den Lehrervereinen. Aus der Pfalz. Post festum. Am 25. Dezember 1889
versammelten sich die israelitischen Lehrer des Rabbinatsbezirks
Zweibrücken zu einer freien Konferenz. Ein allgemeiner israelitischer
pfälzischer Lehrerverein besteht bisher noch nicht. Hier stehen sich
überhaupt die Lehrer aus den verschiedenen Rabbinatsbezirken fremd
gegenüber. Der Eine kennt den Andern nicht, und es ist deshalb
wünschenswert, vielleicht auch möglich, dass der Lehrerverein sich über
die ganze Pfalz ausdehne. Doch gut Ding will Weile haben; der Anhang ist
gemacht und - so Gott will - wird es schon gelingen. - Um 11 Uhr
wurde die Konferenz eröffnet, und mit herzlichen Worten begrüßte unser
allverehrter Rabbiner Dr. Mayer die anwesenden Lehrer, sowie die Vertreter
der israelitischen Kultusgemeinde Zweibrücken. In der Begrüßungsrede
stellte Herr Bezirksrabbiner sich gleichsam als Kollege vor, indem
derselbe in seiner humorvollen Rede mit treffenden und kernigen Worten
bemerkte, dass ja auch ein großer Teil der Wirksamkeit des Rabbiners der
Neuzeit der Schule angehöre. Der Zweck der heutigen Konferenz sei, so
führte Herr Bezirksrabbiner Dr. Mayer weiter aus. 1. Feststellung eines
Lehrplanes für den israelitischen Religionsunterricht an der Volksschule.
2. gegenseitiges Kennenlernen der Lehrer des Rabbinatsbezirkes selbst,
(was bisher größtenteils noch nicht der Fall war). 3. Mittel und Wege
zur Befestigung der Stellung der Religionslehrer. Dieser Punkt konnte
nicht mehr in der heutigen Beratung zur Erledigung kommen, musste deshalb
für eine der nächsten Konferenzen aufgeschoben werden. - Das Thema,
welches sodann besprochen wurde, was ein 'Normallehrplan für den
jüdischen Religionsunterricht'. Die Referate hierzu hatten die Herren
Moses, Rodalben und Bachenheimer,
Zweibrücken übernommen; jene zeugten von großem Fleiß und tiefem
Verständnis der Sache. Die sich an die Vorträge knüpfenden
Verhandlungen waren äußerst lebhaft und führten zu dem Ergebnisse, dass
es einem Ausschusse von vier Mitgliedern bestehend aus dem Herrn
Bezirksrabbiner Dr. Mayer als Vorsitzenden, den Herren Lehrern Moses Rodalben,
Bachenheimer Zweibrücken und Wolf Blieskastel aufgegeben wurde, auf Grund
der heutigen Beschlüssen einen entgültigen Lehrplan festzustellen und
der nächsten Konferenz zur Genehmigung vorzulegen. Ein Weiteres über den
Lehrplan, erlaube ich mir nach definitiver Feststellung desselben zu
berichten. Ein gemeinsames Mittagessen vereinigte die Teilnehmer noch auf
einige vergnügte Stunden, wobei Herr Bezirksrabbiner Dr. Mayer ein
begeistert aufgenommenes Hoch auf Seiner Königlichen Hoheit den Prinzregenten
Luitpold ausbrachte. - Obgleich bis jetzt dem Verein nur Lehrer aus dem
Rabbinat Zweibrücken beigetreten sind, so hoffen wir doch, dass bei der
nächsten Konferenz sich auch Kollegen aus den übrigen Bezirken
beteiligen. Concordia res parvae crescunt." |
Erinnerungen an die Auswanderungen im 19. Jahrhundert: Grabstein in New York für Philip
Dahl aus Zweibrücken (1819-1891)
Anmerkung: das Grab befindet sich in einem jüdischen Friedhof in NY-Brooklyn.
 |
Grabstein
"In Memory of
our beloved Father
Philip Dahl, Born in
Zweibrücken Rhein-Pfalz
November 19th 1819
Died January 18th 1891". |
| Kennkarte
aus der NS-Zeit |
| |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |
| |
Kennkarte
für den in Zweibrücken
geborenen Heinrich Lesem |
 |
|
| |
Kennkarte (ausgestellt
in Mainz 1939) für Heinrich Lesem (geb. 9. Januar 1873 in
Zweibrücken),
Kaufmann, wohnhaft in Mainz, am 27. September 1942 ab Darmstadt in das
Ghetto Theresienstadt
deportiert, wo er am 7. Januar 1943 umgekommen ist. |
|
|