|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"
Zur Übersicht "Synagogen im
Kreis Kaiserslautern"
Otterberg (Kreis
Kaiserslautern)
Jüdische Geschichte / Familie Straus / Synagoge
Jewish History / Family Straus / Synagogue
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Otterberg bestand eine jüdische Gemeinde bis 1897.
Ihre Entstehung geht in die Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts zurück,
als einige jüdische Familien aus benachbarten Orten und anderen pfälzischen
Gebieten zugezogen sind. Jedoch lebten bereits zuvor Juden am Ort: 1650 wird eine jüdische Familie am Ort genannt.
Genaue Zahlen jüdischer Einwohner liegen erst
wieder aus dem 19. Jahrhundert vor. 1803 werden vier jüdische Familien
gezählt, 1808 31 jüdische Einwohner (8 % der Gesamteinwohnerschaft), 1815 acht
jüdische Familien, 1825 56 jüdische Einwohner (2,4 %), 1848 100 jüdische
Einwohner in 21 Familien mit 100 Personen.
1809/10 werden die folgenden jüdischen Haushaltsvorstände genannt:
Salomon Maas (Händler), Joseph Rothschild (Viehhändler), Isaac Strauß
(Viehhändler), Jacob Strauß (Viehhändler), Lazare Strauß (Viehhändler),
Isaac Weil (Händler), David Wolff (Händler). Die Abwanderung jüdischer
Familien aus Otterberg begann recht früh: 1827 wird in
Kaiserslautern unter den dorthin
gezogenen jüdischen Personen Jacob Heumann aus Otterberg genannt.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge, eine jüdische
Schule (Religionsschule) und eine Mikwe. Die Toten der jüdischen Gemeinde wurden
im jüdischen Friedhof in Mehlingen
beigesetzt. Von den jüdischen Lehrern werden genannt: um 1828 Herr Adler,
um 1831 J. Lehmann, sein Nachfolger war J. Asser, der vor 1841 starb, dann
Lehrer Mandel; um 1885/1887 Hermann Strauss (genannt in "Der Israelit" vom
22.9.1885).
Nach der Mitte des 19.
Jahrhunderts ging die Zahl der jüdischen Einwohner durch Aus- und Abwanderung
schnell zurück. 1875 wurden nur noch 23 jüdische Einwohner gezählt, 1887
17, 1888 14, 1892 14 in zwei Familien, 1893 15 in drei Familien, um 1894/1901 15
in zwei Familien. 1897
konnte kein Gottesdienst mehr abgehalten werden, da nur noch drei erwachsene
jüdische Männer hier lebten. Daher wurde in diesem Jahr die jüdische Gemeinde
Otterberg aufgelöst. Die hier noch lebenden Juden wurden der Gemeinde in
Kaiserslautern zugeteilt.
Von den Gemeindevorstehern werden zuletzt genannt: um 1887/1896 H. Marx,
L. Straß und H. Straus. um 1898/1901 H. Marx und H. Straus.
Von den Vereinen und Stiftungen in der Gemeinde werden genannt:
ein Wohltätigkeitsverein (genannt 1869 in "Der Israelit" vom 10.11.1869
und "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 2.11.1869, bzw. als Verein Gemilut
Chassodim in "Der Israelit" vom 3.8.1870), die Eheleute Maas'sche
Stiftung (um 1888/1893 unter Vorsitz von Herrn Straus).
Von den in Otterberg geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Eugen Heimann (geb. 1869
in Otterberg, später Köln, 1942 in das KZ Theresienstadt deportiert, wo er
1944 umgekommen ist), Mathilde Salmon geb. Heimann (geb. 1867 in Otterberg,
später in Berlin, 1941 in das Ghetto Lodz deportiert, 1942 in das
Vernichtungslager Chelmno).
Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Allgemeine Beiträge
Streit vor Gericht zwischen Gemeindegliedern in
Otterberg und dem Rabbiner von Kaiserslautern
(1846)
Das Dokumente stammt aus der Zeit aufkommender Auseinandersetzungen
zwischen reformerisch und konservativ gesinnten Personen in den jüdischen
Gemeinden. Beschrieben wird, wie Personen der Otterberger Gemeinde den
"reformatorischen Bestrebungen" des Rabbiners "stets hindernd im
Wege" standen. Die Bestrebungen des Rabbiners gingen allerdings
ausgesprochen weit, was u.a. daran deutlich wird, dass sich der Rabbiner in der
Gerichtsverhandlung u.a. für eine Abschaffung des feierlichen Eingangsgebetes
an Jom Kippur, dem Kol Nidre aussprach.
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. Dezember
1846: "Otterberg (für Osterberg) bei Kaiserslautern
(bayerische Pfalz), 30. November (1846). Die Presse ist dazu da, die
Übergriffe nach jeder Seite hin zu bekämpfen, um nur dem Geltung zu
verschaffen, was in reiner Intention und mit reinen Mitteln unternommen
worden. Wir haben hier am 3. dieses Monats vor dem Zuchtpolizeigerichte in
öffentlicher Sitzung ein Schauspiel erlebt, das sicherlich einer strengen
Mahnung bedarf. Die Israeliten K. und O. waren von Herrn Rabbiner S.
angeklagt, ihn am letztverflossenen Erew Jom Kippur in der Synagoge
durch Worte in Verrichtung seiner Funktionen gestört zu haben. (Wenn ich
nicht irre, war nämlich dies die Veranlassung, dass jene behaupteten, man
sage an diesem Tage kein Awenu Malkenu ['Unser Vater, unser
König', Teil der Jom-Kippur-Liturgie]). Herr Rabbiner, der bei dieser
Sache selbst als Zeuge geladen war, deponierte mit der größtesten
Leidenschaftlichkeit, und suchte namentlich die als Entlastungszeugen
geladenen Israeliten, zwanzig an der Zahl, worunter die angesehensten der
Stadt, als Teilnehmer eines Komplotts darzustellen; dieses Komplott
stünde seinen reformatorischen Bestrebungen stets hindernd im Wege, und
suche alle Verbesserungen, die er im Gottesdienste einzuführen gedenke,
zu hintertreiben, nicht sowohl aus innerer Frömmigkeit, als vielmehr aus
persönlichem Hasse gegen ihn selbst. Als Beleg seiner Behauptung verließ
Herr S. plötzlich den eigentlichen Boden der Verhandlung, und führte an:
es existiere ein Gebet, das sogenannte Kol Nidre, das am
Versöhnungsfeste gesprochen werde. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. Dezember
1846: "Otterberg (für Osterberg) bei Kaiserslautern
(bayerische Pfalz), 30. November (1846). Die Presse ist dazu da, die
Übergriffe nach jeder Seite hin zu bekämpfen, um nur dem Geltung zu
verschaffen, was in reiner Intention und mit reinen Mitteln unternommen
worden. Wir haben hier am 3. dieses Monats vor dem Zuchtpolizeigerichte in
öffentlicher Sitzung ein Schauspiel erlebt, das sicherlich einer strengen
Mahnung bedarf. Die Israeliten K. und O. waren von Herrn Rabbiner S.
angeklagt, ihn am letztverflossenen Erew Jom Kippur in der Synagoge
durch Worte in Verrichtung seiner Funktionen gestört zu haben. (Wenn ich
nicht irre, war nämlich dies die Veranlassung, dass jene behaupteten, man
sage an diesem Tage kein Awenu Malkenu ['Unser Vater, unser
König', Teil der Jom-Kippur-Liturgie]). Herr Rabbiner, der bei dieser
Sache selbst als Zeuge geladen war, deponierte mit der größtesten
Leidenschaftlichkeit, und suchte namentlich die als Entlastungszeugen
geladenen Israeliten, zwanzig an der Zahl, worunter die angesehensten der
Stadt, als Teilnehmer eines Komplotts darzustellen; dieses Komplott
stünde seinen reformatorischen Bestrebungen stets hindernd im Wege, und
suche alle Verbesserungen, die er im Gottesdienste einzuführen gedenke,
zu hintertreiben, nicht sowohl aus innerer Frömmigkeit, als vielmehr aus
persönlichem Hasse gegen ihn selbst. Als Beleg seiner Behauptung verließ
Herr S. plötzlich den eigentlichen Boden der Verhandlung, und führte an:
es existiere ein Gebet, das sogenannte Kol Nidre, das am
Versöhnungsfeste gesprochen werde. |
 Dieses Gebet enthalte den Ausdruck, dass alle Schwüre und Eide, die ein
Israelit während des ganzen Jahres ablege, förmlich erlassen seien.
Dieses Gebet nun habe er abschaffen wollen, weil es den Betenden leicht
irre führen und zur Ansicht verleiten könne, es würde in demselben der
Meineid verziehen, er sei aber auf den heftigsten Widerstand gestoßen,
und so werde das Kol Nidre heute noch am Verstöhnungstage
gebetet.
Dieses Gebet enthalte den Ausdruck, dass alle Schwüre und Eide, die ein
Israelit während des ganzen Jahres ablege, förmlich erlassen seien.
Dieses Gebet nun habe er abschaffen wollen, weil es den Betenden leicht
irre führen und zur Ansicht verleiten könne, es würde in demselben der
Meineid verziehen, er sei aber auf den heftigsten Widerstand gestoßen,
und so werde das Kol Nidre heute noch am Verstöhnungstage
gebetet.
Herr Rabbiner führte noch mehrere Beispiele von solchen widersinnigen
Gebeten an, die er habe abschaffen wollen, unter Anderen, dass eines
dieser Gebete mit den Worten anfange: 'Ich danke dir, Herr, dass ich kein
Christ bin'; ein anderes: 'Ich danke dir, Herr, dass du mich zu keiner
Frau gemacht.' Als Herr S. seine Zeugenaussage beendigt hatte und zu
seinem Sitze zurückgekehrt war, soll ihm ein anderer Israelit zugerufen
haben: 'Herr Rabbiner, sagen Sie Kiddusch darauf.' Herr S. erhob
sich sofort leidenschaftlich gegen das Gericht und deponierte, dieses Wort
sei eines der gemeinsten Schmähwörter, welche die hebräische Sprache
aufzuweisen habe. Der Mann der jenes Wort ausgerufen, wurde sofort vor
Gericht gestellt. Er erklärte zu seiner Verteidigung, das Wort Kiddusch
habe durchaus die Bedeutung nciht, welche Herr Rabbiner S. ihm beizulegen
sich bemühe. Der Präsident des Gerichts ließ zwei anwesende Israeliten
vortreten, um sich über die Bedeutung des Wortes zu erklären. Auf ihre
Behauptung, das Wort Kiddusch enthalte nichts Beleidigendes, wurde
der Mann freigesprochen.
Die Verhandlung dieser Sache, die einen großen Teil der Sitzung einnahm,
namentlich die krasse Schroffheit, mit welcher der Herr Rabbiner gegen
seine Glaubensgenossen auftrat, machte auf alle Unbeteiligten einen
sichtbar widerlichen und verletzenden Eindruck. Der Verteidiger des
Angeklagten erhob sich darauf und erklärt mit feierlicher Stimme: 'Wenn
alles das wahr ist, was Herr Rabbiner S. zur Schilderung seiner
Glaubensgenossen und von ihren Gebeten und Gebräuchen gesagt hat, so
fühle ich mich versucht, auszurufen: Ich danke dir, Herr, dass du mich
nicht zum Juden gemacht.'
Ich könnte Ihnen noch Manches bei dieser Verhandlung Vorgekommene
aufzählen, will aber, der Kürze wegen, nur noch das anführen, dass Herr
S., um seine Handlungen zu beschönigen, das Wirken seines Vorgängers,
des seligen Herrn Rabbiners Cohen auf alle mögliche Weise zu
verunglimpfen suchte, eines Mannes, dessen Name noch heute wohltuend
klingt, und dessen zu frühes Hinscheiden noch jetzt von Jedermann tief
bedauert wird.
Von welchen moralischen Folgen ein Tatbestand begleitet ist, der, wie der vorliegende,
öffentlich vor einer großen Menge von Zuhörern verhandelt worden,
welche Eindrücke und Meinungen ferner dieser Vorfall hervorgerufen, und
noch hervorruft, davon mag sich jeder Leser Ihres verbreiteten Blattes
überzeugen. St." |
Ergebnis einer Kollekte in der
Gemeinde "für die Notleidenden im Heiligen Land" (1870)
 Mitteilung in "Der Israelit" vom 3. August 1870: "Aus
Otterberg (Pfalz:) von dem Vorstande Salomon Straus: aus der Chewrat
Gemilut Chassodim (Wohltätigkeitsverein) 15 fl., aus der Machzit
HaSchekel-Sammlung an Purim
fünf fl., zusammen 20 fl."
Mitteilung in "Der Israelit" vom 3. August 1870: "Aus
Otterberg (Pfalz:) von dem Vorstande Salomon Straus: aus der Chewrat
Gemilut Chassodim (Wohltätigkeitsverein) 15 fl., aus der Machzit
HaSchekel-Sammlung an Purim
fünf fl., zusammen 20 fl."
|
Über zwei Stiftungen in der
Gemeinde (1891)
 Artikel in "Israelitische Wochenschrift" vom 16. Juli 1891: "Kaiserslautern, 3. Juli. (Original-Korrespondenz).
Zu dem Legat, dass seit
vielen Jahren das kinderlose Manoh'sche Ehepaar seligen Andenkens zu
Otterberg, einer frühen früher nicht unbedeutenden Gemeinde des Rabbinatsbezirks Kaiserslautern, vermacht, mit der Bestimmung, den Todestag durch
Lernen und Kaddischgebet zu begehen (diese Bestimmung wird nun, da in
Otterberg kein Minjan mehr vorhanden, auf Veranlassung unseres Bezirksrabbiners
Dr. Landsberg und mit Genehmigung der vorgesetzten Behörde
alljährlich pünktlich und feierlich in hiesiger Synagoge im Sinne des
Testaments beachtet) gesellt sich ein Vermächtnis von 10.000 Mark, das der
vor ca. sechs Jahren hier verstorbene ledige Herr Nathan May seligen
Andenkens der hiesigen Gemeinde durch seinen in Amerika lebenden wohnenden
Onkel Salomon May gestiftet. Der Testator, aus
Wallhalben stammend und schon
bei Lebzeiten seinen Wohltätigkeitssinn zeigend, bestimmte, dass die
hiesige Gemeinde über obiges Kapital zu verfügen habe, jedoch an seinem
Todestage die Armen hiesiger Gemeinde, sowie der Gemeinden
Wallhalben und
Herschberg entsprechend zu unterstützen. Herr
Dr. Landsberg nahm
Veranlassung, am letzten Sabbat in einer glänzenden und tief zu Herzen
gehenden Rede diese schöne Wohltat des Mannes, der mit großer Liebe dem
hiesigen Gemeindeleben zugetan war, zu preisen und somit sein Andenken zu
ehren. Möge des Redners Wunsch sich erfüllen, dass die Wohlhabenden der
Gemeinde auf ähnliche Weise nach Unsterblichkeit streben, sich erheben zur
Ehre des Judentums und zum eigenen Heile hier und dort!" Artikel in "Israelitische Wochenschrift" vom 16. Juli 1891: "Kaiserslautern, 3. Juli. (Original-Korrespondenz).
Zu dem Legat, dass seit
vielen Jahren das kinderlose Manoh'sche Ehepaar seligen Andenkens zu
Otterberg, einer frühen früher nicht unbedeutenden Gemeinde des Rabbinatsbezirks Kaiserslautern, vermacht, mit der Bestimmung, den Todestag durch
Lernen und Kaddischgebet zu begehen (diese Bestimmung wird nun, da in
Otterberg kein Minjan mehr vorhanden, auf Veranlassung unseres Bezirksrabbiners
Dr. Landsberg und mit Genehmigung der vorgesetzten Behörde
alljährlich pünktlich und feierlich in hiesiger Synagoge im Sinne des
Testaments beachtet) gesellt sich ein Vermächtnis von 10.000 Mark, das der
vor ca. sechs Jahren hier verstorbene ledige Herr Nathan May seligen
Andenkens der hiesigen Gemeinde durch seinen in Amerika lebenden wohnenden
Onkel Salomon May gestiftet. Der Testator, aus
Wallhalben stammend und schon
bei Lebzeiten seinen Wohltätigkeitssinn zeigend, bestimmte, dass die
hiesige Gemeinde über obiges Kapital zu verfügen habe, jedoch an seinem
Todestage die Armen hiesiger Gemeinde, sowie der Gemeinden
Wallhalben und
Herschberg entsprechend zu unterstützen. Herr
Dr. Landsberg nahm
Veranlassung, am letzten Sabbat in einer glänzenden und tief zu Herzen
gehenden Rede diese schöne Wohltat des Mannes, der mit großer Liebe dem
hiesigen Gemeindeleben zugetan war, zu preisen und somit sein Andenken zu
ehren. Möge des Redners Wunsch sich erfüllen, dass die Wohlhabenden der
Gemeinde auf ähnliche Weise nach Unsterblichkeit streben, sich erheben zur
Ehre des Judentums und zum eigenen Heile hier und dort!"
|
Die letzten jüdischen
Einwohnerinnen verlassen Otterberg (1913)
 Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 9. Oktober 1913: "Otterberg.
(Die Letzten.) Dieser Tage verließen die beiden Damen Marx unser
Städtchen, um nach Kaiserslautern überzusiedeln. Dieser an sich ziemlich
unbedeutende Vorgang erhält, wie man der 'Pfälzischen Volkszeitung' berichtet,
dadurch eine besondere Wichtigkeit, als damit die letzten Israeliten unsere
Stadt verlassen haben. Man erinnert sich noch ganz gut hier, dass vor
einigen Jahrzehnten die hiesige Einwohnerschaft mindestens zur Hälfte sich
zum Judentum bekannte. Die Tatsache, dass in verhältnismäßig kurzer Zeit
eine Gemeinde von der meistens Handel treibenden Einwohnerschaft verlassen
wird, gibt sicher zu denken. Otterberg mit seinem früher blühenden
Handel, war durch die Eröffnung der Alsenz- und der Lautertalbahn abseits
gesetzt, sein Handeln unterbunden. Der Wegzug der Juden ist ein Zeichen für
den bevorstehenden Niedergang unseres Ortes in wirtschaftlicher Beziehung."
Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 9. Oktober 1913: "Otterberg.
(Die Letzten.) Dieser Tage verließen die beiden Damen Marx unser
Städtchen, um nach Kaiserslautern überzusiedeln. Dieser an sich ziemlich
unbedeutende Vorgang erhält, wie man der 'Pfälzischen Volkszeitung' berichtet,
dadurch eine besondere Wichtigkeit, als damit die letzten Israeliten unsere
Stadt verlassen haben. Man erinnert sich noch ganz gut hier, dass vor
einigen Jahrzehnten die hiesige Einwohnerschaft mindestens zur Hälfte sich
zum Judentum bekannte. Die Tatsache, dass in verhältnismäßig kurzer Zeit
eine Gemeinde von der meistens Handel treibenden Einwohnerschaft verlassen
wird, gibt sicher zu denken. Otterberg mit seinem früher blühenden
Handel, war durch die Eröffnung der Alsenz- und der Lautertalbahn abseits
gesetzt, sein Handeln unterbunden. Der Wegzug der Juden ist ein Zeichen für
den bevorstehenden Niedergang unseres Ortes in wirtschaftlicher Beziehung."
|
In Otterberg gibt es keine
jüdischen Einwohner mehr (1913)
 Artikel in "Neue jüdische Presse
/ Frankfurter Israelitisches Familienblatt" vom 10. Oktober 1913: "Otterberg
bei Kaiserslautern. Unser fast 3000 Seelen zählendes Städtchen hatte noch
vor wenigen Jahrzehnten eine blühende jüdische Gemeinde. Heute gibt es nicht
eine jüdische Seele mehr hier." Artikel in "Neue jüdische Presse
/ Frankfurter Israelitisches Familienblatt" vom 10. Oktober 1913: "Otterberg
bei Kaiserslautern. Unser fast 3000 Seelen zählendes Städtchen hatte noch
vor wenigen Jahrzehnten eine blühende jüdische Gemeinde. Heute gibt es nicht
eine jüdische Seele mehr hier." |
Aus der
Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule
Nennung der Lehrer in Otterberg in
den 1820er-/1830er-Jahren (1841)
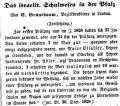 Artikel in "Israelitische Annalen" vom 15. Januar 1841: "Das israelitische Schulwesen in der Pfalz.
Artikel in "Israelitische Annalen" vom 15. Januar 1841: "Das israelitische Schulwesen in der Pfalz.
Von E. Grünebaum, Bezirksrabbiner in Landau. (Fortsetzung.)
Zur ersten Prüfung nun im Jahre 1828
hatten sich 27 Individuen gemeldet, aber nur 24 sich der Prüfung unterzogen.
Von diesen erhielten sieben die Note gut - worunter aber einige ausgezeichnete
waren, wie Maier Elsasser, Lehrer zu Edenkoben, und der damals in
Otterberg
als Lehrer funktionierende Herr Adler, jetzt Privatmann in
Kirchheimbolanden; sieben erhielten die Note hinlänglich und zehn wurden
als notdürftig bezeichnet. Die beiden letzten Kategorien bekamen die Weisung,
sich im nächsten Jahre wieder einer Prüfung zu unterziehen, 'um hierdurch die
Gewissheit zu geben, dass sie den Unterricht an den israelitischen Religionsschulen mit
Nutzen und gesegneten Erfolge zu übernehmen im Stande sind'.
(Int. Bl. 26. September 1828). " |
| |
 Artikel in "Israelitische Annalen" vom 15. Januar 1841: "Rabbinatsbezirk Kaiserslautern Artikel in "Israelitische Annalen" vom 15. Januar 1841: "Rabbinatsbezirk Kaiserslautern
1) Winnweiler, J. Strauss 7. März 1830.
2) Alsenz, B. Weinschenk, 28. August 1830.
3) Odenbach, Is. C. Kampe, 16.
Februar 1831.
4) Otterberg, J. Lehmann, 11. Juni 1831
(Nach dessen Versetzung J. Asser, jetzt gestorben, und an dessen Stelle
jetzt Mandel.)
5) Steinbach, S. Frenkel, 11.
August 1831.
6) Münchweiler, J. Strauß, 15.
Januar 1832.
7) Kirchheimbolanden, Adler,
28. Juli 1832 (an dessen Stelle später der ebenfalls wackere Jakob
Sulzbacher).
8) Kaiserslautern, A. Kahn, 23.
Mai 1833 (später Walz).
9) Hochspeyer, H. Rothschild, 4.
August 1833 (später in Niederhochstadt und jene Stelle ist noch unbesetzt).
10) Gauersheim, B. Feistmann, 30.
Dezember 1834 (gestorben)
11) Börrstadt, Jos. Abr. Blum, 20.
Februar 1836 (versetzt nach Hagenbach, und hier B. Alexander).
12) Rockenhausen, M. Eigner, 28.
Oktober 1837.
13) Niederkirchen, M. Salomon, 11.
Oktober 1837.
14) Marienthal, Isaac Lob, 18. März
1838 (später J. Frank, pensioniert unterm 23. August 1838, für ihn S.
Wolff)." |
Berichte
zu Personen aus der jüdischen Gemeinde -
Beiträge zur Familie Straus (Strauss,
Strauß)
Lazarus
und Sara Strauss aus Otterberg und seine Söhne - ein Überblick:
 | Lazarus Straus (geb. 1809 in Otterberg, gest. 1898
in New York), Vater von Isidor, Nathan und Oskar Straus; gründete in Folge
der durch seine Aktivitäten bei der Revolution 1848/49 (enge Freundschaft
mit Carl Schurz und Gottfried Kinkel) veranlassten Auswanderung in die USA
das Warenhaus L. Straus and Sons (weitere Informationen zur
Familiengeschichte in den unten stehenden Artikeln von 1898 und
1906).
|
 | Isidor Strauss (geb. 1845 in Otterberg, gest. 15. April
1912 beim Untergang der Titanic): 1854 mit seiner Familie in die USA
ausgewandert, zunächst aufgewachsen in Talbotton, Georgia, 1866 nach New
York, 1888 zusammen mit seinem Bruder Nathan Teilhaber des Kaufhauses R.H. Macy
& Co. in New York; 1894-1895 Mitglied des Repräsentantenhauses. Im April
1912 zusammen mit seiner Frau Ida und zwei Angestellten an Bord des Luxusdampfers
Titanic. Beide kamen bei der Katastrophe ums Leben.
Dazu Artikel von Katja Becher in Ludwigshafen24.de vom 24. Februar 2018: "Die
tragische Geschichte des Ehepaars Straus: dieses berühmte Paar aus
'Titanic' lebte in der Region..."
|
 | Nathan Strauss (geb. 31.Januar 1848 in Otterberg, gest.
1931 in New York): 1854
mit seiner Familie in die USA ausgewandert, zunächst aufgewachsen in
Talbotton, Georgia, 1866 nach New York, 1888 zusammen mit seinem Bruder
Isidor Teilhaber des Kaufhauses R.H. Macy & Co. in New York; verheiratet
seit 1875 mit Lina geb. Gutherz; Nathan Strauss galt bereits in den
1890er-Jahren als Wohltäter. Setzte sich für Arme und Obdachlose ein;
unterstützte wesentlich eine Kampagne für pasteurisierte Milch und rettete
dadurch unzähligen Kindern das Leben (vgl. zu
Sandhausen und Text unten zu
Karlsruhe). In den folgenden Jahrzehnten
unterstützte er mit großen Summen Projekte in den USA, Palästina (Israel)
und Deutschland. Die Stadt Netanja in Israel ist nach ihm
benannt.
|
 | Oskar Salomon Strauss (Oscar S. Straus, geb. 23.
Dezember 1850 in Otterberg, gest. 3. Mai 1926 in New York), 1854 mit seiner
Familie in die USA ausgewandert; machte eine politische Karriere zunächst als
US-Gesandter der Türkei 1887-1889 und 1898-1899. 1906-1909 war er unter Präsident
Theodore Roosevelt US Secretary of Commerce
and Labor (Wirtschafts- und Arbeitsminister; war erstes jüdisches
Kabinettsmitglied in den USA); 1909-10 wiederum als Botschafter der USA in der Türkei.
|
Lazarus Straus - bereits vor der
Auswanderung in besonderer Funktion (1843)
Anmerkung: bereits lange vor der 1854 erfolgten
Auswanderung nach Amerika hatte Lazarus Straus eine besondere Rolle in der
Judenschaft von Otterberg und der Region inne. Er war es, der im Alter von 30
Jahren 1843 für die "Allgemeine Zeitung des Judentums" den Nekrolog
zum Tod von Bezirksrabbiner Moses Cohen (Kaiserslautern) verfasste:
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Juni 1843: "Nekrolog.
Am 14. dieses (Monats) entschlummerte nach kurzem Krankenlager unser
geliebter Bezirksrabbiner Moses Cohen zu Kaiserslautern. Geboren im Jahre
1785 zu Merzbach in Unterfranken, bezog er in seinem fünfzehnten Jahre
die damals noch blühende jüdische Hochschule in Fürth, und nachdem er
zwei Jahre da zugebracht, setzte er seine Studien neun Jahre in Prag
weiter fort. Als im Jahre 1828 das Bezirksrabbinat zu Kaiserlautern gegründet
wurde, berief man ihn zu diesem Amte, bei welchem er als Geistlicher und
als ein wahrer Priester (Cohen) des Ewigen fünfzehn volle Jahre hindurch
wirkte. Der Verblichene gehörte zu den selteneren, ausgezeichneten Persönlichkeiten.
Außer seinen theologischen und linguistischen Kenntnissen hatte er sich
noch besonders in Mathematik und Geschichte hervorgetan. Alle seine
heilsamen Verbesserungen, die er namentlich beim Schul- und Synagogenwesen
ins Leben rief, suchte er nicht durch Gewalt, sondern langsam auf dem Wege
der Liebe und Besserung durchzuführen. Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Juni 1843: "Nekrolog.
Am 14. dieses (Monats) entschlummerte nach kurzem Krankenlager unser
geliebter Bezirksrabbiner Moses Cohen zu Kaiserslautern. Geboren im Jahre
1785 zu Merzbach in Unterfranken, bezog er in seinem fünfzehnten Jahre
die damals noch blühende jüdische Hochschule in Fürth, und nachdem er
zwei Jahre da zugebracht, setzte er seine Studien neun Jahre in Prag
weiter fort. Als im Jahre 1828 das Bezirksrabbinat zu Kaiserlautern gegründet
wurde, berief man ihn zu diesem Amte, bei welchem er als Geistlicher und
als ein wahrer Priester (Cohen) des Ewigen fünfzehn volle Jahre hindurch
wirkte. Der Verblichene gehörte zu den selteneren, ausgezeichneten Persönlichkeiten.
Außer seinen theologischen und linguistischen Kenntnissen hatte er sich
noch besonders in Mathematik und Geschichte hervorgetan. Alle seine
heilsamen Verbesserungen, die er namentlich beim Schul- und Synagogenwesen
ins Leben rief, suchte er nicht durch Gewalt, sondern langsam auf dem Wege
der Liebe und Besserung durchzuführen.
Noch nie habe ich einen größeren Leichenzug erblickt. Den
Glaubensgenossen des Verewigten, die aus allen Orten in und außer des
ausgebreiteten Bezirkes herbeigeströmt waren, hatten sich die
christlichen Bewohner der Stadt Kaiserslautern in Masse angeschlossen; die
Beamten, die Geistlichen der verschiedenen Konfessionen, die Lehrer der
Volksschulen, die Zöglinge des Seminars und der Gewerbeschule, sie alle
waren herbeigekommen, um dem Verblichenen die letzte Ehre zu erweisen. Vor
der Stadt machte der Zug Halt, und nachdem die Seminaristen einige
Trauerkantaten abgesungen hatten, bewegte sich der Leichenwagen nach dem
zwei Stunden von da entfernten Begräbnisplatze. Der Dahingeschiedene
hatte, wie der hiezu berufene Leichenredner, Bezirksrabbiner Dr. Grünebaum
aus Landau treffend bemerkte, keinen Feind, ja nicht einmal einen Gegner.
Ihn beweinen eine trostlose Witwe mit fünf Kindern, sein tief getrübter
Bruder, der Bezirksrabbiner (Aron) Merz aus
Dürkheim a. H., sowie sämtliche
Gemeinden des Bezirks Kaiserslautern. Möge sein Andenken noch recht lange
unter uns weilen! Möge aber auch der Geist des Friedens, der Liebe und
der erleuchteten Frömmigkeit, die ihn beseelt, über uns walten, ihm zum
Ruhme und uns zum Segen!
Otterberg, im Mai 1843. L. Straus, der junge." |
Zum Tod von Lazarus Straus
(1898)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Februar 1898:
"New York, 15. Januar (1898). Gestern verschied hier in dem
hohen Alter von 89 Jahren Herr Lazarus Straus, der Gründer des weithin
bekannten Warenhauses L. Straus and Sons. Im Jahre 1809 in Otterberg,
Bayern, geboren, ein Enkel des gleichnamigen Mitgliedes des französischen
Sanhedrins, widmete er sich neben den von ihm betriebenen Studien des
hebräischen Schrifttums und der Geschichte der Juden dem merkantilen
Fache. An der revolutionären Bewegung in den Jahren 1848 und 1849 nahm
er, ein Freund Kinkels und Karl Schurz's, tätigen Anteil. Im Jahre 1853
verließ er die Heimat und wanderte nach Amerika aus. Er eröffnete ein
Geschäft in Talbotton, Georgia und siedelte sich mehrere Jahre später in
New York an, wo er mit seinem Sohne Isidor das Haus begründete, das heute
zu den bedeutendsten und angesehensten des Landes gehört. In den letzten
Jahren seines Lebens zog er sich vom Geschäft zurück und widmete sich
den liebgewonnenen Studien. Als sein Sohn Oskar, der frühere
amerikanische Gesandte in Konstantinopel, der gegenwärtige Präsident der
'Amerikanisch-jüdisch-historischen Gesellschaft', vor einigen Jahren
Herrn Dr. Kayserling in Budapest veranlasste, zur Ermittelung des Anteils,
welchen die Juden an der Entdeckung Amerikas genommen, eine
Forschungsreise nach Spanien zu unternehmen, war er es, der die Kosten der
Reise bestritt. Lazarus Straus, eines der ältesten Mitglieder der
Beth-el-Gemeinde und vertrauter Freund des Rabbiners David Einhorn,
gehörte zu den wohltätigsten Männern New Yorks; viele Familien
betrauern in ihm ihren Ernährer. Sein Andenken wird stets ein gesegnetes
sein!" Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Februar 1898:
"New York, 15. Januar (1898). Gestern verschied hier in dem
hohen Alter von 89 Jahren Herr Lazarus Straus, der Gründer des weithin
bekannten Warenhauses L. Straus and Sons. Im Jahre 1809 in Otterberg,
Bayern, geboren, ein Enkel des gleichnamigen Mitgliedes des französischen
Sanhedrins, widmete er sich neben den von ihm betriebenen Studien des
hebräischen Schrifttums und der Geschichte der Juden dem merkantilen
Fache. An der revolutionären Bewegung in den Jahren 1848 und 1849 nahm
er, ein Freund Kinkels und Karl Schurz's, tätigen Anteil. Im Jahre 1853
verließ er die Heimat und wanderte nach Amerika aus. Er eröffnete ein
Geschäft in Talbotton, Georgia und siedelte sich mehrere Jahre später in
New York an, wo er mit seinem Sohne Isidor das Haus begründete, das heute
zu den bedeutendsten und angesehensten des Landes gehört. In den letzten
Jahren seines Lebens zog er sich vom Geschäft zurück und widmete sich
den liebgewonnenen Studien. Als sein Sohn Oskar, der frühere
amerikanische Gesandte in Konstantinopel, der gegenwärtige Präsident der
'Amerikanisch-jüdisch-historischen Gesellschaft', vor einigen Jahren
Herrn Dr. Kayserling in Budapest veranlasste, zur Ermittelung des Anteils,
welchen die Juden an der Entdeckung Amerikas genommen, eine
Forschungsreise nach Spanien zu unternehmen, war er es, der die Kosten der
Reise bestritt. Lazarus Straus, eines der ältesten Mitglieder der
Beth-el-Gemeinde und vertrauter Freund des Rabbiners David Einhorn,
gehörte zu den wohltätigsten Männern New Yorks; viele Familien
betrauern in ihm ihren Ernährer. Sein Andenken wird stets ein gesegnetes
sein!" |
| |
 Artikel in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 4. März
1898: "New York, 18. Februar. An Altersschwäche - er war 1809 in
Otterberg in der Rheinpfalz geboren - schied am Freitag den 14. vorigen Monats
im Hause seines Sohnes Isidor, Nr. 23 West 56. Straße Herr Lazarus
Straus, einer der bekanntesten Deutschen New York. Artikel in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 4. März
1898: "New York, 18. Februar. An Altersschwäche - er war 1809 in
Otterberg in der Rheinpfalz geboren - schied am Freitag den 14. vorigen Monats
im Hause seines Sohnes Isidor, Nr. 23 West 56. Straße Herr Lazarus
Straus, einer der bekanntesten Deutschen New York.
Der 'New Yorker Herald' widmet ihm folgenden Nachruf: in Herrn Lazarus Straus, der gestern im
Alter von 89 Jahren gestorben ist, hat New York einen seiner geachtetsten
Geschäftsmänner und besten Bürger verloren und die Angehörigen des
Verstorbenen einen Vater, der ein Patriarch im echten Sinn des Wortes war
und zu dem alle Mitglieder seiner großen Familie als zu ihrem Haupte mit Verehrung
hinaufschauten. Wenn je das alte Bibelwort sich bewährt hat,
welches heißt: 'des Vaters Segen baut den Kindern Häuser', so hat es sich hier
bewährt - die drei Söhne des Verstorbenen sind hochgeachtete Bürger und
Geschäftsleute und haben auch schon höhere politische Ehrenstellungen
begleitet - Herr Oskar Straus war Gesandter in der Türkei, Herr Nathan
Straus ist jetzt Präsident der Gesundheitsbehörde von New York und Herr
Isidor Straus war Mitglied des Kongresses. Aber als sie schon in Amt und
Würden waren, sind sie doch ihrem alten Vater gegenüber nie etwas anderes
gewesen als gehorsame Söhne, die seinen Rat einholten uns seine Wünsche
befolgten - und der Segen ihres Vaters ruht auf Ihnen. Zu ihren schönsten
Erinnerungen wird es stets gehören, dass sie sich auch noch als Männer jeden
Freitag Abend, wenn Sie hier waren, im Hause des Vaters versammelten und
dass dann die Mahlzeit nach der Sitte der Väter mit dem orthodoxen
hebräischen Tischgebete eröffnet und geschlossen wurde." |
| |
 Artikel in "Der Israelit" vom 23. Februar 1898: "Amerika. New
York, 18. Februar. An Altersschwäche - er war 1809 in Otterberg in der
Rheinpfalz geboren - schied am Freitag den 14. vorigen Monats im Hause seines
Sohnes Isidor, Nr. 23 West 56. Straße. Herr Lazarus Straus, einer der
bekanntesten Deutschen New Yorks. Artikel in "Der Israelit" vom 23. Februar 1898: "Amerika. New
York, 18. Februar. An Altersschwäche - er war 1809 in Otterberg in der
Rheinpfalz geboren - schied am Freitag den 14. vorigen Monats im Hause seines
Sohnes Isidor, Nr. 23 West 56. Straße. Herr Lazarus Straus, einer der
bekanntesten Deutschen New Yorks.
Der New Yorker Herold mit mit ihm folgenden
Nachruf (unterzeichnet von Rev. Osias Hochglück):
derselbe Text wie oben. |
| |
 Artikel in "Populär-wissenschaftliche Monatsblätter" vom 1. Juni 1898: "An
Altersschwäche - er war 1809 in Otterberg in der Rheinpfalz geboren
- starb in New York Herr Lazarus Strauß, einer der bekanntesten
Deutschen New York. Wenn je das alte Bibelwort sich bewährt hat, welches
heißt: des Vaters Segen bauet den Kindern Häuser, so hat es sich hier
bewährt - die drei Söhne des Verstorbenen sind hochgeachtete Bürger und
Geschäftsleute, und haben auch schon höhere politische Ehrenstellungen
begleitet - Herr Oskar Strauß war Gesandter in der Türkei, Herr Nathan
Strauß ist jetzt Präsident der Gesundheitsbehörde von Groß-New-York und Herr
Isidor Strauß war Mitglied des Kongresses. Aber als sie schon in Amt und
Würden waren, sind sie doch ihrem alten Vater gegenüber nie etwas anderes
gewesen als gehorsame Söhne, die seinen Rat einholten und seine Wünsche
befolgten - und der Segen ihres Vaters ruht auf ihnen." Artikel in "Populär-wissenschaftliche Monatsblätter" vom 1. Juni 1898: "An
Altersschwäche - er war 1809 in Otterberg in der Rheinpfalz geboren
- starb in New York Herr Lazarus Strauß, einer der bekanntesten
Deutschen New York. Wenn je das alte Bibelwort sich bewährt hat, welches
heißt: des Vaters Segen bauet den Kindern Häuser, so hat es sich hier
bewährt - die drei Söhne des Verstorbenen sind hochgeachtete Bürger und
Geschäftsleute, und haben auch schon höhere politische Ehrenstellungen
begleitet - Herr Oskar Strauß war Gesandter in der Türkei, Herr Nathan
Strauß ist jetzt Präsident der Gesundheitsbehörde von Groß-New-York und Herr
Isidor Strauß war Mitglied des Kongresses. Aber als sie schon in Amt und
Würden waren, sind sie doch ihrem alten Vater gegenüber nie etwas anderes
gewesen als gehorsame Söhne, die seinen Rat einholten und seine Wünsche
befolgten - und der Segen ihres Vaters ruht auf ihnen."
|
Über die Tätigkeiten von Nathan Strauß in New York
(1898)
 Artikel
in "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. September 1898:
"Eine große Wohltat ist der Dachgarten auf dem Gebäude der
Educational Alliance wieder täglich Tausende Erholung suchen. Jeden
Freitag und Sonntag finden daselbst Konzerte statt, und Erfrischungen
werden unentgeltlich verabreicht. Herr Nathan Struaß, der bekannte Philanthrop,
hat daselbst eine seiner zahlreichen Milchhallen, in denen sterilisierte
Milch für einen nominellen Preis verkauft wird. Eine andere
Verkaufshalle, welche Herr Strauß auf dem Quai im New Yorker Hafen
errichten wollten, welche Erfolgungszwecken gewidmet ist, wollte die
Häfenbehörde nicht gestattet, weil dadurch dem Pächter des dortigen Hafenrestaurants
Konkurrenz gemacht wurde. " Artikel
in "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. September 1898:
"Eine große Wohltat ist der Dachgarten auf dem Gebäude der
Educational Alliance wieder täglich Tausende Erholung suchen. Jeden
Freitag und Sonntag finden daselbst Konzerte statt, und Erfrischungen
werden unentgeltlich verabreicht. Herr Nathan Struaß, der bekannte Philanthrop,
hat daselbst eine seiner zahlreichen Milchhallen, in denen sterilisierte
Milch für einen nominellen Preis verkauft wird. Eine andere
Verkaufshalle, welche Herr Strauß auf dem Quai im New Yorker Hafen
errichten wollten, welche Erfolgungszwecken gewidmet ist, wollte die
Häfenbehörde nicht gestattet, weil dadurch dem Pächter des dortigen Hafenrestaurants
Konkurrenz gemacht wurde. " |
Nathan Strauß wird Präsident des Sanitätsrates von
New York - Oskar Strauß ist zum Präsidenten der Park-Kommission nominiert
(1898)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Februar 1898:
"New York, im Januar (1898). Nathan Strauß, der
bekannte Philanthrop, ist zum Präsidenten des Sanitätsrates der jetzigen
Viermillionenstadt ernannt worden. Sein Bruder, der frühere amerikanische
Gesandte bei der Pforte, Oskar Strauß, ist zum Präsidenten der
Park-Kommission ausersehen, hat sich aber seine Entscheidung über die
Annahme des ihm zugedachten Amtes noch vorbehalten." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Februar 1898:
"New York, im Januar (1898). Nathan Strauß, der
bekannte Philanthrop, ist zum Präsidenten des Sanitätsrates der jetzigen
Viermillionenstadt ernannt worden. Sein Bruder, der frühere amerikanische
Gesandte bei der Pforte, Oskar Strauß, ist zum Präsidenten der
Park-Kommission ausersehen, hat sich aber seine Entscheidung über die
Annahme des ihm zugedachten Amtes noch vorbehalten." |
Über Oskar S. Straus (geb. 1850 in
Otterberg, Artikel von 1902)
 Artikel in "Ost und West" von 1902 Sp. 321-322:
"Ein jüdischer Diplomat. Von Dr. M. Kayserling (Budapest). Artikel in "Ost und West" von 1902 Sp. 321-322:
"Ein jüdischer Diplomat. Von Dr. M. Kayserling (Budapest).
Vor einigen Wochen ging die Notiz durch die Presse, dass Oskar S. Straus in
New York an die Stelle des verstorbenen früheren Präsidenten Benjamin
Harrison zum Mitglied des internationalen Friedensgerichtshofes im Haag
ernannt wurde. Es ist das der erste Jude, dem diese Auszeichnung zuteil
geworden ist.
Oskar S. Straus, als Diplomat nicht weniger wie als Schriftsteller, als
hingebungsvoller Sohn seines großen, freien Vaterlandes wie als treuer Jude
auch diesseits des Ozeans bekannt, ist seiner Geburt nach ein Deutscher. In
Otterberg, einem Städtchen in der bayerischen Pfalz, erblickte er am
23. Dezember 1850 das Licht der Welt. Er war kaum vier Jahre alt, als sich
sein Vater, Lazarus Straus, ein gebildeter freiheitsliebender Mann,
entschloss, mit seiner Familie nach Amerika auszuwandern; in Talbotton,
Georgia, ließ er sich nieder. In diesem Orte, der nicht mehr als tausend
Einwohner zählte, genoss Oscar den ersten Schulunterricht.
Nach Beendigung des Bürgerkrieges siedelte sich Lazarus Straus in New York
an und fand auch alsbald einen seinen bedeutenden kaufmännischen Fähigkeiten
entsprechenden Wirkungskreis; er eröffnete ein Warenhaus, das er durch
seinen Fleiß und seine Umsicht schnell zur Blüte brachte. Oscar widmete sich
dem Rechtsstudium und wurde an der Universität Columbia 1873 zum Doctor
juris promoviert. Er widmete sich zuerst dem Advokatenstande, trat aber bald
in das Porzellanwarengeschäft seines Vaters, welches unter der renommierten
Firma L. Straus & Sons in New York besteht. Der vielbeschäftigte Kaufmann
fand auch immer Zeit, sich den Wissenschaften zu widmen und eine
politisch-patriotische Tätigkeit zu entfalten.
Ganz ohne sein Dazutun wurde er im Jahre 1887 vom Präsidenten Cleveland zum
Gesandten der Vereinigten Staaten bei der Pforte ernannt; er blieb auf
seinem Posten auf besonderen Wunsche des Präsidenten Harrison bis im August
1890. Sieben Jahre später kehrte er auf Drängen McKinley's wieder als
Gesandter nach Konstantinopel zurück. Mehr als irgendeiner seiner
Gesandtschaftskollegen vermochte er bei dem Sultan durchzusetzen, so dass
derselbe ihn mit großem Bedauern im Dezember 1900 von seinem Posten scheiden
sah. Nach New York zurückgekehrt, nahm er seine ausgebreitete Tätigkeit als
Kaufmann und Fabrikant sowie seine wissenschaftliche Beschäftigung wieder
auf.
Oskar Straus, der Diplomat, der Besitzer einer in New York bekannten,
besonders an Americana reichen Bibliothek, ist auch ein namhafter
Schriftsteller. Im Jahre 1887 erschien sein erstes größeres Werk 'Die
Ursache der republikanischen Regierungsform in den Vereinigten Staaten
Amerikas', das durch die umfassenden Studien, auf denen es beruht, durch
die Neuheit der Gedanken und die Schärfe der Logik allgemeine Aufmerksamkeit
erregte. Von diesem Buche erschien 1890 eine französische Übersetzung mit
einer umfassenden Vorrede des berühmten Nationalökonomen Emil de Laveleye
und vor einigen Jahren eine neue englische Auflage.
Eine noch weit größeren Erfolg als mit diesem Werke erzielte er mit 'Roger
Williams, der Vorkämpfer der Glaubens und Gewissensfreiheit'. Es ist dies
die erste ausführliche und gründliche Biografie jenes Amerikaners, der dem
Grundsatz 'freie Kirche im freien Staate' in der von ihm gegründeten Kolonie
zuerst Geltung verschaffte. Diesem Werke, das eine so günstige Aufnahme
fand, dass die ganze Auflage nach wenigen Monaten vergriffen war, folgte
1896 die Schrift 'Religionsfreiheit in den Vereinigten Staaten'. Er ist
Mitarbeiter verschiedener Journale und Revuen, in 'The Century'
veröffentlichte er eine vortreffliche Monographie über Moritz von Hirsch,
mit dem er von Konstantinopel her innig befreundet war. Ein festes Band
inniger Freundschaft knüpfte ihn und seine Gattin mit der verstorbenen Clara
von Hirsch bis zu deren Hinscheiden.
Oskar S. Strauss wurden mehrfache Auszeichnungen zuteil. Mehrere
Universitäten, wie die von Washington und Pennsylvanien, verliehen ihm das
Diplom eines Doktors der Philosophie. Er ist Präsident der vor zehn Jahren
von ihm ins Leben gerufenen 'Amerikanisch-jüdisch-historischen
Gesellschaft', sowie der Amerikanisch sozial-wissenschaftlichen Vereinigung
und erst vor wenigen Wochen wählte ihn das Schiedsgericht, dass sich in New
York gebildet hat, um Streitigkeiten zwischen Fabrikanten und Arbeitern zu
schlichten, zu seinem Präsidenten. Es gibt überhaupt keine öffentliche
Angelegenheit von nationaler Bedeutung, an der Straus nicht den regsten
Anteil nimmt."
|
Oskar Straus wird zum Minister für Handel und
Industrie berufen (1906)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt - Neue jüdische Presse" vom 2. November
1906: "New York. Ein jüdischer Minister. In das Kabinett ist
zum ersten male ein Jude eingetreten. Präsident Roosevelt hat den
früheren Botschafter am türkischen Hofe Oskar Straus zum Sekretär
(Minister) für Handel und Industrie ernannt. Oskar Straus ist 1850 in Otterberg
(Bayern) geboren, kam als Knabe von 4 Jahren mit seinen Angehörigen nach
Amerika. Er widmete sich nach besuch der Columbia-Lateinschule und der
Columbia-Universität in New York zuerst der juristischen Laufbahn, trat
aber später in das Porzellan- und Glasgeschäft seines Vaters ein. Seine
politische Tätigkeit begann er gelegentlich der Wahl Clevelands zum
Präsidenten im Jahre 1884, und drei Jahre später wurde er Botschafter in
Konstantinopel. Nach dem Tode des Expräsidenten Harrison wurde er 1902
als dessen Nachfolger zum Mitgliede der Friedenskonferenz im Haag (= Den
Haag) ernannt." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt - Neue jüdische Presse" vom 2. November
1906: "New York. Ein jüdischer Minister. In das Kabinett ist
zum ersten male ein Jude eingetreten. Präsident Roosevelt hat den
früheren Botschafter am türkischen Hofe Oskar Straus zum Sekretär
(Minister) für Handel und Industrie ernannt. Oskar Straus ist 1850 in Otterberg
(Bayern) geboren, kam als Knabe von 4 Jahren mit seinen Angehörigen nach
Amerika. Er widmete sich nach besuch der Columbia-Lateinschule und der
Columbia-Universität in New York zuerst der juristischen Laufbahn, trat
aber später in das Porzellan- und Glasgeschäft seines Vaters ein. Seine
politische Tätigkeit begann er gelegentlich der Wahl Clevelands zum
Präsidenten im Jahre 1884, und drei Jahre später wurde er Botschafter in
Konstantinopel. Nach dem Tode des Expräsidenten Harrison wurde er 1902
als dessen Nachfolger zum Mitgliede der Friedenskonferenz im Haag (= Den
Haag) ernannt." |
| |
 Artikel in "Im deutschen Reich" Nr. 12 1906: "Ein jüdischer
Minister.
Artikel in "Im deutschen Reich" Nr. 12 1906: "Ein jüdischer
Minister.
Zum ersten Male ist in Amerika ein Jude ins Kabinett berufen
worden, Oskar Salomon Strauss, der neue Minister für Handel und Gewerbe.
Straus, der 1859 in Otterberg in der Rheinpfalz geboren wurde, kam vier
Jahre später mit seinem Vater nach Amerika, wo dieser bald zu Wohlstand und
Ansehen gelangte. Der Sohn studierte auf der Columbia-Universität die
Rechte, ließ sich in den siebziger Jahren als Advokat nieder und zog bald die
Aufmerksamkeit auf sich. 1880 gab er nach einer schweren Krankheit
den Advokatenberuf auf, trat in das inzwischen von seinem Vater in New York
eröffnete große Porzellan- und Glaswarengeschäft ein und beteiligte sich
dann auch lebhaft am öffentlichen Leben. 1887 wurde er zum Gesandten
bei der Pforte ernannt, kam nach zwei Jahren zurück, um 1897 wieder auf drei
Jahre zu diesem Posten berufen zu werden. Er wurde später zum Mitglied des Haagar
Tribunals ernannt und gilt als ein hervorragender Anhänger der
Weltfriedensidee. Sein warmes Interesse für das Schicksal seiner
Glaubensgenossen hat er in den verschiedensten Stellungen und in der
Verwaltung jüdischer Organisationen vielfach betätigt neuerdings aber auch
dadurch wieder kundgegeben, dass er - obgleich er seinen amerikanischen
Patriotismus gleichzeitig entschieden betont, - sich dennoch sehr für die
Bestrebungen der 'ITO' erwärmte, die darauf gerichtet sind, für die
heimatlos gewordenen russischen Glaubensgenossen gesicherte Asyle zu
schaffen." |
Über Oskar Strauß und die Geschichte der Familie
Strauß (1906)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 9. November
1906: "Oskar Strauß. Über die Familie und die Person des
neuen Ministers der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, lesen wir in den
'Mitteilungen aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus': Die Familie
Strauß stammt aus Bayern, wo seine Vorfahren Landwirte waren und noch
sein Vater ein Gut besaß. Dieser Lazarus Strauß nahm an der Revolution
im Jahre 1848 teil, wurde mit Karl Schurz bekannt und stand zu diesem in
freundschaftlichen Beziehungen bis zu dessen Tode. Lazarus Strauß musste
aus Deutschland flüchten und ging nach Philadelphia. Es wurde ihm aber
geraten, nach dem Süden zu gehen, und im Jahre 1854 eröffnete er in
Talboton im Staates Georgia einen Laden. Er hatte damals drei Söhne:
Isidor, der 9, Nathan, der 6, und Oskar, der noch nicht 4 Jahre alt war.
Die Familie war arm, sodass die Mutter beispielsweise die Kleider für die
Kinder anfertigen und ihre Strümpfe stricken musste. Vater Strauß nahm
entschieden Stellung gegen die Sklaverei und zum Teil aus diesem Grunde
zog er nach dem viel größeren Columbus in demselben Staate. Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 9. November
1906: "Oskar Strauß. Über die Familie und die Person des
neuen Ministers der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, lesen wir in den
'Mitteilungen aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus': Die Familie
Strauß stammt aus Bayern, wo seine Vorfahren Landwirte waren und noch
sein Vater ein Gut besaß. Dieser Lazarus Strauß nahm an der Revolution
im Jahre 1848 teil, wurde mit Karl Schurz bekannt und stand zu diesem in
freundschaftlichen Beziehungen bis zu dessen Tode. Lazarus Strauß musste
aus Deutschland flüchten und ging nach Philadelphia. Es wurde ihm aber
geraten, nach dem Süden zu gehen, und im Jahre 1854 eröffnete er in
Talboton im Staates Georgia einen Laden. Er hatte damals drei Söhne:
Isidor, der 9, Nathan, der 6, und Oskar, der noch nicht 4 Jahre alt war.
Die Familie war arm, sodass die Mutter beispielsweise die Kleider für die
Kinder anfertigen und ihre Strümpfe stricken musste. Vater Strauß nahm
entschieden Stellung gegen die Sklaverei und zum Teil aus diesem Grunde
zog er nach dem viel größeren Columbus in demselben Staate.
Infolge der kriegerischen Ereignisse kam Lazarus Strauß in
Geldverlegenheit. Obwohl ihm ein Chef der Firma, der er 3.000 Dollar
schuldete, riet, sich nicht aller Mittel zu entblößen und mit 10 % zu
akkordieren, wie es die anderen Kaufleute im Süden täten, erklärte
Lazarus Strauß: Ich will meine ganze schuld bezahlen. Ich erwarte nicht,
meinen Kindern viel Vermögen zu hinterlassen, aber ich will ihnen einen
ehrlichen Namen vererben. Mit dem geringen Reste seines Barvermögens
begründete Strauß ein Porzellangeschäft.
Alle drei Söhne dieses Mannes haben es zu Einfluss und Ansehen gebracht. Nathan
Strauß, der die armen Kinder New Yorks mit sterilisierter Milch, ihre
Eltern mit Kohlen im Winter und die Obdachlosen mit Asylen versorgt hat,
war beispielsweise als Kandidat für den New Yorker Bürgermeisterposten
aufgestellt. Isidor Strauß wurde Kongressmitglied und war
beteiligt an der Herstellung des Wilsontarifs. Der bedeutendste aber ist Oskar
Strauß, der Kaufmann, Verfasser mehrerer staatwissenschaftlicher
Werke, Mitglied der permanenten Haager Schiedsgerichtshofes ist und
zweimal amerikanischer Gesandter in Konstantinopel war.
Was waren nun die hauptsächlichsten Taten des jüdischen Gesandten in
Konstantinopel? Damals war christlichen Kolporteuren verboten worden,
Bibeln und Traktätchen in der Türkei zu verteilen. Es schien unmöglich,
da Abhilfe zu schaffen. Aber Strauß, der jüdische Gesandte, fand doch
ein Mittel, dem christlichen Missionswesen zu helfen. Er stellte nämlich
auf der Pforte vor, dass die Kolporteure auch Bibeln verkauften, und dass
eine Verhinderung dieses Geschäfts eine Verletzung des Handelsvertrages
bedeute. So setzte er durch, dass die christlichen Schriften wieder
verteilt werden durften und dass auch 50 gewaltsam geschlossene
christliche Schulen wieder geöffnet wurden. Präsident Cleveland dankte
dem Gesandten für diesen Erfolg und auch der Evangelische Bund in England
ließ ihm durch Vermittlung Lord Salisbury's eine Anerkennung zukommen.
Das zweite Mal gelang es Strauß, mit dem Sultan in einem ernsteren
Konflikt fertig zu werden. Armenische Christen waren massakriert und für
90.000 Dollar Missionsbesitz vernichtet worden. Strauß erklärte dem
Sultan, der Konflikt könne durch einen Krieg oder durch friedliche Mittel
schnell erledigt werden. Er schlug ein Schiedsgericht vor, bemerkte
jedoch, dass dieses dann auch eine Untersuchung wegen der Metzeleien
veranstalten würde. Strauß wusste wohl, dass der Sultan eine solche
Untersuchung nie zulassen würde. In der Tat entschloss sich der Sultan
schnell, die amerikanischen Ansprüche zu befriedigen." |
Oscar Strauß engagierte sich für die verfolgten
russischen Juden (1911)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 24. November
1911: "New York. Die Protestbewegung gegen die Zurücksetzung
amerikanischer jüdischer Reisenden in Russland nimmt ständig an
Ausdehnung zu. Großes Aufsehen macht eine Versammlung von vierhundert
Geistlichen, Vertreter der verschiedenen christlichen Sekten, die als
Protestversammlung gegen diese Zurücksetzung hier stattfand. Den Vorsitz
führte der 80jährige Bischof James Courtny. Er brach in seiner Rede in
Tränen aus über das bittere Unrecht, das den Juden zugefügt wird.
Nachdem die Versammlung einstimmig eine Protestresolution angenommen
hatte, ergriff der zu diesem Zwecke eingeladene frühere Botschafter Oscar
Strauß das Wort zu einer Rede über die Lage der Juden in Russland. Die
Rede machte tiefen Eindruck und veranlasste eine Resolution, die dem
russischen Botschafter zu Übermittlung an seine Regierung überreicht
werden soll." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 24. November
1911: "New York. Die Protestbewegung gegen die Zurücksetzung
amerikanischer jüdischer Reisenden in Russland nimmt ständig an
Ausdehnung zu. Großes Aufsehen macht eine Versammlung von vierhundert
Geistlichen, Vertreter der verschiedenen christlichen Sekten, die als
Protestversammlung gegen diese Zurücksetzung hier stattfand. Den Vorsitz
führte der 80jährige Bischof James Courtny. Er brach in seiner Rede in
Tränen aus über das bittere Unrecht, das den Juden zugefügt wird.
Nachdem die Versammlung einstimmig eine Protestresolution angenommen
hatte, ergriff der zu diesem Zwecke eingeladene frühere Botschafter Oscar
Strauß das Wort zu einer Rede über die Lage der Juden in Russland. Die
Rede machte tiefen Eindruck und veranlasste eine Resolution, die dem
russischen Botschafter zu Übermittlung an seine Regierung überreicht
werden soll." |
Stiftung eines
Milchpasteurisierungsinstitutes in Heidelberg durch Nathan Strauß (1907)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. November 1907:
"Heidelberg. Durch die Großherzigkeit des New Yorker Millionärs
Nathan Strauß ist hier ein Milchpasteurisierungsinstitut errichtet
worden". Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. November 1907:
"Heidelberg. Durch die Großherzigkeit des New Yorker Millionärs
Nathan Strauß ist hier ein Milchpasteurisierungsinstitut errichtet
worden". |
| |
 Links
"Straussische Milchküche" in Sandhausen
bei Heidelberg; Kinder holen pasteurisierte Milch ab (Quelle:
Gemeindearchiv Sandhausen). In Sandhausen wurde die Ausgabestelle einer
solchen Milchküche installiert, weil es im Ort die höchste
Sterblichkeitsrate bei Kleinkindern im Herzogtum gab. Links
"Straussische Milchküche" in Sandhausen
bei Heidelberg; Kinder holen pasteurisierte Milch ab (Quelle:
Gemeindearchiv Sandhausen). In Sandhausen wurde die Ausgabestelle einer
solchen Milchküche installiert, weil es im Ort die höchste
Sterblichkeitsrate bei Kleinkindern im Herzogtum gab.
|
Stiftung eines
Milchpasteurisierungsinstitutes in Karlsruhe (1907)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Dezember 1907:
"Karlsruhe, 19. Dezember (1907). Die Großherzogin-Mutter empfing am
Dienstag Abend im Schlosse zu Karlsruhe den bekannten New Yorker
Millionär Nathan Strauß, der auf ihren Wunsch von Heidelberg, wo er
gegenwärtig vorübergehend seinen Wohnsitz hat, dorthin gekommen war, um
ihr über seine amerikanischen Schöpfungen zu berichten. Die
Großherzogin-Mutter zeigte großes Interesse für die segensreichen
Bestrebungen des Amerikaners, und Straus, der zu den Freunden Morgans und
Rockefellers zählt, erklärte sich bereit, in der Stadt Karlsruhe auf
eigene Kosten ein Pasteurisierungs-Institut zu errichten, wie er es in New
York und anderen amerikanischen Städten, zuletzt in kleinerem Stil in
Heidelberg, geschaffen hat." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Dezember 1907:
"Karlsruhe, 19. Dezember (1907). Die Großherzogin-Mutter empfing am
Dienstag Abend im Schlosse zu Karlsruhe den bekannten New Yorker
Millionär Nathan Strauß, der auf ihren Wunsch von Heidelberg, wo er
gegenwärtig vorübergehend seinen Wohnsitz hat, dorthin gekommen war, um
ihr über seine amerikanischen Schöpfungen zu berichten. Die
Großherzogin-Mutter zeigte großes Interesse für die segensreichen
Bestrebungen des Amerikaners, und Straus, der zu den Freunden Morgans und
Rockefellers zählt, erklärte sich bereit, in der Stadt Karlsruhe auf
eigene Kosten ein Pasteurisierungs-Institut zu errichten, wie er es in New
York und anderen amerikanischen Städten, zuletzt in kleinerem Stil in
Heidelberg, geschaffen hat." |
Nathan Straus ist nach 13monatiger Tätigkeit im Ausland wieder in New York
zurück (1908)
 Artikel
im Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 11. September 1908:
"New York. Nach 13monatlicher Abwesenheit ist der Philanthrop Nathan
Straus hier wieder eingetroffen. Er hat während dieser 13 Monate in
Deutschland, Österreich und England Stationen für pasteurisierte Milch
errichtet und seitens der Behörden und Fachmänner für sein
segensreiches Wirken uneingeschränkte Anerkennung
gefunden." Artikel
im Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 11. September 1908:
"New York. Nach 13monatlicher Abwesenheit ist der Philanthrop Nathan
Straus hier wieder eingetroffen. Er hat während dieser 13 Monate in
Deutschland, Österreich und England Stationen für pasteurisierte Milch
errichtet und seitens der Behörden und Fachmänner für sein
segensreiches Wirken uneingeschränkte Anerkennung
gefunden." |
Brief von Nathan Strauss an die Jahresversammlung der
amerikanischen Zionisten (1912 nach der 'Titanic'-Kastrophe und dem Tod seines
Bruders Isidor)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2. August
1912: "New York. Der bekannte Philanthrop Nathan Straus,
Bruder des früheren Botschafters und Staatssekretärs Oskar Straus
und des bei der 'Titanic'-Katastrophe verunglückten Isidor Straus,
richtete an die Jahresversammlung der amerikanischen Zionisten einen
Brief. In diesem Briefe heißt es: Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2. August
1912: "New York. Der bekannte Philanthrop Nathan Straus,
Bruder des früheren Botschafters und Staatssekretärs Oskar Straus
und des bei der 'Titanic'-Katastrophe verunglückten Isidor Straus,
richtete an die Jahresversammlung der amerikanischen Zionisten einen
Brief. In diesem Briefe heißt es:
'Bei meinem jüngsten Besuch in Palästina machte der gewaltige
Fortschritt im Vergleich zu den Zuständen bei meiner früheren
Palästinareise vor sieben Jahren einen überaus tiefen Eindruck auf mich.
Überall treten die Wirkungen von Dr. Herzls Geist und den großen
Idealen, die er in Jung-Israel wachgerufen hat, deutlich zutage.
Gleichwohl bleibt noch manches zu tun übrig. Dr. Magnes, der Ihrer
Versammlung beiwohnt, wird Ihnen über unsere Bemühungen zur Besserung
der Lage berichten... In den letzten drei Monaten war mein ganzes Sein
vom Gedanken des Zionismus beherrscht, und ich habe eine Fülle von
Plänen für das Wohl des Heiligen Landes erwogen. Infolge unseres
jüngsten Missgeschicks (der Titanic-Katastrophe) waren jedoch meine
Nerven derart angegriffen, dass ich unfähig war, sogleich, wie es mein
sehnlichster Wunsch gewesen wäre, ans Werk zu gehen. Aus diesem Grunde
fühle ich mich auch außerstande, in öffentlicher Versammlung zu
sprechen.'" |
Nathan Straus veranlasst eine
Perlmutter-Arbeiten-Fabrik in Jerusalem (1912)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 16. August
1912: "Jerusalem. Es sind wieder mehrere neue gewerbliche
Unternehmungen von hier zu melden. Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 16. August
1912: "Jerusalem. Es sind wieder mehrere neue gewerbliche
Unternehmungen von hier zu melden.
Der bekannte New Yorker Philanthrop Nathan Straus, der unser Land
vor einiger Zeit besuchte, hat die Errichtung einer Fabrik von
Perlmutter-Arbeiten veranlasst. Bisher wurden diese Arbeiten nur von
Christen in Bethlehem gemacht.
Ein Antwerpener Zionist errichtet hier eine Diamantenschleiferei und wird
damit einigen Dutzend Juden Arbeit
geben." |
Spende von Oskar Salomon Straus (1916)
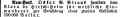 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 28.
Juli 1916: "New York. Oskar S. Straus spendete dem Clara de
Hirsch-Heim für weibliche Einwanderer zur Errichtung eines zweiten
Gebäudes 150.000 Dollar." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 28.
Juli 1916: "New York. Oskar S. Straus spendete dem Clara de
Hirsch-Heim für weibliche Einwanderer zur Errichtung eines zweiten
Gebäudes 150.000 Dollar." |
Hohe Spende von Nathan Strauß für
die Einrichtung des jüdischen Kriegsunterstützungsfonds (1919)
Anmerkung: der Kriegsunterstützungsfonds kam notleidenden Kriegsteilnehmern
oder deren Hinterbliebenen zugute.
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 14. März 1919: "'Jewish Chronicle' meldet: 'Aus den letzten
Berichten geht deutlich hervor, dass die in New York für den jüdischen
Kriegsunterstützungsfonds ausgeschriebene Spende von 5 Millionen Dollar
überzeichnet werden wird. Den größten Einzelbeitrag steuerte Mr.
Nathan Strauß in Höhe von 200.000 Dollar bei. Mr.
Jacob H. Schiff und Mr.
Felix M. Warburg (statt Warburger) gaben je 100.000 Dollar.
Viele der ganz bedeutenden Beträge kamen von nichtjüdischen Häusern und
Persönlichkeiten."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 14. März 1919: "'Jewish Chronicle' meldet: 'Aus den letzten
Berichten geht deutlich hervor, dass die in New York für den jüdischen
Kriegsunterstützungsfonds ausgeschriebene Spende von 5 Millionen Dollar
überzeichnet werden wird. Den größten Einzelbeitrag steuerte Mr.
Nathan Strauß in Höhe von 200.000 Dollar bei. Mr.
Jacob H. Schiff und Mr.
Felix M. Warburg (statt Warburger) gaben je 100.000 Dollar.
Viele der ganz bedeutenden Beträge kamen von nichtjüdischen Häusern und
Persönlichkeiten." |
Weitere Spenden
für das Institut in Karlsruhe (1922)
 Artikel in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 12.1.1922: "Karlsruhe, 4. Dezember
(1922): Der wegen seiner hochherzigen Spenden mehrfach genannte
Philanthrop Nathan Straus in New York hat von Prof. Lust, dem Leiter des
Kinderkrankenhauses in Karlsruhe, die Nachricht erhalten, dass die von
Herrn Straus im Jahre 1907 in Karlsruhe errichtete Milchküche wegen
Mangels an Mitteln geschlossen werden müsse. Herr Straus hat nun an W.T.B.
200.000 Mark überwiesen, die zur Hälfte für Karlsruhe, zur anderen
Hälfte für die ebenfalls von ihm eingerichtete Milchküche der Frau
Gothein-Roemers in Eberswalde bestimmt sind." Artikel in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 12.1.1922: "Karlsruhe, 4. Dezember
(1922): Der wegen seiner hochherzigen Spenden mehrfach genannte
Philanthrop Nathan Straus in New York hat von Prof. Lust, dem Leiter des
Kinderkrankenhauses in Karlsruhe, die Nachricht erhalten, dass die von
Herrn Straus im Jahre 1907 in Karlsruhe errichtete Milchküche wegen
Mangels an Mitteln geschlossen werden müsse. Herr Straus hat nun an W.T.B.
200.000 Mark überwiesen, die zur Hälfte für Karlsruhe, zur anderen
Hälfte für die ebenfalls von ihm eingerichtete Milchküche der Frau
Gothein-Roemers in Eberswalde bestimmt sind." |
74. Geburtstag von Nathan Straus (1922)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. März 1922: "Aus
New York meldet die 'J.P.Z': Am 30. Januar feierte der bekannte jüdische
Philanthrop Nathan Straus seinen 74. Geburtstag. In einer von ihm
herausgegebenen Erklärung bedauert Straus, lange nicht so reich zu sein,
wie man von ihm behauptet; er würde sich sonst schämen, nicht noch mehr
Wohltätigkeit zu üben, als er es tue. Er gebe weit über seine Kräfte
und würde sich schämen, für sich denselben Maßstab zu beanspruchen wie
zu zahlreiche andere reiche Juden." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. März 1922: "Aus
New York meldet die 'J.P.Z': Am 30. Januar feierte der bekannte jüdische
Philanthrop Nathan Straus seinen 74. Geburtstag. In einer von ihm
herausgegebenen Erklärung bedauert Straus, lange nicht so reich zu sein,
wie man von ihm behauptet; er würde sich sonst schämen, nicht noch mehr
Wohltätigkeit zu üben, als er es tue. Er gebe weit über seine Kräfte
und würde sich schämen, für sich denselben Maßstab zu beanspruchen wie
zu zahlreiche andere reiche Juden." |
| |
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Februar
1922: "Nathan Straus feierte seinen 74. Geburtstag. In einem Brief
bedauert Straus, lange nicht so reich zu sein, wie man von ihm behauptet;
er würde sich sonst schämen, nicht noch mehr Wohltätigkeit zu üben,
als er es tue." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Februar
1922: "Nathan Straus feierte seinen 74. Geburtstag. In einem Brief
bedauert Straus, lange nicht so reich zu sein, wie man von ihm behauptet;
er würde sich sonst schämen, nicht noch mehr Wohltätigkeit zu üben,
als er es tue." |
80. Geburtstag von Nathan Strauß
(Januar 1928)
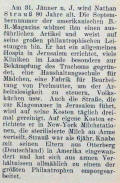 Artikel in "Bnai Berith" vom Oktober 1927 S. 285: "Am 31.
Januar nächsten Jahres wird Nathan Strauß 80 Jahre alt. Die Septembernummer der amerikanischen
Benei-Brith-Magazins widmet ihm einen
ausführlichen Artikel und weist auf seine großen philanthropischen
Leistungen hin. Er hat ein allgemeines Hospiz in Jerusalem errichtet, viele
Kliniken im Lande besonders zur Bekämpfung des Trachoms gegründet, eine Haushaltungsschule für Mädchen, eine Fabrik für Bearbeitung von Perlmutter,
um der Arbeitslosigkeit zu steuern, Volksküchen usw. Auch die
Straße, die zur Klagemauer in Jerusalem führt, wird auf seine Kosten täglich
dreimal gereinigt. Auf eigene Kosten errichtete er in New York
Milchstationen, die sterilisierte Milch an Arme verteilt. Strauß war als
sechsjähriger Knabe mit seinen Eltern aus Otterberg (Deutschland) in Amerika
eingewandert und hat sich aus armen Verhältnissen allmählich zu einem der
größten Philanthropen emporgearbeitet." Artikel in "Bnai Berith" vom Oktober 1927 S. 285: "Am 31.
Januar nächsten Jahres wird Nathan Strauß 80 Jahre alt. Die Septembernummer der amerikanischen
Benei-Brith-Magazins widmet ihm einen
ausführlichen Artikel und weist auf seine großen philanthropischen
Leistungen hin. Er hat ein allgemeines Hospiz in Jerusalem errichtet, viele
Kliniken im Lande besonders zur Bekämpfung des Trachoms gegründet, eine Haushaltungsschule für Mädchen, eine Fabrik für Bearbeitung von Perlmutter,
um der Arbeitslosigkeit zu steuern, Volksküchen usw. Auch die
Straße, die zur Klagemauer in Jerusalem führt, wird auf seine Kosten täglich
dreimal gereinigt. Auf eigene Kosten errichtete er in New York
Milchstationen, die sterilisierte Milch an Arme verteilt. Strauß war als
sechsjähriger Knabe mit seinen Eltern aus Otterberg (Deutschland) in Amerika
eingewandert und hat sich aus armen Verhältnissen allmählich zu einem der
größten Philanthropen emporgearbeitet."
|
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Februar 1928: "Anlässlich seiner
achtzigsten Geburtstages, über den wir bereits berichteten, machte Nathan
Straus weitgehende Stiftungen für alle jüdischen Wohltätigkeitszwecke, auch
für den Aufbau in Palästina." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Februar 1928: "Anlässlich seiner
achtzigsten Geburtstages, über den wir bereits berichteten, machte Nathan
Straus weitgehende Stiftungen für alle jüdischen Wohltätigkeitszwecke, auch
für den Aufbau in Palästina." |
Zum Tod von Nathan Straus
(1931)
 Artikel
in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 14. Januar 1931:
"Nathan Straus. Im hohen Alter von 83 Jahren verstarb am
Montag, dem 11. Januar, in New York Herr Nathan Straus, der große
jüdische Philanthrop und Menschenfreund. In der amerikanischen Judenheit
ist die Trauer um Nathan Straus, auf den sie stolz war, groß. Nicht nur
in Amerika, sondern in der ganzen Welt hatte der Verstorbene, dessen
menschenfreundlichem Wirken die Abwendung von viel Unglück zu verdanken
ist, und dessen Kinderschutzanstalten und Anstalten für
Milch-Pasteurisierung, die er in zahlreichen Ländern gegründet hat,
Tausenden von Kindern das Leben gerettet haben, einen großen
Namen. Artikel
in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 14. Januar 1931:
"Nathan Straus. Im hohen Alter von 83 Jahren verstarb am
Montag, dem 11. Januar, in New York Herr Nathan Straus, der große
jüdische Philanthrop und Menschenfreund. In der amerikanischen Judenheit
ist die Trauer um Nathan Straus, auf den sie stolz war, groß. Nicht nur
in Amerika, sondern in der ganzen Welt hatte der Verstorbene, dessen
menschenfreundlichem Wirken die Abwendung von viel Unglück zu verdanken
ist, und dessen Kinderschutzanstalten und Anstalten für
Milch-Pasteurisierung, die er in zahlreichen Ländern gegründet hat,
Tausenden von Kindern das Leben gerettet haben, einen großen
Namen.
Nathan Straus wurde im Jahre 1848 in Otterberg (Rheinpfalz)
geboren, 1854 wanderten seine Eltern mit ihm aus Deutschland nach den
Vereinigten Staaten aus. Im Jahre 1872 trat er in die Import-Firma seines
Vaters L. Straus & Sons ein und wurde dann Teilhaber des New Yorker
Warenhauses R. H. Macy & Co. sowie des Brooklyner Warenhauses Abraham
& Straus. In der demokratischen Partei New Yorks spielte er von je
eine führende Rolle. 1898 wurde er Präsident des New Yorker 'Board of
Health'. Von dieser Zeit an begann seine weltumfassende gesundheitliche
und philanthropische Tätigkeit. Er schuf insbesondere nicht nur in den
Vereinigten Staaten, die er 1911 bei dem Berliner Internationalen Kongress
zum Schutze der Kinder und 1912 beim Tuberkulose-Kongress in Rom offiziell
vertreten hat, sondern auch in zahlreichen europäischen Ländern Stationen
zur Verteilung von pasteurisierter Milch.
Noch vor dem Weltkriege schloss sich Nathan Straus der zionistischen
Bewegung an. Im Jahre 1912 gründete er in Jerusalem Suppenküchen sowie
ein Health-Büro, das mit dem jüdischen Pasteur-Institut und dem
deutschen Malaria-Institut zu einem Institut in Jerusalem vereinigt wurde.
Während des Krieges, im Jahre 1915, entsandte er ein Lebensmittelschiff
nach Palästina und brachte dadurch der hungernden jüdischen Bevölkerung
dieses Landes Hilfe. Er spendete alljährlich größere Summen für
jüdische, zionistische, und allgemeine philanthropische Zwecke. Mehrere
Male wurde er zum Ehrenpräsidenten der Zionistischen Organisation
Amerikas gewählt. In den Jahren 1920 bis 1922 war er Präsident des
American Jewish Congress.
Vor einigen Jahren gründete er in Jerusalem das große
'Gesundheits-Zentrum', welches Abzweigungen in mehreren Orten Palästinas
hat. Zur Erhaltung dieser Institution, die Angehörigen aller Konfessionen
offen steht, spendete er eine große Geldsumme. 1929 ließ er für das
Institut ein großes Gebäude in Jerusalem aufführen. Das
Gesundheitszentrum trägt seinen und seiner Gattin, Lina Gutherz-Straus,
Namen. Lina Gutherz-Straus verstarb im Jahre 1930. Sie stand ihrem Manne
in allen seinen philanthropischen Werken zur Seite, war in der amerikanischen
Organisation jüdischer Frauen und Mädchen 'Hadassah' anführender Stelle
tätig und hat die Institution er Hadassah ungemein
gefördert.
Nathan Straus war Ehrenbürger der Stadt New York.
Die gesamte amerikanische Presse würdig an leitender Stelle die
Persönlichkeit und das weltumfassende humanitäre Wirken des
Verstorbenen. Die bedeutendsten Vertreter der jüdischen und christlichen
Öffentlichkeit Amerikas, Mitglieder der Regierung und Führer fast aller
großen Organisationen haben den Hinterbliebenen ihr Beileid zum Ausdruck
gebracht.
Das Kondolenzschreiben des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Herbert
Hoover, lautet u.a.: Durch den Tod von Nathan Straus ist unserem
nationalen Leben eine verehrungswürdige Gestalt entrissen worden, deren
Verlust schmerzlich empfunden wird; ein Führer der Judenheit, dessen
Vision von hilfsbereitet Menschenfreundlichkeit über alle nationalen und
konfessionellen Grenzen hinausging; ein Philanthrop, dessen Wohltaten, insbesondere
die für die Kinder, bis in die ferne Zukunft weiter wirken
werden." |
Fotos
zur Geschichte der Familie Straus
(Quelle: die mit *) bezeichneten Fotos: Straus
Historical Society)
 |
 |
 |
Die Brüder Nathan, Oscar und
Isidor Straus 1909 * |
Oscar Salomon Straus
(vor
1900) * |
Oscar Salomon Straus
um 1920 * |
| |
|
|
 |
 |
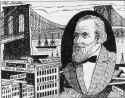 |
Das Haus der Familie Straus in
Otterberg
(historische Aufnahme, vgl. Fotos unten) * |
Nathan Strauss
(Foto vor 1912) |
Nathan Strauss,
Zeichnung, Quelle |
| |
|
|
 |
 |
|
Der amerikanische
Präsident Franklin
D. Roosevelt zusammen mit Nathan Straus
(aus der Sammlung von Wilfried Hager, Sandhausen) |
Jerusalem: Straßenschild:
Nathan Straus
Street (Foto erhalten von Michael Hornung,
Aufnahme vom Juni
2008) |
|
| |
|
|
Weitere Fotos zum
Haus der Familie Straus
aus dem Gemeindearchiv Otterberg |
|
|
 |
 |

|
| Das Haus der Familie
Straus um 1890 |
Das Haus der Familie
Straus um 1900 |
Das Haus der Familie
Straus um 1960 |
| |
|
|
| |
 |
|
Seit September 2006 an der Stadthalle in Otterberg: Denkmal für Oskar
Salomon Straus
 Artikel
aus dem Stadt- und Landkurier vom 21. September 2006: "Denkmal
für Oskar Salomon Straus: Otterberg. In einer Feierstunde zu Ehren
des in Otterberg geborenen Oskar Salomon Straus, der u.a. als Minister in
der Regierung Theodore Roosevelt war, wurde am Freitag, den 16. September
in Anwesenheit der über 20 angereisten Nachkommen aus Amerika ein Denkmal
an der Stadthalle enthüllt. Grußworte richtete Landrat Rolf Künne und
Bürgermeister Ulrich Wasser sowie Roland Paul an die Straus Nachkommen
und an die Mitglieder des Stadtrates sowie an die Bürger von Otterberg.
Oskar Salomon Straus war einer der bekanntesten Söhne Otterbergs. 1850 in
der Wallonenstadt geboren, wanderte bereits im Alter von vier Jahren mit
seiner Familie nach Amerika aus und macht später eine glänzende
Karriere. Dr. Hans Steinebrei erklärte in seiner Ansprache, wie es zu
dieser Verbindung kam. 'Als Heimatforscher setzte ich mich mit der
deutschen Botschaft in Washington in Verbindung, welche mir entsprechende
Informationen lieferte. Bei einer USA-Reise konnte ich sehr viel über
Oskar Salomon Straus finden. 1977 besuchte Robert K. Straus, der
Historiker der Straus Familie Otterberg. Seit dieser Zeit besteht eine
stetige Korrespondenz mit ihm und der gebildeten Straus
Historical Society und der Sekretärin Mrs. Joan Adler. Roland Paul
vom Bezirksverband der Pfalz und ich besuchten Bürgermeister Ulrich
Wasser und unterbreiteten ihm den Vorschlag für ein Denkmal. Wasser war
sehr aufgeschlossen und auch der Stadtrat. Der Bürgermeister wählte
diesen Platz für den Steinfindling neben der Stadthalle. Ich bedanke mich
bei Bürgermeister Wasser und dem Stadtrat, dass dieser Platz mit dem
Denkmal geschaffen werden konnte.' Der Gedenkstein neben der Stadthalle
hat folgenden Text: Oskar Salomon Straus, geb. 1850 in Otterberg,
gestorben 1926 in New York, ausgewandert mit seiner Familie nach USA.
Jura-Studium von 1887-1889 und 1898-1899. Gesandter in der Türkei.
1906-1909 Minister für Handel und Arbeit, erstes jüdisches Mitglied in
einem US-Kabinett. Minister internationaler Organisatoren von
Präsidenten, Autor und Großkaufmann. Seine Brüder Isidor und Nathan erwarben
sich als Kaufleute ('Macy') und Wohltäter ebenfalls bleibende Verdienste.
Oskar Salomon Straus III., Urenkel der Auswanderers und Vorstandsmitglied
der 'Straus Historical
Society' dankte der Stadt Otterberg für die Ehrung der Familie. Er
habe die Verbindung zur Heimat seines Urgroßvaters nie verloren. 'Wir
sind zwar Tausende Meilen entfernt, doch mit unseren Gedanken immer hier.
Wir sind heute zu den Wurzeln unserer Familie zurückgekehrt." Artikel
aus dem Stadt- und Landkurier vom 21. September 2006: "Denkmal
für Oskar Salomon Straus: Otterberg. In einer Feierstunde zu Ehren
des in Otterberg geborenen Oskar Salomon Straus, der u.a. als Minister in
der Regierung Theodore Roosevelt war, wurde am Freitag, den 16. September
in Anwesenheit der über 20 angereisten Nachkommen aus Amerika ein Denkmal
an der Stadthalle enthüllt. Grußworte richtete Landrat Rolf Künne und
Bürgermeister Ulrich Wasser sowie Roland Paul an die Straus Nachkommen
und an die Mitglieder des Stadtrates sowie an die Bürger von Otterberg.
Oskar Salomon Straus war einer der bekanntesten Söhne Otterbergs. 1850 in
der Wallonenstadt geboren, wanderte bereits im Alter von vier Jahren mit
seiner Familie nach Amerika aus und macht später eine glänzende
Karriere. Dr. Hans Steinebrei erklärte in seiner Ansprache, wie es zu
dieser Verbindung kam. 'Als Heimatforscher setzte ich mich mit der
deutschen Botschaft in Washington in Verbindung, welche mir entsprechende
Informationen lieferte. Bei einer USA-Reise konnte ich sehr viel über
Oskar Salomon Straus finden. 1977 besuchte Robert K. Straus, der
Historiker der Straus Familie Otterberg. Seit dieser Zeit besteht eine
stetige Korrespondenz mit ihm und der gebildeten Straus
Historical Society und der Sekretärin Mrs. Joan Adler. Roland Paul
vom Bezirksverband der Pfalz und ich besuchten Bürgermeister Ulrich
Wasser und unterbreiteten ihm den Vorschlag für ein Denkmal. Wasser war
sehr aufgeschlossen und auch der Stadtrat. Der Bürgermeister wählte
diesen Platz für den Steinfindling neben der Stadthalle. Ich bedanke mich
bei Bürgermeister Wasser und dem Stadtrat, dass dieser Platz mit dem
Denkmal geschaffen werden konnte.' Der Gedenkstein neben der Stadthalle
hat folgenden Text: Oskar Salomon Straus, geb. 1850 in Otterberg,
gestorben 1926 in New York, ausgewandert mit seiner Familie nach USA.
Jura-Studium von 1887-1889 und 1898-1899. Gesandter in der Türkei.
1906-1909 Minister für Handel und Arbeit, erstes jüdisches Mitglied in
einem US-Kabinett. Minister internationaler Organisatoren von
Präsidenten, Autor und Großkaufmann. Seine Brüder Isidor und Nathan erwarben
sich als Kaufleute ('Macy') und Wohltäter ebenfalls bleibende Verdienste.
Oskar Salomon Straus III., Urenkel der Auswanderers und Vorstandsmitglied
der 'Straus Historical
Society' dankte der Stadt Otterberg für die Ehrung der Familie. Er
habe die Verbindung zur Heimat seines Urgroßvaters nie verloren. 'Wir
sind zwar Tausende Meilen entfernt, doch mit unseren Gedanken immer hier.
Wir sind heute zu den Wurzeln unserer Familie zurückgekehrt."
Untertexte zu den Fotos auf dem Presseartikel: oberes Foto:
"Denkmal Straus nach Enthüllung v.l.n.r. Dr. Hans Steinebrei,
Bürgermeister Ulrich Wasser, Oskar Salomon Straus III. und Landrat Rolf
Künne."
unteres Foto: "Familienmitglieder der Fam. Straus vor dem
Gedenkstein". |
Berichte zu
weiteren Personen aus der jüdischen Gemeinde
Zum Tod von Joseph Deutsch (geb. 1828 in Otterberg, gest. 1907
in Mainz)
Anmerkung: Joseph Deutsch ist am 22. Juni 1828 in Otterberg geboren als Sohn
von Samuel Deutsch und seiner Frau Friederika Judith. Er war verheiratet mit
Fanny geb. Gros aus Bruchsal. Er starb am 16. März 1907 in Mainz. Genealogische
Informationen und Fotos des Grabsteines:
https://www.geni.com/people/Joseph-Deutsch/6000000051483896249
 Mitteilung in "Bericht der Großloge" vom 1907 Nr. 04 S. 51: "Aus
dem Gedächtnisbuch der Grossloge. Mitteilung in "Bericht der Großloge" vom 1907 Nr. 04 S. 51: "Aus
dem Gedächtnisbuch der Grossloge.
Seit unseren letzten Angaben hatten wir den Tod folgender Brüder zu
beklagen.
Es starben: ...
32. Am 16. März 1907 Bruder Josef Deutsch, Mitbegründer der Rhenusloge in
Mainz 24. Februar 1889 geboren den 22. Juni 1828 in Otterberg. "
|
| Sonstiges: Kennkarte
aus der NS-Zeit |
| |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |
| |
Kennkarten
des in Otterberg
geborenen Jakob Deutsch |

|
|
| |
Kennkarte (Mainz 1939)
für Jakob Deutsch (geb. 3. April 1863 in Otterberg), Kaufmann |
|
Zur Geschichte der Synagoge
1817 wird erstmals ein Betsaal genannt, über den jedoch nichts Weiteres
bekannt ist. Nachdem die Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder in den
1820er-Jahren stark zunahm, plante man den Bau einer neuen Synagoge. 1831
wurde von jüdischen Gemeindemitgliedern ein Haus in der Hintergasse (heute
Kirchstraße) gekauft, um dieses zu einer Synagoge mit Lehrerwohnung umzubauen. 1838
konnte die Synagoge eingeweiht werden. Einer der besonderen Höhepunkt in
der Geschichte der jüdischen Gemeinde war der Besuch des bayrischen Königs
(Ludwig I.) 1843 in der Otterberger Synagoge. Dazu berichtete die
"Allgemeine Zeitung des Judentums" am 3. Juli 1843:
 Otterberg (Pfalz),
18. Juni (1843). Bei der Anwesenheit Seiner Majestät des Königs von Bayern am
13. Juni (1843) allhier, begab sich dieser Monarch nach beendigtem Gottesdienste
in der katholischen Kirche in unsere vor fünf Jahren von der hiesigen, aus
fünfzehn Mitgliedern bestehenden Gemeinde erbaute Synagoge, erkundigte sich
nach der Zahl und dem Wohlstande der Gemeindemitglieder bei dem israelitischen
Lehrer E. Mandel, gab seinen Wohlgefallen zu erkennen, und fügte hinzu:
"Das Alte Testament haben auch wir, und noch das neue." Die
israelitische Gemeinde fühlte sich durch die Aufmerksamkeit Seiner
Majestät höchst beglückt. Otterberg (Pfalz),
18. Juni (1843). Bei der Anwesenheit Seiner Majestät des Königs von Bayern am
13. Juni (1843) allhier, begab sich dieser Monarch nach beendigtem Gottesdienste
in der katholischen Kirche in unsere vor fünf Jahren von der hiesigen, aus
fünfzehn Mitgliedern bestehenden Gemeinde erbaute Synagoge, erkundigte sich
nach der Zahl und dem Wohlstande der Gemeindemitglieder bei dem israelitischen
Lehrer E. Mandel, gab seinen Wohlgefallen zu erkennen, und fügte hinzu:
"Das Alte Testament haben auch wir, und noch das neue." Die
israelitische Gemeinde fühlte sich durch die Aufmerksamkeit Seiner
Majestät höchst beglückt. |
1847 wurde die Synagoge umgebaut. Von der Architektur her war es eine
einfache Dorfsynagoge. Äußerlich fielen die Rundbogenfenster und über dem
Eingang eine hebräische Portalinschrift auf (Zitat aus Psalm 118,20). Für die
Frauen gab es eine Empore mit separatem Zugang.
Nach dem Wegzug beziehungsweise der Auswanderung der meisten jüdischen
Familien wurde das Synagogengebäude nach 1880 verkauft. Damals muss es
sich in einem desolaten Zustand befunden haben. 1902
wurde das Gebäude zu einem Wohnhaus umgebaut. Als solches ist es erhalten.
Beim Umbau zum Wohnhaus wurden die Rundbogenfenster geschlossen und verputzt.
Erst im Zusammenhang mit einer Renovierung
des Gebäudes im Jahr 2002 wurden an der Nordseite die Rundbogenfenster wieder sichtbar
gemacht.
Adresse/Standort der Synagoge: Kirchstraße 19a.
Fotos zur Geschichte der Synagoge
(links: O. Weber s. Lit. S. 141, Foto von B. Gerlach; rechts:
Landesamt s. Lit. S. 309; Farbfotos von 2016 aus der Facebook-Gruppe "Palatia
Judaica" von Bernhard Kukatzki)
 |
 |
|
Die ehemalige Synagoge in
Otterberg
mit den seit 2002 wieder
freigelegten Rundbogenfenstern |
Portalinschrift (Psalm 118,20): "Dies
ist
das Tor zum Herrn, Gerechte ziehen
durch es hinein" |
|
| |
|
|
| |
|
|

 |
 |
 |
| Das Gebäude der
ehemaligen Synagoge in Otterberg im Juli 2016 mit der Hinweistafel: "!835
als jüdisches Bethaus erbaut - 1847 zur Synagoge erhoben - 1900 nach
Auflösung der jüdischen Gemeinde verkauft. Seither als Wohnhaus genutzt."
|
| |
|
|
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
|
Februar 2020:
QR-Codes geleiten durch die Stadt
|
Artikel
von Dorothea Richter in der "Rhein-Pfalz" vom 26. April 2020:
"Otterberg: Internetgeführter Rundgang beschreibt historische
Gebäude
Mit Hilfe von mit QR-Codes, die an verschiedenen Bauwerken angebracht sind,
haben Besucher Otterbergs ab sofort die Möglichkeit, Beschreibungen
historisch interessante Orte und Gebäude der Wallonenstadt zu erkunden.
Sehenswürdigkeiten wie die Abteikirche, die ehemalige Synagoge,
verschiedene Brunnen, Fachwerkbauten und die Stadtmauer sind nur einige
Beispiele für die rund 30 ausgewählten Objekte. Die Initiative geht auf
Harald Forsch zurück, der auch die Internetseite www.Otterberg24.de
entwickelt hat, mit der dieser internetgeführte Rundgang ermöglicht wird.
Bisher sind die ersten fünf Schilder mit den QR-Codes angebracht, bis zum
Sommer sollen die restlichen montiert sein. Die Gesamtkosten für die
Schilder von circa 2000 Euro wurden von den Vereinen Wir in Otterberg,
Otterberger Werbekreis, KulturArt Otterberg, der Verbandsgemeinde
Otterbach-Otterberg sowie mehreren privaten Spendern bisher zu 80 Prozent
finanziert."
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Otmar Weber: Die Synagogen in der Pfalz von 1800 bis heute. Unter
besonderer Berücksichtigung der Synagogen in der Südpfalz. Hg. von der
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Pfalz in Landau. 2005.
S. 133-134. |
 | Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt
des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies
ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. Mainz 2005. S. 309 (mit weiteren Literaturangaben).
|



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|