|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg
Odenheim (Gemeinde Östringen, Landkreis
Karlsruhe)
Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In dem bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zum Stift
Odenheim gehörenden gleichnamigen Ort bestand eine jüdische Gemeinde bis zu
ihrer Auflösung am 1. April 1937 (s.u. CV-Zeitung 1.4.1937). Ihre Entstehung geht in die Zeit des
17. Jahrhunderts zurück. Erstmals wird 1629 Jud Joseph genannt, er war
Mitbegründer des jüdischen Friedhofes in
Oberöwisheim. In den Vogtgerichtsprotokollen von 1670 und 1673
werden bereits mehrere jüdische Familien am Ort genannt (Angaben nach Klaus
Meyer, Esens): 1670 sieben Familien: Isaac Schultheiß (gemeint der
"Judenschultheiß" bzw. Vorsteher der jüdischen Gemeinde), Schmuel,
Koppel, Nathan, Jost, Seeligmann, Joseph Meyer, 1673 acht Familien: Isaac Schultheiß Sel (Sel
vermutlich Abkürzung für gestorben), Schmuel, Koppel, Nathan, Joseph, Mayer,
Roth Judt, Seeligmann. 1683 waren es wieder sieben Familien. 1691 werden in Hilsbach zwei aus Odenheim geflüchtete
Juden genannt.
Im 18. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen
Einwohner wie folgt: 1701 neun Familien, 1720 12 Familien, 1731 57 jüdische
Einwohner, 1733 61, 1746 35, 1762 zehn jüdische Familien, 1788 36 jüdische
Einwohner, 1802 neun jüdische Familien. Die zehn im Jahre 1737 genannten
jüdischen Familien besaßen zusammen neun ganze und zwei halbe Häuser, dazu
22,5 Ruten Krautgärten, 5 Ruten Wiesen und Grasgärten, 1 Viertel Wiesen und 1
Viertel Ackerfläche.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1825 75 jüdische Einwohner (4,3 % von 1.759 Einwohnern), um 1864
höchste Zahl jüdischer
Einwohner mit 156 Personen, 1871 125, 1875 106 (4,7 % von insgesamt
2.241), 1887 87, 1891 78, 1892/94 87 (in 20 Familien), 1899 80 (von insgesamt
2353 Einwohnern), 1900 72 (in 14 Haushaltungen, von insgesamt 2353 Einwohnern), 1910 61 jüdische Einwohner (2,4 % von 2.530).
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde einen Betsaal
beziehungsweise eine Synagoge (s.u.), eine Religionsschule (in der
'Judenschule', dem späteren Lehrerzimmer der Volksschule des Ortes) sowie ein
rituelles Bad. Die Toten der Gemeinde wurden im bereits genannten jüdischen Friedhof
in Oberöwisheim beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde
war ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. Im
Ortssippenbuch Odenheim (s. Lit.) werden für die Zeit der ersten Hälfte/Mitte des 19.
Jahrhundert die folgenden Lehrer / Vorsänger genannt (nach Angaben von Klaus
Meyer, Esens; in alphabetischer, nicht chronologischer Reihenfolge!):
1. Abraham Koppel Brand, geb. um 1795, gest. 14.10.1867, verh. mit Rebekka Bruchsaler aus Odenheim
2. Hajum (Heinrich) Brand, Religionslehrer u. Vorsänger (1851) in Bauerbach,
geb. 21.01.1824, verh. mit Beßle (Babette) Basinger, geb. in
Bauerbach
3. [beim Tod der Witwe angegeben:] Mendel Durlacher, verh. vor 1853 in Odenheim
mit Regine Zimmern, gest. 26.11.1853 als Witwe
4. David Keller, Lehrer u. Vorsänger (1845 - 1849) in Odenheim, verh. mit Karoline Freund
5. Ascher Koch, Vorsänger und Religionslehrer (1850 - 1855), verh. mit Sarah Sophie Weil
6. Baruch Meier, Lehrer und Vorsänger, geb. ca. 1755, gest. 26.06.1835 1.
verh. mit Jette Deuchel, 2. verh. mit Magdalena Rothschild.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war von mindestens 1870 bis
vermutlich 1878 Simon Hecht Lehrer in Odenheim (danach in
Gondelsheim), der Vater der bekannten
Schifffahrtsunternehmer Jacob und Hermann Hecht (s.u.). Um 1881 wird Lehrer
Lehmann genannt; um 1888/89 (auf Grund
der Ausschreibungen unten vermutlich von 1885 bis 1890) war Lehrer Josef Traub
in Odenheim (1889 unterrichtete er auch in
Münzesheim), um 1890/1892 (vermutlich auf Grund der Ausschreibungen unten
von 1890 bis 1893) Lehrer H. Kaufmann (unterrichtete gleichfalls in Münzesheim),
um 1894/1895 Lehrer J. Schwabacher, um 1896/1899 J. Guggenheim (wechselte 1895
von Liedolsheim nach Odenheim; unterrichtete
damals 12 bis 16 Kinder, die Schule wird als Simultanschule genannt), um 1901 J. Zivi (unterrichtete damals 17 Kinder),
um 1903 A. Quittner (unterrichtete 17 Kinder), 1909 bis nach 1916 Isaak
Rabinowitz (war zuvor Lehrer in Hainstadt).
Als Gemeindevorsteher werden genannt: um 1876 S. Hecht, um 1895 S.
Flegenheimer, um 1899 S. Flegenheimer, S. Odenheimer und S. Jordan, um
1901 S. Odenheimer.
Als Rechner der Gemeinde wird genannt: um 1899 E. Schönau.
Von den jüdischen Vereinen wird genannt: Der Israelitische
Wohltätigkeitsverein (um 1901/1903 unter Vorsitz von A. Freund, L.
Mannheimer und A. Brandt).
Bereits im 18. Jahrhundert wird ein Rabbiner am Ort genannt: 1712 tritt Rabbiner
Faist sein Amt an, das er auch 1740 noch inne hatte. Um
1810 wird Rabbiner Abraham Ellinger genannt. 1827 wurde die
Gemeinde dem Rabbinatsbezirk Bruchsal zugeteilt.
Die jüdischen
Familien verdienten ihren Lebensunterhalt zunächst vor allem als Viehhändler.
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gab es Zigarrenfabriken jüdischer
Unternehmer am Ort, mehrere Metzgereien und andere Läden / Geschäfte /
Handlungen, aber auch einen Schuhmacher und einen jüdischen Wirt
(Schwanenwirt).
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde: Gefreiter Hermann (Harry)
Freund (geb. 14.7.1893 in Odenheim, gef. 20.1.1915). Fabrikant Adolf
Flegenheimer erhielt vom Großherzog das Kreuz für freiwillige Kriegshilfe
1914/16 ("Der Gemeindebote" vom 26.10.1917 S. 4).
Um 1924, als noch etwa 40 Personen zur jüdischen Gemeinde gehörten (1,6
% von insgesamt etwa 2.500 Einwohner), waren die Gemeindevorsteher Albert
Freund, Isidor Odenheimer und Adolf Flegenheimer. Damals gab es in der Gemeinde
noch ein schulpflichtiges jüdisches Kind, das seinen Religionsunterricht durch
Lehrer Moritz David (Untergrombach) erhielt. 1932 waren die
Gemeindevorsteher weiterhin Albert Freund (1. Vors.) und Isidor Odenheimer (2.
Vors.). Als Schochet war in der Gemeinde Elias Schocmann tätig. Zur jüdischen
Gemeinde Odenheim gehörten inzwischen (seit der Auflösung der dortigen
Gemeinde 1921) die noch in Menzingen
lebenden jüdischen Personen (1932 noch 6). An jüdischen Vereinen
bestand insbesondere der Wohltätigkeitsverein Chefro. Im Schuljahr
1931/32 gab es zwei schulpflichtige jüdische Kinder in der Gemeinde, die
Religionsunterricht erhielten.
Um 1933 gehörten jüdischen Familien noch die folgenden Gewerbebetriebe:
der Schuh- und Kohlenhandel Siegmund/Helene Brandt, die Zigarrenfabrik Adolf
Flegenheimer, das Manufakturwarengeschäft Isidor und Julius Odenheimer, das Textil- und Manufakturwarengeschäft Fritz
Levy und die Geschirrhandlung Leopold Mannheimer.
1933 lebten noch 20 jüdische Personen in Odenheim. Alsbald waren sie
Ziel von Aktionen von Mitgliedern der NSDAP. Zwischen 1935 und 1937 mussten
alle jüdischen Gewerbebetriebe verkauft beziehungsweise "arisiert"
werden. Die meisten der jüdischen Einwohner konnten noch emigrieren (acht in
die USA, vier nach Frankreich, einer nach Argentinien), sodass beim
Novemberpogrom 1938 nur noch fünf jüdische Personen am Ort waren. Die letzten
vier wurden am 22. Oktober 1940 in das KZ Gurs in Südfrankreich deportiert. Die
vier nach Frankreich emigrierten jüdischen Odenheimer wurden 1943/44 von der
Gestapo verhaftet und nach Auschwitz verschleppt. Dort wurden drei ermordet, der
vierte im Frühjahr 1945 im KZ Buchenwald.
Von den in Odenheim geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen
Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Augusta Auerbacher geb.
Rosenfeld (1893), Bernhard Buttenwieser (1872), Sofie Erlebacher geb.
Flegenheimer (1868), Moses Flegenheimer (1869), Betty Fuchs (1890), Bertha Götz
geb. Mannheimer (1915), Justine Hilb geb. Buttenwieser (1863), Mina Lindauer
geb. Basnizki (1887), Bernhard Mannheimer (1904), Irene Klara Mannheimer (1926),
Leopold Mannheimer (1862), Max Mannheimer (1892), Regina Mannheimer geb. Emrich
(1868), Flora Neuberger geb. Rabinowitz (1914), Isidor Odenheimer (1883), Josef
Julius Odenheimer (1881), Sigmund Odenheimer (1886), Auguste Palm geb.
Flegenheimer (1864), Mathilde Rothschild geb. Buttenwieser (1875).
Weitere Erinnerungen am Ort: Ein Flurname "Moschebuckel" gegenüber
dem Ortsfriedhof erinnert an einen ehemaligen Besitzer Moses Flegenheimer (19.
Jahrhundert). Das noch heute bestehende Siegfriedsbrunnendenkmal in
Odenheim geht auf eine Stiftung von Siegmund (Simon) Odenheimer aus dem Jahr
1932 zurück. Odenheimer stiftete den Brunnen zur Erinnerung an die
Nibelungensage und den Mord Hagens an Siegfried sowie zum Gedenken an seine
Verlobung.
Berichte
aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der jüdischen
Lehrer
Hinweis auf Rabbiner Abraham Ellinger in Odenheim (um
1810)
(Anm. einen ersten Hinweis auf Rabbiner Ellinger in Odenheim erhielt der
Webmaster von Klaus W. Meyer, Esens)
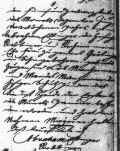 Mit
Abraham Ellinger hatte die jüdische Gemeinde noch um 1810 einen eigenen
Rabbiner; bereits von 1712 bis 1740 wird ein Rabbiner Faist genant. An
Rabbiner Ellinger erinnern u.a. Eintragungen in den israelitischen
Familienregistern Odenheims (HStA Stgt J 386 Bü. 458, Link).
Die Abbildung links zeigt den von Abraham Ellinger vorgenommenen Eintrag
der Geburt seines Sohnes Mayer am 25. Dezember 1811. Als Zeugen werden
die "hiesigen Schutzjuden" Löb und Mendel Manheimer
(Mannheimer) genannt. Mit
Abraham Ellinger hatte die jüdische Gemeinde noch um 1810 einen eigenen
Rabbiner; bereits von 1712 bis 1740 wird ein Rabbiner Faist genant. An
Rabbiner Ellinger erinnern u.a. Eintragungen in den israelitischen
Familienregistern Odenheims (HStA Stgt J 386 Bü. 458, Link).
Die Abbildung links zeigt den von Abraham Ellinger vorgenommenen Eintrag
der Geburt seines Sohnes Mayer am 25. Dezember 1811. Als Zeugen werden
die "hiesigen Schutzjuden" Löb und Mendel Manheimer
(Mannheimer) genannt.
|
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers /
Vorbeters / Schochet 1885 / 1890 / 1893 / 1901 / 1903 / 1904 / 1909
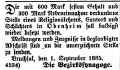 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1885:
"Die mit 600 Mark festem Gehalt und 300 Mark Nebeneinnahme
verbundene Stelle eines Religionslehrers, Kantors und Schächters in Odenheim
soll baldigst wiederbesetzt werden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1885:
"Die mit 600 Mark festem Gehalt und 300 Mark Nebeneinnahme
verbundene Stelle eines Religionslehrers, Kantors und Schächters in Odenheim
soll baldigst wiederbesetzt werden.
Meldungen und Zeugnisse in beglaubigter Abschrift sind an die
unterzeichnete Stelle zu senden. Bruchsal, den 1. September 1885. Die
Bezirkssynagoge." |
| |
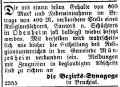 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Mai 1890:
"Die mit einem festen Gehalte von 600 Mark und Nebeneinkommen im
Betrage von 400 Mark verbundene Stelle eines Religionslehrers, Kantors
und Schächters in Odenheim soll baldigst wieder besetzt werden.
Mit derselben wird wahrscheinlich wie bisher die Erteilung des
Religionsunterrichts in der Gemeinde Münzesheim verbunden sein.
Meldungen mit Zeugnissen in beglaubigter Abschrift sind zu richten an
die Bezirks-Synagoge in Bruchsal."
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Mai 1890:
"Die mit einem festen Gehalte von 600 Mark und Nebeneinkommen im
Betrage von 400 Mark verbundene Stelle eines Religionslehrers, Kantors
und Schächters in Odenheim soll baldigst wieder besetzt werden.
Mit derselben wird wahrscheinlich wie bisher die Erteilung des
Religionsunterrichts in der Gemeinde Münzesheim verbunden sein.
Meldungen mit Zeugnissen in beglaubigter Abschrift sind zu richten an
die Bezirks-Synagoge in Bruchsal." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Oktober 1893:
"Die mit einer festen Einnahme von 600 Mark und Nebeneinnahmen in
ungefähr gleichem Betrage verbundene Stelle eines Religionslehrers,
Vorsängers und Schächters in Odenheim soll baldigst wieder
besetzt werden. Meldungen und Zeugnisse in Abschrift, die nicht zurückgesandt
zu werden brauchen, sind zu senden an die Bezirks-Synagoge in
Bruchsal." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Oktober 1893:
"Die mit einer festen Einnahme von 600 Mark und Nebeneinnahmen in
ungefähr gleichem Betrage verbundene Stelle eines Religionslehrers,
Vorsängers und Schächters in Odenheim soll baldigst wieder
besetzt werden. Meldungen und Zeugnisse in Abschrift, die nicht zurückgesandt
zu werden brauchen, sind zu senden an die Bezirks-Synagoge in
Bruchsal." |
| |
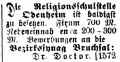 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Februar 1901:
"Die Religionsschulstelle Odenheim ist baldigst zu besetzen.
Fixum 700 Mark. Nebeneinnahmen ca. 200-300 Mark. Bewerbungen an die Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Februar 1901:
"Die Religionsschulstelle Odenheim ist baldigst zu besetzen.
Fixum 700 Mark. Nebeneinnahmen ca. 200-300 Mark. Bewerbungen an die
Bezirkssynagoge Bruchsal: Dr. Doctor." |
| |
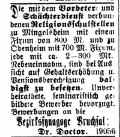 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Dezember 1901:
"Die mit dem Vorbeter- und Schächterdienst
verbundenen Religionsschulstellen zu Mingolsheim
mit einem Fixum von 800 Mark und zu Odenheim mit 700 Mark Fixum,
jede mit ca. 2-300 Mark Nebeneinnahmen, sind bei Aussicht auf Gehaltserhöhung
und Pensionsberichtigung baldigst zu besetzen. Unverheiratete,
seminaristisch gebildete Bewerber bevorzugt. Bewerbungen an die Bezirkssynagoge
Bruchsal: Dr. Doctor." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Dezember 1901:
"Die mit dem Vorbeter- und Schächterdienst
verbundenen Religionsschulstellen zu Mingolsheim
mit einem Fixum von 800 Mark und zu Odenheim mit 700 Mark Fixum,
jede mit ca. 2-300 Mark Nebeneinnahmen, sind bei Aussicht auf Gehaltserhöhung
und Pensionsberichtigung baldigst zu besetzen. Unverheiratete,
seminaristisch gebildete Bewerber bevorzugt. Bewerbungen an die Bezirkssynagoge
Bruchsal: Dr. Doctor." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Januar 1903:
"Die mit Vorsänger- und Schächterdienst verbundene Religionsschulstelle
in Odenheim, Gehalt 700 Mark, freie Wohnung und etwa 300 Mark Nebengefälle,
ist baldigst zu besetzen. Meldungen an die Bezirkssynagoge Bruchsal:
Dr. Doctor." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Januar 1903:
"Die mit Vorsänger- und Schächterdienst verbundene Religionsschulstelle
in Odenheim, Gehalt 700 Mark, freie Wohnung und etwa 300 Mark Nebengefälle,
ist baldigst zu besetzen. Meldungen an die Bezirkssynagoge Bruchsal:
Dr. Doctor." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September 1903:
"Die mit Vorsänger- und Schächterdienst verbundene Religionsschulstelle
in Odenheim ist baldigst zu besetzen. Gehalt 7-800 Mark,
Nebeneinnahmen 2-300 Mark. Pensionsberechtigung in Aussicht gestellt.
Meldungen an die Bezirkssynagogen Bruchsal: Rabbiner Dr. Doctor." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September 1903:
"Die mit Vorsänger- und Schächterdienst verbundene Religionsschulstelle
in Odenheim ist baldigst zu besetzen. Gehalt 7-800 Mark,
Nebeneinnahmen 2-300 Mark. Pensionsberechtigung in Aussicht gestellt.
Meldungen an die Bezirkssynagogen Bruchsal: Rabbiner Dr. Doctor." |
| |
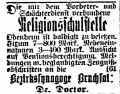 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Januar 1904:
"Die mit dem Vorbeter- und Schächterdienst verbundene Religionsschulstelle
Odenheim ist baldigst zu besetzen. Fixum 7-800 Mark. Nebeneinnahmen
3-400 Mark. Aussicht auf Pensionsberechtigung. Meldungen mit
beglaubigten Zeugnisabschriften an die Bezirkssynagoge Bruchsal: Dr.
Doctor." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Januar 1904:
"Die mit dem Vorbeter- und Schächterdienst verbundene Religionsschulstelle
Odenheim ist baldigst zu besetzen. Fixum 7-800 Mark. Nebeneinnahmen
3-400 Mark. Aussicht auf Pensionsberechtigung. Meldungen mit
beglaubigten Zeugnisabschriften an die Bezirkssynagoge Bruchsal: Dr.
Doctor." |
| |
 Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. Januar 1904:
"Odenheim in Baden. Religionsschulstelle, verbunden mit
Vorbeter- und Schächterdienst per bald. Fixum 7-800 Mark,
Nebeneinnahmen 3-400 Mark. Meldungen zu richten an Herrn Dr. Doctor,
Bruchsal." Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. Januar 1904:
"Odenheim in Baden. Religionsschulstelle, verbunden mit
Vorbeter- und Schächterdienst per bald. Fixum 7-800 Mark,
Nebeneinnahmen 3-400 Mark. Meldungen zu richten an Herrn Dr. Doctor,
Bruchsal." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juli 1909:
"Die Stelle eines Religionslehrers, Kantors und Schächters in
Odenheim soll besetzt werden. Das feste Gehalt beträgt 900 Mark,
die Nebeneinkünfte 500 Mark bei freier Wohnung. Gelegenheit zu weiterer
Nebenbeschäftigung bietet sich am Orte. Meldungen mit
Zeugnisabschriften wolle man an den Unterzeichneten richten. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juli 1909:
"Die Stelle eines Religionslehrers, Kantors und Schächters in
Odenheim soll besetzt werden. Das feste Gehalt beträgt 900 Mark,
die Nebeneinkünfte 500 Mark bei freier Wohnung. Gelegenheit zu weiterer
Nebenbeschäftigung bietet sich am Orte. Meldungen mit
Zeugnisabschriften wolle man an den Unterzeichneten richten.
Bruchsal, 21. Juli 1909.
Dr. M. Eschelbacher, Bezirksrabbiner." |
Hinweis auf den Lehrer und Kantor Simon Hecht (mindestens seit 1870 Lehrer in
Odenheim) und seine Kinder
Anmerkung: Samson
Simon Hecht (geb. 1840 in Wenkheim,
gestorben 1927 in Mannheim) war nach einem Bericht zu seinem 50-jährigen
Amtsjubiläum 1912 in Gondelsheim Lehrer
seit 1862. Er war verheiratet mit Hanna geb. Rosenberg (geb. 1843 in
Neudenau, gest. 1916 in
Gondelsheim; Foto siehe
https://www.geni.com/people/Hanna-Hecht/4808019588480013132). Mindestens
seit 1870 war er Lehrer in Odenheim. Hier
sind seine ersten fünf Kinder geboren: Nathan (geb. 1870), Therese (geb. 1872),
Gustav (geb. 1873), Ludwig (geb. 1876) und Hermann (1877). Genealogische
Informationen zur Familie Einstieg u.a. über Jacob Hecht
https://www.geni.com/people/Jakob-Hecht/4815905678570078501 (mit Foto) oder
Hermann Hecht
https://www.geni.com/people/Hermann-Hecht/4844176412270054377.
Vermutlich 1878 wechselte Lehrer Hecht nach
Gondelsheim, wo im Juni 1879 der Sohn Jacob geboren ist, 1882 noch die
Tochter Sara.
Der in Odenheim am 13. März 1877 geborene Hermann Hecht wurde ein
bekannter deutscher Schifffahrtsunternehmer. Er hat gemeinsam mit seinem Bruder
Jacob Hecht die Rhenania Schiffahrts- und Speditions-Gesellschaft mbH
gegründet, siehe weitere Informationen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hecht.
Hinweis auf den
Lehrer und Kantor Josef Traub
(1932, vermutlich 1890 bis 1893 Lehrer in Odenheim)
Vorbemerkung: seit 1899 war in Mannheim als Kultusbeamter,
Lehrer und Schochet Josef Traub tätig. Er ist am 17. Dezember 1861 in Burgpreppach
geboren. Er war verheiratet mit Betti (Betty) geb. Rothschild (geb.
16. Juni 1869 in Krautheim). Die
beiden hatten mindestens drei Kinder (Flora geb./gest. 1892; Adolf
geb. 12. Mai 1893 in Malsch siehe unten; Hedwig
siehe unten). Josef Traub war vor seiner Zeit in Mannheim als
Lehrer in Krautheim, Odenheim
und um 1893/98 in Malsch tätig. In der
Krautheimer Zeit dürfte er seine Frau kennen gelernt haben. 1940 wurde Josef Traub nach Gurs deportiert, wo er am 15. Dezember 1940
umgekommen ist. Seine Frau Betty (gleichfalls deportiert?) erlebte das
Kriegsende und ist am 13. Juni 1946 auf der Ausreise in die USA in Macon,
Frankreich gestorben (siehe Todesanzeige unten).
Die Tochter Hedwig Traub ist am 3. Juni 1898 in
Malsch geboren. Sie war später gleichfalls als Lehrerin tätig, zuletzt
in den Sonderklassen für jüdische Kinder in der Luisenschule in Mannheim
(1934 bis 1938) und in der dortigen Jüdischen Schule (K2,6, 1938 bis 1940) ebd..
1940 wurde Hedwig Traub mit ihrem Lehrerkollegen Max Ludwig Marx nach Gurs
deportiert und später in Auschwitz ermordet.
Vgl. Presseartikel im
"Mannheimer Morgen" / morgenweb.de vom 18.4.2012: "Neue
Gedenktafel an altem Platz" (zur Erinnerungstafel an der
Hachenburg-Schule, ehem. Luisenschule). |
| Hinweis: vermutlich war die am 7. November 1900 in
Mannheim geborene Gertrud Traub eine Tochter von Betty Traub.
Sie wurde gleichfalls nach Gurs deportiert, im August 1942 nach Auschwitz,
wo sie ermordet wurde. |
| Der Sohn Adolf Traub wird genannt in einer
Einzelfallakte des Landesamtes für Wiedergutmachung: GLA Karlsruhe 480
Nr.14982 http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1823715
. Er konnte in die USA emigrieren (genannt in der nachstehenden
Todesanzeige). Er starb im August 1964 in New York siehe http://www.mocavo.com/Adolf-Traub-1893-1964-Social-Security-Death-Index/04420158135011057167
|
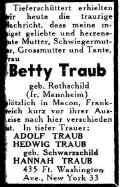 Links: Todesanzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau" vom 21. Juni
1946: Links: Todesanzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau" vom 21. Juni
1946:
"Tieferschüttert erhielten wir heute die traurige Nachricht, dass
meine innigst geliebte und herzensgute Mutter, Schwiegermutter,
Grossmutter und Tante,
Frau Betty Traub geb. Rothschild (fr. Mannheim)
plötzlich in Macon, Frankreich kurz vor ihrer Ausreise nach hier
verschieden ist. In tiefer Trauer:
Adolf Traub Hedwig Traub geb.
Schwarzschild Hannah Traub 435 Ft. Washington Ave., New
York 33". |
| |
 Artikel
in "Der Israelit" vom 30. Juni 1932: "Das Israelitische Gemeindeblatt vom
22. Juni enthält folgende Notiz: der Senior unserer (Mannheimer)
Gemeindebeamten, Herr Josef Traub, tritt am 1. Juli in den Ruhestand,
begleitet von der Verehrung und Dankbarkeit der Gemeinde und der
Gemeindeverwaltung. Jahrzehntelang hat Herr Traub als Lehrer und
Schächtbeamter gewirkt, mit unermüdlicher Arbeitsfreude und strengstem
Pflichtgefühl seinem Dienste hingegeben. Schlicht und fromm in seiner
Lebensführung, wahrte ihr allezeit die Würde seines religiösen Amtes. Möge
ihm eine lange, ungetrübte Altersruhe beschieden sein. Die hohe
Wertschätzung, die aus diesen Worten spricht, kam vor wenigen Monaten ganz
besonders zum Ausdruck, als Herr Traub seinen 70. Geburtstag feiern durfte.
Da würdigte der Vorsitzende des Synagogenrats, Herr Professor Dr. Moses,
die Dienstleistungen des vorbildlichen Beamten, da sprach seiner Ehrwürden
Herr Rabbiner Dr. Unna von dem heiligen Schochet-Beruf, dem
Herr Traub mit ganzer Hingabe diente, da wies unser Raw aber auch im Namen
der Chewrah Kadischah auf die bedeutungsvolle Tatsache hin, dass der
70-jährige seit 32 Jahren in ernsthafter Mizwa-Erfüllung der heiligen
Bruderschaft angehört und zu keiner Stunde fehlt, wenn der Ruf zu letzten
Liebesdiensten an ihn ergeht. Herr Traub, der in jungen Jahren als Lehrer in
Krautheim, Odenheim und
Malsch tätig war und hier lange Jahre
dem Lehrkörper der Klaus-Religionsschule angehörte, nimmt die Verehrung und
die guten Wünsche der Gemeinde, die ihn zu den Ihren zählt, mit in die Jahre
des Ruhestand. Wer so in der Tora verwurzelt ist, dem darf man an der
Schwelle des Greisenalters das Wort als Segenswunsch zurufen: 'Dauer der
Tage ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre (Sprüche
3,16)" Artikel
in "Der Israelit" vom 30. Juni 1932: "Das Israelitische Gemeindeblatt vom
22. Juni enthält folgende Notiz: der Senior unserer (Mannheimer)
Gemeindebeamten, Herr Josef Traub, tritt am 1. Juli in den Ruhestand,
begleitet von der Verehrung und Dankbarkeit der Gemeinde und der
Gemeindeverwaltung. Jahrzehntelang hat Herr Traub als Lehrer und
Schächtbeamter gewirkt, mit unermüdlicher Arbeitsfreude und strengstem
Pflichtgefühl seinem Dienste hingegeben. Schlicht und fromm in seiner
Lebensführung, wahrte ihr allezeit die Würde seines religiösen Amtes. Möge
ihm eine lange, ungetrübte Altersruhe beschieden sein. Die hohe
Wertschätzung, die aus diesen Worten spricht, kam vor wenigen Monaten ganz
besonders zum Ausdruck, als Herr Traub seinen 70. Geburtstag feiern durfte.
Da würdigte der Vorsitzende des Synagogenrats, Herr Professor Dr. Moses,
die Dienstleistungen des vorbildlichen Beamten, da sprach seiner Ehrwürden
Herr Rabbiner Dr. Unna von dem heiligen Schochet-Beruf, dem
Herr Traub mit ganzer Hingabe diente, da wies unser Raw aber auch im Namen
der Chewrah Kadischah auf die bedeutungsvolle Tatsache hin, dass der
70-jährige seit 32 Jahren in ernsthafter Mizwa-Erfüllung der heiligen
Bruderschaft angehört und zu keiner Stunde fehlt, wenn der Ruf zu letzten
Liebesdiensten an ihn ergeht. Herr Traub, der in jungen Jahren als Lehrer in
Krautheim, Odenheim und
Malsch tätig war und hier lange Jahre
dem Lehrkörper der Klaus-Religionsschule angehörte, nimmt die Verehrung und
die guten Wünsche der Gemeinde, die ihn zu den Ihren zählt, mit in die Jahre
des Ruhestand. Wer so in der Tora verwurzelt ist, dem darf man an der
Schwelle des Greisenalters das Wort als Segenswunsch zurufen: 'Dauer der
Tage ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre (Sprüche
3,16)" |
Lehrer Isaak Rabinowitz wechselt von Hainstadt nach
Odenheim (1909)
 Artikel im
"Israelitischen Familienblatt" vom 16. Dezember 1909: "Mitteilungen.
Aus Baden. Herr Lehrer Isaak Rabinowitz in
Hainstadt wurde nach Odenheim
bei Bruchsal versetzt. Die Religionsschulstelle Hainstadt ist dem Herrn
Hobel aus Tauberbischofsheim
nach Ableistung seiner Militärpflicht vom großherzoglichen Oberrat
übertragen worden." Artikel im
"Israelitischen Familienblatt" vom 16. Dezember 1909: "Mitteilungen.
Aus Baden. Herr Lehrer Isaak Rabinowitz in
Hainstadt wurde nach Odenheim
bei Bruchsal versetzt. Die Religionsschulstelle Hainstadt ist dem Herrn
Hobel aus Tauberbischofsheim
nach Ableistung seiner Militärpflicht vom großherzoglichen Oberrat
übertragen worden." |
Publikation des Lehrers Ch. Rabbinowicz (I. Rabinowitz, 1909)
Anmerkung: Lehrer Isaak Rabinowitz war seit 1910 verlobt mit Jenny Guggenheim
aus Tiengen (Neue jüdische Presse/Frankfurter
Israelitisches Familienblatt vom 15.4.1910).
 Buchvorstellung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Januar 1909: Text
wird nicht ausgeschrieben, da kein direkter Bezug zur jüdischen
Geschichte in Odenheim besteht. Buchvorstellung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Januar 1909: Text
wird nicht ausgeschrieben, da kein direkter Bezug zur jüdischen
Geschichte in Odenheim besteht.
|
Auflösung der jüdischen
Gemeinde (1937)
 Artikel
in der "CV-Zeitung" (Zeitung des Central-Vereins) vom 1. April
1937: "Baden. Der Oberrat der Israeliten Badens gibt
bekannt, dass mit Genehmigung des Staatsministeriums und des
Synodalausschusses die israelitischen Gemeinden in Oestringen, Eberstadt
und Odenheim aufgelöst und die noch verbleibenden Mitglieder
anderen Gemeinden zugeteilt werden. Die Religionsgemeinden Heidelberg
und Rohrbach sind zu einer Gemeinde mit der Bezeichnung Israelitische
Religionsgemeinde Heidelberg mit Wirkung vom 1. April 1937 vereinigt
worden." Artikel
in der "CV-Zeitung" (Zeitung des Central-Vereins) vom 1. April
1937: "Baden. Der Oberrat der Israeliten Badens gibt
bekannt, dass mit Genehmigung des Staatsministeriums und des
Synodalausschusses die israelitischen Gemeinden in Oestringen, Eberstadt
und Odenheim aufgelöst und die noch verbleibenden Mitglieder
anderen Gemeinden zugeteilt werden. Die Religionsgemeinden Heidelberg
und Rohrbach sind zu einer Gemeinde mit der Bezeichnung Israelitische
Religionsgemeinde Heidelberg mit Wirkung vom 1. April 1937 vereinigt
worden." |
Zur Geschichte
des Betsaales / der Synagoge
Bereits im 17./18. Jahrhundert hatten die (1762 zehn) jüdischen Familien eine
Synagoge bzw. einen Betsaal eingerichtet. Genannt wird eine
"Judenschule" kurz nach 1700.
Im 19. Jahrhundert konnte eine Synagoge
in der ehemaligen Klosterkirche in der Klostergasse eingerichtet werden.
Über die Geschichte dieser ehemaligen Klosterkirche während der Zeit
als Synagoge ist auf Grund der nur wenigen vorliegenden Quellen nicht mehr viel
bekannt. Bereits in den 1920er-Jahren war es für die klein gewordene Gemeinde
immer schwieriger, die zu den Gottesdiensten notwendige Zehnzahl der Männer
zusammen zu bekommen. Nachdem die Klosterkirche spätestens nach Auflösung der
jüdischen Gemeinde Anfang 1937 nicht mehr genutzt wurde, ist sie auf Grund
ihres baufälligen Zustandes 1940 abgerissen worden.
1988 wurde auf dem Grundstück Untere Klostergasse 20 ein Gedenkstein
zur Erinnerung an die ehemalige Synagoge aufgestellt.
Adresse / Synagogenstandort:
Untere Klostergasse 20
Fotos
Historische Fotos:
|
Historische
Fotos sind nicht bekannt, Hinweise bitte an den
Webmaster von "Alemannia Judaica", E-Mail-Adresse siehe Eingangsseite
|
Fotos nach 1945/Gegenwart:
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 18.11.2004)
 |
 |
 |
| Standort
der ehemaligen Synagoge |
Gedenkstein/-tafel
für die ehemalige Synagoge in Odenheim |
Links
und Literatur
Links:
Quellen:
Literatur:
 | Franz Hundsnurscher / Gerhard Taddey: Die jüdischen
Gemeinden in Baden. 1968 S.
221-222. |
 | Franz Gehrig: Hilsbach. Chronik der höchstgelegenen Stadt im Kraichgau. 1979 S. 197 (zu 1691). |
 | Heimatbuch Östringen. Geschichte einer Stadt. 1982. |
 | Jürgen Stude: Geschichte der Juden im Landkreis Karlsruhe. 1990. |
 | Hefte "Linsabauch" des Heimatkundlichen Arbeitskreises Odenheim: in den Heften 3.6-11.19 aus den Jahren 1986-2000 finden sich Beiträge zur Geschichte der Juden in Odenheim von Kurt
Fay, Eugen Krapp, Karl Mentel, Rainer Maurer. |
 | Joseph Walk (Hrsg.): Württemberg - Hohenzollern - Baden. Reihe: Pinkas Hakehillot. Encyclopedia of Jewish Communities from their foundation till after the Holocaust (hebräisch). Yad Vashem Jerusalem 1986. S. 219-220. |
 | Klaus Rössler (Bearb.): Familienbuch (Ortssippenbuch) von Odenheim (Landkreis Karlsruhe). Hrsg. vom Heimatkundlichen Arbeitskreis Odenheim. 2000. (Reihe: Deutsche Ortssippenbücher Bd. 269, Badische Ortssippenbücher Bd. 86).
Unter Nr. 4990-5071 werden die jüdischen Familien 1772 bis 1893 aufgeführt; der Verfasser hat die im Generallandesarchiv Karlsruhe aufgewahrten Zweiabschriften der Gemeinde Odenheims von 1810 bis 1870 ausgewertet. |
 | Ralf Fetzer: Untertanenkonflikte im Ritterstift Odenheim vom ausgehenden Mittelalter bis zum Ende der Alten Reiches. Reihe: Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg Nr. 150. 2002. ISBN 978-3-17-017334-7. S. 37.87-88. |
 |  Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007. Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007. |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|