|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge
in Heilbronn
Heilbronn (Stadtkreis)
Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte der Stadt
Hier: zur Geschichte des Rabbinates / Bezirksrabbinates im 19./20. Jahrhundert in
Heilbronn
sowie: zur Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule sowie anderer Kultusbeamten
der Gemeinde
Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit Beiträgen zur jüdischen Geschichte
in Heilbronn wurden in jüdischen Periodika gefunden. Bei Gelegenheit werden weitere Texte
eingestellt.
Hinweis: die Texte auf dieser Seite
müssen teilweise noch abgeschrieben und mit Anmerkungen versehen werden,
können jedoch durch Anklicken der Textabbildung bereits gelesen werden.
Übersicht:
Berichte zum
Rabbinat beziehungsweise zu den Rabbinern in Heilbronn
Die
Rabbiner der jüdischen Gemeinde (Hauptgemeinde) in Heilbronn im 19./20.
Jahrhundert
 | 1864 bis 1889 Rabbiner Dr. Moses Engelbert (geb.
1830 als Sohn des Kaufmanns Hermann Engelbert in Gudensberg;
gest. 1891 in Heilbronn): studierte zunächst
bei Rabbiner Wetzlar in seiner Heimatstadt Gudensberg, später in Würzburg, dann in
Frankfurt/Main; ab 1852 Studium in Göttingen, 1855 in Jena. 1855
Religionslehrer und Prediger in Waren (Mecklenburg-Schwerin), 1857
Prediger und Lehrer in Toruń (Thorn, Westpreußen), 1860 Rabbiner in
Kołobrzeg (Kolberg, Pommern); seit 1862 Bezirksrabbiner in Lehrensteinsfeld
- Verlegung des Rabbinatssitzes 1864 nach Heilbronn, 1889 krankheitshalber
Ruhestand, gest. 1891 in Heilbronn. |
 | 1889 bis 1892 (Rabbinatsstellvertreter): Rabbiner Dr.
Berthold Einstein (geb. 1862 in Ulm, gest. 1935 in Landau/Pfalz):
Studium in Berlin und Breslau, 1885 Promotion in Tübingen; 1889
Rabbinatsstellvertretung in Heilbronn, 1891 zweiter Rabbiner ebd., 1892-1894 Rabbiner in Laupheim, 1894 bis Sommer 1934
Bezirksrabbiner in Landau. |
 | 1892 bis 1914 Rabbiner Ludwig Kahn (geb. 1845 in Baisingen,
gest. 1914 in Heilbronn): Studium von 1865 bis 1870 am Rabbinerseminar in
Breslau; 1870 bis 1876 Rabbiner-Vikar (Rabbinatsadjunkt) in
Stuttgart, 1876 bis 1892 Rabbiner in Laupheim. |
 |  1914 bis 1935 Rabbiner Dr. Max Mordechai Beermann (geb. 1873
in Berlin, gest. 1935 in Heilbronn): studierte in Berlin und Gießen, 1898
Rabbinerdiplom; 1898 zunächst Rabbiner in Insterburg (Ostpreußen, heute
Tschernjachowsk, Черняховск),
floh 1914 vor der russischen Besatzung nach Danzig; danach zeitweise
Armeerabbiner; seit März 1915 Rabbiner in Heilbronn, Dozent an der
Volkshochschule; 1928 auch Dozent für Methodik, Homiletik und
religionswissenschaftliche Fächer am evangelischen Lehrerseminar in
Heilbronn; war verheiratet mit Recha geb. Goldberg (1871-1932). 1914 bis 1935 Rabbiner Dr. Max Mordechai Beermann (geb. 1873
in Berlin, gest. 1935 in Heilbronn): studierte in Berlin und Gießen, 1898
Rabbinerdiplom; 1898 zunächst Rabbiner in Insterburg (Ostpreußen, heute
Tschernjachowsk, Черняховск),
floh 1914 vor der russischen Besatzung nach Danzig; danach zeitweise
Armeerabbiner; seit März 1915 Rabbiner in Heilbronn, Dozent an der
Volkshochschule; 1928 auch Dozent für Methodik, Homiletik und
religionswissenschaftliche Fächer am evangelischen Lehrerseminar in
Heilbronn; war verheiratet mit Recha geb. Goldberg (1871-1932). |
 | 1935 bis 1938 Rabbiner Dr. Harry Heimann (geb. 1910
in Bromberg, Posen; heute Bydgoszcz, gest. 1993 in Los Angeles, CA):
studierte in Breslau und Berlin; war 1935 bis 1938 Rabbiner in Heilbronn,
Anfang Dezember 1938 in die USA emigriert; 1939 Rabbiner in Nutley, NJ, 1941
Rabbiner in Palisades Park, NJ; ab 1944 Rabbiner in Huntington Park, Los
Angeles, CA. |
Die
Rabbiner der Israelitischen Religionsgesellschaft Adass
Jeschurun in Heilbronn
 | 1911 bis 1920 Rabbiner Dr. Jonas Ansbacher (geb.
1879 in Nürnberg, gest. 1967 in London): studierte 1895 bis 1897 an der
Rabbinatsschule in Deutschkreuz im Burgenland; nach 1899 Studium an den
Universitäten Erlangen, Zürich und Gießen sowie an der Breuer'schen
Jeschiwa in Frankfurt am Main; nach 1906 Rabbiner in Labischin (Łabiszyn),
Posen, anschließend in Heilbronn; 1920/22 bis 1925 Rabbiner der
Israelitischen Religionsgesellschaft in Stuttgart, 1926 bis 1938 Rabbiner
der Altisraelitischen Kultusgemeinde in Wiesbaden; November 1938 im KZ
Buchenwald integriert, 1939 nach England emigriert; 1941 bis 1955 Rabbiner
in Hampstead, London. |
 | 1921 bis 1922 Rabbiner Dr. Benjamin (Benno) Cohen (geb.
1895 in Altona, umgekommen 31. März 1944 im KZ Auschwitz): Sohn des
Klausrabbiners Jakob Cohn in Altona; studierte 1914 bis 1921 in Berlin,
Frankfurt, Hamburg und Gießen, unterbrochen durch Kriegsteilnahme als
Soldat; zunächst Religionslehrer bei der Adass Jisroel in Berlin und
Prediger an zwei Berliner Privatsynagogen; 1921 Rabbiner der Israelitischen
Religionsgesellschaft in Heilbronn, 1922 Rabbiner der liberalen
sephardischen Synagoge Lützowstraße in Berlin-Tiergarten, 1925 bis 1928
Rabbiner in Schönlange (Trzcianka), 1928 bis 1938 Bezirksrabbiner von
Friedrichstadt-Flensburg mit Sitz in Friedrichstadt,
letzter Landesrabbiner von Schleswig-Holstein; im November 1938 in das KZ
Sachsenhausen eingeliefert; 1938 in die Niederlande emigriert, dort als
Klausdrabbiner der Stiftung "Ets Chajim" in Amsterdam tätig; 1941
mit Frau Bertha geb. Malina und Tochter Mirjam (beide 1943 ermordet) ins KZ
Westerbork inhaftiert, 1943 nach Auschwitz. |
 | 1920/23 bis 1930 Rabbiner Dr. Gerson Feinberg (geb.
1876 in Roth am Sand, ermordet
1942 in Riga): aufgewachsen in Regensburg; Studium an der
Israelitischen Lehrerbildungsanstalt (ILBA) in Würzburg; bis 1900
Lehrer und Kultusbeamter in Kitzingen;
ab 1900 Studium in Zürich und Berlin; 1910 bis 1923 Seminarrabbiner an der
ILBA in Würzburg; wurde im Dezember 1920 zum Rabbiner der Adass Jeschurun
in Heilbronn gewählt; Amtsantritt 1923; 1930 Bezirksrabbiner in
Groß-Strehlitz (Oberschlesien; heute Strzelce, Opolskie); nach der
Pensionierung 1936 noch Rabbinatsverwalter in Schönlanke, um 1938 in
Kreuzburg (Oberschlesien, Kluczbork); war verheiratet mit Sarah geb. Pollak.
Am 15. August 1942 zusammen mit seiner Frau von Berlin aus nach Riga
deportiert. |
 | Nach 1930 Rabbinatsvertretung durch Lehrer Kurt Flamm
(geb. 1910 in Kitzingen, gest. 2003
in Baltimore): studierte 1927 bis 1930 an der Israelitischen
Lehrerbildungsanstalt in Würzburg; nach 1930 Lehrer und Rabbinatsvertreter
in Heilbronn; März 1939 in die USA emigriert; 1940 bis 1978 Lehrer in
Baltimore; war verheiratet mit Ruth geb. Stein
(geb. 1909 in Memel); Söhne Ari Flamm und Gerson Flamm wurden Rabbiner. |
Texte
Verlegung
des Rabbinatssitzes nach Heilbronn (1861 / 1866/67)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 26. November 1861: "Die Israeliten in Heilbronn
haben die Erlaubnis zur Gründung einer eigenen Synagogengemeinde erhalten
und wird der Rabbinatssitz des Bezirks Lehrensteinsfeld
wahrscheinlich dahin verlegt werden. Heilbronn ist auch eine von
den Städten, die die Juden mit Feuer und Schwert aus ihren Mauern verjagt
haben und in welchen sich nun wieder der israelitische Kultus eine Stätte
gegründet hat." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 26. November 1861: "Die Israeliten in Heilbronn
haben die Erlaubnis zur Gründung einer eigenen Synagogengemeinde erhalten
und wird der Rabbinatssitz des Bezirks Lehrensteinsfeld
wahrscheinlich dahin verlegt werden. Heilbronn ist auch eine von
den Städten, die die Juden mit Feuer und Schwert aus ihren Mauern verjagt
haben und in welchen sich nun wieder der israelitische Kultus eine Stätte
gegründet hat." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Mai
1866: "Lehrensteinsfeld bei Weinsberg. Die Frage über die
definitive Rabbinatssitz-Verlegung von hier nach Heilbronn ist dem
Vernehmen nach in ein neues Stadium vorgerückt. Das Ministerium will dem
- beiden Gemeinden lästigen - Provisorium, während dessen der Rabbiner
seinen Wohnsitz teilweise auf eigene Kosten in Heilbronn genommen hat,
spätestens am 1. Juli 1867 ein Ende machen und der hiesigen Gemeinde
nimmer länger zumuten, ein leerstehendes teures Rabbinatshaus zu
erhalten. Auf Ansuchen des jetzigen Stelleninhabers soll nun eine schon
oft wiederholte Sitzung der weltlichen Mitglieder des Heilbronner
Kirchenvorsteheramts unter hohen Orts angeordneter Leitung des
Oberamtmannes in der Mitte April dieses Jahres stattgefunden haben, in der
verhandelt worden sei, ob die Vorsteher, deren Majorität durch den
Eintritt eines neugewählten Mitgliedes sich umgestaltet haben dürfte,
geneigt wären, die Kosten des definitiven Rabbinatssitzes auf Heilbronn
zu übernehmen, da das Ministerium zu einer beantragten zwangsweisen
Sitzverlegung sich nicht entschließen kann. Doch auch die neue Mehrheit
der Vorsteher hat die Annahme des Sitzes von mehreren für die Gemeinden
des Rabbinatssprengels und für die Zentralkirchenkasse finanziell sehr
lästigen Bedingungen abhängig gemacht und uns so die Hoffnung gelassen,
der Rabbinatssitz werde hier in Lehren bleiben, wo er seit einem
Jahrhundert gewesen ist. Die Minorität soll opferwilliger sein, wenn ihr
Antrag durchgeht, das zu errichtende Rabbinat Heilbronn zur Konkurrenz
für die berechtigten Bewerber ordnungsmäßig auszuschreiben, da sich
hoffen lasse, dass sich dann die tüchtigsten Kandidaten um die Stelle in
dieser sich schnell vermehrenden Stadtgemeinde melden würden. Die hiesige
Gemeinde jedoch beharrt bei ihren wohlerworbenen Rechten und verlangt
jedenfalls Ersatz früherer Auslagen. H." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Mai
1866: "Lehrensteinsfeld bei Weinsberg. Die Frage über die
definitive Rabbinatssitz-Verlegung von hier nach Heilbronn ist dem
Vernehmen nach in ein neues Stadium vorgerückt. Das Ministerium will dem
- beiden Gemeinden lästigen - Provisorium, während dessen der Rabbiner
seinen Wohnsitz teilweise auf eigene Kosten in Heilbronn genommen hat,
spätestens am 1. Juli 1867 ein Ende machen und der hiesigen Gemeinde
nimmer länger zumuten, ein leerstehendes teures Rabbinatshaus zu
erhalten. Auf Ansuchen des jetzigen Stelleninhabers soll nun eine schon
oft wiederholte Sitzung der weltlichen Mitglieder des Heilbronner
Kirchenvorsteheramts unter hohen Orts angeordneter Leitung des
Oberamtmannes in der Mitte April dieses Jahres stattgefunden haben, in der
verhandelt worden sei, ob die Vorsteher, deren Majorität durch den
Eintritt eines neugewählten Mitgliedes sich umgestaltet haben dürfte,
geneigt wären, die Kosten des definitiven Rabbinatssitzes auf Heilbronn
zu übernehmen, da das Ministerium zu einer beantragten zwangsweisen
Sitzverlegung sich nicht entschließen kann. Doch auch die neue Mehrheit
der Vorsteher hat die Annahme des Sitzes von mehreren für die Gemeinden
des Rabbinatssprengels und für die Zentralkirchenkasse finanziell sehr
lästigen Bedingungen abhängig gemacht und uns so die Hoffnung gelassen,
der Rabbinatssitz werde hier in Lehren bleiben, wo er seit einem
Jahrhundert gewesen ist. Die Minorität soll opferwilliger sein, wenn ihr
Antrag durchgeht, das zu errichtende Rabbinat Heilbronn zur Konkurrenz
für die berechtigten Bewerber ordnungsmäßig auszuschreiben, da sich
hoffen lasse, dass sich dann die tüchtigsten Kandidaten um die Stelle in
dieser sich schnell vermehrenden Stadtgemeinde melden würden. Die hiesige
Gemeinde jedoch beharrt bei ihren wohlerworbenen Rechten und verlangt
jedenfalls Ersatz früherer Auslagen. H." |
Die definitive Verlegung des Rabbinatssitzes nach Heilbronn steht bevor
(1866/67)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 20. Juni 1866: "Stuttgart. Dem Geheimen Hofrat von Kaulla,
Mitdirektor der Hofbank hier, ist von dem Kaiser von Russland der St.
Annen-Orden 2. Klasse verliehen und darauf von des Königs von
Württemberg die Erlaubnis erteilt worden, diese Ordensdekoration
anzunehmen und zu tragen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 20. Juni 1866: "Stuttgart. Dem Geheimen Hofrat von Kaulla,
Mitdirektor der Hofbank hier, ist von dem Kaiser von Russland der St.
Annen-Orden 2. Klasse verliehen und darauf von des Königs von
Württemberg die Erlaubnis erteilt worden, diese Ordensdekoration
anzunehmen und zu tragen.
Die 'Heilbronner Blätter' melden am 5. Juni (1866), dass die Frage
über die Verwandlung des noch provisorischen Rabbinatssitzes in
Heilbronn zu einem definitiven in ein neues Stadium eingetreten
sei, indem das Kirchenvorsteheramt durch eine Majorität von Einer Stimme
seine finanziellen Bedingungen, wodurch die Zentralkasse und die Gemeinden
des Sprengels zur Besoldungserhöhung und zu den Mietekosten des Rabbinats
bindend beitragspflichtig werden sollten, in bloße Hoffnungen und
Wünsche verwandelt hat, welche die geneigten Mittel- und Oberbehörden
nimmer hindern, die Sitzverlegung vom 1. Juli 1867 an definitiv
vorzuschlagen und anzuordnen. Wenn nun auch damit der israelitischen
Gemeinde in Heilbronn alsbald nicht unbedeutende und später sich
vermehrende pekuniäre Opfer auferlegt worden, so müsste man den
freiwilligen Schritt doch billigen, wenn allgemein zugegeben werden
wollte, dass das fast zweijährige Provisorium in jeder Beziehung
ersprießlich gewirkt hat. Allein die orthodoxe Minorität beharrt aus
finanziellen, religiösen, persönlichen und momentanen Gründen auf ihrer
Protestation gegen die 'geistliche Wohltat' auch jetzt noch, obschon ihr
Widerstand sie kaum noch einen Erfolg hoffen lässt. Möchte diese
mehrjährige Streitfrage so gelöst werden, dass ihre Erledigung den nur
durch sie langentbehrten Frieden in dieser blühenden Gemeinde segensreich
wieder befestige. U." |
Der
Protest gegen die Verlegung des Rabbinates nach Heilbronn bleibt wirkungslos (1867)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Februar
1867: "Vom Neckar. Die Korrespondenz über das von seinem
Hirten verlassene Dorf Lehrensteinsfeld und die Rabbinatswanderung
überhaupt heiße ich herzlich willkommen in diesem Zentralorgan des
orthodoxen Judentums und füge zur Berichtigung nur bei, dass nicht bloß
die Protestation der verlassenen Gemeinde, sondern auch die der Vorsteher
in Heilbronn hierbei endlich wirkungslos zu verhallen scheint, welche die
'neue' Wohltat sich nicht aufdringen lassen mögen. Doch ist vom
Königlichen Ministerium die Frage noch immer nicht definitiv
entschieden und die Hoffnung beider Gemeinden noch nicht ganz aufgegeben,
in Bezug auf Sitz und Person ihren Willen zur Geltung zu
bringen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Februar
1867: "Vom Neckar. Die Korrespondenz über das von seinem
Hirten verlassene Dorf Lehrensteinsfeld und die Rabbinatswanderung
überhaupt heiße ich herzlich willkommen in diesem Zentralorgan des
orthodoxen Judentums und füge zur Berichtigung nur bei, dass nicht bloß
die Protestation der verlassenen Gemeinde, sondern auch die der Vorsteher
in Heilbronn hierbei endlich wirkungslos zu verhallen scheint, welche die
'neue' Wohltat sich nicht aufdringen lassen mögen. Doch ist vom
Königlichen Ministerium die Frage noch immer nicht definitiv
entschieden und die Hoffnung beider Gemeinden noch nicht ganz aufgegeben,
in Bezug auf Sitz und Person ihren Willen zur Geltung zu
bringen." |
Silberhochzeit von Bezirksrabbiner Dr.
Moses Engelbert und seiner
Frau (1883)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 23. Januar 1883: "Bonn, 14. Januar (1883). Man schreibt
uns aus Heilbronn: Am 31. vorigen Monats feierte der hiesige Bezirksrabbiner
Dr. Engelbert seine silberne Hochzeit, und erhielt das Jubelpaar
hierzu aus nah und fern Glückwünsche und Geschenke, unter welch'
letzteren besonders die Ehrengeschenke der hiesigen und Öhringer Gemeinde
sich auszeichneten, die durch besondere Deputationen überreicht
wurden." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 23. Januar 1883: "Bonn, 14. Januar (1883). Man schreibt
uns aus Heilbronn: Am 31. vorigen Monats feierte der hiesige Bezirksrabbiner
Dr. Engelbert seine silberne Hochzeit, und erhielt das Jubelpaar
hierzu aus nah und fern Glückwünsche und Geschenke, unter welch'
letzteren besonders die Ehrengeschenke der hiesigen und Öhringer Gemeinde
sich auszeichneten, die durch besondere Deputationen überreicht
wurden." |
Rabbiner Dr. Berthold Einstein aus Ulm wird zum
Rabbinatsverweser ernannt (1889)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 1. April 1889: "Heilbronn, 22. März (1889). An
Stelle des auf sein Ansuchen auf unbestimmte Zeit beurlaubten Herrn
Rabbiners Dr. Engelbert hier wurde von der Israelitischen
Oberkirchenbehörde Herr Dr. Berthold Einstein aus Ulm,
längere Zeit Rabbinatsverweser in Halle an der Saale, mit der Führung
der sämtlichen Rabbinatsgeschäfte betraut." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 1. April 1889: "Heilbronn, 22. März (1889). An
Stelle des auf sein Ansuchen auf unbestimmte Zeit beurlaubten Herrn
Rabbiners Dr. Engelbert hier wurde von der Israelitischen
Oberkirchenbehörde Herr Dr. Berthold Einstein aus Ulm,
längere Zeit Rabbinatsverweser in Halle an der Saale, mit der Führung
der sämtlichen Rabbinatsgeschäfte betraut." |
| |
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. April 1889: "Man schreibt aus Heilbronn, 22. März. An
Stelle des auf sein Ansuchten auf unbestimmte Zeit beurlaubten Herrn
Rabbiners Dr. Engelbert hier wurde von der Israelitischen
Oberkirchenbehörde Herr Dr. Berthold Einstein aus Ulm,
Zögling des Rabbinerseminars in Breslau und längere Zeit
Rabbinatsverweser in Halle an der Saale, mit der Führung der
Rabbinatsgeschäfte betraut." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. April 1889: "Man schreibt aus Heilbronn, 22. März. An
Stelle des auf sein Ansuchten auf unbestimmte Zeit beurlaubten Herrn
Rabbiners Dr. Engelbert hier wurde von der Israelitischen
Oberkirchenbehörde Herr Dr. Berthold Einstein aus Ulm,
Zögling des Rabbinerseminars in Breslau und längere Zeit
Rabbinatsverweser in Halle an der Saale, mit der Führung der
Rabbinatsgeschäfte betraut." |
Ausschreibung der Stelle eines Religionslehrers mit
rabbinischer Autorisation (1889)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 8. Oktober 1889: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 8. Oktober 1889: |
Unzufriedenheit in der Gemeinde auf Grund der langen
Krankheitszeit des Bezirksrabbiners (1890)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 2. Juni 1890: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 2. Juni 1890: |
Rabbiner Dr. Berthold Einstein wird zum stellvertretenden Rabbiner, nach dem Tod
von Rabbiner Dr. Engelbert zum Rabbinatsverweser ernannt
(1890)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. September 1890: "Der bisherige Rabbinatsverweser Herr
Dr. Bernhard Einstein aus Ulm ist neben dem an der Ausübung seiner
Amtsfunktionen verhinderten Herrn Dr. Engelbert zum stellvertretenden
Rabbiner von Heilbronn ernannt worden." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. September 1890: "Der bisherige Rabbinatsverweser Herr
Dr. Bernhard Einstein aus Ulm ist neben dem an der Ausübung seiner
Amtsfunktionen verhinderten Herrn Dr. Engelbert zum stellvertretenden
Rabbiner von Heilbronn ernannt worden." |
| |
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 12. Februar 1891: "Heilbronn am Neckar, 6.
Februar (1891). Durch Erlass der königlichen israelitischen
Oberkirchenbehörde wurde Herr Dr. Berthold Einstein, der
seitherige Vertreter des seligen Rabbiners, als Rabbinatsverweser für den
hiesigen Rabbinatsbezirk bestellt." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 12. Februar 1891: "Heilbronn am Neckar, 6.
Februar (1891). Durch Erlass der königlichen israelitischen
Oberkirchenbehörde wurde Herr Dr. Berthold Einstein, der
seitherige Vertreter des seligen Rabbiners, als Rabbinatsverweser für den
hiesigen Rabbinatsbezirk bestellt." |
Zum Tod von Rabbiner Dr. Moses Engelbert
(1891)
 Artikel
in der
"Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Januar 1891: "Heilbronn,
18. Januar (1891). Gestern Abend verschied nach schwerem Leiden der
hochgeachtete Rabbiner Dr. Moses Engelbert im Alter von 60 Jahren. Er ist
geboren in Gudensberg (statt Gutenberg) bei Kassel und war vorher
Rabbiner in Kolberg, Waren und seit 1863 in hiesigem Rabbinatsbezirk.
Schon seit mehreren Jahren leidend, wurde ihm als Hilfsgeistlicher Dr. B.
Einstein aus Ulm beigegeben. Das Andenken des Dahingeschiedenen wird hier
in in weiteren Kreisen ein gesegnetes
bleiben". Artikel
in der
"Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Januar 1891: "Heilbronn,
18. Januar (1891). Gestern Abend verschied nach schwerem Leiden der
hochgeachtete Rabbiner Dr. Moses Engelbert im Alter von 60 Jahren. Er ist
geboren in Gudensberg (statt Gutenberg) bei Kassel und war vorher
Rabbiner in Kolberg, Waren und seit 1863 in hiesigem Rabbinatsbezirk.
Schon seit mehreren Jahren leidend, wurde ihm als Hilfsgeistlicher Dr. B.
Einstein aus Ulm beigegeben. Das Andenken des Dahingeschiedenen wird hier
in in weiteren Kreisen ein gesegnetes
bleiben". |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Februar 1891: "Heilbronn,
17. Januar (1891). Allgemeine Teilnahme findet die Kunde von dem gestern
Abend halb 8 Uhr erfolgten Tode des Herrn Rabbiners Dr. Moses Engelbert.
Die hiesige israelitische Gemeinde verliert an ihm einen begabten,
hochgeachteten Prediger und Religionslehrer, der auch in den weiteren
Kreisen der Einwohnerschaft wegen seiner Herzensgüte und seines
ausgezeichneten Charakters, verbunden mit liebenswürdigen Umgangsformen,
allgemein geschätzt und verehrt wurde. Der Verstorbene erreichte ein
Alter von 60 Jahren; er war geboren in Gudensberg (statt Gutenberg)
bei Kassel, wurde nach beendetem Studium Rabbiner in Kolberg, dann in
Waren (Mecklenburg-Schwerin), hierauf in Lehrensteinsfeld und zuletzt,
1863 nach Selbständigmachung der israelitischen Kirchengemeinde, hier in
Heilbronn. Schon seit mehreren Jahren leidend, musste er noch den Schmerz
erfahren, dass ein hoffnungsvoller Sohn und eine verheiratete Tochter vor
ihm aus dem Leben schieden. Dies trug mit dazu bei, dass sich sein
körperliches Leiden verschlimmerte, bis endlich gestern die Auflösung
eintrat." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Februar 1891: "Heilbronn,
17. Januar (1891). Allgemeine Teilnahme findet die Kunde von dem gestern
Abend halb 8 Uhr erfolgten Tode des Herrn Rabbiners Dr. Moses Engelbert.
Die hiesige israelitische Gemeinde verliert an ihm einen begabten,
hochgeachteten Prediger und Religionslehrer, der auch in den weiteren
Kreisen der Einwohnerschaft wegen seiner Herzensgüte und seines
ausgezeichneten Charakters, verbunden mit liebenswürdigen Umgangsformen,
allgemein geschätzt und verehrt wurde. Der Verstorbene erreichte ein
Alter von 60 Jahren; er war geboren in Gudensberg (statt Gutenberg)
bei Kassel, wurde nach beendetem Studium Rabbiner in Kolberg, dann in
Waren (Mecklenburg-Schwerin), hierauf in Lehrensteinsfeld und zuletzt,
1863 nach Selbständigmachung der israelitischen Kirchengemeinde, hier in
Heilbronn. Schon seit mehreren Jahren leidend, musste er noch den Schmerz
erfahren, dass ein hoffnungsvoller Sohn und eine verheiratete Tochter vor
ihm aus dem Leben schieden. Dies trug mit dazu bei, dass sich sein
körperliches Leiden verschlimmerte, bis endlich gestern die Auflösung
eintrat." |
Rabbiner Ludwig Kahn aus Laupheim wird zum Rabbiner in Heilbronn
ernannt (1892)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 10. März 1892: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 10. März 1892: |
| |
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. April
1892: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. April
1892: |
| |
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. Mai 1892: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. Mai 1892: |
Für
die Nachfolge von Dr. Engelbert gibt es mehrere Bewerbungen (1892)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 22. April 1892: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 22. April 1892: |
Abschiedsfeier für Rabbinatsverweser Dr. Berthold Einstein -
Willkommensfeier für Rabbiner Ludwig Kahn (1892)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 27. Juni 1892: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 27. Juni 1892: |
Zum Tod von Rabbiner Ludwig Kahn (1914)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 16. Oktober 1914: "Heilbronn. Rabbiner L.
Kahn ist plötzlich verschieden. Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 16. Oktober 1914: "Heilbronn. Rabbiner L.
Kahn ist plötzlich verschieden.
Er war ein Mann von feiner Bildung und vornehmer Gesinnung und erfreute
sich auch bei der nichtjüdischen Bevölkerung hoher Wertschätzung. Die
'Neckar-Zeitung' würdigt ihn in einem ausführlichen, sehr sympathisch
gehaltenen Nachruf. Sie nennt ihn u.a. einen 'Mann des Friedens, der ein
Kenner und Genießer guter Dichtung und Musik war und lebhaftes Empfinden
für den Ausgleich sozialer Gegensätze, für die Aufgaben der politischen
Erziehung besaß.'
Auf dem Friedhofe hatten sich wohl
alle Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die amtlichen Vertreter des
Bezirks und der Stadt, die Geistlichkeit usw. eingefunden. Es sprachen Rabbiner
Dr. Eschelbacher - Düsseldorf, Kaufmann Scheuer (für
israelitisches Kirchenvorsteheramt), Rechtsanwalt Nördlinger -
Stuttgart (für israelitische Oberkirchenbehörde), Köstlin (für
die Stadt) usw." |
| |
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 30. Oktober 1914: "Heilbronn, 21. Oktober (1914). Unsere
Gemeinde beklagt den unerwartet schnellen Verlust ihres langjährigen
Rabbiners. Bezirksrabbiner Ludwig Kahn ist in der Nacht von Freitag
auf Samstag an einem Herzschlage plötzlich verschieden, nachdem er noch
Freitagabend, wie immer, in der Synagoge gewesen war. Die Beerdigung fand
noch kurz vor Schmini
Azereth am Sonntagnachmittag 4 Uhr statt. Der Lehrer der Gemeinde
gab als erster Redner dem Schmerz der Gemeinde Ausdruck, die großen
Verdienste des Verblichenen hervorhebend. Im Namen der Familie sprach Rabbiner
Dr. Eschelbacher (Düsseldorf) als Schwiegersohn in ergreifenden, aus
der Tiefe des Herzens kommenden Worten. Es sprachen ferner ein Vertreter
des israelitischen Kirchenrates für Württemberg, ein Vertreter der
Bezirksgemeinden, der Vorsteher der Gemeinde Heilbronn, ein Vertreter der
städtischen Behörden, die Vorsteher der verschiedenen Vereine, ein
Vertreter der Loge Benei Brith, der Inspektor des israelitischen
Waisenhauses und als letzter ein jüdischer Feldwebel in Uniform, der
schon im Feld gestanden und leicht verwundet worden ist, um im Namen
seiner Kameraden, von denen etwa 100 der Beerdigung beiwohnten, dem
Verstorbenen zu danken für seine herzliche Teilnahme an dem Geschick der
Krieger, die in dieser schweren Zeit mehr als je des Trostes der Religion
bedürfen. Alle Redner schilderten den schlichten, bescheidenen und
friedliebenden Charakter des Entschlafenen, der ein wahrer Verkünder
echter Religiosität gewesen und seine Lehre mit seinem Leben in
wahrhaftester Weise bekundet hat. Die Beteiligung war trotz der Nähe des
Feiertages eine sehr große, die Zöglinge des Waisenhauses und die
Uniformen der Soldaten gaben der Trauerversammlung ein eigenes Gepräge.
Von der hohen Achtung, die der Verstorbene in der Stadt genoss, zeugen die
bei der Trauerfamilie eingegangenen Schreiben der Geistlichkeit, des
Bürgermeisters, der Schuldirektoren und vieler einzelner. - Rabbiner
Ludwig Kahn, 1845 in Baisingen
(Württemberg) geboren, besuchte 1865 bis 1870 das Breslauer
Rabbinerseminar, wurde 1870 Rabbinatsadjunkt in Stuttgart, 1877 Rabbiner
in Laupheim, 1892 Bezirksrabbiner in Heilbronn.
Er war eine Zierde des Rabbinerstandes und hat zur Ehre des Judentums in
einem langen, reichgesegneten Leben gewirkt." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 30. Oktober 1914: "Heilbronn, 21. Oktober (1914). Unsere
Gemeinde beklagt den unerwartet schnellen Verlust ihres langjährigen
Rabbiners. Bezirksrabbiner Ludwig Kahn ist in der Nacht von Freitag
auf Samstag an einem Herzschlage plötzlich verschieden, nachdem er noch
Freitagabend, wie immer, in der Synagoge gewesen war. Die Beerdigung fand
noch kurz vor Schmini
Azereth am Sonntagnachmittag 4 Uhr statt. Der Lehrer der Gemeinde
gab als erster Redner dem Schmerz der Gemeinde Ausdruck, die großen
Verdienste des Verblichenen hervorhebend. Im Namen der Familie sprach Rabbiner
Dr. Eschelbacher (Düsseldorf) als Schwiegersohn in ergreifenden, aus
der Tiefe des Herzens kommenden Worten. Es sprachen ferner ein Vertreter
des israelitischen Kirchenrates für Württemberg, ein Vertreter der
Bezirksgemeinden, der Vorsteher der Gemeinde Heilbronn, ein Vertreter der
städtischen Behörden, die Vorsteher der verschiedenen Vereine, ein
Vertreter der Loge Benei Brith, der Inspektor des israelitischen
Waisenhauses und als letzter ein jüdischer Feldwebel in Uniform, der
schon im Feld gestanden und leicht verwundet worden ist, um im Namen
seiner Kameraden, von denen etwa 100 der Beerdigung beiwohnten, dem
Verstorbenen zu danken für seine herzliche Teilnahme an dem Geschick der
Krieger, die in dieser schweren Zeit mehr als je des Trostes der Religion
bedürfen. Alle Redner schilderten den schlichten, bescheidenen und
friedliebenden Charakter des Entschlafenen, der ein wahrer Verkünder
echter Religiosität gewesen und seine Lehre mit seinem Leben in
wahrhaftester Weise bekundet hat. Die Beteiligung war trotz der Nähe des
Feiertages eine sehr große, die Zöglinge des Waisenhauses und die
Uniformen der Soldaten gaben der Trauerversammlung ein eigenes Gepräge.
Von der hohen Achtung, die der Verstorbene in der Stadt genoss, zeugen die
bei der Trauerfamilie eingegangenen Schreiben der Geistlichkeit, des
Bürgermeisters, der Schuldirektoren und vieler einzelner. - Rabbiner
Ludwig Kahn, 1845 in Baisingen
(Württemberg) geboren, besuchte 1865 bis 1870 das Breslauer
Rabbinerseminar, wurde 1870 Rabbinatsadjunkt in Stuttgart, 1877 Rabbiner
in Laupheim, 1892 Bezirksrabbiner in Heilbronn.
Er war eine Zierde des Rabbinerstandes und hat zur Ehre des Judentums in
einem langen, reichgesegneten Leben gewirkt." |
Brief
von Bruno Kahn (Sohn von Rabbiner Ludwig Kahn) an seinen inzwischen verstorbenen
Vater aus der Kriegsgefangenschaft (1914)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. November 1914: "Zürich, 30. Oktober (1914).
Das hier erscheinende 'Israelitische Wochenblatt' veröffentlicht in Nr.
43 folgenden Brief eines jüdischen Kriegsgefangenen aus England. Der
Brief, in englischer Sprache geschrieben, ist von Herrn Bruno Kahn an
seinen inzwischen verstorbenen Vater, Rabbiner Kahn in Heilbronn
gerichtet.
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. November 1914: "Zürich, 30. Oktober (1914).
Das hier erscheinende 'Israelitische Wochenblatt' veröffentlicht in Nr.
43 folgenden Brief eines jüdischen Kriegsgefangenen aus England. Der
Brief, in englischer Sprache geschrieben, ist von Herrn Bruno Kahn an
seinen inzwischen verstorbenen Vater, Rabbiner Kahn in Heilbronn
gerichtet.
Frith Hill, Camp Frimley.
'Sieben Tage sollt ihr in Hütten wohnen.' Wie oft habe ich an diesen Satz
kürzlich denken müssen: denn schon seit Ende August wohne ich hier mit
Hunderten von deutschen kriegsgefangenen Leidensgenossen in Hütten oder
vielmehr Zelten. Es sind meistens Männer in militärpflichtigem Alter,
die von der englischen Regierung an der Abreise verhindert worden sind.
Ein großer Teil derselben wurde zuerst nach Olympia gebracht, einem
ungeheuren zirkusartigen Gebäude, in dem sonst Ausstellungen, Pferderennen
usw. abgehalten zu werden pflegen. Später wurden wir alle hierher transportiert,
in ein großes Zeltlager, das durch Stacheldrahtzäune von der Außenwelt
geschieden ist. Über die Behandlung und Verpflegung können wir uns nicht
beklagen. Es gereicht mir zur ganz besonderen Freude, Euch mitteilen zu
können, dass den jüdischen Kriegsgefangenen die Erlaubnis erteilt wurde,
den 'Jom Kippur' den Traditionen unseres Glaubens gemäß zu feiern. Ein
großes Zelt wurde für den Gottesdienst bereitgestellt, und ein junger
Rabbiner, Reverend L. Morris, kam speziell von London, um den Gottesdienst
zu leiten. Wir waren im ganzen 26 Juden, und Ihr könnt Euch leicht
denken, wie wir uns alle fühlten unter diesen Verhältnissen. Während
der 'Maskir neschomaus' und 'Unesaneh-Taukef'-Gebete blieb kein Auge
trocken. Die Londoner Synagogenhauptgemeinde versorgte uns mit
Gebetbüchern und Talesim, die wir zum Andenken behalten dürfen. Ich kann
Euch versichern, keiner von uns wird je diesen 'Jom Kippur' vergessen, und
wenn wir auch 100 Jahre alt werden sollten. Die wachthabenden Offiziere
und alle anderen Gefangenen behandelten uns während des Feiertags
mit dem größten Respekt, ja, mit ganz besonderer Höflichkeit, und es
gereichte mir zur großen Genugtuung, dass zwei jüdische Soldaten, die in
Frankreich von den englischen Truppen zu Kriegsgefangenen gemacht wurden,
die Erlaubnis bekamen, in unser Lager hinüber zu kommen, um am
Gottesdienst teilzunehmen. Die Namen derselben sind B. Seelig aus
Vennebeck, Minden in Westfalen und Hermann Baehr aus Haaren (sc.
Stadtteil von Bad Wünnenberg), Kreis Büren. Zum Anbeißen hatten wir
Kaffee, Heringe und Butterbrot - ganz wie zu Hause - und später Suppe,
Braten, Obst und eine lang entbehrte Zigarette." |
| Sc. obiger Brief findet sich auch in
einer Seite
der Website lexikus.de - Kriegsbriefe deutscher und österreichischer
Juden 1914-1918. |
Rabbiner Dr. Max Beermann ist auf das Rabbinat Heilbronn
ernannt worden (1915)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 11. März 1915: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 11. März 1915: |
Gedanken zum Chanukkafest von Rabbiner Dr. Max Beermann
(1919)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. Dezember 1919: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. Dezember 1919: |

|
Publikation von Rabbiner Dr. Max Beermann
(1927)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 1. September 1927: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 1. September 1927: |
Rabbiner der
Israelitischen Religionsgesellschaft
Amtseinführung von Dr. Jonas Ansbacher als Rabbiner der
Israelitischen Religionsgesellschaft (1911)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 13. Juli 1911: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 13. Juli 1911: |
Ausschreibung der Stelle eines Rabbiners für die
Israelitische Religionsgesellschaft (1920)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 10. Juni 1920: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 10. Juni 1920: |
Rabbiner Dr. Gerson Feinberg wird als Nachfolger von Rabbiner Jonas Ansbacher Rabbiner der Religionsgesellschaft "Adas Jeschurun"
(1920)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 23. Dezember 1920: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 23. Dezember 1920: |
Ausschreibung der Rabbinerstelle der Israelitischen
Religionsgesellschaft (1921)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 5. Mai 1921: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 5. Mai 1921: |
Dr. Benno Cohen wird zum Rabbiner der Israelitischen
Religionsgesellschaft gewählt (1921)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 9. Juni 1921: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 9. Juni 1921: |
Aus
der Geschichte der jüdischen Lehrer, Vorbeter und weiterer Kultusbeamten sowie
der Schule
Ausschreibung
der Religionslehrer- und Vorsängerstelle (1862)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. März 1862: Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. März 1862:
"Erledigte Religionslehrer- und Vorsängerstelle.
Die Stelle eines Religionslehrers und Vorsängers, der zugleich auch
geprüfter Schächter sein muss, ist demnächst hierorts definitiv zu
besetzen. Mit dieser Stelle ist ein bares Fix-Gehalt von 350 Gulden und
ein Mietgeldaversum von 110 Gulden jährlich nebst den gesetzlichen
Emolumenten verbunden. Befähigte Bewerber haben ihre Gesuche mit den
Zeugnissen innerhalb 3 Wochen hierher franco einzusenden,
erforderlichenfalls zu einem Probevortrag sich einzufinden und
ausländische Bewerber einer Prüfung bei der königlichen israelitischen
Oberkirchenbehörde sich zu unterziehen.
Heilbronn am Neckar, den 20. Februar 1862. Das israelitische
Kirchenvorsteheramt. In dessen Namen: Weimann, k.
Rabbiner." |
Anzeige
von Lehrer Jacob Löwenstein (1863)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 15. September 1863: "Hauslehrer-Stelle. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 15. September 1863: "Hauslehrer-Stelle.
Für eine Familie in einer württembergischen Oberamtsstadt am Neckar wird
ein jüdischer Hauslehrer und Erzieher für mehrere Kinder
gesucht. Derselbe müsste wesentlich im Hebräischen und in der Religion
überhaupt zu unterrichten verstehen. Neben völlig freier Station im
Hause würde ein anständiges Salair gegeben und die Reisekosten dahin
vergütet werden. Leistungsfähigkeit im kaufmännischen Fache würde dem
Bewerber zur Empfehlung dienen.
Reflektanten wollen sich sofort in portofreien Briefen wenden
an
Lehrer Löwenstein in Heilbronn am
Neckar." |
Lehrer
Jakob Löwenstein wirbt für seine Schülerpension (1868 / 1869)
Anmerkung: Jakob Löwenstein (geb. 26. Dezember 1819 in Bonfeld,
gest. 15. Januar 1884 in Heilbronn) studierte 1835 bis 1838 am
Lehrerseminar in
Esslingen. Er war 1838 bis 1841 Lehrer in Gerabronn, 1841 bis 1844 in
Korb,
danach in Oedheim,
Weikersheim,
Hohebach und von 1856 bis 1862 in
Oberdorf. Er
bewarb sich erfolgreich auf die obige Ausschreibung der Stelle in Heilbronn, wo
er bis 1882 als Lehrer tätig geblieben ist. Er war seit 30. April 1850 (in
Oedheim) verheiratet mit Dinah geb.
Stern (geb. 6. Oktober 1826 in Oedheim, gest.
22. April 1882 in
Heilbronn). Das Ehepaar hatte zehn Kinder, von denen drei früh verstorben sind.
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 17. Juni 1868: "Heilbronn am Neckar. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 17. Juni 1868: "Heilbronn am Neckar.
Der Unterzeichnete ist durch Veränderungen in seinen
Familienverhältnissen jetzt oder im Herbst dieses Jahres in der Lage,
Zöglinge, welche hier die Kaufmannschaft erlernen oder das Gymnasium oder
die Oberrealschule besuchten wollen, in Pension zu nehmen und deren
Hausarbeiten und religiös-sittliche Erziehung zu überwachen.
Lehrer Löwenstein." |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 29. September 1869: "Heilbronn am Neckar. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 29. September 1869: "Heilbronn am Neckar.
Das neue Schuljahr im hiesigen Königlichen Gymnasium und in der
Königlichen Realanstalt beginnt mit der Prüfung der neu eintretenden
Schüler am Donnerstag den 14. Oktober dieses Jahres. - Der Unterzeichnete
ist durch veränderte Familienverhältnisse und den Austritt etlicher
Zöglinge in der Lage wieder einige Pensionäre anzunehmen, welche außer
Kost und Logis auch Anleitung in ihren häuslichen Arbeiten und eine
wünschenswerte Aufsicht über ihr religiös-sittliches Betragen finden
würden.
Löwenstein, israelitischer Lehrer und Vorsänger." |
Ausschreibung
der Stelle des zweiten Vorsängers und Religionslehrers (1873)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 24. Juni 1873: Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 24. Juni 1873: |
Lehrer
Moritz Dreifus wirbt für seine Schülerpension
(1878)
 Anmerkung: Moritz (Moses) Dreifus (geb. 1848 in Richen, Baden, gest. 1924 in
Heilbronn): er unterstützte bereits seit 1873 (vgl. 40-jähriges
Ortsjubiläum 1913, s.u.) den erkrankten Lehrer Löwenstein
bei der Erfüllung seiner Dienstpflichten; 1885 wurde er definitiv angestellt.
Über Jahrzehnte war er Lehrer und Vorsänger in Heilbronn. Er war verheiratet
mit Karoline geb. Löwenthal aus Talheim. Anmerkung: Moritz (Moses) Dreifus (geb. 1848 in Richen, Baden, gest. 1924 in
Heilbronn): er unterstützte bereits seit 1873 (vgl. 40-jähriges
Ortsjubiläum 1913, s.u.) den erkrankten Lehrer Löwenstein
bei der Erfüllung seiner Dienstpflichten; 1885 wurde er definitiv angestellt.
Über Jahrzehnte war er Lehrer und Vorsänger in Heilbronn. Er war verheiratet
mit Karoline geb. Löwenthal aus Talheim. |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 21. August 1878: "Pension. Israelitische Knaben, Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 21. August 1878: "Pension. Israelitische Knaben,
welche die hiesigen vorzüglichen Lehranstalten besuchen wollen, finden zu
Beginn des neuen Schuljahres (15. Oktober) in meinem Hause Kost und Logis,
elterliche Pflege und Beaufsichtigung bei ihren Hausaufgaben gegen
mäßiges Honorar. Alles Weitere brieflich.
Heilbronn am Neckar, August 1878. M. Dreifus,
Lehrer." |
Beisetzung des Oberlehrers Jakob Löwenstein (1884)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. Februar 1884: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. Februar 1884: |
Ausschreibungen der Stelle des
zweiten Religionslehrers (1884 / 1886)
Anmerkung: die Ausschreibung erfolgte nach der Zurruhesetzung von Lehrer
Jakob Löwenstein. Moritz Dreifus (s.u.) wurde erster Lehrer und Vorsänger in
der jüdischen Gemeinde Heilbronn; ihm wurde ein zweiter Religionslehrer
zugeteilt.
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 11. Februar 1884: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 11. Februar 1884: |
| |
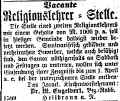 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 8. März 1886: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 8. März 1886: |
Ausschreibung der Stelle des
zweiten Lehrers, Vorbeters und
Schochet (1901)
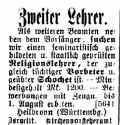 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 18. Juli 1901: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 18. Juli 1901: |
| |
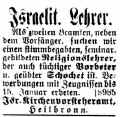 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 16. Dezember 1901: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 16. Dezember 1901: |
40-jähriges Ortsjubiläum von Kantor und Lehrer
Moritz Dreifus (1913)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 31. Dezember 1913: "Heilbronn. Kantor und Lehrer Moritz
Dreyfus (Dreifus) feiert am 1. Januar sein 40-jähriges Jubiläum als
Beamter der hiesigen jüdischen Gemeinde. Herr Dreyfus ist ein
hervorragender Chason (Kantor), ein tüchtiger Lehrer und ein seelenguter
Mensch, dem die Erfüllung von Liebestätigkeiten stets höchste Aufgabe
war." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 31. Dezember 1913: "Heilbronn. Kantor und Lehrer Moritz
Dreyfus (Dreifus) feiert am 1. Januar sein 40-jähriges Jubiläum als
Beamter der hiesigen jüdischen Gemeinde. Herr Dreyfus ist ein
hervorragender Chason (Kantor), ein tüchtiger Lehrer und ein seelenguter
Mensch, dem die Erfüllung von Liebestätigkeiten stets höchste Aufgabe
war." |
Ausschreibung
der Stelle eines Rabbiners oder Lehrers bei der
Israelitischen Religionsgesellschaft (1922)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 26. Oktober 1922: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 26. Oktober 1922: |
Ausschreibung der Stelle des Synagogenverwalters und
Schochet (1923)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 16. August 1923: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 16. August 1923: |
Oberlehrer
und Kantor Isy Krämer (Lehrer in Heilbronn von 1903 bis 1939)
 Oberlehrer
Isy Krämer (geb. 9. August 1877 in Mönchsroth,
gest. 16. April 1963 in Brooklyn): wirkte seit 1903 36 Jahre lang als
Lehrer und Vorsänger in Heilbronn. Er erteilte den Unterricht an den
höheren Schulen und später auch am Lehrerseminar zusammen mit dem
jeweiligen Rabbiner. Er war nebenher Musikkritiker (u.a. in der
"Heilbronner Zeitung" und bei der "Neckar-Zeitung"),
war zeitweise in der Theaterkommission des Gemeinderates der Stadt
Heilbronn. Nach 1933 hat er sich um die Auswanderung seiner
Glaubensgenossen Verdienste erworben. Er selbst emigrierte 1939 nach Frankreich,
später nach Amerika. Er war verheiratet mit Julie geb. Würzburger (geb.
12. April 1888 in Heilbronn). Krämer war eng befreundet mit dem späteren
Bundespräsidenten Dr. Theodor Heuss. Oberlehrer
Isy Krämer (geb. 9. August 1877 in Mönchsroth,
gest. 16. April 1963 in Brooklyn): wirkte seit 1903 36 Jahre lang als
Lehrer und Vorsänger in Heilbronn. Er erteilte den Unterricht an den
höheren Schulen und später auch am Lehrerseminar zusammen mit dem
jeweiligen Rabbiner. Er war nebenher Musikkritiker (u.a. in der
"Heilbronner Zeitung" und bei der "Neckar-Zeitung"),
war zeitweise in der Theaterkommission des Gemeinderates der Stadt
Heilbronn. Nach 1933 hat er sich um die Auswanderung seiner
Glaubensgenossen Verdienste erworben. Er selbst emigrierte 1939 nach Frankreich,
später nach Amerika. Er war verheiratet mit Julie geb. Würzburger (geb.
12. April 1888 in Heilbronn). Krämer war eng befreundet mit dem späteren
Bundespräsidenten Dr. Theodor Heuss. |
Oberlehrer
Isy Krämer wurde als Mitglied der Theaterkommission der Stadt gewählt (1929)
 Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"
vom 15. Februar 1929: "Heilbronn. (Aus dem Gemeindeleben).
Der neugewählte Gemeinderat hiesiger Stadt hat am 24. Januar in seiner
ersten Sitzung den Oberlehrer Isy Krämer unserer jüdisch-liberalen
Gemeinde als Mitglieder der Theaterkommission gewählt. Kurz vorher wurde
er vom Oberbürgermeister Herrn Prof. Bentinger aufgefordert, in das im
Navi Verlag erschienene Stadtbuch über das Heilbronner Musikleben einen
Beitrag zu liefern, dem Wunsche er auch nachkam." Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"
vom 15. Februar 1929: "Heilbronn. (Aus dem Gemeindeleben).
Der neugewählte Gemeinderat hiesiger Stadt hat am 24. Januar in seiner
ersten Sitzung den Oberlehrer Isy Krämer unserer jüdisch-liberalen
Gemeinde als Mitglieder der Theaterkommission gewählt. Kurz vorher wurde
er vom Oberbürgermeister Herrn Prof. Bentinger aufgefordert, in das im
Navi Verlag erschienene Stadtbuch über das Heilbronner Musikleben einen
Beitrag zu liefern, dem Wunsche er auch nachkam." |
Oberlehrer
und Kantor Karl Kahn (Lehrer in Heilbronn bis 1941)
| Karl Kahn (geb. 26. Dezember 1890 in Hollenbach,
umgekommen in Auschwitz): studierte von 1905 bis 1908 am Lehrerseminar in
Esslingen; war zunächst (bereits um 1922) Lehrer in Stuttgart, ab 1924 bis 1941 in Heilbronn; wurde 1942 von Stuttgart aus nach Theresienstadt
deportiert, Transportleiter mit Theodor Rothschild; von dort 1944 nach
Auschwitz, wo er und seine Frau Rita geb. Meyer (geb. 1906 in
Bibra)
ermordet wurden. http://stolpersteine-heilbronn.de/list/wollhausstr-40.html |
Lehrer Karl Kahn, Sohn von Hirsch Kahn in Hohebach,
wurde im Krieg mit dem Eisernen Kreuz I ausgezeichnet (1918)
Anmerkung: Der im Text genannte Handelsmann Hirsch Kahn ist am 17. Juli 1849 in
Hollenbach geboren als Sohn des Handelsmannes Abraham Kahn und der Sara geb.
Hess. Er heiratete am 15. Mai 1873 in Mergentheim Malchen geb. Neumann, eine am
8. Juli 1851 in Nagelsberg geborene Tochter des Hirsch Neumann und der Mina geb. Feldenheimer. Die beiden hatten zehn Kinder, von denen zwei früh verstorben
sind. Hirsch Kahn verzog (mit Frau und vermutlich noch einem Teil der Kinder) im
Jahr 1900 nach Hohebach. Der Sohn Karl Kahn ist 1890 noch in Hollenbach
geboren, studierte 1905 bis 1908 am Lehrerseminar Esslingen, war zunächst Lehrer
in Stuttgart, ab 1924 in Heilbronn. Er wurde in Auschwitz ermordet, nachdem er
1942 nach Theresienstadt deportiert wurde, vgl. http://stolpersteine-heilbronn.de/list/wollhausstr-40.html.
 Artikel im "Israelitischen
Familienblatt" vom 5. September 1918: "Jüdische Ritter des
Eisernen Kreuzes erster Klasse. 1. Leutnant Oskar Herz
(inzwischen gefallen). Sohn des Lehrers Herrn Joseph Herz,
Ittlingen. 2. Vizefeldwebel
Albert Grünebaum, Sohn des Herrn Heinrich Grünebaum, Offenbach-Bürgel.
3. Flugzeugführer Unteroffizier Siegfried Heimann, Sohn der Witwe
Frau Clothilde Heimann.
Oberdorf-Bopfingen. 4. Oberarzt Dr. Philipp Roos, Düsseldorf.
5. Feldhilfsarzt Walter Röttgen. Sohn des verstorbenen Herrn N. L.
Röttgen, Wattenscheid. 6. Gefreiter Kurt Horwitz, Sohn des
Metzgermeisters Herrn Sally Horwitz, Bünde i. W. 7.
Flieger-Unteroffizier Hans Lustig, Sohn des Herr Simon Lustig,
Radzionskau Oberschlesien. 8. Unteroffizier E. Unger, Sohn des
Sanitätsrats Herrn Dr. Unger, Kurnik i. Posen. 11. Leutnant der
Reserve Emil Kraemer, Sohn des Kantors Herrn Simon Krämer,
Ansbach in Bayern. 16. Leutnant
Kurt Eichenberg, Sohn des verstorbenen Getreidehändlers Herrn Siegfried
Eichenberg, Göttinqen. 11. Leutnant der Reserve Karl J. Kahn,
Lehrer und Kantor in Stuttgart, Sohn des Herrn Hirsch Kahn, Hohebach.
12. Feldhilfs- und stellvertretender Bataillonsarzt August Watermann,
Sohn des Herrn S. Watermann, Marienhafe Ostfriesland. 14. Stabs- und
Regimentsarzt Dr. Julius Peiser, Sohn des Herrn Alex Peiser, Posen.
15. Vizewachtmeister Assessor Friedrich Caro, Sohn des Herrn
Siegfried Caro, Berlin. 16. Vizefeldwebel und Offiziersaspirant
Ernst Löwenstein, Sohn des Mühlenbesitzers Herr Felix Löwenstein,
Steinheim in Westfalen". Artikel im "Israelitischen
Familienblatt" vom 5. September 1918: "Jüdische Ritter des
Eisernen Kreuzes erster Klasse. 1. Leutnant Oskar Herz
(inzwischen gefallen). Sohn des Lehrers Herrn Joseph Herz,
Ittlingen. 2. Vizefeldwebel
Albert Grünebaum, Sohn des Herrn Heinrich Grünebaum, Offenbach-Bürgel.
3. Flugzeugführer Unteroffizier Siegfried Heimann, Sohn der Witwe
Frau Clothilde Heimann.
Oberdorf-Bopfingen. 4. Oberarzt Dr. Philipp Roos, Düsseldorf.
5. Feldhilfsarzt Walter Röttgen. Sohn des verstorbenen Herrn N. L.
Röttgen, Wattenscheid. 6. Gefreiter Kurt Horwitz, Sohn des
Metzgermeisters Herrn Sally Horwitz, Bünde i. W. 7.
Flieger-Unteroffizier Hans Lustig, Sohn des Herr Simon Lustig,
Radzionskau Oberschlesien. 8. Unteroffizier E. Unger, Sohn des
Sanitätsrats Herrn Dr. Unger, Kurnik i. Posen. 11. Leutnant der
Reserve Emil Kraemer, Sohn des Kantors Herrn Simon Krämer,
Ansbach in Bayern. 16. Leutnant
Kurt Eichenberg, Sohn des verstorbenen Getreidehändlers Herrn Siegfried
Eichenberg, Göttinqen. 11. Leutnant der Reserve Karl J. Kahn,
Lehrer und Kantor in Stuttgart, Sohn des Herrn Hirsch Kahn, Hohebach.
12. Feldhilfs- und stellvertretender Bataillonsarzt August Watermann,
Sohn des Herrn S. Watermann, Marienhafe Ostfriesland. 14. Stabs- und
Regimentsarzt Dr. Julius Peiser, Sohn des Herrn Alex Peiser, Posen.
15. Vizewachtmeister Assessor Friedrich Caro, Sohn des Herrn
Siegfried Caro, Berlin. 16. Vizefeldwebel und Offiziersaspirant
Ernst Löwenstein, Sohn des Mühlenbesitzers Herr Felix Löwenstein,
Steinheim in Westfalen". |
|