|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg
Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis)
Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In dem bis zum Anfang des
19. Jahrhunderts zum Kurfürstentum Mainz gehörenden Walldürn bestand eine jüdische
Gemeinde bereits im Mittelalter. Die Gemeinde wurde von den
Judenverfolgungen 1298, 1335/37 und 1348/49 betroffen und vernichtet. Seit 1378
lebten wiederum einzelne Juden in der Stadt, die zu den neun "oberen Städten"
des Erzbistums Mainz gehörte.
In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts lassen sich gleichfalls Juden
in Walldürn nachweisen. 1470 wurden sie mit den anderen Juden des Erzstiftes
Mainz ausgewiesen.
Die Entstehung der kleinen neuzeitlichen Gemeinde geht in die Zeit des 18.
Jahrhunderts zurück. Seit der Zeit um 1700 erfährt man wieder von jüdischen
Einwohnern. 1713 wird in einer Rechnung des Klosters Amorbach ein Walldürner
Schutzjude genannt. Bis um 1720 waren es jedoch nicht mehr als drei Familien in der
Stadt. Weitere zogen im Laufe des 18. Jahrhunderts zu, sodass es 1783 immerhin
sieben jüdische Haushaltungen waren.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1825 23 jüdische Einwohner (0,8 % von insgesamt 2.798 Einwohnern),
1858 37 und die höchste Zahl im 19. Jahrhundert 1864 mit 38 Personen,
1875 25 (0,8 % von 3.174), 1888 23, 1895 20 (in vier Familien), 1898 15 (in vier
Haushaltungen), 1900 14 jüdische Einwohner, 1903 15 (in vier Haushaltungen, von
insgesamt 3204 Einwohnern). Die jüdischen Einwohner
waren noch um 1830 fast alle Hausierer mit Ellenwaren, nur Isak Nezes Sinsheimer
betrieb ein Ladengeschäft. In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden einige
weitere Geschäfte und Handlungen eröffnet.
Im Revolutionsjahr 1848 kam es zu Ausschreibungen gegen jüdische
Einwohner. Dabei wurde der Laden von Aron Sender demoliert, die Ware auf die
Straße geworfen, Bücher und Handschriften verbrannt, Lebensmittel geraubt und
der Wein an Ort und Stelle ausgetrunken.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge, eine
Religionsschule und ein rituelles Bad (letzteres am Marsbach im Haus Untergasse
31 mit einem ausgemauerten quadratischen Schacht, der bis unter den Spiegel des
Marsbaches reichte, aber auch Wasserzuleitung hatte; das Bad wurde schon vor
1900 nicht mehr benutzt, 1969 zugeschüttet). Um 1887/89 lebte noch der
emeritierte Lehrer M. Hammer in der Gemeinde und erteilte den wenigen jüdischen
Kinder noch den Religionsunterricht. Um 1892/1897 war E. Riselsheimer Kantor
und Schochet der Gemeinde.
Die Toten der Gemeinde wurden im jüdischen
Friedhof in Bödigheim
beigesetzt. 1827 wurde die Gemeinde dem Rabbinatsbezirk Merchingen
zugeteilt, der später vom Bezirksrabbiner in Mosbach
betreut wurde.
Als Gemeindevorsteher werden genannt: um 1892/1894 S. Oppenheimer und W.
Strauß, um 1895 W. Strauß und E. Riselsheimer, um 1897 H. Zimmern, E.
Risselsheimer, um 1903 J. Zimmern.
Um 1924, als 23 jüdische Einwohner in Walldürn (0,6 % von insgesamt
etwa 4.000 Einwohnern) gezählt wurden, war Gemeindevorsteher Isak Riselsheimer.
Auch 1932 war er als Gemeindevorsteher im Amt.
Bis nach 1933 waren im Besitz der (damals nur noch 19) jüdischen
Gemeindeglieder noch folgende Gewerbebetriebe: das Trikotagen- und
Wollwarengeschäft von Sophie Riselsheimer (Hauptstraße 13), das
Eisenwarengeschäft Isak Riselsheimer (Hauptstraße 21) und das Gasthaus zur
"Sonne", Inhaber Eduard Neuberger (Am Plan 3).
In den Jahren nach 1933 ist ein Teil der jüdischen Gemeindeglieder auf
Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Entrechtung und
der Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Auch der letzte
Gemeindevorsteher Isak Riselsheimer verließ mit seiner fünfköpfigen Familie
die Stadt. Zwei der jüdischen Einwohner verstarben vor 1938 in der Stadt. Am 8.
November 1937 wurde die Gemeinde aufgelöst. Am 22. Oktober 1940 wurden die
letzten 10 anwesenden jüdischen Einwohner nach Gurs deportiert. Das Eigentum
der letzten drei jüdischen Familien wurde konfisziert und später versteigert.
Von den in Walldürn geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen
Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Elise Kahn geb.
Riselsheimer (1890), Hubert Kahn (1922), Irene Kahn (1924), Leopold Kahn (1885),
Regine Kahn geb. Zimmern (1867), Sitta Kahn (1925), Eduard Neuberger (1869),
Emil Strauß (1860), David Zimmern (1896), Hugo Zimmern (1898), Leopold Zimmern
(1901), Lydia Zimmern geb. Bloch (1898).
Aus der Geschichte
der jüdischen Gemeinde
Allgemeine
Gemeindebeschreibung (1931)
 Artikel
in "Israelitisches Familienblatt" vom 2. Juli 1931: "Walldürn. 4000
Einwohner, ca. 15 jüdische Seelen. Eine der ältesten jüdischen Gemeinden
Badens, erlebt 1298 die Rindfleischverfolgung, 1349 eine schlimmere, besitzt
1710 schon oder wieder eine Synagoge, wird 1848 von den erwähnten
demokratischen Judenverfolgungen in Mitleidenschaft gezogen. Um 1900 hat die
Gemeinde 20 Seelen und gehört zu Hainstadt,
geht 1913 auf zwölf Seelen zurück, hat aber um 1924 wieder 23 Seelen mit
eigene Gemeinde und Synagoge, aber keinen Beamten. Walldürn ist ein
altertümliches Städtchen mit sehenswertem Heimatmuseum. Wegen ritueller
Verpflegung wende man sich an Vorsteher Riselsheimer. " Artikel
in "Israelitisches Familienblatt" vom 2. Juli 1931: "Walldürn. 4000
Einwohner, ca. 15 jüdische Seelen. Eine der ältesten jüdischen Gemeinden
Badens, erlebt 1298 die Rindfleischverfolgung, 1349 eine schlimmere, besitzt
1710 schon oder wieder eine Synagoge, wird 1848 von den erwähnten
demokratischen Judenverfolgungen in Mitleidenschaft gezogen. Um 1900 hat die
Gemeinde 20 Seelen und gehört zu Hainstadt,
geht 1913 auf zwölf Seelen zurück, hat aber um 1924 wieder 23 Seelen mit
eigene Gemeinde und Synagoge, aber keinen Beamten. Walldürn ist ein
altertümliches Städtchen mit sehenswertem Heimatmuseum. Wegen ritueller
Verpflegung wende man sich an Vorsteher Riselsheimer. " |
Aus der
Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule
Ausschreibungen der Stelle des
Lehrers in Hainstadt mit der Filialgemeinde
Walldürn (1909/1910)
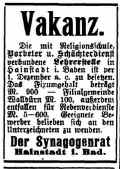 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1909: "Vakanz. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1909: "Vakanz.
Die mit Religionsschule, Vorbeter und Schächterdienst verbundene Lehrerstelle
in Hainstadt in Baden ist per 1. Dezember dieses Jahres zu besetzen. Das
Fixumgehalt beträgt Mark 900 - Filialgemeinde Walldürn Mark 100,
außerdem entfallen für Nebenverdienste Mark 5-600. Geeignete Bewerber
belieben sich an den Unterzeichneten zu wenden.
Der Synagogenrat Hainstadt in Baden." |
|
|
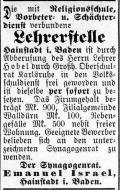 Anzeige
in "Israelitisches Familienblatt" vom 26. Mai 1910: "Die mit
Religionsschule, Vorbeter- und Schächterdienst verbundene Anzeige
in "Israelitisches Familienblatt" vom 26. Mai 1910: "Die mit
Religionsschule, Vorbeter- und Schächterdienst verbundene
Lehrerstellen
Hainstadt in Baden ist durch
Abberufung des Herrn Lehrer Hobel durch Großherzoglichen Oberschulrat
Karlsruhe in den Volksschuldienst frei geworden und ist dieselbe per sofort
zu besetzen. Das Fixumgehalt beträgt Mk. 900, Filialgemeinde Walldürn
Mk. 100, Nebengefälle Mk. 500 nebst freier Wohnung. Geeignete Bewerber
Belieben sich an den unterzeichneten Synagogenrat zu wenden.
Der Synagogenrat.
Emanuel Israel, Hainstadt in Baden." |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Juden in Walldürn schon im 12.
Jahrhundert ? (aus einem Beitrag von Berthold Rosenthal 1935)
 Mitteilung
in "Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judentums" 1935 S.
51: "Zur Germania Judaica. Mitteilung
in "Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judentums" 1935 S.
51: "Zur Germania Judaica.
Unter ... (S. 481, Z. 5) ist weder Trani noch (Szilwas: Juden in Würzburg,
12) Tyrnau zu verstehen, sondern das etwa 50 km von
Würzburg entfernte badische
Walldürn, für das durch Urkunden des 12. Jahrhunderts die Namen Turna
oder Durna bezeugt sind und das mit ... (Mart. 66) identisch wäre. Demnach
hätten im 12. Jahrhundert schon Juden in Walldürn gelebt. Berthold
Rosenthal. " |
Aus dem 18. Jahrhundert
 Aus
einem Artikel im "Magazin für die Wissenschaft des Judentums" 1889 S. 259:
"Geschichtliche und Bibliografische Notizen. Aus
einem Artikel im "Magazin für die Wissenschaft des Judentums" 1889 S. 259:
"Geschichtliche und Bibliografische Notizen.
Von Dr. Leopold Löwenstein in
Mosbach.
Die Durchsicht von Prof. Kaufmanns Monographie 'Letzte Vertreibung der Juden
aus Wien' (Programmbeilage zum Jahresbericht der Pester Rabbinerschule, Pest
1889), eines wertvollen Beitrags zur Geschichte Österreichs und Deutschlands
und ihn so herrlichem Stil geschrieben, wie wir ihn an den gediegenen
Arbeiten des Verfassers gewohnt sind, gibt mir zu folgenden Bemerkungen
Anlass.
...
Daselbst S. 179 Anm. 5 ist Herzfeld-Heizfeld s.v.a.
Heidingsfeld, früher Sitz des
Würzburgischen Rabbinats. Der Herausgeber der Hagada... ist Schlomoh (nicht
Meschullam) Salman. Derselbe war Rabbinats-
|
 ebd.
S. 260: "assessor des Kurmainzischen Kreises und wohnte in Walldürn
(im badischen Odenwald), welches damals zu Kurmainz gehörte. Aus diesem
Grunde nennt sich der Herausgeber ..., was Kaufmann irrtümlich als 'Rabbinatsassessor
von Mainz' auffasst. Ebensowenig war sein Schwiegervater Mainzer Vorsteher,
sondern wohnte in Walldürn. Letzteres ist die richtige Lesung für
..., welches Kaufmann Waltern liest, während Wolf bibl. hebr. III S. 1037
und Steinschneider Cat. Bodl. S. 2397 No. 6983 Voltiran daraus machen.
Walldürn hieß ursprünglich Düren und wird als solches unter den Plätzen, wo
Judenverfolgungen stattfanden, mehrmals im Mainz-Nürnberger, sowie im
Deutzer Memorbuch erwähnt. Obengenannter R. Salomon wurde später Rabbiner in
Bödigheim (unweit Walldürn), wo er in
besonderer Achtung stand und weit über die Grenze seines Rabbinates sich
eines großen Rufs erfreute. In dem im Großherzoglichen Generallandesarchiv
in Karlsruhe befindlichen Archivalien zur Geschichte der Juden in
Heinsheim (am Neckar) wird mitgeteilt,
dass anno 1744 bei einer dort ausgebrochenen Streitsache zwischen
herrschaftlichen Schutzjuden und solchen, die zum Deutschorden gehörten, der
'renommierte 40-jährige (d.h. 40 Jahre amtierende) Rabbiner Salomon Wolf in
Bödigheim' als Schiedsrichter berufen
wurde. Das Bödigheimer Memorbuch ist von ihm anno 1745 angelegt. Er erwähnt
darin unter den üblichen Jiskor verschiedene seiner Verwandten, unter
anderem als berühmte Gelehrte seinen Großvater R. Jehuda bin Eliahu, sowie
seinen Vater R. Seeb und zwar diesen als Verfasser der Bücher... Am Schluss
des Memorbuchs verzeichnet er in fließendem hebräischen Stil sämtliche
gottesdienstliche Gebräuche, welche das Jahr hindurch einzuhalten sind,
damit dieselben für alle Zeiten festgehalten und nicht von jedem beliebigen
'geringen Gelehrten' nach Willkür geändert werden…" ebd.
S. 260: "assessor des Kurmainzischen Kreises und wohnte in Walldürn
(im badischen Odenwald), welches damals zu Kurmainz gehörte. Aus diesem
Grunde nennt sich der Herausgeber ..., was Kaufmann irrtümlich als 'Rabbinatsassessor
von Mainz' auffasst. Ebensowenig war sein Schwiegervater Mainzer Vorsteher,
sondern wohnte in Walldürn. Letzteres ist die richtige Lesung für
..., welches Kaufmann Waltern liest, während Wolf bibl. hebr. III S. 1037
und Steinschneider Cat. Bodl. S. 2397 No. 6983 Voltiran daraus machen.
Walldürn hieß ursprünglich Düren und wird als solches unter den Plätzen, wo
Judenverfolgungen stattfanden, mehrmals im Mainz-Nürnberger, sowie im
Deutzer Memorbuch erwähnt. Obengenannter R. Salomon wurde später Rabbiner in
Bödigheim (unweit Walldürn), wo er in
besonderer Achtung stand und weit über die Grenze seines Rabbinates sich
eines großen Rufs erfreute. In dem im Großherzoglichen Generallandesarchiv
in Karlsruhe befindlichen Archivalien zur Geschichte der Juden in
Heinsheim (am Neckar) wird mitgeteilt,
dass anno 1744 bei einer dort ausgebrochenen Streitsache zwischen
herrschaftlichen Schutzjuden und solchen, die zum Deutschorden gehörten, der
'renommierte 40-jährige (d.h. 40 Jahre amtierende) Rabbiner Salomon Wolf in
Bödigheim' als Schiedsrichter berufen
wurde. Das Bödigheimer Memorbuch ist von ihm anno 1745 angelegt. Er erwähnt
darin unter den üblichen Jiskor verschiedene seiner Verwandten, unter
anderem als berühmte Gelehrte seinen Großvater R. Jehuda bin Eliahu, sowie
seinen Vater R. Seeb und zwar diesen als Verfasser der Bücher... Am Schluss
des Memorbuchs verzeichnet er in fließendem hebräischen Stil sämtliche
gottesdienstliche Gebräuche, welche das Jahr hindurch einzuhalten sind,
damit dieselben für alle Zeiten festgehalten und nicht von jedem beliebigen
'geringen Gelehrten' nach Willkür geändert werden…"
|
Aufruf zur Unterstützung des
erblindeten Alexander Sender in Walldürn (1887)
 Anzeige
in "Der Israelit" vom 19. Mai 1887: "Bitte an edle Menschenfreunde! Anzeige
in "Der Israelit" vom 19. Mai 1887: "Bitte an edle Menschenfreunde!
Bereits im Frühjahr 1870 erlaubte ich mir, den verehrlichen Lesern dieser
Blätter die traurige Lage der Familie des erblindeten, im besten Mannesalter
stehenden Alexander Sender aus Walldürn zu schildern und die
öffentliche Mildtätigkeit zur Linderung der traurigen Lage anzurufen.
Seit April 1870, also seit 5 1/2 Jahren lebt diese Familie, da weder der
erblindete Mann, noch dessen blödsinnige Frau etwas erwerben können, von den
seinerzeit gesammelten milden Gaben.
Über die Verwendung der sich ergebenen Summe habe ich unterm 7. Januar
dieses Jahres notariell beglaubigte Rechnung abgelegt und spreche hiermit
namens der Notleidenden für jene Liebesgaben den edlen Gebern den besten
Dank aus.
Die Lage dieser Unglücklichen hat sich seitdem nicht gebessert, aber die
Mittel sind in diesem langen Zeitraume aufgebraucht. Die Not hat jetzt ihren
Gipfelpunkt erreicht. Entblößt von allen Mitteln, ohne jeglichen Erwerb,
hungernd und ohne Begleitung, jede Hoffnung auf Besserung dieser
schrecklichen Lage aufgebend, sieht diese schwer heimgesuchte Familie in die
Zukunft. Der Anblick dieser Jammergestalten ermutigt mich, heute wieder die
mildtätigen Herzen edler Menschen, zur Linderung dieses Elendes anzurufen
und innigst zu bitten, Scherflein beizutragen, um Tränen zu trocknen und
Hunger zu stillen.
Die rasche die Not dieser Dürftigen gelindert wird, desto gottgefälliger und
seliger ist die Handlung.
Dass die Unterstützung keinen Unwürdigen zugewendet wird, dafür bürge ich
und wollen gefälligst etwaige Spinden an den Unterzeichneten eingesendet
werden.
Leopold Oppenheimer, Bezirksältester.
Buchen, im September 1875.
Vorstehende Angaben, bezüglich der Verhältnisse der Alexander Senders
Eheleute hier, werden als vollkommen wahr mit dem Bemerken bestätigt, dass
genannte Familie der Unterstützung sehr bedürftig ist.
Walldürn, den 29. September 1875.
Bürgermeisteramt: H. Kieser." |
Ergebnis einer Spendensammlung in
Hainstadt und Walldürn (1887)
 Mitteilung
in "Der Israelit" vom 19. Mai 1887: "Hainstadt.
Durch den Gemeindevorstand Herrn Neuberger: Challogeld von den Frauen: Mina
Kaufmann 1.30, Klara Kaufmann 1.20, Adelheid Oppenheimer 1. Sara Neuberger
1.50, Karoline Kaufmann 1.50, Babette Neuberger 1, Sophie Neuberger 1.64.
Rika Neuberger 1, Sara Neuberger Witwe 1, Witwe Gundersheimer 1.45, durch
Lehrer Biberles, Challogeld von den Frauen: Hanna Reis 2.30, Sophie Reis
1.50, Fanny Lissberger 1.50, Fanny Israel 1.45, Mina Gundersheimer 1.29,
Ricka Kaufmann 0.50, Sara Klein 1. Fanny Alexander 0.50. Emma Kaufmann 1.20,
Rifka Kaufmann 0.50, Hannchen Israel 1, von demselben aus Walldürn:
Karolina Zimmern 0.50, Justine Rödel 0.40. Jette Riselsheimer 0.20, Bertha
Hammer 0.20 Mark. " Mitteilung
in "Der Israelit" vom 19. Mai 1887: "Hainstadt.
Durch den Gemeindevorstand Herrn Neuberger: Challogeld von den Frauen: Mina
Kaufmann 1.30, Klara Kaufmann 1.20, Adelheid Oppenheimer 1. Sara Neuberger
1.50, Karoline Kaufmann 1.50, Babette Neuberger 1, Sophie Neuberger 1.64.
Rika Neuberger 1, Sara Neuberger Witwe 1, Witwe Gundersheimer 1.45, durch
Lehrer Biberles, Challogeld von den Frauen: Hanna Reis 2.30, Sophie Reis
1.50, Fanny Lissberger 1.50, Fanny Israel 1.45, Mina Gundersheimer 1.29,
Ricka Kaufmann 0.50, Sara Klein 1. Fanny Alexander 0.50. Emma Kaufmann 1.20,
Rifka Kaufmann 0.50, Hannchen Israel 1, von demselben aus Walldürn:
Karolina Zimmern 0.50, Justine Rödel 0.40. Jette Riselsheimer 0.20, Bertha
Hammer 0.20 Mark. " |
Vortragsabend mit dem
Synodalabgeordneten Otto Simon in Hainstadt (1934)
Anmerkung: zu Misrachi-Gruppe vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Misrachi.
 Artikel
in "Israelitisches Familienblatt" vom 19. April 1934: "Hainstadt (Baden).
Hier hielt Synodalabgeordneter Dr. Otto Simon (Mannheim)
Leiter des Palästinanebenamtes für Baden-Württemberg in Mannheim, einen
Vortrag über 'Vor verschlossenen Toren!' Die Veranstaltung, von Lehrer Willi
Wertheimer (Buchen) veranlasst und
geleitet, erfreute sich reichen Besuches aus den umliegenden Gemeinden.
Anschließend konnte eine 'Misrachi-Gruppe' für den Bezirk
Buchen ins Leben gerufen werden. " Artikel
in "Israelitisches Familienblatt" vom 19. April 1934: "Hainstadt (Baden).
Hier hielt Synodalabgeordneter Dr. Otto Simon (Mannheim)
Leiter des Palästinanebenamtes für Baden-Württemberg in Mannheim, einen
Vortrag über 'Vor verschlossenen Toren!' Die Veranstaltung, von Lehrer Willi
Wertheimer (Buchen) veranlasst und
geleitet, erfreute sich reichen Besuches aus den umliegenden Gemeinden.
Anschließend konnte eine 'Misrachi-Gruppe' für den Bezirk
Buchen ins Leben gerufen werden. " |
Feierstunde zum Chanukkafest (1934)
 Artikel
in "Jüdische Rundschau" vom 16. Januar 1934: "Hardheim. Artikel
in "Jüdische Rundschau" vom 16. Januar 1934: "Hardheim.
Am 25. Dezember lud die Gemeinde Lehrer Wertheimer -
Buchen zu einer Feierstunde ein. Im
Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Lichtbildervortrag des Vortragenden:
'Tel Aviv und die Orangenküste'. Die Kleinen aus den Religionsschulen
Buchen, Walldürn und
Hardheim führten ein kleines Chanukkaspiel
auf, das ebenso wie das von jugendlichen Kräften aufgeführte Stück 'Drei
treffen sich vor dem Jugendheim' mit großem Beifall aufgenommen wurde. Im
Namen der Gemeinde sprach Synagogenrat Urspringer Begrüßungs- und
Schlussworte." |
Treffen der Religionsschüler aus
Hardheim, Hainstadt und Buchen in Walldürn (1935)
Anmerkung: zur Feier des 15. Schwat vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tu_biSchevat.
 Mitteilung
in "Israelitisches Familienblatt" vom 14. Februar 1935: "Walldürn
(Baden). Die Religionsschüler des Bezirks aus den Kleingemeinden
Hardheim,
Hainstadt und
Buchen veranstalteten hier erstmalig ein
Treffen und feierten den 15. Schwat. Auch wurde der Filmstreifen 'Neue
Wälder in Erez' vorgeführt." Mitteilung
in "Israelitisches Familienblatt" vom 14. Februar 1935: "Walldürn
(Baden). Die Religionsschüler des Bezirks aus den Kleingemeinden
Hardheim,
Hainstadt und
Buchen veranstalteten hier erstmalig ein
Treffen und feierten den 15. Schwat. Auch wurde der Filmstreifen 'Neue
Wälder in Erez' vorgeführt." |
Verkauf der Synagoge und Auflösung der Gemeinde (1937)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. September 1937: "Mannheim.
Die Gemeinde Eberstadt in Baden wurde
aufgelöst, die Synagoge wurde verkauft. In Walldürn in Baden
wurde die Synagoge verkauft, die Auflösung der Gemeinde steht
bevor." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. September 1937: "Mannheim.
Die Gemeinde Eberstadt in Baden wurde
aufgelöst, die Synagoge wurde verkauft. In Walldürn in Baden
wurde die Synagoge verkauft, die Auflösung der Gemeinde steht
bevor." |
Über einzelne
Personen aus der jüdischen Gemeinde
Gemeindevorsteher J. Riselsheimer
emigriert nach Amerika (1934)
Anmerkung: Isaac Riselsheimer (1873-1962) ist beigesetzt im Cedar Park
Cemetery in Paramus, Bergen County, New Jersey USA https://de.findagrave.com/memorial/209021443/isaac-riselsheimer
(Fotos und weitere Informationen zur Familie)
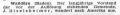 Mitteilung in "Israelitisches Familienblatt" vom 14. Oktober 1934: "Walldürn
(Baden). Der langjährige Vorstand der vor der Auflösung stehenden
Gemeinde, J. Riselsheimer, wandert nach Amerika aus." Mitteilung in "Israelitisches Familienblatt" vom 14. Oktober 1934: "Walldürn
(Baden). Der langjährige Vorstand der vor der Auflösung stehenden
Gemeinde, J. Riselsheimer, wandert nach Amerika aus." |
Über den aus Walldürn stammenden Oberlehrer i.R. Hermann Zimmern
zu seinem 80. Geburtstag (1936)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
11. Juni 1936: "Mannheim 4. Juni (1936). Am 30. dieses Monats
begeht Hermann Zimmern, Oberlehrer i.R. in Mannheim, B 7,12 in
körperlicher und geistiger Frische seien 80. Geburtstag. Der Jubilar,
geboren 1856 in Walldürn, war 45 Jahre im badischen
Volksschuldienst, davon 40 Jahre in Kippenheim
bei Lahr, zuletzt als Schulleiter. 1922 wurde er in den wohlverdienten
Ruhestand versetzt und wohnt seit 1926 bei seiner Tochter in Mannheim. Wir
wünschen dem Jubilar, der sich ob seines heiteren, gütigen Wesens
allgemeiner Beliebtheit und Wertschätzung erfreut, einen schönen
gesegneten Lebensabend! (Alles Gute) bis 120 Jahre." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
11. Juni 1936: "Mannheim 4. Juni (1936). Am 30. dieses Monats
begeht Hermann Zimmern, Oberlehrer i.R. in Mannheim, B 7,12 in
körperlicher und geistiger Frische seien 80. Geburtstag. Der Jubilar,
geboren 1856 in Walldürn, war 45 Jahre im badischen
Volksschuldienst, davon 40 Jahre in Kippenheim
bei Lahr, zuletzt als Schulleiter. 1922 wurde er in den wohlverdienten
Ruhestand versetzt und wohnt seit 1926 bei seiner Tochter in Mannheim. Wir
wünschen dem Jubilar, der sich ob seines heiteren, gütigen Wesens
allgemeiner Beliebtheit und Wertschätzung erfreut, einen schönen
gesegneten Lebensabend! (Alles Gute) bis 120 Jahre."
|
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Werbung für Grünkern aus Walldürn (1927)
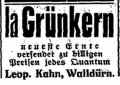 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Juli 1927: "Ia
Grünkern Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Juli 1927: "Ia
Grünkern
neueste Ernste versendet zu billigen Preisen jedes
Quantum
Leopold Kahn, Walldürn". |
Todesanzeige für Dora Riselsheimer
geb. Sondheimer (1930)
 Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 27. Februar 1930: "Todesanzeige. Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 27. Februar 1930: "Todesanzeige.
Nach Gottes unerforschlichem Ratschlusse verschied nach langem Leiden, doch
plötzlich und unerwartet, am Samstag, 22. Februar, meine liebe Frau, unsere
über alles geliebte Mutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin, Tante,
Großmutter
Frau Dora Riselsheimer geb. Sondheimer
im fast vollendeten 59. Lebensjahre. Die tieftrauernden
Hinterbliebenen.
I.d.N. (in deren Namen) J. Riselsheimer und Kinder
Walldürn i.B., den 22. Februar 1930
Schlüchtern, Aschaffenburg, Worms am Rhein, Denver (Colorado)." |
Verlobungsanzeige für Rosel Gutmann
und Alfred Riselsheimer (1931)
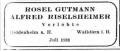 Anzeige
in "Israelitisches Familienblatt" vom 30. Juli 1931: Anzeige
in "Israelitisches Familienblatt" vom 30. Juli 1931:
"Rosel Gutmann - Alfred Riselsheimer
Verlobte
Heidenheim a.H. Walldürn i.B. Juli 1931" |
Verlobungsanzeige für Else Traubel
und Alfred Riselsheimer (1937)
Anmerkung: Schewuos = Schawuot (Wochenfest)
 Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 2. Mai 1937: "Wir
haben uns verlobt
Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 2. Mai 1937: "Wir
haben uns verlobt
Else Traubel - Alfred Riselsheimer
Oberaltertheim Walldürn (Schewuos)." |
Fotos aus jüdischen Familien in Walldürn
(Die Fotos stammen aus dem Bildarchiv des ersten Buchener Fotografen Karl
Weiß (1876-1956); Quelle:
https://nat.museum-digital.de/index.php?t=serie&serges=1246#objects;
Erläuterungen zu den Fotos nach den Recherchen von Dr. Axel Burkhardt,
Landesstelle für Museumsbetreuung, Stuttgart)
Zur
Geschichte des Betsaales / der Synagoge
Nachdem um 1770
vermutlich die Zehnzahl religionsmündiger jüdischer Männer erreicht war,
richtete sich die Gemeinde in dem (1755 erbauten) Gebäude Zunftgasse 3 einen
Betsaal ein (auch "Synagoge" genannt). Er befand sich im zweiten
(oberen) Stockwerk des Gebäudes.
Nicht zu allen Seiten konnten Gottesdienste in der Synagoge abgehalten werden.
So konnten zwischen 1890 und 1921 kaum Gottesdienste abgehalten werden, da in
Walldürn kein Minjan (Zehnzahl jüdischer Männer) vorhanden war. So war die
Bar Mizwa-Feier in der Synagoge 1912 ein besonderes Ereignis. Als nach 1920 die
Zahl der Gemeindeglieder vorübergend wieder anstieg, konnten auch wieder regelmäßige
Gottesdienste stattfinden.
Bar-Mizwa-Feier in der Synagoge
(1912)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 30.August
1912: "Walldürn. In unserer Synagoge fand letzten Samstag zum
ersten Male seit Jahrzehnten wieder einmal an einem Samstag Gottesdienst
statt und zwar aus Anlass der Barmizwoh des Sohnes des Herrn Isaak
Riselsheimer. Da hier nur drei jüdische Familien wohnen, ist sonst an ein
Minjan nicht zu denken. Lehrer Schereschewsky -
Hainstadt leitete in
feierlicher Weise den Gottesdienst." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 30.August
1912: "Walldürn. In unserer Synagoge fand letzten Samstag zum
ersten Male seit Jahrzehnten wieder einmal an einem Samstag Gottesdienst
statt und zwar aus Anlass der Barmizwoh des Sohnes des Herrn Isaak
Riselsheimer. Da hier nur drei jüdische Familien wohnen, ist sonst an ein
Minjan nicht zu denken. Lehrer Schereschewsky -
Hainstadt leitete in
feierlicher Weise den Gottesdienst." |
Neujahrsfest in der Synagoge
(1921)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Oktober 1921:
"Walldürn (Baden), 5. Oktober (1921). Ein Roschhaschono-Fest von
seltener Bedeutung wurde unserer israelitischen Gemeinde nach langer Pause
zuteil. Nachdem unsere Kehilla (Gemeinde) seit fast 30 Jahren ohne Minjan
war, können wir seit kurzer Zeit wieder öffentlichen Gottesdienst
abhalten, da die Gemeinde in letzter Zeit Zuzug erhalten hat. Für die
Alteingesessenen ist es wirklich eine hohe Freude, erleben zu dürfen, wie
sich unsere Gemeinde wieder erholt hat. Möge es manch anderer Gemeinde,
die auch ohne Minjan ist, ebenfalls vergönnt sein, ihre Kehilla zu
vergrößern." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Oktober 1921:
"Walldürn (Baden), 5. Oktober (1921). Ein Roschhaschono-Fest von
seltener Bedeutung wurde unserer israelitischen Gemeinde nach langer Pause
zuteil. Nachdem unsere Kehilla (Gemeinde) seit fast 30 Jahren ohne Minjan
war, können wir seit kurzer Zeit wieder öffentlichen Gottesdienst
abhalten, da die Gemeinde in letzter Zeit Zuzug erhalten hat. Für die
Alteingesessenen ist es wirklich eine hohe Freude, erleben zu dürfen, wie
sich unsere Gemeinde wieder erholt hat. Möge es manch anderer Gemeinde,
die auch ohne Minjan ist, ebenfalls vergönnt sein, ihre Kehilla zu
vergrößern." |
Die Synagoge in Walldürn war noch bis 1937
Mittelpunkt der immer kleiner werdenden jüdischen Gemeinde.
1935/36 war sie für die jungen Leute eines damals in Walldürn einige Zeit
bestehenden landwirtschaftlichen Ausbildungszentrum Treffpunkt. Darüber
schreibt Willi Wertheimer: "Mit Genehmigung des Kreisleiters gründeten wir in
Walldürn ein Hachaluz-Zentrum. Dort konnten junge Menschen sich bei jüdischen
und nichtjüdischen Bauern auf den Beruf des Landwirts vorbereiten, um dann als
junge Pioniere ins Land der Väter zu gehen und dort das Land zu bebauen. Die
Landwirte A. Neuburger in Walldürn, Max Hofmann in Hainstadt, Günther Böttigheimer
in Kleineicholzheim, Steinhard und Stern in
Eberstadt und Fieger, ein Nichtjude
aus Hardheim, beschäftigen solche jungen Männer. Ihre Bleibe hatten diese
Jungen bei Levi in Sennfeld, am Wochenende trafen sie sich in der Synagoge in
Walldürn. Bald aber wurde diese Genehmigung widerrufen und die Chaluzim mussten
verschwinden...".
Verkauf der Synagoge (1937)
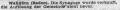 Mitteilung in "Israelitisches Familienblatt" vom 2. September 1937: "Walldürn
(Baden). Die Synagoge wurde verkauft, die Auflösung der Gemeinde steht
bevor." Mitteilung in "Israelitisches Familienblatt" vom 2. September 1937: "Walldürn
(Baden). Die Synagoge wurde verkauft, die Auflösung der Gemeinde steht
bevor." |
1937 wurde das Gebäude mit dem Betsaal verkauft und
zu einem Wohnhaus umgebaut. In Räumen des Erd- und Obergeschosses sind noch
barocke Stuckdecken erhalten. In einem Zimmer des Erdgeschosses wurden Bücher
und andere Gegenstände der Gemeinde aufbewahrt. Aus diesem Zimmer führte eine
Treppe zum Betsaal, von dem heute nichts mehr erkennbar ist. Bauliche Maßnahmen
im Haus sind nach einer Anweisung des Landesdenkmalamtes vom August 1990 mit der
Denkmalschutzbehörde abzusprechen.
Mit Beschluss des Gemeinderates von Walldürn vom 16.
Oktober 1989 wurde am Haus des ehemaligen Betsaales eine Gedenktafel
angebracht.
Fotos
Historische Fotos:
|
Historische Fotos sind nicht bekannt,
Hinweise bitte an den
Webmaster von "Alemannia Judaica", E-Mail-Adresse siehe Eingangsseite |
Fotos nach 1945/Gegenwart:
Foto um 1985:
(Foto links: Hahn; Foto rechts in:
Aufsatz von W.
Gramlich s. Lit. s. 55)
|
 |
 |
| |
Haus des Betsaals in
der Zunftgasse 3 |
Zeugnis der jüdischen
Geschichte: die
Stuckdecke in der Zunftgasse 3 (unterer
Vorraum zum
Betsaal, 18. Jh.) |
| |
| |
|
|
Fotos 2005:
(Fotos: Hahn,
Aufnahmedatum 19.3.2005; die Gedenktafel wurde am 5.9.2003 aufgenommen) |
|
 |
 |
 |
| Haus des Betsaals in der Zunftgasse 3 |
Ansicht von Südwesten |
Gedenktafel |
| |
|
|
Presseartikel
| Januar
2014: Zum Tod von Daniel Mahr, dem
Begründer des "Kultur- und
Kunstmuseums" |
Artikel in den
"Fränkischen Nachrichten" vom 16. Januar 2014: "Daniel Mahr ist gestorben: Der Maler und Poet wurde 69 Jahre alt / 1988 in den Odenwald übergesiedelt.
Ein Verlust für die Kunstszene der Region,
Rippberg. Daniel Mahr ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 69 Jahren. Mahr, der sich selbst als Maler und Poet bezeichnete, war eine feste Größe in der Kunstszene des Neckar-Odenwald-Kreises.
Mahr hatte ein bewegtes Leben. Am 9. Oktober 1944 wurde er als Sohn jüdischer Eltern in Tschkowitz im Sudetenland geboren. Sein Vater wurde ermordet, seine Mutter und er überlebten den Krieg und das Naziregime.
1945 kamen beide zunächst nach Mannheim, dann nach Heidelberg, wo sie im Stadtteil Kirchheim sesshaft wurden. Hier ist Daniel Mahr aufgewachsen.
Dort hat er einen katholischen Kindergarten besucht. Zu Hause wurde er freilich jüdisch erzogen. Zwei Lehren hat Daniel Mahr absolviert. Eine als Schlosser, eine als Maschinenbauer.
Schon früh hat sich Daniel Mahr Gedanken über sich und das Judentum gemacht.
'Jude zu sein, das wurde lange versteckt, das wurde nichtöffentlich
gemacht', sagte er einmal im Gespräch mit den FN. Bei Daniel Mahr war das anders: Er machte kein Geheimnis daraus, dass er Jude war.
In Heidelberg hat Daniel Mahr seine ersten künstlerischen Schritte gemacht. Zuerst hat er Gedichte geschrieben, dann mit dem Malen angefangen. Schon früh, mit 26 Jahren, hat er sich ganz der Kunst verschrieben. Das Malen, mehr noch die Gedichte, das war für Mahr auch immer eine Möglichkeit, mit sich selbst ins Reine zu kommen, sein Leben zu verarbeiten. In Heidelberg hat er künstlerisch fruchtbare Phasen erlebt, aber auch eine schwere Schaffenskrise. Das war in den 80er Jahren. Letztlich führte diese Krise dazu, dass Mahr in den Odenwald übersiedelte. 1988 zog er nach
Laudenberg. Külsheim, Hornbach, Reinhardsachsen und Rippberg waren weitere Stationen. Die Gegend hat ihn beflügelt. Beim Malen hat er neue Stile entwickelt, neue Formen gefunden, seine Gedichte gingen ihm leichter von der Hand.
Neben der Malerei und dem Dichten ist vor allem das "Kultur- und Kunstmuseum" untrennbar mit dem Namen Daniel Mahr verbunden. Mit der Einrichtung wollte er eine Brücke zwischen Kunst und Religion schlagen und den Dialog zwischen Juden und Nichtjuden fördern. Und er hat damit durchaus Erfolg gehabt. "Sein" Museum genoss europaweit Anerkennung. 2007 schloss die Einrichtung ihre Pforten. Und Daniel Mahr litt darunter, dass sich kein Ort mehr fand, wo er sein Projekt hätte fortsetzen können. Die mangelnde Unterstützung machte ihm zu schaffen. Und auch wenn er das Gegenteil sagte: Wer ihn kannte, der spürte seinen Verdruss.
Seine Ziele verfolgte Mahr immer mit Konstanz und Zielstrebigkeit. "Juden sind stur und dickköpfig", sagte er einmal. Da hat er sich nicht ausgenommen. Das machte den Umgang mit ihm nicht immer einfach. Dafür gab es mit ihm aber auch keine halben Sachen, sondern immer eine klare Ansage.
Mit dem Maler und Poeten ist die Kunstszene der Region ein großes Stück ärmer geworden. mar."
Link
zum Artikel |
| |
| Das von 2002 (Eröffnung
am 30. Juni 2002) bis 2007 bestehende "Kultur- und
Kunstmuseum" schlug eine Brücke zwischen Kunst und Religion. Das
von Daniel Mahr aufgebaute Museum war im Walldürner Ortsteil Rippberg in
der Amorbacher Strasse 30 untergebracht. Es sollte den Dialog zwischen
Juden und Nichtjuden fördern. |
 |
 |
|
| |
Link oben zum Internetarchiv
der wayback-machine mit Fragmenten
der Website des Kultur- und Kunstmuseums (von 2006) |
|
|
Links und Literatur
Links:
Quellen:
| Hinweis
auf online einsehbare Familienregister der jüdischen Gemeinde Walldürn |
In der Website des Landesarchivs
Baden-Württemberg (hier: Generallandesarchiv Karlsruhe) sind einige Familienregister aus
badischen jüdischen Gemeinden einsehbar:
Link zur Übersicht (nach Amtsgerichtsbezirken)
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=12390
Zu Walldürn ist vorhanden (auf der jeweiligen Unterseite zur
Einsichtnahme weiter über "Digitalisate anzeigen"):
390 Nr. 831: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch 1810-1870
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119722
390 Nr. 832: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch
1816-1823
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119723
390 Nr. 833: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch
1824-1829
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119724
390 Nr. 834: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch
1830-1835
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119725
390 Nr. 835: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch
1836-1841
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119726
390 Nr. 836: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch
1842-1847
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119727
390 Nr. 837: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch
1848-1855
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119728
390 Nr. 838: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch
1856-1861
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119729
390 Nr. 839: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch
1862-1866
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119730
390 Nr. 840: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch
1867
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119734
390 Nr. 841: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch
1868
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119735
390 Nr. 842: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch
1869-1870
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119736 .
|
Literatur:
 | Germania Judaica II,2 S. 862-863. |
 | Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.
1968. S. 283-284. |
 | Walter Gramlich: Zur Geschichte der Walldürner Juden. in: 25 Jahre
Heimat- und Museumsverein und Neueröffnung des Museums Walldürn (=
Walldürner Museumsschriften Heft 7). 1991 S. 51-61. |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|