|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"
Unterriedenberg (Kreis
Bad Kissingen)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Unterriedenberg bestand eine jüdische Gemeinde bis
1938. Ihre Entstehung geht mindestens in die Zeit des 18. Jahrhunderts
zurück. Die jüdischen Familien wurden von der Herrschaft Sterpferts im
Römershag aufgenommen. 1763 wurden 12 jüdische Familien am Ort
gezählt.
Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1867 84 jüdische Einwohner (28,2 % von 298), 1890 61 (23,2 % von
263), 1900 71 (28,0 % von 254), 1910 46 (17,2 % von 267), 1925 34 (14,3 % von
237).
Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Unterriedenberg auf
insgesamt 12 Matrikelstellen die folgenden jüdischen Familienvorstände
genannt (mit neuem Familiennamen und Erwerbszweig): Victor Machol Engel
(Viehhandel), Bonum Maier Engelhard (Viehhandel), Abraham Schlom Goldbach
(Schmusen und Taglohn), Victor Joseph Nusbaum (Schmusen und Taglohn), Moses Wolf
Hahn (Schmusen und Taglohn), Knebel Simon Sitzmann (Schmusen und Taglohn),
Hirsch Maier Engelhard (Schmusen und Taglohn), Victor Gerst Strauß
(Schnittwarenhandel), Mindel Mantel (Schnittwarenhandel), Mindel, Witwe von
Joseph Edelstein (Kramwarenhandel), Jend Hirsch Hecht (Viehhandel), Salomon
Victor Heß (Viehhandel).
Die jüdischen Familien lebten auch im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts vor allem vom Viehhandel, einige
eröffneten Geschäfte am Ort (s.u. Anzeige des Schnitt-, Eisen-
und Spezereiwaren-Geschäftes von Viktor Sitzmann 1893).
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge
(s.u.), eine jüdische Schule mit Lehrerwohnung und ein rituelles Bad (1909
renoviert).
Die Toten der Gemeinde wurde auf dem jüdischen Friedhof in Pfaffenhausen,
seit 1911 in Geroda beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Religionslehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (siehe
Ausschreibung der Stelle unten 1876). Als Lehrer werden genannt: bis 1901
Emanuel Levi (danach in Willmars). Die jüdische
Gemeinde gehörte von 1840 bis 1892/93 zum Rabbinatsbezirk Gersfeld,
danach zum Distriktsrabbinat Bad
Kissingen.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Gefreiter Nathan
Goldbach (geb. 6.6.1890 in Oberriedenberg, gef. 26.8.1914), Gustav Sitzmann
(geb. 12.12.1895 in Unterriedenberg, gef. 20.3.1916) und Meier (Maier) Sitzmann
(geb. 25.9.1894 in Unterriedenberg, gef. 4.6.1917). Ihre Namen stehen auf dem
Kriegerdenkmal für die Gefallenen beider Weltkrieg unmittelbar neben der Kirche
an der Kirchstraße 12.
1932 waren die Vorsteher der Gemeinde Albin Lichtstern und Leo Sitzmann,
letzterer als Schriftführer und Schatzmeister. Im Schuljahr 1932/33 erhielten
noch zwei jüdische Kinder Religionsunterricht.
1933 lebten noch 32 jüdische Personen in Unterriedenberg (14,4 % von
222). Infolge der zunehmenden Repressalien und der Folgen des wirtschaftlichen
Boykotts verarmten die jüdischen Familien sehr schnell. Nachdem der Besuch
der öffentlichen Schule in Unterriedenberg für die jüdischen Kinder nicht
mehr möglich war, besuchten diese 1936 die israelitische Volksschule in Brückenau.
Im Februar 1937
mussten bereits vier Familien von der jüdischen "Winterhilfe"
versorgt werden. Bis Anfang November 1938 sind vier jüdische Einwohner in die
USA emigriert, 15 verzogen in andere deutsche Städte (je fünf nach Frankfurt
am Main und Würzburg sowie in andere Städte). Danach lebten noch sechs
jüdische Familien am Ort (zwei der Haushaltsvorstände waren Ladenbesitzer,
einer Bäcker, einer Viehhändler). Am Novemberpogrom 1938 waren vor
allem SA-Leute aus Unterriedenberg, Oberbach und Oberriedenberg beteiligt. Sie
drangen in die jüdischen Häuser ein, schlugen die Fenster ein, zerstörten die
Wohnungen und verbrannten die auf die Straße geworfenen Trümmer. Das bei Juden
gefundene Geld wurde dem Bürgermeister übergeben. Der Bürgermeister hatte
sich an die Ortspolizei gewandt, um die Ausschreitungen zu verhindern, doch
wurde ihm mitgeteilt, dass von den vorgesetzten Behörden jede Einmischung
untersagt wurde. Die jüdische Gemeinde wurde wenige Wochen später
aufgelöst. Die letzten elf jüdischen Einwohner verzogen am 10. Dezember 1938
nach Frankfurt am Main.
Von den in Unterriedenberg geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Herrmann (Heinemann) Edelstein
(1870, siehe Presseartikel unten), Betty Frank geb. Levi (1894), Klara Gerson geb. Sitzmann (1862), Abraham
Goldbach (1881), Jakob Goldbach (1862), Julius Goldbach
(1889), Ida Hecht (1887), Rita Hecht (1893), Regina Heinemann geb. Goldbach
(1885), Gitta Klaar geb. Sitzmann (1887), Melita Levi geb. Hecht (1889),
Dorothea Mautner geb. Edelstein (1883), Selma Reich geb. Goldbach (1898), Fanny
Reis geb. Edelstein (1876), Sara Roer geb. Edelstein (1885), Irene Sitzmann
(1920), Isidor Sitzmann (1885), Karl Sitzmann (1886, "Stolperstein" seit
Februar 2020 in Berlin-Charlottenburg*), Lidia Sitzmann (1926), Rosa Sitzmann
geb. Goldbach (1891, "Stolperstein" seit Februar 2020 in
Berlin-Charlottenburg*), Siegfried Sitzmann (1889), Eva Tannenwald geb. Engel (1874).
*)
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Berlin-Charlottenburg.
Im August 1949 fand vor dem Landgericht in Würzburg ein Prozess gegen 28
der beim Novemberpogrom 1938 Beteiligten statt. Fünf erhielten
Gefängnisstrafen zwischen fünf und neun Monaten, 23 wurden
freigesprochen.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Religionslehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle 1876 /
1901
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juli 1876:
"Brückenau in Bayern. Der israelitische Religionslehrer-,
Vorsänger- und Schächterdienst zu Unterriedenberg ist in Erledigung
gekommen. Derselbe erträgt fassionsgemäß mit Schluss des auf 40 Mark 24
Pfennig veranschlagten Schulholzes zu 6 Steren und des Wohnungs-Anschlages
zu 40 Mark ein jährliches Einkommen von 826 Mark 96 Pfennig. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juli 1876:
"Brückenau in Bayern. Der israelitische Religionslehrer-,
Vorsänger- und Schächterdienst zu Unterriedenberg ist in Erledigung
gekommen. Derselbe erträgt fassionsgemäß mit Schluss des auf 40 Mark 24
Pfennig veranschlagten Schulholzes zu 6 Steren und des Wohnungs-Anschlages
zu 40 Mark ein jährliches Einkommen von 826 Mark 96 Pfennig.
Bewerber um genannte Stelle haben innerhalb 3 Wochen ihre Gesuche, mit den
erforderlichen Zeugnissen versehen, hierorts einzureichen.
Brückenau, den 4. Juli 1876. Königliches Bezirksamt als
Distrikts-Schulinspektion von Tautphoeus." |
|
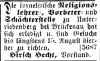 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juli 1901: "Die
israelitische Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle zu
Unterriedenberg bei Brückenau hat sich erledigt und sind Gesuche bis
längstens 15. August hierher zu richten. Hirsch Hecht, Vorstand." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juli 1901: "Die
israelitische Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle zu
Unterriedenberg bei Brückenau hat sich erledigt und sind Gesuche bis
längstens 15. August hierher zu richten. Hirsch Hecht, Vorstand." |
| |
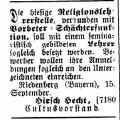 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19.9.1901:
"Die hiesige Religionslehrerstelle, verbunden mit Vorbeter-
Schächterfunktion, soll mit einem seminaristisch gebildeten Lehrer
sogleich besetzt werden. Bewerber wollen ihre Anmeldungen sogleich an den
Unterzeichneten einreichen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19.9.1901:
"Die hiesige Religionslehrerstelle, verbunden mit Vorbeter-
Schächterfunktion, soll mit einem seminaristisch gebildeten Lehrer
sogleich besetzt werden. Bewerber wollen ihre Anmeldungen sogleich an den
Unterzeichneten einreichen.
Riedenberg (Bayern), 15. September.
Hirsch Hecht, Kultusvorstand." |
Aus dem jüdischen
Gemeindeleben
Auswanderung jüdischer Einwohner in den 1830er-Jahren - auch ein 85jähriger
aus Unterriedenberg fasst den Entschluss dazu
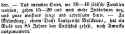 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. März 1839
innerhalb eines allgemeinen Artikels zur Auswanderung aus Unterfranken:
"Aus manchen Orten, wo 30-40 jüdische Familien wohnen, gehen 15-20
und noch mehr Individuen weg, und zwar meistens junge und arbeitsame
Leute. - Zu Riedenburg (falsch für Riedenberg, gemeint
Unterriedenberg), einem Dorf im Landgericht Brückenau, hat ein Greis
von 85 Jahren den Entschluss gefasst, nach Amerika auszuwandern." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. März 1839
innerhalb eines allgemeinen Artikels zur Auswanderung aus Unterfranken:
"Aus manchen Orten, wo 30-40 jüdische Familien wohnen, gehen 15-20
und noch mehr Individuen weg, und zwar meistens junge und arbeitsame
Leute. - Zu Riedenburg (falsch für Riedenberg, gemeint
Unterriedenberg), einem Dorf im Landgericht Brückenau, hat ein Greis
von 85 Jahren den Entschluss gefasst, nach Amerika auszuwandern." |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Zum Tod von Isaak Engelhardt (1908)
Anmerkung: Der Artikel ist mit Unterriedenbach
überschrieben. Einen solchen Ort gibt es nicht. Da von "hiesiger
Gemeinde" die Rede ist, liegt vermutlich eine Verwechslung mit Unterriedenberg
vor. Auch eine Verschreibung für Unterreichenbach könnte möglich sein,
doch gehörten die dort lebenden jüdischen Personen zu Birstein.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Mai 1908: "Unterriedenbach,
30. April (1908). Einen schmerzlichen Verlust erlitt die hiesige Gemeinde
durch den Tod des Herrn Isaak Engelhardt, der nach vierwöchentlicher,
schwerer Krankheit in der ersten Sedernacht verstarb. Die zahlreiche
Beteiligung bei der Beisetzung gab Zeugnis von der allgemeinen Beliebtheit
des Verblichenen. Alle, die ihn kannten, werden ihm ein gutes Andenken
bewahren." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Mai 1908: "Unterriedenbach,
30. April (1908). Einen schmerzlichen Verlust erlitt die hiesige Gemeinde
durch den Tod des Herrn Isaak Engelhardt, der nach vierwöchentlicher,
schwerer Krankheit in der ersten Sedernacht verstarb. Die zahlreiche
Beteiligung bei der Beisetzung gab Zeugnis von der allgemeinen Beliebtheit
des Verblichenen. Alle, die ihn kannten, werden ihm ein gutes Andenken
bewahren." |
Zum 80. Geburtstag von Minna Edelstein geb. Goldbach
(1926)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. April 1926: "Unterriedenberg
bei Brückenau, 18. April (1926). Am 27. April dieses Jahres feiert Frau
Minna Edelstein, geb. Goldbach, in voller körperlicher und geistiger
Rüstigkeit ihren achtzigsten Geburtstag. Sie zählt seit vielen Jahren zu
den ersten im Gotteshaus, wie überhaupt die schönsten jüdischen
Eigenschaften sie schmücken. Wir wünschen (alles Gute) bis 120 Jahre!" Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. April 1926: "Unterriedenberg
bei Brückenau, 18. April (1926). Am 27. April dieses Jahres feiert Frau
Minna Edelstein, geb. Goldbach, in voller körperlicher und geistiger
Rüstigkeit ihren achtzigsten Geburtstag. Sie zählt seit vielen Jahren zu
den ersten im Gotteshaus, wie überhaupt die schönsten jüdischen
Eigenschaften sie schmücken. Wir wünschen (alles Gute) bis 120 Jahre!" |
Zum Tod von Minna Edelstein geb. Goldbach (1927)
Anmerkung: Foto des Grabsteines siehe
unten.
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Dezember
(1927): Unterriedenberg bei Brückenau, 20. Dezember. Im gesegneten
Alter von 82 Jahren verstarb hier Frau Minna Edelstein, die älteste
Bürgerin des Ortes. In echt jüdischem Geiste erzogen, hat sie sich die
Ideale des Judentums zu bewahren gewusst und auch die Tücken des Lebens
konnten ihre Wahrhaftigkeit nicht erschüttern. Die große Beteiligung der
christlichen Bevölkerung bei ihrer Beerdigung legten Zeugnis von der
Liebe ab, die man der Verstorbenen entgegenbrachte. Herr Lehrer Strauß - Geroda
hielt vor dem Trauerhause eine Trauerrede - die Frauentugenden der
Verklärten rühmend." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Dezember
(1927): Unterriedenberg bei Brückenau, 20. Dezember. Im gesegneten
Alter von 82 Jahren verstarb hier Frau Minna Edelstein, die älteste
Bürgerin des Ortes. In echt jüdischem Geiste erzogen, hat sie sich die
Ideale des Judentums zu bewahren gewusst und auch die Tücken des Lebens
konnten ihre Wahrhaftigkeit nicht erschüttern. Die große Beteiligung der
christlichen Bevölkerung bei ihrer Beerdigung legten Zeugnis von der
Liebe ab, die man der Verstorbenen entgegenbrachte. Herr Lehrer Strauß - Geroda
hielt vor dem Trauerhause eine Trauerrede - die Frauentugenden der
Verklärten rühmend." |
Zum Tod von Rosa Goldbach (1932)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Januar 1933: "Unterriedenberg,
29. Dezember (1932). Am Erew
Schabbat Koddäsch Paraschat Wejischlach (Freitag vor dem Schabbat mit
der Toralesung Wejischlach = 1. Mose 32,4 - 36,43, das war Freitag, 16.
Dezember 1932) haben wir Frau Rosa Goldbach, Gattin des Herrn Salomon
Goldbach, zu Grabe getragen. Aus einem arbeitsreichen Leben und einer
über 50jährigen Ehe wurde sie nach monatelanger schwerer Erkrankung am
Mittwoch, den 15. Kislew (= 14. Dezember 1932) abgerufen. Sie sah gute und
böse Tage, ertrug schwerstes Leid - den Tod einer erwachsenen Tochter und
den Verlust eines hoffnungsreichen Sohnes als Opfer des Krieges - und trug
allen Schmerz gleich ihrem Gatten ergeben in den unerforschlichen Willen
von Gott. Die Beteiligung am Geleite war sehr groß. - Vor dem Trauerhause
würdige Herr Lehrer Kahn aus Geroda die
Verdienste des Verklärten und schilderte den herben Schmerz des
vereinsamten Gatten und der Kinder. Ein Schwager der Heimgegangenen,
Lehrer Heinemann in Fulda, gab tief oft ergriffen, dem eigenen Schmerz und
dem der Familie Ausdruck. Ihre Seele sei eingebunden sein in den Buch des
Lebens. Amen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Januar 1933: "Unterriedenberg,
29. Dezember (1932). Am Erew
Schabbat Koddäsch Paraschat Wejischlach (Freitag vor dem Schabbat mit
der Toralesung Wejischlach = 1. Mose 32,4 - 36,43, das war Freitag, 16.
Dezember 1932) haben wir Frau Rosa Goldbach, Gattin des Herrn Salomon
Goldbach, zu Grabe getragen. Aus einem arbeitsreichen Leben und einer
über 50jährigen Ehe wurde sie nach monatelanger schwerer Erkrankung am
Mittwoch, den 15. Kislew (= 14. Dezember 1932) abgerufen. Sie sah gute und
böse Tage, ertrug schwerstes Leid - den Tod einer erwachsenen Tochter und
den Verlust eines hoffnungsreichen Sohnes als Opfer des Krieges - und trug
allen Schmerz gleich ihrem Gatten ergeben in den unerforschlichen Willen
von Gott. Die Beteiligung am Geleite war sehr groß. - Vor dem Trauerhause
würdige Herr Lehrer Kahn aus Geroda die
Verdienste des Verklärten und schilderte den herben Schmerz des
vereinsamten Gatten und der Kinder. Ein Schwager der Heimgegangenen,
Lehrer Heinemann in Fulda, gab tief oft ergriffen, dem eigenen Schmerz und
dem der Familie Ausdruck. Ihre Seele sei eingebunden sein in den Buch des
Lebens. Amen." |
Zum Tod von Salomon Goldbach (1935)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 17. Juni
1935: "Unterriedenberg, 14. Juni (1935). Am Montag, den 3. Juni,
wurde unsere kleine Gemeinde von einem herben Schlage getroffen: Salomon
Goldbach hauchte, 79 Jahre alt, seine reine Seele aus und kam am
Mittwoch, den 4. Siwan, auf dem Friedhofe zu Geroda
neben seiner vor 2 ½
Jahren ihm im Tode vorausgegangenen Gattin zur letzten Ruhe. Der
Verstorbene war ein echter Jehudi vom alten Schlage, der keine Mizwah
(Gebot) versäumte und viele Jahre an den hohen Feiertagen als Chasan
(ehrenamtlicher Vorbeter) fungierte. Er gab einer Gemeinde ein gutes
Beispiel ab und fand damit Anklang und Nacheiferung. Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 17. Juni
1935: "Unterriedenberg, 14. Juni (1935). Am Montag, den 3. Juni,
wurde unsere kleine Gemeinde von einem herben Schlage getroffen: Salomon
Goldbach hauchte, 79 Jahre alt, seine reine Seele aus und kam am
Mittwoch, den 4. Siwan, auf dem Friedhofe zu Geroda
neben seiner vor 2 ½
Jahren ihm im Tode vorausgegangenen Gattin zur letzten Ruhe. Der
Verstorbene war ein echter Jehudi vom alten Schlage, der keine Mizwah
(Gebot) versäumte und viele Jahre an den hohen Feiertagen als Chasan
(ehrenamtlicher Vorbeter) fungierte. Er gab einer Gemeinde ein gutes
Beispiel ab und fand damit Anklang und Nacheiferung. Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zurruhesetzung des aus Unterriedenberg
stammenden Hauptlehrers Herrmann (Heinemann) Edelstein (Sugenheim) zum
1. Januar 1936
Über Lehrer Herrmann Edelstein: Geboren am 7. September 1870 in
Unterriedenberg; studierte vermutlich an der Israelitischen
Lehrerbildungsanstalt in Würzburg; war von 1899 bis 1924 Lehrer, Kantor und
Schächter der israelitischen Kultusgemeinde in
Sugenheim. Er war mit Jeanette geb. Kahn verheiratet, das Paar hatte drei
Kinder. Nach Schließung der jüdischen Elementarschule 1924 blieb er als
Religionslehrer tätig. 1936 zog Edelstein mit seiner Frau nach München.
Edelstein wurde am 1. Januar 1934 aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung
des Berufsbeamtentums in den Ruhestand versetzt, nach der Pressemitteilung von
unten am 1. Januar 1936 in den "dauernden Ruhestand". 1936 besuchten die
Edelsteins ihre Töchter in Palästina, kehrten aber nach Deutschland zurück.
Spätere Bemühungen um eine erneute Ausreise scheiterten. Am 10. November 1938
wurde Edelstein ins KZ Dachau gebracht und erst nach 35 Tagen wieder entlassen.
Am 1. Juli 1942 wurde er mit seiner Frau nach Theresienstadt deportiert. Er ist
dort am 10. Juni 1944 umgekommen, seine Frau bereits am 6. Februar 1943.
Mindestens zwei der drei Kinder konnten nach Palästina emigrieren. Quelle:
Gedächtnisblatts der Schüler Andreas Wimmer und Stefan Grasser in den
Gedächtnisblättern KZ Dachau (2013)
https://www.gedaechtnisbuch.org/gedaechtnisblaetter/?f=E&gb=3641.
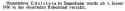 Meldung in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom
15. Januar 1936: "Hauptlehrer Edelstein in
Sugenheim wurde ab 1.
Januar 1936 in den dauernden Ruhestand versetzt." Meldung in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom
15. Januar 1936: "Hauptlehrer Edelstein in
Sugenheim wurde ab 1.
Januar 1936 in den dauernden Ruhestand versetzt." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Kaufmann Viktor Sitzmann sucht einen Lehrling (1893)
Anmerkung: Zur Genealogie der Familie
Viktor Sitzmann (1860-1940) siehe
https://www.geni.com/people/Viktor-Sitzmann/6000000071035737922
Demnach war einer der Söhne von Viktor Sitzmann der 1886 (nicht 1896) geborene
Karl Sitzmann, später verheiratet mit Rosa geb. Goldbach, geb.
1891 in Unterriedenbach). Beide wurden am 27./29.11.1941 von Berlin nach
Litzmannstadt (Lodz) deportiert, von dort im Mai 1942 ins Vernichtungslager
Kulmhof (Chelmno). Sie sind umgekommen bzw. wurden ermordet. Der Tochter
Martha Eisenberger geb. Sitzmann (geb. 1916 in Unterriedenbach) gelang im
Dezember 1938 die Ausreise aus Deutschland. Sie ist 1967 gestorben. Auch dem
Sohn Gustav Sitzmann (geb. 1919 in Berlin) gelang im März 1939 die
Ausreise aus Deutschland. Am 5. Januar 1950 erfolgte die Namensänderung in
Gustave Seitz. Er ist 2009 gestorben. Weiteres zur Familiengeschichte siehe
Beitrag von Allan Hendriksen/Michael Halfmann:
Die
Familie Sitzmann (eingestellt als pdf-Datei).
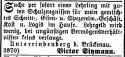 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juni 1893: "Suche
per sofort einen Lehrling mit guten Schulzeugnissen für mein gemischtes
Schnitt-, Eisen- und Spezereiwaren-Geschäft. Kost und Logis im Hause.
Lehrgeld wird wenig, bei ungünstigen Vermögensverhältnissen keins
verlangt. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juni 1893: "Suche
per sofort einen Lehrling mit guten Schulzeugnissen für mein gemischtes
Schnitt-, Eisen- und Spezereiwaren-Geschäft. Kost und Logis im Hause.
Lehrgeld wird wenig, bei ungünstigen Vermögensverhältnissen keins
verlangt.
Unterriedenberg bei Brückenau. Viktor Sitzmann." |
Verlobungsanzeige von Irma Stern und Louis Sitzmann
(1922)
Anmerkung: Zur Genealogie der
Familie Louis Sitzmann (1891-1970) und Irma geb. Stern (1898-1972) siehe
https://www.geni.com/people/Louis-Sitzmann/6000000044469163886
..
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Oktober 1922: "Irma
Stern - Louis Sitzmann. Verlobte. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Oktober 1922: "Irma
Stern - Louis Sitzmann. Verlobte.
Veitshöchheim bei Würzburg - Fulda
/ Riedenberg bei Brückenau. Oktober 1922 / Sukos (sc.
Laubhüttenfest) 5683". |
Zur Geschichte der Synagoge
Die Synagoge in Unterriedenberg wurde 1752 erbaut. In
ihr wurde ein um 1800 angelegtes Totengedenkbuch aufbewahrt sowie ein Protokollbuch
der Gemeinde mit Eintragungen ab 1837 und ein altes Registerbuch der Heiligen
Bruderschaft (Chewra Kadischa, Beerdigungs- und
Wohltätigkeitsverein).
Regelmäßige Gottesdienste konnten bis Anfang 1938 abgehalten werden. Im
März 1938 war allerdings kein Minjan mehr am Ort (Zehnzahl der jüdischen
Männer), worauf man den Gottesdienst nun Gemeinden mit den Juden der
Nachbargemeinde Dittlofsroda abhielt.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde das Inventar der Synagoge und der
jüdischen Schule von den SA-Leuten aus Unterriedenberg, Oberbach und
Oberriedenberg völlig zerstört. Das Gebäude wurde nach 1945 abgebrochen und
an seiner Stelle ein Wohnhaus erbaut.
Bericht über die Ereignisse in
Unterriedenberg beim Novemberpogrom 1938 von Carol(a) Bermann (aus
Familie Sitzmann): "Ich war in der Schule in (Bad) Brückenau. Da
hat der Lehrer gesagt, 'es wird etwas vorgehn und ich soll schnell den Zug
nehmen und heimfahren.' Da bin ich heimgefahren und in unser Haus
gegangen, wo sich gerade der Vater, die Mutter, der Großvater und meine
Schwester aufhielten. Und da haben wir in dem Wohnzimmer gesessen und
gehört, wie die SS und SA draußen zu unserem Haus marschiert sind. Dann
(sind die ins Haus gekommen und) haben die uns alle in die Kammer, wo wir
immer gegessen haben, reingetan und die Tür zugemacht und gesagt: 'Da
müssen Sie bleiben.' Dann sind (weitere von der) SA und SS ins Haus
gekommen, in den zweiten Stock, in die Schlafzimmer und haben die Fenster
aufgemacht und haben alles aus den Fenstern nausgeschütt': Das Möbel,
die Betten, die Federbetten, die Wäsche, Porzellan und alles, auch das
aus dem Wohnzimmer, alles auf den Hof nausgeschütt'. Da war nichts mehr
im Haus. Dann sind sie gekommen mit einem Truck (Lastwagen). Und was sie
nicht auf den Truck getan haben und was noch ganz war, das haben Leute aus
der Nachbarschaft und vom ganzen Ort sich mitgenommen. Wir haben da
gesessen und Angst gehabt, nicht gewusst, was sie mit uns machen. Ich war
zwölf und meine Schwester acht Jahre alt. Und wie sie dann fertig waren,
alle Leute fortgegangen waren, dann ist die SS gekommen und haben meinen
Vater verhaftet, Den Großvater haben sie nicht mitgenommen, weil der
schon alt (über 70) war. Dann haben wir gehört, dass sie die ganze
Synagoge zerstört haben. Und neben der Synagoge hat die Oma (Lichtstern)
gewohnt, mein Onkel Sitzmann mit der Betti (seiner Frau) und der Lydia.
Dann wurde deren Wohnung zerstört. Auch alles kaputtgemacht. Und dann
sind die Oma und der Onkel, die Frau und die Tochter am Abend zu uns ins
Haus gekommen. In der Nacht sind wir alle in unsere Scheune ins Heu
gegangen. Und da haben wir gewohnt und geschlafen auf dem Heu die
nächsten zwei Wochen. Wir haben Angst gehabt, wieder ins Haus zu gehen.
Das meiste, was wir (zum Essen) gehabt haben, waren Kartoffeln und Rote
Rüben aus unserm Keller. Milch und etwas zum Essen, das haben uns die
Herchenröders (Nachbarn) gebracht, hintenrum durch die Scheune. Und da
warn wir dort zwei Wochen. Und auf einmal, das ist ganz komisch, wir haben
einen Hund gehabt, der hat Ajax geheißen, und auf einmal morgens um 5 Uhr
an hat der Hund gebellt wie verrückt. Und eine Stunde später ist mein
Vater heimgekommen. Die haben ihn rausgelassen vom Gefängnis (in
Brückenau), weil er ein Kriegsverletzter war. Vielleicht hat aber auch
der dortige Major, der war nämlich unser Steuerberater, ein gutes Wort
für ihn eingelegt. Das wissen wir nicht. Die meisten (Mitgefangenen) sind
damals nach Dachau gekommen. Und dann ist er (der Vater) am nächsten Tag
nach Frankfurt/a.M. gegangen und hat eine Wohnung gesucht und dann sind
wir nach Frankfurt gegangen. Ich hab Ihnen ja gesagt, das war an der
Ostendstraße in der Nähe vom Ostbahnh0of. Die Eltern haben sich doch gar
nciht mehr rausgetraut. Die haben doch immer mich geschickt, weil ich
blond war und so 'arisch' aussah. Von Frankfurt sind wir dann nach Genua
mit dem Zug und dort haben wir dann das Schiff genommen. Zuvor haben sie
uns an der Grenze noch Schwierigkeiten gemacht, alle Koffer aufgemacht und
wir mussten alle Papiere zeigen."
(zitiert in: Geheimnisvolles Masken aus der Rhön - Von jüdischen und
christlichen Bartmännern s.Lit. S. 146-147).
Anmerkung: Die genannte Carol(a) Berman(n) war die Tochter von Isidor
Lichtstern (geb. 1898 in Weisbach,
gest. 1866 in den USA), der mit Lea geb. Sitzmann (geb. 1901 in
Unterriedenberg, gest. 1977 in den USA) verheiratet war und mit ihr und
seiner Familie in Unterriedenberg lebte. |
Adresse/Standort der Synagoge: Ringweg 2
Fotos
| |
|
|
| |
|
|
Es sind noch keine
Fotos vorhanden; über Zusendungen freut sich der Webmaster
von
"Alemannia Judaica"; Adresse siehe Eingangsseite. |
|
| |
|
|
Zwei Grabsteine
von Verstorbenen jüdischen Einwohnern aus Unterriedenberg
im jüdischen Friedhof Geroda |
Grabstein von Hugo Engel
aus Unterriedenberg
im jüdischen Friedhof Schweinfurt |
 |
 |
 |
Grabstein mit zerbrochener
Inschrifttafel
für Helga Zippora Strauß von
Unterriedenberg, gest. am
12. Tewet
5868 = 28./29. Dezember 1925 |
Grabstein für Mina Edelstein
geb. Goldbach von Unterriedenberg,
gest. 13. Kislew
5688 = 7. Dezember 1927
(vgl. Berichte oben) |
Grabstein für
Hugo Engel,
geb. 11. Juli 1861 in Riedenberg,
gest. 3. Juli 1884
in Schweinfurt.
Der Grabstein ist im jüdischen Friedhof
Schweinfurt in Reihe I, Grab 21. |
| |
| |
|
(Foto von Elisabeth
Böhrer) |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 418-419. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 121. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 395-396.
|
 | Cornelia Binder und Michael (Mike) Mence: Last Traces /
Letzte Spuren von Deutschen jüdischen Glaubens im Landkreis Bad Kissingen.
Schweinfurt 1992. |
 | dieselben: Nachbarn der Vergangenheit / Spuren von
Deutschen jüdischen Glaubens im Landkreis Bad Kissingen mit dem Brennpunkt
1800 bis 1945 / Yesteryear's Neighbours. Traces of German Jews in the administrative district of Bad Kissingen focusing on the period
1800-1945. Erschienen 2004. ISBN 3-00-014792-6. Zu beziehen bei den
Autoren/obtainable from: E-Mail.
Info-Blatt
zu dieser Publikation (pdf-Datei). |
 | Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen
Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche
Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.
Würzburg 2008. S. 99. |
 | Geheimnisvolles Masken aus der Rhön - Von jüdischen
und christlichen Bartmännern (Hrsg. vom Hessischen Landesmuseum
Darmstadt). Eine Ausstellung des Hessischen Landesmuseums in der
Außenstelle Lorsch 6.2.2005 bis 18.9.2005.
In dieser Publikation der Bericht zum Novemberpogrom 1938 in Unterriedenberg
S. 146-147. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Unterriedenberg Lower
Franconia. A Jewish community was present from at least the late 18th century,
numbering 84 in 1867 (of a total 298) and 32 in 1933. Under Nazi rule, Jewish
cattle traders were forced to sell off their stock. Twenty Jews left before Kristallnacht
(9-10 November 1938), 15 for other German cities. On Kristallnacht SA
troops wrecked Jewish homes. The remaining 11 Jews left for Frankfurt on 10
December.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|