|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht "Synagogen im Stadtkreis Wiesbaden"
Schierstein mit
Frauenstein (Stadt
Wiesbaden)
Jüdische Geschichte / Synagoge
(Seite wurde erstellt unter Mitarbeit von Dorothee
Lottmann-Kaeseler)
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Schierstein bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/42. Ihre
Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1853 14 Familien beziehungsweise Haushaltungen, 1858 20
wahlberechtigte Mitglieder, 1867 8 jüdische Familien, 1868 11 Familien
(einschließlich Frauenstein) mit 56 Personen, davon 10 schulpflichtige Kinder,
1871 52 jüdische Einwohner (2,7 % von insgesamt 1.906 Einwohner), 1885 50 (2,1
% von 2.423), 1895 70 (2,4 % von 2.976), 1905 45 (1,0 '% von 4.431).
Zur jüdischen Gemeinde Schierstein gehörten auch die in Frauenstein
lebenden jüdischen Personen. Dabei handelte es sich um Angehörige der Familie
von Simon Salmon (aus Merzig) und seiner Frau Amalie geb. Kahn, Familienfotos
siehe bei http://www.before-the-holocaust.net/
unter Frauenstein). Mitte der 1920er-Jahre lebten außer dem Ehepaar noch
die Tochter Rosa im Haus sowie der Sohn Saly mit Ehefrau Selma und dem ersten
Enkel (Siegfried, geb. 1924).
Die jüdischen Haushaltsvorsteher in Schierstein verdienten den Lebensunterhalt
der Familien bis weit ins 19. Jahrhundert hinein überwiegend als Händler; in
Frauenstein gab es mehrere Metzger. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gab es
mehrere jüdische Kaufläden und Handelsgeschäfte am Ort, die jüdischen
Personen gehörten.
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zogen mehrere der jüdischen Einwohner /
Familien in umliegende Städte, vor allem nach Wiesbaden, unter ihnen
Julius Herz (geb. 1819 in Schierstein, seit 1843 Hofjuwelier in Wiesbaden; das
Geschäft - zuletzt unter den Namen Netter Herz & Heimerdinger - bestand bis
zur zwangsweisen "Arisierung" 1938) oder Joseph Mayer Baum (geb. 1813
in Schierstein: in Wiesbaden begründete er die Fa. "Nassauische
Leinenindustrie J.M. Baum", die um 1900 zu einem Unternehmen von
Weltgeltung wurde; vgl. unten Bericht zum Tod von Joseph Baum [geb. 1874 in
Schierstein]; die Firma wurde in der NS-Zeit gleichfalls zwangsweise
"arisiert"; aus der Familie Baum stammt der Gründungsdirektor des
Ulmer Museums Prof. Dr. Julius Baum [geb. 1882 in Wiesbaden], vgl. Familiengeschichte
Baum in einer Website; zu Julius Baum siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Julius_Baum).
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine
Religionsschule, ein rituelles Bad und ein Friedhof.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter (Kantor) und Schochet tätig war (vgl.
unten Ausschreibung der Stelle 1865). Um 1860/65 war Lehrer Josua Thalheimer
einige Zeit am Ort. Ob auf die Ausschreibung von 1865 (möglicherweise nach dem
Weggang von Lehrer Thalheimer) sich wieder ein Lehrer beworben hat, ist nicht
bekannt, zumal die Gemeinde damals sehr verarmt war. Ab 1869-70 unterrichtete
Lehrer Simon Ackermann aus Eltville die jüdischen Kinder in Schierstein. Die
Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk Wiesbaden. 1879 schloss sich die Gemeinde
geschlossen der (orthodoxen) Israelitischen Religionsgesellschaft in Wiesbaden
an.
An jüdischen Vorstehern sind bekannt: 1855 Josef Baum, 1867 Abraham Kahn, 1891
Tobias Kahn, ab 1906 Daniel Kahn, um 1924 Samuel Kahn.
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Siegfried Salmon
(geb. 26.12.1882 in Frauenstein, gef. 12.5.1915). Außerdem sind gefallen:
Vizefeldwebel Berthold Rosengarten (geb. 25.9.1886 in Schierstein, vor 1914 in
Remscheid wohnhaft, gef. 31.7.1916) und Heinrich Kahn (geb. 24.3.1889 in
Schierstein, vor 1914 in Ulm wohnhaft, gef. 16.7.1918).
Einige der jüdischen Familien waren seit der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts zu einigem Wohlstand gekommen, unter ihnen Metzger Karl Israel
(geb. 1890), dem das Haus Wilhelmstraße 40 in Schierstein gehörte. Es war auch
Miteigentümer an dem Hof Luisenstraße 6 und Eigentümer eines Bauplatzes im
Neuen Weg 3 und weiterer Grundstücke am Ort (weitere Informationen zur Familie
Karl Israel siehe pdf-Datei
des "Aktiven Museums Spiegelgasse").
Um 1924, als zur Gemeinde noch etwa 60 Personen gehörten (1,2 % von
insgesamt etwa 5.000 Einwohner), war Gemeindevorsteher der bereits genannte
Samuel Kahn. Als Lehrer, Kantor und Schochet war (bereits seit 1905) Arnold
Katzenstein tätig. Er unterrichtete an der Religionsschule der Gemeinde
damals vier Kinder und erteilte den Religionsunterricht an der Volksschule des
Ortes. Gleichfalls unterrichtete der die jüdischen Kinder in einigen
umliegenden jüdischen Gemeinde (u.a. in Eltville).
1932 war Gemeindevorsteher Karl Kahn (bereits seit 1932). Als
Lehrer war weiterhin Arnold Katzenstein tätig (vgl. Bericht zum Tod seiner Frau
1933 siehe unten; dort wird Lehrer Katzenstein als "Vater des
Rheingaues" bezeichnet). Im Schuljahr 1931/32 unterrichtete er sieben Kinder in
Religion. An jüdischen Vereinen gab es insbesondere - gemeinsam mit der
Gemeinde Biebrich - den Israelitischen Männerkrankenverein (gegründet
1839, siehe Bericht zum 70-jährigen Bestehen 1909 unten).
1933 lebten noch etwa 60 jüdische Personen in Schierstein.
In
den folgenden Jahren ist ein Teil der
jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,
der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Im Oktober 1935 wurde
ein jüdischer Viehhändler, der verbotenerweise ein Kalb geschächtet hatte,
angezeigt und mit anderen Gemeindegliedern verhaftet. Er erhielt drei Monate
Gefängnisstrafe (siehe Bericht unten). Beim Novemberpogrom 1938 wurde
die Synagoge zerstört (s.u.). Danach überfielen die SA-Männer die Geschäfte
und Wohnungen jüdischer Familien (u.a. des Metzgermeisters Israel, der Kaufleute
Katz, Kahn, des Lehrers Katzenstein, von Robert Kahn, der Geschwister Schönberger sowie des
Metzgermeisters Löwenthal). An der Plünderung der Geschäfte beteiligte sich
auch die Schiersteiner Bevölkerung. Ende 1938 mussten die letzten jüdischen
Gewerbetreibenden ihre Geschäfte schließen, darunter Karl Israel. Er musste
auch sein Haus unter Wert verkaufen. Am 11. September 1941 wurde Familie Israel
mit anderen jüdischen Personen zwangsweise in das "Judenhaus"
Luisenstraße 6 einquartiert. Die letzten jüdischen Einwohner
Schiersteins wurden am 10. Juni 1942 deportiert, unter ihnen Familie Karl Israel
und der Lehrer Arnold
Katzenstein.
Von den in Schierstein geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Dr. Alexander
Bayerthal (1867),
Emma Blättner
geb. Kahn (1876), Hedwig Israel geb. Hallgarten (1895), Herta Israel (1925),
Karl Israel (1890), Margot Israel (1928), Rosel Israel (1922), Emmi (Emilie) Kahn geb. Teutsch (1905),
Walter Kahn (1937), Otto
Kahn (1891), Arnold
Katzenstein (1869), Walter Koch (1910), Bertha Schönberger (1870), Hilda Teutsch geb. Rauh
(1875), Isak Teutsch (1863).
Zu mehreren der genannten Personen gibt es "Erinnerungsblätter"
und weitere Informationen in der Website des aktiven Museums Spiegelgasse
(jeweils pdf-Dateien): zu Dr.
Alexander Bayerthal - Familie
Karl und Hedwig Israel mit ihren drei Töchtern) - Familie
Otto und Emilie Kahn mit Sohn Walter.
Von den in Frauenstein geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"):
Gertrud Katz (1891), Selma Salmon (1892), Ilse Salmon (1928), Rosa Salmon (1894), Siegfried
Salmon (1923), Walter Salmon (1929).
Über das Schicksal der Familie Salmon informieren ein in der Website des
aktiven Museums Spiegelgasse eingestellter Presseartikel
sowie ein Erinnerungsblatt
(pdf-Datei).
Anmerkung
zu den Namenslisten Schierstein und Frauenstein:
eine
Auswertung der genannten Quellen ergibt keine vollständigen Listen, da die
beiden Orte Schiersten und Frauenstein bereits 1926 beziehungsweise 1928 nach
Wiesbaden eingemeindet wurden und die Namen der umgekommenen jüdischen
Einwohner in den beiden Orte teilweise unter Wiesbaden genannt werden.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet
1865 / 1895
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit’ vom 9. August 1865: "Die Stelle eines
Lehrers und Vorbeters ist Ende des Sommersemesters in unserer Gemeinde
vakant; auch kann damit der Schächterdienst, welcher ca. 120 Gulden einträgt,
verbunden werden. Bewerber wollen sich melden bei dem Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit’ vom 9. August 1865: "Die Stelle eines
Lehrers und Vorbeters ist Ende des Sommersemesters in unserer Gemeinde
vakant; auch kann damit der Schächterdienst, welcher ca. 120 Gulden einträgt,
verbunden werden. Bewerber wollen sich melden bei dem
Vorstand M. Liebmann. Schierstein, August 1865." |
| |
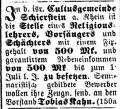 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Juni 1895: "In der israelitischen
Kultusgemeinde Schierstein am Rhein ist die Stelle eines
Religionslehrers, Vorsängers und Schächters mit einem Fixgehalt
von 500 Mark und garantiertem Nebeneinkommen von 500 Mark bis
zum 1. Juli laufenden Jahres zu besetzen. Seminaristisch gebildete
Bewerber wollen ihre Zeugnisse senden an den Vorstand Tobias Kahn." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Juni 1895: "In der israelitischen
Kultusgemeinde Schierstein am Rhein ist die Stelle eines
Religionslehrers, Vorsängers und Schächters mit einem Fixgehalt
von 500 Mark und garantiertem Nebeneinkommen von 500 Mark bis
zum 1. Juli laufenden Jahres zu besetzen. Seminaristisch gebildete
Bewerber wollen ihre Zeugnisse senden an den Vorstand Tobias Kahn."
|
Über
Lehrer Josua Thalheimer (1905, Lehrer in Schierstein um
1860?)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 12. Mai 1905:
"Falkenstein im Taunus.
Am 1. Mai schied der hiesige israelitische Lehrer Thalheimer aus seiner
beinahe 35 Jahre innegehabten Stellung, um in den Ruhestand zu treten.
Seine Amtstätigkeit begann er 1855 in Hochheim
am Main, wirkte in Schierstein, Lorsbach und Camberg,
um dann anfangs der 70er-Jahre zunächst nach Königstein
und 1875 nach Falkenstein
überzusiedeln". Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 12. Mai 1905:
"Falkenstein im Taunus.
Am 1. Mai schied der hiesige israelitische Lehrer Thalheimer aus seiner
beinahe 35 Jahre innegehabten Stellung, um in den Ruhestand zu treten.
Seine Amtstätigkeit begann er 1855 in Hochheim
am Main, wirkte in Schierstein, Lorsbach und Camberg,
um dann anfangs der 70er-Jahre zunächst nach Königstein
und 1875 nach Falkenstein
überzusiedeln". |
| Anmerkung: unklar ist die Nennung von
Lorsbach, da es dort zu keiner Zeit eine jüdische Gemeinde gab,
vermutlich auch zu keiner Zeit mehrere jüdische Familien gelebt
haben. |
Nennung von
Lehrer Heymann in Schierstein bei einer Lehrerkonferenz in Singhofen (1864)
 Artikel
in "Der Israelitische Lehrer" vom 6. Oktober 1864:
"Aus Nassau. Zu Singhofen
(Amt Nassau) hat am 19. September eine Versammlung israelitischer Lehrer zu
dem Zwecke stattgefunden, einen gemeinsamen Anschluss an den
Unterstützungsverein zu bewerkstelligen. Diese Versammlung war von den
Herren Friedberg aus Nastätten,
Morgenthal aus Holzappel,
Emmel aus Limburg, Levi aus
Eltville, Laubheim aus
Singhofen, Aron aus
Kördorf (nicht: Kirdorf),
Friedberg aus Ruppertshofen
besucht (Heymann aus Schierstein hatte seine Verhinderung
angezeigt). Als vorzüglichster Erfolg dieser Vorberatung haben wir vorläufig
mitzuteilen, dass Anfangs November eine größere Versammlung in
Limburg a.L. stattfinden soll, und dass
als Vertrauensmann Herr Friedberg aus
Ruppertshofen bestimmt worden,
welcher die Einladung (an Rabbiner, Vorstände, Lehrer und Gemeindeglieder
erlassen wird, und bei welchem auch die Anmeldungen zu machen sind. Die
betreffende Ansprache wird in einer der nächsten Nummern des 'Israelitischen
Lehrer' erscheinen." Artikel
in "Der Israelitische Lehrer" vom 6. Oktober 1864:
"Aus Nassau. Zu Singhofen
(Amt Nassau) hat am 19. September eine Versammlung israelitischer Lehrer zu
dem Zwecke stattgefunden, einen gemeinsamen Anschluss an den
Unterstützungsverein zu bewerkstelligen. Diese Versammlung war von den
Herren Friedberg aus Nastätten,
Morgenthal aus Holzappel,
Emmel aus Limburg, Levi aus
Eltville, Laubheim aus
Singhofen, Aron aus
Kördorf (nicht: Kirdorf),
Friedberg aus Ruppertshofen
besucht (Heymann aus Schierstein hatte seine Verhinderung
angezeigt). Als vorzüglichster Erfolg dieser Vorberatung haben wir vorläufig
mitzuteilen, dass Anfangs November eine größere Versammlung in
Limburg a.L. stattfinden soll, und dass
als Vertrauensmann Herr Friedberg aus
Ruppertshofen bestimmt worden,
welcher die Einladung (an Rabbiner, Vorstände, Lehrer und Gemeindeglieder
erlassen wird, und bei welchem auch die Anmeldungen zu machen sind. Die
betreffende Ansprache wird in einer der nächsten Nummern des 'Israelitischen
Lehrer' erscheinen." |
Über Lehrer Arnold Katzenstein
(Lehrer in Schierstein von 1896 bis 1938/39)
Arnold Katzenstein ist am 17. Oktober 1869 in Neuhof geboren.
Seit 1896 (nach der Ausschreibung der Stelle 1895 siehe oben) war er als Lehrer, Kantor und Schochet in Schierstein tätig. Wegen seiner vielen
Ämter und auf Grund seines engagierten Wirkens war er am Ort und in der
Umgebungen (auch in Eltville,
Rüdesheim a. Rhein und
Hochheim am Main) sehr beliebt. Er galt
in den jüdischen Gemeinden als "Vater des Rheingaus". Arnold Katzenstein war
verheiratet mit Berta geb. Loeb (geb. 17. März 1868, gest. 13. März 1933, siehe Bericht zu
ihrem Tod unten). Die beiden hatten eine früh verstorbene Tochter Gita Elsa
(geb. 6. Juni 1896, gestorben im Alter von drei Monaten). 1900 adoptierte
das Ehepaar ein russisch-jüdisches Waisenkind. Katzensteins wohnten in
Schierstein in der Wörthstr. 6 (heute Milanstraße). Beim Novemberpogrom 1938
wurde Katzensteins Wohnung zerstört und geplündert. Er musste in einen
bescheidenen Anbau ziehen, 1939 nach Wiesbaden in die Herderstraße 11. Am 1. September 1942 wurde er in das Ghetto
Theresienstadt deportiert, von hier aus in das Vernichtungslager Treblinka, wo
er am 29. September 1942 ermordet wurde.
Siehe auch Erinnerungsblatt
des "Aktiven Museums Spiegelgasse" Wiesbaden).
Lehrer Katzenstein in Schierstein wird bei einer
Lehrerkonferenz genannt (1898)
 Artikel
in "Der Israelit" vom 1. August 1898:
"Limburg, 28. Juli (1898). (Der Verein
israelitischer Lehrer Nassaus) hielt am 17. dieses Monats hier im
'Preußischen Hof' seine Generalversammlung ab... Es wurde eine
Kommission ernannt, bestehend aus den Herren Katzenstein -
Schierstein, Oppenheimer - Hadamar..." Artikel
in "Der Israelit" vom 1. August 1898:
"Limburg, 28. Juli (1898). (Der Verein
israelitischer Lehrer Nassaus) hielt am 17. dieses Monats hier im
'Preußischen Hof' seine Generalversammlung ab... Es wurde eine
Kommission ernannt, bestehend aus den Herren Katzenstein -
Schierstein, Oppenheimer - Hadamar..." |
Lehrer Katzenstein in Schierstein referiert bei einer
Lehrerkonferenz (1899)
 Artikel
in "Der Israelit" vom 2. November 1899:
"Verein der israelitischen Lehrer des ehemaligen Herzogtums Nassau.
Auszug aus dem Bericht über die Jahresversammlung zu Wiesbaden. Nach
mehreren Einleitungsreden wird in die Tagesordnung eingetreten. Es erhält
das Wort Herr Kollege Katzenstein - Schierstein zu seinem Thema
'Welche Mittel stehen dem israelitischen Lehrer zu Gebote, die Religiosität
in seiner Gemeinde zu heben'. Der Herr Referent hat sich in der Tat ein sehr
schwieriges, aber auch sehr lohnendes Thema gestellt. In dem mit großem
Fleiße ausgearbeiteten Vortrag sucht der Referent zu konstatieren, dass
besonders in den 'Landgemeinden' die Religiosität sehr abgenommen habe; das
beweise der spärtliche Besuch des öffentlichen Gottesdienstes sogar am
Sabbat. Artikel
in "Der Israelit" vom 2. November 1899:
"Verein der israelitischen Lehrer des ehemaligen Herzogtums Nassau.
Auszug aus dem Bericht über die Jahresversammlung zu Wiesbaden. Nach
mehreren Einleitungsreden wird in die Tagesordnung eingetreten. Es erhält
das Wort Herr Kollege Katzenstein - Schierstein zu seinem Thema
'Welche Mittel stehen dem israelitischen Lehrer zu Gebote, die Religiosität
in seiner Gemeinde zu heben'. Der Herr Referent hat sich in der Tat ein sehr
schwieriges, aber auch sehr lohnendes Thema gestellt. In dem mit großem
Fleiße ausgearbeiteten Vortrag sucht der Referent zu konstatieren, dass
besonders in den 'Landgemeinden' die Religiosität sehr abgenommen habe; das
beweise der spärtliche Besuch des öffentlichen Gottesdienstes sogar am
Sabbat. |
 In
der alten Zeit habe man im Gotteshause an Wochentagen mehr Andächtige
gefunden, wie jetzt an Sabbat- und Festtagen. Vereine zu Torastudium und
Bauen von Sukkots (sc. Laubhütten) finde man selten; die Vereine der guten
alten Zeit sind eingegangen. Es entspinnt sich eine sehr rege und
interessante Debatte..." In
der alten Zeit habe man im Gotteshause an Wochentagen mehr Andächtige
gefunden, wie jetzt an Sabbat- und Festtagen. Vereine zu Torastudium und
Bauen von Sukkots (sc. Laubhütten) finde man selten; die Vereine der guten
alten Zeit sind eingegangen. Es entspinnt sich eine sehr rege und
interessante Debatte..."
Zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken. |
Aus dem jüdischen Gemeinde- und
Vereinsleben
70-jähriges Jubiläum des Israelitischen
Männerkrankenvereins Biebrich, Schierstein und Frauenstein
(1909)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit von 4. März 1909:
"Biebrich am Rhein, 20. Februar. Am 18. Februar, 27.
Schewat, feierte
der Israelitische Männerkrankenverein Biebrich, Schierstein und
Frauenstein sein 70jähriges Jubiläum. Die Feier wurde durch einen
besonderen Festgottesdienst durch Herrn Lehrer Sulzbacher - Biebrich
eingeleitet. Alsdann folgte der alljährlich am Stiftungsfeste
stattfindende Jom-Kippur-Katan-Gottesdienst. Gegen 3 Uhr
versammelten sich die Mitglieder zur Generalversammlung und dem
darauf folgenden Festmahle. Zunächst ergriff der Vorsitzende des Vereins,
Herr Josef Kahn das Wort, um die fast vollzählig erschienenen Mitglieder
willkommen zu heißen. Im weiteren Verlaufe seiner Rede gedachte Herr Kahn
der Gründer des Vereins und bat, unter Hinweis auf die schon damals
festgelegten wohltätigen Zwecke und Ziele, alle Anwesenden durch festes
Zusammenhalten dafür Sorge zu tragen, dass das von den Vorfahren
übernommene Erbe auf ewige Zeiten erhalten bleibe. Herr M. Reifenberg
dankte für die erwiesene Ehrung in bewegten Worten. Weitere Ansprachen
hielten die Herren Lehrer Sulzbacher - Biebrich und Katzenstein -
Schierstein."
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit von 4. März 1909:
"Biebrich am Rhein, 20. Februar. Am 18. Februar, 27.
Schewat, feierte
der Israelitische Männerkrankenverein Biebrich, Schierstein und
Frauenstein sein 70jähriges Jubiläum. Die Feier wurde durch einen
besonderen Festgottesdienst durch Herrn Lehrer Sulzbacher - Biebrich
eingeleitet. Alsdann folgte der alljährlich am Stiftungsfeste
stattfindende Jom-Kippur-Katan-Gottesdienst. Gegen 3 Uhr
versammelten sich die Mitglieder zur Generalversammlung und dem
darauf folgenden Festmahle. Zunächst ergriff der Vorsitzende des Vereins,
Herr Josef Kahn das Wort, um die fast vollzählig erschienenen Mitglieder
willkommen zu heißen. Im weiteren Verlaufe seiner Rede gedachte Herr Kahn
der Gründer des Vereins und bat, unter Hinweis auf die schon damals
festgelegten wohltätigen Zwecke und Ziele, alle Anwesenden durch festes
Zusammenhalten dafür Sorge zu tragen, dass das von den Vorfahren
übernommene Erbe auf ewige Zeiten erhalten bleibe. Herr M. Reifenberg
dankte für die erwiesene Ehrung in bewegten Worten. Weitere Ansprachen
hielten die Herren Lehrer Sulzbacher - Biebrich und Katzenstein -
Schierstein." |
Allgemeine Gemeindebeschreibung (1936!)
 Artikel
im "Gemeindeblatt der Israelitischen Gemeinde Frankfurt" vom 20. Juli
1936: "Wiesbaden – Schierstein, Südwestecke von Groß-Wiesbaden,
altes Fischerdorf, dessen Geschichte sich im Schatten von Wiesbaden und
Biebrich vollzog; um 1200 Sitz der Ritter von Schierstein. Heute viel
aufgesucht von Liebhabern frisch gekochter oder gebratener Rheinfische und
von Besuchern des schönen Rheinstrandbades. – Verhältnismäßig hohe
und strenge Synagoge, erbaut 1858. Rechts vom Toraschrein ein geschnitzter
Holzständer mit reichem Blätter- und Früchteschmuck, gekrönt vom
nassauischen Wappen. Er trägt zwei Tafeln mit dem Gebet für den
Landesherrn. Das Ganze ist Geschenk ‚Seiner Erlaucht Herrn Grafen
Wenzelaus Carl zu Leiningen-Billigheim’. Tempora mutantur: 1096 führt
ein Vorfahr dieses Herrn, Graf Emicho zu Leiningen, die Scharen der
Kreuzfahrer gegen die Juden zu Mainz, Worms und Speyer. – Schön
geschnitzte Menorah links vom Oraun (Toraschrein) Älter als die Synagoge
ist die hundertjährige Chewra (Wohltätigkeitsverein) Biebrich –
Schierstein – Frauenstein. – Nun in zweistündigem Marsch den Rhein
entlang durch Niederwalluf, wo niemals Juden wohnten, nach…" Artikel
im "Gemeindeblatt der Israelitischen Gemeinde Frankfurt" vom 20. Juli
1936: "Wiesbaden – Schierstein, Südwestecke von Groß-Wiesbaden,
altes Fischerdorf, dessen Geschichte sich im Schatten von Wiesbaden und
Biebrich vollzog; um 1200 Sitz der Ritter von Schierstein. Heute viel
aufgesucht von Liebhabern frisch gekochter oder gebratener Rheinfische und
von Besuchern des schönen Rheinstrandbades. – Verhältnismäßig hohe
und strenge Synagoge, erbaut 1858. Rechts vom Toraschrein ein geschnitzter
Holzständer mit reichem Blätter- und Früchteschmuck, gekrönt vom
nassauischen Wappen. Er trägt zwei Tafeln mit dem Gebet für den
Landesherrn. Das Ganze ist Geschenk ‚Seiner Erlaucht Herrn Grafen
Wenzelaus Carl zu Leiningen-Billigheim’. Tempora mutantur: 1096 führt
ein Vorfahr dieses Herrn, Graf Emicho zu Leiningen, die Scharen der
Kreuzfahrer gegen die Juden zu Mainz, Worms und Speyer. – Schön
geschnitzte Menorah links vom Oraun (Toraschrein) Älter als die Synagoge
ist die hundertjährige Chewra (Wohltätigkeitsverein) Biebrich –
Schierstein – Frauenstein. – Nun in zweistündigem Marsch den Rhein
entlang durch Niederwalluf, wo niemals Juden wohnten, nach…" |
Anschluss der in Schierstein und Frauenstein lebenden
jüdischen Personen an die orthodoxe israelitische Religionsgesellschaft in
Wiesbaden (1879)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Dezember 1879. "Wiesbaden,
30. November (1879). Sämtliche Mitglieder der israelitischen
Kultusgemeinde Schierstein-Frauenstein sind unter Beachtung der
desfallsigen Gesetzesvorschriften, also Erklärung vor dem Gerichte, aus
der seitherigen Kultusgemeinschaft ausgetreten und werden sich nun der
seit Anfang dieses Jahres dahier mit Korporationsrechten bestehenden
orthodoxen israelitischen Religionsgesellschaft anschließen. Der Zweck
dieses Austritts, der Aufsicht des reformatorischen Grundsätzen
huldigenden Bezirksrabbiners Süskind überhoben zu werden, dürfte
hiermit erreicht sein." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Dezember 1879. "Wiesbaden,
30. November (1879). Sämtliche Mitglieder der israelitischen
Kultusgemeinde Schierstein-Frauenstein sind unter Beachtung der
desfallsigen Gesetzesvorschriften, also Erklärung vor dem Gerichte, aus
der seitherigen Kultusgemeinschaft ausgetreten und werden sich nun der
seit Anfang dieses Jahres dahier mit Korporationsrechten bestehenden
orthodoxen israelitischen Religionsgesellschaft anschließen. Der Zweck
dieses Austritts, der Aufsicht des reformatorischen Grundsätzen
huldigenden Bezirksrabbiners Süskind überhoben zu werden, dürfte
hiermit erreicht sein." |
Berichte zu einzelnen
Personen aus der Gemeinde
Otto Kahn wurde zum preußischen Offizier befördert (1916)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. September
1916: "Schierstein am Rhein. Vizefeldwebel und Inhaber des Eisernen
Kreuzes Otto Kahn, Sohn des Gemeindeverordneten und Vorstehers der
israelitischen Gemeinde Daniel Kahn, Inhaber der Firma Gebrüder Kahn, ist
zum preußischen Offizier befördert worden." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. September
1916: "Schierstein am Rhein. Vizefeldwebel und Inhaber des Eisernen
Kreuzes Otto Kahn, Sohn des Gemeindeverordneten und Vorstehers der
israelitischen Gemeinde Daniel Kahn, Inhaber der Firma Gebrüder Kahn, ist
zum preußischen Offizier befördert worden." |
Hochzeitsanzeige für Otto Kahn und
Emmi geb. Teutsch (1936)
 Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 30. Januar 1936: Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 30. Januar 1936:
"Otto Kahn - Emmi
Kahn geb. Teutsch
Vermählte.
Wiesbaden/Schierstein - Venningen (Rheinland-Pfalz)
Trauung: Venningen 2. Februar 1936." |
Anmerkung: Otto Kahn und
seine Frau Emmi Kahn geb. Teutsch wurden gemeinsam mit dem 1937
geborenen Sohn Walter 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert,
später nach Auschwitz, wo alle drei ermordet wurden.
Erinnerungsblatt im "Aktiven Museum Spiegelgasse" in Wiesbaden:
https://www.am-spiegelgasse.de/wp-content/downloads/erinnerungsblaetter/EB-Kahn-Otto.pdf
|
Zum Tod des aus Schierstein stammenden Königlich
Preußischen Kommerzienrates Joseph Baum (Inhaber einer Leinenhandlung in
Wiesbaden (1917)
Weitere Informationen zu Joseph Baum, Vorsitzender der Deutschen
Gesellschaft für Kaufmannserholungsheime
Siehe u.a.
https://www.wiesbaden.de/microsite/stadtlexikon/a-z/baum_joseph.php
Zu dem 1913 eröffneten "Joseph-Baum-Haus" in Wiesbaden:
https://www.wiesbaden.de/microsite/stadtlexikon/a-z/Joseph-Baum-Haus.php
Über die Nassauische Leinenindustrie Joseph Maier Baum https://www.wiesbaden.de/microsite/stadtlexikon/a-z/Nassauische_Leinenindustrie_Joseph_Maier_Baum.php
(sc. die Firma wurde als kleines Geschäft in Schierstein gegründete und
entwickelte sich in Wiesbaden zum bedeutenden Industrieunternehmen; nach dem
Ersten Weltkrieg nach Frankfurt verlegt).
Joseph Baum (1874-1917) und Hermann Baum (1877-1923) waren Söhne von Salomon
Baum (1844-1899), des Mitinhabers der Textilfirma Nassauische Leinenindustrie
Joseph Maier Baum.
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. April 1917:
"Wiesbaden, 30. März (1917). In dem am Samstag, den 24. dieses
Monats dahingegangenen Königlich Preußischen Kommerzienrat Joseph Baum
ist nicht nur einer unserer hervorragendsten Kaufleute aus dem Leben
geschieden, sondern auch ein Mann von tiefem sozialen Empfinden, ein
aufrechter, gläubiger Jude, der mit der Liebe zu seinen Mitmenschen wie zur
Natur einen weiten Blick dafür verband, was dem deutschen Kaufmann bislang
mangelte. Durch Begründung der Kaufmannserholungsheime ist Baum im ganzen
Deutschen Reiche bekannt geworden, und bei Gelegenheit der Eröffnung des
Heims im Taunus wurde ihm die Ernennung zum Kommerzienrat vom Minister
persönlich überbracht. Baum entstammte einer angesehenen jüdischen Familie
in Schierstein im Rheingau. In jungen Jahren bereits übernahm er mit seinem
. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. April 1917:
"Wiesbaden, 30. März (1917). In dem am Samstag, den 24. dieses
Monats dahingegangenen Königlich Preußischen Kommerzienrat Joseph Baum
ist nicht nur einer unserer hervorragendsten Kaufleute aus dem Leben
geschieden, sondern auch ein Mann von tiefem sozialen Empfinden, ein
aufrechter, gläubiger Jude, der mit der Liebe zu seinen Mitmenschen wie zur
Natur einen weiten Blick dafür verband, was dem deutschen Kaufmann bislang
mangelte. Durch Begründung der Kaufmannserholungsheime ist Baum im ganzen
Deutschen Reiche bekannt geworden, und bei Gelegenheit der Eröffnung des
Heims im Taunus wurde ihm die Ernennung zum Kommerzienrat vom Minister
persönlich überbracht. Baum entstammte einer angesehenen jüdischen Familie
in Schierstein im Rheingau. In jungen Jahren bereits übernahm er mit seinem
. |
 Bruder
Hermann gemeinsam das väterliche Geschäft in Wiesbaden, eine große
Leinenhandlung, die die beiden Herren durch Angliederung von Webereien zu
hoher Blüte brachten..." Bruder
Hermann gemeinsam das väterliche Geschäft in Wiesbaden, eine große
Leinenhandlung, die die beiden Herren durch Angliederung von Webereien zu
hoher Blüte brachten..."
Zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken. |
Zum Tod von Berta Katzenstein - Frau von Lehrer Arnold Katzenstein (1933)
 Artikel
in der "Jüdischen Wochenzeitung für Wiesbaden und Umgebung"
vom 24. März 1933: "Frau Berta Katzenstein-Schierstein seligen
Andenkens. Artikel
in der "Jüdischen Wochenzeitung für Wiesbaden und Umgebung"
vom 24. März 1933: "Frau Berta Katzenstein-Schierstein seligen
Andenkens.
Am Dienstag, den 14. März wurde in Schierstein Frau Berta Katzenstein zu
Grabe getragen. Mit ihr ist eine der tätigsten und beliebtesten Jüdinnen
unserer Gegend dahingegangen. Nicht zum wenigsten ihr Verdienst ist es,
wenn Lehrer Katzenstein, mit dem sie in mehr als 40-jähriger Ehe
verbunden war, der Vater des Rheingaues heißt. Die Wahrhaftigkeit ihrer
jüdischen Frömmigkeit bewährten die Eheleute besonders, als sie in den
Anfangsjahren des Jahrhunderts eine russische Pogromwaise übernahmen, und
es völlig an die Stelle der ihnen versagten eigenen Kinder treten
ließen.
Am Grabe würdigte Herr Stadt- und Bezirksrabbiner Dr. Lazarus die
Persönlichkeit und die Verdienste der Verstorbenen. Der jüdische
Friedhofsteil konnte die große Zahl der Trauernden, Juden und Nichtjuden,
bei weitem nicht fassen.
L.L." |
Ein jüdischer Viehhändler wird auf Grund von
NS-Bestimmungen verurteilt (1935)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Oktober 1935: "Wiesbaden. Ein jüdischer
Viehhändler aus Schierstein, der beschuldigt wurde, Ende August ein Kalb
nach jüdischem Ritus geschächtet zu haben, was seinerzeit eine Erregung
verursacht hat, die zu der Inschutzhaftnahme mehrerer jüdischer Einwohner
geführt hat, wurde vom Wiesbadener Amtsgericht zu einer Gefängnisstrafe
von drei Monaten unter Anrechnung von einem Monat Untersuchungshaft
verurteilt." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Oktober 1935: "Wiesbaden. Ein jüdischer
Viehhändler aus Schierstein, der beschuldigt wurde, Ende August ein Kalb
nach jüdischem Ritus geschächtet zu haben, was seinerzeit eine Erregung
verursacht hat, die zu der Inschutzhaftnahme mehrerer jüdischer Einwohner
geführt hat, wurde vom Wiesbadener Amtsgericht zu einer Gefängnisstrafe
von drei Monaten unter Anrechnung von einem Monat Untersuchungshaft
verurteilt." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige des Manufaktur-, Konfektions- und
Schuhwarengeschäftes Carl Katz (1901)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. September 1901: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. September 1901:
"Lehrling.
Suche für mein Manufaktur-, Konfektions- und Schuhwarengeschäft einen
Lehrling bei freier Kost und Logis.
Carl Katz, Schierstein am Rhein." |
|
Kennkarte
aus der NS-Zeit |
| |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |
| |
Kennkarte
des in Schierstein
geborenen Eugen Schönberger |

|
|
| |
Kennkarte (ausgestellt
in Mainz 1939) für Isaak Eugen Schönberger (geb. 5.
November 1871 in Schierstein),
Weiteres zu ihm und seiner Lebensgeschichte siehe Wikipedia-Artikel
Eugen Schönberger (Fabrikant) |
|
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst (in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts)
wurden die Gottesdienste in einem Betraum abgehalten, wobei es sich um einen
"kellerartigen, dumpf-feuchten Raum" (Arnsberg S. 270) gehandelt haben
soll. 1853 beziehungsweise 1855 beschloss die Gemeinde den Neubau
einer Synagoge und erwarb hierfür ein Grundstück in der damaligen
Kirchstraße. Die Bauarbeiten begonnen mit der Vergabe der Gewerke Ende 1856. Am
18. September 1857 konnte die Synagoge eingeweiht werden. Im Betsaal gab
es 40 Männer-, auf der Empore 24 Frauenplätze. Graf Wenzelaus Carl zu
Leiningen-Billigheim stiftete einen schön geschnitzten Holzständer mit dem
nassauischen Wappen, der
rechts vom Toraschrein aufgestellt wurde und mit reichem Blätter- und Früchtewerk
verziert war, gekrönt vom
nassauischen Wappen. Auf dem Holzständer waren zwei Tafeln mit dem Gebet für den
Landesherrn angebracht. Da die Regierung für den Synagogenbau keine
Unterstützung gegeben hatte, geriet die jüdische Gemeinde in eine finanzielle
Notlage. Zudem verzogen in den folgenden Jahren mehrere Familien vom
Ort.
Einweihung der Synagoge in Schierstein (September 1857)
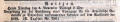 Mitteilung
im "Wiesbadener Tagblatt" vom 6. November 1856: "Notizen. Mitteilung
im "Wiesbadener Tagblatt" vom 6. November 1856: "Notizen.
Heute Dienstag den 6. November mittags 2 Uhr:
Vergebung der bei Errichtung einer Synagoge für die israelische Gemeinde zu
Schierstein vorkommenden Arbeiten auf dem Rathaus daselbst. Siehe Tagblatt
Nummer 259." |
| |
 Mitteilung
im "Wiesbadener Tagblatt" vom 19. September 1857: "Unserer israelitischen
Gemeinde ist soeben der Genuss der Einweihung ihrer neuen Synagoge, welche
ganz ohne allen äußeren Glanz stattfand, zuteil geworden. Schierstein, den
18. September 1857." Mitteilung
im "Wiesbadener Tagblatt" vom 19. September 1857: "Unserer israelitischen
Gemeinde ist soeben der Genuss der Einweihung ihrer neuen Synagoge, welche
ganz ohne allen äußeren Glanz stattfand, zuteil geworden. Schierstein, den
18. September 1857." |
| |
|
Der Vorsteher J. Baum vermisst seit dem Gottesdienst an Jom Kippur ein
Buch (1857) |
 Mitteilung
im "Wiesbadener Tagblatt" vom 3. Oktober 1857: "Am 28. September dieses
Jahres, am Versöhnungstage Jom Kippur ist dem Vorsteher J. Baum ein
deutsches Buch in der neuen Synagoge entkommen. Im Namen der
israelitischen Gemeinde wird der redliche Finder ersucht, obiges Buch an den
Eigentümer zurückzugeben. Mitteilung
im "Wiesbadener Tagblatt" vom 3. Oktober 1857: "Am 28. September dieses
Jahres, am Versöhnungstage Jom Kippur ist dem Vorsteher J. Baum ein
deutsches Buch in der neuen Synagoge entkommen. Im Namen der
israelitischen Gemeinde wird der redliche Finder ersucht, obiges Buch an den
Eigentümer zurückzugeben.
Schierstein, den 1. Oktober 1857." |
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge durch Brandstiftung zerstört.
Eine Frau aus Schierstein hatte noch einige Kultgegenstände, Torarollen usw.
retten und verbergen können.
Nach 1945 ging das Synagogengrundstück mit der noch stehenden Ruine -
nach Klärung des Restitutionsverfahrens - in den Besitz der Stadt Wiesbaden
über.
Über den Gerichtsprozess gegen die des Synagogenbrandes
verdächtigen SA-Leute (Bericht in einer
jiddischen Zeitung 1946)
Anmerkung: bei der Zeitung handelt es sich
um "Undzer Wort: Wochn-Szrift / arojsgegebn durchn C.K. fun die bafraijte Jidn
in Franken / אונדזער ווארט : וואכן שריפט / ארויסגעגבן דורכן צ.ק. פון די באפרייטע
[...]. Dies war eine Wochenzeitung für jüdische Displaced Persons, die die
Konzentrationslager überlebte hatten und in DP-Lagern vor allem in der
amerikanischen Zone untergebracht waren.
 Artikel
in der Zeitschrift "Undzer Wort" vom 3. Mai 1946: "Gericht
farmiszept cweij hitleristn far farbrenen a jidisze sinagoge. Das
Landgericht Wiesbadn hot szabes d. 6. IV.1946 gemiszpet far untercindn un
farnichtn di Schiersteiner sinagoge dem 10 Nowember 1938 di Nacis: Pikard,
Häberle, Bill un Albert. Der gewezener S.A. Oberszturmfuhrer Pickard iz
farmiszpet geworn oif 5 jor un der gewzner S.A. man Häberle cu 2 jor tfise.
Di lecte czwej senen culib mangl in bawaijzn fraj geworn..." Artikel
in der Zeitschrift "Undzer Wort" vom 3. Mai 1946: "Gericht
farmiszept cweij hitleristn far farbrenen a jidisze sinagoge. Das
Landgericht Wiesbadn hot szabes d. 6. IV.1946 gemiszpet far untercindn un
farnichtn di Schiersteiner sinagoge dem 10 Nowember 1938 di Nacis: Pikard,
Häberle, Bill un Albert. Der gewezener S.A. Oberszturmfuhrer Pickard iz
farmiszpet geworn oif 5 jor un der gewzner S.A. man Häberle cu 2 jor tfise.
Di lecte czwej senen culib mangl in bawaijzn fraj geworn..."
Übersetzung: Gericht verurteilt zwei Nationalsozialisten für das Verbrennen
einer jüdischen Synagoge. Das Landgericht Wiesbaden hat am Samstag, den 6.
April 1946 für das Anzünden und Zerstören der Schiersteiner Synagoge am 10.
November 1938 die Nazis Pikard, Häberle, Bill und Albert verurteilt. Der
früher S.A. Obersturmführer Pickard is verurteilt worden zu 5 Jahren und der
früher SA-Mann Häberle zu 2 Jahren Gefängnis. Die zwei anderen sind wegen
Mangel an Beweisen frei gekommen..." |
1967 wurde die Ruine bis auf geringe Reste der Umfassungsmauern
abgebrochen. Diese wurden zusammen mit der Steinrosette aus der Ostwand der
Synagoge in eine Gedenkstätte integriert, die am 20. September 1968 in
Anwesenheit von Vertretern der Stadt Wiesbaden und der jüdischen Gemeinden in
Wiesbaden und Frankfurt eingeweiht wurde. Bei der Einweihung sprachen unter
anderen der Oberbürgermeister der Stadt Wiesbaden sowie die Herren Prof. Dr.
Herbert Lewin (damals Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden
in Hessen) und Dr. Paul Arnsberg von der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main.
Zur "Gedenkstätte Synagoge" in Schierstein siehe auch
https://www.schierstein24.de/Wiesbaden-Rhein-Main-Hafen/ueber-schierstein/synagoge.php
Adresse/Standort der Synagoge: Bernhard-Schwarz-Straße
17 (früher Kirchstraße)
Fotos
(Quelle: Historische Innenaufnahmen aus
http://www.vor-dem-holocaust.de:
Foto links aus dem Stadtarchiv Wiesbaden, Fotos rechts aus der Sammlung von Dorothee
Lottmann-Kaeseler)
Historische
Innenaufnahmen
|
 |
 |
| |
Innenansicht der
Synagoge
mit Blick zum Toraschrein |
Das Foto oben
wurde an der Goldenen Hochzeit
des Ehepaares Salmon aus Frauenstein aufgenommen.
Beim Foto links in der Synagoge ist u.a. der
mit der Zahl "50" geschmückte Hochzeitsbaldachin
zu erkennen. |
| |
| |
| |
|
|
| Die zerstörte Synagoge vor
dem Abbruch |
 |
 |
| |
Die Synagogenruine, vermutlich Mitte
der 1960er-Jahre
(Foto: Stadtarchiv Wiesbaden; das Foto wurde durch den damaligen städtischen
Fotografen Joachim Weber aufgenommen;
es findet sich auch in P. Arnsberg Bilder S. 183) |
| |
|
|
| |
|
|
Foto von einer
Gedenkveranstaltung,
vermutlich 1994
(aus der Sammlung von
Dorothee Lottmann-Kaeseler) |
 |
|
| |
Ansprache von Dr.
Liebermann |
|
| |
|
|
| Synagogengrundstück
und Gedenkstätte im Sommer 2008 |
|
 |
 |
 |
Blick
auf das Grundstück der ehemaligen Synagoge mit der in den Gedenksteine
eingefassten Steinrosette aus der Ostwand der Synagoge. Inschrift des
Gedenksteines: "Diese Rosette schmückte die Ostwand der Synagoge,
die bis zu ihrer mutwilligen Zerstörung am zehnten November 1938 an
dieser Stelle stand und Mittelpunkt der Mitglieder der Jüdischen Gemeinde
war, bis diese in die Vernichtungslager verschleppt wurden. Diesen
Gedenkstein errichtete die Stadt Wiesbaden zur Erinnerung und steten
Mahnung.
'Denn von Zion geht die Lehre aus und das Wort des Ewigen von Jerusalem:
Kein Volk wird gegen ein anderes Volk mehr das Schwert erheben und sie
werden nicht mehr das Kriegshandwerk erlernen'. Diese Worte schrieb der
Prophet Jesaja am Anfang des zweiten Kapitels seines Buches vor etwa zweitausendsiebenhundert
Jahren - MCMLXVIII." |
| |
 |
 |
 |
| Erhaltene
Reste der Umfassungsmauer, die in die Gedenkstätte integriert wurden |
| |
 |
 |
 |
| |
Die
am 19. September 2020 errichtete Gedenkstele mit Fotos und Informationen zur
Geschichte der Synagoge
(Fotos: Walter Richters); eine Einweihungsfeier war für das Frühjahr 2021
geplant, wurde jedoch wegen der Corona-Pandemie abgesagt. |
| |
|
Die
beleuchtete Gedenkstätte (2021)
(Foto: Walter Richters) |
 |
| |
|
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
September 2018:
Bericht zur Zerstörung der
Synagoge und der Geschichte des Gebäudes nach 1945
Anmerkung: der Artikel erschien anlässlich einer geplanten
Kranzniederlegung. Die Schiersteiner Kirchen und der Ortsbeirat erinnerten
an die Zerstörung der Synagoge mit einer kleinen Veranstaltung und einer
Kranzniederlegung am 20. September 2018, um 18 Uhr vor der Gedenkstätte in
der Bernhard-Schwarz-Straße. Es wurde neben einer Kranzniederlegung ein
geschichtlicher Abriss sowie ein 'Zeitzeugenbericht' zur Einweihung der
Gedenkstätte vor 50 Jahren vorgetragen.
|
Artikel
von Anja Baumgart-Píetsch im "Wiesbadener Kurier" vom 15. September
2018:
"Die Feuerwehr durfte nicht löschen
In der Pogromnacht 1938 zerstörten Nazis die Schiersteiner Synagoge – unter
den Augen neugieriger Zuschauer. Die Schiersteiner planen zu diesem Anlass
eine Gedenkveranstaltung.
Julius Löwenthal hieß der einzige jüdische Mitbürger Schiersteins, der 1945
aus dem KZ Theresienstadt zurückkehrte. Alle anderen jüdischen Familien aus
Schierstein wurden von den Nazis umgebracht. Ihre Synagoge wurde vor 160
Jahren, also 1858, in der damaligen Kirchstraße 15-17 eingeweiht. Sie diente
80 Jahre lang als Gotteshaus. In der Pogromnacht 1938 wurde sie zerstört,
ihre Ruine stand bis in die Sechzigerjahre, bevor sie abgerissen wurde und
1968 an ihre Stelle die Gedenkstätte in der Bernhard-Schwarz-Straße trat –
auch dies ein runder Gedenktag, ein halbes Jahrhundert. 'Vielleicht können
die drei Daten ein Anlass sein, der jüdischen Schiersteiner Mitbürgerinnen
und Mitbürger zu gedenken, die eine Bereicherung des Lebens in unserem Ort
waren und denen wir dann so viel Leid angetan haben', sagt der
stellvertretende Ortsvorsteher Walter Richters.
Bereits im 18. Jahrhundert im Verbund mit Frauenstein. Grundlage
dieses Textes bildet die Broschüre 'Die jüdische Gemeinde Schierstein' von
Lothar Bembenek, zusammengestellt im Auftrag der Grünen im Ortsbeirat 1988,
sowie die Internetseite 'Alemannia judaica', für die Dorothee
Lottmann-Kaeseler viele historische Informationen zusammengetragen hat.
Demnach bestand die jüdische Gemeinde bereits seit dem 18. Jahrhundert,
schon damals mit Frauenstein zusammengefasst. Rund ein bis drei Prozent der
Einwohner Schiersteins waren Juden. Überwiegend waren sie Händler, in
Frauenstein gab es mehrere Metzger. Es gab die Synagoge, eine
Religionsschule, ein rituelles Bad und einen Friedhof. Die Synagoge wird in
einer Zeitschrift 1936 folgendermaßen beschrieben: 'Verhältnismäßig hohe und
strenge Synagoge, erbaut 1858. Rechts vom Toraschrein ein geschnitzter
Holzständer mit reichem Blätter- und Früchteschmuck, gekrönt vom
nassauischen Wappen. Er trägt zwei Tafeln mit dem Gebet für den Landesherrn.
Das Ganze ist Geschenk ‚Seiner Erlaucht Herrn Grafen Wenzeslaus Carl zu
Leiningen-Billigheim’. 1096 führte ein Vorfahr dieses Herrn, Graf Emicho zu
Leiningen, die Scharen der Kreuzfahrer gegen die Juden zu Mainz, Worms und
Speyer'. 1933 lebten noch etwa 60 jüdische Personen in Schierstein. In den
folgenden Jahren zogen viele fort oder wanderten aus.
In der Pogromnacht wurde nicht nur die Synagoge, sondern wurden auch
Geschäfte und Wohnungen jüdischer Familien zerstört. Davon gibt es genaue
Schilderungen, die aus den späteren Prozessen gegen die Täter stammen. 'D.
und die ortsfremden SA-Angehörigen hatten bereits die äußere Umfriedung
zerschlagen und waren dabei, mit ihren Äxten die Inneneinrichtung, den
Altar, das Gestühl und Gebälk zu zertrümmern. Als das Holz jedoch nicht
Feuer fangen wollte, erteilte der Angeklagte P. H. den Befehl, beim
Mitangeklagten B. Benzin zum Anzünden der Synagoge zu holen. H. beschaffte
sich ein Fahrrad, fuhr zu der Tankstelle des B., der ihm ohne weitere Fragen
2 Kanister Benzin aushändigte. … Wenige Minuten später stand die Synagoge in
hellen Flammen. An diesem Anstecken beteiligte sich ein unmittelbarer
Täterkreis von 5-6 Personen, um den sich ein äußerer Teilnehmerkreis von
zahlreichen Neugierigen als Zuschauer gesammelt hatte.' Die Feuerwehr traf
ein, hatte jedoch den Befehl, nur 'die angrenzenden Anwesen von einem
Übergreifen des Feuers zu bewahren'. Erst nachdem die Synagoge völlig
ausgebrannt war, wurde der Rest gelöscht. Anschließend wurde die
Fetthandlung Kahn abgebrannt. Am Abend ging die Zerstörung weiter: Acht
Minuten nach 21.30 Uhr erscholl bei der Familie Löwenthal in der Wallufer
Straße 6 der Ruf 'Jud, Jud, Jud'. Frau Löwenthal öffnete und musste zusehen,
wie mit Äxten und Rohren ihr gesamtes Wohnungsinventar zerstört und der Herd
umgestoßen wurde, sodass der Fußboden brannte. 'Nach Fortgang der Täter
löschte Löwenthal den Fußboden und richtete die Wohnung notdürftig mithilfe
der Nachbarn wieder her.'
Vier Täter wurden nach dem Krieg verurteilt. Zu Zuchthausstrafen von
zwei bis fünf Jahren wurden vier Täter nach dem Krieg verurteilt. Heute
liest man auf dem Mahnmal, der übrig gebliebenen Rosette der Ostwand der
Synagoge, unter anderem einen Spruch aus dem Buch Jesaja: 'Kein Volk wird
gegen ein anderes Volk mehr das Schwert erheben und sie werden nicht mehr
das Kriegshandwerk erlernen.' "
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. II S. 270-272. |
 | ders.: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Bilder -
Dokumente. S. 183. |
 | Keine Artikel zu Schierstein bei Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 beziehungsweise dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 347-357. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 590. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Schierstein
(now part of Wiesbaden) Hesse-Nassau. The community, which had members in nearby
Frauenstein, engaged Jewish teachers and numbered 70 (2 % of the population) in
1895. Its synagogue was burned down on Kristallnacht (9-10 November 1938) and
those who remained shared the fate of the Jews of Wiesbaden.


vorherige Synagoge zur ersten Synagoge
|