|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"
Untereisenheim mit
Obereisenheim (Gemeinde
Eisenheim, VG Estenfeld, Kreis Würzburg)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Untereisenheim bestand eine kleine jüdische Gemeinde
bis Juli 1938. Ihre Entstehung geht mindestens in die Zeit des 18. Jahrhunderts
zurück.
Im benachbarten Obereisenheim werden 1532
die beiden Juden "Mosse vnnd Joslen zu Oberneysentzheim" genannt
(siehe Urkunde auf Seite zu Goßmannsdorf),
doch lebten hier in der Folgezeit nur wenige jüdische Familien. 1539 wird Jud
Jobstle erwähnt (vermutlich identisch mit Joslen), 1543 Jude Effraym.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
in Untereisenheim wie folgt: 1816 42 jüdische Einwohner (6,3 % von insgesamt 664), 1867 48 (7,7 %
von 620), 1880 37 (6,0 % von 615), 1900 30 (4,9 % von 609), 1910 17 (2,8 % von
602).
Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Untereisenheim auf
insgesamt sieben Matrikelstellen die folgenden jüdischen
Familienvorstände genannt (mit neuem Familiennamen und Erwerbszweig): Nathan
Männlein Schloss (Wein- und Schnittwarenhandel, dann Schmuserei), Samuel
Männlein Schloss (Wein- und Schnittwarenhandel, dann Viehhandel), Lazarus
Männlein Schloss (Wein- und Schnittwarenhandel, dann Viehhandel), Loeb
Männlein Hellermann (Weinhandel), Bär Männlein Hellermann (Wein- und
Viehhandel), Abraham Salomon Frankenthaler (Schnittwaren-, Vieh- und
Weinhandel), Joseph Salomon Frankenthaler (Schnittwaren- und
Viehhandel). In Obereisenheim lebten damals keine jüdischen Familien.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.) mit
einem Schulzimmer. Die Toten der Gemeinde wurden im jüdischen Friedhof
in Schwanfeld beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der
Gemeinde war zeitweise ein jüdischer Lehrer angestellt, der zugleich als
Vorbeter und Schächter (Schochet) tätig war. Namentlich ist Lehrer Isak Weglein bekannt, der ab 1876 in Demmelsdorf
bei Bamberg angestellt war.
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde: Unteroffizier
Isidor Schloss (geb. 4.4.1890 in Untereisenheim, vor 1914 in Würzburg wohnhaft,
gef. 4.11.1914).
Um 1924, als noch 10 jüdische Personen am Ort lebten
(1,25 % von insgesamt 800 Einwohnern), war Vorsteher der Gemeinde Jos.
Frankenthaler. Damals erhielt das einzige in der Gemeinde lebende
schulpflichtige Kind den Religionsunterricht durch Lehrer Siegbert Friedmann aus
Schwanfeld. Die Gemeinde gehörte zum
Distriktsrabbinat Kitzingen. Auch 1932 war Vorsteher der weiterhin 10
Personen umfassenden kleinen Gemeinde Jos. Frankenthaler.
1933 lebten noch 6 jüdische Personen in Untereisenheim (1,0 % von
insgesamt 606 Einwohnern). Zwei dieser Personen emigrierten 1934 nach Holland,
drei weitere in die USA (1939). Im Juli 1938 erfolgt die Auflösung der Gemeinde
durch den Verband der Israelitischen Gemeinden in Bayern. 1940 lebte nur noch
ein jüdisches Ehepaar am Ort, das auf Anweisung der Polizei Untereisenheim
verlassen musste.
Von den in Untereisenheim geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Hanna Blümlein (1876),
Bernhard Frankenthaler (1873), Klara Frankenthal geb.
Frankenthaler (1899), Hermann Hellermann (1857), Sofie Klau geb. Frankenthaler
(1888), Babette Oppenheimer geb. Blümlein (1882), Emil Schloss (1885), Selma Stern
geb. Frankenthaler (1889), Sali Wolfromm
geb. Blümlein (1874).
Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Lehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle 1884 / 1886
Aus den Ausschreibungstexten geht u.a. hervor, dass um 1884/86 Joseph Blümlein
Vorsteher der jüdischen Gemeinde war.
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Juli 1884:
"Gesucht wird zum baldigen Eintritt ein Religionslehrer und
Vorsänger ledigen Standes, mit jährlichem Gehalt von 500 Mark,
entsprechenden Nebenverdienst, freie Wohnung und Beheizung. Bewerber
wollen sich wenden an Joseph Blümlein, Kultusvorstand. Untereisenheim,
Post Seligenstadt, Bayern." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Juli 1884:
"Gesucht wird zum baldigen Eintritt ein Religionslehrer und
Vorsänger ledigen Standes, mit jährlichem Gehalt von 500 Mark,
entsprechenden Nebenverdienst, freie Wohnung und Beheizung. Bewerber
wollen sich wenden an Joseph Blümlein, Kultusvorstand. Untereisenheim,
Post Seligenstadt, Bayern." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Dezember 1886:
"Die Lehrer-, Vorsänger- und Schochetstelle in Untereisenheim ist
vakant. Fixer Gehalt 500 Mark. Gesuche, mit Zeugnissen belegt, sind zu
sehen an Blümlein in Untereisenheim, Post Seligenstadt
(Bayern)." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Dezember 1886:
"Die Lehrer-, Vorsänger- und Schochetstelle in Untereisenheim ist
vakant. Fixer Gehalt 500 Mark. Gesuche, mit Zeugnissen belegt, sind zu
sehen an Blümlein in Untereisenheim, Post Seligenstadt
(Bayern)." |
| |
| |
| Nach der 1909 erfolgten Ausschreibung wurde für Schwanfeld
ein Lehrer gesucht, der auch die Filiale Untereisenheim zu betreuen hatte: |
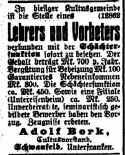 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Dezember 1909:
"In hiesiger Kultusgemeinde ist die Stelle eines Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Dezember 1909:
"In hiesiger Kultusgemeinde ist die Stelle eines
Lehrers und Vorbeters
verbunden mit der Schächterfunktion sofort zu besetzen. Der Gehalt
beträgt Mark 700 pro Jahr. Vergütung für Beheizung Mark 100.
Garantiertes Nebeneinkommen Mark 300. Die Schächterfunktion ca. Mark 450.
Sowie eine Filiale (Untereisenheim) ca. Mark 250. Unverheiratete,
seminaristisch gebildete Bewerber haben den Vorzug. Zeugnisse
erbeten.
Adolf Berk, Kultusvorstand, Schwanfeld, Unterfranken." |
Nachruf auf den 1920 verstorbenen
Lehrer Isak Weglein (vor 1876 Lehrer in Untereisenheim)
 Lehrer Isak Weglein starb im Februar
1920 in Uffenheim und wurde im jüdischen Friedhof Ermetzhofen beigesetzt. Zu
seinem Tod erschien in der Zeitschrift "Der Israelit" am 1. April 1920
folgender Artikel: "Uffenheim, 1. März (1920). Vor einigen Tagen starb der
hier im Ruhestande lebende Lehrerveteran I.L. Weglein im 74. Lebensjahre. Er
amtierte in Bibergau, Untereisenheim und schließlich in Demmelsdorf bei
Bamberg; in letzterer Gemeinde wirkte er segensreich volle 40 Jahre und erwarb
sich Dank und Anerkennung der vorgesetzten Behörden. Der zur Beerdigung
herbeigeeilte Distriktsrabbiner Dr. Brader aus Ansbach, skizzierte das
Lebensbild des verstorbenen Lehrers, pries insbesondere seine innige
Frömmigkeit, Bescheidenheit und sein stets freundliches Wesen. Auf dem
Begräbnisplatz in Ermetzhofen widmete Herr Hauptlehrer Strauß von hier, dem
verstorbenen Kollegen herzliche Worte der Treue und Freundschaft und rief ihm
namens des israelitischen Lehrervereins sowie des paritätischen allgemeinen
bayerischen Brudervereins die letzten Abschiedsgrüße zu. Sein Andenken wird
ein gesegnetes und dauerndes sein. Seine Seele sei eingebunden in den Bund
des Lebens." Lehrer Isak Weglein starb im Februar
1920 in Uffenheim und wurde im jüdischen Friedhof Ermetzhofen beigesetzt. Zu
seinem Tod erschien in der Zeitschrift "Der Israelit" am 1. April 1920
folgender Artikel: "Uffenheim, 1. März (1920). Vor einigen Tagen starb der
hier im Ruhestande lebende Lehrerveteran I.L. Weglein im 74. Lebensjahre. Er
amtierte in Bibergau, Untereisenheim und schließlich in Demmelsdorf bei
Bamberg; in letzterer Gemeinde wirkte er segensreich volle 40 Jahre und erwarb
sich Dank und Anerkennung der vorgesetzten Behörden. Der zur Beerdigung
herbeigeeilte Distriktsrabbiner Dr. Brader aus Ansbach, skizzierte das
Lebensbild des verstorbenen Lehrers, pries insbesondere seine innige
Frömmigkeit, Bescheidenheit und sein stets freundliches Wesen. Auf dem
Begräbnisplatz in Ermetzhofen widmete Herr Hauptlehrer Strauß von hier, dem
verstorbenen Kollegen herzliche Worte der Treue und Freundschaft und rief ihm
namens des israelitischen Lehrervereins sowie des paritätischen allgemeinen
bayerischen Brudervereins die letzten Abschiedsgrüße zu. Sein Andenken wird
ein gesegnetes und dauerndes sein. Seine Seele sei eingebunden in den Bund
des Lebens."
|
Zur Geschichte der Synagoge
Eine Synagoge wurde 1868 erbaut. Es handelte sich
um einen eingeschossigen Natursteinbau mit einem Steilgiebel und einer
schlichten Fassadengliederung mit Rundbogenfenstern. Auf Grund der
zurückgegangenen Zahl der Gemeindeglieder konnte freilich schon Anfang des 20.
Jahrhunderts kein regelmäßiger Gottesdienst mehr abgehalten werden.
Im Februar 1938 wurde das Gebäude verkauft und danach als
Getreidespeicher zweckentfremdet. 1972 wurde das Synagogengebäude
abgebrochen. Auf dem Grundstück befindet sich heute eine Garage beziehungsweise
ein Gemüsegarten.
Adresse/Standort der Synagoge: Hadergasse 2
Foto
(Foto: Hahn, Aufnahmedatum: 1.3.2007)
|
|
 |
 |
Die ehemalige Synagoge befand
sich links des abgebildeten Wohnhauses (Haus des jüdischen Lehrers)
an Stelle der heutigen Garage
in gleicher Flucht und unverputztem Muschelkalkmauerwerk wie das Wohnhaus.
Nach Aussagen älterer Anwohner muss sich unter dem Boden der Garage noch
eine
zugeschüttete Mikwe befinden
(Information von Knut Noack, Website
www.uendereisem.de) |
Oben: Ausschnitt aus einem
Plan der Hadergasse.
Gebäude Nr. 40 markiert den Standort der Synagoge.
Zwischen 40 und 42 ist das Haus des jüdischen Lehrers eingetragen
(Quelle: Katasterplan nach 1928; übernommen aus der
Website von Knut
Noack, vgl. Anmerkung links) |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 415-416. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 119. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 392-393. |
 | Jutta Sporck-Pfitzer: Die ehemaligen jüdischen
Gemeinden im Landkreis Würzburg. Hrsg. vom Landkreis Würzburg. Würzburg
1988. S. 76. |
 | Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen
Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche
Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.
Würzburg 2008. S. 237. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Untereisenheim Lower
Franconia. The Jewish population in 1897 was 48 (total 620). Of the seven
present under Nazi rule, five emigrated and the last two were expelled in 1940.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|