|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zur Übersicht "Synagogen
im Elsass"
Schirrhofen
(Dep. Bas-Rhin / Alsace / Unterelsass)
Synagogue / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Schirrhoffen bestand eine jüdische Gemeinde bis in Zeit nach dem Ersten
Weltkrieg. Ihre Entstehung geht in das 18. Jahrhundert zurück. Seit 1723 war
Juden die Niederlassung erlaubt. 1784 wurden 27 jüdische Familien mit
127 Personen gezählt.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
entwickelte sich Schirrhoffen zu einer der bedeutendsten Gemeinden der Region
Bas-Rhin. Die Zahl der jüdischen Gemeindeglieder entwickelte sich wie
folgt: 1807 184 jüdische Einwohner, 1841 445 jüdische Einwohner (von
insgesamt 645 Einwohnern), 1851 409, 1866 427, 1880 342, 1900 188.
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ging die Zahl der jüdischen Gemeindeglieder
insbesondere durch Auswanderung nach Amerika, weniger durch Abwanderung in die
Stadt zurück.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge
(s.u.), eine jüdische Schule, ein rituelles Bad und seit 1881 ein eigener Friedhof.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde waren ein Rabbiner und ein
Lehrer angestellt, die auch die Vorbeterdienste übernahmen.
Von 1815 bis 1910 war
Schirrhoffen Rabbinatssitz. Unter den Rabbinern sind zu nennen:
- Rabbiner Aron Lazarus (Aron ben Elieser Schach; geb. 1786 in Mainbernheim
als Sohn des Dajan Elieser ben Aron, Dajan in Mainbernheim,
gest. 1854 in Schirrhofen): studierte in Lauterbourg;
war seit April 1826 Rabbiner in Schirrhofen; eröffnete auch eine Jeschiwa, in
der er seine Schüler auch in die Kabbala einführte.
- Rabbiner Zacharie Lazarus (geb. 1829 in Schirrhofen als Sohn des
o.g. Rabbiners Aron Lazarus, gest. 1897 in Westhoffen, Unterelsass): studierte
1847-1855 an der École rabbinque in Metz; 1855 bis 1872 Rabbiner in
Schirrhoffen, seit 1872 Rabbiner in Westhoffen.
- Rabbiner Félix Blum (geb. 1847 in Bischheim,
gest. 1925 in Straßburg): studierte 1866-72 an der École rabbinique in Paris;
1873 bis 1875 Rabbiner in Schirrhofen, ab 1875 in
Fegersheim ab 1886 in
Phalsbourg, Lothringen; um/vor 1890/91 in Brumath, 1899 in Mulhouse. 1922 in den
Ruhestand nach Straßburg.
-
- Rabbiner Simon Lévy (geb. 1838 in
Balbronn, gest. 1898 in
Schirrhoffen): studierte in Metz und Paris; ab 1867 Rabbiner in
Ingwiller, 1875
bis 1898 Rabbiner in Schirrhoffen.
Rabbiner Dr. Zacharias Wolff (geb. 1840/41 in
Pfungstadt, gest. 1915 in
Straßburg): studierte in Gießen,
Würzburg und Berlin; 1867 bis 1882 Lehrer
und Prediger der Gemeinde Biblis und Direktor der dort von ihm gegründeten
israelitischen Bürgerschule; seit 1882 Direktor der Rabbinervorbereitungsschule
in Colmar; 1899 bis 1902 Rabbiner in Schirrhoffen (Bericht zu seiner
Amtseinführung 1899 unten bei der Geschichte der Synagoge), danach nach
Bischheim berufen.
- Rabbiner Dr. Sylvain Lehmann (geb. 1875 in Guebwiller, gest. 1938 in
Bischwiller): studierte in Colmar und Berlin; nach 1902 Rabbiner in
Schirrhoffen-Bischwiller; 1910 wurde das Rabbinat nach Bischwiller
verlegt, wo er bis 1938 amtierte. Zunächst gab er noch wöchentlich
Religionsunterricht in Schirrhofen.
Aus der Gemeinde
stammte u.a. der Schriftsteller Alexandre Weill (1811-1899). Auf Grund
der zeitweise weit mehr als die Hälfte der Einwohner umfassenden Zahl der
jüdischen Einwohner gab es mehrfach jüdische Bürgermeister des Ortes: 1846
bis 1864 Levy, 1864 bis 1884 Weil, 1884 bis 1905 Simon Heymann (siehe Bericht
unten) und 1905 bis 1907
Salomon Kahn (1832-1907).
1905 gehörten der jüdischen Gemeinde noch 188 Personen an, 1910
83, 1912 50, von denen
die meisten jedoch innerhalb der nächsten beiden Jahrzehnte vom Ort verzogen.
Die letzten jüdischen Einwohner wurden in der NS-Zeit deportiert.
Von den in Schirrhofen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen ist in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem): Henriette Strauss geb. Kahn (1870).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Allgemeiner Artikel zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (1911)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Juli 1911:
"Straßburg im Elsass, 21. Juli (1911). Traurig mutet es an, wenn man
die Kultusgemeinde Schirrhofen betrachtet, die vor noch nicht so langer
Zeit zu den größten Landgemeinden des Elsass gehörte und heute in die
Reihe der kleinsten eingerückt ist. Wie rasch die Abnahme geschah, mögen
folgende Zahlen beweisen. Im Jahre 1866 hatte diese Gemeinde die
Höchstzahl von 427 jüdischen Seelen erreicht, 1880 wohnten hier noch
342, - 1900 noch 188, 1910 noch 83 Juden, und in diesem Jahre wird die
Zahl auf 50 herabsinken. Der Hauptgrund dieses Rückgangs liegt nicht, wie
in anderen Orten, in der Landflucht, sondern in der Auswanderung der
jungen Leute nach Amerika. Von der Geschichte der Juden in Schirrhofen
berichtet August Kocher aus Herrlisheim Unterelsass folgendes: 'Schon
frühzeitig hatte Schirrhofen eine Judengemeinde. Im Jahre 1730 besaßen
sie hier eine Synagoge. Im Jahr 1778 befanden sich hier 26 Judenfamilien.
Die Zählung vom 10. Juli 1784 ergab 27 Familien mit 127 Personen. 1807
hatte Schirrhofen 184 Judenpersonen. Den 10. Mai 1811 wurde hier Abraham
(Alexander) Weill geboren, der sich durch mehrere literarische Werke
auszeichnete. Er starb in Paris den 19. April 1899. 1818 wurde in
Schirrhofen die heutige Synagoge erbaut. Im Jahre 1851 zählte der Ort 409
Juden. Wie sich diese Zahl in den folgenden Jahren änderte, ist oben
bemerkt worden. 1881 erhielten sie einen eigenen Friedhof, vorher wurden
sie in Hagenau begraben. Schirrhofen ist seit 1820 Sitz eines Rabbiners'.
Damit schließt die Ausführung Kochers in seinem 1907 erschienenen
Bändchen. Wie bekannt, ist seither der Rabbinatssitz nach Bischweiler
verlegt worden. Interessant ist noch zu bemerken, dass die Bevölkerung
dieses Ortes lange Zeit fast nur aus Juden bestand, weshalb natürlich die
meisten Mitglieder des Gemeinderats und der Bürgermeister Juden waren.
Folgende jüdische Ortsvorstände amtierten hier: 1846 bis 1864 Levy, 1864
bis 1884 Weil, 1884 bis 1905 Simon Heymann und 1905 bis 1907 Salomon Kahn.
Heute sind die Juden nur noch durch ein Mitglied: Moritz Bloch, im
Gemeinderat vertreten." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Juli 1911:
"Straßburg im Elsass, 21. Juli (1911). Traurig mutet es an, wenn man
die Kultusgemeinde Schirrhofen betrachtet, die vor noch nicht so langer
Zeit zu den größten Landgemeinden des Elsass gehörte und heute in die
Reihe der kleinsten eingerückt ist. Wie rasch die Abnahme geschah, mögen
folgende Zahlen beweisen. Im Jahre 1866 hatte diese Gemeinde die
Höchstzahl von 427 jüdischen Seelen erreicht, 1880 wohnten hier noch
342, - 1900 noch 188, 1910 noch 83 Juden, und in diesem Jahre wird die
Zahl auf 50 herabsinken. Der Hauptgrund dieses Rückgangs liegt nicht, wie
in anderen Orten, in der Landflucht, sondern in der Auswanderung der
jungen Leute nach Amerika. Von der Geschichte der Juden in Schirrhofen
berichtet August Kocher aus Herrlisheim Unterelsass folgendes: 'Schon
frühzeitig hatte Schirrhofen eine Judengemeinde. Im Jahre 1730 besaßen
sie hier eine Synagoge. Im Jahr 1778 befanden sich hier 26 Judenfamilien.
Die Zählung vom 10. Juli 1784 ergab 27 Familien mit 127 Personen. 1807
hatte Schirrhofen 184 Judenpersonen. Den 10. Mai 1811 wurde hier Abraham
(Alexander) Weill geboren, der sich durch mehrere literarische Werke
auszeichnete. Er starb in Paris den 19. April 1899. 1818 wurde in
Schirrhofen die heutige Synagoge erbaut. Im Jahre 1851 zählte der Ort 409
Juden. Wie sich diese Zahl in den folgenden Jahren änderte, ist oben
bemerkt worden. 1881 erhielten sie einen eigenen Friedhof, vorher wurden
sie in Hagenau begraben. Schirrhofen ist seit 1820 Sitz eines Rabbiners'.
Damit schließt die Ausführung Kochers in seinem 1907 erschienenen
Bändchen. Wie bekannt, ist seither der Rabbinatssitz nach Bischweiler
verlegt worden. Interessant ist noch zu bemerken, dass die Bevölkerung
dieses Ortes lange Zeit fast nur aus Juden bestand, weshalb natürlich die
meisten Mitglieder des Gemeinderats und der Bürgermeister Juden waren.
Folgende jüdische Ortsvorstände amtierten hier: 1846 bis 1864 Levy, 1864
bis 1884 Weil, 1884 bis 1905 Simon Heymann und 1905 bis 1907 Salomon Kahn.
Heute sind die Juden nur noch durch ein Mitglied: Moritz Bloch, im
Gemeinderat vertreten." |
Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer
Ausschreibung
der Lehrerstelle (1872)
 Ausschreibung
der Stelle in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Januar
1872: "Lehrerstelle. Die israelitische Lehrerstelle in Schirrhofen,
im Kreise Hagenau (Elsass), welche ein Einkommen von ca. 1.600 Franken und
Wohnung hat, ist zu vergeben. Bewerber, die außer dem deutschen auch
hebräischen Unterricht zu erteilen haben, wollen ihr Gesuch mit
Zeugnissen der Mairie in Schirrhofen einreichen. Engler,
Schulinspektor." Ausschreibung
der Stelle in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Januar
1872: "Lehrerstelle. Die israelitische Lehrerstelle in Schirrhofen,
im Kreise Hagenau (Elsass), welche ein Einkommen von ca. 1.600 Franken und
Wohnung hat, ist zu vergeben. Bewerber, die außer dem deutschen auch
hebräischen Unterricht zu erteilen haben, wollen ihr Gesuch mit
Zeugnissen der Mairie in Schirrhofen einreichen. Engler,
Schulinspektor." |
| Auf die Ausschreibung bewarb
sich erfolgreich Lehrer Joseph Levi, der in der Gemeinde bis 1896
blieb. |
Pensionierung
von Lehrer Joseph Levi (1896)
 Artikel in "Der Israelit" vom
7.5.1896: "Schirrhofen im Elsass, 29. April. Der sehr beliebte und
allgemein geachtete Lehrer und Sekretär des Bürgermeisteramtes Herr
Joseph Levi von hier, ließ sich aus Gesundheitsrücksichten in den
Ruhestand versetzen. In den hiesigen Zeitungen finden wir folgende Notiz
über ihn. 'Unser Lehrer, Herr Joseph Levi ist in Folge von Krankheit
pensioniert wurden. Seine Majestät der Kaiser haben allergnädigst ihm
das Allgemeine Ehrenzeichen zu verleihen geruht. Herr Levi war seit dem 1.
Mai 1872 in Schirrhofen tätig und hat die Mehrzahl der hiesigen Einwohner
ausgebildet. Er war ein braver, pflichttreuer Lehrer und freuen wir uns
über die ihm von Allerhöchster Stelle gewordene Auszeichnung. Er hat
seinen Wohnsitz nach Hagenau verlegt, wo seine Tochter verheiratet ist.
Möge es ihm vergönnt sein, noch recht viele Jahre bei guter Gesundheit
seine wohlverdiente Pension zu genießen." Artikel in "Der Israelit" vom
7.5.1896: "Schirrhofen im Elsass, 29. April. Der sehr beliebte und
allgemein geachtete Lehrer und Sekretär des Bürgermeisteramtes Herr
Joseph Levi von hier, ließ sich aus Gesundheitsrücksichten in den
Ruhestand versetzen. In den hiesigen Zeitungen finden wir folgende Notiz
über ihn. 'Unser Lehrer, Herr Joseph Levi ist in Folge von Krankheit
pensioniert wurden. Seine Majestät der Kaiser haben allergnädigst ihm
das Allgemeine Ehrenzeichen zu verleihen geruht. Herr Levi war seit dem 1.
Mai 1872 in Schirrhofen tätig und hat die Mehrzahl der hiesigen Einwohner
ausgebildet. Er war ein braver, pflichttreuer Lehrer und freuen wir uns
über die ihm von Allerhöchster Stelle gewordene Auszeichnung. Er hat
seinen Wohnsitz nach Hagenau verlegt, wo seine Tochter verheiratet ist.
Möge es ihm vergönnt sein, noch recht viele Jahre bei guter Gesundheit
seine wohlverdiente Pension zu genießen." |
Ehrenzeichen
für Lehrer Levi 1896
 Meldung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Mai 1896:
"Der Lehrer und Sekretär des Bürgermeisteramts in Schirrhofen
Joseph Levi hat anlässlich seiner Pensionierung das allgemeine Ehrenzeichen
erhalten." Meldung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Mai 1896:
"Der Lehrer und Sekretär des Bürgermeisteramts in Schirrhofen
Joseph Levi hat anlässlich seiner Pensionierung das allgemeine Ehrenzeichen
erhalten." |
Aus der Geschichte der Rabbiner
Als Rabbiner am Ort wird Felix Blum eingeführt
(1873)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. April 1873:
"Schirhofen (Elsass), im März (1873). Am 17. Februar wurde
hier ein neuer Rabbiner, Herr Felix Blum, ein Schüler des
Rabbinerseminars von Paris, in Gegenwart des Großrabbiners von
Straßburg, des Kreisdirektors, des Bürgermeisters und anderer Honoratioren,
installiert. Es werden in Kurzem noch andere Besetzungen vakanter
Rabbinersitze in Elsass-Lothringen vor sich gehen. Man sieht hieraus, dass
die Verhältnisse der jüdischen Gemeinden im neuen Reichslande durchaus
nicht den gefährlichen Charakter angenommen haben, den man von Frankreich
aus vorausgesagt, und wahrscheinlich auch gewünscht hat. Die Gemeinden
haben durch Auswanderung in ihrem Bestande durchaus nicht gelitten, ihre
Institutionen sind sorgfältig aufrecht erhalten worden, und die deutsche
Regierung lässt ihnen alle Pflege zukommen, die sie nach dem Gesetze
beanspruchen können." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. April 1873:
"Schirhofen (Elsass), im März (1873). Am 17. Februar wurde
hier ein neuer Rabbiner, Herr Felix Blum, ein Schüler des
Rabbinerseminars von Paris, in Gegenwart des Großrabbiners von
Straßburg, des Kreisdirektors, des Bürgermeisters und anderer Honoratioren,
installiert. Es werden in Kurzem noch andere Besetzungen vakanter
Rabbinersitze in Elsass-Lothringen vor sich gehen. Man sieht hieraus, dass
die Verhältnisse der jüdischen Gemeinden im neuen Reichslande durchaus
nicht den gefährlichen Charakter angenommen haben, den man von Frankreich
aus vorausgesagt, und wahrscheinlich auch gewünscht hat. Die Gemeinden
haben durch Auswanderung in ihrem Bestande durchaus nicht gelitten, ihre
Institutionen sind sorgfältig aufrecht erhalten worden, und die deutsche
Regierung lässt ihnen alle Pflege zukommen, die sie nach dem Gesetze
beanspruchen können." |
Das Rabbinat in Schirrhofen wurde
wieder besetzt (1873)
Anmerkung: die Neubesetzung 1873 in
Mutzig bezog sich auf Rabbiner Jacques
Schwab, in Schirrhofen auf Rabbiner Felix Blum.
 Artikel
in "Israelitische Wochenschrift" von 1873 S. 118: "Elsass. Zum
Oberrabbiner von Colmar ist nunmehr
Rabbiner Isidor Weil erwählt worden. Die Beziehungen zu den deutschen
Regierungen, schreibt 'Univ. Isr.' bei Gelegenheit der Installation des
neugewählten Konsistoriums, sind auf Höflichkeit und Wohlwollen gegründet.
Ebenso sind zwei Unterrabbinate (in Schirrhofen und
Mutzig) neu besetzt worden und zwar durch
Zöglinge des Pariser Seminars. Artikel
in "Israelitische Wochenschrift" von 1873 S. 118: "Elsass. Zum
Oberrabbiner von Colmar ist nunmehr
Rabbiner Isidor Weil erwählt worden. Die Beziehungen zu den deutschen
Regierungen, schreibt 'Univ. Isr.' bei Gelegenheit der Installation des
neugewählten Konsistoriums, sind auf Höflichkeit und Wohlwollen gegründet.
Ebenso sind zwei Unterrabbinate (in Schirrhofen und
Mutzig) neu besetzt worden und zwar durch
Zöglinge des Pariser Seminars.
Wir haben uns also nicht geirrt, als wir vor langer Zeit in diesem Blatte
vorausgesagt haben, dass die deutsche Regierung gegen Anstellung
französischer Rabbiner im Elsass nicht den leisesten Einwand erheben werde." |
Zum Tod von Rabbiner Simon Levy (1898)
 Meldung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. Oktober 1898:
"In Schirrhofen im Elsass ist am 2. dieses Monats der Rabbiner Simon
Levy, ein gelehrter und frommer Mann, ein treuer Freund unseres Blattes,
im 60. Lebensjahr gestorben. Friede seinem Andenken!" Meldung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. Oktober 1898:
"In Schirrhofen im Elsass ist am 2. dieses Monats der Rabbiner Simon
Levy, ein gelehrter und frommer Mann, ein treuer Freund unseres Blattes,
im 60. Lebensjahr gestorben. Friede seinem Andenken!" |
Ernennung von Rabbiner Dr. Sylvain Lehmann zum Rabbiner
in Schirrhofen (1902)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 26. September 1902: "Die von dem israelitischen
Bezirkskonsistorium vorgenommenen Ernennungen der Rabbinatskandidaten Dr.
Josef Bloch zum Rabbiner in Dambach,
Dr. S. Lehmann zum Rabbiner in Schirrhofen, Camill Bloch
zum Rabbiner in Sulz i.W.
und Max Gugenheim zum Rabbiner in Quatzenheim
sind seitens des Ministeriums für Elsass-Lothringen bestätigt
worden."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 26. September 1902: "Die von dem israelitischen
Bezirkskonsistorium vorgenommenen Ernennungen der Rabbinatskandidaten Dr.
Josef Bloch zum Rabbiner in Dambach,
Dr. S. Lehmann zum Rabbiner in Schirrhofen, Camill Bloch
zum Rabbiner in Sulz i.W.
und Max Gugenheim zum Rabbiner in Quatzenheim
sind seitens des Ministeriums für Elsass-Lothringen bestätigt
worden." |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Steckbrief des Jakob Schirm aus Schirrhofen
(1822)
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 3. August 1822 (Quelle: Stadtarchiv
Donaueschingen): "Bekanntmachungen - Steckbrief. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 3. August 1822 (Quelle: Stadtarchiv
Donaueschingen): "Bekanntmachungen - Steckbrief.
Am 26. vorigen Monats haben 3 Juden einen diesseitigen Amtsangehörigen
und Bürger von Ehrenstetten, auf folgende Art um 100 große Thaler zu
betrügen versucht. Zwei dieser Juden kamen ganz früh, gaben sich für
Viehhändler aus, verlangten Vieh oder auch Pferde zu kaufen. Bald darauf
kam ein dritter verkleideter Jude, welcher sich für einen Russen, und
zwar für den Bedienten eines russischen Generals ausgab. Der letztere,
welcher, die beiden erstern nicht zu kennen, sich verstellte, klagte sehr
über Schmerzen an einem Fuß, stellte sich, als könne er nicht deutsch
sprechen, tat sehr furchtsam, küsste dem Hauseigentümer, welcher
betrogen werden sollte, fleißig die Hände, kniete vor ihm nieder, und
rief öfters aus - Vater, Vater! nicht Kopf abhauen!
Anfangs suchte dieser vorgebliche Russe eine silberne Sackuhr zu
verkaufen, zeigte aber bald in einer kleinen Schachtel einige mit
böhmischen Steinen besetzte Finger - und Ohrenringe, ein solches kleines
Kreuz, und eine sogenannte venezianische Kette von Semilor.
Die 2 Viehhändler kamen dazu, bewun- |
 derten
diese Kostbarkeiten, behaupteten, dass sie von sehr großem Wert seien,
sie schätzten zwei Ohrenringe und eine Fingerring aus wenigstens 8000
fl., und verlangten, der Bürger von Ehrenstetten solle diese
Kostbarkeiten nicht mehr aus seinem Hause lassen, er solle sie kaufen,
oder ihnen das benötigte Geld darleihen, damit die diesen kostbaren
Schmuck kaufen können. derten
diese Kostbarkeiten, behaupteten, dass sie von sehr großem Wert seien,
sie schätzten zwei Ohrenringe und eine Fingerring aus wenigstens 8000
fl., und verlangten, der Bürger von Ehrenstetten solle diese
Kostbarkeiten nicht mehr aus seinem Hause lassen, er solle sie kaufen,
oder ihnen das benötigte Geld darleihen, damit die diesen kostbaren
Schmuck kaufen können.
Die 2 Viehhändler gaben nämlich vor, dass sie sehr viel Vieh erst
kürzlich aufgekauft, und dafür all ihr Geld ausgelegt haben, dass sie
aber bis den andern Tag eine beträchtliche Summe Geldes erhalten werden.
Diese beiden boten nun dem Russen, welcher für die 2 Ihren und den
Fingerring nebst der Kette 200 Rubel verlangte, 100 große Taler. Der
Bürger von Ehrenstetten war entschlossen, den 2 Viehhändlern, welche er
für reiche Leute hielt, die abverlangten 100 Thaler darzuleihen, und die
Viehhändler wollten ihm dafür, bis zur Rückzahlung dieser Summe den
gekauften Schmuck, jedoch wohl besiegelt, als Versatz zurücklassen. Aus
dem Handel wurde aber nichts, weil die verlangten 100 große Thaler nicht
aufgebracht werden konnten.
Der verkappte Russe wollte von dem Hauseigentümer den Weg in den Wald
gezeigt haben, dieser merkte Unrat, arretierte denselben mit zufälliger
Hilfe, und brachte ihn gefänglich hier ein. - Die beiden anderen Juden
aber entkamen und konnten bisher, der erlassenen Steckbriefe ungeachtet,
nicht beigefangen werden.
Bereits auf die nämliche Art, wie
in Ehrenstetten, wurde am 29. Mai 1820 ein Bürger von Wihl um 346 fl. 36
kr., am 7. Juni 1820, ein Bürger von Hecklingen um 335 Gulden, und ein
Bürger aus dem Kirchzartertal zu Ende November vorigen Jahres um 66
Gulden betrogen.
Bei der heute mit dem am 26. vorigen Monats
arretierten Juden - welche nach einem bei sich führenden Pass der
Königlich Französischen Präfektur zu Straßburg vom 7. November vorigen
Jahres Jakob Sturm heißt, und in Schirrhofen im Elsass bürgerlich sein
soll - stattgehabten Konfrontation, haben die betrogenen von Wihl und aus
dem Kirchzartertal diesen Jakob für den nämlichen anerkannt, welcher
auch sie als verkleideter und angeblicher Russe ganz auf die nämliche
Art, durch die nämliche Kunstgriffe und durch Spielung der nämlichen
Komödie, betrogen habe, wie der Betrug in Ehrenstetten versucht
worden.
Da man nun erfahren, dass auch in mehreren anderen Orten ähnliche
Betrügereien stattgefunden: so glaubt man diesen Vorfall umständlich zur
allgemeinen Warnung öffentlich bekannt machen, und alle respektive
Behörden bitten zu müssen, auf die, nebst dem arretierten Jakob Sturm -
unter signa efierten zwei weiteren noch nicht beigefangenen Juden, welcher
der Teilnahme an den stattgehabten und versuchten Betrügereien sehr stark
beeinzüchtig sind, fahnden, auf Betreten arretieren, und anher einliefern
zu wollen.
Person-Beschrieb. 1. Der arretierten Jakob Sturm. Jakob
Sturm von Schirrhofen im Elsass, niederrheinischen Departements, 49
Jahr alt, 5' 8" 2'" hoch, hat ein längliches schmales Gesicht,
blasse Gesichtsfarbe, hohe Stirne, graue Augen, hellbraune, a la Titus
geschnittene kurz Haare, und Augenbrauen von dieser Farbe, einen starken
blonden Backenbart, oben und unten eine Zahnlücke, mittlern Mund
spitziges Kinn, große Ohren, und ist von schlanker
Statur.
Als Jude trägt Jakob Sturm einen Frackrock von grünem Tuch, noch ganz
gut, ein weiß und blaugestreiftes Gilet von Piquet, lange Hosen von
hellblauem Nanquinette, kurze oder Halbstiefel, ein weiß und
blaugestreiftes Halstuch von Mouselin, einen runden schwarzen Filzhut, und
im rechten Ohr einen kleinen goldenen Ring.
Als Russe ist derselbe gekleidet in einen wollenen gestrickten hellgrauen
Tschopen mit dunkelgrauen bibernen Ärmeln sehr weit, weite Hosen von
grauem Nanquinette, ziemlich schmutzig, eine Kappe von schwarzem
Manchester mit einem Stulp von grauem Pelz, um diese Kappe war ein
schwarzes Tuch gebunden, ebenso hatte er den Kopf noch besonders nur der
Länge nach mit einem schwarzen Tuch verbunden, das Gilet war nicht
sichtbar, die Stiefel wie oben. |
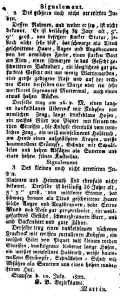 Signalement.
2. Des größeren noch nicht arretierten Juden. Signalement.
2. Des größeren noch nicht arretierten Juden.
Dessen Namen, und woher er sei, ist nicht bekannt. Er ist beiläufig 38
Jahre alt, 5' 9" groß, von besetzter starker Statur, jedoch nicht
sehr dick, hat schwarze a la Titus geschnittene Haare, Augen und
Augenbrauen von der nämlichen Farbe, einen starken Bart am Kinn, einen
schwarzen in das Gesicht geschnittenen Backenbart, ein längliches gut gefärbtes
Gesicht mit nur wenig Blatternarben, eine große gebogene Nase und auf der
rechten Seite derselben ein Warze oder ein sehr merkbares sogenanntes
Muttermal, auch einen etwas hohen Rücken.
Derselbe trug am 26. vorigen Monats einen langen dunkelblauen Überrock
mit Knöpfen von nämlichen Zeug, lange, dunkelblaue Hosen, ein weißes
Gilet von Piquet mit kleinen roten Streifen, die Knöpfe ebenfalls vom
nämlichen Zeug, ein weiß mouselinenes Halstuch, am Hemd einen aufgestülpten
Kragen, weiße baumwollene Strümpfe, Schuhe mit Schnällelen und hohen
Absätzen als Suverow und einen hohen feinen Kastorhut.
Signalement 3. Des kleinen noch nicht arretierten Juden.
Namen und Heimat sind ebenfalls nicht bekannt. Derselbe ist beiläufig 36
Jahre alt, 5' 5" groß, von mittlerer Status, hat schwarz braune als
Titus geschnittene Haare, solche Augen und Augenbrauen, hohe Stirne, Mund
und Nase gut proportioniert, ein wohlgefährbtes Gesicht, schwarzbraunen
Bart, und Backenbart und gute Zähne.
Derselbe trug einen dunkelblauen tüchenen Frackrock mit weißen
metallenen Knöpfen, ein weißer Gilet von Piquet mit kleinen roten
Streifen, dunkelgraue, biberne lange Hosen, ein weißes mouselines
Halstuch, weiße baumwollene Strümpfe, Schnällelen-Schuh mit Absätzen
als Suverow und einen hohen runden feinen Gut.
Staufen, den 10. Juli 1822. Großherzoglich Badisches Bezirksamt.
Martin." |
Zum Tod von Bürgermeister Simon Heymann (1905)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. März 1905:
"Aus dem Elsass, 1. März (1905). In Schirrhofen starb
am 27. Februar in seinem 81. Lebensjahre der Bürgermeister Simon
Heymann. Er hatte dieses Ehrenamt seit 1881 ununterbrochen inne. Auch
war er lange Jahre Präsident der israelitischen Gemeinde, aus deren
Vorstand er vor kurzem ausschied, um sich ganz den
Bürgermeistereigeschäften widmen zu können. Die Regierung verliert in
ihm einen gewissenhaften, fleißigen Beamten, die Gemeinde einen jederzeit
hilfsbereiten und zuvorkommenden Vorsteher." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. März 1905:
"Aus dem Elsass, 1. März (1905). In Schirrhofen starb
am 27. Februar in seinem 81. Lebensjahre der Bürgermeister Simon
Heymann. Er hatte dieses Ehrenamt seit 1881 ununterbrochen inne. Auch
war er lange Jahre Präsident der israelitischen Gemeinde, aus deren
Vorstand er vor kurzem ausschied, um sich ganz den
Bürgermeistereigeschäften widmen zu können. Die Regierung verliert in
ihm einen gewissenhaften, fleißigen Beamten, die Gemeinde einen jederzeit
hilfsbereiten und zuvorkommenden Vorsteher." |
Erinnerung an die Heimat Schirrhofen in den USA -
Grabstein für Julius Weill aus Schirrhofen in New Orleans (1875-1937)
Anmerkung: das Foto wurde von Rolf Hofmann (Stuttgart) im April 1994 im 1860
eröffneten Hebrew Rest Cemetery in New Orleans, 2100 Pelopidas at Frenchman
Street, near Elysian Fields and Gentilly Blvd.,
aufgenommen.
 Grabstein im "Hebrew Rest Cemetery" in New Orleans
für das Ehepaar Weill:
Grabstein im "Hebrew Rest Cemetery" in New Orleans
für das Ehepaar Weill:
"Hier ruht WEILL
Julius Weill Feb. 4 1875 - Feb. 20 1937
Born in Schirhofen Alsace
Bertha Levy Weill Feb 14 1889 - Aug. 29 1972
Born in Marckolsheim Alsace
Ihre Seelen seien eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zur Geschichte der Synagoge
Eine erste Synagoge wurde 1730 erbaut. Da sie zu klein war, erstellte
die Gemeinde 1817/18 eine neue Synagoge, die im Herbst 1818 eingeweiht wurde.
1899 wurde sie umfassend renoviert, worüber ein Bericht in der
Zeitschrift "Der Israelit" vorliegt:
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. September 1899:
"Schirrhofen. Vor einigen Tagen konnte die israelitische Gemeinde ein
Doppelfest feiern, nämlich die Wieder-Einweihung der neu restaurierten
Synagoge, sowie die Amtseinführung des Herrn Dr. Wolf, des bewährten
Leiters der eingegangenen Präparandenschule zu Kolmar. Von Nah und Fern
waren neugierige zu dieser Feier herbeigeeilt. Unter den Anwesenden
bemerkten wir die Herren Rabbiner aus Zabern, Hagenau, Weißenburg,
Buchsweiler, Lauterburg und Saarunion, welche fast alle ehemalige Schüler
des Dr. Wolf sind. Als Vertreter der Regierung war anwesend Kreisdirektor
Freiherr von Gagern aus Hagenau. Rabbiner Levy - Hagenau führte unsern
neuen Rabbiner mit einem herzlichen Willkommen in sein Amt ein; er möchte
Glück, Segen und Freude in seinem neuen Wirkungskreis finden. Mehrere
Psalmen wurden von Kantor Weill abwechselnd mit dem Synagogenchor in
schönster Weise vorgetragen. Darauf hielt Dr. Wolf seine Antrittsrede.
Die Synagoge bildet jetzt eine Zierde der Gemeinde." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. September 1899:
"Schirrhofen. Vor einigen Tagen konnte die israelitische Gemeinde ein
Doppelfest feiern, nämlich die Wieder-Einweihung der neu restaurierten
Synagoge, sowie die Amtseinführung des Herrn Dr. Wolf, des bewährten
Leiters der eingegangenen Präparandenschule zu Kolmar. Von Nah und Fern
waren neugierige zu dieser Feier herbeigeeilt. Unter den Anwesenden
bemerkten wir die Herren Rabbiner aus Zabern, Hagenau, Weißenburg,
Buchsweiler, Lauterburg und Saarunion, welche fast alle ehemalige Schüler
des Dr. Wolf sind. Als Vertreter der Regierung war anwesend Kreisdirektor
Freiherr von Gagern aus Hagenau. Rabbiner Levy - Hagenau führte unsern
neuen Rabbiner mit einem herzlichen Willkommen in sein Amt ein; er möchte
Glück, Segen und Freude in seinem neuen Wirkungskreis finden. Mehrere
Psalmen wurden von Kantor Weill abwechselnd mit dem Synagogenchor in
schönster Weise vorgetragen. Darauf hielt Dr. Wolf seine Antrittsrede.
Die Synagoge bildet jetzt eine Zierde der Gemeinde." |
Durch die Auswanderung der meisten jüdischen Einwohner konnten bereits in den
1920er-Jahren keine regelmäßigen Gottesdienste gefeiert werden. 1930 stand die
Synagoge zum Verkauf, doch wurde dieser nochmals verschoben. 1945 ist sie bei
den Kämpfen gegen Schluss des Krieges niedergebrannt. 1959 wurde die Ruine
abgebrochen, das Synagogengrundstück verkauft. Auf diesem wurde ein Wohnhaus
erbaut (Grundstück: 7, Rue des Huttes).
Adresse/Standort der Synagoge: 7 Rue des
Huttes
Fotos
Historische Ansichten
der
Synagoge |
 |
 |
| |
Die Synagoge in
Schirrhofen |
| |
|
Erinnerung an die jüdische
Geschichte: die "Rue de Juifs" |
 |
 |
| |
Die "Rue de
Juifs" (Judenstrasse) in Schirrhoffen, in der es jedoch keine Spuren
der jüdischen Geschichte mehr zu entdecken gibt. |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Rose-Marie Vetter: À La Lisière de la Forêt: Schirrhein/Schirrhofen.
Strasbourg 1995. |
 | Beitrag von Joë Friedemann: Alexandre Weill : un "hors-cadre"
de la vie juive alsacienne au 19ème siècle. 1811- 1899: hier
anklicken (der Schriftsteller Alexandre Weill stammt aus Schirrhoffen) |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|