|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
Synagogen in Bayerisch Schwaben
Oettingen (Landkreis Donau-Ries)
Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge
Übersicht:
Es besteht eine weitere
Seite mit Texten zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (bitte
anklicken)
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
(english
version)
(Text erstellt unter Mitarbeit von R. Hofmann, Stuttgart - HarburgProject)
In Oettingen gab es bereits im Mittelalter eine jüdische Gemeinde. Die
in Oettingen lebenden jüdischen Geschäftsleute standen in engen Verbindungen
zu den Nördlinger Juden. Bei den Judenverfolgungen 1298 und 1348/49
wurde die Gemeinde zweimal weitgehend vernichtet. Seit Anfang des 15.
Jahrhunderts lebten Juden wieder in der Stadt. 1434 zahlten drei
jüdische Familien 100 Gulden Krönungssteuer ans Reich. Die 1457 genannte
"Judengasse" ist vermutlich die heutige Ledergasse im Nordosten der
Stadt. 1488 wurden die Juden Oettingens (damals sechs Familien)
ausgewiesen, doch gab es seit der Mitte des 16. Jahrhunderts und bis erneut eine
jüdische Gemeinde.
Auf Grund der Teilung der Stadt zwischen zwei konfessionell unterschiedlichen
oettingischen Herrschaften Linien (Oettingen-Oettingen, das später zu
Oettingen-Wallerstein gehörte und Oettingen-Spielberg) gab es in Oettingen bis
1731 "lutherische Juden" und "katholische Juden", die auch
zwei verschiedene Synagogen besuchten. Ungeteilt für beide Herrschaftslinien
blieb das Rabbinat, zu dessen Inhaber mehrere hervorragende Gelehrte
gehörten, u.a. Gaon Rabbi Henoch Sundel Ben Abraham (Rabbiner von 1649 bis 1665),
Rabbi Schimon ben Jischai (um 1680 Rabbiner in Oettingen), Rabbiner
Moscheh Meir ben Jizchak (Tarnopol, Verfasser des Pentateuchkommentars Meor
Katan, gest. 1696 und in Wallerstein
beigesetzt), Rabbiner Naftali Chanoch ben R. Mordechai (Nachfolger des
vorigen Rabbiners nach 1696), Rabbiner Abraham David Mahler (aus Prag, in
Oettingen von 1719 bis 1753, ab 1724 hochfürstlicher und hochgräflicher
Landrabbiner in Oettingen), Rabbiner Abraham Binjamin Wolf Spiro ben Schmuel
halevi (geb. in Prag, bis 1764 Rabbiner in Oettingen), Rabbiner Jakob ben
Pinchas Katzenellenbogen (war ein Sohn des Rabbiners Pinchas
Katzenellenbogen, der von 1719-20 Rabbiner in Wallerstein, dann in
Marktbreit, Leipnik und Boskowitz war, wo
er 1758 gestorben ist; Jakob ben Pinchas Katzenellenbogen war von 1764 bis zum
seinem Tod 1795 Rabbiner in Oettingen), Rabbiner Pinchas Jacob Katzenellenbogen
(zunächst Rabbiner in Schwabach, als
Nachfolger seines Vaters Rabbiner in Oettingen von 1795 bis 1845, beigesetzt in
Wallerstein), Rabbiner Dr. Meyer Feuchtwang (1846 bis 1857). 1851/52 sollte nach der
vorübergehenden Auflösung der Distriktrabbinates Schwabach
der Rabbinatsbezirk von Oettingen wesentlich vergrößert werden. Doch wurden
die Pläne nicht umgesetzt, vielmehr das Distriktrabbinat Oettingen nach 1857
aufgelöst und Oettingen dem Bezirksrabbinat Wallerstein
zugeteilt.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine
jüdische Schule, ein rituelles Bad und einen Friedhof. Zur Besorgung
religiöser Aufgaben war (neben dem Rabbiner) ein Lehrer angestellt, der
teilweise zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (vgl. Ausschreibungen
der Stelle/n auf der Textseite).
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Unteroffizier Max
Badmann (geb. 24.6.1890 in Oettingen, gef. 23.9.1915), Gefreiter Ludwig Gutmann
(geb. 20.10.1897 in Obermoschel, Sohn des Lehrers Leopold Gutmann, der 1898 von
Obermoschel nach Oettingen wechselte, gef. 6.6.1918), Joseph Herrmann (geb. 9.7.1881
in Oettingen, gef. 21.5.1916) und Max Herrmann (geb. 13.2.1886 in Oettingen,
gef. 18.7.1916).
1925 gehörten noch 107 Einwohner Oettingens zur jüdischen Gemeinde
(3,6 % von etwa 3.000 Einwohnern). Die Gemeindevorsteher waren damals
Louis Badmann, Hermann Badmann, Louis Emanuel, Samuel Martin und Theodor
Engländer. Als Kantor und Lehrer wirkte Leopold Gutmann. Er
unterrichtete noch elf schulpflichtige Kinder im Religionsunterricht. An
jüdischen Vereinen gab es einen Wohltätigkeitsverein (Chewroth) unter
Louis Emanuel mit 46 Mitgliedern), einen Jünglingsverein und Leopold Gutmann
(acht
Mitglieder) und den Frauenverein (gegründet 1900; Ziele Krankenpflege und
Unterstützung Hilfsbedürftiger) unter Klara Engländer (33 Mitglieder). 1932
war erster Gemeindevorsteher und Schriftführer Max Badmann, 2. Vorsitzender
Louis Emanuel. Kantor und Lehrer war inzwischen Alois Kurzweil. Die Zahl der
schulpflichtigen jüdischen Kinder war auf sieben
zurückgegangen.
1933 wurden 66 jüdische Einwohner in Oettingen gezählt, von denen ein
Teil auswandern konnte. Vermutlich letzter Lehrer der Gemeinde war Leopold Rose,
der im Herbst 1936 von Oettingen nach Hörstein wechselte. Beim Novemberpogrom
1938 wurde die Synagoge geschändet und demoliert (siehe unten). Die letzten
der jüdischen Einwohner Oettingens wurden 1941/42 (teilweise von anderen
Orten aus) deportiert und ermordet.
Von den in Oettingen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Albert Aufhäuser (1877),
David Badmann (1869), Elsa Badmann geb. Wimpfheimer (1888), Leo Badmann (1884),
Ludwig Badmann (1893), Max Badmann (1881), Auguste Buckmann (1882), Josef
Buckmann (1880), Sofie Buckmann geb. Neustädter (1887), Albert Emanuel (1900),
Hans Emanuel (1933), Rosa (Roalie) Engländer geb. Vorchheimer (1878), Theodor
Engländer (1876), Berta Gerst geb. Badmann (1883), Beno Gutmann (1903),
Henriette Gutmann geb. Strauss (1873), Ida Gutmann geb. Leiter (1876), Justin
Gutmann (1880), Marie Hamburger geb. Klein (1874), Berta Hausner (1853), Martha
Heidecker geb. Kugler (1890), Henriette Heilbronner geb. Hausner (1860), Philipp
Herrmann (1878), Rudolf Herrmann (1929), Salo Herrmann (1891), Therese Herrmann
geb. Weißmann (1884), Emma Heß geb. Klein (1878), Julie Hirsch geb. Herrmann
(1875), Therese Kleemann geb. Engländer (1881), Martha Löwenberger geb.
Schülein (1884), Marta Löwensteiner geb. Hermann (1887), Frieda Martin geb.
Herrmann (1910), Helmut Martin (1934), Selma Martin geb. Neuburger (1898),
Thekla Mayer geb. Michelbacher (1883), Alfred Michelbacher (1892), August
Michelbacher (1889), Alfred Model (1867), Sigmund Model (1862), Salomon
Neuburger (1902), Laura Neumann geb. Obermeier (1862), Julius Regensburger
(1887), Minna Regensburger geb. Sämann (1881), Berta Rothschild geb. Frohmann
(1880), Rosa Sämann geb. Weissmann (1868), Betty Schlossmann (1880), Mina
Schlossmann (1881), Mathilde Schülein (1891, ermordet in Grafeneck 1940,
"Euthanasie"), Martha Schulheimer (1887), Max Schulheimer (1891), Sigmund
Schulheimer (1882), Adolf Schwab (1874), Gustav Schwab (1870), Alfred Springer
(1923), Betty Springer geb. Herz (1889), Fritz Springer (1915), Ludwig Springer
(1878), Friedrich (Fritz) Steiner (1888, vgl. ein Dokument
auf der Seite zu Fischach), Gretchen Steiner geb. Kirchhausen
(1903), Julius Steiner (1900), Regina Steiner (1871), Rosette Weinberger geb.
Badmann (1865), Lilly (Lea) Wolff geb. Badmann (1895).
Zur Geschichte der
Synagoge
Eine Synagoge beziehungsweise ein Betsaal war bereits
vermutlich bereits im Mittelalter vorhanden. Unter den 1488 ausgewiesenen Juden
war auch ein "Schulklopfer", der die Aufgabe hatte, die
Gemeindeglieder zu den Gottesdiensten (vor allem zu den Frühgottesdiensten)
zusammenzurufen. Im 16./17. Jahrhundert wird vermutlich jeweils ein Betsaal in
einem der jüdischen Häuser genutzt worden sein.
Eine Synagoge wird im
18. Jahrhundert erstellt worden sein. Sie stand nach dem Katasterplan von 1833
auf dem heutigen Grundstück Schäfflergasse 1. Im selben Gebäude war auch die
Rabbinerwohnung. Für die Erlaubnis, Gottesdienste zu feiern, hatte die
Gemeinde 1761 und 1806 an die Herrschaft 16 Gulden 30 Kreuzer jährlich an
"Synagogengeld" zu bezahlen. Die Zahlung dieser jährlichen
Abgaben hatte zur Voraussetzung, dass die Synagoge auf Kosten der Herrschaft
errichtet war.
Bericht über eine Predigt in der Synagoge in
Oettingen (1849)
 Artikel in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter"
vom 9. November 1849: "Nördlingen, den 28. Oktober (1849).
Geehrtester Herr Redakteur! In der Voraussetzung, dass mein Bericht Ihnen
und einem großen Teil der Leser Ihres geschätzten Blattes nicht
uninteressant sein wird, teile ich Ihnen Folgendes mit: Am
vergangenen Schabbat hatte die hiesige Gemeinde die Ehre und den Genuss
von einem Rabbinatskandidaten aus Ihrer ehrwürdigen Heiligen Gemeinde,
namens Mosche Jeschajahu usw. (= Moses Jesaias Glogau) aus Altona,
welcher sich seit mehreren Jahren bei Rabbiner Abraham Wechsler in Schwabach,
sowie in deren zu seinem Fache gehörigen Wissenschaften ausbildet, durch
eine Predigt erbaut zu werden. - Derselbe hat sowohl dahier als in Wassertrüdingen
des Rabbinatssitzes des Rabbiners Joseph Buttenwieser, wo er am
vergangenen Sukkot und in Oettingen, dem Rabbinatssitze des
berühmten Rabbiners Dr. Feuchtwanger öffentliche Erbauungsreden
hielt den ungeteiltesten Beifall seiner Zuhörer erworben. Der
reichhaltige Inhalt seiner Predigten, aus denen allenthalben gründliche
Gelehrsamkeit, tiefes Forschen und echte Gottesfurcht hervorleuchteten,
sowie sein vortrefflicher Vortrag berechtigt uns zu der Erwartung, dass er
einst seinen Posten mit großem Erfolg ausfüllen wird (weshalb ihm auch
ein solcher, wenn er einst einen sucht, nicht vorenthalten werden
möge.)" Artikel in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter"
vom 9. November 1849: "Nördlingen, den 28. Oktober (1849).
Geehrtester Herr Redakteur! In der Voraussetzung, dass mein Bericht Ihnen
und einem großen Teil der Leser Ihres geschätzten Blattes nicht
uninteressant sein wird, teile ich Ihnen Folgendes mit: Am
vergangenen Schabbat hatte die hiesige Gemeinde die Ehre und den Genuss
von einem Rabbinatskandidaten aus Ihrer ehrwürdigen Heiligen Gemeinde,
namens Mosche Jeschajahu usw. (= Moses Jesaias Glogau) aus Altona,
welcher sich seit mehreren Jahren bei Rabbiner Abraham Wechsler in Schwabach,
sowie in deren zu seinem Fache gehörigen Wissenschaften ausbildet, durch
eine Predigt erbaut zu werden. - Derselbe hat sowohl dahier als in Wassertrüdingen
des Rabbinatssitzes des Rabbiners Joseph Buttenwieser, wo er am
vergangenen Sukkot und in Oettingen, dem Rabbinatssitze des
berühmten Rabbiners Dr. Feuchtwanger öffentliche Erbauungsreden
hielt den ungeteiltesten Beifall seiner Zuhörer erworben. Der
reichhaltige Inhalt seiner Predigten, aus denen allenthalben gründliche
Gelehrsamkeit, tiefes Forschen und echte Gottesfurcht hervorleuchteten,
sowie sein vortrefflicher Vortrag berechtigt uns zu der Erwartung, dass er
einst seinen Posten mit großem Erfolg ausfüllen wird (weshalb ihm auch
ein solcher, wenn er einst einen sucht, nicht vorenthalten werden
möge.)" |
| Hinweis: Die von Moses Jesajas Glogau
gehaltene Predigt findet sich auf der Textseite
zu Oettingen. |
1853 wurde - noch während der Amtszeit des letzten Oettinger
Rabbiners (Meir Feuchtwang) - auf dem Grundstück des bisherigen Synagogengebäudes
in der Schäfflergasse eine neue Synagoge erbaut bzw. eingerichtet.
Hinweis auf die bevorstehende Einweihung der Synagoge in
Oettingen (1853)
 Im
Zusammenhang mit dem Bericht über die Einweihung der Synagoge in Heidenheim
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. November
1853: "...Dem nahen Oettingen steht demnächst eine gleiche
Feier bevor. Überhaupt nimmt die Errichtung neuer jüdischer
Gotteshäuser in unserm Lande auf eine erfreuliche Weise zu. Möchte auch
die sittliche und moralische Veredlung unserer Glaubensgenossen hiermit
gleichen Schritt halten!" Im
Zusammenhang mit dem Bericht über die Einweihung der Synagoge in Heidenheim
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. November
1853: "...Dem nahen Oettingen steht demnächst eine gleiche
Feier bevor. Überhaupt nimmt die Errichtung neuer jüdischer
Gotteshäuser in unserm Lande auf eine erfreuliche Weise zu. Möchte auch
die sittliche und moralische Veredlung unserer Glaubensgenossen hiermit
gleichen Schritt halten!" |
Über 80 Jahre war die Synagoge Zentrum des
jüdischen Gemeindelebens in Oettingen.
Während des Novemberpogroms 1938 wurde die
Synagoge auf Grund ihrer Nähe zu anderen Häusern nicht niedergebrannt. Die
Fenster, das gesamte Inventar und alle
Ritualien wurden zerstört. Unter den vernichteten Ritualien befanden sich 13
Torarollen, zwei kostbare Toraschrein-Vorhänge (von 1764 bzw. 1806) und viel
Silbergerät. Über das Schicksal des reichen Gemeindearchivs, das im
Gemeindesaal war, ist nichts bekannt. Es verschwand am Pogromtag spurlos
zusammen mit der jüdischen Gemeindebibliothek und der Bibliothek der jüdischen
Volksschule.
Nach 1945 wurde das Synagogengebäude zunächst von
amerikanischem Militär beschlagnahmt und der Jüdischen Vermögensverwaltung
(JRSO) übertragen. Später kam das Gebäude in Privatbesitz.
Fotos
Historische Fotos:
(Quelle der Fotos links und rechts, obere Zeile: G. Römer: Schwäbische Juden s.Lit. S.
272.275;
Quelle untere Zeile: Theodor Harburger: Inventarisierung jüdischer Kunst-
und Kulturdenkmäler Bd. 3 S. 637ff;
Originale in den Central Archives
Jerusalem)
 |
 |
 |
Die Synagoge in Oettingen
(Gebäude rechts im Vordergrund) |
Die Wetterfahne der ehemaligen
Synagoge Oettingen, heute im
Heimatmuseum
der Stadt |
Oberlehrer Leopold Gutmann um
1926
mit der damaligen jüdischen
Schulklasse in Oettingen |
| |
| |
|
|
  |
 |
 |
Toraschilde aus Oettingen aus
dem 18. Jahrhundert |
Tora-Aufsatz (Rimmon) aus
Oettingen aus dem 17. Jahrhundert |
Tora-Vorhang (Parochet )
aus
Oettingen) |
| Die von Theodor
Harburger am 19.9.1927 in Oettingen fotografierten Gegenstände sind nicht
erhalten. |
Fotos nach 1945/Gegenwart:
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 12.3.2004)
 |
 |
 |
Blick auf die
ehemalige Synagoge; im Fenster der Ostwand ist - über dem früher
darunter befindlichen Toraschrein -
ein Davidsstern erhalten |
| |
 |
 |
 |
Hinweistafel
an der Synagoge |
Bericht aus der
"Sonntagszeitung"
vom 13.11.2005
zur
Gedenkstein-Enthüllung |
Modell des Gedenksteines auf
der Einladungskarte zur
Veranstaltung am 10.11.2005 |
| |
| |
|
|
| Jüdisches Schulhaus: |
|
|
 |
 |
 |
| Das ehemalige
jüdische Schulhaus mit Rabbiner-/Lehrerwohnung in der Ringgasse (frühere
Judengasse) |
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
(Bericht übersandt von Peter Karl Müller,
Kirchheim/Ries)
 Artikel
in den "Rieser Nachrichten" vom 11. November 2008: "Erinnerung
an die Oettinger Juden. Gedenkfeier. Zwei neue Tafeln in der Ringgasse
und in der Schäfflergasse enthüllt. Artikel
in den "Rieser Nachrichten" vom 11. November 2008: "Erinnerung
an die Oettinger Juden. Gedenkfeier. Zwei neue Tafeln in der Ringgasse
und in der Schäfflergasse enthüllt.
Oettingen / heja / Gestern vor 70 Jahren wurde in Oettingen die
Synagoge in der Schäfflergasse geschändet - und zwar von Schulkindern,
die dazu von ihrem Lehrer mit Prügeln und Äxten bewaffnet wurden und
denen von Umstehenden Beifall für ihre Untaten gezollt wurde. Eine
Gedenktafel erinnert heute an diesem Ort an die Juden, die von 1933 bis
1942 in der Stadt wohnten. Jetzt wird dieses Denkmal von einem Schild
ergänzt, das an die ehemalige Synagoge und die Rabbinerwohnung erinnert,
die sich früher in dem Gebäude befanden. Außerdem enthält es den
Hinweis, dass das Denkmal von dem Lehminger Bildhauer Fred Jansen
gestaltet wurde, von dem im Übrigen auch das Zusatzschild stammt.
Gestern wiesen im Rahmen einer Gedenkfeier anlässlich des 70. Jahrestages
der Schändung der Oettinger Synagoge durch die Nationalsozialisten die 1.
Vorsitzender des Heimatvereins Oettingen, Gerda Martin und Bürgermeister
Matti Müller auf die Zusatztafel hin und erinnerten an die Gräueltaten
des Nationalsozialismus. 'Heute vor 70 Jahren, fast zu selben Zeit,
zerstörten Schulkinder die Oettinger Synagoge', so Gerda Martin. Umso
mehr freue es sie, dass zur gestrigen Gedenkfeier Schüler der Oettinger
Grund- und Hauptschule mit ihrem Lehrer erschienen seien.
'Dieses Denkmal und das Zusatzschild sind ein Mahnmal wider das Vergessen
und für mehr Toleranz', sagte sie. Und: 'Wir wollen in Oettingen an
unsere jüdischen Mitbürger denken, deren Namen in diese beiden Rollen
eingraviert sind und ich kann Sie nur bitten, drehen Sie an diesen Rollen
und denken Sie an die Juden, die in Oettingen lebten'. Im Namen der Stadt
und des Stadtrats bedankte sich Bürgermeister Müller für das Engagement
des Heimatvereins: 'Ich sage Ihnen für Ihre sehr wichtige Arbeit die
vollkommene Unterstützung der Stadt zu', erklärte er.
Im Anschluss begab man sich in die Ringgasse: Dort wurde von
Museumspfleger ein Schild enthüllt, das an das ehemalige Judengässchen
erinnert. 'Das Judengässchen,' oder manche sagten auch Judengasse, wurde
bereits 1938 von den Nationalsozialisten in Ringgasse umbenannt',
erklärte dazu Gerda Martin. Der Heimatverein habe sich nun entschlossen,
mit einem Schild an den früheren Namen der Gasse zu erinnern." |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Germania Judaica III,2 S. 1061.
|
 | Ludwig Müller: Aus fünf Jahrhunderten. Beiträge zur Geschichte
der jüdischen Gemeinden im Ries. in: Zeitschrift des Historischen Vereins
für Schwaben und Neuburg 26 1899 S. 81-183. |
 | Louis Lamm: Das Memorbuch von Oettingen. In:
Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft 1931-32. S. 147-159.
Online
eingestellt (pdf-Datei). |
 |  "Oettinger
Blätter" vom Januar 1989: Die Juden in Oettingen - ein Beitrag zur
Heimatgeschichte. "Oettinger
Blätter" vom Januar 1989: Die Juden in Oettingen - ein Beitrag zur
Heimatgeschichte. |
 | Gernot Römer: Der Leidensweg der Juden in Schwaben. Schicksale von
1933-1945 in Berichten, Dokumenten und Zahlen. Augsburg 1983. |
 | ders.: Die Austreibung der Juden aus Schwaben. Schicksale nach 1933 in
Berichten, Dokumenten, Zahlen und Bildern. Augsburg 1987. |
 | ders.: Schwäbische Juden. Leben und Leistungen aus zwei Jahrhunderten. In
Selbstzeugnissen, Berichten und Bildern. Augsburg 1990. |
 | 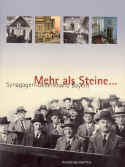 "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band I:
Oberfranken - Oberpfalz - Niederbayern - Oberbayern - Schwaben.
Erarbeitet von Barbara Eberhardt und Angela Hager. Hg.
von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.
Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschland. Begründet und
herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im
Allgäu. (mit umfassenden Quellen- und
Literaturangaben) "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band I:
Oberfranken - Oberpfalz - Niederbayern - Oberbayern - Schwaben.
Erarbeitet von Barbara Eberhardt und Angela Hager. Hg.
von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.
Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschland. Begründet und
herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im
Allgäu. (mit umfassenden Quellen- und
Literaturangaben)
ISBN 978-3-98870-411-3.
Abschnitt zu Oettingen S. 523-529. |
 |
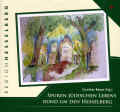 Spuren jüdischen Lebens rund um den Hesselberg. Kleine Schriftenreihe Region Hesselberg Band
6.
Spuren jüdischen Lebens rund um den Hesselberg. Kleine Schriftenreihe Region Hesselberg Band
6.
Hrsg. von Gunther Reese, Unterschwaningen 2011. ISBN
978-3-9808482-2-0
Zur Spurensuche nach dem ehemaligen jüdischen Leben in der Region Hesselberg lädt der neue Band 6 der
'Kleinen Schriftenreihe Region Hesselberg' ein. In einer Gemeinschaftsarbeit von 14 Autoren aus der Region, die sich seit 4 Jahren zum
'Arbeitskreis Jüdisches Leben in der Region Hesselberg' zusammengefunden haben, informieren Ortsartikel über Bechhofen, Colmberg,
Dennenlohe, Dinkelsbühl, Dürrwangen, Feuchtwangen, Hainsfarth, Heidenheim am Hahnenkamm, Jochsberg, Leutershausen, Mönchsroth, Muhr
am See (Ortsteil Altenmuhr), Oettingen, Schopfloch, Steinhart,
Wallerstein, Wassertrüdingen und Wittelshofen über die Geschichte der ehemaligen jüdischen Gemeinden. Am Ende der Beiträge finden sich Hinweise auf sichtbare Spuren in Form von Friedhöfen, Gebäuden und religiösen Gebrauchsgegenständen mit Adressangaben und Ansprechpartnern vor Ort. Ein einleitender Beitrag von Barbara Eberhardt bietet eine Einführung in die Grundlagen des jüdischen Glaubens. Eine Erklärung von Fachbegriffen, ein Literaturverzeichnis und Hinweise auf Museen in der Region runden den Band mit seinen zahlreichen Bildern ab. Das Buch ist zweisprachig erschienen, sodass damit auch das zunehmende Interesse an dem Thema aus dem englischsprachigen Bereich
abgedeckt werden kann, wie Gunther Reese als Herausgeber und Sprecher des Arbeitskreises betont. Der Band mit einem Umfang von 120 Seiten ist zum Preis von
12,80 €- im Buchhandel oder im Evangelisch-Lutherischen Pfarramt Mönchsroth, Limesstraße 4, 91614 Mönchsroth, Tel.: 09853/1688 erhältlich
E-Mail: pfarramt.moenchsroth[et]elkb.de. |
| |
|
 |  "Ma
Tovu...". "Wie schön sind deine Zelte, Jakob..." Synagogen
in Schwaben. Mit Beiträgen von Henry G. Brandt, Rolf Kießling,
Ulrich Knufinke und Otto Lohr. Hrsg. von Benigna Schönhagen.
JKM Jüdisches Kulturmuseum Augsburg-Schwaben. 2014. "Ma
Tovu...". "Wie schön sind deine Zelte, Jakob..." Synagogen
in Schwaben. Mit Beiträgen von Henry G. Brandt, Rolf Kießling,
Ulrich Knufinke und Otto Lohr. Hrsg. von Benigna Schönhagen.
JKM Jüdisches Kulturmuseum Augsburg-Schwaben. 2014.
Der Katalog erschien zur Wanderausstellung "Ma Tovu...".
"Wie schön sind deine Zelte, Jakob..." Synagogen in Schwaben des
Jüdischen Kultusmuseums Augsburg-Schwaben und des Netzwerks Historische
Synagogenorte in Bayerisch-Schwaben.
|


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Oettingen Swabia. The community was
virtually destroyed in the Rindfleisch massacres of 1298 and the Black Death
persecutions of 1348-49. Jews were present again in the late 14th century under
ducal protection. In the 17th century they were active as moneylenders and horse
and cattle traders. With the city divided between two rival duchies, two Jewish
communities arose in the second half of the 17th century, each constituting the
seat of a district rabbinate. In 1690 the Jews were saved from a pogrom in a
blood libel and commemorated the event annually by a special fast until the 20th
century. A new synagogue was consecrated in 1853. In 1857, 88 children were
enrolled in a Jewish public school. The Jewish population reached a peak of 430
in 1837 (total 3.210) and thereafter declined steadily to 66 in 1933. On Kristallnacht
(9-10 November 1938), the synagogue was vandalized and 13 Torah scrolls were
destroyed; afterwards Jewish homes and stores were wrecked. Forty-five Jews left
for other German cities in the Nazi era; another ten emigrated. Of the remaining
Jews, eight were deported to Piaski (Poland) via Munich on 3 April 1942.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|