|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"
Zur Übersicht "Synagogen im
Kreis Bad Kreuznach"
Schweppenhausen (VG Stromberg, Landkreis Bad
Kreuznach )
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Schweppenhausen bestand eine jüdische Gemeinde bis um
1930. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück.
Genaue Zahlen jüdischer Einwohner sind jedoch erst aus dem 19. Jahrhundert
bekannt. 1808 lebten 52 jüdische Personen am Ort (12 % der
Gesamtbevölkerung). 1827 wurde bereits die Höchstzahl jüdischer
Einwohner mit 72 Personen erreicht, danach ging die Zahl durch Aus- und
Abwanderung zurück (1858 63 Personen, d.h. 10 % der Gesamteinwohnerschaft; 1895
35 Personen).
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Julius Eschenheimer
(geb. 20.8.1893 in Esch, Untertaunus, gef. 11.3.1915).
Um 1925, als noch 20 Personen der jüdischen Gemeinde
angehörten (3,3 % von etwa 600 Einwohnern), war Vorsitzender der Gemeinde Jakob
Schüller. Den Religionsunterricht für die damals noch zwei jüdischen
Kindern erteilte Lehrer Bernhard Lehmann aus Simmern. An jüdischen Vereinen gab
es einen Wohltätigkeitsverein, dem 1925 18 Mitglieder unter dem
Vorsitzenden Moritz Marx angehörten. 1932 war Vorsitzender der Gemeinde Moritz Marx.
Nach 1933 verzogen unter dem
Druck der zunehmenden Repressalien und der Wirkungen des wirtschaftlichen
Boykotts weitere der jüdischen Einwohner den Ort. 1939 lebten in
Schweppenhausen noch die
folgenden jüdischen Personen: Elisabeth Eschenheimer geb. Dach, Henny
Schüller, Jakob Schüller und Emilie Schüller geb. Marx sowie die jüdische
Ehefrau von August Bahnemann. 1942 wurden die verbliebenen jüdischen Einwohner
- außer Frau Bahnemann - deportiert.
Von den in Schweppenhausen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945" sowie dem Buch "Jüdische Grabstätten"
s. Lit. S.
383): Elisabeth Eschenheimer geb. Dach (1881), Ilse K. Eschenheimer
(1914), Helene Haas geb. Dach (1866),
Moritz Haas (1862), David Löb (1869), Heinrich Löb (1903), Emma Marx geb. Löb
(1878), Henriette Marx (1854), Mathilde Meyer geb. Schüller (1869), Elisabeth
Oster geb. Haas (1899), Nelly Henriette Reiss geb. Dach
(1901), Henny Schüller (1891), Isaak Schüller (1880), Josef Schüller
(1912), Karoline Schüller (1869), Jacob Schwarz (1943), Hermann Silberstein (geb. in Schweppenhausen, lebte mit
seiner Frau Selma geb. Glücksmann (1883) und den beiden Kindern in Frankfurt, von wo
aus die ganze Familie deportiert und ermordet wurde).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
In jüdischen Periodika des 19. / 20. Jahrhunderts wurden -
außer dem bei der Synagogengeschichte zitierten Bericht - noch keine Artikel
zur jüdischen Geschichte in Schweppenhausen gefunden.
Zur Geschichte der Synagoge
Eine erste Synagoge war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
vorhanden. Es ist nicht bekannt, wann sie erbaut wurde. Um 1860 ist diese
erste Synagoge abgebrannt. Für einige Zeit musste ein provisorischer Betsaal
benutzt werden. 1862/63 konnte mit Hilfe zahlreicher Spenden eine neue Synagoge erstellt werden. Im
Monat Elul 5623 (siehe Bericht unten = August/September 1863) wurde die neue Synagoge, in der
sich auch die Wohnung für den Lehrer und ein Schulzimmer befand, mit einem
großen Fest der ganzen Gemeinde eingeweiht werden. Die Einweihung nahm Rabbiner
Bamberger aus Kreuznach vor. Über das Einweihungsfest liegt in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 28. Oktober 1863 ein Bericht
vor:
 Schweppenhausen bei Kreuznach, im Elul. Gott hat geholfen, unsere Synagoge
ist vollendet und wir haben bereits am verflossenen Sabbat unseren Gottesdienst
in derselben begonnen. Die Unterzeichneten finden sich daher, sowohl in ihrem
als im Namen ihrer Gemeinde verpflichtet, ihren wärmsten Dank allen Denjenigen,
von nah wie von fern, hiermit auszusprechen, die mit Rat und Tat dazu
beigetragen haben, dass unser Gotteshaus seine Vollendung, ja so bald seine
Vollendung erreicht hat. Das Andenken an die Freude der Einweihung wird
zeitlebens nicht aus unserm Herzen sowie aus dem unserer Kinder und Enkel
weichen. Man konnte diese Einweihung ein wahres religiöses Volksfest nennen.
Die ganze Umgegend, Israeliten wie Nichtisraeliten beteiligten sich daran und
ein Jeder, der dazu beitragen konnte, das Fest zu verherrlichen, der tat es mit
Freude. Die Straßen des Dorfes sowie die Synagoge wurden von unseren
christlichen Mitbürgern mit Blumen, Kränzen, Bäumchen etc. geschmückt,
besonders war dabei Herr Postmeister Lang von hier recht tätig. Schweppenhausen bei Kreuznach, im Elul. Gott hat geholfen, unsere Synagoge
ist vollendet und wir haben bereits am verflossenen Sabbat unseren Gottesdienst
in derselben begonnen. Die Unterzeichneten finden sich daher, sowohl in ihrem
als im Namen ihrer Gemeinde verpflichtet, ihren wärmsten Dank allen Denjenigen,
von nah wie von fern, hiermit auszusprechen, die mit Rat und Tat dazu
beigetragen haben, dass unser Gotteshaus seine Vollendung, ja so bald seine
Vollendung erreicht hat. Das Andenken an die Freude der Einweihung wird
zeitlebens nicht aus unserm Herzen sowie aus dem unserer Kinder und Enkel
weichen. Man konnte diese Einweihung ein wahres religiöses Volksfest nennen.
Die ganze Umgegend, Israeliten wie Nichtisraeliten beteiligten sich daran und
ein Jeder, der dazu beitragen konnte, das Fest zu verherrlichen, der tat es mit
Freude. Die Straßen des Dorfes sowie die Synagoge wurden von unseren
christlichen Mitbürgern mit Blumen, Kränzen, Bäumchen etc. geschmückt,
besonders war dabei Herr Postmeister Lang von hier recht tätig.
Die Einweihung begann Freitag, nachmittags 5 Uhr mit Minchagebet in der
Stube, die seitdem unsere alte Synagoge ein Raub der Flammen geworden, als
Betlokal diente und nachdem hierauf Herr Rabbiner Bamberger aus
Kreuznach eine kurze, aber
herzliche Abschiedsrede gesprochen, begann ein unabsehbarer Zug von diesem Betlokal aus sich zur neuen Synagoge hin zu bewegen. Herr
Kantor N. Cahn aus
Bingen leistete hierbei Vortreffliches. Drei Torarollen, von den Ältesten der
Gemeinde unter einem Himmel getragen, bildeten den Anfang des Zuges. An der
Synagoge angelangt, überreichte der Herr Bürgermeister Dheil von
Windesheim
dem Herrn W. P. Heymann aus Kopenhagen, der unsere Gemeinde mit einer
prachtvollen Sepher Tora (= Torarolle) beschenkt hatte und sich, da er gerade
auf Reisen in unserer Gegend sich befand, bei unserm Feste einfand, den Schlüssel
zur Synagoge, der sie, nach vorausgeschickten herzlichen Glückwünschen öffnete.
Nach dem Eintritte ward in der Synagoge Ma
towu ("Wie lieblich…") gesungen und einige passende Psalmen vom Kantor
und der Gemeinde rezitiert. Hierauf hielt der Rabbiner die Einweihungsrede über
Psalm 24,1-6, die einen ungeteilten Beifall sowohl bei Israeliten wie bei
Nichtisraeliten erntete. Unter den zahlreichen christlichen Anwesenden befanden
sich auch der königliche Friedensrichter von Stromberg, die Herren Bürgermeister
von Windesheim und Stromberg und andere Persönlichkeiten höheren Ranges. Nach
der Predigt und einigen unmittelbar darauf abgesungenen Psalmen folgte Kabbalat
Schabbat ("Empfang des Schabbat"). Sabbat früh predigte der Herr
Rabbiner über die Stelle im Talmud Rosch-Haschana
Fol. 16 … Der Gottesdienst
endete gegen Mittag. |
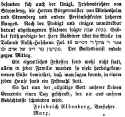 Ein eigentliches Festessen fand wohl nicht statt, allein in jeder Familie wurden
so viele herbeigekommenen Gäste bewirtet, dass man sagen konnte, in einem jeden
Hause fand ein Festmahl statt. Ein eigentliches Festessen fand wohl nicht statt, allein in jeder Familie wurden
so viele herbeigekommenen Gäste bewirtet, dass man sagen konnte, in einem jeden
Hause fand ein Festmahl statt.
So hat nun der allgütige Gott unserer kleinen Gemeinde einen Tag geschenkt, der
nie aus unserm Gedächtnisse schwinden wird.
Friedrich Albenberg, Vorsteher
Marx, Vorsteher."
|
Die Schweppenhauser Synagoge wurde zeitweise auch von den in Windesheim
lebenden jüdischen Personen besucht, bis dort eine eigene Synagoge erbaut
wurde. Die Synagoge war ein einfacher Bruchsteinsaalbau (7 m x 9 m) mit
Rundbogenfenstern in den Traufseiten. Die zweigeschossige Wohnung für den
Vorsänger/Lehrer nahm den westlichen Gebäudeteil ein.
W.P. Heymann (Kopenhagen) hat zur Einweihung der Synagoge
eine neue Torarolle gespendet (Rückblicke von 1865 und 1867 anlässlich des Todes
von W. P. Heymann)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Mai 1865: "Kopenhagen,
Anfangs Ijar (Privatmitteilung) .... Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Mai 1865: "Kopenhagen,
Anfangs Ijar (Privatmitteilung) ....
Zum Schlusse wollen wir noch eine Mannes erwähnen, der auch in weiteren
kreisen bekannt zu werden verdient und es schon in hohem Grade ist, da er
besonders Gemeinden auch in der weitesten Ferne seine hilfespendende Hand
reicht. Es ist dies der sowohl mit Mitteln als auch jüdischen Kenntnissen
reichlich begabte Herr W. P. Heymann dahier. Derselbe hat es sich zur
löblichen Aufgabe gemacht, fremde Gemeinden, die irgendein religiöses
Projekt zur Ausführung bringen wollen, nach Kräften zu subventionieren, wie
er zum Beispiel der Gemeinde Schweppenhausen bei Kreuznach vor
einigen Jahren bei ihrem Synagogenbau eine Sefer Tora schreiben ließ. Er
(G'tt) vermehre seine Tage und seine Jahre im Guten und im Glück (nach
Hiob 36,11). Ein Mann aus dem Haus Levi. " |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1867: "Eine zweite, aber
betrübende Nachricht aus Kopenhagen haben wir unsern Lesern mitzuteilen. Der
denselben wohlbekannte Herr W.P. Heymann verließ, nachdem er mit
seinem enormen Nachlasse die israelitische Gemeinde Kopenhagens und ihre
Wohltätigkeitsinstitute noch reichlich gedacht, vor ungefähr sechs Wochen
das Zeitliche, um im besseren Leben den Lohn seiner Taten zu ernten. Nicht
allein die Gemeinde, in deren Mitte er gelebt und gewirkt, verliert an ihm
eines ihrer bedeutendsten und hervorragendsten Mitglieder - auch alle
religiösen Unternehmungen nah und fern verlieren an ihm einen ihrer
wohlwollendsten Mäzene. Wir können wohl mit Recht sagen, dass niemals ein
Bittgesuch um Förderung irgendeines religiösen Unternehmens - und deren
erhielt er nicht wenige - an ihn gelangte, dem er nicht reichlich, ja
zuweilen mit fürstlicher Munifizenz entsprochen hätte und erinnern wir nur
an die Gemeinde Schweppenhausen bei Kreuznach, der er bei Gelegenheit
ihrer Synagogenweihe eine prachtvolle Sefer Tora (Torarolle) schenkte
- seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1867: "Eine zweite, aber
betrübende Nachricht aus Kopenhagen haben wir unsern Lesern mitzuteilen. Der
denselben wohlbekannte Herr W.P. Heymann verließ, nachdem er mit
seinem enormen Nachlasse die israelitische Gemeinde Kopenhagens und ihre
Wohltätigkeitsinstitute noch reichlich gedacht, vor ungefähr sechs Wochen
das Zeitliche, um im besseren Leben den Lohn seiner Taten zu ernten. Nicht
allein die Gemeinde, in deren Mitte er gelebt und gewirkt, verliert an ihm
eines ihrer bedeutendsten und hervorragendsten Mitglieder - auch alle
religiösen Unternehmungen nah und fern verlieren an ihm einen ihrer
wohlwollendsten Mäzene. Wir können wohl mit Recht sagen, dass niemals ein
Bittgesuch um Förderung irgendeines religiösen Unternehmens - und deren
erhielt er nicht wenige - an ihn gelangte, dem er nicht reichlich, ja
zuweilen mit fürstlicher Munifizenz entsprochen hätte und erinnern wir nur
an die Gemeinde Schweppenhausen bei Kreuznach, der er bei Gelegenheit
ihrer Synagogenweihe eine prachtvolle Sefer Tora (Torarolle) schenkte
- seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens."
|
Nachdem in den Jahren nach 1933 die Zahl der jüdischen Einwohner so
stark zurückgegangen war, dass kein Gottesdienst mehr in der Synagoge möglich
war, verkauften für die Jüdische Kultusgemeinde Moritz Marx, David Löb und
Jakob Schüller die Synagoge am 12. Oktober 1938 für 2.500 RM an einen
Privatmann. Die wenigen in Schweppenhausen noch lebenden jüdischen Personen
besuchten bis zu deren Verwüstung beim Novemberpogrom 1938 die Synagoge in
Seibersbach. Der neue Besitzer des Synagogengebäudes baute dieses zu einer Scheune
um. Das Gebäude ist bis heute erhalten. In den 1990er-Jahren wurden die Reste
des Toraschreines ausgebaut, die Wandöffnung verschlossen.
Adresse/Standort der Synagoge: Schwabenstraße 4a.
Foto
(Quelle: Landesamt S. 341)
 |
|
|
Die ehemalige Synagoge in
Schweppenhausen: Blick auf den
westlichen Gebäudeteil, in dem sich die
Vorsängerwohnung befand. |
Neue Fotos werden
bei Gelegenheit erstellt -
über Zusendungen freut sich der Webmaster,
Adresse siehe Eingangsseite |
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
|
August 2020:
Erinnerung an die Synagoge in
Schweppenhausen
|
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung" vom 6. August 2020:
Abschnitt zu Schweppenhausen: "Baustellenschilder und
Mülltonnen dekorieren das brüchige Gemäuer der ehemaligen Synagoge von
Schweppenhausen in der Schwabenstraße. Nichts erinnert mehr daran, dass hier
einst jüdische Mitbürger ihre Gottesdienste abhielten. 1863 wurde die
Synagoge mit einem großen Fest eingeweiht. In einem Bericht der Zeitschrift
'Israelit hieß es: 'Die Straßen des Dorfes sowie die Synagoge wurden von
unseren christlichen Mitbürgern mit Blumen, Kränzen und Bäumchen
geschmückt.' In dem Gebäude war auch eine Wohnung für den Lehrer und
Vorbeter untergebracht. Nach 1933 verließen die meisten jüdischen Mitbürger
wegen der zunehmenden Repressalien das Dorf. Im Oktober 1938 musste das
Synagogengebäude für 2500 Reichsmark an einen Privatmann verkauft werden.
Noch in den 1990er Jahren wurden die Reste des Thoraschreins ausgebaut. Die
letzten vier verbliebenen jüdischen Einwohner (Elisabeth Eschenheimer, Henny
Schüller, Jakob Schüller und Emilie Schüller) wurden 1942 in den Osten
deportiert. Insgesamt verzeichnet Yad Vashem 17 Opfer des NS-Terrors auf
Schweppenhausen. Sie alle haben zu ihren Lebzeiten die Dorfsynagoge in der
Schwabenstraße besucht. Heute erinnert an dem maroden Gebäude nicht mehr
daran...". Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung" vom 6. August 2020:
Abschnitt zu Schweppenhausen: "Baustellenschilder und
Mülltonnen dekorieren das brüchige Gemäuer der ehemaligen Synagoge von
Schweppenhausen in der Schwabenstraße. Nichts erinnert mehr daran, dass hier
einst jüdische Mitbürger ihre Gottesdienste abhielten. 1863 wurde die
Synagoge mit einem großen Fest eingeweiht. In einem Bericht der Zeitschrift
'Israelit hieß es: 'Die Straßen des Dorfes sowie die Synagoge wurden von
unseren christlichen Mitbürgern mit Blumen, Kränzen und Bäumchen
geschmückt.' In dem Gebäude war auch eine Wohnung für den Lehrer und
Vorbeter untergebracht. Nach 1933 verließen die meisten jüdischen Mitbürger
wegen der zunehmenden Repressalien das Dorf. Im Oktober 1938 musste das
Synagogengebäude für 2500 Reichsmark an einen Privatmann verkauft werden.
Noch in den 1990er Jahren wurden die Reste des Thoraschreins ausgebaut. Die
letzten vier verbliebenen jüdischen Einwohner (Elisabeth Eschenheimer, Henny
Schüller, Jakob Schüller und Emilie Schüller) wurden 1942 in den Osten
deportiert. Insgesamt verzeichnet Yad Vashem 17 Opfer des NS-Terrors auf
Schweppenhausen. Sie alle haben zu ihren Lebzeiten die Dorfsynagoge in der
Schwabenstraße besucht. Heute erinnert an dem maroden Gebäude nicht mehr
daran...". |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Dokumentation Jüdische Grabstätten im Kreis Bad
Kreuznach. Geschichte und Gestaltung. Reihe: Heimatkundliche Schriftenreihe
des Landkreises Bad Kreuznach Band 28. 1995. S. 379-390. |
 | Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt
des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies
ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. Mainz 2005. S. 341 (mit weiteren Literaturangaben).
|
n.e.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|