|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht "Synagogen im Lahn-Dill-Kreis"
Münchholzhausen (Stadt
Wetzlar, Lahn-Dill-Kreis)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Münchholzhausen bestand eine kleine jüdische
Gemeinde bis nach 1933. Erstmals werden Juden am Ort 1519 genannt. Auf das
17. Jahrhundert gehen die Flurnamen wie "Judenacker" und
"Judenberg" zurück.
Innerhalb der früheren Grafschaft Solms Braunfels bestand zunächst eine
Zuordnung der in Münchholzhausen lebenden Juden zeitweise zur Gemeinde in
Braunfels. Bei der Bildung von (insgesamt acht) Synagogenbezirken (mit zusammen
30 Versammlungsorten) im Kreis Wetzlar zum 1. August 1853 gehörten zum vierten
Bezirk "Münchholzhausen, Nauborn, Griedelbach, Kraftsolms,
Kröffelbach und Bonbaden". Alle acht Synagogenbezirke waren der
Synagogengemeinde Wetzlar zugeordnet.
Im 18. Jahrhundert lebten bis zu 60 jüdische Personen am Ort. So werden
in einer Liste von 1773, als der Ort an die Grafen Solms in Braunfels
zurückfiel, 12 jüdische Familien mit etwa 60 Personen genannt. Im 18.
Jahrhundert gab es eine jüdische Metzgerei am Ort; Abraham Meier war als Arzt
tätig.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1816 47 jüdische Einwohner, 1823 55, 1843 37, 1905 und 1914 10
beziehungsweise 9 jüdische Familien. Diese Familien waren 1914 nach ihren
Familienvätern: Händler Elias Bock (3 Jahre alt), Händler Karl Bock (33 Jahre
alt, Gießener Straße 65), Händler Julius Michel (32 Jahre alt), Händler Michel
Michel (57 Jahre alt), Händler Isaak Rosenbaum (59 Jahre alt), Maurer Gustav
Rosenthal (48 Jahre alt), Händler Isaak Rosenthal (36 Jahre alt), Händler Louis
Rosenthal (39 Jahre alt), Händler Siegmund Seligmann (36 Jahre alt).
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule,
ein rituelles Bad und ein Friedhof. Zur
Besorgung religiöser Aufgaben war vermutlich zeitweise ein Lehrer angestellt, der
zugleich als Vorsänger und Schochet tätig war. 1739 wird erstmals ein
Vorsänger namens Israel genannt, der sich von Jonas Weller ein Haus angemietet
hatte.
Im Ersten Weltkrieg wurde von den jüdischen Kriegsteilnehmern
Landsturmmann Levi Rosenthal mit dem Eisernen Kreuz II ausgezeichnet.
Anfang der 1930er-Jahre war die Gemeinde nicht mehr selbständig, sondern
der jüdischen Gemeinde in Wetzlar
angeschlossen.
In den Jahren nach 1933 sind die meisten der
jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,
der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Unter den Emigrierten war
auch Julius Rosenbaum, der 1938 mit seiner Familie nach Palästina (Israel)
emigrierte. Ende 1939 gab es noch 16 im Oktober 1940 12 jüdische Einwohner.
Von den in Münchholzhausen geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Auguste Grete Bock geb.
Baum (1875), Berta (Bertha) Bock geb. Wallenstein (1888), Elias Bock (1872), Flora Bock
(), Klara (Caroline) Kahn geb. Bock (1887), Johanna Mayer geb. Bock (1887), Egon Metzger
(), Johanna Metzger (1903), Lothar Metzger (1932), Siegmund Metzger (1905),
Julius Michel (1881), Kathinka Michel geb. Stern (1884), Rosa Oppenheim geb.
Rosenbaum (1881), Bertha Rosenthal geb. Seligmann (1869), Isidor Rosenthal (1898), Lina Rosenthal geb. Rosenthal (1885,
Stolperstein liegt in Mainzlar, Daubringer
Straße),
Louis Rosenthal (1875), Rosa Rosenthal (1870), Settchen Rosenthal (1872), Sofie
Rosenthal geb. Siegbert (1873), Thekla Rosenthal geb. Metzger (1908,
Stolperstein liegt in Mainzlar, Daubringer
Straße), Rosa
Schweitzer geb. Michel (1884, Stolperstein liegt für sie in Altenahr), Paula Seligmann geb. Michel (1892), Sara
Selma Seligmann geb. Weil (1885), Siegmund Meyer Seligmann (1877), Johanna
(Hanna) Strauß (1888),
Klara Wallenstein (1890).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und
Privatpersonen
Anzeige von M. Michel (1901)
Anmerkung: vermutlich eine Anzeige von Michel Michel, der 1931 seinen 75.
Geburtstag feiert (s.u.)
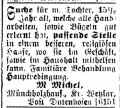 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. August 1901:
"Suche für meine Tochter, 15 1/2 Jahre alt, welche alle
Handarbeiten, sowie Bügeln gut erlernt hat, passende Stelle in
einem besseren, religiösen Hause, wo sie im Geschäft, sowie im Haushalt
mithelfen kann. Familiäre Behandlung Hauptbedingung. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. August 1901:
"Suche für meine Tochter, 15 1/2 Jahre alt, welche alle
Handarbeiten, sowie Bügeln gut erlernt hat, passende Stelle in
einem besseren, religiösen Hause, wo sie im Geschäft, sowie im Haushalt
mithelfen kann. Familiäre Behandlung Hauptbedingung.
M. Michel, Münchholzhausen, Kreis Wetzlar, Post Dutenhofen." |
Anzeigen von Rosa Rosenbaum und der
Frau Is. Rosenthal (1900 / 1928)
Anmerkung: bei der ersten Anzeige hat vermutlich Rosa Rosenbaum (geb. 1881
später verheiratete Oppenheim; nach der Deportation ermordet) für sich eine
Stelle gesucht.
 Anzeige
in "Der Israelit" vom 28. Februar 1900: "Ein 18-jähriges Mädchen sucht
Stellung als Volontärin bei freier Station. Anzeige
in "Der Israelit" vom 28. Februar 1900: "Ein 18-jähriges Mädchen sucht
Stellung als Volontärin bei freier Station.
Rosa Rosenbaum,
Münchholzhausen bei Wetzlar." |
| |
 Anzeige
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 21. August 1924:
"Suche für meine 18jährige Tochter zur weiteren Ausbildung Stelle in
besserem Hause bei Familienanschluss. Anzeige
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 21. August 1924:
"Suche für meine 18jährige Tochter zur weiteren Ausbildung Stelle in
besserem Hause bei Familienanschluss.
Frau Is. Rosenthal, Münchholzhausen bei Wetzlar".
|
Kleine Mitteilungen
Im "Israelitischen Familienblatt" vom 2. Dezember 1926 S. 6 wird die Verlobung
von Johanna Rosenthal aus Münchholzhausen mit Siegmund (Sieges)
Metzger aus Ketsch am Rhein mitgeteilt.
Im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. Februar 1927 S. 5 wird der Tod von
Bertha Rosenthal Witwe geb. Wetterhahn aus Münchholzhausen am 8. Februar
1927 mitgeteilt.
Im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. März 1927 S. 5 wird die Hochzeit von
Siegmund Metzger aus Ketsch am Rhein
mit Johanna Metzger geb. Rosenthal mitgeteilt.
Im "Israelitischen Familienblatt" vom 14. Juni 1928 wird die Verlobung von
Hedwig Rosenthal aus Münchholzhausen mit Emil Nachmann aus
Cramberg/Unterlahnkreis mitgeteilt.
Im "Israelitischen Familienblatt" vom 29. August 1929 wird die Verlobung von
Hedwig Rosenthal aus Münchholzhausen mit Egon Sommer aus
Crainfeld (Oberhessen) mitgeteilt.
Im "Israelitischen Familienblatt" vom 18. Dezember 1930 wird die Silberne
Hochzeit von Isaack Rosenthal und seiner Frau geb. Simon am 20.
Dezember 1930 mitgeteilt.
Im "Israelitischen Familienblatt" vom 2. Januar 1931 wird die Hochzeit von
Ida Bock aus Münchholzhausen mit Ludwig Koch aus
Mainz-Bretzenheim am 4. Januar 1931
mitgeteilt.
Im "Israelitischen Familienblatt" vom 19. Februar 1931 wird der 75. Geburtstag
von Michel Michel am 21. Februar 1931 mitgeteilt.
Im "Israelitischen Familienblatt" vom 11. Februar 1932 S. 6 wird die Geburt
eines Sohnes von Sieges Metzger und Johanna geb. Rosenthal in
Münchholzhausen mitgeteilt.
Im "Israelitischen Familienblatt" vom 29. November 1934 S. 16 wird der 80.
Geburtstag von Isaak Rosenbaum am 5. Dezember 1934 in Münchholzhausen
mitgeteilt.
Im "Israelitischen Familienblatt" vom 28. November 1935 wird der 60. Geburtstag
von Louis Rosenthal am 4. Dezember 1935 in Münchholzhausen mitgeteilt.
Im "Israelitischen Familienblatt" vom 24. Februar 1938 wird der 60. Geburtstag
von Isaak Rosenthal aus Münchholzhausen, jetzt Ramat Gan / Palästina
am 2. März 1938 mitgeteilt.
Im "Israelitischen Familienblatt" vom 9. Juni 1938 S. 18 wird mitgeteilt, dass
Julius Rosenbaum, der langjährige Vorbeter der Gemeinde Münchholzhausen,
mit seiner Familie emigriert.
Gedenkblätter in Yad Vashem, Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem / Israel
(Quelle: https://yvng.yadvashem.org/)
 |
 |
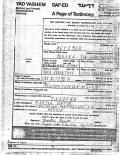 |
 |
 |
Bertha Bock
geb. Wallenstein (1888) |
Bertha
Rosenthal
geb. Seligmann (1869) |
Johanna
Metzger
(1903) |
Johanna
Strauss (1888)
|
| |
|
|
|
|
 |
 |
 |
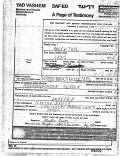 |
 |
Julius
Michel (1881)
|
Kathinka
Michel
geb. Stern (1884) |
Louis
Rosenthal
(1875) |
Paula
Seligmann
geb. Michel (1892) |
| |
|
|
|
|
 |
 |
 |
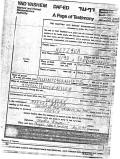 |
|
| Rosa
Schweitzer geb. Michel (1884) und Karl Schweizer |
Siegmund
Metzger (1903) |
|
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst gab es Beträume in privaten Wohnhäusern. Später war eine Synagoge war in einer alten Fachwerkscheune
eingerichtet. Die jüdische Gemeinde hatte dieses Gebäude 1887 erwerben
und in ihm eine Synagoge einrichten könnten. Kauf und Umbau kosteten die
Gemeinde 2.200 Mark. Nach Arnsberg II S. 370 war das Synagogengebäude 1938 noch erhalten.
Adresse/Standort der Synagoge: Kirchstraße
/ Gießener Straße
Fotos
Es sind noch keine
Fotos zur jüdischen Geschichte in Münchholzhausen vorhanden;
über
Hinweise oder Zusendungen freut sich der Webmaster der "Alemannia
Judaica";
Adresse siehe Eingangsseite. |
|
| |
|
|
Erinnerungsarbeit vor Ort - einzelne Berichte
|
Juni 2024:
Münchholzhäuser machen jüdische
Geschichte des Ortes sichtbar |
Artikel von Sebvastian Reh in
mittelhessen.de vom "Münchholzhäuser machen jüdische Geschichte des Orts
sichtbar.
Der jüdische Friedhof in Münchholzhausen ist versteckt. Grabsteine sind mit
Moos bewachsen und Inschriften verschmutzt. Konfirmanden haben sie
gereinigt. Doch es geht um viel mehr.
Wetzlar-Münchholzhausen. 1250 Jahre schreibt die Geschichte
Münchholzhausens. Mindestens. Und viele Jahrhunderte waren Juden ein fester
Bestandteil dieser Geschichte. Heute allerdings … Es gibt nicht mehr viel,
was auf sie hindeutet. Und das Verbliebene drängt sich nicht gerade auf. In
der Straße Herrenwiese hinter einer hohen Hecke liegt er etwas versteckt,
der jüdische Friedhof. Nur eine kleine Messingtafel an dem Tor weist auf ihn
hin. Die Grabsteine sind mit Moos bewachsen, die Inschriften verschmutzt.
Einige Münchholzhäuser haben sich daran gemacht, das zu ändern, sie zu
säubern, die Erinnerung an die Münchholzhäuser Juden wachzuhalten – gerade,
diese Formulierung fällt auf dem Friedhof immer wieder, in diesen Zeiten.
'Das hier ist ein besonderer Ort, aber auch einer, der normal ist. Man
sollte keine Scheu haben, ihn zu besuchen', sagt Thorsten Rohde. Der
Münchholzhäuser hat die Aktion angestoßen.
Das Ziel: Jugendliche an die Geschichte heranführen. Vor ein paar
Jahren hatte er in Weilburg eine ähnliche Initiative gestartet, zusammen mit
dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen und der Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Limburg. Damals hatten Schüler die
Grabsteine gereinigt. Rohde sieht das als Möglichkeit, Jugendliche an die
christlich-jüdisch-deutsche Geschichte heranzuführen, als Form von
Extremismus-Prävention. Dieses Mal sind es Konfirmanden der Evangelischen
Kirchengemeinde Dutenhofen/Münchholzhausen, die an die Geschichte
herangeführt werden sollen. Die Jungen tragen Kippot, die Mädchen
Kopftücher. Das gehört sich so auf einem jüdischen Friedhof.
'Ich find’s klasse, dass wir heute hier stehen', sagt ihr Pfarrer, Michael
Philipp. Es sei wichtig, den Konfirmanden klarzumachen: 'Jawohl, die Juden
gehören zu uns.' Gerade in Zeiten eines erstarkenden Antisemitismus. Mit
Schwämmen, Bürsten und Wassereimern machen sich die Konfirmanden ans Werk.
Sie schrubben das Moos von den Steinen, waschen Ablagerungen aus den
Inschriften. Es hat vor allem einen symbolischen Charakter, macht Daniel
Neumann klar.
Lob vom Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinden in Hessen. Er ist
Vorsitzender des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden in Hessen. 'Diese
Säuberung ist ehrenhaft, ich bin dankbar', sagt er. Er erklärt den
Konfirmanden, was das Judentum unter einer Beerdigungsgesellschaft versteht.
Das sind meist Angehörige eines Toten, die ihn für die Beerdigung
zurechtmachen. Diese Jungen und Mädchen machten etwas Ähnliches. 'Es ist
eine Aufgabe, die man am Toten vollzieht, der nicht mal Danke sagen kann.
Man macht es einfach nur, weil man es möchte', sagt Neumann. 'Ihr helft
dabei, die Namen dieser Menschen zu ehren, diesem Ort etwas mehr Würde zu
geben.' Die, die normalerweise diese Aufgabe übernehmen, seien nicht mehr da
– oder zumindest nicht mehr in Deutschland. Die Gräber stammen aus der Zeit
vor dem Zweiten Weltkrieg, vor der Nazi-Diktatur. 'Die Menschen, die hier
liegen, haben keine Verwandten mehr, weil sie geflohen sind oder ermordet
wurden.'
Das jüdische Müchholzhausen lebt an einem anderen Ort weiter.
'Jüdisches Leben war über Jahrhunderte ein Teil von Münchholzhausen', sagt
Ortsvorsteher Jörg Schneider (CDU). So schrieb Klaus Grumbach in dem Heft
'Münchholzhäuser Juden', dass 1836 rund zehn Prozent der Einwohner des
Wetzlarer Stadtteils jüdischen Glaubens waren. Sie führten kleine Läden,
handelten mit Stoffen. Die Synagoge beziehungsweise das Gebetshaus befand
sich in einer alten Scheune in der heutigen Kirchstraße. Ihr Wirken gelte es
zu würdigen, sagt Schneider. Und wieder: 'In diesen Zeiten ist es besonders
wichtig.' Während der Nazi-Diktatur wurde das Gebetshaus zerstört. Der
Friedhof steht noch. Er ist aber nicht das einzige Zeichen jüdischen Lebens
in Münchholzhausen, das die Shoah überlebt hat, weiß Dirk Weber. Er kümmert
sich zusammen mit Stephan Köhler und Bruno Übelacker in der Münchholzhäuser
Dorfstube darum, die Geschichte des Stadtteils zu bewahren. Weber berichtet
von Isaak Rosenthal, einem ehemaligen Münchholzhäuser Juden, der 1937 mit
seiner Familie nach Palästina geflohen war. Webers Großvater kannte
Rosenthal. Der Kontakt zwischen den Familien brach nie ab. Vor vier Jahren
hatte Rosenthals Enkelin, die in Tel Aviv lebt, Weber dann Fotos einer
Bar-Mizwa, eines religiösen Festes, geschickt. Auf ihnen war auch eine
Tora-Rolle zu sehen. Es stellte sich heraus, dass Rosenthal die Tora aus
Münchholzhausen nach Palästina mitgenommen hatte. Weber sagt: 'Ob Menschen
oder Gebäude, die Nazis haben fast alles vernichtet. Es ist schön, dass das
noch erhalten ist.' Das jüdische Münchholzhausen lebt an einem anderen Ort
weiter."
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 88-90 (einige Angaben innerhalb
des Abschnittes zu Braunfels) und Bd. II S. 365-380 (innerhalb des
Abschnittes zu Wetzlar). |
 | Keine Abschnitte - mit dem Hinweis "1938
zerstört" bei Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 und dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994 sowie Neubearbeitung der Bänden
2007². |
 | Keine näheren Angaben zu Münchholzhausen in: Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel. 1995 (Abschnitt
zu Wetzlar). |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 480 (wenig innerhalb des Abschnittes zu
Wetzlar). |
 | Wolfgang Wiedl: Jüdisches Leben in
Münchholzhausen. Hrsg. vom Wetzlarer
Geschichtsverein e.V. In: Mitteilungen des Wetzlarer
Geschichtsvereins 45. 2011. S. 155-326. |
 |
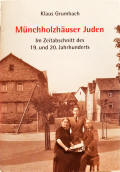 Klaus
Grumbach: Münchholzhäuser Juden. Im Zeitabschnitt des 19. und 20.
Jahrhunderts. 23 S. ca. 2005. Klaus
Grumbach: Münchholzhäuser Juden. Im Zeitabschnitt des 19. und 20.
Jahrhunderts. 23 S. ca. 2005. |
n.e.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|