|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"
zurück zu den Synagogen im Stadtkreis
Koblenz
Koblenz (Rheinland-Pfalz)
Jüdische Geschichte / die Synagogen
(die Seite wurde erstellt unter Mitarbeit von Helene
Thill,
Koblenz)
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
 In Koblenz bestand eine bedeutende jüdische
Gemeinde bereits im Mittelalter. Als wichtiger Durchgangsort und
Mittelpunkt für Handel und Markt bot es bereits früh günstige Voraussetzungen
für die Ansiedlung jüdischer Handelsleute. Erstmals werden Juden in der Stadt
in einer Zollordnung von 1104 genannt. Der älteste Nachweis auf einen
jüdischen Einwohner ist ein Grabstein aus dem Jahr 1149. Die älteste jüdische
Ansiedlung befand sich neben der ältesten Altstadt im Florinsstift, dem
hauptsächlichen Markt und Verkehrsplatz (spätere Münzstraße, siehe Foto
links, zwischen der
erzbischöflichen Burg und dem Stift St. Florin). Das erste Haus, das
nachweislich in jüdischem Besitz war, wurde von Jud Süskind 1238 an den
Erzbischof von Trier verkauft und befand sich in diesem Bereich. Eine Judengasse
wird seit 1276 genannt. Am Ende der Gasse war ein Tor in der Stadtmauer, das Judentor
(1282 genannt). In Koblenz bestand eine bedeutende jüdische
Gemeinde bereits im Mittelalter. Als wichtiger Durchgangsort und
Mittelpunkt für Handel und Markt bot es bereits früh günstige Voraussetzungen
für die Ansiedlung jüdischer Handelsleute. Erstmals werden Juden in der Stadt
in einer Zollordnung von 1104 genannt. Der älteste Nachweis auf einen
jüdischen Einwohner ist ein Grabstein aus dem Jahr 1149. Die älteste jüdische
Ansiedlung befand sich neben der ältesten Altstadt im Florinsstift, dem
hauptsächlichen Markt und Verkehrsplatz (spätere Münzstraße, siehe Foto
links, zwischen der
erzbischöflichen Burg und dem Stift St. Florin). Das erste Haus, das
nachweislich in jüdischem Besitz war, wurde von Jud Süskind 1238 an den
Erzbischof von Trier verkauft und befand sich in diesem Bereich. Eine Judengasse
wird seit 1276 genannt. Am Ende der Gasse war ein Tor in der Stadtmauer, das Judentor
(1282 genannt).
Die jüdischen Familien bildeten eine Gemeinde mit einem Rat an
ihrer Spitze (1307: magistratus et universitas Judeorium in Confluentia). Die
jüdische Gemeinde hatte eigene Einrichtungen wie Synagoge, Friedhof oder ein
Spital. Im 12. Jahrhundert waren Juden (wie auch Christen) u.a. als
Sklavenhändler tätig. Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts spielten sie eine
wichtige Rolle im Geldhandel. Selbst der Erzbischof von Köln wird 1339 als
Schuldner von zwei Juden in Koblenz genannt. Es bestand ein reges jüdisches
Geistesleben: mehrere jüdische Gelehrte, auch rabbinische Autoritäten
hielten sich in der Stadt auf oder hatten sich hier niedergelassen (darunter R.Chajjim
ben Jechiel, ein Gefährte von R. Meir von Rothenburg und sein Bruder Ascher ben
Jechiel. 1344 schrieb Elieser ben Samuel ha-Lewi ein prächtiges Bibelmanuskript,
das einen Pentateuchkommentar enthält und heute in der Sächsischen
Landesbibliothek Dresden aufgewahrt wird. Die
jüdische Gemeinde war im Mittelalter von zahlreichen Verfolgungen
betroffen. Am 2. April 1265 wurden 20 Juden, darunter auch Kinder
ermordet. 1281, 1287/88 (Werner-Pogrom) kam es zu Verfolgungen. Bei der
sogenannten Armleder-Verfolgung rief Ritter Wilhelm von Liebenstein die Stadt
Koblenz auf, wie Bacharach, Lorch, Kaub, Oberwesel und Boppard die Juden zu
erschlagen; die Koblenzer Bürger kamen der Aufforderung nach. Die grausame
Verfolgung während der Pestzeit 1348/49 vernichtete die Gemeinde.
1351 wurde wieder eine jüdische Familie in der Stadt aufgenommen. In den
folgenden Jahren zogen weitere jüdische Personen/Familien zu. Es entstand eine,
im Vergleich zur Zeit vor den Verfolgungen kleinere jüdische Gemeinde. Doch kam
es bereits 1355 wieder zu einer neuen Verfolgung. Juden lebten in der Folgezeit
fast ausschließlich von Geldgeschäften gegen Schuldsein oder Pfand oder von
Geschäften mit Liegenschaften. Die jüdischen Häuser standen wie in der Zeit
vor den Verfolgungen der Pestzeit in der "Judengasse" (heutige
Münzstraße). 1351-1418 gab es in der Judengasse 13 von Juden bewohnte Häuser.
1418 wurden infolge der Judenausweisung aus dem Erzstift Trier, alle
Juden aus Koblenz vertrieben. 100 Jahre lang hatte die Stadt dann keine Juden,
bis 1518 der Trierer Erzbischof Richard von Greifenklau fünf jüdische
Familien in der Stadt für 20 Jahre aufnahm. Nach dem Tod Richard von
Greifenklaus 1531 kam es zu Ausschreitungen gegen die Juden, ihre Häuser wurden
geplündert, Friedhof und Synagoge zerstört.
Vom 16.-18. Jahrhundert
lebten Juden mit längeren oder kürzeren Unterbrechungen in der Stadt. Eine
kleine jüdische Gemeinde begann sich zu entwickeln, in der wie im Mittelalter
einige bedeutende Gelehrte wirkten. Darunter ist Jair Chajim Bacharach
(1639-1702) zu nennen, der von 1666-69 Rabbiner in Koblenz war und danach als
Talmudlehrer in Worms wirkte. 1735 lebten 31 jüdische Familien in der Stadt.
Während der Zeit der französischen Besatzung erhielten die Juden die
Gleichberechtigung. 1794, als 33 jüdische Familien in der Stadt lebten, wurde
das Judentor zum Ghetto eingerissen.
1807 wurden 41 jüdische Familien mit 188
Personen gezählt. Die Zahl nahm im Laufe der 19. Jahrhunderts weiter zu
(1858 415, 1895 576 Personen). Die wirtschaftlichen Verhältnisse der jüdischen
Familien verbesserten sich im Laufe dieses Jahrhunderts. Die jüdischen Handels-
und Gewerbebetriebe in der Stadt hatten eine zunehmende wirtschaftliche
Bedeutung. Es entstand eine wohlhabende jüdische Mittelschicht, bestehend aus
Ärzten, Rechtsanwälten, Kaufleuten u.a. Das 19. Jahrhundert war trotz der sich
verbessernden Lebensbedingungen der jüdischen Einwohner von einem immer
wiederkehrenden Antisemitismus geprägt. Die Auswirkungen des Hep-Hep-Aufstandes
1819, der Revolution von 1848 und des Antisemitismus seit dem letzten Drittel
des 19. Jahrhunderts zeigten sich in Koblenz sehr deutlich.
Koblenz war für die
jüdischen Gemeinden der weiteren Umgebung ein religiöses Zentrum, vor allem
durch das hier beheimatete Bezirksrabbinat (nach dem Bericht über die
Gemeindeverhältnisse von 1849 s.u. wurde es 1849 gegründet; Rabbiner: Dr. Ben Israel
(1843/49-1877), Dr. Adolf Lewin (1878-1885), Dr. Moritz Singer (seit 1886, gest.
1900). Nach 1900 wurde das Bezirksrabbinat zunächst nicht wieder besetzt. Erst
1935 erfolgte eine Wiederrichtung des Bezirksrabbinates Koblenz für einige Jahre
(Rabbiner Dr. Max Vogelstein).
Um 1925, als etwa 800 Personen zur jüdischen Gemeinde gehörten (etwa
1,4 % der Gesamteinwohnerschaft von 60.000 Personen) waren die Vorsteher der
jüdischen Gemeinde Moritz Moser, Jacob Meyer, N. Morgenthau, Willi
Mayer-Alberti, Arthur Günther. Der Repräsentanz gehörten an: Alfred Schloss,
L. Jordan, Leopold Hirsch, Dr. Treidel, S. Siegler, Julius Adler, Siegfried
Cohn, Simon Daniel, Hermann Haimann, Josef Schneider, Max Mayer. Als Prediger
und Lehrer wirkte Benno Huhn (vgl. Bericht unten zu seinem
25-jährigen Amtsjubiläum 1926). David Cohn war Synagogendiener. Die jüdische
Religionsschule besuchten 48 Kinder. An den höheren Schulen erhielten 62 Kinder
jüdischen Religionsunterricht. An jüdischen Vereinen und
Wohltätigkeitseinrichtungen bestanden u.a.: ein Israelitischer Frauen-Verein
(gegründet ca. 1827), eine örtliche Zentrale für jüdische Wohlfahrtspflege,
gegr. 1924), die Israelitische Witwen- und Waisenkasse (gegründet ca. 1830),
der Männerkrankenverein (gegründet ca. 1827), die Durchwandererfürsorgestelle,
die Eintracht-Loge U.O.B.B., die Schwesternvereinigung der Eintracht-Loge
(gegründet 1902), eine Ortsgruppe des Central-Vereins, ein jüdischer
Jugendverein, eine Junggruppe im jüdischen Jugendheim und der Reichsbund
jüdischer Frontsoldaten. Zur jüdischen Gemeinde in Koblenz gehörten auch die
in Metternich, Ehrenbreitstein, Pfaffendorf, Güls und Horchheim lebenden
jüdischen Personen.
Im Juni 1933 wurden 669 jüdische
Einwohner in der Stadt gezählt. Schnell machten sich die Auswirkungen des
wirtschaftlichen Boykotts und der zunehmenden Entrechtung bemerkbar. Immer mehr
jüdische Gewerbetreibende waren gezwungen, ihr Geschäft zu verkaufen oder
aufzugeben. Die Auswanderung nahm zu. Dennoch gab es noch ein reges kulturelles
jüdisches Leben. Beim Novemberpogrom 1938 wurde nicht nur die Synagoge
verwüstet, sondern auch 40 jüdische Häuser und 19 jüdische Läden. Etwa 100
jüdische Männer kamen in das Konzentrationslager nach Dachau, wo zwei von
ihnen verstarben. Im Mai 1939 gab es noch 308 jüdische Personen in der
Stadt, viele waren von umliegenden Dörfern zugezogen. 1942 begannen die
Deportationen der jüdischen Einwohner: Mit dem ersten Transport am 22. März
wurden 120 Juden in die Vernichtungslager des Ostens verbracht. Weitere
Transporte folgen zwischen Juni 1942 und Juli 1943.
1945 und danach kehrten nur wenige
Überlebende der früheren Gemeinde zurück. Doch konnte mit einigen anderen
zugezogenen jüdischen Personen eine - zunächst kleine - jüdische Gemeinde wieder
begründet werden. 1987 gehörten ihr etwa 100 Personen an. Durch
die Zuwanderung jüdischer Personen aus den GUS-Staaten nahm in den
1990er-Jahren die Zahl der Gemeindeglieder zu.
2011/20 zählte die Gemeinde
knapp 1000 Mitglieder. Die jüdische Kultusgemeinde Koblenz ist zuständig
für die in der Stadt Koblenz, im Landkreis Mayen-Koblenz sowie die Kreise
Ahrweiler, Mayen, Cochem, Zell, St. Goar, St. Goarshausen, Simmern, Unterlahn,
Unter- und Oberwesterwald lebenden jüdischen Personen. Die Gemeinde betreut die
in diesem Bereich liegenden etwa 100 jüdischen Friedhöfe. Für die
Gemeindemitglieder wird ein umfangreiches Programm geboten (neben
Veranstaltungen und Gottesdiensten in der Synagoge weitere
Begegnungsveranstaltungen, Seniorennachmittage, Deutschunterricht, allgemeine
kulturelle Veranstaltungen u.a.m.). Der Bau einer neuen Synagoge ist geplant
(siehe unten).
Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte des Rabbinates
Über den Rabbinats-Kandidaten Dr. Ben Israel
(1843)
Anmerkung: Rabbiner Dr. Ben Israel ist als Benjamin Israel
1819 in Dierdorf geboren und am 6. November
1876 in Koblenz gestorben. Er studierte 1840 bis 1842 in Bonn und wurde 1843
zunächst Prediger und Religionslehrer in Koblenz, ab 1849 Rabbiner der damals
400 Mitglieder zählenden jüdischen Gemeinde (siehe unten Bericht von 1849 über
Reformen in Gottesdienst und Gemeinde). Er gehörte zu den Reform-Rabbinern und
nahm u.a. an der Kasseler Rabbiner-Versammlung 1868 teil. Quelle: Biographisches
Handbuch der Rabbiner München 2004. Bd. I,471.472.
Rabbiner Dr. Ben Israel hatte zwei Söhne: Victor Ben Israel (geb. 1857 in
Koblenz) und Sanitätsrat Dr. Leopold Ben Israel (geb. 1863 in Koblenz,
gest. 1930 in Aachen; Grab im alten jüdischen Friedhof Aachen
https://de.billiongraves.com/grave/Leopold-Ben-Israel/11148490).
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Dezember 1843:
"Koblenz, im November (1843). Die hiesige Gemeinde hat an dem
Rabbinats-Kandidaten Herrn Dr. Ben Israel einen sehr tüchtigen Prediger
und Religionslehrer gewonnen, der durch seine Vorträge eine bedeutsame
Wirkung übet." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Dezember 1843:
"Koblenz, im November (1843). Die hiesige Gemeinde hat an dem
Rabbinats-Kandidaten Herrn Dr. Ben Israel einen sehr tüchtigen Prediger
und Religionslehrer gewonnen, der durch seine Vorträge eine bedeutsame
Wirkung übet." |
Publikation von Rabbiner Ben Israel (1873)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. September
1873: Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. September
1873:
"Durch die H. Hölscher'sche Buchhandlung in Koblenz zu
beziehen:
Seder Tefilla. Gebetbuch für Synagoge und Haus.
Neu geordnet und übersetzt von Ben Israel, Rabbiner der
Synagogengemeinde Koblenz.
Zwei Teile. 50 Bogen 2 Thl. 10 Sgr.
Dieses Gebetbuch, welches durch seine originelle Anlage, einerseits das
Aufsuchen einzelner Gebetstücke beseitigt, und andererseits den
Anhängern der nicht zu den Extremen gehörenden verschiedenen
Glaubensrichtungen die Möglichkeit bietet, nach ihrer religiösen
Überzeugung zu beten, sucht namentlich dem in fortgeschrittenen Gemeinden
am Neujahr und Versöhnungstag tiefempfundenen Mangel einer würdigen,
anregenden, dem Kultus an den übrigen Festtagen entsprechenden
Gottesdienstfeier abzuhelfen." |
Ausschreibungen der Rabbiner- und Predigerstelle nach dem Tod
von Dr. Ben Israel (1877) sowohl in der liberalen "Allgemeinen Zeitung des
Judentums" wie auch in der orthodoxen Zeitschrift "Der Israelit"
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Juni 1877:
"Bekanntmachung. Die durch das Ableben des seligen Herrn Ben
Israel erledigte Rabbiner- und Prediger-Stelle hiesiger
Synagogengemeinde soll im Laufe dieses Jahres wieder besetzt werden; mit
dieser Stelle ist außer großer, schöner Wohnung und erheblichen
Nebenverdiensten ein fixer Gehalt von 2.400 Mark verbunden; qualifizierte
Bewerber wollen sich unter Einsendung ihrer Zeugnisse baldigst bei dem
Unterzeichneten melden. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Juni 1877:
"Bekanntmachung. Die durch das Ableben des seligen Herrn Ben
Israel erledigte Rabbiner- und Prediger-Stelle hiesiger
Synagogengemeinde soll im Laufe dieses Jahres wieder besetzt werden; mit
dieser Stelle ist außer großer, schöner Wohnung und erheblichen
Nebenverdiensten ein fixer Gehalt von 2.400 Mark verbunden; qualifizierte
Bewerber wollen sich unter Einsendung ihrer Zeugnisse baldigst bei dem
Unterzeichneten melden.
Koblenz, den 29. Mai 1877. Der Vorstand: Max Salomon." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juni 1877: Text wie
oben. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juni 1877: Text wie
oben. |
Wahl von Rabbiner Dr. Adolf Lewin 1878
(Rabbiner in Koblenz bis 1885)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16. April 1878:
"Bonn, 7. April (1878 - Notizen). Wir erhalten vom Vorstande der
Synagogengemeinde zu Koblenz folgende Berichtigung: 'Entgegen der
in Nr. 12 Ihres geschätzten Blattes veröffentlichten Mitteilung aus
Koblenz, wonach die Rabbinerwahl noch nicht vollzogen und Herr Dr. Lewin
aus Koschmin noch nicht gewählte sei, bitten wir Sie an gleicher Stelle
jene Mitteilung zu widerrufen und zwar mit dem ausdrücklichen
Hinzufügen, dass die am 23. Januar dieses Jahres von dem
Repräsentantenkollegium vollzogene Wahl des Herrn Dr. Adolf Lewin in
Koschmin zum Rabbiner hiesiger Synagogengemeinde, am 8. März dieses
Jahres die Zustimmung des Vorstandes und am 29. März dieses Jahres die
Genehmigung der Königlichen Regierung erhalten hat." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16. April 1878:
"Bonn, 7. April (1878 - Notizen). Wir erhalten vom Vorstande der
Synagogengemeinde zu Koblenz folgende Berichtigung: 'Entgegen der
in Nr. 12 Ihres geschätzten Blattes veröffentlichten Mitteilung aus
Koblenz, wonach die Rabbinerwahl noch nicht vollzogen und Herr Dr. Lewin
aus Koschmin noch nicht gewählte sei, bitten wir Sie an gleicher Stelle
jene Mitteilung zu widerrufen und zwar mit dem ausdrücklichen
Hinzufügen, dass die am 23. Januar dieses Jahres von dem
Repräsentantenkollegium vollzogene Wahl des Herrn Dr. Adolf Lewin in
Koschmin zum Rabbiner hiesiger Synagogengemeinde, am 8. März dieses
Jahres die Zustimmung des Vorstandes und am 29. März dieses Jahres die
Genehmigung der Königlichen Regierung erhalten hat." |
Biographie von Rabbiner Dr. Adolf Lewin
 Artikel
in der Zeitschrift "Ost und West", Ausgabe Mai 1910 aus Anlass
des Todes von Dr. Lewin: "Am 24. Februar dieses Jahres im 25. Jahre
seiner segensreichen Tätigkeit in Freiburg im Breisgau
ist Rabbiner Dr.
Adolf Lewin gestorben. Am 23. September 1843 in Pinne geboren, besuchte er
zuerst das Gymnasium im nahen Posten, dann das Katholische Gymnasium in
Breslau, wo er nach bestandenem Abiturienten-Examen die Universität
bezog. Im jüdisch-theologischen Seminar in Breslau, das er schon als
Primaner besucht hatte, saß er zu Füßen Frankl's, nach dem er aus
Dankbarkeit seinen ersten Sohn 'Gottfried' nannte. Durch Erteilung von
Unterricht verdiente er sich während seines Studiums nicht nur seinen Lebensunterhalt,
sondern machte noch Ersparnisse, die er als Beitrag zur Erziehung der
jüngeren Geschwister verwendete. Nach bestandenem Rabbinatsexamen
gehörte seine erste Tätigkeit dem Vaterland. Als Feldseelsorger
bewährte er sich auf den Schlachtfeldern im Krieg 1870/71. Nach dem
Friedensschluss war er kurze Zeit Adjunkt des Landrabbiners von Emden,
dann von 1872 bis 1878 Rabbiner in Koschmin, bis 1885 in Koblenz
und von da an bis zu seinem Tode Bezirksrabbiner von Freiburg und Sulzburg. Seit dem Jahr 1899 behörte er als Konferenz-Rabbiner dem
Großherzoglichen Oberrat der Israeliten an." Artikel
in der Zeitschrift "Ost und West", Ausgabe Mai 1910 aus Anlass
des Todes von Dr. Lewin: "Am 24. Februar dieses Jahres im 25. Jahre
seiner segensreichen Tätigkeit in Freiburg im Breisgau
ist Rabbiner Dr.
Adolf Lewin gestorben. Am 23. September 1843 in Pinne geboren, besuchte er
zuerst das Gymnasium im nahen Posten, dann das Katholische Gymnasium in
Breslau, wo er nach bestandenem Abiturienten-Examen die Universität
bezog. Im jüdisch-theologischen Seminar in Breslau, das er schon als
Primaner besucht hatte, saß er zu Füßen Frankl's, nach dem er aus
Dankbarkeit seinen ersten Sohn 'Gottfried' nannte. Durch Erteilung von
Unterricht verdiente er sich während seines Studiums nicht nur seinen Lebensunterhalt,
sondern machte noch Ersparnisse, die er als Beitrag zur Erziehung der
jüngeren Geschwister verwendete. Nach bestandenem Rabbinatsexamen
gehörte seine erste Tätigkeit dem Vaterland. Als Feldseelsorger
bewährte er sich auf den Schlachtfeldern im Krieg 1870/71. Nach dem
Friedensschluss war er kurze Zeit Adjunkt des Landrabbiners von Emden,
dann von 1872 bis 1878 Rabbiner in Koschmin, bis 1885 in Koblenz
und von da an bis zu seinem Tode Bezirksrabbiner von Freiburg und Sulzburg. Seit dem Jahr 1899 behörte er als Konferenz-Rabbiner dem
Großherzoglichen Oberrat der Israeliten an." |
Ausschreibung der Rabbiner-Stelle (1885)
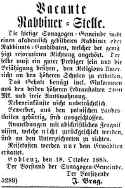 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Oktober 1885:
"Vakante Rabbiner-Stelle. Die hiesige Synagogen-Gemeinde sucht einen
akademisch gebildeten Rabbiner oder Rabbinatskandidaten, welcher der
gemäßigt reformierten Richtung angehört. Derselbe muss ein guter
Prediger sein und die Befähigung besitzen, den Religionsunterricht an den
höheren Schulen zu erteilen. Das Gehalt beträgt inklusive Einkommen aus
den beiden höheren Lehranstalten 2400 Mark und freie Amtswohnung. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Oktober 1885:
"Vakante Rabbiner-Stelle. Die hiesige Synagogen-Gemeinde sucht einen
akademisch gebildeten Rabbiner oder Rabbinatskandidaten, welcher der
gemäßigt reformierten Richtung angehört. Derselbe muss ein guter
Prediger sein und die Befähigung besitzen, den Religionsunterricht an den
höheren Schulen zu erteilen. Das Gehalt beträgt inklusive Einkommen aus
den beiden höheren Lehranstalten 2400 Mark und freie Amtswohnung.
Nebeneinkünfte nicht unbeträchtlich. Bewerber, aus den polnischen
Landesteilen gebürtig, sind ausgeschlossen.
Anmeldungen mit abschriftlichen Zeugnissen, welche nicht zurückgeschickt
werden, sind an den Unterzeichneten zu richten.
Reisekosten werden nur dem Erwählten erstattet.
Koblenz, den 18. Oktober 1885. Der Vorstand der Synagogengemeinde. Der
Vorsitzende J. Brag." |
| |
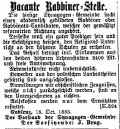 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 27. Oktober 1885: Dieselbe Anzeige wie in der
konservativ-orthodoxen Zeitschrift "Der Israelit" (oben)
erschien in der liberalen "Allgemeinen Zeitung des
Judentums". Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 27. Oktober 1885: Dieselbe Anzeige wie in der
konservativ-orthodoxen Zeitschrift "Der Israelit" (oben)
erschien in der liberalen "Allgemeinen Zeitung des
Judentums". |
Zum Tod von Rabbiner Dr. Singer (1900)
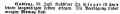 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Juli 1900: "Koblenz,
29. Juli (1900). Rabbiner Dr. Singer ist heute seinen langwierigen Leiden
erlegen. Die Beerdigung findet morgen Montag statt." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Juli 1900: "Koblenz,
29. Juli (1900). Rabbiner Dr. Singer ist heute seinen langwierigen Leiden
erlegen. Die Beerdigung findet morgen Montag statt." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. August 1900: "Koblenz,
30. Juli (1900). Rascher wie es jemand geahnt, hat der höchste aller
Richter, der über Leben und Tod der Menschheit entscheidet, sein
unerbittliches Urteil gefällt und dem Leben eines hart geprüften Mannes
ein Ziel gesetzt. Im Königswerther Hospital in Frankfurt erlöste
Freitagnacht um 11 Uhr ein sanfter Tod unsern Rabbiner Dr. Moritz Singer
von seinem langen Leiden.
N Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. August 1900: "Koblenz,
30. Juli (1900). Rascher wie es jemand geahnt, hat der höchste aller
Richter, der über Leben und Tod der Menschheit entscheidet, sein
unerbittliches Urteil gefällt und dem Leben eines hart geprüften Mannes
ein Ziel gesetzt. Im Königswerther Hospital in Frankfurt erlöste
Freitagnacht um 11 Uhr ein sanfter Tod unsern Rabbiner Dr. Moritz Singer
von seinem langen Leiden.
N
un ruht der Kampf und entsetzt steht man an der Bahre dieses Dulders, den
ein herbes Geschick im Verein mit Unversöhnlichkeit, Misshelligkeiten und
Missverständnissen so früh im besten Mannesalter dahingestreckt. Und
angesichts dieses göttlichen Eingreifens ziehen Friede und Versöhnung
ein und wessen Herz noch einen Funken Mitleid und Mitgefühl aufzuweisen
hat, ist bestrebt, den Bemitleidenswerten, die der grausame Tod eines
Gatten und Vaters beraubte, zu helfen, sie zu trösten und ihre Zukunft zu
einer lichten, sorgenlosen zu gestalten. Das ist die Perspektive, die sich
der hiesigen Gemeinde eröffnet, das ist die Aufgabe der Verwaltung, der
sie sich – die Anzeichen sind schon vorhanden – auch nicht entziehen
wird. Er der Verklärte, ist mit Worten der Versöhnung auf den Lippen zu
seinem Richter eingegangen, seine Familie seiner Gemeinde anvertrauend und
ihrem Schutze empfehlend. Herrliche Worte des Trostes und der Versöhnung
sprach Herr Dr. Auerbach am Sarge des verstorbenen Kollegen. Möge die
Ergriffenheit und Rührung, die Aller Herzen dabei beschlich, auch bei der
Beratung über die Schritte zu Gunsten der verwaisten Familie bestimmend
sein; vielleicht dämmert einmal wieder die Morgenröte des Friedens in
der hiesigen Gemeinde auf, zum Segen ihrer selbst und der ganzen jüdischen
Welt. Hugo Nahm." |
Jahrgedächtnisfeier für Rabbiner Dr. Moritz Singer (1901)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. August 1901:
"Koblenz, 29. Juli (1901). Am 22. dieses Monats fand hier auf
dem israelitischen Friedhofe zum Jahresgedächtnis eine Trauerfeier für
unseren in der Blüte der Jahre hingerafften Rabbiner Dr. Singer statt. -
Herr Rabbiner Dr. Plaut in Frankfurt am Main, der sich diese Feierlichkeit
zu Ehren eines heimgegangenen Kollegen sehr angelegen sein ließ, hatte
auch die Güte, die unter den obwaltenden Umständen gewiss nicht leichte
Gedächtnisrede zu übernehmen. Dass er sich der übernommenen Aufgabe in
meisterhafter Weise entledigte. braucht bei diesem Redner nicht erst
gesagt zu werden. Er knüpfte an an den Vers in den Klageliedern:
'Gefallen ist die Krone von unserem Haupte!', mit welchem er dem Verlust
im Namen der Gemeinde und der Familie ergreifenden Ausdruck gab. Aber wie
auch für den zerstörten Tempel der große R. Jochanan ben Saccai einen
Ersatz erblickte in dem 'Alter der Liebe', so sei es auch hier die Liebe,
deren Opfer und Hingebung mit diesem von der Zeit zu früh verlangten
Opfer auszusöhnen die Macht haben. - Nicht nur der Vorstand unserer
Gemeinde und viele Freunde des Heimgegangenen waren anwesend, sondern auch
aus der Ferne sahen wir Freunde der so schwer geprüften Familie,
namentlich hatte es sich der hochherzige Gönner der verwaisten Kinder,
Herr Hugo Schlesinger aus Frankfurt am Main nicht nehmen lassen, an dieser
Trauerfeierlichkeit teilzunehmen. Sowohl der Gemeindevorstand wie alle
Anwesenden dankten es dem Herrn Dr. Plaut, dass er dem wahrhaft traurigen
Jahre einen so würdigen, versöhnenden Abschluss gegeben." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. August 1901:
"Koblenz, 29. Juli (1901). Am 22. dieses Monats fand hier auf
dem israelitischen Friedhofe zum Jahresgedächtnis eine Trauerfeier für
unseren in der Blüte der Jahre hingerafften Rabbiner Dr. Singer statt. -
Herr Rabbiner Dr. Plaut in Frankfurt am Main, der sich diese Feierlichkeit
zu Ehren eines heimgegangenen Kollegen sehr angelegen sein ließ, hatte
auch die Güte, die unter den obwaltenden Umständen gewiss nicht leichte
Gedächtnisrede zu übernehmen. Dass er sich der übernommenen Aufgabe in
meisterhafter Weise entledigte. braucht bei diesem Redner nicht erst
gesagt zu werden. Er knüpfte an an den Vers in den Klageliedern:
'Gefallen ist die Krone von unserem Haupte!', mit welchem er dem Verlust
im Namen der Gemeinde und der Familie ergreifenden Ausdruck gab. Aber wie
auch für den zerstörten Tempel der große R. Jochanan ben Saccai einen
Ersatz erblickte in dem 'Alter der Liebe', so sei es auch hier die Liebe,
deren Opfer und Hingebung mit diesem von der Zeit zu früh verlangten
Opfer auszusöhnen die Macht haben. - Nicht nur der Vorstand unserer
Gemeinde und viele Freunde des Heimgegangenen waren anwesend, sondern auch
aus der Ferne sahen wir Freunde der so schwer geprüften Familie,
namentlich hatte es sich der hochherzige Gönner der verwaisten Kinder,
Herr Hugo Schlesinger aus Frankfurt am Main nicht nehmen lassen, an dieser
Trauerfeierlichkeit teilzunehmen. Sowohl der Gemeindevorstand wie alle
Anwesenden dankten es dem Herrn Dr. Plaut, dass er dem wahrhaft traurigen
Jahre einen so würdigen, versöhnenden Abschluss gegeben." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Juli 1901: "Koblenz,
22. Juli (1901). Eine eindrucksvolle Gedenkfeier am Grabe seines
verstorbenen Kollegen und Freundes, Dr. M. Singer, veranstaltete heute
Herr Rabbiner Dr. Plaut aus Frankfurt am Main in Anwesenheit der
Singer'schen Familie, zahlreicher Freunde des Verblichenen und des
Vorstandes der Gemeinde. In ergreifender Weise wies Herr Dr. Plaut
nochmals auf das tragische Geschick seines Freundes hin, der im
blühendsten Alter den Seinen und der Gemeinde entrissen wurde, und pries
zugleich das göttliche Walten, das der verwaisten Familie einen zweiten
Vater und Versorger in der Person eines hochherzigen Frankfurter Herrn
gegeben. Die kleine, aber ergreifende Feier hat in Aller Herzen einen
tiefen Nachklang gefunden. Herrn Rabbiner Dr. Plaut selbst gebührt für
seine rührende freundschaftliche Intention der Dank Aller, die dem
Verstorbenen nahe gestanden." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Juli 1901: "Koblenz,
22. Juli (1901). Eine eindrucksvolle Gedenkfeier am Grabe seines
verstorbenen Kollegen und Freundes, Dr. M. Singer, veranstaltete heute
Herr Rabbiner Dr. Plaut aus Frankfurt am Main in Anwesenheit der
Singer'schen Familie, zahlreicher Freunde des Verblichenen und des
Vorstandes der Gemeinde. In ergreifender Weise wies Herr Dr. Plaut
nochmals auf das tragische Geschick seines Freundes hin, der im
blühendsten Alter den Seinen und der Gemeinde entrissen wurde, und pries
zugleich das göttliche Walten, das der verwaisten Familie einen zweiten
Vater und Versorger in der Person eines hochherzigen Frankfurter Herrn
gegeben. Die kleine, aber ergreifende Feier hat in Aller Herzen einen
tiefen Nachklang gefunden. Herrn Rabbiner Dr. Plaut selbst gebührt für
seine rührende freundschaftliche Intention der Dank Aller, die dem
Verstorbenen nahe gestanden." |
Errichtung eines Bezirksrabbinates in Koblenz (1935)
 Artikel in "Jüdische Schulzeitung" vom 1. September 1935: "Einrichtung
eines Bezirksrabbinats in Koblenz. Auf Anregung des preußischen
Landesverbandes jüdischer Gemeinden und auf Grund der von ihm zugesagten
Unterstützung hat die Synagogengemeinde Koblenz beschlossen, dass seit
mehreren Jahrzehnten verwaiste Rabbinat wieder zu besitzen und im
Einvernehmen mit dem preußischen Landesverband zu einem Bezirksrabbinat für
die zahlreichen Gemeinden der Umgebung auszugestalten. Der Rabbinatsbezirk
wird außer Koblenz die dem Landesverband angeschlossenen Gemeinden der
Kreise Mayen, Cochem, Sankt Goar und Simmern, sowie die rechtsrheinischen
Gemeinden Vallendar,
Bendorf-Sayn,
Neuwied,
Dierdorf und Puderbach umfassen;
insgesamt handelt es sich um rund 30 Gemeinden mit zum Teil allerdings nur
geringer Seelenzahl. Der Landesverband erhofft aus der Einrichtung des
Bezirksrabbinats gerade für die kleinen Gemeinden des Hunsrücks und der
Seitentäler des Rheins eine Stärkung und Vertiefung des jüdischen Lebens und
die Schaffung eines engen und fruchtbaren Zusammenhalt zwischen den
verstreuten jüdischen Gemeinschaften. Artikel in "Jüdische Schulzeitung" vom 1. September 1935: "Einrichtung
eines Bezirksrabbinats in Koblenz. Auf Anregung des preußischen
Landesverbandes jüdischer Gemeinden und auf Grund der von ihm zugesagten
Unterstützung hat die Synagogengemeinde Koblenz beschlossen, dass seit
mehreren Jahrzehnten verwaiste Rabbinat wieder zu besitzen und im
Einvernehmen mit dem preußischen Landesverband zu einem Bezirksrabbinat für
die zahlreichen Gemeinden der Umgebung auszugestalten. Der Rabbinatsbezirk
wird außer Koblenz die dem Landesverband angeschlossenen Gemeinden der
Kreise Mayen, Cochem, Sankt Goar und Simmern, sowie die rechtsrheinischen
Gemeinden Vallendar,
Bendorf-Sayn,
Neuwied,
Dierdorf und Puderbach umfassen;
insgesamt handelt es sich um rund 30 Gemeinden mit zum Teil allerdings nur
geringer Seelenzahl. Der Landesverband erhofft aus der Einrichtung des
Bezirksrabbinats gerade für die kleinen Gemeinden des Hunsrücks und der
Seitentäler des Rheins eine Stärkung und Vertiefung des jüdischen Lebens und
die Schaffung eines engen und fruchtbaren Zusammenhalt zwischen den
verstreuten jüdischen Gemeinschaften.
Zum Bezirksrabbiner ist Herr Dr. Max Vogelstein, Berlin, der Sohn des
bekannten Breslauer Rabbiners gewählt worden. Herr Dr. Vogelstein hat sich
neben praktischer Tätigkeit als Rabbiner und akademischer Religionslehrer
besonders durch seine wissenschaftlichen Arbeiten ausgezeichnet, auf Grund
deren er auch seit über einem Jahr an der vom preußischen Landesverband
geschaffenen jüdischen Lehrerbildungsanstalt in Berlin als Dozent tätig war.
Herr Dr. Vogelstein wird das Amt in Koblenz am 1. September antreten." |
Aus der Geschichte der jüdischen
Lehrer und der Schule
Noch ungeordnete Verhältnisse im Unterrichtswesen der
Gemeinde - Bericht von 1840
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19.
Dezember 1840: "Koblenz, 6. Dezember (1840). Mit vollem Rechte
ist in No. 48 aus Bonn der falsche Berichterstatter in No. 43 abgewiesen
worden. Möge es allen Denen so ergehen, die eine schlechte Sache mit
Lügen übertünchen wollen. Denn von den gerühmten bewirkt sein
sollenden 'neuen Anordnungen und heilsamen Vorschlägen zur Veredlung und
Verbesserung unserer religiösen Zustände etc. etc.' ist noch nicht bei
uns laut noch sichtbar geworden, und dürfte es auch wohl schwerlich, noch
sobald werden, bei der bekannten Herzens- und Geistesbeschaffenheit
derjenigen, die dazu berufen und verpflichtet wären. Vornehmlich
betrübend und schmerzlich für jedes fühlende echt jüdische Herz ist der
bei uns noch gar sehr im Argen liegende Zustand des religiösen jüdischen
Jugendunterrichts. So z.B. in der hiesigen Koblenzer, 50 bis 55
Familien starken Judengemeinde, befindet sich kein einziger jüdischer,
weder öffentlicher noch Privatlehrer; und entbehrt folglich, die
betreffende Jugend , nicht nur alle und jede Unterweisung in der Religion
selbst, sondern auch aller auch der geringsten Kenntnis der hebräischen
Sprache und Literatur. Auch bleiben die herben Früchte dieser, für den
hiesigen Vorstand unverantwortlicher Verwahrlosung nicht aus. Denn krasse
Ignoranz und religiöser Indifferentismus, in steigender Progression, sind
leider die charakteristischen Eigenschaften unserer solchergestalt wild
aufwachsenden Jugend. Und welche traurige Aussichten für die Zukunft,
bietet nicht eine solche heillose Vernachlässigung, ohne baldige
nachdrückliche Abhilfe, dar!"
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19.
Dezember 1840: "Koblenz, 6. Dezember (1840). Mit vollem Rechte
ist in No. 48 aus Bonn der falsche Berichterstatter in No. 43 abgewiesen
worden. Möge es allen Denen so ergehen, die eine schlechte Sache mit
Lügen übertünchen wollen. Denn von den gerühmten bewirkt sein
sollenden 'neuen Anordnungen und heilsamen Vorschlägen zur Veredlung und
Verbesserung unserer religiösen Zustände etc. etc.' ist noch nicht bei
uns laut noch sichtbar geworden, und dürfte es auch wohl schwerlich, noch
sobald werden, bei der bekannten Herzens- und Geistesbeschaffenheit
derjenigen, die dazu berufen und verpflichtet wären. Vornehmlich
betrübend und schmerzlich für jedes fühlende echt jüdische Herz ist der
bei uns noch gar sehr im Argen liegende Zustand des religiösen jüdischen
Jugendunterrichts. So z.B. in der hiesigen Koblenzer, 50 bis 55
Familien starken Judengemeinde, befindet sich kein einziger jüdischer,
weder öffentlicher noch Privatlehrer; und entbehrt folglich, die
betreffende Jugend , nicht nur alle und jede Unterweisung in der Religion
selbst, sondern auch aller auch der geringsten Kenntnis der hebräischen
Sprache und Literatur. Auch bleiben die herben Früchte dieser, für den
hiesigen Vorstand unverantwortlicher Verwahrlosung nicht aus. Denn krasse
Ignoranz und religiöser Indifferentismus, in steigender Progression, sind
leider die charakteristischen Eigenschaften unserer solchergestalt wild
aufwachsenden Jugend. Und welche traurige Aussichten für die Zukunft,
bietet nicht eine solche heillose Vernachlässigung, ohne baldige
nachdrückliche Abhilfe, dar!" |
Ausschreibung der Stelle eines Lehrers, Vorbeters und
Schochet (1849)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. März 1849: "Bei der israelitischen Gemeinde in Koblenz
wird ein unverheirateter, wissenschaftlich gebildeter Mann, welcher den
höhern Religionsunterricht zu leiten, und gleichzeitig das Vorbeteramt
nach abgekürztem Ritus zu bekleiden, eventuell auch religiöse Vorträge
zu halten im Stande ist; ferner ein unverheirateter Mann, welcher den
Unterricht in der unteren Klasse der Religionsschule zu erteilen befähigt
und ein tüchtiger Schochet ist, vom 1. Juli dieses Jahres ab zu
engagieren gesucht. Hierauf Reflektierende belieben sich unter Einsendung
ihrer Qualifikations- und Moralitätszeugnisse und unter Bemerkung ihrer
Ansprüche in portofreien Briefen baldigst an unterzeichnete Stelle zu
wenden." Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. März 1849: "Bei der israelitischen Gemeinde in Koblenz
wird ein unverheirateter, wissenschaftlich gebildeter Mann, welcher den
höhern Religionsunterricht zu leiten, und gleichzeitig das Vorbeteramt
nach abgekürztem Ritus zu bekleiden, eventuell auch religiöse Vorträge
zu halten im Stande ist; ferner ein unverheirateter Mann, welcher den
Unterricht in der unteren Klasse der Religionsschule zu erteilen befähigt
und ein tüchtiger Schochet ist, vom 1. Juli dieses Jahres ab zu
engagieren gesucht. Hierauf Reflektierende belieben sich unter Einsendung
ihrer Qualifikations- und Moralitätszeugnisse und unter Bemerkung ihrer
Ansprüche in portofreien Briefen baldigst an unterzeichnete Stelle zu
wenden." |
Geordnete Schulverhältnisse unter Lehrer Sommer - Bericht von 1859
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. Februar 1859:
"Koblenz, 17. Dezember. In unserer Gemeinde findet die
Religionsschule unter der Leitung des Herrn Sommer, eines tüchtigen
Schulmannes, allgemeine Anerkennung; hier findet kein pedantischer Zwang
statt, sondern der Unterricht wird mit Lust und Liebe, der Fassungshabe
der Schüler und Schülerinnen entsprechend und in den verschiedenen
Abteilungen fortschreitend, unter der Aufsicht einer besonderen
Schulkommission in den meisten Fächern des jüdischen Wissens und der
Geschichte der jüdischen Volkes erteilt, und findet bei den
Jahresprüfungen und der feierlichen Konfirmation der entlassenen
Zöglinge öffentliche und wohl verdiente Anerkennung. Darum darf es auch
nicht Wunder nehmen, wenn der Gemeindevorstand vor einigen Jahren den
Gehalt des Herrn Sommer ansehnlich verbessert, und wollen wir es nicht
versäumen, in diesem viel gelesenen Blatte einen rührenden und
erhebenden Akt mitzuteilen, der sich dieser Tage unter unseren Augen
zutrug. Einige Zöglinge der Schule fassten den Entschluss, ihrem Lehrer
einen kleinen Beweis ihrer Dankbarkeit zu geben, und demselben in
Anerkennung für die vielen Mühen und Anstrengungen, die er durch sie
gehabt und noch täglich hat, durch Überreichung eines kleinen Geschenks
zu erfreuen. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. Februar 1859:
"Koblenz, 17. Dezember. In unserer Gemeinde findet die
Religionsschule unter der Leitung des Herrn Sommer, eines tüchtigen
Schulmannes, allgemeine Anerkennung; hier findet kein pedantischer Zwang
statt, sondern der Unterricht wird mit Lust und Liebe, der Fassungshabe
der Schüler und Schülerinnen entsprechend und in den verschiedenen
Abteilungen fortschreitend, unter der Aufsicht einer besonderen
Schulkommission in den meisten Fächern des jüdischen Wissens und der
Geschichte der jüdischen Volkes erteilt, und findet bei den
Jahresprüfungen und der feierlichen Konfirmation der entlassenen
Zöglinge öffentliche und wohl verdiente Anerkennung. Darum darf es auch
nicht Wunder nehmen, wenn der Gemeindevorstand vor einigen Jahren den
Gehalt des Herrn Sommer ansehnlich verbessert, und wollen wir es nicht
versäumen, in diesem viel gelesenen Blatte einen rührenden und
erhebenden Akt mitzuteilen, der sich dieser Tage unter unseren Augen
zutrug. Einige Zöglinge der Schule fassten den Entschluss, ihrem Lehrer
einen kleinen Beweis ihrer Dankbarkeit zu geben, und demselben in
Anerkennung für die vielen Mühen und Anstrengungen, die er durch sie
gehabt und noch täglich hat, durch Überreichung eines kleinen Geschenks
zu erfreuen.
Eine Kollekte, die sie zu diesem Zwecke bei den Eltern der Schulkinder
abhielten, brachte schnell eine namhafte Summe zusammen, und so wurden am
14. dieses Monats in dem festlich erleuchteten und verzierten Schullokale
in Gegenwart des dazu eingeladenen Gemeindevorstandes und der
Schulkommission unter entsprechenden Anreden des Herrn Sommer zwei
wertvolle silberne Leuchter und ein kostbares Service von der versammelten
Schuljugend überreicht. Auf das Innigste gerührt und überrascht durch
dieses äußere Zeichen der Dankbarkeit, hielt Herr Sommer eine von Herzen
kommende und allgemeine Rührung erweckende Ansprache an die
Versammlung." |
25-jähriges Amtsjubiläum von Prediger und Lehrer
Benno Huhn (1926)
 Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom
8. Januar 1926: "Koblenz. (Amtsjubiläum). Am 1. Januar
1926 beging die Synagogengemeinde Koblenz die Feier der 25-jährigen,
amtlichen Tätigkeit ihres Predigers und Lehrers Herrn Benno Huhn.
Die Feier gestaltete sich zu einer Kundgebung des gegenseitigen Vertrauens
von Seelsorger und Gemeinde. Zu dem Festgottesdienst wurde der Jubilar
durch die gesamte Verwaltung in feierlicher Weise eingeführt. Eine
Ansprache durch den Vorsitzenden, Herrn Moser, betonte die
unvergänglichen Verdienste des Gefeierten, welcher in der darauffolgenden
Festpredigt der Anhänglichkeit und Liebe zu seiner Gemeinde beredten
Ausdruck verlieh. Herr Oberkantor Fleischmann aus Köln erhöhte
die feierliche Stimmung durch den mit unvergleichlich herrlicher Stimme
durchgeführten kantoralen Teil des Festgottesdienstes. Am Abend des
Festtages versammelten sich die Gemeindemitglieder in den Gemeindesälen
zu einer geselligen Feier, in welcher von verschiedenen Rednern das
mustergültige Schaffen und Wirken des Jubilars, das Aufblühen der
Gemeinde und die vorbildliche Tätigkeit der gegenwärtigen Verwaltung
hervorgehoben
wurden." Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom
8. Januar 1926: "Koblenz. (Amtsjubiläum). Am 1. Januar
1926 beging die Synagogengemeinde Koblenz die Feier der 25-jährigen,
amtlichen Tätigkeit ihres Predigers und Lehrers Herrn Benno Huhn.
Die Feier gestaltete sich zu einer Kundgebung des gegenseitigen Vertrauens
von Seelsorger und Gemeinde. Zu dem Festgottesdienst wurde der Jubilar
durch die gesamte Verwaltung in feierlicher Weise eingeführt. Eine
Ansprache durch den Vorsitzenden, Herrn Moser, betonte die
unvergänglichen Verdienste des Gefeierten, welcher in der darauffolgenden
Festpredigt der Anhänglichkeit und Liebe zu seiner Gemeinde beredten
Ausdruck verlieh. Herr Oberkantor Fleischmann aus Köln erhöhte
die feierliche Stimmung durch den mit unvergleichlich herrlicher Stimme
durchgeführten kantoralen Teil des Festgottesdienstes. Am Abend des
Festtages versammelten sich die Gemeindemitglieder in den Gemeindesälen
zu einer geselligen Feier, in welcher von verschiedenen Rednern das
mustergültige Schaffen und Wirken des Jubilars, das Aufblühen der
Gemeinde und die vorbildliche Tätigkeit der gegenwärtigen Verwaltung
hervorgehoben
wurden." |
Berichte aus
dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben
Ein jüdischer Bürger wird zum Stadtverordneten gewählt
(1846)
 Meldung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Oktober 1846:
"Koblenz, 6. Oktober (1846). Auch hier ist ein Israelit zum Stadtverordneten
gewählt worden." Meldung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Oktober 1846:
"Koblenz, 6. Oktober (1846). Auch hier ist ein Israelit zum Stadtverordneten
gewählt worden." |
Reformen in Gottesdienst und der Gemeinde
(1849)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 16. Juli 1849: "Koblenz, 3. Juli (1849).
Während uns aus so vielen größeren und kleineren jüdischen Gemeinde
die Klage wegen Zerrüttung und Zerfall der Gemeindezustände zu Ohren
kommt, ist es mir erfreulich, Ihnen die Mitteilung machen zu können, dass
die neue Zeit auf die Verhältnisse unserer Gemeinde den wohltätigsten
und befriedigendsten Einfluss geübt hat, und dieselben eine Gestalt
erlangt haben, welcher die vollste Anerkennung gewährt werden muss und
wird. So wie unser Kultus vom verflossenen Rosch Haschana
(Neujahrstage) an eine völlige Umwandlung erlitten und in demselben die
Beschlüsse der R.V. (Rabbiner-Versammlung) bis auf wenige Ausnahmen in
Ausführung gebracht worden sind, sodass am gewöhnlichen Sabbate der Gottesdienst
nicht länger als 1 1/4, am Festtage nicht länger als 1 1/2 Stunde
dauert, und derselbe beinahe zur Hälfte in deutscher Sprache abgehalten
wird, ebenso sind auch die Verwaltungsangelegenheiten, welche sich
in einem sehr traurigen Zustande befanden, durch eine von der Gemeinde zur
Regulierung derselben gewählte Kommission zur allgemeinen Zufriedenheit
geordnet worden. Mit der Hälfte der früheren Umlagen werden jetzt alle Institutionen
auf bessere und zweckmäßigere Weise verwaltet. Wer die früheren
Verhältnisse hiesiger Gemeinde gekannt, muss den Mut und den takt der
Männer bewundern, die in einer so kurzen Zeit so Gewaltiges vollbracht
und das Alles ohne den Frieden der Gemeinde auf einen Augenblick zu
stören. Fast alle Beschlüsse derselben sind einstimmig gefasst und auf
die schonendste Art zur Ausführung gebracht worden. Auf diese Weise wurde
es denn auch möglich, den schon vor mehreren Jahren projektierten Bau
einer neuen Synagoge in verflossenen Frühjahre zu beginnen, und wir
werden vielleicht schon in den Herbstfeiertagen zur Einweihung derselben
schreiten können. Wie auch von Seiten unserer christlichen Mitbürger das
Streben der jüdischen Gemeinde gewürdigt wird, können Sie daraus
ermessen, dass der Stadtrat durch einen fast einstimmigen Beschluss dem
jüdischen Kultus aus der Stadtkasse einen jährlichen Zuschuss von
beinahe 100 Thaler bewilligt, sowie zur Umfriedung des umfangreichen
Gottesackers das nötige Material (im Werte von einigen hundert
Thalern) angeboten und überreicht hat. Und um den gewonnenen Boden
selbstständig bearbeiten, und ohne Störung von außen die erwünschten
Früchte erzielen zu können, ist, wie ein Segen von oben, unterm 8. des
verflossenen Monats dem Vorstande vom königlichen Oberpräsidium eine
Zuschrift übermacht worden, wonach, gemäß eines Ministerialreskriptes
die rheinischen jüdischen Konsistorien, die uns so hinderlich im Wege
gestanden (noch vor wenigen Monaten hat das zu Bonn die hiesige Regierung
darum angegangen, die Reformen in unserm Gottesdienste zu verbieten) aufgelöst
worden sind. Demgemäss ist nun hier sofort ein selbstständiges
Rabbinat gegründet und unser bisheriger Prediger, Herr Ben-Israel,
zum Rabbiner desselben ernannt worden. Wir hoffen, dass dieses Rabbinat
sich recht bald dadurch, dass die umliegenden Gemeinden sich anschließen,
zu einem größeren Sprengel ausdehnen wird, was umso mehr zu erwarten
steht, als Herr Ben-Israel durch seine sechsjährige Verwaltung des
Predigeramtes bewiesen hat,
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 16. Juli 1849: "Koblenz, 3. Juli (1849).
Während uns aus so vielen größeren und kleineren jüdischen Gemeinde
die Klage wegen Zerrüttung und Zerfall der Gemeindezustände zu Ohren
kommt, ist es mir erfreulich, Ihnen die Mitteilung machen zu können, dass
die neue Zeit auf die Verhältnisse unserer Gemeinde den wohltätigsten
und befriedigendsten Einfluss geübt hat, und dieselben eine Gestalt
erlangt haben, welcher die vollste Anerkennung gewährt werden muss und
wird. So wie unser Kultus vom verflossenen Rosch Haschana
(Neujahrstage) an eine völlige Umwandlung erlitten und in demselben die
Beschlüsse der R.V. (Rabbiner-Versammlung) bis auf wenige Ausnahmen in
Ausführung gebracht worden sind, sodass am gewöhnlichen Sabbate der Gottesdienst
nicht länger als 1 1/4, am Festtage nicht länger als 1 1/2 Stunde
dauert, und derselbe beinahe zur Hälfte in deutscher Sprache abgehalten
wird, ebenso sind auch die Verwaltungsangelegenheiten, welche sich
in einem sehr traurigen Zustande befanden, durch eine von der Gemeinde zur
Regulierung derselben gewählte Kommission zur allgemeinen Zufriedenheit
geordnet worden. Mit der Hälfte der früheren Umlagen werden jetzt alle Institutionen
auf bessere und zweckmäßigere Weise verwaltet. Wer die früheren
Verhältnisse hiesiger Gemeinde gekannt, muss den Mut und den takt der
Männer bewundern, die in einer so kurzen Zeit so Gewaltiges vollbracht
und das Alles ohne den Frieden der Gemeinde auf einen Augenblick zu
stören. Fast alle Beschlüsse derselben sind einstimmig gefasst und auf
die schonendste Art zur Ausführung gebracht worden. Auf diese Weise wurde
es denn auch möglich, den schon vor mehreren Jahren projektierten Bau
einer neuen Synagoge in verflossenen Frühjahre zu beginnen, und wir
werden vielleicht schon in den Herbstfeiertagen zur Einweihung derselben
schreiten können. Wie auch von Seiten unserer christlichen Mitbürger das
Streben der jüdischen Gemeinde gewürdigt wird, können Sie daraus
ermessen, dass der Stadtrat durch einen fast einstimmigen Beschluss dem
jüdischen Kultus aus der Stadtkasse einen jährlichen Zuschuss von
beinahe 100 Thaler bewilligt, sowie zur Umfriedung des umfangreichen
Gottesackers das nötige Material (im Werte von einigen hundert
Thalern) angeboten und überreicht hat. Und um den gewonnenen Boden
selbstständig bearbeiten, und ohne Störung von außen die erwünschten
Früchte erzielen zu können, ist, wie ein Segen von oben, unterm 8. des
verflossenen Monats dem Vorstande vom königlichen Oberpräsidium eine
Zuschrift übermacht worden, wonach, gemäß eines Ministerialreskriptes
die rheinischen jüdischen Konsistorien, die uns so hinderlich im Wege
gestanden (noch vor wenigen Monaten hat das zu Bonn die hiesige Regierung
darum angegangen, die Reformen in unserm Gottesdienste zu verbieten) aufgelöst
worden sind. Demgemäss ist nun hier sofort ein selbstständiges
Rabbinat gegründet und unser bisheriger Prediger, Herr Ben-Israel,
zum Rabbiner desselben ernannt worden. Wir hoffen, dass dieses Rabbinat
sich recht bald dadurch, dass die umliegenden Gemeinden sich anschließen,
zu einem größeren Sprengel ausdehnen wird, was umso mehr zu erwarten
steht, als Herr Ben-Israel durch seine sechsjährige Verwaltung des
Predigeramtes bewiesen hat, |
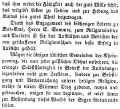 dass
ihm weder die Fähigkeit noch der gute Wille fehlt, das religiöse Leben
zu fördern und zur Hebung des Kultus sein gutes Teil
beizutragen. dass
ihm weder die Fähigkeit noch der gute Wille fehlt, das religiöse Leben
zu fördern und zur Hebung des Kultus sein gutes Teil
beizutragen.
Durch das Engagement des bisherigen Lehrers zu Bad
Ems, Herrn S. Sommer, zum Religionslehrer und Vorbeter, ist
für das Aufblühen und Gedeihen der neu geschaffenen Religionsschule der
beste Erfolg in Aussicht gestellt.
Mögen die übrigen jüdischen Gemeinden der Rheinprovinz, die nun jeder
geistlichen Obhut entbehren, die erlangte Selbstständigkeit in Betreff
der Kultusangelegenheiten nicht zum Zerstören, sondern zur Befestigung
und Verherrlichung unserer heiligen Religion, welche so vielen Stürmen
Trotz geboten, nutzen und gebrauchen, mögen sie nur beginnen, es wird
ihnen zur Vollendung dieses Werkes der Segen Gottes nicht
fehlen." |
Antijüdisches in der Presse (1850)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. Mai 1850:
"Koblenz, 2. Mai (1850). Es ist merkwürdig, wie man sich in
Deutschland noch immer nicht entwöhnen will, bei jeder Gelegenheit, wo
die Religion auch nicht den geringsten Einfluss übt, den 'Juden'
hervorzuheben. Ein hiesiger Arzt hat gegen einen hiesigen Kaufmann im
hiesigen 'Tageblatt' etwas geschrieben. Er wird dafür angeklagt und zu 25
Taler Strafe verurteilt. Nun, das sind Dinge, die täglich passieren. da
wird aber in allen Zeitungen darüber geschrieben, und recht
geflissentlich hervorgehoben 'der jüdische Arzt Dr. A.' ff. Was hat da
der Jude mit zu tun? Schreibt man etwa 'der katholische Arzt, der
evangelische Rechtsanwalt, der griechisch-unierte Schreiner, der
mennonitische Schuhmacher' und dergleichen? Bevor selbst die deutschen
Redaktionen, die doch auf Bildung Ansprach machen wollen, solcherlei
Gesinnungen nicht ablegen, ihr Wohlwollen gegen eine große
Religionspartei stets an den Tag zu legen, ist auf eine allgemeine Duldung
nicht zu rechnen, und nicht zu verwundern, dass von Zeit zu Zeit es sich
zeigt, wie die Glut des Vorurteils und Hasses noch immer unter einer
dünnen Decke von Asche fortglimmt." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. Mai 1850:
"Koblenz, 2. Mai (1850). Es ist merkwürdig, wie man sich in
Deutschland noch immer nicht entwöhnen will, bei jeder Gelegenheit, wo
die Religion auch nicht den geringsten Einfluss übt, den 'Juden'
hervorzuheben. Ein hiesiger Arzt hat gegen einen hiesigen Kaufmann im
hiesigen 'Tageblatt' etwas geschrieben. Er wird dafür angeklagt und zu 25
Taler Strafe verurteilt. Nun, das sind Dinge, die täglich passieren. da
wird aber in allen Zeitungen darüber geschrieben, und recht
geflissentlich hervorgehoben 'der jüdische Arzt Dr. A.' ff. Was hat da
der Jude mit zu tun? Schreibt man etwa 'der katholische Arzt, der
evangelische Rechtsanwalt, der griechisch-unierte Schreiner, der
mennonitische Schuhmacher' und dergleichen? Bevor selbst die deutschen
Redaktionen, die doch auf Bildung Ansprach machen wollen, solcherlei
Gesinnungen nicht ablegen, ihr Wohlwollen gegen eine große
Religionspartei stets an den Tag zu legen, ist auf eine allgemeine Duldung
nicht zu rechnen, und nicht zu verwundern, dass von Zeit zu Zeit es sich
zeigt, wie die Glut des Vorurteils und Hasses noch immer unter einer
dünnen Decke von Asche fortglimmt." |
Gottesdienste mit zahlreichen Soldaten - Einsatz für die
französisch-jüdischen Kriegsgefangenen (1870)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. Oktober 1870:
"Koblenz, 14. Oktober (1870). An den eben verlebten hohen
Feiertagen wurde unsere Synagoge von Soldaten aller Waffengattungen
besucht. Ein sonderbares Bild bot es aber dem Auge, als die hier gefangen
gehaltenen französischen Israeliten, unter denen sich Söhne von mehreren
Rabbinen aus Elsass befinden, unter Eskorte preußischer Soldaten zur
Synagoge gebracht und von denselben nach beendigtem Gottesdienst, und
nachdem sie, auf Kosten der hiesigen israelitischen Gemeinde, wohl
gespeist und getränkt waren, auch wieder zurückgeführt wurden. Es ist
jedoch weniger der Synagogengesuch der Franzosen, welchen ich Ihnen
hervorheben wollte, denn vielen unter ihnen mag es bloß darum zu tun
gewesen sein, einmal in die Stadt am Rhein zu kommen. Bemerken wollte ich
Ihnen bloß, wie sich auch hier wieder das echt jüdische Herz gezeigt
hat. Kaum war es kund geworden, dass den Franzosen während der Feiertage
gestattet sei, die Synagoge zu besuchen, als auch schon die Mittel zu
ihrer Beköstigung für Rosch-haschonoh, Jom-Kippur und Sokkut durch
freiwillige Gaben herbeigebracht waren. Hier zeigte es sich, dass der Jude
in seiner Wohl- und Mildtätigkeit keinen Feind kennt und bewährten sich
aufs herzlichste die Worte des weisen Salomo: 'wenn deinen Feind
hungert, gib ihm Brot zu essen, und wenn ihm dürstet, gib ihm Wasser zu
trinken' (Sprüche 25,21) Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. Oktober 1870:
"Koblenz, 14. Oktober (1870). An den eben verlebten hohen
Feiertagen wurde unsere Synagoge von Soldaten aller Waffengattungen
besucht. Ein sonderbares Bild bot es aber dem Auge, als die hier gefangen
gehaltenen französischen Israeliten, unter denen sich Söhne von mehreren
Rabbinen aus Elsass befinden, unter Eskorte preußischer Soldaten zur
Synagoge gebracht und von denselben nach beendigtem Gottesdienst, und
nachdem sie, auf Kosten der hiesigen israelitischen Gemeinde, wohl
gespeist und getränkt waren, auch wieder zurückgeführt wurden. Es ist
jedoch weniger der Synagogengesuch der Franzosen, welchen ich Ihnen
hervorheben wollte, denn vielen unter ihnen mag es bloß darum zu tun
gewesen sein, einmal in die Stadt am Rhein zu kommen. Bemerken wollte ich
Ihnen bloß, wie sich auch hier wieder das echt jüdische Herz gezeigt
hat. Kaum war es kund geworden, dass den Franzosen während der Feiertage
gestattet sei, die Synagoge zu besuchen, als auch schon die Mittel zu
ihrer Beköstigung für Rosch-haschonoh, Jom-Kippur und Sokkut durch
freiwillige Gaben herbeigebracht waren. Hier zeigte es sich, dass der Jude
in seiner Wohl- und Mildtätigkeit keinen Feind kennt und bewährten sich
aufs herzlichste die Worte des weisen Salomo: 'wenn deinen Feind
hungert, gib ihm Brot zu essen, und wenn ihm dürstet, gib ihm Wasser zu
trinken' (Sprüche 25,21) |
Rekrutenvereidigung in der Synagoge (1890)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
4. Dezember 1890: "In Koblenz sind diesmal bei der
Rekrutenvereidigung zum ersten Male die Soldaten israelitischer Konfession
in der Synagoge vereidigt". Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
4. Dezember 1890: "In Koblenz sind diesmal bei der
Rekrutenvereidigung zum ersten Male die Soldaten israelitischer Konfession
in der Synagoge vereidigt". |
Die Beamtengehälter der Gemeinde werden erhöht
(1892)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
8. April 1892: "Die Koblenzer israelitische Gemeindeverwaltung
hat angesichts der herrschenden Teuerung die Beamtengehälter zum
1. April erhöht, trotzdem dies erst vor drei Jahren bereits einmal
geschehen ist und vor einem halben Jahr eine einmalige Teuerungszulage
bewilligt worden
war." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
8. April 1892: "Die Koblenzer israelitische Gemeindeverwaltung
hat angesichts der herrschenden Teuerung die Beamtengehälter zum
1. April erhöht, trotzdem dies erst vor drei Jahren bereits einmal
geschehen ist und vor einem halben Jahr eine einmalige Teuerungszulage
bewilligt worden
war." |
Gegen den sich ausbreitenden Antisemitismus (1892)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. August 1892:
"Koblenz, 1. August (1892). Mehrere angesehene Firmen am Rhein haben
die Arbeiter ihrer Fabriken vor dem Besuche antisemitischer Versammlungen
gewarnt. Einige haben wissen lassen, dass diejenigen, welche Mitglieder
von antisemitischen Vereinen werden, eine Aufkündigung des
Arbeitsverhältnisses zu erwarten haben." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. August 1892:
"Koblenz, 1. August (1892). Mehrere angesehene Firmen am Rhein haben
die Arbeiter ihrer Fabriken vor dem Besuche antisemitischer Versammlungen
gewarnt. Einige haben wissen lassen, dass diejenigen, welche Mitglieder
von antisemitischen Vereinen werden, eine Aufkündigung des
Arbeitsverhältnisses zu erwarten haben." |
Ausschuss-Sitzung des Verbandes israelitischer Gemeinden
im Regierungsbezirk Koblenz (1907)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 19. Juli 1907: "Koblenz. Der Verband
israelitischer Gemeinden im Regierungs-Bezirk Koblenz hielt unter der
Leitung seines Vorsitzenden, Herrn Dr. Lichtenstein -
Neuwied, eine
Ausschusssitzung ab. Der Verband bezweckt vorzugsweise: Austausch von
Erfahrungen in der Gemeindeverwaltung, bestehende Missstände in kleinen
Gemeinden zu beseitigen und Differenzen zu schlichten, das Gemeindewesen
zu organisieren, Pflege und Förderung des Religionsunterrichts,
Heranziehung der Jugend zu anderen Erwerbszweigen als zum Viehhandel,
Hebung geistiger Kultur. - Die diesmaligen Beratungen des Ausschusses
bezogen sich auf die Einrichtung und Förderung des Religionsunterrichtes
in mehreren Gemeinden des Bezirks. Für den Religionsunterricht gibt es in
den zum Bezirke gehörenden Teilen des Westerwaldes, der Eifel und des
Hunsrück noch vieles zu tun. Am 28. Juli soll in Rheinböllen eine
abermalige Ausschusssitzung und allgemeine Versammlung zur Besprechung
über Religions-Schulangelegenheiten stattfinden". Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 19. Juli 1907: "Koblenz. Der Verband
israelitischer Gemeinden im Regierungs-Bezirk Koblenz hielt unter der
Leitung seines Vorsitzenden, Herrn Dr. Lichtenstein -
Neuwied, eine
Ausschusssitzung ab. Der Verband bezweckt vorzugsweise: Austausch von
Erfahrungen in der Gemeindeverwaltung, bestehende Missstände in kleinen
Gemeinden zu beseitigen und Differenzen zu schlichten, das Gemeindewesen
zu organisieren, Pflege und Förderung des Religionsunterrichts,
Heranziehung der Jugend zu anderen Erwerbszweigen als zum Viehhandel,
Hebung geistiger Kultur. - Die diesmaligen Beratungen des Ausschusses
bezogen sich auf die Einrichtung und Förderung des Religionsunterrichtes
in mehreren Gemeinden des Bezirks. Für den Religionsunterricht gibt es in
den zum Bezirke gehörenden Teilen des Westerwaldes, der Eifel und des
Hunsrück noch vieles zu tun. Am 28. Juli soll in Rheinböllen eine
abermalige Ausschusssitzung und allgemeine Versammlung zur Besprechung
über Religions-Schulangelegenheiten stattfinden". |
Ausschreibung der Stelle des Schochet und Synagogendieners
(1909)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. April 1909: "Die
Synagogengemeinde Koblenz am Rhein sucht zum Herbst dieses Jahres
(möglichst vor den Feiertagen) einen Schochet und Synagogendiener,
der stimmlich begabt und Baal Kore sein muss, um eventuell den
Vorbeter vertreten zu können. Ausländer ausgeschlossen. Offerten mit
Zeugnisabschriften und Gehaltsansprüchen sind an den Vorstand zu
richten." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. April 1909: "Die
Synagogengemeinde Koblenz am Rhein sucht zum Herbst dieses Jahres
(möglichst vor den Feiertagen) einen Schochet und Synagogendiener,
der stimmlich begabt und Baal Kore sein muss, um eventuell den
Vorbeter vertreten zu können. Ausländer ausgeschlossen. Offerten mit
Zeugnisabschriften und Gehaltsansprüchen sind an den Vorstand zu
richten." |
Vermietung von Räumen im Synagogengebäude und Spenden
der Gemeinde zur Unterstützung von Frauen und Kindern einberufener Soldaten
(1914)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 11. September 1914: "Koblenz, 4. September (1914). Der
Vorstand und die Repräsentanten der hiesigen Synagogengemeinde haben
beschlossen: Die unteren Räume des Synagogengebäudes, soweit dieselben
verfügbar sind, durch Vermittlung der Residenzstadt Koblenz für noch
näher zu bestimmende Zwecke den Frauenvereinen zur Verfügung zu stellen.
Gleichzeitig wurde einstimmig bewilligt: 500 Mark dem Roten Kreuz, 500
Mark dem Vaterländischen Frauenverein und 500 Mark dem Israelitischen
Frauenverein. Der letztere Betrag soll zur Speisung und Versorgung von
Frauen und Kindern, deren Ernährer zur Fahne einberufen sind, verwendet
werden." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 11. September 1914: "Koblenz, 4. September (1914). Der
Vorstand und die Repräsentanten der hiesigen Synagogengemeinde haben
beschlossen: Die unteren Räume des Synagogengebäudes, soweit dieselben
verfügbar sind, durch Vermittlung der Residenzstadt Koblenz für noch
näher zu bestimmende Zwecke den Frauenvereinen zur Verfügung zu stellen.
Gleichzeitig wurde einstimmig bewilligt: 500 Mark dem Roten Kreuz, 500
Mark dem Vaterländischen Frauenverein und 500 Mark dem Israelitischen
Frauenverein. Der letztere Betrag soll zur Speisung und Versorgung von
Frauen und Kindern, deren Ernährer zur Fahne einberufen sind, verwendet
werden." |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der Gemeinde
Erinnerung an die Auswanderungen im 19.
Jahrhundert - Grabstein für Ida Sussmann aus Koblenz in New
Orleans (gest. 1867)
Anmerkung: das Foto wurde von Rolf Hofmann (Stuttgart) im April 1994 im 1860
eröffneten Hebrew Rest Cemetery in New Orleans, 2100 Pelopidas at Frenchman
Street, near Elysian Fields and Gentilly Blvd.,
aufgenommen.
 Grabstein im "Hebrew Rest Cemetery" in New Orleans
für
Grabstein im "Hebrew Rest Cemetery" in New Orleans
für
"Ida Sussmann,
Born in Koblens Prussia
Died October 4th 1867
aged 19 years". |
Otto Jordan vermacht einen Betrag zu wohltätigen
Zwecken (1890)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16. Mai
1890: "Herr Otto Jordan aus Koblenz hat in seinem und im Namen
seiner Schwestern Frau Generalmajor Freifrau von Rössing und Frau
Regierungsrat Düesberg zum Andenken an den verstorbenen Vater, Herrn
Kommerzienrat Anton Jordan, dem Rabbiner Herrn Dr. Singer 500 Mark
überreicht, um sie zu wohltätigen Zwecken zu
verwenden."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16. Mai
1890: "Herr Otto Jordan aus Koblenz hat in seinem und im Namen
seiner Schwestern Frau Generalmajor Freifrau von Rössing und Frau
Regierungsrat Düesberg zum Andenken an den verstorbenen Vater, Herrn
Kommerzienrat Anton Jordan, dem Rabbiner Herrn Dr. Singer 500 Mark
überreicht, um sie zu wohltätigen Zwecken zu
verwenden." |
Carl Mayer wird zum mexikanischen Konsul ernannt (1892)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
28. Oktober 1892: "Herr Carl Mayer in Koblenz, Besitzer der
weltbekannten rührigen Kuvertfabrik M. Mayer daselbst, wurde zum
mexikanischen Konsul
ernannt." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
28. Oktober 1892: "Herr Carl Mayer in Koblenz, Besitzer der
weltbekannten rührigen Kuvertfabrik M. Mayer daselbst, wurde zum
mexikanischen Konsul
ernannt." |
50-jähriges Jubiläum von Justizrat Adolf Seligmann
als Jurist (1894)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
20. April 1894: "Justizrat Adolf Seligmann in Koblenz feierte
sein fünfzigjähriges Jubiläum als Jurist. Bei der Beglückwünschung
von Seiten der Justizbehörden und seiner Kollegen überreicht Herr
Landgerichts-Direktor Petry den dem Jubilar vom Kaiser verliehenen Roten
Adler-Orden vierter
Klasse." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
20. April 1894: "Justizrat Adolf Seligmann in Koblenz feierte
sein fünfzigjähriges Jubiläum als Jurist. Bei der Beglückwünschung
von Seiten der Justizbehörden und seiner Kollegen überreicht Herr
Landgerichts-Direktor Petry den dem Jubilar vom Kaiser verliehenen Roten
Adler-Orden vierter
Klasse." |
Zum Tod des langjährigen Gemeindevorstehers Leopold Salomon (1900)
Anmerkung:
der nachfolgende Abschnitt weist darauf hin, dass es Ende des 19. Jahrhunderts
zu starken Spannungen in der Gemeinde zwischen konservativen und reformerisch
gesinnten Kreisen gekommen ist, in die auch der Rabbiner sowie der verstorbene
Leopold Salomon hineingezogen worden sind. Der Abschnitt ist aus der kritischen
Sicht der konservativ-orthodoxen Zeitschrift "Der Israelit" geschrieben:
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juli 1900: "Koblenz,
18. Juli (1900). Eine jener Männer, die, wie die alten knorrigen Eichen,
Sturm und Wetter trotzen, Leute, mit den heute immer seltener werdenden
Eigenschaften: Charakter, treue und Frömmigkeit, wurde heute Morgen 5 Uhr
plötzlich in die Ewigkeit abberufen: Herr Leopold Salomon. Seit
Jahrzehnten im Vorstand der Gemeinde, an der Spitze eines der ersten
Handelshäuser der Stadt, hoch angesehen bei allen Konfessionen, stand der
Verblichene, ein bescheidener, und bei seiner Bescheidenheit umso höherer
Charakter, an der Schwelle der Jahre, die der Prophet als Zeitdauer des
menschlichen Lebens bezeichnet. Der Verstorbene – es ist traurig, dass
solches überhaupt erwähnenswert, in Koblenz jedoch, der Hochburg der
religiösen Indifferentismus, verdient das hervorgehoben zu werden –
versäumte nie einen Gottesdienst, bis in jüngster Zeit die skandalösen
Vorgänge in der Gemeinde, die sich auch auf den Gottesdienst verpflanzt
hatten, ihn mit den meisten der besseren Elemente von der Synagoge
fernhielt. Es wurde ihm damals eine Düpierung zuteil, die vom religiösen
wie menschlichen Standpunkte aus nicht leicht ihresgleichen finden dürfte.
Herr Salomon hatte aus Anlass der Vermählung seines jüngstens Kindes
einen kostbaren Vorhang für die heilige Lade gestiftet. Damals vertrat er
noch das Amt eines Repräsentanten-Vorstehers. Als bald darauf, nachdem
gewisse Elemente an die Spitze der Verwaltung gelangt und im Nu mit
Reformen bei der Hand waren, jener unselige Zwist aus Anlass der brutalen
und unrechtmäßigen Kündigung des Rabbiners in der Gemeinde ausbracht,
legte Herr Salomon, ein warmer Verteidiger des so grausam und unmenschlich
behandelten todkranken Mannes, nachdem er vergebens versucht, die Sache in
Güte und Frieden beizulegen, für seine humanen Bemühungen indess nur
Spott und Hohn seitens einiger jüngere rund dafür umso unreiferer
Kollegen in der Verwaltung geerntet, legte Herr Salomon sein Amt nieder.
Bald nachher erwachte in den Köpfen einiger jener Männer, die die unüberbrückbare
Kluft in der Gemeinde geschafften zu haben, sich rühmen dürfen, ein
merkwürdig ästhetisches Gefühl, mit dem der Anblick jenes Vorhanges
sich nicht vereinigen ließ. Man fasste den Beschluss den Vorhang
abzunehmen und ihn anders zu verwenden. Indes erfuhr Herr Salomon von dem
sauberen Plane und erbat sich mittels eingeschriebenen Briefes sein
Geschen zurück; und seinem Wunsche wurde willfahrt. So geschehen in
Koblenz mit einem Manne, unter dessen Ägide Friede und Ruhe in der
Gemeinde stets geherrscht, der nie Jemanden brüskiert, der allen ein
Wohltäter, Freund und Berater gewesen.
D Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juli 1900: "Koblenz,
18. Juli (1900). Eine jener Männer, die, wie die alten knorrigen Eichen,
Sturm und Wetter trotzen, Leute, mit den heute immer seltener werdenden
Eigenschaften: Charakter, treue und Frömmigkeit, wurde heute Morgen 5 Uhr
plötzlich in die Ewigkeit abberufen: Herr Leopold Salomon. Seit
Jahrzehnten im Vorstand der Gemeinde, an der Spitze eines der ersten
Handelshäuser der Stadt, hoch angesehen bei allen Konfessionen, stand der
Verblichene, ein bescheidener, und bei seiner Bescheidenheit umso höherer
Charakter, an der Schwelle der Jahre, die der Prophet als Zeitdauer des
menschlichen Lebens bezeichnet. Der Verstorbene – es ist traurig, dass
solches überhaupt erwähnenswert, in Koblenz jedoch, der Hochburg der
religiösen Indifferentismus, verdient das hervorgehoben zu werden –
versäumte nie einen Gottesdienst, bis in jüngster Zeit die skandalösen
Vorgänge in der Gemeinde, die sich auch auf den Gottesdienst verpflanzt
hatten, ihn mit den meisten der besseren Elemente von der Synagoge
fernhielt. Es wurde ihm damals eine Düpierung zuteil, die vom religiösen
wie menschlichen Standpunkte aus nicht leicht ihresgleichen finden dürfte.
Herr Salomon hatte aus Anlass der Vermählung seines jüngstens Kindes
einen kostbaren Vorhang für die heilige Lade gestiftet. Damals vertrat er
noch das Amt eines Repräsentanten-Vorstehers. Als bald darauf, nachdem
gewisse Elemente an die Spitze der Verwaltung gelangt und im Nu mit
Reformen bei der Hand waren, jener unselige Zwist aus Anlass der brutalen
und unrechtmäßigen Kündigung des Rabbiners in der Gemeinde ausbracht,
legte Herr Salomon, ein warmer Verteidiger des so grausam und unmenschlich
behandelten todkranken Mannes, nachdem er vergebens versucht, die Sache in
Güte und Frieden beizulegen, für seine humanen Bemühungen indess nur
Spott und Hohn seitens einiger jüngere rund dafür umso unreiferer
Kollegen in der Verwaltung geerntet, legte Herr Salomon sein Amt nieder.
Bald nachher erwachte in den Köpfen einiger jener Männer, die die unüberbrückbare
Kluft in der Gemeinde geschafften zu haben, sich rühmen dürfen, ein
merkwürdig ästhetisches Gefühl, mit dem der Anblick jenes Vorhanges
sich nicht vereinigen ließ. Man fasste den Beschluss den Vorhang
abzunehmen und ihn anders zu verwenden. Indes erfuhr Herr Salomon von dem
sauberen Plane und erbat sich mittels eingeschriebenen Briefes sein
Geschen zurück; und seinem Wunsche wurde willfahrt. So geschehen in
Koblenz mit einem Manne, unter dessen Ägide Friede und Ruhe in der
Gemeinde stets geherrscht, der nie Jemanden brüskiert, der allen ein
Wohltäter, Freund und Berater gewesen.
D
er traurige Verlust, den die Gemeinde erlitt, rief in mir die Erinnerung
jener skandalösen Affäre wieder wach. Mit dem Tode dieses Mannes, den
man übermorgen ins Grab senkt, geht die Erinnerung an die ihm angetane
Schmach in den Herzen seiner zahlreichen Freunde wieder frisch auf.
(Wir bemerken, dass wir persönlich den Verhältnissen in Koblenz ganz
fern stehen. Die Vorgänge dort entziehen sich unserer Beurteilung. Der
gegenwärtige Herr Korrespondent scheint auf einem anderen Standpunkte zu
stehen, wie der, der uns im vergangenen Jahre mit Berichten vom genannten
Platze versorgte. Redaktion des ‚Israelit’)." |
80. Geburtstag von Amalia Götz
(1901)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. März
1901: "Koblenz,
3. März (1901). In geradezu staunenswerter geistiger und körperlicher
Frische begeht heute das älteste und zugleich würdigste Mitglied unserer
Gemeinde seinen achtzigsten Geburtstag: Fräulein Amalia Götz, eine der
bekanntesten und beliebtesten Erscheinungen in unserer Stadt. Wenn je eine
Frau in Israel den Ehrennamen: Esches
Chajil – wackere Frau – verdiente, so ist es Fräulein Götz, die
die hohen Tugenden einer echten, wahrhaft frommen Jüdin mit dem Geiste
und der Bildung einer Rahel in sich vereinigt. Der Typus des echtesten
Patriziertums, in gleichem Maße angesehen und beliebt bei allen
Konfessionen, hat es niemals ein hehreres Beispiel selbstloser Aufopferung
und edelster Menschenliebe gegeben, als wie es die Jubilarin tagtäglich
gibt. Dabei ist sie von jenem echt jüdisch-frommen Geiste beseelt, der
die Dokumentierung wahrer Frömmigkeit nicht nur in öffentlichen
Demonstrationen erblickt. Bei Sturm und Regen ist die Hochbetagte stets
und ständig bei jedem Gottesdienste anwesend und folgt den Gebeten nicht
weniger, wie auch der Tora-Verlesung mit großem Interesse. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. März
1901: "Koblenz,
3. März (1901). In geradezu staunenswerter geistiger und körperlicher
Frische begeht heute das älteste und zugleich würdigste Mitglied unserer
Gemeinde seinen achtzigsten Geburtstag: Fräulein Amalia Götz, eine der
bekanntesten und beliebtesten Erscheinungen in unserer Stadt. Wenn je eine
Frau in Israel den Ehrennamen: Esches
Chajil – wackere Frau – verdiente, so ist es Fräulein Götz, die
die hohen Tugenden einer echten, wahrhaft frommen Jüdin mit dem Geiste
und der Bildung einer Rahel in sich vereinigt. Der Typus des echtesten
Patriziertums, in gleichem Maße angesehen und beliebt bei allen
Konfessionen, hat es niemals ein hehreres Beispiel selbstloser Aufopferung
und edelster Menschenliebe gegeben, als wie es die Jubilarin tagtäglich
gibt. Dabei ist sie von jenem echt jüdisch-frommen Geiste beseelt, der
die Dokumentierung wahrer Frömmigkeit nicht nur in öffentlichen
Demonstrationen erblickt. Bei Sturm und Regen ist die Hochbetagte stets
und ständig bei jedem Gottesdienste anwesend und folgt den Gebeten nicht
weniger, wie auch der Tora-Verlesung mit großem Interesse.
Aus tausenden Herzen steigen heute Glück- und Segenswünsche für den
weiteren Lebensabend der hoch verehrten Greisin zu des Höchsten Thron
empor. Und wenn die Jubilarin auch in rührender Bescheidenheit ihre
Verdienst zurückzuweisen sucht, so wissen wir doch, dass auf die gerade
das Dichterwort so recht passt: 'Wer den Besten seiner Zeit genug getan -
Der hat gelebt für alle Zeiten!' H.N." |
Kaufmann Ludwig Kirchheimer rettet ein Kind vor dem Ertrinken
(1912)
Anmerkung: der genannte Ludwig Kirchheimer ist
möglicherweise identisch mit dem im jüdischen Friedhof Koblenz beigesetzten
Ludwig Kirchheimer (geb. 26. April 1880, gest. 23. Juli 1913). Grabstein
online.
 Mitteilung im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 5.
Juli 1912: "Koblenz.
Der Kaufmann Ludwig Kirchheimer rettete mit Lebensgefahr aus den Fluten
des Rheins ein fünfjähriges Kind, das beim Spielen ins Wasser gestürzt
war." Mitteilung im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 5.
Juli 1912: "Koblenz.
Der Kaufmann Ludwig Kirchheimer rettete mit Lebensgefahr aus den Fluten
des Rheins ein fünfjähriges Kind, das beim Spielen ins Wasser gestürzt
war." |
Auszeichnung für den Geheimen Medizinalrat Dr. Salomon
(1914)
 Mittelung im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 10. Juli 1908: "Koblenz. Geheimer Medizinalrat Dr.
Salomon erhielt den Kronenorden 3. Klasse". Mittelung im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 10. Juli 1908: "Koblenz. Geheimer Medizinalrat Dr.
Salomon erhielt den Kronenorden 3. Klasse".
|
Kriegsauszeichnung für Oberarzt Alfred SInger, Sohn von Rabbiner Singer
(1916)
 Meldung
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2. Juni
1916: "Berlin.
Oberarzt Alfred Singer, Sohn des verstorbenen Koblenzer Rabbiners, erhielt
das Ritterkreuz des österreichischen Franz-Josef-Ordens." Meldung
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2. Juni
1916: "Berlin.
Oberarzt Alfred Singer, Sohn des verstorbenen Koblenzer Rabbiners, erhielt
das Ritterkreuz des österreichischen Franz-Josef-Ordens." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige von S.A. Friedberg (1874)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 31. März
1874: "Für ein
feines Geschäft, das an Sabbat und Festtagen geschlossen ist, wird ein
Ladenmädchen gesucht, das sich auch als Stütze der Hausfrau nützlich
machen kann. Nähere Auskunft erteilt auf frankierte Anfragen S.A.
Friedberg in Koblenz." Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 31. März
1874: "Für ein
feines Geschäft, das an Sabbat und Festtagen geschlossen ist, wird ein
Ladenmädchen gesucht, das sich auch als Stütze der Hausfrau nützlich
machen kann. Nähere Auskunft erteilt auf frankierte Anfragen S.A.
Friedberg in Koblenz." |
Anzeige der Weinhandlung Carl Th. Oehmen (1901)
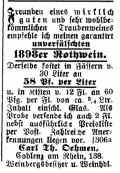 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. September 1901: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. September 1901:
"Freunden eines wirklich guten und sehr bekömmlichen Traubenweines
empfehle ich meinen garantiert unverfälschten 1898er Rotwein.
Derselbe kostet in Fässern von 30 Liter an 58 Pfennig per Liter und in
Kosten von 12 Flaschen an 60 Pfennig per Flasche von ca. 3/4 Liter Inhalt
einschließlich Glas. Als Probe versende ich auch 2 Flaschen nebst
ausführlicher Preisliste per Post. Zahlreiche Anerkennungen liegen
vor.
Carl Th. Oehmen, Koblenz am Rhein,
Weinbergsbesitzer und Weinhandlung." |
Anzeige des Herren-Garderobe- und Maßgeschäftes M. Gottschalk (1901)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 24. Dezember 1901:
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 24. Dezember 1901:
"Lehrling.
Für mein Herren-Garderobe- und Maßgeschäft suche einen Lehrling, mit
guter Schulbildung. Selbstgeschriebene Offerten an
M. Gottschalk, Koblenz." |
Anzeige des Hotels zur Traube (1904)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. März 1904: "Koblenz.
Hotel zur Traube. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. März 1904: "Koblenz.
Hotel zur Traube.
Besitzer: A. Flory
empfiehlt seinen prachtvollen, großen, neuen Saal sowie Neben-Säle, zur
Abhaltung von Festlichkeiten. Separate Einrichtung für
Hochzeitsfeierlichkeiten. - Streng rituelle Geschirre und Tafelservice
unter Aufsicht." |
Verlobungsanzeige von Else Dachauer und Alfred Bernd
(1924)
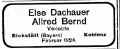 Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 13. März 1924:
Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 13. März 1924:
"Else Dachauer - Alfred Bernd. Verlobte.
Eichstätt (Bayern) Koblenz
Februar 1924." |
Gemeinde nach 1945
Veranstaltung der jüdischen Kultusgemeinde im März 1947
 Artikel
vom März 1947: "Koblenz.
Unter dem Motto 'Juden aller Länder vereinigt Euch' veranstaltete die
jüdische Kultusgemeinde Koblenz im März 1947 einen Ball, an dem leider
infolge der schlechten Witterung viele Gäste von auswärts nicht
teilnehmen konnten. Trotz allem brachte der Abend den
Gemeinde-Mitgliedern, sowie den Gästen einige Stunden gemütlichen
Beisammenseins. Besonders Beifall fand die Darbietung unserer Jüngsten,
die einen Bauerntanz (?) aufführten. Den Höhepunkt des Abends bildete
eine deutsche (?) sowie eine amerikanische Versteigerung zu Gunsten der jüdischen
Wohlfahrt. Alles in allem bildete der Abend einen vollen Erfolg für die
Veranstalter, was besonders in den anerkennenden Worten aller
Gemeindemitglieder und der eingeladenen Gäste zum Ausdruck kam." Artikel
vom März 1947: "Koblenz.
Unter dem Motto 'Juden aller Länder vereinigt Euch' veranstaltete die
jüdische Kultusgemeinde Koblenz im März 1947 einen Ball, an dem leider
infolge der schlechten Witterung viele Gäste von auswärts nicht
teilnehmen konnten. Trotz allem brachte der Abend den
Gemeinde-Mitgliedern, sowie den Gästen einige Stunden gemütlichen
Beisammenseins. Besonders Beifall fand die Darbietung unserer Jüngsten,
die einen Bauerntanz (?) aufführten. Den Höhepunkt des Abends bildete
eine deutsche (?) sowie eine amerikanische Versteigerung zu Gunsten der jüdischen
Wohlfahrt. Alles in allem bildete der Abend einen vollen Erfolg für die
Veranstalter, was besonders in den anerkennenden Worten aller
Gemeindemitglieder und der eingeladenen Gäste zum Ausdruck kam." |
Zur Geschichte des Betsaales / der Synagoge
Eine Synagoge wird im Mittelalter erst im 14.
Jahrhundert genannt (1367 juden schole, 1457 juden schule), doch
war eine solche beziehungsweise ein Betsaal vermutlich bereits im 11./12.
Jahrhundert vorhanden. 1367 heißt es von einem Haus in der Judengasse, dass in
einem "vor ziden eyne juden schole" ("vor Zeiten eine
Judenschule") war. Die Synagoge stand in der Judengasse, vermutlich
nahe der "Judenpforte" (Tor in der Stadtmauer). 1457 heißt es von
einem Haus, das zwischen der Judenpforte und der Judenschule stand. Die in der
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts erneuerte oder neu eingerichtete/gebaute
Synagoge wurde bei den Ausschreitungen gegen die Juden der Stadt 1531 zerstört.
Vermutlich wurde wenig später eine neue Synagoge errichtet beziehungsweise
eingerichtet.
Seit Anfang des 18. Jahrhunderts gab es wieder eine
Judenschule und eine Mikwe. Das Gebäude befand sich hinter den Häusern 539/40
in der Kleinen Judengasse (Balduinstraße). 1838 fand letztmals eine Reparatur
statt (Fenster erneuert). Diese alte Synagoge wurde bis zur Einweihung der
neuen Anfang 1851 benutzt. Ende der 1840-Jahre plante die Gemeinde den Bau einer
neuen Synagoge. Im Oktober 1847 erwarb die jüdische Gemeinde den
ehemaligen Adelssitz "Bürresheimer Hof" (den Corps des Logis)
am Florinsmarkt und richtete ihn 1848/50 als Synagoge her. Beim "Bürresheimer"
Hof handelte es sich um einen alten, um 1660 erbauten Adelshof.
Bericht über die Gemeinde - Planung der neuen Synagoge
(1848)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. April
1848: "Koblenz,
28. März (1848). Es ist bemerkenswert, dass das Ministerium Bodelschwingh
noch dem hiesigen israelitischen Prediger, Herrn Ben Israel, für seine Mühewaltung
um die Seelsorge der Gefangenen eine Gratifikation von 20 Talern bestimmt
hatte. – Auch hier ist eine sehr würdige Totenfeier gehalten worden. - Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. April
1848: "Koblenz,
28. März (1848). Es ist bemerkenswert, dass das Ministerium Bodelschwingh
noch dem hiesigen israelitischen Prediger, Herrn Ben Israel, für seine Mühewaltung
um die Seelsorge der Gefangenen eine Gratifikation von 20 Talern bestimmt
hatte. – Auch hier ist eine sehr würdige Totenfeier gehalten worden. -
Die Kultusangelegenheiten der Gemeinde sind in einer sehr erfreulichen
Entwicklung begriffen. Den Bestrebungen der Vorsteher Herrn M. Götz und
J. Engers ist es in Verbindung mit den Herren M. Feist, V. Bernays, M.
Seligmann und E. Abraham gelungen, die dem Bau
einer neuen Synagoge in nicht geringer Anzahl so lange
entgegenstehenden Hindernisse auf die befriedigendste Weise zu beseitigen
und alle Vorbereitungen zu treffen, die uns, wenn die politische Bewegung
keine Störung bring, künftigen Herbst schon ein, den Anforderungen der
Zeit in jeder Hinsicht entsprechendes Gotteshaus in Aussicht stellen. Dass
im Letzteren nur ein würdiger, wahrhaft erbaulicher Gottesdienst
abgehalten werden solle, wird von keinem Gemeindegliede in Zweifel
gezogen, weshalb es auch innigster Wunsch ist, dass das neue Gebetbuch
endlich einmal erscheinen möge." |
Der Umbau wurde durch den Königlichen Bau-Inspektor
Johann Claudius von Lassaulx geplant; es entstanden eine Synagoge sowie eine Religionsschule, zwei Krankenanstalten und
eine Dienstwohnung für den Rabbiner. Von Anfang an war in der Synagoge eine
Orgel. Wenige Monate nach der Einweihung sammelte die Gemeinde spontan das Geld
für ein größeres Instrument. Über die Einweihung der neuen Synagoge am
24. Januar 1851 liegen Berichte in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vor:
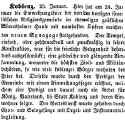 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. Februar 1851: Koblenz.
Hier hat am 24. Januar die Einweihungsfeier der von der dortigen israelitischen
Religionsgemeinde im ehemaligen gräflichen Bürresheimer Hause mit namhaften
Opfern errichteten neuen Synagoge stattgefunden. Der Tempel, einfach, aber
geschmackvoll und zweckmäßig in seiner Konstruktion, war für die feierliche
Gelegenheit besonders ausgeschmückt; eine zahlreiche und glänzende
Versammlung, worunter die höchsten Zivil und Militärbehörden, sowie viele
Koblenzer Bürger wohnten der Feier bei. Dieselbe wurde durch den Prediger der
Gemeinde mit einem Einweihungssegen eröffnet, welchem eine Predigt und darauf
noch ein Gebet für König, Vaterland, die Stadt Koblenz und deren Einwohner
folgte. Der Gottesdienst wurde gehoben durch Chor- und Sologesänge mit Orgel-
und Instrumentalbegleitung. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. Februar 1851: Koblenz.
Hier hat am 24. Januar die Einweihungsfeier der von der dortigen israelitischen
Religionsgemeinde im ehemaligen gräflichen Bürresheimer Hause mit namhaften
Opfern errichteten neuen Synagoge stattgefunden. Der Tempel, einfach, aber
geschmackvoll und zweckmäßig in seiner Konstruktion, war für die feierliche
Gelegenheit besonders ausgeschmückt; eine zahlreiche und glänzende
Versammlung, worunter die höchsten Zivil und Militärbehörden, sowie viele
Koblenzer Bürger wohnten der Feier bei. Dieselbe wurde durch den Prediger der
Gemeinde mit einem Einweihungssegen eröffnet, welchem eine Predigt und darauf
noch ein Gebet für König, Vaterland, die Stadt Koblenz und deren Einwohner
folgte. Der Gottesdienst wurde gehoben durch Chor- und Sologesänge mit Orgel-
und Instrumentalbegleitung. |
| |
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Februar 1851: Koblenz,
5. Februar. Am 24. vorigen Monats beging die hiesige israelitische
Religionsgemeinde das Fest der Einweihung ihrer neuen Synagoge. Sind derartige
Festlichkeiten im Allgemeinen auch überall dieselben, und daher ein Bericht
über solche eine undankbare Arbeit für den Referenten, so sind doch die
Verhältnisse, welche mit der Einweihung der neuen Synagoge in Verbindung
stehen, von so großer Bedeutung für unsere Gemeinde sowohl als für das
jüdische Interesse überhaupt, dass ein ausführlicher Bericht in diesem
vielgelesenen Blatte ganz an seinem Platze sein dürfte. Wir müssen es daher
zuerst als einen besonders glücklichen Zufall bezeichnen, dass es der Gemeinde
gelang, als Baustätte den größeren Teil des ehemals Gräflich von
Bürresheim-Renesse'schen Stammhauses an einem der schönsten, freien Plätze
hiesiger Stadt, zu akquirieren, indem die Lage des neuen Tempels im Gegensatze
zu jener der alten Synagoge, welche sich in einem versteckten Winkel einer
abgelegenen Straße befand, die durch göttliche Hilfe erlangte jetzige Stellung
der jüdischen Gemeinden scharf bezeichnet; aber auch in Bezug auf den in dem
neuen ebenso einfach als geschmackvoll und zweckmäßig erbauten Gotteshause
eingeführten Ritus dürfen wir uns zu einem gleichmäßig erhebenden
Fortschritte Glück wünschen. Es ist nämlich der angestrengtesten Tätigkeit
unseres würdigen Rabbinen und Predigers, Herrn Ben Israel, gelungen, dem
Gottesdienste seine Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Februar 1851: Koblenz,
5. Februar. Am 24. vorigen Monats beging die hiesige israelitische
Religionsgemeinde das Fest der Einweihung ihrer neuen Synagoge. Sind derartige
Festlichkeiten im Allgemeinen auch überall dieselben, und daher ein Bericht
über solche eine undankbare Arbeit für den Referenten, so sind doch die
Verhältnisse, welche mit der Einweihung der neuen Synagoge in Verbindung
stehen, von so großer Bedeutung für unsere Gemeinde sowohl als für das
jüdische Interesse überhaupt, dass ein ausführlicher Bericht in diesem
vielgelesenen Blatte ganz an seinem Platze sein dürfte. Wir müssen es daher
zuerst als einen besonders glücklichen Zufall bezeichnen, dass es der Gemeinde
gelang, als Baustätte den größeren Teil des ehemals Gräflich von
Bürresheim-Renesse'schen Stammhauses an einem der schönsten, freien Plätze
hiesiger Stadt, zu akquirieren, indem die Lage des neuen Tempels im Gegensatze
zu jener der alten Synagoge, welche sich in einem versteckten Winkel einer
abgelegenen Straße befand, die durch göttliche Hilfe erlangte jetzige Stellung
der jüdischen Gemeinden scharf bezeichnet; aber auch in Bezug auf den in dem
neuen ebenso einfach als geschmackvoll und zweckmäßig erbauten Gotteshause
eingeführten Ritus dürfen wir uns zu einem gleichmäßig erhebenden
Fortschritte Glück wünschen. Es ist nämlich der angestrengtesten Tätigkeit
unseres würdigen Rabbinen und Predigers, Herrn Ben Israel, gelungen, dem
Gottesdienste seine |
 ganze Würde und Reinheit wiederzugeben, und hat er es
zugleich durch das von ihm zusammengesetzte und eingeführte Gebetbuch möglich
gemacht, dass den religiösen Bedürfnissen sowohl der altgläubigen als auch
der freier denkenden Juden völlige Rechnung getragen wird, wodurch der Friede
in unserer Gemeinde auch nicht einen Augenblick gestört ward. In dem Vorworte
des erwähnten Gebetbuches spricht sich Herr Ben Israel darüber folgendermaßen
aus: ganze Würde und Reinheit wiederzugeben, und hat er es
zugleich durch das von ihm zusammengesetzte und eingeführte Gebetbuch möglich
gemacht, dass den religiösen Bedürfnissen sowohl der altgläubigen als auch
der freier denkenden Juden völlige Rechnung getragen wird, wodurch der Friede
in unserer Gemeinde auch nicht einen Augenblick gestört ward. In dem Vorworte
des erwähnten Gebetbuches spricht sich Herr Ben Israel darüber folgendermaßen
aus:
'Die aufgenommenen hebräischen Gebete wurden in der ursprünglichen, uns
überkommenen Fassung beibehalten, damit selbst der altgläubigste Israelit an
der Teilnahme unseres Gottesdienstes nicht behindert sei, sowie besonders
diejenigen Stücke, welche der Jude der Neuzeit nicht mit Überzeugung und
Innigkeit beten zu können glaubt, als stille Andacht bezeichnet worden, und
durch Hinzufügung der Übersetzung und neuer Gebete in deutscher Sprache auch
diesem hinlänglich die Möglichkeit gegeben ist, an der stillen Andacht auf
seine Weise sich zu beteiligen und das ihm Anstößige unberücksichtigt zu
lassen. Bei der Zusammenstellung vorliegender Gebete leitete mich der Gedanke,
dass der Friede und die Eintracht die größte Zierde einer Gemeinde seien, und
dass man, um den zu erhalten, einer jeden Überzeugung gerecht werden müsse.'
Und können wir daher nur wünschen, dass sich recht viele Gemeinden dieses
Gebetbuch ebenfalls aneignen, und dadurch der Friede in derselben ebenso wie bei
uns erhalten werden möge.
Die Feier selbst war eine sehr großartige und wurde durch die Teilnahme der
höchsten Zivil- und Militärbehörden der Rheinprovinz sowie sämtlicher
städtischer Behörden und vieler anderer Honoratioren bedeutend gehoben. Einen
tiefen Eindruck machte besonders die Festpredigt des Herrn Rabbinen, worin er
die Glaubens- und Pflichtenlehren der jüdischen Religion klar und scharf
entwickelte, um, wie der geehrte Redner hervorhob, die von so vielen
Nichtisraeliten noch gehegten Vorurteile gegen dieselbe zu entkräften, sowie
auch der Moment des Einstellens der Torarollen in die heilige Lade, und war es
ergreifend, die heilige Rührung zu beobachten, von welcher selbst die
altgläubigsten Gemeindemitglieder durchdringen wurden, als zum ersten male die
Gebete von einem gut eingeübten Chore und mit Orgelbegleitung in den Hallen des
neuen Tempels erschallten; alle Herzen |
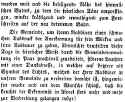 wurden weit und die beseligende Nähe des
himmlischen Vaters, zu dem die feierlichen Töne emporstiegen, winkte
kräftigend und ermutigend zum Fortschreiten auf der neu betretenen Bahn. wurden weit und die beseligende Nähe des
himmlischen Vaters, zu dem die feierlichen Töne emporstiegen, winkte
kräftigend und ermutigend zum Fortschreiten auf der neu betretenen Bahn.
Die Gemeinde, um ihrem Rabbinen einen schwachen Ausdruck der Anerkennung für
sein Wirken und seine Ausdauer zu geben, überreichte demselben dieser Tage in
feierlicher Weise durch die Gemeindeverwaltung ein paar prachtvoll gearbeitete,
silberne Leuchter mit einer Dankadresse, in welcher auf Letztere als Symbol des
Lichtes, welches der Herr Rabbiner in unserer Gemeinde zu verbreiten bemüht
ist, hingewiesen wurde und mit dem Wunsche schloss, dass die Leuchte der
Erkenntnis in Israel stets mehr und mehr zur Verbreitung gelangen möge. |
| |
| Neue Orgel |
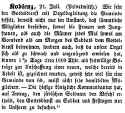 Artikel
in der Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. August 1851: "Koblenz, 21. Juli. Wie sehr der Gottesdienst mit Orgelbegleitung die Gemeinde
fesselt, beweist nicht nur der Umstand, dass sämtliche Mitglieder derselben,
sowohl die Frauen und Jungfrauen, als auch die Männer jedes Mal sowohl am
Vorabend als am Morgen des Sabbats dem Gottesdienst beiwohnen, sondern auch,
dass da unsere Orgel sich als zu schwach und ungenügend erwiesen hat, binnen 1
1/2 Tage circa 1.000 Taler als freiwillige Beiträge zur Anschaffung einer
neuen, welche bereits in Arbeit ist, gezeichnet wurden, gewiss sehr viel für
eine Gemeinde von 60, meist nicht sehr bemittelten Mitgliedern. - Die hiesige
königliche Kommandantur hat, auf Antrag, den jüdischen Soldaten den Befehl
erteilt, den Gottesdienst an Sabbat und Festtagen nur in Uniform zu
besuchen." Artikel
in der Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. August 1851: "Koblenz, 21. Juli. Wie sehr der Gottesdienst mit Orgelbegleitung die Gemeinde
fesselt, beweist nicht nur der Umstand, dass sämtliche Mitglieder derselben,
sowohl die Frauen und Jungfrauen, als auch die Männer jedes Mal sowohl am
Vorabend als am Morgen des Sabbats dem Gottesdienst beiwohnen, sondern auch,
dass da unsere Orgel sich als zu schwach und ungenügend erwiesen hat, binnen 1
1/2 Tage circa 1.000 Taler als freiwillige Beiträge zur Anschaffung einer
neuen, welche bereits in Arbeit ist, gezeichnet wurden, gewiss sehr viel für
eine Gemeinde von 60, meist nicht sehr bemittelten Mitgliedern. - Die hiesige
königliche Kommandantur hat, auf Antrag, den jüdischen Soldaten den Befehl
erteilt, den Gottesdienst an Sabbat und Festtagen nur in Uniform zu
besuchen." |
| |
| Reformen im gottesdienstlichen Leben
(1851) |
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. Oktober 1851:
"Koblenz, 13. Oktober (1851). Bei dem Fortschritte, den der jüdische
Religionskultus bei so vielen Gemeinden in neuerer Zeit gewonnen hat,
dürfte Ihnen, geehrter Herr Redakteur, ein Bericht über die Bestrebungen
der hiesigen israelitischen Gemeinden nicht ohne Interesse sein. Nach
festlicher Einweihung der hiesigen neuen Synagoge, welche bereits im Monat
Januar des laufenden Jahres stattfand, was die Aufgabe gestellt worden,
eine durchaus edlere Umgestaltung des Gottesdienstes zu schaffen, welche
mit Beibehaltung der, wesentlich im Geiste und in den Vorschriften der
jüdischen Religion liegenden gottesdienstlichen Gebräuchen,
hauptsächlich in folgenden Punkten eine zweckmäßige und die Andacht
belebende Reform herbeiführen sollte. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. Oktober 1851:
"Koblenz, 13. Oktober (1851). Bei dem Fortschritte, den der jüdische
Religionskultus bei so vielen Gemeinden in neuerer Zeit gewonnen hat,
dürfte Ihnen, geehrter Herr Redakteur, ein Bericht über die Bestrebungen
der hiesigen israelitischen Gemeinden nicht ohne Interesse sein. Nach
festlicher Einweihung der hiesigen neuen Synagoge, welche bereits im Monat
Januar des laufenden Jahres stattfand, was die Aufgabe gestellt worden,
eine durchaus edlere Umgestaltung des Gottesdienstes zu schaffen, welche
mit Beibehaltung der, wesentlich im Geiste und in den Vorschriften der
jüdischen Religion liegenden gottesdienstlichen Gebräuchen,
hauptsächlich in folgenden Punkten eine zweckmäßige und die Andacht
belebende Reform herbeiführen sollte.
1) Das Absingen der Litaneien des Vorsängers sollte sich nur auf das Nötigste
beschränken, und dieses nach vorhergegangener musikalischer Bearbeitung
der zu singenden Litaneien mit Begleitung der Orgel stattfinden.
2) Die Responsorien zwischen Vorbeter und Gemeinde sollten so lange von
einem unter Leitung des Organisten stehenden Sängerchore vertreten
werden, bis die Gemeinde durch vieles Hören allmählich imstande sein
würde, selbst respondieren zu können. Außerdem aber soll dieser
Sängerchor den Gottesdienst von Anfang bis zum Schluss bei allen
feierlichen Momenten durch den Vortrag entsprechender teil hebräischer,
teil deutscher vierstimmiger Gesänge verherrlichen.
Die größte Schwierigkeit bei Lösung dieses Problems stellte sich durch
den Anbau des musikalischen Rituals heraus, indem eine mit Orgelbegleitung
versehene Bearbeitung aller, sowohl für den gewöhnlichen Sabbatdienst
als für die sämtlichen Festtage des Jahres gehörenden Litaneien eine
viel umfassende Arbeit war, ebenso auch fast alle vierstimmigen Gesänge
besonders komponiert werden mussten, um vollkommen zweckdienlich zu
sein.
Wie glücklich die Lösung dieser Aufgabe gelungen ist, wie trefflich der
Sängerchor eingeübt ist, wie geläufig die schwierige Korrespondenz
zwischen Vorsänger und dem Organisten vonstatten geht, davon lieferte die
erhebende Gottesfeier während der verflossenen Festtage, des
Neujahrsfestes und Versöhnungsfestes, den schönsten Beweis. In allen
Räumen war die festlich geschmückte und erleuchtete Synagoge von einem
wahrhaft andächtigen Publikum gefüllt, in dessen Mitte sich auch eine
Mehrzahl von Christen befand, die der belebende Impuls des schönen, noch
durch Blasinstrumente verstärkten vierstimmigen Gesanges, sowie der Ruf,
welchen der hiesige Rabbiner, Herr Ben Israel, |
 als
vortrefflicher und hinreißender Kanzelredner besitzt, herbeigezogen
hatte. Referent dieser Zeilen, welcher diese Mehrzahl mit angehörte,
fühlte sich zu dem Bekenntnisse gedrungen, dass die Gottesfeier, der er
wiederholt beiwohnte, eine würdige und erhebende war, und allen
jüdischen Gemeinden zur regesten Nacheiferung empfohlen werden müsse. als
vortrefflicher und hinreißender Kanzelredner besitzt, herbeigezogen
hatte. Referent dieser Zeilen, welcher diese Mehrzahl mit angehörte,
fühlte sich zu dem Bekenntnisse gedrungen, dass die Gottesfeier, der er
wiederholt beiwohnte, eine würdige und erhebende war, und allen
jüdischen Gemeinden zur regesten Nacheiferung empfohlen werden müsse.
Schließlich knüpft sich hieran noch die Bemerkung, dass der Organist der
Gemeinde, Herr Musikdirektor Ebell, das musikalische Ritual in der vorhin
erwähnten Weise vollständig zum gottesdienstlichen Gebrauche geordnet
hat, und ebenso auch alle zur Gottesfeier nötigen vierstimmigen Gesänge
komponiert hat. Derselbe beabsichtigt später seine zweckdienlichen
Arbeiten zum Gebrauche aller jüdischen Gemeinden, welche einen ähnlichen
Gottesdienst einführen sollten, im Subskriptionswege herauszugeben, durch
dessen Beteiligung jede Gemeinde in musikalischer Hinsicht vollständig
versorgt sein würde. Ein unparteiischer Nichtisraelit." |
Ausgesprochen interessant ist ein Bericht vom Dezember 1854, aus dem man
erfährt, wie die Gottesdienst an Jom Kippur ("Großer
Versöhnungstag") in der Koblenzer Synagoge nach den durchgeführten
Gottesdienstreformen gestaltet wurden. Offenbar hatte Koblenz damals für
Reformkreise einer weiten Region (unter anderem wird Mannheim genannt) eine
Vorbildfunktion eingenommen.
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Dezember 1854:
"Während
eines kurzen Aufenthaltes in dem reizend gelegenen Koblenz wollte es der
günstige Zufall, dass ich an meiner Weiterreise verhindert, den Jom Kippur
("Großer Versöhnungstag") daselbst verlebte. Ich besuchte des Abends die
dortige Synagoge, die in ihrer einfachen und gefälligen Bauart viel Eleganz und
Pracht entfaltet und zeichnet sich namentliche die Fassade an der heiligen Lade,
zu der einige Stufen hinanführen, nebst der zur Seite befindlichen Kanzel,
vorteilhaft aus. – Der öffentliche Gottesdienst hatte noch nicht begonnen,
heilige Stille herrschte ringsherum; Männer und Frauen nicht durch Galerien,
Gitter und Vorhänge ängstlich voneinander geschieden, saßen in Andacht
versunken, da trat nach einigen Minuten der Rabbiner Ben Israel durch eine
Seitentür ein und in demselben Augenblick ließ die Orgel ihre hellen, mächtigen
Töne vernehmen und begleitete das ergreifende Lied: "O Tag des Herrn, du nahst,"
das von dem Chordirektor meisterhaft gesungen wurde. Deutsche und hebräische
Gebete folgten abwechselnd aufeinander und eine Predigt, worin der Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Dezember 1854:
"Während
eines kurzen Aufenthaltes in dem reizend gelegenen Koblenz wollte es der
günstige Zufall, dass ich an meiner Weiterreise verhindert, den Jom Kippur
("Großer Versöhnungstag") daselbst verlebte. Ich besuchte des Abends die
dortige Synagoge, die in ihrer einfachen und gefälligen Bauart viel Eleganz und
Pracht entfaltet und zeichnet sich namentliche die Fassade an der heiligen Lade,
zu der einige Stufen hinanführen, nebst der zur Seite befindlichen Kanzel,
vorteilhaft aus. – Der öffentliche Gottesdienst hatte noch nicht begonnen,
heilige Stille herrschte ringsherum; Männer und Frauen nicht durch Galerien,
Gitter und Vorhänge ängstlich voneinander geschieden, saßen in Andacht
versunken, da trat nach einigen Minuten der Rabbiner Ben Israel durch eine
Seitentür ein und in demselben Augenblick ließ die Orgel ihre hellen, mächtigen
Töne vernehmen und begleitete das ergreifende Lied: "O Tag des Herrn, du nahst,"
das von dem Chordirektor meisterhaft gesungen wurde. Deutsche und hebräische
Gebete folgten abwechselnd aufeinander und eine Predigt, worin der
|
 Rabbiner in
gediegenen und begeisternden Worten über die Bedeutung des Festes sprach,
leitete zuletzt auf die ... hin, mit der die schöne Feier endete. – Nicht
minder erhebend und zur Andacht stimmend verlief der folgende Tag. Den tiefsten
Eindruck machte jedoch neben der Awoda
(Gottesdienst) die Seelenfeier, die vor dem Mincha-Gebet
(Mittagsgebet) durch einen vierstimmigen Choral eingeleitet wurde, worauf der
Rabbiner wieder die Kanzel bestieg und die Frage erörterte: Wie ehrt man das
Andenken an die Verstorbenen. – Die Gemeinde erhob sich alsdann zu einem
stillen, inbrünstigen Gebet, kein Laut wurde vernommen, nur hier und da entwand
sich ein Seufzer der beklommenen Brust und leise spielte die Orgel einige
Trauermelodien dazu. – Fürwahr, diese Feier erinnert mich lebhaft an eine
Stelle Jean Pauls, die heißt: "Wenn der Geistliche die Herzen wie Altäre zur
Andacht einweihte, und dann sagte: nun wollen wir beten, darauf schwiege, die Hände
faltete, Haupt und Augen senkte und so mit ihm die ganze Gemeinde, und wenn in
dieser kurzen Innenfeier die Orgeltöne eines Chorals langsam gingen und
mitbeteten, - so wird es schwer sein, nicht zu beten oder nicht recht zu beten."
Und so war es auch dort. Die ganze Gemeinde war sichtlich ergriffen, sie fühlte
den Ernst, die Weihe der Stunde, es war eine rührende Stimmung. Ein Sologesang:
"Was ist der Mensch," recht innig vorgetragen, folgte ganz passend dem Gebet.
– Mit Beendigung des Neeila, nachdem
von dem Rabbiner in einem deutschen Schlussgebet nochmals unser
Glaubensbekenntnis, die Devise des Judentums, das "Höre Israel" gesprochen und
Chor und Gemeinde unter Orgelbegleitung die schöne Melodie des Schma
Jisrael und die so genannten Schmot
mit voller Kraft gesungen – endete auch der Tag des Herrn. – Ruhe, Anstand,
Würde, Andacht, verließ keinen Augenblick die Gläubigen, nichts störte den günstigen
Eindruck und wir mussten offen gestehen, einen solchen Gottesdienst haben wir
noch nirgends wieder gefunden. – Verwundert wird mancher Leser fragen, wie ist
es möglich, eine Gemeinde, die aus so verschiedenen Elementen besteht, den
ganzen Tag in andächtiger Stimmung zu erhalten? Und doch ist dem so. Mit
richtigem Kennerblick hat der Rabbiner zwischen den einzelnen Gebetabschnitten
Pausen von einer halben Stunde eingeführt und zwar um 11 Uhr nach Beendigung
des Schacharit (Morgengebet) und um 3
Uhr nach Beendigung des Mussaf-Gebetes.
Diese Pausen sind sowohl eine Erholung für den Kantor, der nicht durch einen
sogenannten Schacharit- oder Mincha-Chasen
(d.h. ein anderen Vorbeter, der diese Gebete übernimmt) abgelöst wird, sondern
von früh bis Abends mit Rabbiner in
gediegenen und begeisternden Worten über die Bedeutung des Festes sprach,
leitete zuletzt auf die ... hin, mit der die schöne Feier endete. – Nicht
minder erhebend und zur Andacht stimmend verlief der folgende Tag. Den tiefsten
Eindruck machte jedoch neben der Awoda
(Gottesdienst) die Seelenfeier, die vor dem Mincha-Gebet
(Mittagsgebet) durch einen vierstimmigen Choral eingeleitet wurde, worauf der
Rabbiner wieder die Kanzel bestieg und die Frage erörterte: Wie ehrt man das
Andenken an die Verstorbenen. – Die Gemeinde erhob sich alsdann zu einem
stillen, inbrünstigen Gebet, kein Laut wurde vernommen, nur hier und da entwand
sich ein Seufzer der beklommenen Brust und leise spielte die Orgel einige
Trauermelodien dazu. – Fürwahr, diese Feier erinnert mich lebhaft an eine
Stelle Jean Pauls, die heißt: "Wenn der Geistliche die Herzen wie Altäre zur
Andacht einweihte, und dann sagte: nun wollen wir beten, darauf schwiege, die Hände
faltete, Haupt und Augen senkte und so mit ihm die ganze Gemeinde, und wenn in
dieser kurzen Innenfeier die Orgeltöne eines Chorals langsam gingen und
mitbeteten, - so wird es schwer sein, nicht zu beten oder nicht recht zu beten."
Und so war es auch dort. Die ganze Gemeinde war sichtlich ergriffen, sie fühlte
den Ernst, die Weihe der Stunde, es war eine rührende Stimmung. Ein Sologesang:
"Was ist der Mensch," recht innig vorgetragen, folgte ganz passend dem Gebet.
– Mit Beendigung des Neeila, nachdem
von dem Rabbiner in einem deutschen Schlussgebet nochmals unser
Glaubensbekenntnis, die Devise des Judentums, das "Höre Israel" gesprochen und
Chor und Gemeinde unter Orgelbegleitung die schöne Melodie des Schma
Jisrael und die so genannten Schmot
mit voller Kraft gesungen – endete auch der Tag des Herrn. – Ruhe, Anstand,
Würde, Andacht, verließ keinen Augenblick die Gläubigen, nichts störte den günstigen
Eindruck und wir mussten offen gestehen, einen solchen Gottesdienst haben wir
noch nirgends wieder gefunden. – Verwundert wird mancher Leser fragen, wie ist
es möglich, eine Gemeinde, die aus so verschiedenen Elementen besteht, den
ganzen Tag in andächtiger Stimmung zu erhalten? Und doch ist dem so. Mit
richtigem Kennerblick hat der Rabbiner zwischen den einzelnen Gebetabschnitten
Pausen von einer halben Stunde eingeführt und zwar um 11 Uhr nach Beendigung
des Schacharit (Morgengebet) und um 3
Uhr nach Beendigung des Mussaf-Gebetes.
Diese Pausen sind sowohl eine Erholung für den Kantor, der nicht durch einen
sogenannten Schacharit- oder Mincha-Chasen
(d.h. ein anderen Vorbeter, der diese Gebete übernimmt) abgelöst wird, sondern
von früh bis Abends mit
|
 rühmenswerter Ausdauer seinen Funktionen vorsteht,
sowie für die Gemeinde selbst, die in dem ihr gehörenden Garten mit herrlicher
Aussicht auf die Mosel und Umgebung Gelegenheit hat, sich zu erfrischen und von
Neuem zu sammeln. Dadurch allein konnte dem fortwährenden Herein- und
Hinausgehen während des Gebetes, wie es leider noch an vielen Orten Sitte ist,
vorgebeugt werden. Dass die Einführung dieses geregelten und zeitgemäßen
Gottesdienstes dem Rabbiner nicht leicht geworden, dass er manchen schweren
Kampf zu bestehen hatte, kann man sich denken. Galt es ja bei dem Scheiden aus
der alten Synagoge, den alten Schlendrian mit seinen Unsitten zu verbannen und
zu vergessen, eine starre Orthodoxie mit ihrer steten Opposition zu belehren und
den Indifferenten, die nirgends fehlen, für die heilige Sache des Judentums
Interesse einzuflößen. Daher überragt auch die verhältnismäßig kleine
Anzahl dortiger Glaubensbrüder alle andern
größeren Gemeinden am Rhein, wie Düsseldorf, Bonn, Köln usw. Ja, an
letztgenanntem Orte musste sogar an Rosch
Haschana (Neujahrsfest) von der Polizei die Synagoge wegen Baufälligkeit
geschlossen werden! Welch ein trauriges Zeugnis für eine so reiche Gemeinde! rühmenswerter Ausdauer seinen Funktionen vorsteht,
sowie für die Gemeinde selbst, die in dem ihr gehörenden Garten mit herrlicher
Aussicht auf die Mosel und Umgebung Gelegenheit hat, sich zu erfrischen und von
Neuem zu sammeln. Dadurch allein konnte dem fortwährenden Herein- und
Hinausgehen während des Gebetes, wie es leider noch an vielen Orten Sitte ist,
vorgebeugt werden. Dass die Einführung dieses geregelten und zeitgemäßen
Gottesdienstes dem Rabbiner nicht leicht geworden, dass er manchen schweren
Kampf zu bestehen hatte, kann man sich denken. Galt es ja bei dem Scheiden aus
der alten Synagoge, den alten Schlendrian mit seinen Unsitten zu verbannen und
zu vergessen, eine starre Orthodoxie mit ihrer steten Opposition zu belehren und
den Indifferenten, die nirgends fehlen, für die heilige Sache des Judentums
Interesse einzuflößen. Daher überragt auch die verhältnismäßig kleine
Anzahl dortiger Glaubensbrüder alle andern
größeren Gemeinden am Rhein, wie Düsseldorf, Bonn, Köln usw. Ja, an
letztgenanntem Orte musste sogar an Rosch
Haschana (Neujahrsfest) von der Polizei die Synagoge wegen Baufälligkeit
geschlossen werden! Welch ein trauriges Zeugnis für eine so reiche Gemeinde!
Wohltuend und erfreulich für die Glaubensgenossenschaft zu Koblenz wird daher
gewiss die Anerkennung sein, die ihr bereits zuteil wurde. Verschiedene
Deputationen aus nah und fern, zuletzt die aus Mannheim mit ihrem Rabbiner an
der Spitze, beweisen dies zur Genüge. Sie waren alle gekommen, wie uns
berichtet, um den dortigen Gottesdienst als Norm für den ihrigen zu nehmen, und
waren voll des Lobes, nachdem sie demselben beigewohnt.
Zum Schluss möchte ich mir noch erlauben, den Verwaltungsrat auf einen Übelstand
aufmerksam zu machen, der sich mit geringen Opfern leicht beseitigen ließe. Ich
meine den schmalen Gang von der Treppe zum Haupteingang. Durch das Entfernen der
zwei anstoßenden Zimmer würde der Ganz in einen weiten, hellen Platz
umgewandelt und etwaigen Unglücksfällen sicher vorgebeugt werden.
|
Über die "Gottesdienstweise in der Synagoge zu
Koblenz" - Veröffentlichung von Rabbiner Dr. Ben Israel (1862)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Februar 1862:
"In J. Hölschers Verlag in Koblenz ist erschienen: Die
Gottesdienstweise in der Synagoge zu Koblenz, ausführlich darstellt
von Ben Israel, Rabbiner in Koblenz, 8. Preis geh. 6 Sgr. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Februar 1862:
"In J. Hölschers Verlag in Koblenz ist erschienen: Die
Gottesdienstweise in der Synagoge zu Koblenz, ausführlich darstellt
von Ben Israel, Rabbiner in Koblenz, 8. Preis geh. 6 Sgr.
Die als selbst vom talmudischen Standpunkte aus zulässig nachgewiesen
Reformen bei dem Gottesdienste in der Synagoge zu Koblenz sind - wie aus
diesem Schriftchen zu ersehen - für den Kultus vieler in- und
ausländischen Gemeinden, namentlich für den zu einer gewissen
Berühmtheit gelangten in Mannheim, zum Vorbild geworden. Die
Zweckmäßigkeit dieser Reform ist aber eben sowohl dadurch, als auch
durch eine mehr als zehnjährige Erfahrung hinlänglich konstatiert, und
es dürfte demnach bei allseitig sich kundgebendem Streben, dem jüdischen
Gottesdienste eine zeitgemäßere Gestaltung zu geben, die sämtliche der
Reform bedürftige Momente der jüdischen Gottesverehrung mit großer
Ausführlichkeit behandelnde Broschüre als ein schätzenswerter Führer
benutzt werden." |
1863/64 setzten trotz der zehn Jahre zuvor so
positiv beschriebenen Eindrücke aus dem gottesdienstlichen Leben Spannungen in der Gemeinde zwischen
orthodox und liberal geprägten Kreisen der Gemeinde ein. Sie entzündeten sich vor allem an der Person des liberalen Rabbiners Ben Israel. Im Laufe
der Jahre führten die Spannungen dazu, dass sich eine orthodoxe Gruppe der
Gemeinde abspaltete.
Widerstände in der Gemeinde gegen das liberal geprägte
gottesdienstliche Leben (1864)
 Artikel
in der (orthodoxen, gegenüber dem Gottesdienst in Koblenz kritisch
eingestellten) Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juni 1864:
"Koblenz, den 21. Juni (1864). Wenn auch gar manche
Erscheinung der Gegenwart auf religiösem Gebiete einen traurigen Eindruck
hervorruft, so ist es doch erfreulich, zu sehen, wie überall die
sogenannte jüdische Reform Fiasko macht; auch in unserer bisher wenig im
Rufe der Frömmigkeit stehenden Gemeinde fängt man an, zur Einsicht zu
kommen, wohin das Abgehen vom alten gebahnten Wege der Väter endlich
führen muss. Man möchte gern wieder umkehren, und diese Umkehr zum
Bessern zeigt sich bereits in einer Agitation gegen den Rabbiner Ben
Israel; unlängst brachten die jüdischen Blätter eine Anzeige, die eine
solche Agitation andeutete; aber noch andere Anzeichen sind da. So wurde
am vorigen Sabbat der Sohn eines Vorstandsmitglieder Bar Mizwah; der Vater
verschmähte es, denselben von Herrn Ben Israel konfirmieren zu lassen.
Statt dessen ließ er ihn in dem gegenüberliegenden Ehrenbreitstein die
Paraschah (Wochenabschnitt aus der Tora) lesen. Am selben Sabbat hielt
dort Herr Rabbinatskandidat Dr. Sulzbach aus Frankfurt am Main, bei der
fast die gesamte hiesige Gemeinde anwesend war. Die erwähnte Predigt hat
einen großartigen Eindruck hervorgerufen; man hat erkannt, dass das echte
Judentum auf soliderer Basis beruht, als die moderne Phraseologie. Herr
Dr. Sulzbach sprach warm und innig; man fühlte, dass seine Worte dem
Stempel der Wahrheit trugen, dass sie vom Herzen kamen, und bei allen
Anwesenden wurde die Sehnsucht rege, wiederum einen echten Lehrer unserer
göttlichen Religion den unsrigen nennen zu dürfen. - Schon in der
nächsten Zeit hoffe ich, Ihnen interessante Dinge von hier aus mitteilen
zu können." Artikel
in der (orthodoxen, gegenüber dem Gottesdienst in Koblenz kritisch
eingestellten) Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juni 1864:
"Koblenz, den 21. Juni (1864). Wenn auch gar manche
Erscheinung der Gegenwart auf religiösem Gebiete einen traurigen Eindruck
hervorruft, so ist es doch erfreulich, zu sehen, wie überall die
sogenannte jüdische Reform Fiasko macht; auch in unserer bisher wenig im
Rufe der Frömmigkeit stehenden Gemeinde fängt man an, zur Einsicht zu
kommen, wohin das Abgehen vom alten gebahnten Wege der Väter endlich
führen muss. Man möchte gern wieder umkehren, und diese Umkehr zum
Bessern zeigt sich bereits in einer Agitation gegen den Rabbiner Ben
Israel; unlängst brachten die jüdischen Blätter eine Anzeige, die eine
solche Agitation andeutete; aber noch andere Anzeichen sind da. So wurde
am vorigen Sabbat der Sohn eines Vorstandsmitglieder Bar Mizwah; der Vater
verschmähte es, denselben von Herrn Ben Israel konfirmieren zu lassen.
Statt dessen ließ er ihn in dem gegenüberliegenden Ehrenbreitstein die
Paraschah (Wochenabschnitt aus der Tora) lesen. Am selben Sabbat hielt
dort Herr Rabbinatskandidat Dr. Sulzbach aus Frankfurt am Main, bei der
fast die gesamte hiesige Gemeinde anwesend war. Die erwähnte Predigt hat
einen großartigen Eindruck hervorgerufen; man hat erkannt, dass das echte
Judentum auf soliderer Basis beruht, als die moderne Phraseologie. Herr
Dr. Sulzbach sprach warm und innig; man fühlte, dass seine Worte dem
Stempel der Wahrheit trugen, dass sie vom Herzen kamen, und bei allen
Anwesenden wurde die Sehnsucht rege, wiederum einen echten Lehrer unserer
göttlichen Religion den unsrigen nennen zu dürfen. - Schon in der
nächsten Zeit hoffe ich, Ihnen interessante Dinge von hier aus mitteilen
zu können." |
Die orthodoxe Gruppe feierte 1878 während der Woche
Privatgottesdienste in der Synagoge, bis ihr das 1884 von der Kultusgemeinde aus
verboten wurde.
Feier zum 25-jährigen Bestehen der Synagoge (1876)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. März 1876:
"Koblenz, 22. Februar (1876). Zur Erinnerung an die vor 25 Jahren
vollzogene Einweihung ihrer Synagoge und Einführung des reformierten
Gottesdienstes feierte die hiesige Gemeinde den letzten Sabbat, 24.
Schewet, in höchst solenner Weise. Der Gottesdienst am Vorabend und am
Morgen war ein durchaus festlicher und durch erhebende Gesänge
verherrlicht. Dieser Feier, an welcher die Gesamtgemeinde in gehobener und
freudiger Stimmung sich beteiligte, wohnten auch der Regierungspräsident
und Oberbürgermeister bei. In seiner Festrede hob der Rabbiner die
Befriedigung hervor, die er bei dem unerschütterten Bestande der neuen
Gottesdienstordnung empfinde, welche ihre segensreiche Kraft nun auch
dadurch erwiesen, dass nach einem Vierteljahrhundert ihrer Dauer, die
Liebe und der Eifer für sie in solch unzweideutiger Weise sich kund gebe.
Es war ein wahrer Fest- und Jubeltag für alle Mitglieder, die mit wenigen
Ausnahmen auch an dem Konzerte, Festessen und Ball teilnahmen, für welche
der Vorstand und die Repräsentanten eine namhafte Summe aus der
Gemeindekasse bewilligt hatten. Bei Gelegenheit dieser Feier wurde dem
Rabbiner, welchem die Gemeinde ihre geordneten, befriedigenden und sich
bewährt habenden Zustände verdankte, ein sehr wertvolles, silbernes
Kaffeeservice nebst einer Adresse überreicht, worin ihm Dank, Anerkennung
und die besten Wünsche für die Zukunft ausgesprochen werden." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. März 1876:
"Koblenz, 22. Februar (1876). Zur Erinnerung an die vor 25 Jahren
vollzogene Einweihung ihrer Synagoge und Einführung des reformierten
Gottesdienstes feierte die hiesige Gemeinde den letzten Sabbat, 24.
Schewet, in höchst solenner Weise. Der Gottesdienst am Vorabend und am
Morgen war ein durchaus festlicher und durch erhebende Gesänge
verherrlicht. Dieser Feier, an welcher die Gesamtgemeinde in gehobener und
freudiger Stimmung sich beteiligte, wohnten auch der Regierungspräsident
und Oberbürgermeister bei. In seiner Festrede hob der Rabbiner die
Befriedigung hervor, die er bei dem unerschütterten Bestande der neuen
Gottesdienstordnung empfinde, welche ihre segensreiche Kraft nun auch
dadurch erwiesen, dass nach einem Vierteljahrhundert ihrer Dauer, die
Liebe und der Eifer für sie in solch unzweideutiger Weise sich kund gebe.
Es war ein wahrer Fest- und Jubeltag für alle Mitglieder, die mit wenigen
Ausnahmen auch an dem Konzerte, Festessen und Ball teilnahmen, für welche
der Vorstand und die Repräsentanten eine namhafte Summe aus der
Gemeindekasse bewilligt hatten. Bei Gelegenheit dieser Feier wurde dem
Rabbiner, welchem die Gemeinde ihre geordneten, befriedigenden und sich
bewährt habenden Zustände verdankte, ein sehr wertvolles, silbernes
Kaffeeservice nebst einer Adresse überreicht, worin ihm Dank, Anerkennung
und die besten Wünsche für die Zukunft ausgesprochen werden." |
Der dreijährige Zyklus der Toralesungen wird
wieder abgeschafft (1892)
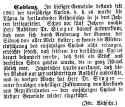 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. November 1892:
"Koblenz. In hiesiger Gemeinde bestand seit 1851 der dreijährige
Zyklus, d.h. es wurde die Tora in fortlaufender Reihenfolge in je drei
Jahren fertiggelesen. Schon vor fünf Jahren machte Herr Rabbiner Dr.
Singer darauf aufmerksam, dass man sich durch Änderung der Namen der
Sidros (Toraabschnitte) von aller Welt isoliere; er konnte die
Wiedereinführung des einjährigen Zyklus nicht erlangen, erreichte
jedoch, dass seitdem der dreijährige Zyklus derart behandelt wurde, dass
stets ein Stück aus derselben Sidra gelesen wurde, die in ganz Israel
üblich war. Inzwischen wurde anerkannt, dass dieser Modus zur zur
notdürftigen Aushilfe ausreichte, und in voriger Woche hat Herr Dr.
Singer - unter freudiger einhelliger Zustimmung von Vorstand und
Repräsentanten - den einjährigen Zyklus in hiesiger Gemeinde wieder
eingeführt. (Israelitische Wochenschrift)" Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. November 1892:
"Koblenz. In hiesiger Gemeinde bestand seit 1851 der dreijährige
Zyklus, d.h. es wurde die Tora in fortlaufender Reihenfolge in je drei
Jahren fertiggelesen. Schon vor fünf Jahren machte Herr Rabbiner Dr.
Singer darauf aufmerksam, dass man sich durch Änderung der Namen der
Sidros (Toraabschnitte) von aller Welt isoliere; er konnte die
Wiedereinführung des einjährigen Zyklus nicht erlangen, erreichte
jedoch, dass seitdem der dreijährige Zyklus derart behandelt wurde, dass
stets ein Stück aus derselben Sidra gelesen wurde, die in ganz Israel
üblich war. Inzwischen wurde anerkannt, dass dieser Modus zur zur
notdürftigen Aushilfe ausreichte, und in voriger Woche hat Herr Dr.
Singer - unter freudiger einhelliger Zustimmung von Vorstand und
Repräsentanten - den einjährigen Zyklus in hiesiger Gemeinde wieder
eingeführt. (Israelitische Wochenschrift)" |
50-jähriges Bestehen der Synagoge (1901)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Oktober 1901: "Koblenz,
8. Oktober (1901). Still, ohne Sang und Klang, wurde am vergangenen
Samstag das 50-jährige Bestehen der hiesigen Synagoge begangen, die am
24. Januar 1851 eröffnet wurde. Die Feier war auf Sukkoth verschoben
worden, da die Renovierung der Synagoge erst im Sommer beendet wurde. Von
der Feier, die in einer Art 'Erinnerungspredigt' bestand, kann man sagen:
'Verlegte Märkte werden schlecht gehalten'." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Oktober 1901: "Koblenz,
8. Oktober (1901). Still, ohne Sang und Klang, wurde am vergangenen
Samstag das 50-jährige Bestehen der hiesigen Synagoge begangen, die am
24. Januar 1851 eröffnet wurde. Die Feier war auf Sukkoth verschoben
worden, da die Renovierung der Synagoge erst im Sommer beendet wurde. Von
der Feier, die in einer Art 'Erinnerungspredigt' bestand, kann man sagen:
'Verlegte Märkte werden schlecht gehalten'." |
1923
wurde die Synagoge innen renoviert und erhielt einen
neuen Toraschrein.
Beim Novemberpogrom 1938, d.h. in der Nacht vom 9.
auf den 10. November 1938, wurde die Synagoge im Bürresheimer Hof von SA- und
SS-Leuten sowie der Gestapo zerstört. Angezündet wurde sie nicht. Es bestand
die Gefahr, dass ein Brand der Synagoge auf die benachbarten Gebäude übergreifen
könnte. Bei den Zerstörungsaktionen wurden der große Toraschrein, die Orgel,
die Kanzel, mehrere siebenarmige Leuchter, der Chanukka-Leuchter und vieles mehr
zerstört, das Mobiliar auf die Strasse geworfen. Das Gebäude blieb insgesamt
erhalten. Seit 16. Dezember 1938 war es im Besitz der Stadt. Ein Kaufpreis an
die jüdische Gemeinde wurde nicht gezahlt. Zunächst bestanden Pläne, im
Gebäude einen neuen Kindergarten unterzubringen, für den das
Stadtgestaltungsamt 1939 Pläne erstellt hatte. Mit Kriegsbeginn zog jedoch das
neue Wirtschaftsamt ein, das am 18. September 1939 hier seine Hauptstelle
eröffnete. Am 7. Januar 1941 zog auch das Ernährungsamt in die ehemalige
Synagoge.
Beim Bombenangriff auf die Stadt vom 22. April 1944 wurde das Gebäude zerstört, sodass
nur noch die Außenmauern blieben.
Nach 1945 stellte man den Bürresheimer
Hof in seiner barocken Form wieder her. Die Synagoge wurde nicht mehr
rekonstruiert. Der Bürresheimer Hof wurde nach 1970 von der Stadt Koblenz unter
anderem als Kinder- und Jugendbibliothek sowie als Mediothek genutzt. Im ersten
Stock – in einem separaten Raum – wurde 1986 ein Gedenkzimmer an die jüdischen
Familien und an die jüdische Kultur eingerichtet.
An der Fassade des Bürresheimer Hofes wurde von einem privaten Freundeskreis eine Gedenktafel
angebracht.
2013 stand das Gebäude des "Bürresheimer
Hofes" leer. Von Seiten der Stadt gab es Pläne, das Gebäude an einen
Investor zu verkaufen und im Bürresheimer Hof z.B. ein Institut für
nachhaltiges Wirtschaften und ein Gästehaus einzurichten. Die jüdische
Gemeinde hätte sich auch eine Rückkehr an ihren früheren Standort vorstellen
können. Doch
gab es hierzu von Seiten des Oberbürgermeisters, der Stadtverwaltung und des
Stadtrates kein Interesse. Noch 2013 verkaufte die Stadt Koblenz den
sanierungsbedürftigen Bürresheimer Hof gemeinsam mit dem Alten Kaufhaus, dem
Dreikönigenhaus und dem Schöffenhaus an einen Privatinvestor, der die Gebäude
sanieren und dann ein hochschulnahes Institut unterbringen wollte. Für den
Bürresheimer Hof mit seinem Galeriebau waren Gästewohnungen für auswärtige
Dozenten und eine gastronomische Nutzung vorgesehen. Die Umbaumaßnahmen wurden
2015 begonnen, 2019 jedoch unvollendet auf Grund von finanziellen
Schwierigkeiten des Investors auf Grund erheblicher Mehrkosten bei der Sicherung
der Substanz und des archäologischen Erbes eingestellt. Im Herbst 2019 wurde
überlegt, das Stadtarchiv im Bürresheimer Hof unterzubringen. https://de.wikipedia.org/wiki/Bürresheimer_Hof
Ereignisse des Gedenkens um die ehemalige
Synagoge - Pressemitteilungen der Jahre 1994-2001:
 |
19. August 1994: Zum zehnten Mal
halten sich in diesen Tagen auf Einladung der Christlich-Jüdischen
Gesellschaft für Brüderlichkeit 34 jüdische ehemalige Mitbürgerinnen und
Mitbürger in Koblenz auf. Bei einer Gedenkstunde in der Jugendbücherei im
Bürresheimer Hof (ehemalige Synagoge) erinnert Oberbürgermeister Hörter
an das Unrecht, das während der NS-Zeit an den Juden begangen wurde. |
 |
17. Oktober 1996: Ignatz
Bubis, Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, stellt mit
einer Autorenlesung in der ehemaligen Synagoge am Florinsmarkt seine
Autobiographie vor. |
 |
18. September 1997: Oberbürgermeister
Dr. Schulte-Wissermann begrüßt ehemalige jüdische Mitbürger, die in der
NS-Zeit aus Deutschland fliehen mussten und sich seit 20 Jahren zum ersten
Mal wieder in Koblenz aufhalten. Sie besichtigen unter anderem den
Gedenkraum in der ehemaligen Synagoge im Bürresheimer Hof. |
 |
28. September 2000: Das
Mittelrhein-Museum gibt zwei Bilder aus der ehemaligen Synagoge im Bürresheimer
Hof an ihre Eigentümerin, die Jüdische Kultusgemeinde, zurück. Die Gemälde
waren nach der Erstürmung der Synagoge in der "Reichskristallnacht"
am 9. November 1938 in den Besitz des städtischen Schlossmuseums gelangt.
Bei der Rückübereignung des Bürresheimer Hofs an die Jüdische Gemeinde
1947 vergaß man die Bilder. Sie wurden kürzlich bei den Vorbereitungen zur
Ausstellung "Inside out – Bilderspeicher Museum" wieder
entdeckt. Die Jüdische Gemeinde überlässt die Stücke dem
Mittelrhein-Museum als Leihgabe. |
 |
Samstag, 27. Januar 2001: Anlässlich
des heutigen Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus rufen
etliche Parteien, Gewerkschaften, Verbände und Organisationen für 13.30
Uhr zu einem Protestmarsch gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit
auf. Die Demonstration, an der sich rund 1.500 Menschen beteiligen, endet
mit einer Kundgebung vor dem Bürresheimer Hof am Florinsmarkt, der
ehemaligen Synagoge. Um 17 Uhr findet in der Elisabethkirche im Rauental ein
Gedenkgottesdienst mit christlich-jüdischem Gebet statt. |
 |
Vgl. weitere Presseberichte zur
Erinnerungsarbeit unten. |
Neue Synagoge nach 1945:
Die 1925 geweihte Trauerhalle auf dem
jüdischen Friedhof wurde beim Novemberpogrom 1938 gleichfalls
geschändet. Sie konnte jedoch wieder gerichtet werden, sodass in ihr bis zu den
Deportationen 1942 unter Aufsicht der Gestapo wieder Gottesdienst abgehalten werden konnten. 1947 wurde von der französischen Besatzung der Mittelteil
des Gebäudes als provisorischer Betsaal hergerichtet. Nach den Plänen des
jüdischen Architekten Helmut Goldschmidt aus Mayen erfolgte drei Jahre später
ein Neubau der Synagoge auf dem Friedhof. Das Richtfest wurde im April 1951
gefeiert; noch im selben oder im folgenden Jahr wurde das Gebäude eingeweiht. Weitere Umbauten
erfolgten in den folgenden Jahrzehnten, unter anderem durch Anbau eines
Gemeindesaals 1961/62. Dieser Betsaal in der Schlachthofstraße 5 wird bis heute als Mittelpunkt der
jüdischen Gemeinde in Koblenz benutzt.
Aktuell: Es gibt seit seit dem Zuzug
jüdischer Familien/Personen aus den GUS-Ländern in den 1990er-Jahren Überlegungen, eine
neue Synagoge in Koblenz zu erbauen. Zeitweise wurde - auch auf Wunsch der
jüdischen Gemeinde Koblenz - eine Rückkehr in den Bürresheimer Hof überlegt, doch wieder zurückgestellt (siehe Presse-Artikel
unten). Im August 2013 wurde der Reichensperger Platz als Standort einer
neuen Synagoge ins Gespräch gebracht (siehe Presse-Artikel
unten). Im Januar 2014 kam von Seiten der Verwaltung "grünes
Licht" für einen Neubau der Synagoge im Bereich der "Weißer
Gasse", genauer im "Weißergässer Dreieck" (siehe Presse-Artikel
unten). Dieser Standort kommt auf Grund der im weiteren Jahresverlauf 2014
vorgenommenen Untersuchungen für eine Bebauung mit einer Synagoge in Frage.
Für das Projekt werden Baukosten in Höhe von etwa sechs Millionen Euro
veranschlagt. Etwa ein Drittel davon muss die Gemeinde selbst aufbringen, Ein
Förderverein unterstützt die Gemeinde in ihrem Vorhaben. Im Sommer 2020 wird von
einer Grundsteinlegung für die neue Synagoge in 2021 ausgegangen.
Standorte der Synagogen:
 |
mittelalterliche Synagogen in der
Münzstraße (frühere Judengasse), später in der Balduinstraße (frühere
Kleine Judengasse) |
 |
Florinsmarkt 13 (Synagoge 1851 bis
1938) ("Bürresheimer Hof") |
 |
Schwerzstraße 14 beziehungsweise Schlachthofstraße
5 im Rauenthal (Synagoge nach 1945).
|
Fotos:
(wenn nicht anders angegeben: Fotos: sw-Fotos: Landesamt s.u. Lit. S.
214-218; Farbfotos:
Stadt Koblenz)
| Plan / Historische Fotos |
|
|
 |
 |
 |
Plan von Koblenz 1905: Mit der
Nr. "5"
ist die Synagoge am Fruchtmarkt
bezeichnet; die
Münzstraße markiert
die jüdische Ansiedlung im Mittelalter.
|
Jüdisches Gemeindezentrum mit
Synagoge im "Bürresheimer Hof"
(zwei Säle, in denen Gottesdienste
abgehalten wurden) und jüdische Schule,
Rabbiner- und
Hausmeisterwohnung |
Hofansicht der
ehemaligen
Synagoge
(vor 1923)
|
| |
| |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Fenster des Betsaales |
Renaissanceportal
im Innenhof mit dem Giebel und den beiden Gebotstafeln (um 1935) |
| |
|
Im Zweiten Weltkrieg |
Neue Fotos
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 18.8.2006) |
 |
 |
 |
Rechts: das ehemalige
Synagogengebäude -
ausgebrannt nach einem Bombenangriff
(1944/45, Quelle) |
Der Bürresheimer Hof, nach
1945 in der barocken Form aufgebaut.
Dadurch erinnert äußerlich - außer
der Gedenktafel - nichts
mehr
an die Synagoge |
| |
|
 |
 |
 |
Hinweistafel am Eingang zum
Bürresheimer Hof |
Gedenkraum für die jüdische
Gemeinde im Bürresheimer Hof |
| |
| |
|
 |
 |
 |
Das Gebäude wird
heute u.a.
als Bibliothek genutzt |
Gedenkraum für
die ehemalige jüdische Gemeinde, eingerichtet von
Schülern des
Staatlichen Hildagymnasiums Koblenz und Helene Thill |
| |
|
Die Synagoge in der ehemaligen Friedhofshalle
(Fotos obere Zeile: Archiv Thill; Farbfotos: Hahn, Aufnahmedatum 18.8.2006) |
|
 |
 |
 |
Fotos von einem jüdischen
Gottesdienst 1947 |
Die frühere Friedhofshalle -
1938-42 und nach 1945 Synagoge der jüdischen Gemeinde |
| |
| |
|
 |
 |
 |
Eingang zur Synagoge mit
Portalinschrift:
"Mein Haus soll ein Haus des Gebets für
alle
Völker genannt werden" |
Eingang zur Verwaltung der
Jüdischen Kultusgemeinde |
|
| |
| |
|
|
"Stolpersteine"
in Koblenz
(Fotos: Franz G. Bell, Kottenheim) |
 |
 |
| |
In
Koblenz wurden für die Umgekommenen der NS-Zeit mehrfach
"Stolpersteine" verlegt: im Januar 2007, November 2007, Januar
2009, Mai 2010 und August 2011. Oben: "Stolpersteine" für Jenny
Kahn geb. Salomon (1888) und Wilhelm Kahn (1879), beide in Sobibor
ermordet. Die oben abgebildeten Steine wurden am 27. Januar 2007 vor dem
Haus Rizzastraße 22 in Koblenz verlegt.
Weitere Informationen über http://mahnmal-koblenz.de/index.php/stolpersteine.html |
| |
|
|
Einzelne
Presseberichte
| Mai 2011:
Könnte aus dem "Bürresheimer Hof"
wieder das jüdische Gemeindezentrum werden? |
Artikel von Peter Karges in der "Rhein-Zeitung" vom 27. Mai 2011
(Artikel):
"Synagoge zurück in den Bürresheimer Hof? - Koblenz will Kosten nicht tragen.
Der Bürresheimer Hof am Florinsmarkt könnte in naher Zukunft zum Großteil leer stehen.
Denn nicht nur die Kinder- und Musikbibliothek wird mit der Fertigstellung des Kulturbaus auf dem Zentralplatz aus den oberen Etagen des 1660 errichteten Gebäudes verschwinden, sondern auch die Kammerspiele des Stadttheaters, die im Erdgeschoss des Bürresheimer Hofs ihr Domizil haben, sollen aufgegeben werden. Wird die Streichliste des Oberbürgermeisters umgesetzt, dann gibt es keine eigenen Inszenierungen des Stadttheaters mehr im Bürresheimer Hof. Nur noch Projekte des Kinder- und Jugendtheaters wären dann dort noch zu sehen..." |
| |
| September 2011:
Weitere "Stolpersteine" wurden in
Koblenz verlegt - inzwischen liegen 78 "Stolpersteine" in der
Stadt |
Artikel in der "Rhein-Zeitung" vom
1. September 2011 (Artikel):
"In Koblenz erinnern Pflasterstein-Gedenktafeln an Opfer des Holocausts
Koblenz – Sie sollen Steine des Anstoßes sein, bewusste Stolperfallen, die den Finger legen in eine schmerzhafte Wunde deutscher Geschichte, die niemals heilen wird und als Mahnung vor erneuter
'Infektion' mit dem nationalsozialistischen Bazillus auch bewusst niemals heilen soll: Die Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunter Demnig. Bundesweit verbaut Demnig seit einigen Jahren solche Stolpersteine vor Gebäuden, aus denen die Hitler-Schergen Juden, Sinti, Roma, Homosexuelle, Behinderte und politisch Andersdenkende in die Vernichtungslager deportierten. In Koblenz gibt es seit Samstag 78 solcher Stolpersteine, solcher Gedenkplatten, die Namen, Geburts- und Todestag der Nazi-Opfer zeigen..."
Wo in Koblenz Stolpersteine an das Schicksal von den Nazis verfolgter und ermordeter Menschen liegen, ist auf der Homepage des Vereins Mahnmal Koblenz unter
www.mahnmal-koblenz.de/index.php/stolpersteine.html
zu lesen. Hier finden sich auch kurze Informationen zu den Biografien der Opfer." |
| |
| Mai 2012:
Zum 90. Geburtstag von Dr. Heinz Kahn,
langjähriger Vorsitzender der jüdischen Kultusgemeinde Koblenz |
Pressemitteilung der Landesregierung
Rheinland-Pfalz vom 13. Mai 2012: "90. Geburtstag von Dr. Heinz Kahn.
Lebensweg ist geprägt durch Bekenntnis zur Menschlichkeit..."
Link
zum Artikel - Auch eingestellt
als pdf-Datei |
| |
| Februar 2013:
Im Bürresheimer Hof kann vermutlich nicht wieder
die Synagoge eingerichtet werden |
Artikel von Doris Schneider in der
"Rhein-Zeitung" vom 20. Februar 2013: "Alternative für Synagoge gesucht
Koblenz - Die jüdische Kultusgemeinde muss sich neu orientieren. Die Hoffnungen, wieder in die alte Synagoge einziehen zu können (in der zurzeit die Kinder- und Jugendbücherei und die Musikbibliothek ihren Platz haben), scheinen nach den jüngsten Plänen der Nutzung durch die Görlitz-Stiftung endgültig vom Tisch. Denn die Stiftung hat ein Nutzungskonzept vorgelegt, das alle drei frei werdenden Gebäude in der Altstadt beinhaltet (die RZ berichtete).
'Und da die Stadt ja wenig Geld hat und die Stiftung welches investieren würde, ist es sehr wahrscheinlich, dass nicht die Synagoge umgesetzt wird. Ich habe nur noch wenig Hoffnung, dass das klappen
wird', sagt Heinz Kahn, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Koblenz, die neben der Stadt alle umliegenden Landkreise umfasst.
Eine Hoffnung will er aber nicht aufgeben, nämlich die, dass es für die heutige Synagoge in der Schlachthofstraße doch noch irgendwann einen alternativen Standort geben wird.
'Denn dass die Synagoge unmittelbar neben dem jüdischen Friedhof ist, das dürfte ein einmaliger Fall
sein.' Das sei in der Religion grundsätzlich verboten, so Kahn. Umso größer waren die Hoffnungen der Gemeinde, als bekannt wurde, dass die alte Synagoge nach dem Umzug ihrer jetzigen Nutzer in den Kulturbau auf dem Zentralplatz einen neuen Nutzer suche. Die Kosten für eine Wiedereinrichtung der Gemeinde wären zu stemmen gewesen, ist Kahn überzeugt.
'Wir hatten schon Bund und Land um Zuschüsse gebeten, das sah gut aus', sagt er.
Nun, man könne es nicht ändern, ergänzt er ein bisschen resigniert. Die Stadt habe aber Zusagen gemacht, dass sie bei der Suche nach einem alternativen Standort helfen wolle.
'Zu meinen Lebzeiten glaube ich aber nicht mehr daran', so Kahn, der bald 91 wird." |
| |
| Juli 2013:
Artikel in der "Rhein-Zeitung" vom 22. Juli 2013: "Neue
Synagoge sollte Bürresheimer Hof ablösen. |
| |
August 2013:
Artikel in der "Rhein-Zeitung vom 22. August 2013: "Neue
Synagoge auf dem Reichensperger Platz in Koblenz?"
- auch als
pdf-Datei eingestellt. |
| |
September 2013:
Artikel von Claudia Keller in der Zeitschrift "Der Tagesspiegel"
vom 19. September 2013: "Streit um Synagoge: Zurück in die
Mitte"
Link
zum Artikel |
| |
| Oktober 2013:
Neue Ideen von Studenten der Hochschule
Koblenz |
Artikel in der "Rhein-Zeitung" vom
24. Oktober 2013: "Studenten in Koblenz planen neue Synagoge auf
Stadtbadareal.
Koblenz - Synagoge statt Stadtbad: Das Areal, auf dem in der Weißer Gasse noch das marode Hallenbad der Stadt Koblenz steht, wäre als
Gelände prädestiniert für ein neues jüdisches Gebetshaus und
Gemeindezentrum..."
Link
zum Artikel |
| |
| Januar/Februar 2014:
Ist ein geeignetes Grundstück für einen
Synagogenneubau gefunden ? |
Artikel von Reinhard Kallenbach in der
"Rhein-Zeitung" vom 15. Januar 2014: "Synagoge kann in Weißer Gasse in Koblenz gebaut werden
Koblenz - In der westlichen Altstadt kann es eigentlich nur noch aufwärts gehen: Die Anforderungen der Stadt an eine Bebauung des Stadtbadgeländes sind hoch, und es gibt sogar einen attraktiven Standort für eine neue Synagoge.
... die Stadt will der Jüdischen Kultusgemeinde ein attraktives Grundstück für den Bau einer neuen Synagoge zur Verfügung stellen - und zwar im
'Weißergässer Dreieck'. Das ist die große Rasenfläche an der Rampe zum Parkhaus. Hier kann nicht nur stadtbildprägend gebaut werden, es ist auch möglich, Sichtbezüge zum historischen Altstadtkern herzustellen und damit auch zum jüdischen Leben im Mittelalter.
Die Kultusgemeinde hat bereits signalisiert, dass sie mit dieser Lösung einverstanden ist, die einen weiteren Vorzug hat: Es besteht kein Zeitdruck; Konzeption und Finanzierung können sorgfältig vorbereitet werden, weil das Gelände komplett aus den bisherigen Planungen herausgenommen wird..."
Link
zum Artikel |
Artikel von Reinhard Kallenbach in der
"Rhein-Zeitung" vom 31. Januar 2014: "Gefährden Altlasten Standort für Synagoge in der Weißer Gasse in Koblenz?
Koblenz - Das noch unbebaute Rasendreieck in der Weißer Gasse wäre ein idealer Standort für eine Synagoge. Doch geht es bei den aktuellen Überlegungen um mehr als architektonische Fragen. Es besteht die Gefahr, dass auf dem Grundstück unangenehme und teure Überraschungen lauern..."
Link
zum Artikel |
Artikel von Doris Schneider in der "Rhein-Zeitung"vom
14. Februar 2014: "Synagoge in der Weißer Gasse in Koblenz: Bodenproben sind im Labor
Koblenz - Die Wiese in der Weißer Gasse, die als möglicher neuer Standort für die Synagoge im Gespräch ist, sieht aus, als wäre eine Horde Wildschweine darübergelaufen. Tatsächlich sind hier in den vergangenen Tagen Bodenproben entnommen worden..."
Link
zum Artikel |
| |
| Februar 2014:
Zum Tod von Dr. Heinz Kahn |
Artikel von Reinhard Kallenbach in der
"Rhein-Zeitung" vom 10. Februar 2014: "Holocaust-Zeitzeuge Heinz Kahn ist tot: Jüdische Kultusgemeinde trauert
Koblenz/Polch - Die Jüdische Kultusgemeinde trauert um Dr. Heinz Kahn. Der langjährige Vorsitzende der Jüdischen Kultusgemeinde Koblenz starb am Sonntag, 9. Februar, im Alter von 91 Jahren. Wie die Christlich-Jüdische Gesellschaft mitteilte, wird er am Mittwoch, 11. Februar, um 11.30 Uhr auf dem Friedhof in der Schwerzstraße beigesetzt..."
Link
zum Artikel |
| |
| März 2014:
Entwürfe / Ausstellung zur neuen Synagoge |
Artikel in glaubeaktuell.net vom 29. März
2014: "Eine neue Synagoge für Koblenz - Ausstellung zeigt Entwürfe
von Absolventen der Koblenzer Hochschule...
Link
zum Artikel derselbe
Artikel in bistum-trier.de Artikel
in der Rhein-Zeitung |
| |
| August 2014:
Eine weitere Entscheidung zur neuen Synagoge soll
bis zum Herbst 2014 fallen |
Pressemitteilung vom 9. August 2014 (aus
swr.de): "Entscheidung für neue Synagoge soll bis zum Herbst fallen
Der Förderverein für eine neue Synagoge rechnet damit, dass bis zum Herbst eine Entscheidung über einen möglichen Neubau in der Altstadt fällt. Die Koblenzer Stadtverwaltung prüft zurzeit, ob sich die Entwürfe eines Architekten am geplanten Standort umsetzen lassen. Der Vorsitzende des Fördervereins Neue Synagoge, Heribert Heinrich, weist aber darauf hin, dass auch noch die Finanzierung geklärt werden muss. Bei den Neubauten in Mainz, Worms, Bad Kreuznach und Speyer haben sich die Stadt, das Land und die jüdische Gemeinde die Kosten geteilt. Die Stadt Koblenz habe bereits signalisiert, dass sie bereit wäre, einen Teil mit zu übernehmen. Das Land Rheinland-Pfalz sagte jetzt zu, über die Förderung für eine neue Synagoge in Koblenz in der nächsten Haushaltssitzung zu beraten. Zurzeit nutzt die jüdische Gemeinde eine alte Trauerhalle auf ihrem Friedhof als Synagoge."
Link
zum Artikel |
| |
|
November 2014:
Wissenschaftliches Symposium zu
einer neuen Synagoge in Koblenz |
Artikel von Dipl.-Ing. (FH) Melanie
Dargel-Feils (Hochschule Koblenz) vom 24. November 2014: "Forum
Wissenschaft: Symposium 'Eine neue Synagoge für Koblenz'
Am Samstag, beschäftigte sich das Forum Wissenschaft - ein Zusammenschluss
der Universität Koblenz, der Hochschule Koblenz und der Volkshochschule
Koblenz - mit dem Thema 'Eine neue Synagoge für Koblenz'. Hierzu war Prof. Henner Herrmanns als Referent eingeladen. Gleich zu Anfang machte Prof.
Herrmanns deutlich, dass ein Synagogenbau mehr sei als eine Immobilie, denn
sie habe auch eine wichtige städtebauliche Funktion inne. Aus diesem Grund
müssten Synagogen Stadtbild prägend konzipiert sein, vor allem, wenn sich
das Grundstück – wie hier in Koblenz - in der Innenstadt befinde. So sei es
nicht nur für Mitglieder der Jüdischen Kultusgemeinde von Bedeutung, wie die
neue Synagoge in Koblenz gestaltet wird, sondern es gehe alle Koblenzer
Bürger und Bürgerinnen etwas an. Architektur stelle nämlich mehr dar als die
Erfüllung bestimmter Funktionen, mit dem Ziel größtmöglicher Einsparung und
Kostengünstigkeit. In diesem Zusammenhang warnte Prof. Herrmanns vor
falscher Bescheidenheit, die verheerende Folgen haben könnte, und zwar für
die nächsten Jahrzehnte. Er erörterte, dass gute Architektur das Streben
nach Ästhetik, nach Wohlbefinden und nach Kommunikation befriedigt und die
Befindlichkeit der Menschen, nicht nur die der Gemeindemitglieder,
beeinflusst. Nur so, bemerkte der Architekturprofessor, kann die
vielbeschworene urbane Identität erreicht werden.
Seine Aussagen konkretisierte er anhand der von ihm betreuten studentischen
Entwürfe zum Thema 'Eine neue Synagoge für Koblenz'. Zusätzlich erläuterten
die beiden Studentinnen Kristina Bozic und Sehriban Cakir ihre
Entwurfsarbeiten. Alle Entwürfe könnten als ästhetische und städtebauliche
Orientierungsgrundlage für weitere Planungsschritte angesehen werden. Dass
gute Architektur für eine Stadt ein Wert an sich ist, zeigte im Anschluss
die Architektin Eva-Maria Klöckner MA, Assistentin am Fachbereich Bauwesen,
anhand von realisierten Synagogen-Komplexen. Denn in vielen Städten der
Bundesrepublik Deutschland sind nach dem II. Weltkrieg bemerkenswerte
Synagogen neu erbaut worden, die u. a. auch die Forderungen nach
Stadtentwicklungsimpulsen, Repräsentation, Touristenattraktion und
Integrationsmedium erfüllen. Prof. Herrmanns plädierte zum Abschluss nochmal
für die Ausschreibung eines Architektenwettbewerbs, um für dieses wichtige
Bauvorhaben die bestmögliche Lösung zu erhalten. Weitere Informationen:
http://www.hs-koblenz.de"
Link zum Artikel
|
| |
| Januar 2015:
Die Pläne für eine neue Synagoge werden
konkreter |
Artikel von Reinhard Kallenbach in der
"Rhein-Zeitung" vom 2. Januar 2015: "Neue Synagoge in Koblenz: Projekt nimmt Konturen an.
Koblenz. Noch im Januar könnten entscheidende Etappen auf dem Weg zum Bau einer neuen Synagoge in der Weißer Gasse gemeistert werden. In Mainz stehen wichtige Gespräche über die Zuschüsse bevor. Und auch seitens der Stadt wird Geld fließen.
Im nicht öffentlichen Teil seiner letzten Sitzung vor den Weihnachtsferien hat sich der Rat mit großer Mehrheit nicht nur für eine Bezuschussung des Projektes ausgesprochen, sondern auch konkrete Zahlen genannt. Wie Joachim Hofmann-Göttig im Telefonat mit unserer Zeitung erklärte, ist die Entscheidung wiederum Grundlage für weitere Berechnungen auf Landesebene. Vor diesem Hintergrund möchte der Oberbürgermeister die Höhe des städtischen Zuschusses noch nicht nennen.
Endgültig gelöst ist dagegen bereits die Standortfrage. Hofmann-Göttig weist darauf hin, dass die Stadt der Jüdischen Kultusgemeinde ursprünglich zehn mögliche Standorte für einen Neubau genannt hatte, wobei das Areal in der Weißer Gasse am Ende eindeutiger Favorit war. "Das Grundstück kann bebaut werden", so der Stadtchef wörtlich. Danach sah es ursprünglich nicht unbedingt aus, weil Experten mit hohen Altlasten und einer entsprechend teuren Entsorgung rechneten..."
Link
zum Artikel |
| |
|
Juli 2015:
Hoffnung auf einen baldigen Bau
einer neuen Synagoge - Eröffnung schon 2017/18 ? |
Pressemitteilung dpa vom 11. Juli 2015:
"Neue Synagoge in Koblenz geplant. 77 Jahre nach der Zerstörung der
Koblenzer Synagoge durch die Nazis plant die örtliche jüdische
Kultusgemeinde einen Neubau.
'Es soll kein Prachtbau sein, aber größer als die jetzige Notlösung', sagte
der Vorsitzende des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden von
Rheinland-Pfalz, Avadislav Avadiev, der Deutschen Presse-Agentur. Laut
Stadtverwaltung könnte die Synagoge 2017 oder 2018 ihre Pforten öffnen. Die
erste grobe Finanzplanung sehe Gesamtkosten von sechs Millionen Euro vor.
Das Land Rheinland-Pfalz habe zwei Millionen Euro zugesagt und die Stadt
Koblenz bis zu 1,5 Millionen Euro. Demnach verblieben für die jüdische
Kultusgemeinde 2,5 Millionen Euro." |
| |
| März 2017:
Benefizkonzert für neue Synagoge |
Artikel in swr-aktuell vom 24.3.2017: "Koblenz Benefizkonzert für neue Synagoge
Mit einem Benefizkonzert wollen Unterstützer der jüdischen Gemeinde Koblenz Geld für den Bau der neuen Synagoge sammeln. Im Görreshaus spielt heute Abend die New Yorker Pianistin Nina Tichmann. Der Erlös des Konzerts soll der jüdischen Gemeinde in Koblenz zukommen. Sie ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, hat mehr 1.000 aktive Mitglieder - aber keine Synagoge. Vor zwei Jahren gab die Stadt grünes Licht, für einen Neubau in der Altstadt. Baukosten: rund sechs Millionen Euro. Etwa ein Drittel davon muss die finanzschwache Gemeinde selbst aufbringen. Hilfe bekommt sie dabei von einem Förderverein. Doch bis jetzt ist noch nicht viel Geld zusammengekommen. Das soll sich nun ändern. Das Klavierkonzert heute Abend um 19.30 Uhr ist der Startschuss, weitere Benefiz-Konzerte sind geplant - zum Beispiel mit dem Koblenzer Musiker Django Reinhard."
Link
zum Artikel |
| |
|
November 2017:
Gedenken an den Novemberpogrom
1938 |
Pressemitteilung der Christlich-jüdischen
Gesellschaft in "Blick aktuell" vom 16. November 2017:
"Jüdisch-Christliche Gedenkfeier in Koblenz. 'Um Gottes Willen - keine
Gewalt im Namen Gottes'
Feierstunde im Gemeindesaal der Synagoge anlässlich des 78. Jahrestages der
Reichspogromnacht
Koblenz. Avi Avadiev, Vorsitzender der Jüdischen Kultusgemeinde und
jüdischer Vorsitzender der Christlich-Jüdischen Gesellschaft Koblenz,
begrüßte die sehr zahlreichen Gäste der Feierstunde anlässlich des 78.
Jahrestages der Reichspogromnacht im Gemeindesaal der Synagoge Koblenz. Für
die Christlich-Jüdische Gesellschaft Koblenz begrüßte Vorstandsmitglied
Prof. Dr. Pater Alban Rüttenauer. Er zitierte den jüdischen Journalisten
Günter Bernd Ginzel: 'Was wäre gewesen, wenn in der Pogromnacht die
christlichen Kirchen Sturm geläutet hätten, um zum Widerstand und Protest
aufzurufen' - 'In Koblenz kann man es sich gut vorstellen: Die ehemalige
Synagoge im Bürresheimer Hof lag und liegt in direkter Nachbarschaft zur
Florinskirche und zur Liebfrauenkirche. Was wäre hier möglich gewesen! Doch
es kam leider anders. Heute erinnern wir uns, um in Gegenwart und Zukunft
Solidarität zu zeigen'. Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, Oberbürgermeister
der Stadt Koblenz, betonte in seinem Grußwort, dass er sich darüber freue,
die Schirmherrschaft über den Bau einer neuen Synagoge in Koblenz übernommen
zu haben. Nach der hebräischen und deutschen biblischen Lesung durch
Rabbiner Efraim Yehoud-Desel und Pastoralreferentin Jutta Lehnert, vertiefte
diese den Text. Ihr Fazit: 'Mit unseren Worten - vor allem den öffentlich
gesprochenen und geschriebenen - müssen wir vorsichtig umgehen. Jedes Wort,
das wir reden, wandelt die Welt und greift ein in die Psyche der Menschen.
Das gilt für das unduldsame oder giftige Wort einer Mutter, das sich in die
Seele eines Kindes einnisten kann genauso wie für die Hasstiraden von
politisch Extremen im Internet oder auf den Straßen.'
Kranz am Mahnmal niedergelegt. Gebete und Segen auf Hebräisch und
Deutsch sprach und sang Kantor und Rabbiner Efraim Yehoud-Desel, die sehr
stimmungsvolle und musikalisch ausgezeichnete Umrahmung gestalteten Elke
Schäfgen (Klavier) und Judit Schlenzig (Flöte). Besonders beim letzten Stück
'Yerushalayim shel zahav Jerusalem von Gold' hörte man beim Refrain viele
Stimmen, die mitsangen. Zum Abschluss der Feier legte Oberbürgermeister
Hofmann-Göttig einen Kranz am Mahnmal für die sechs Millionen ermordeten
Juden auf dem jüdischen Friedhof nieder. Rabbiner Yehoud-Desel intonierte
die beiden Gebete 'El male rachamim' (Gedenken an die Opfer der Shoa) und 'Kaddisch'
(Totengedenken)."
Link zum Artikel |
| |
|
August 2018:
Ehemalige jüdische Koblenzer und
Nachkommen zu Besuch in der Stadt |
Artikel in der "Rhein-Zeitung" vom 20.
August 2018: "Koblenz. Zu Besuch in der alten Heimat. Die
Christlich-Jüdische Gesellschaft für Brüderlichkeit Koblenz hat ehemalige
jüdische Mitbürger aus dem Raum Koblenz eingeladen. Dank der Unterstützung
vieler Förderer konnte erneut eine Reihe von Veranstaltungen angeboten
werden..."
Link zum Artikel |
| |
|
November 2018:
Schülerinnen und Schüler
übernehmen die Patenschaft für "Stolpersteine" |
Artikel in "Blick aktuell" vom 20. November
2018: "Stadt Koblenz. Schüler übernehmen für 57 Stolpersteine
Patenschaften
Koblenz. Auf Initiative von Kultur- und Schuldezernentin Dr. Margit
Theis-Scholz, unterstützt durch die Christliche-Jüdische Gesellschaft
Koblenz und den Förderverein Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus
in Koblenz haben zwölf Koblenzer Schulen Patenschaften für Stolpersteine
übernommen. Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig.
Mit den im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln soll an das Schicksal der
einst in den jeweiligen Häusern und Wohnungen lebenden und dann in der Zeit
des Nationalsozialismus verfolgten, vertriebenen oder getöteten Mitbürgern
jüdischen Glaubens erinnert werden. Die Schulen nehmen nun an einem durch
das Bildungsbüro der Stadtverwaltung Koblenz (Kultur- und
Schulverwaltungsamt) organisierten jährlichen Aktionstag in Erinnerung an
die Reichspogromnacht am 9. November teil. Die Schüler machen hierbei eine
symbolische Reinigung der in der Nähe ihrer Schule verlegten Stolpersteine.
Die Übergabe der entsprechenden Reinigungssets an die teilnehmenden Schulen
erfolgte durch Kultur- und Schuldezernentin Dr. Theis-Scholz im Rathaus. Mit
den Sets ausgestattet wurden die Grundschule Arenberg, die Grundschule
Freiherr-vom-Stein, die Grundschule Güls, die Grundschule Immendorf, die
Grundschule Pfaffendorf, die Grundschule Schenkendorf, das Hilda-Gymnasium,
die Integrierte Gesamtschule Koblenz, die Clemens-Brentano-/Overberg-Realschule
plus Koblenz, die Diesterweg-Schule, das Bischöfliche Cusanus-Gymnasium und
die Dr. Zimmermannsche Wirtschaftsschule. Im Rahmen dieser Übergabe
zeichnete Dr. Jürgen Schumacher, der Vorsitzende des Fördervereins Mahnmal
Koblenz, den anwesenden Schülern die Ereignisse um die Novemberpogrome 1938
in Koblenz nach. Walter Baum von der Carl-Benz-Schule berichtete über die
Patenschaft für 14 Stolpersteine, die im Rahmen des fächerübergreifenden
Unterrichts aus dem Bereich der Berufsfachschule und des
Berufsvorbereitungsjahrs bereits besteht. Im Anschluss an die Übergabe der
Reinigungssets wurden Schüler der Clemens-Brentano-/Overberg-Realschule plus
Koblenz zur symbolischen Reinigung der Stolpersteine an der Liebfrauenkirche
11 begleitet. Kultur- und Schuldezernentin Dr. Theis-Scholz erachtet einen
solchen Aktionstag als wichtigen Beitrag für eine lebendige
Erinnerungskultur und hofft, die Patenschaften im kommenden Jahr noch auf
weitere Schulen ausweiten zu können. Sie bedankte sich besonders bei der
Christlich-Jüdischen Gesellschaft Koblenz für die Dokumentation zu den
schicksalhaften Opferbiografien, welche die Schulen entsprechend in den
Unterricht integrieren können. Die Stolpersteinpatenschaften werden vom
Bildungsbüro Koblenz koordiniert. Das Bildungsbüro Koblenz wurde im Jahr
2017 mit Unterstützung von Fördermitteln des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung gegründet. Als Koordinierungsstelle für Bildungsfragen
arbeitet das Bildungsbüro Koblenz primär an der Vernetzung von
Bildungsangeboten und Bildungsakteuren in Koblenz."
Link zum Artikel |
| |
|
September 2019:
35. Heimatbesuch früherer
Koblenzerinnen und Koblenzer |
Pressemitteilung Stadt Koblenz vom
September 2019: "35. Heimatbesuch früherer Koblenzerinnen und Koblenzer.
Rege Kontakte pflegen. Gäste aus Israel, den USA und Deutschland wurden
durch die Kulturdezernentin begrüßt
Koblenz. In Vertretung des Oberbürgermeisters der Stadt Koblenz,
David Langner, begrüßte die Kultur- und Bildungsdezernentin Dr. Margit
Theis-Scholz die Gäste des Heimatbesuchs aus Israel, aus den USA und aus
Deutschland persönlich. In ihrer Begrüßungsansprache ging sie darauf ein,
dass die früheren Koblenzerinnen und Koblenzer sowie deren Angehörige
vertrieben, respektlos behandelt wurden und aufgrund der Ausreise und Flucht
in andere Länder als Kind unter widrigsten Bedingungen ein neues Zuhause
suchen mussten. Familien wurden ausgelöscht, es bestanden in den
allermeisten Fällen existenzielle Nöte, und viele Schicksalsschläge mussten
bewältigt werden.
Unrecht kann nicht ungeschehen gemacht werden. Margit Theis-Scholz
betonte, dass man das Unrecht nicht ungeschehen machen könne, aber die Stadt
Koblenz sehr viel Wert auf eine gute Willkommenskultur lege und dass man
froh sei, solch rege Kontakte mit den heute Lebenden zu pflegen. In Koblenz
existieren bereits zahlreiche Initiativen, Verbände, Vereine und
Institutionen, wie unter anderem der Förderverein Mahnmal Koblenz, die
Christlich-Jüdische Gesellschaft, der Freundschaftskreis Koblenz – Petah
Tikva, aber auch die Kirchen, die sich intensiv mit der Gedenkarbeit
innerhalb der Erinnerungskultur auseinandersetzen. Das Kultur- und
Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz hat ein regelmäßiges Netzwerktreffen
zur Erinnerungskultur ins Leben gerufen und beteiligt sich auch aktiv an der
Vertiefung der Erinnerungskultur und der Gestaltung von Gedenkfeiern in der
Stadt.
15 Schulen mit Patenschaften für Stolpersteine. Dr. Theis-Scholz
führte aus, dass in Koblenz bereits 15 Schulen Patenschaften für die
Stolpersteine übernommen haben, die im Stadtgebiet für die Opfer des
Nationalsozialismus verlegt wurden. Jährlich findet hierzu ein Treffen mit
den Schulen statt, die sich mit den jeweiligen Opferbiografien beschäftigen
und sich bereit erklärt haben, die über 120 Stolpersteine in Koblenz zu
pflegen. Außerdem arbeitet man an der Entwicklung einer App, die über die
Biografien der Opfer des Nationalsozialismus informiert und so das Gedenken
der Opfer in einer modernen Form erfahrbar macht. Dr. Theis-Scholz dankte
allen, die sich in der Gedenkarbeit engagieren und so die Erinnerung an die
Opfer und die Geschehnisse in der Zeit des Nationalsozialismus wach halten.
Bei der Verabschiedung wünschte sie allen einen angenehmen Aufenthalt in
Koblenz, einen anregenden Gesprächsaustausch und ein gesundes Wiedersehen im
nächsten Jahr."
Pressemitteilung Stadt Koblenz - übernommen aus
"Blick-Aktuell" vom 18. September 2019. |
| |
|
November 2019:
Schulen übernehmen
Stolperstein-Patenschaften zur Reinigung der Stolpersteine in der Stadt
|
Pressemitteilung Stadt Koblenz - Artikel im
Mittelrhein-Tageblatt vom 19. November 2019: "Koblenz – Gesellschaft:
Weitere Schulen übernehmen Patenschaften für Stolpersteine
Koblenz – Gesellschaft: Auf Initiative von Kultur- und Bildungsdezernentin
Dr. Margit Theis-Scholz, unterstützt durch die Christlich-Jüdische
Gesellschaft Koblenz und dem Förderverein Mahnmal für die Opfer des
Nationalsozialismus in Koblenz, haben weitere Koblenzer Schulen
Patenschaften für Stolpersteine übernommen. Die Stolpersteine sind ein
Projekt des Künstlers Gunter Demnig. Mit den im Boden verlegten kleinen
Gedenktafeln soll an das Schicksal der einst in den jeweiligen Häusern und
Wohnungen lebenden und dann in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgten,
vertriebenen oder getöteten Mitbürgerinnen und Mitbürgern jüdischen Glaubens
erinnert werden. Das Bildungsbüro Koblenz organisiert hierzu jährlich einen
Aktionstag in Erinnerung an die Reichspogromnacht am 9. November. Hieran
nahmen neun Koblenzer Schulen teil. Mit den Sets ausgestattet wurden die
Grundschule Am Löwentor, die Grundschule Arenberg, die Grundschule
Freiherr-vom-Stein, die Grundschule Güls, die Grundschule Immendorf, die
Grundschule Koblenz-Metternich, die Grundschule Pfaffendorf, die Grundschule
Schenkendorf, die Carl-Benz-Schule, das Bischöfliche Cusanus-Gymnasium, die
Clemens-Brentano-/Overberg-Realschule plus Koblenz, die Diesterweg-Schule,
das Görres-Gymnasium, das Hilda-Gymnasium, die Integrierte Gesamtschule
Koblenz, die Realschule plus auf der Karthause, das Max-von-Laue Gymnasium
und die Dr. Zimmermannsche Wirtschaftsschule. Im Rahmen dieser Übergabe
dankte Avadislav Avadiev, der Vorsitzende des Landesverbandes Jüdischer
Gemeinden in Rheinland-Pfalz, den Schulen für die Übernahme und die damit
verbundene Reinigung der Stolpersteine. Dr. Jürgen Schumacher, der
Vorsitzende des Fördervereins Mahnmal Koblenz, führte den anwesenden
Schülerinnen und Schülern vor Augen, was es bedeutete, damals ein Kind
jüdischen Glaubens zu sein. Danach führte Kathrin Schmude vom Stadtarchiv
Koblenz in die Geschichte der jüdischen Familie Hermann aus Koblenz ein.
Einzelne Ausschnitte aus den Briefen wurden von Schülerinnen und Schülern
des Hilda-Gymnasiums vorgelesen. Im Anschluss an die Übergabe der
Reinigungssets haben Schülerinnen und Schüler der Carl-Benz-Schule Koblenz
Stolpersteine in der Schloßstraße gereinigt. Kultur- und Bildungsdezernentin
Dr. Margit Theis-Scholz erachtet einen solchen Aktionstag als wichtigen
Beitrag für eine lebendige Erinnerungskultur und Gedenkarbeit. Sie bedankt
sich besonders bei der Christlich-Jüdischen Gesellschaft Koblenz für die
Dokumentation zu den schicksalhaften Opferbiografien, welche die Schulen
entsprechend in den Unterricht integrieren können. Die
Stolpersteinpatenschaften werden vom Bildungsbüro Koblenz und der
Partnerschaft für Demokratie Koblenz, welche im Rahmen des Bundesprogramms
'Demokratie leben!' eingegangen wurde, koordiniert. Das Bildungsbüro Koblenz
wurde im Jahr 2017 mit Unterstützung von Fördermitteln des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung gegründet. Als
Koordinierungsstelle für Bildungsfragen arbeitet das Bildungsbüro Koblenz
primär an der Vernetzung von Bildungsangeboten und Bildungsakteuren in
Koblenz." *
Link zum Artikel |
| |
|
August 2020:
Der Bau einer neuen Synagoge rückt
näher - Grundsteinlegung für 2021 geplant
|
Artikel in RTL.de vom 21. August 2020 (Übernahme
Pressemeldung DPA): "'Hohe symbolische Bedeutung': Synagoge in Koblenz
geplant.
Die erste neue Synagoge in Rheinland-Pfalz nach der Einweihung der jüdischen
Gotteshäuser in Speyer 2011 und in Mainz 2010 soll in Koblenz entstehen.
'Ich würde mich sehr freuen, wenn unsere zwei Zeitzeuginnen, die im KZ
Theresienstadt gewesen sind, und mehrere Dutzend weitere
Holocaust-Überlebende in der Jüdischen Gemeinde Koblenz nächstes Jahr die
Grundsteinlegung erleben würden', sagte der Vorsitzende des Landesverbands
der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz, Avadislav Avadiev, der
Deutschen Presse-Agentur. Vor allem nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion
waren zahlreiche Holocaust-Überlebende auch nach Rheinland-Pfalz gezogen.
'2021 feiern wir außerdem 1700 Jahre jüdisches Leben im heutigen
Deutschland', ergänzte Avadiev. Eine Grundsteinlegung für eine neue
Koblenzer Synagoge im kommenden Jahr hätte auch angesichts des zunehmenden
Antisemitismus eine 'hohe symbolische Bedeutung', betonte der Geschäftsmann.
'Vor 20 Jahren hätte ich mir diese Entwicklung nicht vorstellen können.'
Avadiev erinnerte an den Anschlag bei der Synagoge von Halle vor fast einem
Jahr mit zwei Toten. Längst müssten auch in Rheinland-Pfalz sehr viele
jüdische Veranstaltungen polizeilich geschützt werden. Abgesehen von
jüdischen Gebets- und Veranstaltungsräumen gibt es in Rheinland-Pfalz laut
Avadiev sieben Synagogen mit Gottesdiensten: in Mainz, Worms, Bad Kreuznach,
Trier, Kaiserslautern und Speyer - hinzu kommt die jetzige Synagoge in
Koblenz, die nur ein Provisorium und zu klein ist und durch den Neubau
ersetzt werden soll. Außerdem finden sich in Rheinland-Pfalz mehrere Dutzend
denkmalgeschützte Synagogen ohne Gottesdienste. In Koblenz drängt sich die
jüdische Gemeinde seit dem Zweiten Weltkrieg in eine umgebaute Trauerhalle
auf ihrem Friedhof. 'Da passen nur maximal 100 Leute rein, das ist längst zu
eng', sagte Avadiev. In der Jüdischen Gemeinde im Großraum Koblenz seien
fast 1000 Juden registriert - und landesweit in allen fünf Gemeinden etwa
3300. Insgesamt lebten aber sicherlich dreimal mehr Juden in
Rheinland-Pfalz. Das Innere der alten Koblenzer Synagoge zerstörten die
Nazis in der Pogromnacht am 9./10. November 1938. Wann der schon seit
Jahrzehnten ersehnte Neubau eröffnet werden könne, lasse sich noch nicht
sagen, erklärte Avadiev. Die Kosten für Bau und Grundstück in der Koblenzer
Altstadt bezifferte er mit rund sechs Millionen Euro. Diese wollten sich das
Land Rheinland-Pfalz, die Stadt Koblenz, die Jüdische Gemeinde und der
Förderverein Neue Synagoge für Koblenz teilen. Diese Pläne gibt es schon
seit Jahren. Die Rhein-Mosel-Stadt hat zwar schon seit dem Mittelalter eine
jüdische Gemeinde. Sie war aber nie so bedeutend wie in den sogenannten
Schum-Städten Speyer, Worms und Mainz, die jetzt mit ihrem jüdischen Erbe
Unesco-Welterbe-Stätte werden wollen. Daher wechselte in Koblenz der
Standort der Synagoge im Laufe der Jahrhunderte mehrmals. Avadiev wohnt
selbst im Raum Koblenz. Seine Vorfahren in Italien waren Sefarden, also
Juden spanischer Abstammung. Sein Großvater hatte eine Fischfangflotte auf
dem Kaspischen Meer - und eine eigene Synagoge. Er selbst wurde in
Usbekistan geboren, wuchs in Aserbaidschan auf und kam vor einem
Vierteljahrhundert nach Rheinland-Pfalz."
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Germania Judaica I,144-147; II,1 S. 407-414; III,1 S.
624-632. |
 | Eva Salier (Übersetzung und Kurzfassung von Lilo Heine):
Jugend unter der Nazi-Diktatur. Leidensweg der Koblenzerin Eva Salier geb.
Hellendag. In: SACHOR. Beiträge zur jüdischen Geschichte und zur
Gedenkstättenarbeit in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor und
Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für
politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad
Kreuznach. 6. Jahrgang, Ausgabe 2/96, Heft Nr. 12 S. 59-64.
Dieser
Beitrag ist auch online zugänglich
(pdf-Datei) |
 | Hildburg-Helene Thill: Noch nicht einmal alle
Grabsteine sind geblieben. Juden aus Braubach. In: SACHOR. Beiträge zur jüdischen Geschichte
in Rheinland-Pfalz. 3. Jahrgang. Ausgabe 1/1993, Heft Nr. 4. S. 42-45. Online
zugänglich (als pdf-Datei eingestellt, 6,1 MB; u.a. zur
Familie des Koblenzer Arztes Dr. Eugen Stern).
|
 | Lilo Heine: Begegnungsnachmittage der jüdischen
GUS-Zuwanderer im Gemeindesaal der Jüdischen Kultusgemeinde Koblenz. In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit
in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor
und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für
politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad
Kreuznach. 7. Jahrgang Ausgabe 2/1997 Heft Nr. 14 S. 23-24. Online
eingestellt (pdf-Datei). |
 | Elmar Ries: Die Deportationen von jüdischen
Mitbürgern aus Koblenz und Umgebung. In: SACHOR. Beiträge zur jüdischen Geschichte
in Rheinland-Pfalz. 3. Jahrgang. Ausgabe 2/1993, Heft Nr. 5. S. 32-45. Online
zugänglich (als pdf-Datei eingestellt, 18,5 MB).
|
 | Joachim Hennig: Verfolgung und Wiederstand in
Koblenz 1933-1945. Eine Skizze. In. In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit
in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor
und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für
politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad
Kreuznach. 9. Jahrgang, Ausgabe 1/1999. S. 50-62. Online
zugänglich (als pdf-Datei eingestellt). |
 | ders.: Verfolgung und Wiederstand in
Koblenz 1933-1945. Eine Skizze. Teil 2 (Fortsetzung aus SACHOR Heft
Nr. 17 - 1/1999 S. 50-63). In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit
in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor
und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für
politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad
Kreuznach. 10. Jahrgang, Ausgabe 1/2000, Heft Nr. 18. S. 5-27. Online
zugänglich (als pdf-Datei eingestellt). |
 | Lilo Heine: Ehemalige jüdische Bürger entdeckten
ihre alte rheinische Heimat neu. 13 Jahre "Heimatbesuch" von
1985-1997. In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit
in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor
und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für
politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad
Kreuznach. 9. Jahrgang, Ausgabe 1/1999. S. 5-28. Online
zugänglich (als pdf-Datei eingestellt). |
 | Zur Erinnerung an die Koblenzer Synagoge: zwei Beiträge
vorgelegt aus Anlass der Einweihung des Gedenkraumes im "Bürresheimer
Hof", Koblenz 1986 (Veröffentlichungen der Stadtbibliothek Koblenz
Band 18). |
 | Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt
des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies
ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. Mainz 2005. S. 214-218 (mit zahlreichen weiteren
Literaturangaben). |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Koblenz
Rhineland. Jews are first mentioned in 1100. A sizable Jewish community began to
develop with Jews from Koblenz playing an important role as moneylenders to the
nobility and the Church from the end of the 13th century. Among the prominent
Jewish scholars were R. Hayyim ben Yehiel, a follower of R. Meir of Rothenburg,
and his brother Asher. In 1344, R. Eliezer ben Shemuel ha-Levi produced a
surviving parchment Bible with commentaries. The medievel community fell victim
to recurring persecutions (in 1265, 1281, 1287-88, 1337) and was totally
destroyed in the Black Death disturbances of 1348-49. Jews resettled but were
expelled definitely in 1418. They were allowed to return in 1518.
A renewed Jewish community began to develop, establishing a synagogue in 1702.
The community was served by several notable rabbis, among them the kabbalist and
Talmud scholar Yair Hayyim Bacharach (1666-60). Under French rule in the early
19th century, the Jews were accorded equal rights but community autonomy was
curtailed under the consistory system. Although Napoleon's "Infamous Decree,"
which remained in effect until 1847, limited their freedom of movement and trade,
Jews nonetheless began to achieve prominence in the city. The first Jew was
elected to the municipal council in 1842 and a Jew became a district judge in
1879. The Jewish population increased from 342 in 1808 to 634 (total 45,147) in
1900. In the latter half of the 19th century, the economic circumstances of the
Jews improved considerably. Most were merchants in the food and textile trade
and a number of clothing stores like Tietz and Jacobi were court suppliers.
Antisemitic outbreaks also occured, during the Hep!Hep! riots of 1819 and again
in 1848. Anti-Jewish feeling was also manifest in the last decade of the 19th
century with the spread of antisemitic incitement. The community was in the
forefront of the movement for religious reform. A new synagogue with an organ
and mixed choir was consecrated in 1851. However, from 1878 Neo-Orthodoxy made a
comeback when Dr. Adolf Levin became rabbi. A branch of the Central Union (C.V.)
was founded in 1893 and the Zionists were active in 1913. The Jewish population
grew to 800 in 1929. In June 1933, about four months after the Nazi takeover,
669 Jews were counted in Koblenz. The Jewish population suffered from the
economic boycott and mounting persecution. The Tietz establishment was sold off
in 1933 and Jews were gradually pushed out of the grain and cattle trade. Forced
to sell their stores, homes, and land, they began to emigrate. Jewish cultural
life nontheless continued under the auspices of the Jewish Cultural Association
(350 members in 1935), the Zionists, and B'nai B'rith. A Zionist Habonim youth
group was founded in 1935. On Kristallnacht (9-10 November 1938), the
synagogue, over 40 Jewish homes, and at least 19 Jewish stores were destroyed.
About 100 Jewish men were sent to the Dachau concentration camp, two dying of
heart attacks. In May 1939 only 308 Jews remained. Deportations commenced in
1942, with Koblenz serving as a regional concentration pont. The first transport
for the east left on 22 March, with 120 Jews and another from the Sayn
psychiatric hospital. Additional transports left on 15 June, 27 July, and 28
February 1943 and in July 1943. A few dozen survivors returned after the war. In
1987, the Jewish population was 100.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|