|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
zu den "Synagogen im
Wetteraukreis"
Gross-Karben mit
Klein-Karben, Okarben, Petterweil und Rendel (Stadt
Karben, Wetterau-Kreis)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Zur jüdischen Geschichte in Groß-Karben
und Umgebung siehe
die Seiten bei
www.stolpersteine-in-karben.de
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Groß-Karben bestand eine jüdische
Gemeinde bis 1938/42. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17./18. Jahrhunderts
zurück.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: in Groß-Karben 1828 130 jüdische Einwohner, 1861 152 (17,3 % von insgesamt 878
Einwohnern), 1871 217, 1880 136 (14,1 % von 936), 1900 130, 1910 90. Zur
jüdischen Gemeinde in Groß-Karben gehörten auch die in Klein-Karben, Okarben,
Petterweil und Rendel lebenden jüdischen Einwohner. Hier wurden gezählt: In Klein
Karben:
1830 12 jüdische Einwohner, in Okarben: 1830 29, 1905 15; in
Rendel: 1830 27,
1905 24. Zu Petterweil siehe eigene
Seite.
Ausführliche Informationen zu den einzelnen Familien und der Geschichte der
einzelnen Familienmitglieder sowie ihre Gewerbebetriebe in Groß-Karben und den
umliegenden Orten finden sich auf der Website von www.stolpersteine-in-karben.de.
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule,
ein rituelles Bad (neben der Synagoge) und ein Friedhof;
auch in Klein-Karben wurde ein Friedhof
angelegt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der
zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (vgl. Ausschreibungen der Stelle
unten). Der jüdische Lehrer unterrichtete teilweise auch die jüdischen Kinder
in umliegenden Gemeinden (u.a. in Nieder-Wöllstadt).
Die beiden letzten Lehrer waren Nathan Driels (geb. 1845 in Emden,
verheiratet mit Lina geb. May und drei Kindern Adolf, Moritz und Frieda; alle
drei in der NS-Zeit umgekommen; Nathan Driels starb am 28. März 1928) und
Isaak Markus (zuvor in Assenheim, geb. 1872 in Nowgorod; nach Novemberpogrom 1938 nach Frankfurt
geflüchtet und über England in die USA emigriert). Die Gemeinde gehörte zum liberalen Provinzialrabbinat Oberhessen mit Sitz in
Gießen.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: aus Groß-Karben
Ludwig Junker (geb. 22.6.1887 in Groß-Karben, gef. 1.9.1914), Vizefeldwebel
Friedrich Kahn (geb. 22.7.1892 in Groß-Karben, gef. 9.10.1917) und Nathan
Strauss (geb. 12.12.1880 in Groß-Karben, gef. 30.7.1915), aus Rendel
Gefreiter Wilhelm Weinberg (geb. 6.3.1894 in Frankfurt am Main, gef.
9.6.1918).
Um 1924, als zur Gemeinde 76 Personen gehörten (4,9 % von insgesamt 1.543
Einwohnern, dazu 10 Personen aus Okarben und 9 aus Rendel), waren die
Gemeindevorsteher Max Grünebaum, Moritz Grünebaum und Max Strauß. Als Lehrer
war der bereits genannt Nathan Driels tätig. Er erteilte den damals fünf schulpflichtigen
jüdischen Kindern der Gemeinde den Religionsunterricht (dazu auch die
jüdischen Kinder in Burg-Gräfenrode,
Nieder-Wöllstadt). Als Rechner der
Gemeinde war Herr Kahn tätig, als Synagogendiener Siegfried Strauß
(Bahnhofstraße 9). Seit 1928 war Isaak Markus Lehrer in
Groß-Karben; er blieb bis zum Novemberpogrom 1938 in Groß-Karben). 1932 war
Gemeindevorsteher Max Grünebaum. Er blieb auch der letzte Gemeindevorsteher.
1933 lebten 81 jüdische Personen in Groß-Karben (in etwa 15 Familien; 4,8 % von insgesamt 1.651
Einwohnern). In
den folgenden Jahren ist ein Teil der
jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,
der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Seit 1933 kam es
regelmäßig zu Belästigungen und körperlichen Misshandlungen jüdischer
Einwohner, zu Sachbeschädigungen (eingeworfene Fensterscheiben) und gezielten
Geschäftsschädigungen. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge
durch Nationalsozialisten zerstört (s.u.), anschließend wurden die jüdischen
Männer in das Spritzenhaus gesperrt und brutal ausgepeitscht. Die jüdischen
Häuser und Geschäfte wurden überfallen, völlig ausgeplündert oder das Inventar zerstört. Nach diesen Ereignissen versuchten viele
Familien, alsbald vom Ort zu verziehen (27 sind nach Frankfurt) oder
auszuwandern (USA, Südamerika, Südafrika, England, Frankreich, Schweiz,
Niederlande). Die meisten der letzten jüdischen Einwohner wurden im Herbst 1942
deportiert (acht aus Groß-Karben, Lea Weinberg geb. Grünebaum aus Rendel). Eine mit einem nichtjüdischen Mann verheiratete jüdische Frau
wurden im Februar 1945 nach Theresienstadt deportiert. Sie hat überlebt und
konnte im Mai 1945 nach Groß-Karben
zurückkehren.
Von den in Groß-Karben geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Dina Bendorf geb.
Junker (1889), Adolf Driels (1881), Moritz Driels (1882), Frieda Drielsma geb.
Driels (1888), Rebekka Ettlinger geb. Grünebaum (1898), Blanka Beate Grünebaum
(1910), Emilie Grünebaum (1860), Frieda Grünebaum (1900), Heinrich Grünebaum
(1900), Isidor Grünebaum (1871), Lilli Grünebaum (1906), Louis Grünebaum
(1869), Moritz Grünebaum (1889), Rosa Grünebaum (1883), Theodor Grünebaum
(1865), Johanna Hahn geb. Strauß (1876), Karoline Hahn geb. Grünebaum (1868),
Clara (Klara) Herzfeld geb. May (1879), Adolf Hirsch (1882), Antonie Hirsch geb.
Junker (1889), Erich Julius Hirsch (1925), Marga Else Hirsch (1923), Johanna
Isenburger geb. Kulb (1885),Wilhelmina Jacobs geb. Kulb (1888), Bertha Joseph
(1896), Anna Junker (1874), Bella Junker geb. Simon (1892), Hugo Junker (1894),
Margot Junker (1921), Isidor Kahn (1861), Julius Kulb (1895), Klothilde Levy
geb. Grünebaum (1883), Betti Neuhaus geb. Kleemann (1870), Moritz Rosenthal
(1881), Ilse Nannchen Ross (1928), Julius Ross (1897), Moritz Ross (1888),
Johanna Scheuer geb. Kircher (1867), Sofie Spahn geb. Berkowitz (1907), Rebekka
Ruth Speier geb. Grünebaum (1888), Franziska Strauss (1888), Julius Strauss
(1882), Moritz Strauss (1865), Hermann Sziff (1875), Johanna Vos geb. Driels
(1875), Antonie Wertheimer geb. Junker (1896).
An viele der Umgekommenen aus Groß-Karben erinnern inzwischen "Stolpersteine"
vor Ort: www.stolpersteine-in-karben.de
Aus Klein-Karben ist umgekommen: Mathilde Eichenbronner geb. Ortenberger
(1874).
Aus Okarben sind umgekommen: Adolf Grünewald (1878), Emil Grünewald
(1886), Hans Grünewald (1901), Isidor Grünewald (1884), Adolf Kahn
(1883).
Aus Rendel sind umgekommen: Gustav Grünebaum (1864), Heinrich Grünebaum
(1899), Max Grünebaum (1869), Meier Grünebaum (1861), Rosa Grünebaum (1862),
Rosi Junker geb. Grünebaum (1894), Erna Katz geb. Grünebaum (1898), Lea
Weinberg geb. Grünebaum (1869).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1865 /
1871
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Januar 1865:
"In der hiesigen israelitischen Gemeinde ist die Stelle eines
Lehrers, Vorsängers und Schächters alsbald zu besetzen. Fixer Gehalt 400
Gulden nebst freier Wohnung und 20 Gulden Vergütung für Heizung. Die
Einkünfte des Schächteramts nebst anderen Nebeneinkünften belaufen sich
auf 100 Gulden.
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Januar 1865:
"In der hiesigen israelitischen Gemeinde ist die Stelle eines
Lehrers, Vorsängers und Schächters alsbald zu besetzen. Fixer Gehalt 400
Gulden nebst freier Wohnung und 20 Gulden Vergütung für Heizung. Die
Einkünfte des Schächteramts nebst anderen Nebeneinkünften belaufen sich
auf 100 Gulden.
Groß-Karben, den 28. Dezember 1864. Der Vorstand. Abraham
Grünebaum II." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Juli 1871:
"Die hiesige israelitische Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle
ist mit einem jährlichen Gehalt von 400 Gulden, freie Wohnung und 20
Gulden für Heizung der Schule, vakant. Reflektierende wollen sich bei dem
hiesigen Vorstand melden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Juli 1871:
"Die hiesige israelitische Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle
ist mit einem jährlichen Gehalt von 400 Gulden, freie Wohnung und 20
Gulden für Heizung der Schule, vakant. Reflektierende wollen sich bei dem
hiesigen Vorstand melden.
Groß-Karben, den 29. Juli 1871. Der Vorstand." |
Lehrer Isaac Marcus wechselt von
Assenheim nach Groß-Karben (1929)
 Artikel
im "Israelitischen Familienblatt" vom 1. August 1929: "Assenheim.
Am 1. Juli verließ der Lehrer und Kultus Beamte Isaac Marcus nach
30-jähriger Amtstätigkeit die israelitische Gemeinde zu
Assenheim, um eine Stelle in
Groß-Karben anzutreten. Beliebt bei Juden und auch der andersgläubigen
Bevölkerung, hat Herr Marcus in seiner langjährigen Dienstzeit es
verstanden, die kleine Gemeinde zusammenzuhalten und seine Tätigkeit in
jeder Beziehung zu einer segensreichen im Interesse des Judentum zu
gestalten." Artikel
im "Israelitischen Familienblatt" vom 1. August 1929: "Assenheim.
Am 1. Juli verließ der Lehrer und Kultus Beamte Isaac Marcus nach
30-jähriger Amtstätigkeit die israelitische Gemeinde zu
Assenheim, um eine Stelle in
Groß-Karben anzutreten. Beliebt bei Juden und auch der andersgläubigen
Bevölkerung, hat Herr Marcus in seiner langjährigen Dienstzeit es
verstanden, die kleine Gemeinde zusammenzuhalten und seine Tätigkeit in
jeder Beziehung zu einer segensreichen im Interesse des Judentum zu
gestalten." |
Herr Braun aus Groß-Karben fungiert
als Vorbeter in der Synagoge Bad Vilbel (1931)
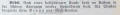 Artikel
im "Mitteilungsblatt des Verbandes israelitischer Religionsgemeinden in
Hessen" 1931 6 S. 6: "Vilbel. Nach einer halbjährigen Pause fand an
Pessach in der schönen Synagoge wieder Gottesdienst statt. Als Chasson
(Vorbeter) fungierte Herr Braun aus
Groß-Karben." Artikel
im "Mitteilungsblatt des Verbandes israelitischer Religionsgemeinden in
Hessen" 1931 6 S. 6: "Vilbel. Nach einer halbjährigen Pause fand an
Pessach in der schönen Synagoge wieder Gottesdienst statt. Als Chasson
(Vorbeter) fungierte Herr Braun aus
Groß-Karben." |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Allgemeine Gemeindebeschreibung (1936!)
 Artikel
im "Gemeindeblatt der Israelitischen Gemeinde Frankfurt" vom
August 1936 S. 436: "Von Vilbel über Dorteilweil in 1 3/4 Stunden - Bahnfahrt
12 Minuten nicht zu empfehlen, da Bahnhof 1/2 Stunde vom Ort, dagegen mit
Kraftpost in 20 Minuten zur Synagoge von Groß-Karben. Artikel
im "Gemeindeblatt der Israelitischen Gemeinde Frankfurt" vom
August 1936 S. 436: "Von Vilbel über Dorteilweil in 1 3/4 Stunden - Bahnfahrt
12 Minuten nicht zu empfehlen, da Bahnhof 1/2 Stunde vom Ort, dagegen mit
Kraftpost in 20 Minuten zur Synagoge von Groß-Karben.
Alter Ort mit etwa 1.600 Einwohnern. Die heutige Gemeinde ist kaum sehr
alt, trotzdem einzelne Juden schon früh dort wohnen. Heute etwa 15
Familien. Synagoge zwar nicht an der Straße, aber augenscheinlich
für eine viel größere Gemeinde gebaut: 1905 noch 130, 1924 60 Seelen. Friedhof
einige Minuten vom Ort, links jenseits der Heldenbergener Straße, kurz
vor 1870 über einem älteren aufgeschüttet. - Im Ort einige alte Bauten,
Schloss der einst mächtigen Herren von Karben, denen beträchtliche Zeit
zahlreiche Juden unterstanden. In der Nähe mehrere Kohlensäurequellen,
deren Versand beachtlich ist. 3/4 Stunden nordwestlich bei Okarben,
dessen Juden zu Großkarben gehörten, Römerkastell. Von Groß-Karben in
1 Stunde nach Burg Gräfenrode, einem alten Dorf, dessen Juden
ebenfalls zu Großkarben gehören, und in weiteren 30 Minuten nach
Ilgenstadt, einem Dorf von gut 1.000 Einwohnern, heute ohne Juden.
Bedeutende romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert, die einst dazu
gehörigen Klostergebäude um 1755 zum Schloss der Grafen von Rappenberg
umgebaut. Der Torbau an der Südseite herrliches
Barock." |
Kritik an der "ökumenischen Gesinnung" vor
Ort (1903)
Anmerkung: die hier geäußerte Kritik stammt aus orthodoxer
Seite, von der aus jüdisch-christliche Ehen abgelehnt wurden
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 6. November
1903: "Groß-Karben. Ein großer Teil der Judenheit dieser
Gemeinde lebt in dem Glauben, dass die Zukunft der Judenheit bei
Hintenansetzung der konfessionellen Tradition in der Ausgleichung der
äußersten Grenzen der Reform mit allgemeiner Einheit und Gleichheit zu
suchen sei. Die Folgen bleiben natürlich nicht aus. Erst kürzlich
verlobte sich ein junges Mädchen - Selma Cahn - mit Zustimmung und im
Hause ihrer Eltern mit einem evangelischen
Eisenbahnarbeiter." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 6. November
1903: "Groß-Karben. Ein großer Teil der Judenheit dieser
Gemeinde lebt in dem Glauben, dass die Zukunft der Judenheit bei
Hintenansetzung der konfessionellen Tradition in der Ausgleichung der
äußersten Grenzen der Reform mit allgemeiner Einheit und Gleichheit zu
suchen sei. Die Folgen bleiben natürlich nicht aus. Erst kürzlich
verlobte sich ein junges Mädchen - Selma Cahn - mit Zustimmung und im
Hause ihrer Eltern mit einem evangelischen
Eisenbahnarbeiter." |
Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Einzelpersonen
Verlobungs- und Heiratsanzeige von Rosel
Strauss und Heinrich Grünebaum in Rendel (1929)
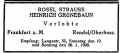 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Januar 1929: "Rosel
Strauss - Heinrich Grünebaum. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Januar 1929: "Rosel
Strauss - Heinrich Grünebaum.
Verlobte. Frankfurt am Main - Rendel / Oberhessen.
Empfang: Langestraße 55, Samstag, den 19. und Sonntag, den
20.1.1929." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Juli 1929: "Heinrich
Grünebaum - Rosel Grünebaum geb. Strauss.
Vermählte. Rendel (Oberhessen) - Frankfurt am
Main. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Juli 1929: "Heinrich
Grünebaum - Rosel Grünebaum geb. Strauss.
Vermählte. Rendel (Oberhessen) - Frankfurt am
Main.
Trauung und Empfang: Sonntag, 7. Juli 1929. Frankfurt am Main,
Liederhalle, Langestraße 26." |
Zur Geschichte der Synagoge
Noch Anfang des 18. Jahrhunderts war es den jüdischen
Familien am Ort streng verboten, öffentlich Gottesdienst zu halten. Als im
September 1709 Jud Heyem aus Anlass des jüdischen Neujahrsfeste das Schofarhorn
geblasen hat, kam es zu heftigen Gegenreaktionen der Groß Karbener Christen.
Heyem hatte die sehr hohe Strafe von 200 Reichstalern zu bezahlen. In Karben
dürfte es damals eine einfache Betstube in einem der jüdischen Häuser gegeben
haben.
1840, nach anderen Angaben erst 1872 wurde eine Synagoge am Ort
erbaut. Beim zweitgenannten Jahr kann es sich auch um das Jahr eines Umbaus
gehandelt haben.
Seit der Zeit des Ersten Weltkrieges besuchten auch die in Burg-Gräfenrode
lebenden jüdischen Personen die Synagoge in Groß-Karben. Die Torarolle aus
Burg-Gräfenrode war in die Synagoge nach Groß-Karben verbracht
worden.
Letztmals wurde - auf Initiative von Lehrer Isaak Markus - 1932 die
Synagoge umfassend renoviert.
Renovierung und Neueinweihung der Synagoge
(1932)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. November 1932:
"Groß-Karben, 15. November (1932). Die israelitische Gemeinde
Groß-Karben (bei Friedberg in Hessen) hat in diesem Jahre ihre alte
Synagoge einer gründlichen Renovierung unterzogen. Die kleine, 26
Familien zählende Gemeinde, mit einem rührigen Vorstand an der Spitze,
hat damit bewiesen, dass es auch in dieser so schweren Zeit möglich ist,
aus eigener Kraft etwas Großes zu schaffen. Gern und freudig hat jeder
Einzelne gegeben, um das von den Vätern ererbte Gotteshaus vor dem
Verfall zu schützen und in würdigem Zustand zu wissen. Der Lehrer
der Gemeinde, Herr Markus, der eigentliche Vater des Projektes, hat
dessen Kosten aus freiwilligen Spenden innerhalb der Gemeinde gesammelt
und sich mit diesem Werk ein bleibendes Verdienst um seine Gemeinde
erworben. Am 1. Abend Roschhaschono (= 30. September 1932) dankte Herr
Markus in einer gehaltvollen Ansprache den Gemeindemitgliedern und pries
deren Gebefreudigkeit. Die Groß-Karbener Juden aber sind stolz auf ihr
Werk und auf ihre Synagoge." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. November 1932:
"Groß-Karben, 15. November (1932). Die israelitische Gemeinde
Groß-Karben (bei Friedberg in Hessen) hat in diesem Jahre ihre alte
Synagoge einer gründlichen Renovierung unterzogen. Die kleine, 26
Familien zählende Gemeinde, mit einem rührigen Vorstand an der Spitze,
hat damit bewiesen, dass es auch in dieser so schweren Zeit möglich ist,
aus eigener Kraft etwas Großes zu schaffen. Gern und freudig hat jeder
Einzelne gegeben, um das von den Vätern ererbte Gotteshaus vor dem
Verfall zu schützen und in würdigem Zustand zu wissen. Der Lehrer
der Gemeinde, Herr Markus, der eigentliche Vater des Projektes, hat
dessen Kosten aus freiwilligen Spenden innerhalb der Gemeinde gesammelt
und sich mit diesem Werk ein bleibendes Verdienst um seine Gemeinde
erworben. Am 1. Abend Roschhaschono (= 30. September 1932) dankte Herr
Markus in einer gehaltvollen Ansprache den Gemeindemitgliedern und pries
deren Gebefreudigkeit. Die Groß-Karbener Juden aber sind stolz auf ihr
Werk und auf ihre Synagoge." |
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge durch Nationalsozialisten geschändet, geplündert und
niedergebrannt. Auch eine benachbarte Scheune der jüdischen
Familie Josef Junker ist abgebrannt. Auf Befehl des damaligen Bürgermeisters
Heinrich Flach,
der zugleich Ortsgruppenleiter der NSDAP war, durfte die angerückte Feuerwehr
nicht löschen. Die Brandruine blieb bis nach Kriegsende stehen und wurde dann
abgebrochen.
1949 waren vor dem Landgericht Gießen 12 Personen wegen den Ereignissen
beim Novemberpogrom beziehungsweise wegen Landfriedensbruch angeklagt (die
meisten der Angeklagten waren aus Groß-Karben!; vgl. zum Prozess die Synagogenprozess-Akten im
Staatsarchiv Darmstadt AZ H 13 Gießen/498). Sieben von ihnen wurden
freigesprochen, fünf erhielten Gefängnisstrafen zwischen vier und 12 Monaten.
Mit 12 Monaten wurde Heinrich Flach bestraft, der seit 1931 Ortsgruppenleiter
der NSDAP in Groß-Karten und von 1933 bis 1941 Bürgermeister der Gemeinde
war.
Am Synagogenstandort erinnert ein kleiner, unauffälliger Gedenkstein an
die ehemalige Synagoge.
Adresse/Standort der Synagoge: Heldenberger
Straße 10 bzw. 12 (die Synagoge stand zwischen Heldenberger Straße 10 und
14).
Fotos
(Quelle: Website www.stolpersteine-in-karben.de,
hier: Seite
zur Synagoge)
| Die Synagoge in
Groß-Karben |
|
|
 |
 |
 |
Zeichnung der ehemaligen
Synagoge
(gezeichnet von Edgar Braun, NY) |
Bildmontage, erstellt von der
Initiative "Stolpersteine in Karben" |
Vor der Synagoge im Jahr 1937:
links
Lehrer Isaak Markus, rechts
Synagogendiener Siegfried Strauss |
| |
|
| |
|
|
Nach der Zerstörung
der Synagoge |
 |
|
| |
Die zerstörte Synagoge (Ende
Mai 1945) |
|
| |
|
|
| Gedenken an die Synagoge |
 |
 |
| |
Gedenkstein auf dem
Grundstück der Synagoge |
| |
|
|
Erinnerungsarbeit vor Ort - einzelne Berichte
| März 2009: Die
"Stolpersteine" in Groß-Karben werden gereinigt |
Artikel aus "Bad Vilbel online" (Link
zum Artikel)
"Putzaktion in Groß-Karben
Karben: Die Inschriften auf den so genannten "Stolpersteinen", die bereits in den vergangenen Jahren in die öffentlichen Bürgersteige Groß-Karbens eingelassen wurden, sind teilweise nur noch schwer lesbar.
"Da diese Gedenksteine an Groß-Kärber erinnern, die von Nationalsozialisten aus rassistischen Gründen verfolgt wurden, sei der Beginn der Internationalen Wochen gegen Rassismus ein passender Anlass, die Messingtafeln wieder blank zu
putzen", so die Initiative stolpersteine-in-karben.de "womit auch der Mahncharakter der Gedenksteine unterstrichen werden
soll." |
| |
| August 2009:
Auszeichnung für die "Stolperstein"-Initiative |
Artikel in der "Wetterauer
Zeitung" vom 3. August 2009 (Link zum Artikel): "Kulturpreis der Stadt für Stolpersteine-Initiative
Karben (pe). Die Initiative 'Stolpersteine in Karben' hat den diesjährigen Kulturehrenpreis der Stadt erhalten. Der Magistrat folgte bei seiner Entscheidung einer Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft Kultur (Arge). Am Montagnachmittag überreichte Bürgermeister Roland Schulz den beiden Aktiven der Initiative, Irma Mattner und Hartmut Polzer, die entsprechende Urkunde im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Sitzungszimmer des Rathauses. Die beiden hätten sich
'in herausragender Art und Weise ehrenamtlich engagiert in einem Bereich, der mit höchster Sensibilität und größter Sorgfalt bearbeitet werden
muss', so Schulz in seiner Begründung...."
|
| |
| Oktober 2010:
Weitere "Stolpersteine" werden am 13.
Oktober 2010 verlegt |
Artikel in der "Frankfurter Neuen Presse" vom 11. Oktober 2010 (Link
zum Artikel):
"Hintergrund: Erinnern an die ehemaligen Nachbarn.
Für Hugo und Rosa Junker, Betty Grünebaum sowie für weitere ehemalige jüdische Groß-Kärber Bürger werden morgen (Mittwoch) insgesamt neun Stolpersteine verlegt. Die Stolpersteine werden über Patenschaften finanziert.
Über diesen Weg beteiligen sich diesmal beispielsweise die 'Senioren 60 plus' der SPD Karben an der Stolpersteinverlegung.
Angeregt durch die Gesprächsrunde 'Gesellschaftliche Verantwortung' und dem Vortrag von Hartmut Polzer im vergangenen Jahr, entschieden sich die SPD-Senioren, die Kosten für zwei Stolpersteine zu übernehmen, berichtet der Vorsitzende Rainer Züsch. Er bedankt sich bei allen Senioren, die mit Geldbeträgen diese Spende an die Aktion
'Stolpersteine gegen das Vergessen' möglich machten.
Die Verlegung beginnt am 13. Oktober um 14.30 Uhr in der Bahnhofstraße 51 in Groß-Karben. Wer eine Patenschaft übernehmen möchte, wendet sich an die Initiative Stolpersteine unter Telefon (0 60 39) 4 25 39. Informationen auch unter
http://www.stolpersteine-in-karben.de
im Internet. dpg." |
| |
Artikel von Susanne Krejcik in der
"Frankfurter Neuen Presse" vom 11. Oktober 2010 (Link zum Artikel):
"Aus Groß-Karben in den Tod.
Bis zur Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 1933 lebten viele Juden in Groß-Karben, Okarben, Rendel und Burg-Gräfenrode. Was aus einigen dieser Karbener wurde, stellt die FNP vor. Grundlage sind die Gespräche mit Zeitzeugen und Archivrecherchen der
'Initiative Stolpersteine in Karben' im Vorgriff auf die geplante Verlegung von Stolpersteinen als Erinnerung an die ehemaligen Karbener. Heute Teil zwölf: Die Geschichte von Familie Hugo Junker aus Groß-Karben..." |
| |
Bericht von Georgia Lori in der
"Frankfurter Neuen Presse" vom 13. Oktober 2010 über die
Verlegung der "Stolpersteine" in Groß-Karben
(Artikel: "Die Gräber in unseren Herzen. Gunter Demnig
verlegt neun Stolpersteine in Karben". |
| |
| März 2011:
Schüler reinigen "Stolpersteine" und pflegen damit die
Erinnerung |
Artikel von Susanne Krejcik in der "Frankfurter Neuen
Presse" vom 14. März 2011 (Link zum Artikel):
"Putzen gegen das Vergessen.
Schüler reinigen in Karben Stolpersteine, die an Schicksale verfolgter Juden erinnern
In Karben sind 48 Stolpersteine zur Erinnerung an die früher hier
lebenden Juden verlegt. Zum Auftakt der Internationalen Woche gegen
Rassismus haben der Gesprächskreis Prävention und die Initiative
Stolpersteine zum Reinigen der Steine aufgerufen.
Karben. Gabriele Davis vom Gesprächskreis Prävention sowie Irma Mattner und Hartmut Polzer von der Initiative Stolpersteine begrüßen die Erwachsenen sowie Schüler der Kurt-Schumacher-Schule (KSS) am Treffpunkt Kreuzgassbrunnen in Groß-Karben. Die Messingtafeln der Steine seien staubig und teils oxidiert, erklärt Polzer..."
|
| |
| März 2012:
Schüler reinigen "Stolpersteine" und
pflegen damit die Erinnerung |
Artikel von Andreas K. Schopf in der
"Frankfurter Rundschau" vom 14. März 2012: "Das
Schlimmste ist das Vergessen.
Schüler und Freiwillige putzen die Stolpersteine in
Karben..."
Link
zum Artikel |
| |
| Mai 2012:
Weitere acht "Stolpersteine" wurden
verlegt |
Artikel in der "Frankfurter
Rundschau" vom 15. Mai 2012: "Mit dem Kopf und dem Herzen
stolpern.
Karben. Acht neue Steine erinnern an die Opfer der
Nationalsozialisten..."
Link
zum Artikel
Anmerkung: Vier "Stolpersteine" wurden vor dem Haus
Bahnhofstraße 47 für die jüdische Familie Kulb verlegt (für Isidor und
Bella Kulb mit ihren beiden Kindern, die 1934 von Groß-Karben nach
Frankfurt flüchteten und später nach Uruguay emigrierten; zwei Steine
wurden für Adelheid und Lili Grünebaum vor dem Haus Bahnhofstraße 4
verlegt (beide wurden nach der Deportation ermordet); zwei weitere Steine
wurden für politisch Verfolgte verlegt. |
| |
| Oktober 2014:
Erinnerung an die jüdische
Geschichte |
| Presseartikel von Andras Groth in der
"Frankfurter Rundschau" vom 13. Oktober 2014: "Karben.
Skizze mit trauriger Geschichte". |
| |
|
Mai 2016: Über
die Stolperstein-Initiative in Karben |
Artikel von Susanne Krejcik in der
"Frankfurter Neuen Presse" vom 20. Mai 2016: "Karbener Initiative.
Stolpersteine gegen das Vergessen
Auf Betreiben der Initiative Stolpersteine in Karben wurden bislang 56
Stolpersteine in den Stadtteilen zur Erinnerung an die Menschen verlegt, die
einst hier lebten und in den Konzentrationslagern ermordet wurden. Und die
Arbeit geht weiter.
In den vergangenen zehn Jahren hat die Initiative mehr als 100
Einzelschicksale recherchiert. 'Mit der Verlegung von Stolpersteinen wollen
wir an die früheren Bürger Karbens erinnern. Darüber hinaus war es uns ein
Anliegen, die Menschen zu informieren und mitzunehmen durch Veranstaltungen
und Gespräche mit Zeitzeugen', sagen Irma Mattner und Hartmut Polzer von der
Initiative Stolpersteine in Karben im Rückblick. Die Teilnahme an einer
Verlegung von Stolpersteinen in Bad Vilbel
im Jahr 2006 habe den Anstoß gegeben, so etwas auch in Karben zu initiieren,
erzählen Mattner und Polzer. Wenn man vor dem Haus stehe, in dem der Mensch
gelebt habe und zudem etwas über sein Leben erfahre, 'dann ist es fast so,
als ob man denjenigen gekannt hat'. Vor zehn Jahren haben sie mit ihren
Recherche-Arbeiten begonnen, im darauffolgenden Jahr haben sie die
Initiative gegründet. Für die Daten, die der Künstler Gunter Demnig
benötigt, um die Steine zur Erinnerung an die Opfer des Holocausts in den
Gehweg verlegen zu können, haben sie via Internet bei Yad Vashem
recherchiert, im Bundesarchiv, in regionalen Archiven wie den Staatsarchiven
in Wiesbaden und Darmstadt sowie im Jüdischen Museum in Frankfurt. Helmut
Weigands Dokumentation 'Groß-Karben und seine Juden' habe ihnen ebenso
geholfen wie die Unterstützung durch Helmut Heide; beide sind verstorbene
Mitglieder des Geschichtsvereins. Durch ihre Recherchen haben sie in
Erfahrung gebracht, wie die jüdischen Bürger einst in Karben lebten, in
welchen Vereinen sie verwurzelt waren und welche Kontakte zu den
christlichen Nachbarn bestanden. Die Recherche-Ergebnisse machten das
funktionierende Miteinander von Juden und Christen in den kleinen Karbener
Stadtteilen bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten deutlich, sagt
Polzer.
Im November 2007 fand die erste Verlegung von Stolpersteinen durch Gunter
Demnig statt. Bis jetzt hat er 56 Stolpersteine in Karben verlegt. Bei den
Verlegungen hat die Initiative mit der Karbener Kurt-Schumacher-Schule
kooperiert und Schüler eingebunden. So trugen diese während der Verlegungen
einzelne Schicksale vor. An manchen Verlegungen nahmen Nachfahren der
Ermordeten teil, die dafür weite Anreisen in Kauf nahmen. Für ihr Engagement
hat die Initiative im Jahr 2009 den Kulturehrenpreis der Stadt Karben
bekommen: Im Jahr 2013 wurde die mit dem Ehrenamtspreis der SPD Hessen Süd
ausgezeichnet. Zu den ersten Zeitzeugen, die von der Initiative im Laufe der
Jahre eingeladen wurden, gehörte Trude Simonsohn im Juni 2007. Durch
Gespräche mit Zeitzeugen wolle man die Erinnerung anschaulich machen, sagen
Mattner und Polzer. Die Initiative – sie gehört dem 'Bündnis für ein offenes
Karben' an – hat mit anderen kooperiert, etwa beim Pogromgedenken und beim 'Trialog
der Religionen' mit dem Deutsch-Ausländischen-Freundschaftskreis sowie mit
verschiedenen Kirchengemeinden. Von Beginn an haben Mattner und Polzer die
Ergebnisse ihrer Recherchen im Internet veröffentlicht. Auf der
Internetseite der Initiative finden sich zudem Informationen in englischer
Sprache. Zu den beeindruckendsten Erlebnissen in den vergangenen Jahren
'gehörten persönliche Begegnungen', sagen Mattner und Polzer. Etwa jene mit
Klara Kirschberg, geboren 1922 in
Burg-Gräfenrode, damals 'Klärchen' genannt. Die Jüdin – nach ihrer
Hochzeit hieß sie Clare Zweig – überlebte den Holocaust durch einen
Kindertransport und wanderte in die USA aus. Dort besuchte Polzer sie
zunächst für ein Interview, das als Grundlage für den Film 'Klärchen –
Flucht in eine fremde Welt' diente, der in Karben gezeigt wurde. Daraus
entwickelte sich eine Freundschaft, die bis zu Zweigs Tod im Jahr 2014
andauerte. Zudem trafen Mattner und Polzer mit Nachfahren aus den USA
zusammen, die sich auf Spurensuche nach ihren Vorfahren in Karben
aufhielten. 'Wir möchten dazu beitragen, dass die Erinnerung an die früheren
Karbener Bürger wachgehalten wird und dass sich so etwas nicht wiederholt',
sagen Irma Mattner und Hartmut Polzer."
Link zum Artikel |
| |
Juni 2016:
Weitere fünf "Stolpersteine" und
eine "Stolperschwelle" wurden in Groß-Karben verlegt
Anmerkung: Es wurden fünf
"Stolpersteine" für die Mitglieder der Familie Strauß in der Heldenberger
Straße 8 verlegt: für Adolf Strauss (1890), Bertha Strauss geb. Kahn (1860),
Ida Strauss geb. Buss (1894), Liselotte (Lilo) Strauss (1921), Walter
Strauss (1926); die Familie konnte 1936 noch in die USA emigrieren; eine
"Stolperschwelle" wurde zur Erinnerung an die Zerstörung der Groß-Kärbener
Synagoge an ihrem Standort in der Heldenberger Straße 10 verlegt. Nach
dieser Verlegung liegen insgesamt 61 "Stolpersteine" in Karben.
Mit der Aktion wird die Verlegung von "Stolpersteinen" in Karben vermutlich
beendet sein.
Vgl. auch den Wikipedia-Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Karben (mit
Fotos der "Stolpersteine" und der "Stolperschwelle")
|
Artikel von Kim Anh Schäfer in der
"Frankfurter Neuen Presse" vom 27. Juni 2016: "Erinnerung an Opfer der
Nationalsozialisten. Stolpern mit Kopf und Herz
In Karben wurden gestern fünf Stolpersteine verlegt – und eine
Stolperschwelle. Sie sollen an die jüdische Gemeinde Groß-Karben und ihre
Synagoge erinnern, die beim Pogrom in der Nacht auf den 10. November 1938
von Nationalsozialisten zerstört wurde. 'Wer ein Erinnern an diese
schreckliche Geschichte nicht mehr für wichtig hält, dem kann ich nur sagen:
Gedenken an Tyrannei und Diktatur hat keine Verfallszeit. Wenn man die
Menschheit und die Geschichte kennt, weiß man, dass so etwas wieder
passieren kann.' So begrüßt Bürgermeister Guido Rahn (CDU) die Karbener, die
gekommen sind, um den während der NS-Zeit verfolgten Juden zu gedenken.
Ideologien wie die der Nationalsozialisten rechtzeitig zu unterbinden, sei
wichtig, betont Rahn – und dafür müsse man die Geschichte kennen. 'Es reicht
nicht zu sagen, es wären nur ein paar Wenige, die so denken: Früher waren es
auch ein paar, dann ein paar mehr, und irgendwann die Mehrheit.' Karben
möchte erinnern, nicht vergessen. Das zeigte sich gestern ein weiteres Mal
deutlich. Insgesamt 56 Stolpersteine sind bereits in der Stadt vor den
damaligen Häusern jüdischer Karbener Bürger verlegt – und erinnern an die
Schicksale, die diese unter Hitlers Schreckensherrschaft erleiden mussten.
Auch Stadtverordnetenvorsteherin Ingrid Lenz (CDU) betont die Wichtigkeit
des Erinnerns. Sie verweist auf die Verpflichtung zum Beistand von Menschen,
die vor Verfolgung fliehen müssen – auch in der Gegenwart. Gunter Demnig
heißt der Kölner Künstler, der seit 1993 Stolpersteine verlegt. Mittlerweile
sind es über 56 000 Steine in 20 europäischen Ländern; in etwa 1600
deutschen Orten liegen Stolpersteine. Auch Demnig begrüßt die Karbener,
bevor er die neuen und vorerst letzten Stolpersteine in der Stadt verlegt.
Er erklärt die Idee, die hinter der Aktion steckt: Durch die Messingplatten,
die mitten in den Gehweg verlegt werden, werden Passanten auf diejenigen
aufmerksam, denen Demnig mit seinem Projekt eine Ehre erweisen möchte. Mit
der Zeit wird das Messing – und damit die Erinnerung – durch das
Darüberlaufen mehr und mehr poliert. 'Wer die Inschrift auf den Steinen
lesen will, muss automatisch eine Verbeugung machen oder sogar niederknien',
erklärt der Künstler. Die beste Erläuterung des Begriffs 'Stolpersteine' sei
von einem Schüler gekommen, erzählt Demnig, der oft mit Schulklassen
arbeitet: 'Man fällt nicht etwa hin, sondern man stolpert mit dem Kopf und
mit dem Herzen.' In der Heldenberger Straße verlegt Demnig nun fünf
Stolpersteine für die Mitglieder der Familie Strauss, über deren Leben
Monika Heinz und Marlies Gebhard-Petri vom Karbener Heimatmuseum erzählen:
Im März 1936 floh die gesamte Familie, die ein Textilgeschäft betrieben
hatte, vor der drohenden Verfolgung nach New York. Obwohl dies noch vor der
Reichspogromnacht 1938 geschah, ahnte die Familie längst, was ihnen
bevorstehen würde, wenn sie blieben: Einige Monate vor der gelungenen Flucht
wurden die Nürnberger Rassegesetze beschlossen. Wesentlich seltener als
Stolpersteine sind die sogenannten Stolper- oder Gedenkschwellen. Dies sind
Messingplatten, die etwa die sechsfache Länge eines einfachen Stolpersteins
haben und ganzen Opfergruppen gewidmet sind. Die Stolperschwelle, die Gunter
Demnig nun in der Heldenberger Straße 10 verlegt, weist auf die Zerstörung
der Groß-Kärber Synagoge hin. Über die Synagoge und die jüdische Gemeinde
Karbens sprechen Laura Semdner und Greta Barion. Sie besuchen an der
Kurt-Schumacher-Schule (KSS) in Karben den Geschichtsleistungskurs von
Lehrerin Monika Lenniger. Werner Giesler, Pfarrer der evangelischen Kirche
Klein-Karben, erklärt die Synagoge als einen Versammlungsort ebenso wie
Kirchen und Moscheen – und verweist auf die morgenländischen Wurzeln des
Christentums im Judentum. 'Wer also von einer christlich-abendländischen
Gesellschaft träumt, spricht von einem Widerspruch in sich.' Rabbiner Andrew
Steiman hält anschließend eine Gedenkrede auf dem Gelände der Groß-Kärber
Synagoge. 'Zwar sind die Steine dieses Gebetsortes zerstört worden, aber die
Heiligkeit kann man nicht zerstören', sagt er. 'So wurde zwar der Altar der
Synagoge zerstört, doch in Form dieser Stolpersteine kommt er nun zurück.
Die Steine sind selbst ein Stückchen Heiligkeit.' Um diese zu spüren, geben
sich die heute erschienenen Karbener die Hände. Rabbiner Steiman spricht mit
ihnen ein jüdisches Gebet, das traditionell für die Angehörigen Toter
gebetet wird. Und schließt mit den Worten 'Dieser Ort hat Zukunft, weil er
Vergangenheit hat'."
Link zum Artikel |
| |
|
April 2020:
Nach der Sanierung der
Groß-Karbener Bahnhofstraße wurden die "Stolpersteine" gesäubert und neu
verlegt |
Artikel in der "Wetterauer Zeitung" vom 3.
April 2020: "Stolpersteine glänzen wieder
Karben (pm). Nachdem die Sanierung der Bürgersteige im ersten Teil der
Groß-Karbener Bahnhofstraße abgeschlossen war, wurden auch die demontierten
Gedenksteine, die an die Verfolgten des Nazi-Regimes erinnern, wieder
verlegt. Irma Mattner und Hartmut Polzer von der Initiative Stolpersteine in
Karben nutzten die Gelegenheit, die Messingsteine, die schon stark oxidiert
waren, aufzupolieren. Jetzt glänzen die sogenannten Stolpersteine, kleine
Messingtafeln, die der Kölner Künstler Gunter Demnig in einem europaweiten
Projekt seit über zehn Jahren in die Fußwege einlässt, wieder am alten
Standort.
Familien Kulb und Grünebaum verfolgt. Vor dem Haus 47 ("Der Weinkeller")
erinnern die Stolpersteine an die Familie Isidor Kulb, die bereits 1934 nach
Uruguay floh, weil die Ausgrenzung der Juden in Groß-Karben schon zu diesem
Zeitpunkt sehr heftig war. So konnte der Bäcker Fourier beispielsweise der
Familie Kulb das Brot nur noch bei Dunkelheit mithilfe von Nachbarn über den
Gartenzaun zukommen lassen, wie Mattner und Polzer in ihrer Pressemitteilung
schreiben. Vor dem Haus 51 erinnern die Stolpersteine an die Familie
Heinrich Grünebaum, die Ende der 1920er Jahre von Rendel nach Groß-Karben
kam. 1935 verließen sie Groß-Karben und hofften, in Frankfurt unter dem
Schutz der großen jüdischen Gemeinde überleben zu können.
Verhaftet und nach Auschwitz gebracht. Im April 1939 flohen sie über
Hamburg nach Belgien, wo sie dann auch ihren Sohn wieder zu sich holten, dem
bereits 1938 die Ausreise mit einem Kindertransport nach Holland gelungen
war. Im Januar 1943 wurde jedoch die ganze Familie verhaftet und von
Mechelen nach Auschwitz deportiert. Diese Deportation war übrigens die
einzige, die von Widerstandskämpfern (es waren drei junge belgische
Studenten), überfallen und zum Halten gebracht wurde, wissen Mattner und
Polzer weiter zu berichten. Nur wenigen gelang die Flucht. Familie Grünebaum
war jedoch nicht dabei. Weitere Informationen über die Initiative finden
sich unter
www.stolpersteine-in-karben.de."
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Quellen:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 288-290. |
 | Helmut Heide: Zur Geschichte der Gross-Karbener
Juden. In: Karben - Geschichte und Gegenwart. Karben 1973 S.
373-398. |
 | ders.: Die Rendeler Juden und ihre Schicksale. Karbener
Heft 1. S. 94-104. Vgl. den online
zu lesenden Auszug. |
 | Helmut Weigand: Groß-Karben und seine Juden.
1993. |
 | Keine Abschnitte zu Groß-Karben bei Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 und |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 327. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 142-144. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Gross-Karben Hesse.
Established in the 17th century, the community numbered 217 (about 24 % of the
total) in 1871, had members in nearby Rendel, and was affiliated with the
Orthodox rabbinate of Giessen. The Jews dealt in agricultural produce and owned
stores, including three kosher butcher shops. On Kristallnacht (9-10
November 1938), the synagogue was burned down and a full-scale pogrom took place.
Of the 80-100 Jews living there in 1933, about two dozen emigrated and survived;
the rest were eventually deported.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|