|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zu den "Synagogen
im Kreis Offenbach"
Egelsbach (Kreis
Offenbach)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Egelsbach bestand eine jüdische Gemeinde bis Ende 1938. Ihre Entstehung
geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück. 1725 werden
erstmals Juden am Ort genannt, 1734 waren es 17 jüdische Einwohner (drei
Erwachsene, 14 Kinder). 1770 werden vier jüdische Familien genannt, 1798 sechs. Im
18. Jahrhundert dürften die jüdischen Familien vor allem in den noch heute
bestehenden "Judengasse" gelebt haben.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1830 40 jüdische Einwohner, 1861 69 (4,3 % von insgesamt 1.589
Einwohnern), 1880 63 (2,9 % von 2.135), 1895 80 (3,7 % von 2.176), 1905 92 (3,2
% von 2.902), 1910 90 (2,8 % von 3.183).
Bis um 1840 gehörten die jüdischen Familien in Egelsbach zur Gemeinde in Langen
und benutzten die dortigen Einrichtungen. Danach bestand eine selbständige jüdische
Gemeinde in Egelsbach.
An Einrichtungen bestanden seit den 1840er-Jahren eine Synagoge (s.u.), eine
Religionsschule, ein rituelles Bad und ein Friedhof.
Die Gemeinde gehörte zum orthodoxen Bezirksrabbinat Darmstadt II. Zur
Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war mindestens im Zeitraum zwischen
1876 und 1905 ein Religionslehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und
Schochet tätig war. Als Religionslehrer waren nacheinander in Egelsbach tätig:
die Herren Levy/Levi (um 1873), Heinebach, Alumann, Stern, Zopf, Ehrmann, Bloch, Gorden,
Mannheimer, Katz, E. Agulnik (um 1892/95), Heilman, Schafheimer, Quittner,
Ansbacher, Eisenberger (1901 genannt, siehe Artikel unten); seit 1902 zum
zweiten Male Lehrer Heilmann, gefolgt von Lehrer Friedmann (bis 1905); danach
wurde der Unterricht der jüdischen Kinder und das Schächten teilweise durch
auswärtige Lehrer/Kultusbeamte übernommen (1905 Religionsunterricht durch
Lehrer Waldek aus Langen,
kurze Zeit wir ein Lehrer Uhlfelder genannt, ab Dezember 1905 Vertretung des
Religionsunterrichtes durch Lehrer Anhalter aus Langen),
1910 wird ein Lehrer Scherr genannt.
Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1868/1878 Marx Kahn, 1881 N. Kahn
(falls kein Schreibfehler für M. Kahn), um 1886 Salomon Reis I., um 1887
M. Katz I., um 1888 Salomon Reis I., um 1899/1900 Hermann Kahn I., um 1900/1902
Lazarus Simon, um 1904 Adolph Holmann, 1906 Simon Grünbaum, Hermann Kahn I und
Max Katz, um 1924ff siehe unten.
Von den jüdischen Vereinen werden genannt: ein Israelitischer
Krankenverein/Wohltätigkeitsverein "Friede" (1906/1915 genannt), eine Ortsgruppe
des "Verbandes der Sabbatfreunde" (1907 genannt). Weitere Vereine s.u..
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Isaak Reis (geb.
12.12.1878 in Egelsbach, gef. 6.10.1915) und Alfred Simon (geb. 16.7.1895 in
Egelsbach, gef. 19.5.1915).
Um 1924, als zur jüdischen Gemeinde etwa 65 Personen gehörten (1,8
% von insgesamt etwa 3.553 Einwohnern, Zahl von 1925), waren die
Gemeindevorsteher Daniel Katz, Sally Rothschild, Isaak Simon II. Den
Religionsunterricht der damals 10 schulpflichtigen jüdischen Kinder wurde durch
Lehrer Saffra aus Frankfurt am Main erteilt. Die Gemeinde hatte diesen
"Wanderlehrer" durch den Freien Vereins für das orthodoxe Judentum
vermittelt bekommen. Als Vorbeter und Schochet kam Hirsch Quiat (Kwiat) aus Sprendlingen
regelmäßig nach Egelsbach. An jüdischen Vereinen gab es eine Chewra
Gemilut Chassodim (Wohltätigkeitsverein) und eine Ortsgruppe des
Central-Vereines (1924 unter Leitung von Daniel Katz) sowie ein "Jüdischer
Jugendverein" (1922 genannt). 1932 waren die
Gemeindevorsteher Moses Reis (1. Vors.), M. Meyer (2. Vors.) und Isaak Simon II
(3. Vors.). Hirsch Quiat (= Hermann Kwiat) war weiterhin Vorbeter und
Schochet (zur Lebensgeschichte seiner Tochter Lieselotte siehe bei der
Literatur); seit April 1925 lebte er auch in Egelsbach. Im Schuljahr 1931/32
waren nur noch zwei schulpflichtige jüdische Kinder in Religion zu
unterrichten.
1933 lebten noch 60 jüdische Einwohner gezählt (1,6 % von
insgesamt 3.707 Einwohnern). In den folgenden Jahren ist ein Teil der jüdischen
Gemeindeglieder auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der Repressalien
weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Unter den Auswanderern war auch der jüdische
Arzt in Egelsbach, Dr. Theo Keller, der aus Friedberg
stammte, seit mindestens 1927 als Arzt in Egelsbach tätig war und mit seiner Familie 1933 wieder nach Friedberg zurückkehrte. Von
hier aus ist er nach Palästina ausgewandert. Andere jüdische Einwohner
verzogen nach Mainz, Frankfurt und nach anderen Orten. Zehn konnten zwischen
1934 und 1938 in die USA emigrieren; Vorbeter Hermann Kwiat emigrierte 1938 nach
Südamerika. Zu gewalttätigen Ausschreitungen kam es bereits vor dem
Novemberpogrom 1938: im September 1938 wurde ein jüdischer Einwohner
durch den NSDAP-Ortsgruppenleiter verprügelt. Am 28. September 1938 drangen
angeblich betrunkene Personen in jüdische Häuser ein, zerschlugen die
Inneneinrichtung und trieben die Bewohner in die Flucht. Beim Novemberpogrom
1938 wurde nicht nur die Inneneinrichtung der Synagoge völlig zerstört,
sondern auch jüdische Familien in ihren Wohnungen überfallen, u.a. die Familie
des Viehhändlers Moses Reis (Schulstraße 16) und die Witwe Friedericke Glückauf
(Taunusstraße 35). Am Abend des 10. November wurde von SA-Leuten die jüdische
Bevölkerung auf den Feldweg nach Langen getrieben. Dabei kam es zu schweren
Misshandlungen. Am 28. Dezember 1938 verzogen die letzten beiden jüdischen
Einwohner nach Darmstadt.
Von den in Egelsbach geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen
Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Edith Bacharach
(1936), Guda (Gutta) Bacharach geb. Katz (1896), Regina (Rega, Recha) Burchardi
geb. Kahn (1879), Emma Eisemann (1925), Johanna Eisemann geb. Katz (1895),
Manfred Eisemann (1923), Sara Fuld geb. Reis (1878), Friederike Glückauf geb.
Reiss (1877), Guda Hamburger geb. Katz (1859), Siegfried Julius Hofmann (1900),
David Katz (1897), Dora (Dorchen) Katz geb. Wetzler (), Gerda Katz (), Gertrude
Katz (1897), Minna Katz (1898), Moritz Katz (1895), Paula Katz (1900), Sally
Katz (1901), Helene Kaufmann geb. Katz (1862), Emilie Korsetz geb. Kohn (1865),
David Mayer (1899), Ellen Mayer (1932), Elsa Oppenheimer geb. Levy (1893), Ester
Reis (1917), Gustav Reis (1880), Hanna Reis geb. Oppenheimer (1881), Rosalie
Reis geb. Hofmann (1893), Theodor (Theo) Reis (1928), Hermann Scher (1911),
Isidor Simon (1899), Kurt Simon (1929), Ludwig Simon (1925), Sophie Simon geb.
Reinhardt (1903), Adolf Stern (1889), Minna Stern geb. Levy (1902), Ida Strauß
geb. Katz (1902), Mathilde Wolf geb. Simon (1883).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1868 / 1876 /
1878 / 1881 / 1886 / 1887 / 1888 / 1899 / 1900 / 1901 / 1902 / 1904 / 1925
Anmerkung: Aus den Anzeigen geht auch der Name
des jeweiligen Gemeindevorstehers hervor.
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Mai 1868:
"Bekanntmachung. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Mai 1868:
"Bekanntmachung.
Die israelitische Religionslehrer- und
Vorsängerstelle zu Egelsbach, Kreis Offenbach, mit welcher ein Gehalt von
230 bis 250 Gulden bar und freier Wohnung verbunden ist, soll alsbald
wieder besetzt werden. Der Schächterdienst, wenn solches der Lehrer
versteht, kann per Jahre auch 40 Gulden eintragen. Konkurrenzfähige
Bewerber wollen sich binnen 4 Wochen unter Vorlage ihrer Zeugnisse bei dem
unterzeichneten Vorstand unter portofreien Eingaben melden. Der israelitische
Vorstand Marx Kahn." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. November 1876:
"Bekanntmachung. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. November 1876:
"Bekanntmachung.
Die israelitische Religionslehrer- und
Vorsängerstelle zu Egelsbach, Kreis Offenbach, mit welcher ein Gehalt von
500 bis 600 Mark bar und freier Wohnung verbunden ist, soll alsbald wieder
besetzt werden. Der Schächterdienst, wenn solchen der Lehrer versteht,
kann per Jahr 60 Mark betragen.
Konkurrenzfähige Bewerber wollen sich binnen vier Wochen unter Vorlage
ihrer Zeugnisse bei dem unterzeichneten Vorstand unter portofreien
Eingaben melden.
Der israelitische Vorstand M. Kahn." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Januar 1878:
"Bekanntmachung. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Januar 1878:
"Bekanntmachung.
Die israelitische Religionslehrer- und
Vorsängerstelle zu Egelsbach, Kreis Offenbach, mit welcher ein Gehalt von
400 bis 500 Mark bar und freier Wohnung verbunden ist, soll sogleich wieder
besetzt werden. Der Schächterdienst, wenn solchen der Lehrer versteht,
kann pro Jahr 60 Mark eintragen.
Konkurrenzfähige Bewerber wollen sich binnen vier Wochen unter Vorlage
ihrer Zeugnisse bei den unterzeichneten Vorstand unter portofreier Eingabe
melden.
Der Israelitische Vorstand. Marx Kahn." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juli 1881:
"Die hiesige Lehrer- und Vorsängerstelle ist vakant. Gehalt bei
freier Wohnung 500 Mark. Schochet erwünscht, welche Stelle auch
mindestens 200 Mark einträgt. Bewerber wollen sich entweder schriftlich
oder selbst in Person sofort bei unterzeichnetem Vorstand melden.
Reisekosten erhält nur derjenige, welcher engagiert wird. Egelsbach bei
Langen, 28. Juni 1881. N. Kahn." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juli 1881:
"Die hiesige Lehrer- und Vorsängerstelle ist vakant. Gehalt bei
freier Wohnung 500 Mark. Schochet erwünscht, welche Stelle auch
mindestens 200 Mark einträgt. Bewerber wollen sich entweder schriftlich
oder selbst in Person sofort bei unterzeichnetem Vorstand melden.
Reisekosten erhält nur derjenige, welcher engagiert wird. Egelsbach bei
Langen, 28. Juni 1881. N. Kahn." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. August 1886:
"Egelsbach. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. August 1886:
"Egelsbach.
Die israelitische Gemeinde wünscht einen Lehrer
nebst Schächter und Vorsänger ledigen Standes, womöglichst Deutscher,
mit Gehalt von ca. 500 Mark nebst Nebenverdienste, bei sofortigem
Eintritt.
Der israelitische Vorstand Salomon Reis I." |
| |
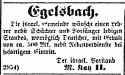 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Juni 1887:
"Egelsbach. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Juni 1887:
"Egelsbach.
Die israelitische Gemeinde wünscht einen Lehrer
nebst Schächter und Vorsänger ledigen Standes, womöglich Deutscher, mit
Gehalt von ca. 500 Mark nebst Nebenverdienste bei sofortigem Eintritt.
Der israelitische Vorstand M. Katz II." |
| |
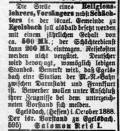 Anzeige
in der "israelitischen Wochenschrift für die religiösen und sozialen
Interessen des Judentums" 1888 Heft 19: "Die Stelle eines
Religionslehrers, Vorsängers nebst Schächters in der
israelitischen Gemeinde zu Egelsbach soll alsbald besetzt werden mit
einem jährlichen Gehalt von circa 500 Mark; der Schächterdienst kann 200
Mark eintragen. Reisekosten werden nicht vergütet. Deutscher wird bevorzugt,
womöglich ledigen Standes. Bemerkt wird, dass Egelsbach eine Station der
Main-Neckar-Bahn zwischen Darmstadt und Frankfurt ist. Bewerber wollen unter
Anschluss ihre Zeugnisse bei dem unterzeichneten Vorstand sich melden. Anzeige
in der "israelitischen Wochenschrift für die religiösen und sozialen
Interessen des Judentums" 1888 Heft 19: "Die Stelle eines
Religionslehrers, Vorsängers nebst Schächters in der
israelitischen Gemeinde zu Egelsbach soll alsbald besetzt werden mit
einem jährlichen Gehalt von circa 500 Mark; der Schächterdienst kann 200
Mark eintragen. Reisekosten werden nicht vergütet. Deutscher wird bevorzugt,
womöglich ledigen Standes. Bemerkt wird, dass Egelsbach eine Station der
Main-Neckar-Bahn zwischen Darmstadt und Frankfurt ist. Bewerber wollen unter
Anschluss ihre Zeugnisse bei dem unterzeichneten Vorstand sich melden.
Egelsbach, (Hessen) im Oktober 1888. Der israelitische Vorstand zu
Egelsbach. Salomon Reis I." |
| |
| Besonders schwierig war
1899/1900 die Stelle zu besetzen: über mehrere Monate erschienen Anzeigen
in der Zeitschrift "Der Israelit" - das Antrittsdatum der Stelle
wurde mit jeder Anzeige nach hinten verschoben: |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1899: "In der
israelitischen Gemeinde Egelsbach bei Darmstadt ist die
Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle per März neu zu
besetzen. Der Gehalt beträgt 500 Mark, nächst freier Wohnung und gutem
Nebeneinkommen. Offerten nebst Zeugnisse an den Vorstand erbeten. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1899: "In der
israelitischen Gemeinde Egelsbach bei Darmstadt ist die
Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle per März neu zu
besetzen. Der Gehalt beträgt 500 Mark, nächst freier Wohnung und gutem
Nebeneinkommen. Offerten nebst Zeugnisse an den Vorstand erbeten.
Hermann Kahn I." |
| |
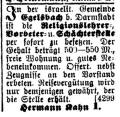 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juni 1899: "In der
israelitischen Gemeinde Egelsbach bei Darmstadt ist die
Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle per sofort zu besetzen
der Gehalt beträgt 500-550 Mark, freie Wohnung und gutes Nebeneinkommen.
Offerten nebst Zeugnisse an den Vorstand erbeten. Reisevergütung wird nur
demjenigen gewährt, der die Stelle erhält. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juni 1899: "In der
israelitischen Gemeinde Egelsbach bei Darmstadt ist die
Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle per sofort zu besetzen
der Gehalt beträgt 500-550 Mark, freie Wohnung und gutes Nebeneinkommen.
Offerten nebst Zeugnisse an den Vorstand erbeten. Reisevergütung wird nur
demjenigen gewährt, der die Stelle erhält.
Hermann Kahn I." |
| |
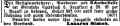 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1900:
"Die Religionslehrer-, Vorbeter- und Schochetstelle der Gemeinde
Egelsbach bei Frankfurt am Main ist per 1. August zu besetzen. Gehalt Mark
600 nebst freier, großer Wohnung und guten Nebenverdiensten. Bewerber
wollen vorher ihre Zeugnisse einsenden an den Vorstand. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1900:
"Die Religionslehrer-, Vorbeter- und Schochetstelle der Gemeinde
Egelsbach bei Frankfurt am Main ist per 1. August zu besetzen. Gehalt Mark
600 nebst freier, großer Wohnung und guten Nebenverdiensten. Bewerber
wollen vorher ihre Zeugnisse einsenden an den Vorstand.
Lazarus
Simon." |
| |
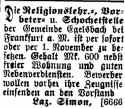 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. September 1900: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. September 1900:
"Die Religionslehrer-, Vorbeter und Schochetstelle der
Gemeinde Egelsbach bei Frankfurt am Main ist per sofort oder per 1.
November zu besetzen. Gehalt Mark 600 nebst freier Wohnung und guten
Nebenverdiensten. Bewerber wollen vorher ihre Zeugnisse einsenden an den
Vorstand
Lazarus Simon". |
| |
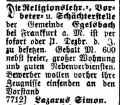 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Oktober 1900: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Oktober 1900:
"Die Religionslehrer-, Vorbeter und Schächterstelle der Gemeinde
Egelsbach bei Frankfurt am Main ist per sofort oder 1. Dezember dieses
Jahres zu besetzen. Gehalt Mark 600 nebst freier, großer Wohnung und
guten Nebenverdiensten. Bewerber wollen vorher ihre Zeugnisse einsenden an
den Vorstand
Lazarus Simon." |
| |
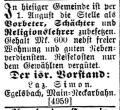 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juni 1901: "In hiesiger
Gemeinde ist per 1. August die Stelle als Vorbeter, Schächter
und Religionslehrer zu besetzen. Gehalt Mark 600 nebst freier Wohnung
und guten Nebenverdienst. Reisekosten nur dem Gewählten vergütet. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juni 1901: "In hiesiger
Gemeinde ist per 1. August die Stelle als Vorbeter, Schächter
und Religionslehrer zu besetzen. Gehalt Mark 600 nebst freier Wohnung
und guten Nebenverdienst. Reisekosten nur dem Gewählten vergütet.
Der israelitische Vorstand: Lazarus Simon.
Egelsbach, Main-Neckar-Bahn." |
| |
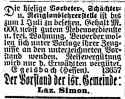 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Mai 1902:
"Die hiesige Vorbeter-, Schächter und Religionslehrerstelle ist bis
zum 1. Juli zu besetzen. Gehalt Mark 600, nebst gutem Nebenverdienste und
freier Wohnung. Bewerber wollen sich unter Vorlage ihrer Zeugnisse an den
unterzeichneten Vorstand wenden. Reisevergütung wird nur dem Erwählten
vergütet. Egelsbach (Hessen). Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Mai 1902:
"Die hiesige Vorbeter-, Schächter und Religionslehrerstelle ist bis
zum 1. Juli zu besetzen. Gehalt Mark 600, nebst gutem Nebenverdienste und
freier Wohnung. Bewerber wollen sich unter Vorlage ihrer Zeugnisse an den
unterzeichneten Vorstand wenden. Reisevergütung wird nur dem Erwählten
vergütet. Egelsbach (Hessen).
Der Vorstand der israelitischen Gemeinde: Lazarus Simon." |
| |
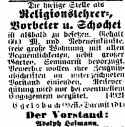 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. August 1904:
"Die hiesige Stelle als Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. August 1904:
"Die hiesige Stelle als
Religionslehrer-, Vorbeter und Schochet
ist alsbald zu besetzen. Gehalt 600 Mark und Nebeneinkünfte, freie große
Wohnung mit allen Bequemlichkeiten, nebst großem Garten. Seminarist
bevorzugt. Bewerber wollen ihre Zeugnisabschriften an unterzeichneten
Vorstand einsenden. Reisevergütung wird nur bei eventuellem Engagement
vergütet.
Egelsbach (Hessen-Darmstadt). Der Vorstand: Adolph Holmann". |
|
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. April 1925:
"Wir suchen per sofort einen Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. April 1925:
"Wir suchen per sofort einen
Vorbeter und Schochet (gleichzeitig
Religionslehrer).
Geräumige neue Dienstwohnung mit Garten vorhanden.
Gehalt nach Vereinbarung. Bewerbungsschreiben bittet man an den
israelitischen vorstand Moses Reis in Egelsbach zu senden." |
Vakaturvertretungen auf der Lehrer- und Vorbeterstelle
(1905)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. Juli 1905:
"Egelsbach. Seit dem Weggange der Herrn Friedmann ist die Stelle
eines israelitischen Religionslehrers noch nicht wieder besetzt. Dieselbe
wird durch Herrn Eschwege aus Frankfurt, der den Gottesdienst abhält,
verwaltet, während der Religionsunterricht durch Herrn Lehrer Waldek aus
Langen abgehalten wird. - Das Verhältnis wird - wie es scheint - auch in
der nächsten Zeit keine Änderung erfahren, sind die beteiligten Kreise
bis jetzt doch ganz zufrieden damit." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. Juli 1905:
"Egelsbach. Seit dem Weggange der Herrn Friedmann ist die Stelle
eines israelitischen Religionslehrers noch nicht wieder besetzt. Dieselbe
wird durch Herrn Eschwege aus Frankfurt, der den Gottesdienst abhält,
verwaltet, während der Religionsunterricht durch Herrn Lehrer Waldek aus
Langen abgehalten wird. - Das Verhältnis wird - wie es scheint - auch in
der nächsten Zeit keine Änderung erfahren, sind die beteiligten Kreise
bis jetzt doch ganz zufrieden damit." |
Lehrer Uhlfelder verlässt Egelsbach (1905)
Anmerkung: Lehrer Uhlfelder war vermutlich nur wenige
Monate in Egelsbach (vgl. den vorigen Artikel vom Juli
1905)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 1. Dezember
1905: "Egelsbach. Durch den Weggang des Herrn Lehrer Uhlfelder
ist die hiesige Vorbeterstelle Herrn Eschwege aus Frankfurt, welcher
dieselbe schon einmal versehen hat, und die Religionslehrerstelle Herrn
Lehrer Anhalter - Langen übertragen
worden." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 1. Dezember
1905: "Egelsbach. Durch den Weggang des Herrn Lehrer Uhlfelder
ist die hiesige Vorbeterstelle Herrn Eschwege aus Frankfurt, welcher
dieselbe schon einmal versehen hat, und die Religionslehrerstelle Herrn
Lehrer Anhalter - Langen übertragen
worden." |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Vorstandswahlen (1906)
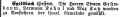 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 19. Januar
1906: "Egelsbach (Hessen). Die Herren Simon Grünbaum, Hermann
Kahn I und Max Katz wurden zu Vorstehern der israelitischen Gemeinde
gewählt." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 19. Januar
1906: "Egelsbach (Hessen). Die Herren Simon Grünbaum, Hermann
Kahn I und Max Katz wurden zu Vorstehern der israelitischen Gemeinde
gewählt." |
Trauerfeier zum Tod von Bezirksrabbiner Dr. Nathan Cahn
(1924)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. September
1924: "Egelsbach bei Darmstadt, 31. August (1924). Angesichts des
plötzlichen Hinscheidens unseres hoch verehrten und geliebten
Bezirksrabbiners Dr. Nathan Cahn - das Andenken an den Gerechten ist
zum Segen - wurde in unserer Gemeinde zu Ehren des Dahingeschiedenen
eine Trauerrede von unserem Lehrer, Herrn Nossel (oder Rossel?),
abgehalten. Er schilderte vor der tief betrübten Gemeinde in ergreifenden
Worten die unermüdliche Aufopferungsfreudigkeit und die großen Wohltaten
des Verstorbenen. Drum wollen wir mit doppelter Energie bestrebt sein, die
Ziele des teuren Verstorbenen zu verfolgen und zu erreichen."
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. September
1924: "Egelsbach bei Darmstadt, 31. August (1924). Angesichts des
plötzlichen Hinscheidens unseres hoch verehrten und geliebten
Bezirksrabbiners Dr. Nathan Cahn - das Andenken an den Gerechten ist
zum Segen - wurde in unserer Gemeinde zu Ehren des Dahingeschiedenen
eine Trauerrede von unserem Lehrer, Herrn Nossel (oder Rossel?),
abgehalten. Er schilderte vor der tief betrübten Gemeinde in ergreifenden
Worten die unermüdliche Aufopferungsfreudigkeit und die großen Wohltaten
des Verstorbenen. Drum wollen wir mit doppelter Energie bestrebt sein, die
Ziele des teuren Verstorbenen zu verfolgen und zu erreichen." |
Berichte zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
Zum Tod des langjährigen Vorstehers und ehrenamtlichen
Vorbeters Nathan Kahn (1897)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. November 1897: "Egelsbach,
28. Oktober (1897). Mit dem Tode des ältesten, immer an der Spitze der
Gemeinde stehenden Nathan Kahn, verloren wir eines unserer hervorragenden
Mitglieder. Die Ausübung von Tora, Gottesdienst und Wohltätigkeit waren
seine höchste Freude. Seit einem halben Jahrhundert fungierte er als Vorbeter
an den ehrfurchtgebietenden Tagen (sc. Tage von Neujahrsfest bis Jom
Kippur). So war es ihm noch gegönnt, im Alter von 79 Jahren am
verflossenen Jom Kippur das Minchagebet vorzutragen und am Sukkot-Fest
das Matnes Jad zu verrichten. Seit dem Bestehen der hiesigen Chewra
Gemilut Chassodim (Wohltätigkeitsverein) war er erster Vorstand
derselben. Herr Großherzoglicher Landesrabbiner Dr. Marx aus Darmstadt
schilderte in meisterhafter Weise die Tugenden des Verstorbenen und den
herben Verlust, den die Gemeinde erlitten." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. November 1897: "Egelsbach,
28. Oktober (1897). Mit dem Tode des ältesten, immer an der Spitze der
Gemeinde stehenden Nathan Kahn, verloren wir eines unserer hervorragenden
Mitglieder. Die Ausübung von Tora, Gottesdienst und Wohltätigkeit waren
seine höchste Freude. Seit einem halben Jahrhundert fungierte er als Vorbeter
an den ehrfurchtgebietenden Tagen (sc. Tage von Neujahrsfest bis Jom
Kippur). So war es ihm noch gegönnt, im Alter von 79 Jahren am
verflossenen Jom Kippur das Minchagebet vorzutragen und am Sukkot-Fest
das Matnes Jad zu verrichten. Seit dem Bestehen der hiesigen Chewra
Gemilut Chassodim (Wohltätigkeitsverein) war er erster Vorstand
derselben. Herr Großherzoglicher Landesrabbiner Dr. Marx aus Darmstadt
schilderte in meisterhafter Weise die Tugenden des Verstorbenen und den
herben Verlust, den die Gemeinde erlitten." |
Zum Tod von Simon Simon (1901)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. November 1901:
"Egelsbach, 10. November (1901). Am 23. Cheschwan (= 5.
November 1901) starb dahier Herr Simon Simon im Alter von 80
Jahren. Der Verstorbene gehörte zu den beliebtesten Mitgliedern unserer
Gemeinde. Die zahlreiche Beteiligung von nahe und fern bei der Kewuro
(Beerdigung) bewies, dass der Verstorbene im hohen Ansehen stand. Am Grabe
sprach in meisterhafter Ausführung Seiner Ehrwürden Herr
Provinzial-Rabbiner Dr. Marx - sein Licht leuchte. Anknüpfend an
den Text 'Und Abraham starb in einem guten Greisenalter' (1. Mose
25,8) usw. entwickelte er in seiner Rede, dass Herr Simon ein würdiger
Nachkomme unseres Erzvaters Abraham war, dass er treu am Judentume hing
und die Vorschriften unserer heiligen Religion treu befolgte. Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. Eisenberger,
Lehrer."
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. November 1901:
"Egelsbach, 10. November (1901). Am 23. Cheschwan (= 5.
November 1901) starb dahier Herr Simon Simon im Alter von 80
Jahren. Der Verstorbene gehörte zu den beliebtesten Mitgliedern unserer
Gemeinde. Die zahlreiche Beteiligung von nahe und fern bei der Kewuro
(Beerdigung) bewies, dass der Verstorbene im hohen Ansehen stand. Am Grabe
sprach in meisterhafter Ausführung Seiner Ehrwürden Herr
Provinzial-Rabbiner Dr. Marx - sein Licht leuchte. Anknüpfend an
den Text 'Und Abraham starb in einem guten Greisenalter' (1. Mose
25,8) usw. entwickelte er in seiner Rede, dass Herr Simon ein würdiger
Nachkomme unseres Erzvaters Abraham war, dass er treu am Judentume hing
und die Vorschriften unserer heiligen Religion treu befolgte. Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. Eisenberger,
Lehrer." |
Silberne Hochzeit von Hermann Kahn I und seiner Frau geb. Löwenstein
(1903)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. August
1903: "Egelsbach. Herr Hermann Kahn I. und Frau geb.
Löwenstein feierten am 8. dieses Monats das Fest der silbernen
Hochzeit." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. August
1903: "Egelsbach. Herr Hermann Kahn I. und Frau geb.
Löwenstein feierten am 8. dieses Monats das Fest der silbernen
Hochzeit." |
70. Geburtstag von Daniel Katz (1931)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Dezember 1931: "Egelsbach
bei Darmstadt, 20. Dezember (1931). Am 20. Teweth feiert Herr Daniel Katz
seinen 70. Geburtstag. Herr Katz ist in dem Kreise der Gesetzestreuen kein
Unbekannter. Schon von seiner frühesten Jugend an unbeirrbar und fest auf
dem Boden des gesetzestreuen Judentums stehend, hat er sein Lebensprinzip
als Kohen Zedek (sc. Herleitung des Familiennamens Katz =
Priester der Gerechtigkeit; Herleitung aus einer Kohen-Familie) und
treuer Jehudi durchs Leben zu gehen, ohne Wanken stets hoch
gehalten. 'Es fallen dir zur Seite Tausend und Zehntausend zu deiner
Rechten - dir nahet sie nicht' (Psalm 91,7). Mochten auch allenthalben
sich Abfall und Gleichgültigkeit gegenüber den Anforderungen unserer Tora
geltend machen, für ihn hab es in seinem familiären und geschäftlichen
Leben nur stets das eine: der Tora gemäß zu leben. Zu allen
Veranstaltungen, die in Frankfurt, der Metropole der deutschen Orthodoxie,
oder in Darmstadt für die Tora stattfinden, stets findet sich auch Daniel
Katz ein, wo Gelegenheit ist zu lernen oder für Torajudentum einzutreten.
Wenn auch manchmal in den letzten Jahren gesundheitliche Störungen sich
geltend machen wollen - wenn in Darmstadt ein Lehrerschiur (Lernvortrag)
stattfindet oder in Frankfurt in der Friedberger Anlage sich Gelegenheit
bietet, an einem Jom Kippur Katan-Gottesdienst teilzunehmen, dann
ist Herr Katz gesund, dann hält ihn nicht zurück, der Tora und dem
Gottesdienst dienend sich hinzugeben. Er gehört zu den Juden, wie sie
heute auf dem Lande leider immer seltener werden, die patriarchengleich
fest stehen auf dem graniten Felsen altjüdischer Lebensgestaltung. Wer je
Gelegenheit hat, nach Egelsbach zu kommen, versäumt nicht, den alten
Herrn in seinem Heim aufzusuchen, und wenn der Besucher gar mit Worten
der Tora aufzuwarten hat, dann findet er in Herrn Katz einen gar
freudigen und dankbaren Hörer. So hat Herr Katz verstanden, sein Heim zu
einem kleinen Heiligtum zu gestalten, in dem sich jüdisches
Familieleben in prächtigster Weise entfalten konnte und ihm Kinder
erwuchsen, die im Sinne ihres Vaters leben. Es gibt wohl in unserem Lande
kaum eine gesetzestreue Institution, für die Herr Katz nicht schon nach Kräften
gesteuert. Wie Daniel Katz Wohltätigkeit zu üben versteht,
dürfte nachfolgende Episode erzählen, die Schreiber dieses vor mehr als
zwanzig Jahren erlebte. Er weilte gerade in einem oberhessischen
jüdischen Hause, als ein armer Wanderer erschien. Als der Arme in diesem
Hause gastfreundlich mit Speise und Trank bewirtet ward, ging ihm das Herz
auf und er fing an zu reden: 'Nicht überall werden wir Armen so
behandelt. Aber einen Mann gibt es, bei dem ich auch vorige Woche gegessen
und getrunken habe. Und als ich ihm einige Tage später in Frankfurt auf
der Straße begegnete, kam er auf mich zu und reichte mir mit Schalom
Aleichem-Gruß die Hand.' 'Das ist Daniel Katz aus Egelsbach!' 'Jawohl, es
ist Daniel Katz.' Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Dezember 1931: "Egelsbach
bei Darmstadt, 20. Dezember (1931). Am 20. Teweth feiert Herr Daniel Katz
seinen 70. Geburtstag. Herr Katz ist in dem Kreise der Gesetzestreuen kein
Unbekannter. Schon von seiner frühesten Jugend an unbeirrbar und fest auf
dem Boden des gesetzestreuen Judentums stehend, hat er sein Lebensprinzip
als Kohen Zedek (sc. Herleitung des Familiennamens Katz =
Priester der Gerechtigkeit; Herleitung aus einer Kohen-Familie) und
treuer Jehudi durchs Leben zu gehen, ohne Wanken stets hoch
gehalten. 'Es fallen dir zur Seite Tausend und Zehntausend zu deiner
Rechten - dir nahet sie nicht' (Psalm 91,7). Mochten auch allenthalben
sich Abfall und Gleichgültigkeit gegenüber den Anforderungen unserer Tora
geltend machen, für ihn hab es in seinem familiären und geschäftlichen
Leben nur stets das eine: der Tora gemäß zu leben. Zu allen
Veranstaltungen, die in Frankfurt, der Metropole der deutschen Orthodoxie,
oder in Darmstadt für die Tora stattfinden, stets findet sich auch Daniel
Katz ein, wo Gelegenheit ist zu lernen oder für Torajudentum einzutreten.
Wenn auch manchmal in den letzten Jahren gesundheitliche Störungen sich
geltend machen wollen - wenn in Darmstadt ein Lehrerschiur (Lernvortrag)
stattfindet oder in Frankfurt in der Friedberger Anlage sich Gelegenheit
bietet, an einem Jom Kippur Katan-Gottesdienst teilzunehmen, dann
ist Herr Katz gesund, dann hält ihn nicht zurück, der Tora und dem
Gottesdienst dienend sich hinzugeben. Er gehört zu den Juden, wie sie
heute auf dem Lande leider immer seltener werden, die patriarchengleich
fest stehen auf dem graniten Felsen altjüdischer Lebensgestaltung. Wer je
Gelegenheit hat, nach Egelsbach zu kommen, versäumt nicht, den alten
Herrn in seinem Heim aufzusuchen, und wenn der Besucher gar mit Worten
der Tora aufzuwarten hat, dann findet er in Herrn Katz einen gar
freudigen und dankbaren Hörer. So hat Herr Katz verstanden, sein Heim zu
einem kleinen Heiligtum zu gestalten, in dem sich jüdisches
Familieleben in prächtigster Weise entfalten konnte und ihm Kinder
erwuchsen, die im Sinne ihres Vaters leben. Es gibt wohl in unserem Lande
kaum eine gesetzestreue Institution, für die Herr Katz nicht schon nach Kräften
gesteuert. Wie Daniel Katz Wohltätigkeit zu üben versteht,
dürfte nachfolgende Episode erzählen, die Schreiber dieses vor mehr als
zwanzig Jahren erlebte. Er weilte gerade in einem oberhessischen
jüdischen Hause, als ein armer Wanderer erschien. Als der Arme in diesem
Hause gastfreundlich mit Speise und Trank bewirtet ward, ging ihm das Herz
auf und er fing an zu reden: 'Nicht überall werden wir Armen so
behandelt. Aber einen Mann gibt es, bei dem ich auch vorige Woche gegessen
und getrunken habe. Und als ich ihm einige Tage später in Frankfurt auf
der Straße begegnete, kam er auf mich zu und reichte mir mit Schalom
Aleichem-Gruß die Hand.' 'Das ist Daniel Katz aus Egelsbach!' 'Jawohl, es
ist Daniel Katz.'
So steht Herr Daniel Katz als Siebziger fest auf den Boden des
Torajudentums. Möge ihm Gott die Gnade gewähren, noch
lange Jahre in Gesundheit zu verbringen, zum Zeichen dessen, dass man auch
auf dem Lande als Vereinzelter ein guter und treuer Jehudi sein kann. (Alles
Gute) bis 120 Jahre." |
75. Geburtstag von Daniel Katz (1936)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Dezember 1936:
"Egelsbach, 20. Dezember (1936). Am 23. Dezember vollendete der
Senior unserer Gemeinde, Herr Daniel Katz, sein 75. Lebensjahr. Herr Katz
ist einer der Männer, die auf dem Lande immer seltener werden. Seine
durchaus gesetzes- und traditionstreue Lebensführung, seine Liebe zur
Tora machen ihn in dem weiten Kreises derer, die ihn kennen, zu einer
verehrungswürdigen Persönlichkeit. Möge ihm Gott die Gnade gewähren,
ihn noch recht lange in ungeschwächter Gesundheit seiner Familie und
seinen Freunden zu erhalten. (Alles Gute) bis 120." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Dezember 1936:
"Egelsbach, 20. Dezember (1936). Am 23. Dezember vollendete der
Senior unserer Gemeinde, Herr Daniel Katz, sein 75. Lebensjahr. Herr Katz
ist einer der Männer, die auf dem Lande immer seltener werden. Seine
durchaus gesetzes- und traditionstreue Lebensführung, seine Liebe zur
Tora machen ihn in dem weiten Kreises derer, die ihn kennen, zu einer
verehrungswürdigen Persönlichkeit. Möge ihm Gott die Gnade gewähren,
ihn noch recht lange in ungeschwächter Gesundheit seiner Familie und
seinen Freunden zu erhalten. (Alles Gute) bis 120." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Feidel Hofmann sucht eine
Haushälterin (1891) und für ihren Sohn eine Lehrstelle als Schneider (1895)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. März 1891: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. März 1891:
"Ein Mädchen als Haushälterin zum sofortigen Eintritt wird gesucht
von Feidel Hofmann, Egelsbach." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. April 1895: "Ich suche zur
Erlernung des Schneiderhandwerks für meinen Sohn einen jüdischen Meister.
Feidel Hofmann, Egelsbach. " Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. April 1895: "Ich suche zur
Erlernung des Schneiderhandwerks für meinen Sohn einen jüdischen Meister.
Feidel Hofmann, Egelsbach. " |
Anzeige von Schuhmachermeister Leopold Hofmann (1901)
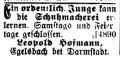 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Juni 1901: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Juni 1901:
"Ein ordentlicher Junge kann die Schuhmacherei erlernen.
Samstags und Feiertage geschlossen.
Leopold Hofmann, Egelsbach bei
Darmstadt." |
Anzeige von Lazarus Simon (1901)
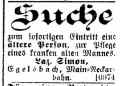 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. September 1901: "Suche Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. September 1901: "Suche
zum sofortigen Eintritt eine ältere Person, zur Pflege eines
kranken alten Mannes.
Lazarus Simon,
Egelsbach, Main-Neckar-Bahn." |
Verlobungsanzeige von Johanna Katz
und Hugo Eisemann (1921)
Anmerkung: Hugo Eisemann (geb. 1892) und Johanna geb. Eisemann (geb. 1895)
sind nach der Deportation in der NS-Zeit umgekommen.
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Dezember 1921: "Statt Karten! Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Dezember 1921: "Statt Karten!
Johanna Katz - Hugo Eisemann
Verlobte
Egelsbach bei Frankfurt am Main
Bauerbach S.M.
Frankfurt am Main Lange Straße 3 und 60 ." |
Verlobungsanzeige von Recha Levy
und Ludwig Oppenheimer (1924)
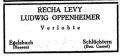 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. September 1924:
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. September 1924:
"Recha Levy - Ludwig Oppenheimer
Verlobte Egelsbach (Hessen) -
Schlüchtern (Bezirk Kassel)" |
Verlobungsanzeige von Julie Bamberger und David Katz
(1930)
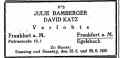 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Juni
1930: "Gott sei gepriesen.
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Juni
1930: "Gott sei gepriesen.
Julie Bamberger - David Katz
Verlobte
Frankfurt am Main Fichtestraße 18,1 -
Frankfurt am Main / Egelsbach.
Zu Hause: Samstag
und Sonntag, den 28.6. und 29.6.1930". |
Zur Geschichte der Synagoge
Bis um 1840 besuchten die jüdischen Familien aus Egelsbach
die Synagoge in Langen. In den
1840er-Jahren stellte Wolf Simon einen Raum in seinem Privathaus für die
Gottesdienste in Egelsbach zur Verfügung (Gebäude Schulstraße 50). Im Haus
befand sich auch ein Ritualbad (Mikwe). Dieses Haus wurde 1703 von Simon Simon,
eine der ältesten jüdischen Familien in Egelsbach erbaut (der Jahr ist bekannt
auf Grund der Übersetzung der in den 1920er-Jahren entfernten Hausinschrift).
1847 erwarb die Gemeinde
das Anwesen Keim in der Langener Straße 1, das in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts erbaut
und in der Folgezeit als Gastwirtschaft mit Tanzsaal worden war. Es hatte ein Sockelgeschoss aus Bruchstein und ein Obergeschoss mit
spätbarockem Fachwerk. Der Verkauf des Gebäudes wurde am 16. Juni 1847
unterzeichnet. In dem Haus wurden ein Betraum sowie die Lehrerwohnung und ein rituelles Bad
eingerichtet. 1903 wird der Betsaal allerdings als ein "schmuckloses
Zimmer" beschrieben (s.u.). In ihm
waren drei Torarollen vorhanden. Nachdem eine unbrauchbar geworden war, sammelte
ein Tora-Verein die Mittel für eine neue dritte Torarolle. Diese konnte im
August 1897 mit einem Fest für den ganzen Ort eingeweiht werden:
Einweihung einer neuen Torarolle im alten Betsaal im August 1897
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1897: "Egelsbach. Die
hiesige Gemeinde feierte vergangenen Schabbat Nachamu ein Fest, wie ein
solches seit 32 Jahren noch nicht stattgefunden hat. Es war eine
Tora-Einweihung. Vor ca. 3 Jahren gründete der jetzt in
Bischofsheim bei
Mainz stehende Lehrer Agulnik einen "Tora-Verein". welchem nur
12 Gemeinde-Mitglieder beitraten, trotzdem eine Tora noch sehr nötig
gebraucht wurde; da bloß zwei solcher vorhanden sind. (Das dritte Sefer
ist unbrauchbar). Durch monatliche Beiträge und durch freiwillige Gaben
einiger Auswärtiger kam der Verein in die glückliche Lage, eine
Torarolle schreiben zu lassen und die Weihe am vergangenen Schabbat
feierlichst zu begehen. Freitag Nachmittag hielt Seiner Ehrwürden Herr
Großherzoglicher Landesrabbiner Dr. Marx - sein Licht leuchte -
nachdem die Torarolle angefertigt war, eine ergreifende Ansprache, worin
namentlich der Schlusslochstab L und der Anfangsbuchstabe B von der
Torarolle die Hauptrolle spielte (gemeint: 1. Mose 1,1 beginnt mit B,
5. Buch Mose endet auf L). Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1897: "Egelsbach. Die
hiesige Gemeinde feierte vergangenen Schabbat Nachamu ein Fest, wie ein
solches seit 32 Jahren noch nicht stattgefunden hat. Es war eine
Tora-Einweihung. Vor ca. 3 Jahren gründete der jetzt in
Bischofsheim bei
Mainz stehende Lehrer Agulnik einen "Tora-Verein". welchem nur
12 Gemeinde-Mitglieder beitraten, trotzdem eine Tora noch sehr nötig
gebraucht wurde; da bloß zwei solcher vorhanden sind. (Das dritte Sefer
ist unbrauchbar). Durch monatliche Beiträge und durch freiwillige Gaben
einiger Auswärtiger kam der Verein in die glückliche Lage, eine
Torarolle schreiben zu lassen und die Weihe am vergangenen Schabbat
feierlichst zu begehen. Freitag Nachmittag hielt Seiner Ehrwürden Herr
Großherzoglicher Landesrabbiner Dr. Marx - sein Licht leuchte -
nachdem die Torarolle angefertigt war, eine ergreifende Ansprache, worin
namentlich der Schlusslochstab L und der Anfangsbuchstabe B von der
Torarolle die Hauptrolle spielte (gemeint: 1. Mose 1,1 beginnt mit B,
5. Buch Mose endet auf L).
Vom herrlichsten Wetter begünstigt, stellte sich der Festzug, nachdem um
6 Uhr morgens das Schacharit-Gebet verrichtet wurde, um 9 Uhr in schöner
Reihefolge auf. Weiß gekleidete Mädchen eröffneten den Zug. Nach der
neuen Torarolle, welche unter einem Baldachin abwechselnd von den älteren
Mitgliedern des Tora-Vereins getragen wurde, ging Herr Rabbiner Dr. Marx
und der Ortsgeistliche Herr Pfarrer Wehsarg, dann die Ortsobrigkeit. Die
übrigen Gemeindemitglieder, Vereine etc. beschlossen den herrlichen
Festzug, welcher sich um die Mitte des Ortes zur Synagoge bewegte. Als man
in der Synagoge, welche leider die Menge der Festgenossen nicht alle
fassen konnte, angekommen, wurde vom hiesigen Lehrer Heilmann Mah towu
und einige Psalmen gesungen. Hierauf hielt Herr Rabbiner Dr. Marx - sein
Licht leuchte - eine solche prächtige Rede, dass, obwohl sie beinahe 1
1/2 Stunden währte, dennoch zu schnell beendet schien. Mit Recht gebührt
daher dem Herrn Rabbiner Dr. Marx, welcher das Fest durch diese Rede so
sehr verherrlichte 'die Palme des Tages.'
Die rege Anteilnahme des ganzen Ortes, sowie der Flaggenschmuck der
Häuser waren das schönste Zeichen für die Einigkeit , die am hiesigen
Platze zwischen Juden und Christen herrscht. Abends 9 Uhr versammelte sich
die Jugend zu einem Bankett, welches auch von der Umgegend stark besucht
wurde. Mögen solche Feste noch recht oft gefeiert werden, zu Ehren Gottes
im Hause Israel und in allen Landen." |
1901 beschloss die jüdische Gemeinde den Bau
einer neuen Synagoge (Beschluss vom 13. Juni 1901). Der Gemeinderat erklärte
sich zur Leitung eines Beitrages zu den Baukosten bereit. Am 25. Oktober 1901
konnte die Israelitische Religionsgemeinde einen geeigneten Bauplatz in der
Feldstraße zur Erbauung einer Synagoge erwerben. Mit dem Bau soll im Frühjahr
1902 begonnen werden. Die Grundsteinlegung war am 27. Juni 1902.
Erbaut wurde eine Synagoge mit 73 Plätzen für Männer und 42 für Frauen. Es war ein großzügig angelegter Bau mit
neuromanischen Stilelementen: charakteristisch die einzelnen, doppelten und
dreiteiligen Rundbogenfenster mit Mittelsäulchen, deren Basis und Kapitelle
nach romanischem Muster aus rotem Sandstein ausgeführt wurden. Auf dem
vorspringenden Risalit mit seinem treppenartigen Giebel befanden sich steinerne
Gebotstafeln. Der Synagogensaal war im südlichen Teil. Er hatte eine Empore
für die Frau. Im Gebäude waren auch die jüdische Schule, das rituelle Bad und
noch andere Räume der jüdischen Gemeinde. Das Gebäude wurde aus der Flucht vor
der Rheinstraße zurückgesetzt, sodass eine Vor-Zone entstand, die die Synagoge
aus der Reihe der gleichartigen Wohnhäuser heraushebt. Die Synagoge wurde am 7. August
1903 durch Rabbiner Dr. Marx aus Darmstadt eingeweiht.
Das bisherige Synagogengebäude wurde am 13. August 1903 an Herrn Andreas Graf
verkauft, der es zu einem Wohnhaus umbaute.
Die Einweihung der neuen Synagoge (1903)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 7. August
1903: "Egelsbach. Heute Freitag findet hier die Einweihung der
neuen Synagoge statt. Herr Rabbiner Dr. Marx, Darmstadt, wird die Festrede
halten." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 7. August
1903: "Egelsbach. Heute Freitag findet hier die Einweihung der
neuen Synagoge statt. Herr Rabbiner Dr. Marx, Darmstadt, wird die Festrede
halten." |
| |
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. August
1903: "Egelsbach. Klein, aber fein, kann man von der neuen
Synagoge, deren Einweihung wir vorigen Freitag vollzogen, sagen. Der
gesamte Ort hat unser Fest mitgefeiert, fast von jedem Hause wehte eine
Fahne und legte Zeugnis ab von dem einträchtigen Zusammenwohnen der
jüdischen und der christlichen Bevölkerung. Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. August
1903: "Egelsbach. Klein, aber fein, kann man von der neuen
Synagoge, deren Einweihung wir vorigen Freitag vollzogen, sagen. Der
gesamte Ort hat unser Fest mitgefeiert, fast von jedem Hause wehte eine
Fahne und legte Zeugnis ab von dem einträchtigen Zusammenwohnen der
jüdischen und der christlichen Bevölkerung.
Bisher hatten wir Egelsbacher eigentlich noch keine Synagoge, denn ein
schmuckloses Zimmer in dem ersten Stocke eines Privathauses musste unserem
gottesdienstlichen Bedürfnisse Genüge leisten. Jetzt haben wir nun eine
Synagoge und zwar eine, die sich sehen lassen darf. Deswegen war auch die
Freude an dem Gelingen des Werkes, zu dem ein jedes Mitglied unserer
Gemeinde sein Scherflein beigetragen hat, allgemein sehr groß, deshalb
bildet auch die Einweihungsfeier ein Denkstein in dem Leben eines jeden
Einzelnen unserer Gemeinde. Eine große Anzahl Gäste aus der Umgegend von
Egelsbach hatten sich zur Einweihungsfeier eingefunden. In der alten
Synagoge fand um 1 Uhr ein Abschiedsgottesdienst statt, an den sich eine
Predigt des Rabbiners Dr. Marx aus Darmstadt anschloss. Ein Zug, wie ihn
Egelsbach noch nie gesehen hat, durchzog hierauf die Straußen. Voran die
Schulkinder, hierauf die Damen, vier Torarollen und hinterher die Herren,
alles festlich gekleidet und geschmückt. Nach Überreichung des
Schlüssels zog man in das neue Gebäude ein, während eine Darmstädter
Kapelle spielte. Nachdem der Chor Ma towu und Boruch habboh
in meisterhafter Weise gesungen hatte, betrat dann Herr Rabbiner Dr. Marx
die Kanzel und hielt in kernigen Worten die Einweihungsrede. Er dankte dem
Baukomitee, insbesondere dem Vorsitzenden desselben, Herrn Hofmann und dem
Architekten Eck für ihre Mühe und Sorgfalt, mit denen sie das Werk zu
gutem Ende führten. Ferner sprach er den Gemeinden und dem Großherzog
Ernst Ludwig, die das Unternehmen gefördert und unterstützt haben,
seinen tief gefühlten Dank aus. Nach Beendigung der Einweihungsrede wurde
im Hotel 'Zur Krone' ein Konzert gegeben, und abends wieder ein solches
bei Rinnenthal. Zwei Festbälle im Hotel zum 'Heß' und im Hotel 'zur
Krone' schlossen die Feier.
Nicht unerwähnt wollen wir lassen, dass das Porauches (Vorhang am
Toraschrein) mit schöner Goldstickerei und die Schulchandecke (Decke auf
Vorlesepult), welche die Firma A. Rothschild, Hebräische Buchhandlung und
Kunststickerei in Frankfurt für die neue Synagoge geliefert hat, durch
ihre gediegene und künstlerische Ausführung allgemeinen Beifall
fanden." |
| |
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 4. September
1903: "Egelsbach, 1. September (1903). Nachdem die neue
Synagoge eingeweiht und ihrer Bestimmung übergeben, dürfte ein
Rückblick auf die Entwicklung gewiss angebracht sein. Nachdem die hiesige
israelitische Gemeinde lange Zeit zu der Nachbargemeinde Langen gehört
hatte, wurde derselben in den 1840er-Jahren von Wolf Simon ein Betsaal zur
Verfügung gestellt (später Simon Simon). Es war in dem jetzt Lazarus
Simon'schen Wohnhause. Im Jahre 1850 erwarb sich die Gemeinde das seither
innegehabte Betlokal, Mikwe und Lehrerwohnung. Es sei hierbei erwähnt,
dass noch zwei Männer am Leben sind, die damals den Kauf abschließen
halfen, nämlich Herr Lederhändler Moses Katz in Darmstadt und Herr
Privatier Vogel Kahn in Worms, beide sind jetzt hoch betagt. Nach
unermüdlichem Fleiße ist es der strebsamen Religionsgemeinde möglich
gewesen, im vorigen Frühjahr den Grundstein zu der jetzigen Synagoge zu
legen. Leider sollte einer der bei der Grundsteinlegung Mitwirkenden die
Einweihung nicht mehr erleben. Herr Herz Katz starb anfangs dieses Jahres
im Alter von 85 Jahren. Als Religionslehrer waren nacheinander hier
tätig, die Herren Levy, Heinebach, Alumann, Stern, Zopf, Ehrmann, Bloch,
Gorden, Mannheimer, Katz, Agulnik, Heilman, Schafheimer, Quittner,
Ansbacher, Eisenberger und seit vorigem Jahre zum zweiten Male Herr Lehrer
Heilmann. Bei Beginn des Baues waren Vorsteher Lazarus Simon, Max Katz und
Simon Grünebaum; in die Baukommission wurden gewählt Daniel Katz,
Ferdinand Lederer und Elias Levy. Bei der im vorigen Jahre notwendig
gewordenen Neuwahl wurden in den Vorstand gewählt: Adolf Hofmann, Elisas
Levy und Salomon Reis I. In die Baukommission neu: Daniel Katz. Max Katz
und Ferdinand Lederer. Das unter Ersterem freudig angefangene Werk ist
unter Letzterem glücklich vollende worden. Möge der wohltuende Frieden
auch in das Gotteshaus eingezogen sein, insbesondere möge aber Friede und
Eintracht unter den beiden hiesigen Einzelkonfessionen wohnen. Die neue
Synagoge, eine Zierde unseres Ortes, in der unteren Rheinstraße gelegen,
ist von Herrn Architekt Enk in Darmstadt erbaut. Auch die hiesige
politische Gemeinde hat einen Beitrag in anerkennendster Weise zur
Verfügung gestellt. Wir schließen unseren Bericht mit dem Wunsche, dass
die Gemeinde sich weiter entwickeln möge zur Ehre des Judentums und zur
Freude eines jeden aufrichtigen und begeisterten Bekenners
desselben." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 4. September
1903: "Egelsbach, 1. September (1903). Nachdem die neue
Synagoge eingeweiht und ihrer Bestimmung übergeben, dürfte ein
Rückblick auf die Entwicklung gewiss angebracht sein. Nachdem die hiesige
israelitische Gemeinde lange Zeit zu der Nachbargemeinde Langen gehört
hatte, wurde derselben in den 1840er-Jahren von Wolf Simon ein Betsaal zur
Verfügung gestellt (später Simon Simon). Es war in dem jetzt Lazarus
Simon'schen Wohnhause. Im Jahre 1850 erwarb sich die Gemeinde das seither
innegehabte Betlokal, Mikwe und Lehrerwohnung. Es sei hierbei erwähnt,
dass noch zwei Männer am Leben sind, die damals den Kauf abschließen
halfen, nämlich Herr Lederhändler Moses Katz in Darmstadt und Herr
Privatier Vogel Kahn in Worms, beide sind jetzt hoch betagt. Nach
unermüdlichem Fleiße ist es der strebsamen Religionsgemeinde möglich
gewesen, im vorigen Frühjahr den Grundstein zu der jetzigen Synagoge zu
legen. Leider sollte einer der bei der Grundsteinlegung Mitwirkenden die
Einweihung nicht mehr erleben. Herr Herz Katz starb anfangs dieses Jahres
im Alter von 85 Jahren. Als Religionslehrer waren nacheinander hier
tätig, die Herren Levy, Heinebach, Alumann, Stern, Zopf, Ehrmann, Bloch,
Gorden, Mannheimer, Katz, Agulnik, Heilman, Schafheimer, Quittner,
Ansbacher, Eisenberger und seit vorigem Jahre zum zweiten Male Herr Lehrer
Heilmann. Bei Beginn des Baues waren Vorsteher Lazarus Simon, Max Katz und
Simon Grünebaum; in die Baukommission wurden gewählt Daniel Katz,
Ferdinand Lederer und Elias Levy. Bei der im vorigen Jahre notwendig
gewordenen Neuwahl wurden in den Vorstand gewählt: Adolf Hofmann, Elisas
Levy und Salomon Reis I. In die Baukommission neu: Daniel Katz. Max Katz
und Ferdinand Lederer. Das unter Ersterem freudig angefangene Werk ist
unter Letzterem glücklich vollende worden. Möge der wohltuende Frieden
auch in das Gotteshaus eingezogen sein, insbesondere möge aber Friede und
Eintracht unter den beiden hiesigen Einzelkonfessionen wohnen. Die neue
Synagoge, eine Zierde unseres Ortes, in der unteren Rheinstraße gelegen,
ist von Herrn Architekt Enk in Darmstadt erbaut. Auch die hiesige
politische Gemeinde hat einen Beitrag in anerkennendster Weise zur
Verfügung gestellt. Wir schließen unseren Bericht mit dem Wunsche, dass
die Gemeinde sich weiter entwickeln möge zur Ehre des Judentums und zur
Freude eines jeden aufrichtigen und begeisterten Bekenners
desselben." |
| |
Weitere Anzeigen/Dokumente
zur neuen Synagoge in Egelsbach
(Quelle: Geschichtsverein Egelsbach, vgl. unten Website
www.63329.info mit Informationen zu
Egelsbach Nr. 27) |
 |
 |
 |
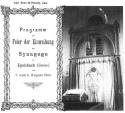 |
Anzeige: Vergebung von
Bauarbeiten
für die neue Synagoge vom 9. Mai 1902 |
Bericht über die
Grundsteinlegung
der Synagoge vom 27. Juni 1902 |
Anzeigen / Programm zur
Einweihung der Synagoge am 7./8. August 1903 |
Programm zur Einweihung mit
Innenansicht - Blick zum Toraschrein |
| |
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge durch
SA-Leute (Brigade 50 Starkenburg, Männer der Standart 168) völlig verwüstet. Möglicherweise wurde auch Feuer gelegt. Die
Inneneinrichtung, Ritualien und Gebetbücher wurden aus dem Fenster geworfen,
auf den nahe gelegenen Sportplatz verbracht und dort verbrannt. Die steinernen
Gebotstafeln auf dem Giebel der Synagoge wurden heruntergerissen und
zertrümmert.
Das Synagogengebäude wurde 1941 von der Gemeinde Egelsbach samt Grundstück für
5.000 Reichsmark von der schon nicht mehr bestehenden Israelitischen Gemeinde
Egelsbach "gekauft", wobei der Betrag auf ein Sperrkonto bei
der Bezirkssparkasse Langen eingezahlt wurde. Von Seiten der jüdischen Familien
unterzeichneten Moses Reis und David Katz I., die damals nicht mehr in
Egelsbach, sondern in Frankfurt am Main wohnten. Die Synagoge wurde danach als Unterbringungsort von ausländischen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen
zweckentfremdet.
Nach 1945 kam das Gebäude - vermutlich nach
Klärung des Restitutionsverfahrens - in Privatbesitz und wurde (Ende der
1950er-/Anfang der 1960er-Jahre) zu einem Wohnhaus
umgebaut.
Adressen/Standorte der Synagogen: Erster Betsaal
(bis 1847): Schulstraße 12; Alte Synagoge
(1847): Langener Str. 1; Neue Synagoge (1903): Rheinstraße 49
Fotos
(Quelle: sw-Fotos erste und zweite Fotozeile und dritte
Fotozeile rechts: Geschichtsverein Egelsbach; sw-Foto zweite Fotozeile links: Arnsberg Bilder S. 47; neuere Fotos:
Hahn, Aufnahmedatum 3.8.2008)
Haus der Familie Simon
(Betraum vor 1847) |
 |
|
| |
|
|
| |
|
|
Das Gebäude der alten
Synagoge
1847-1903 |
 |
|
| |
|
|
| |
|
|
Das Gebäude der ehemaligen
Synagoge
um 1970 |
 |
 |
| |
|
|
| |
|
|
Das Gebäude der ehemaligen
Synagoge
im Sommer 2008 |
 |
 |
| |
Blick auf die
ehemalige Synagoge von der Rheinstraße |
| |
|
 |
 |
 |
| |
Hinweistafel mit
der Inschrift (deutsch und hebräisch): "Ehemalige Synagoge.
Feierlich eingeweiht am 28.1.1903. Geschändet und geplündert am 10.11.
1938." |
| |
|
|
Gedenktafel
auf dem
Kirchplatz |
 |
 |
| |
Tafel mit der
Inschrift: "Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. 'Die
Pflicht,
sich zu erinnern, stehe über dem Verlangen zu vergessen. Karl
Kraus'." |
| |
|
Die "Judengasse"
in Egelsbach -
vermutlich jüdisches Wohngebiet
im 18. Jahrhundert |
 |
 |
| |
Blick entlang der
"Judengasse" |
Straßenschild |
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| Oktober 2009:
In Egelsbach werden "Stolpersteine"
verlegt |
Artikel vom 9. Oktober 2009 in der
"Offenbach-Post" (Artikel):
"Egelsbach - Erste Aktion am 15. Oktober erinnert an Familien
Bacharach, Eisemann, Katz und Reis - Stolperstein-Premiere in Egelsbach.
Egelsbach - (hob) Es ist nie zu spät, eine gute Sache zu beginnen. Frei nach diesem Grundsatz erlebt nun auch die Gemeinde die erste Verlegung von Stolpersteinen im Gedenken an Egelsbacher Juden, die vom nationalsozialistischen Terror-Regime gequält und getötet wurden.
Am Donnerstag, 15. Oktober, um 15 Uhr wird der Künstler Gunter Demnig die ersten Stolpersteine verlegen. Sie erinnern an die Familien Bacharach, Eisemann, Katz und Reis, die einst in der Ernst-Ludwig-Straße 39 beziehungsweise in der Woogstraße 5 gewohnt haben..." |
| Der Arbeitskreis freut sich über weitere Mitarbeiter und über Paten, die bereit sind, 95 Euro für einen Stolperstein zu übernehmen.
Spenden unter dem Stichwort Stolpersteine können aufs Konto 33 002 5 93 bei der Sparkasse Langen-Seligenstadt, BLZ 506 521 24, überwiesen werden.
Kontakt zum Arbeitskreis über das evangelische Gemeindebüro, Tel.: 49076. |
| |
| Oktober 2009:
Nachkomme der jüdischen Familie Bacharach kommt
zur Verlegung der Stolpersteine am 15. Oktober 2009 |
Artikel von Gaby Melk in der "Offenbach-Post" (Artikel
online)
vom 14. Oktober 2009: "Der Klang der Versöhnung
Egelsbach - Am morgigen Donnerstag verlegt der Künstler Gunter Demnig im Ort die ersten Stolpersteine zum Gedenken an jüdische Nazi-Opfer.
Dieser lang ersehnten Premiere widmet die Egelsbacher Stolperstein-Initiative bereits heute eine Informations- und Gedenkveranstaltung mit einem ganz besonderen Gast: Dr. Laurence Sherr, Musikprofessor an der Kennesaw State University in Atlanta/ USA und Sohn der ehemaligen Egelsbacherin Alice Bacharach, ist zur Verlegung der Gedenksteine für seine Familie nach Egelsbach gekommen. Er wird ab 20 Uhr in der Kulturscheuer (Ernst-Ludwig-Straße 65) nicht nur über seine Familie erzählen, sondern auch musizieren – und damit Egelsbach zum Schauplatz einer Uraufführung im Zeichen von Erinnerung und Versöhnung machen..." |
| Link: Website
mit Seiten über Biographie und das Werk von Prof. Laurence Sherr |
| |
Artikel in der "Offenbach-Post" (Artikel
online) vom 16. Oktober 2009: "Erinnerung verblasst nicht
Egelsbach - (hob) Seit gestern 'stolpern' auch die Bürger von Egelsbach über die dunkelste Periode der Vergangenheit. Das
'Stolpersteine'-Projekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig symbolisiert, dass die Erinnerung an die Opfer des Nazi-Terrors nicht verblasst..." |
| |
| Oktober 2010:
In Egelsbach werden weitere
"Stolpersteine" verlegt |
Artikel von Holger Borchard in "op-online.de" vom Oktober 2010 (Artikel):
"Erst gequält und dann ermordet.
Egelsbach ‐ Die Arbeitsgemeinschaft Stolpersteine erinnert am 13. Oktober mit einer weiteren Aktion ans Schicksal ehemaliger jüdischer Bürger während der Nazizeit.
.
Das Haus in der Schulstraße 50 kennen viele Egelsbacher – während der Kerb vor Kurzem beherbergte es den
'Schoppepetzer-Hof'. Die Geschichte des Gebäudes und seiner Bewohner dürfte freilich nur den Wenigsten geläufig sein. Am Mittwoch, 13. Oktober, um 14 Uhr werden vor dem Haus Schulstraße 50 fünf Stolpersteine in den Gehweg eingesetzt. Sie erinnern an die Familie Simon sowie an Thekla Lehmann..." |
| |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 149-150. |
 | ders.: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Bilder -
Dokumente. S. 47. |
 | Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 S. 172-173. |
 | dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 142 (keine weiteren
Angaben zu 1988). |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 274-275. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 39-40. |
 | Christine Wittrock: Egelsbach 1933-1945. Egelsbach
1988. |
 | Beate und Serge Klarsfeld: Die Kinder von Izieu.
Eine jüdische Tragödie. Berlin 1991.
In diesem Buch wird auch das Schicksal des 1928 in Egelsbach geborenen Theodor
Reis beschrieben. Seine Mutter kam, nachdem die Familie von Egelsbach
nach Wollenberg geflohen ist (von dort
stammte der Vater von Theodor Reis) mit der Deportation der badischen
Juden im Oktober 1940 nach Gurs, von hier später nach Auschwitz und wurde
ermordet. Der Sohn Theodor konnte von einer französisch-jüdischen
Kinderhilfsorganisation zunächst in einem Kinderheim in Palavas-les-Flots
versteckt werden; nach dem deutschen Einmarsch wurde dieses Heim durch den
Gestapochef von Lyon Klaus Barbie im April 1944 liquidiert. Die Kinder,
darunter Theodor Reis wurden deportiert und bei einer Massenerschießung
entweder in Kovno (Litauen) oder in Reval (Estland)
ermordet. |
 |  Andrea
von Treuenfeld: In Deutschland eine Jüdin, eine Jeckete in Israel.
Geflohene Frauen erzählen ihr Leben. Gütersloher Verlagshaus 2011. Andrea
von Treuenfeld: In Deutschland eine Jüdin, eine Jeckete in Israel.
Geflohene Frauen erzählen ihr Leben. Gütersloher Verlagshaus 2011.
In diesem Buch findet sich S. 54-64 die Lebensgeschichte von Ahuva Salant,
geboren als Lieselotte Liebe Kwiat (Tochter des Kultusbeamten Hirsch /
Hermann Kwiat, s.o.), die am 7. September 1931 in Egelsbach geboren ist und
in Jerusalem lebt (2011). |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Egelsbach
Hesse. This Orthodox community numbered ober 90 (3,2 % of the total) in
1905, declining to 60 in 1933. The Nazi boycott campaign drove Jews from the
town and by December 1938, after Kristallnacht (9-10 November 1938), the
remaining 44 had left - some emigrating to the United States and Palestine.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|