|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg
Wiesenbach mit
Blaufelden (Stadt Blaufelden, Landkreis
Schwäbisch Hall)
Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In dem bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts markgräflich
ansbachischen Ort Wiesenbach bestand eine jüdische Gemeinde bis 1928. Ihre
Entstehung geht in die Zeit des 16./17. Jahrhundert zurück. Vermutlich haben
sich nach 1520 einige aus Rothenburg vertriebene Juden am Ort niederlassen
können. 1603 werden drei jüdische Familien am Ort genannt, 1629 sind es bereits sieben
Familien. Bei dieser Zahl scheint es in den kommenden Jahrzehnten geblieben
sein: 1808 wurden sechs Familien gezählt.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1812 35 jüdische Einwohner, 1824 44, 1831 51, 1843 46, höchste Zahl
um 1858 mit 53 Personen in etwa 15 Haushaltungen, 1860 49, 1886 33, 1900 30,
1910 30.
Zur jüdischen Gemeinde in Wiesenbach gehörten auch die wenigen in Blaufelden
lebenden jüdischen Personen (nach 1875 einzelne feststellbar). Dazu gehörte
die Familie des Handelsmannes Isak Stern aus Wiesenbach, dessen Söhne Albert
und Max 1877 beziehungsweise 1878 in Blaufelden geboren sind. Die Familie verzog
1899 nach Crailsheim, 1902 wieder nach
Wiesenbach.
Das Wohngebiet der jüdischen Familien konzentrierte sich vermutlich
zunächst auf die ehemalige "Judengasse" (heute Engelhardshauser
Strauße; im Volksmund "Gäßle").
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge, eine
Religionsschule (Schulhaus in der Hirtengasse: einstöckiges Haus mit einer
Lehrerwohnung und Schulraum; Haus wurde um 1935 bis 1940 verkauft, abgebrochen
und mit dem Haus Hirtengasse 14 neu überhaupt) und ein rituelles Bad (im
Untergeschoss des Schulhauses). Seit 1832 gehörten die Wiesenbacher Juden als
Filialgemeinde zur israelitischen Religionsgemeinde in Michelbach an der Lücke
und damit zum Bezirksrabbinat Braunsbach.
Die Toten der Gemeinde wurden im jüdischen Friedhof in Michelbach
an der Lücke beigesetzt.
Im 19. Jahrhundert hatte die jüdische Gemeinde zeitweise einen Lehrer /
Vorbeter. Es wird genannt: um 1864 Lehrer Nördlinger. Um 1900 hielt Lehrer
M. Cohn aus Crailsheim den
Religionsunterricht in Wiesenbach (1903 unterrichtete er hier noch vier Kinder).
Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1889/95 Abraham Stern, um
1895/98 M. Neumann.
Die jüdischen Familien lebten überwiegend
vom Vieh- und Warenhandel. An ehemaligen, bis nach 1900 bestehenden
jüdischen Handelsbetrieben sind bekannt: Viehhandlung Albert Neumann (Engelhardshauser
Straße 33, abgebrochen), Textilhandlung Isaak Rosenthal (Goldbiegelgasse 13),
Pferde- und Viehhandlung Maier Max Stern (Blaufelder Straße 144, bis nach
1935), Vieh- und Textilhandlung Nathan und Klara Stern (Schmalfelder Straße
90).
Unter den Kriegsteilnehmern im Ersten Weltkrieg war aus Wiesenbach
Alfred Stern (zeitweise als Minenwerfer eingesetzt), Sohn des Nathan Stern.
1917 wurde er für seinen Kriegseinsatz mit der Württembergischen Silbernen
Verdienstmedaille ausgezeichnet.
1933 lebten noch vier jüdische Personen in Wiesenbach (Familie von Maier
Max). Als 1935 der Pfarrer des Ortes zwei Mädchen, die zu einer Tagung in
Wiesenbach waren, bei Familie Maier Max unterbrachte, wurde er dafür in der
nationalsozialistischen Zeitschrift "Flammenzeichen" kritisiert:
"Offenbar hält es der Pfarrer für besser, wenn die Mädchen jüdisch
verseucht werden, als wenn sie von der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft
angesteckt werden."
Von den in Wiesenbach
geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in
der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Sara
Gundelfinger geb. Stern (1861), Selma Gutmann geb. Stern (1891), Regine
Rosenthal geb. Lehmann (1876), Meta Schwarz geb. Stern (1889), Rahel Stern geb.
Strauß (1864), Wolf Stern (1888), Sophie Wertheimer geb. Neumann (1883).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Berichte aus dem jüdischen
Gemeindeleben
Auflösung der jüdischen Gemeinde Wiesenbach (1928)
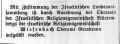 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Juli 1928: "Mit Zustimmung der Israelitischen Landesversammlung ist durch Anordnung des
Oberrats der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs die
israelitische Religionsgemeinschaft
Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Juli 1928: "Mit Zustimmung der Israelitischen Landesversammlung ist durch Anordnung des
Oberrats der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs die
israelitische Religionsgemeinschaft
Wiesenbach Oberamt Gerabronn
aufgelöst worden." |
Berichte zu einzelnen
Personen aus der Gemeinde
Zum Tod von Moses Strauß (1899)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. März 1899 (leicht
abgekürzt zitiert): "Wiesenbach (Württemberg). "Es starb
Mose, der Diener Gottes. Es gefiel dem Gebieter über Leben und Tod,
seinen treuen Diener Moses Strauß, das Oberhaupt der hiesigen Gemeinde,
von dieser Welt in ein besseres Jenseits abzurufen. Mit einem Kuss
des Himmels, wie unser Lehrer Moses, starb er: ohne Todeskampf,
sanft und still, hauchte er, am Donnerstag, 6. Adar (16. Februar
1899), im Alter von nahezu 76 Jahren, seine reine Seele aus. Der
Verstorbene war im wahren Sinne des Wortes ein Demütiger und Frommer.
In der Ausübung der Gottesgebote fand er seinen höchsten
Lebensgenuss und war namentlich sein Streben, sein Ziel, Gott zu ehren...
Die Klagen und Bitten der Armen und Bedürftigen fanden bei ihm kein
verschlossenes Ohr; er gab oft und gern. Viele Tränen des Kummers hat er im
Stillen getrocknet, Wohltätigkeit im Verborgenen
geübt. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. März 1899 (leicht
abgekürzt zitiert): "Wiesenbach (Württemberg). "Es starb
Mose, der Diener Gottes. Es gefiel dem Gebieter über Leben und Tod,
seinen treuen Diener Moses Strauß, das Oberhaupt der hiesigen Gemeinde,
von dieser Welt in ein besseres Jenseits abzurufen. Mit einem Kuss
des Himmels, wie unser Lehrer Moses, starb er: ohne Todeskampf,
sanft und still, hauchte er, am Donnerstag, 6. Adar (16. Februar
1899), im Alter von nahezu 76 Jahren, seine reine Seele aus. Der
Verstorbene war im wahren Sinne des Wortes ein Demütiger und Frommer.
In der Ausübung der Gottesgebote fand er seinen höchsten
Lebensgenuss und war namentlich sein Streben, sein Ziel, Gott zu ehren...
Die Klagen und Bitten der Armen und Bedürftigen fanden bei ihm kein
verschlossenes Ohr; er gab oft und gern. Viele Tränen des Kummers hat er im
Stillen getrocknet, Wohltätigkeit im Verborgenen
geübt.
Die Räume der hiesigen Synagoge bezeugen ihm, wie pünktlich und
gewissenhaft er die Ämter eines Vorbeters und Toralesers bekleidet
hat. Rührend war es anzusehen, sogar in seinen Alterstagen, wie er den Jom
Kipper von Abend bis zum Abend stehend verbrachte und aus der ganzen
Tiefe seines Gemütes, mit der ganzen Innigkeit seiner Gefühle,
sämtliche Gebete vortrug. Zu denen, die viele zur Gerechtigkeit
führten (Daniel 12,3) mussten wir ihn zählen, wegen seiner
belehrenden Schiur-Vorträge (Lehrvorträge).
Wohl nötigte ihn sein Beruf, seine meiste Lebenszeit unter Nichtjehudim
zuzubringen, trotzdem legte er sich alle Entbehrungen auf, um die
vorgeschriebenen Speisegesetze streng zu beobachten. Möge Gott den
Hinterbliebenen seinen reichen Trost spenden. Seine Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens. M. Cohn,
Lehrer." |
Zum Tod von Babette Stern (1902)
 Artikel
in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 3. November 1902: "Wiesenbach in
Württemberg (Unlieb verspätet.) Einen schweren Verlust hat unsere kleine
Gemeinde Wiesenbach erlitten. Frau Babette Stern, die würdige Gattin
ihres schon vor vielen Jahren ihr im Tode vorausgegangenen Gatten Simon
Stern, hat in ihrem, kaum vollendeten 69. Lebensjahre das Zeitliche
gesegnet, um ihrem Gatten zu folgen in ein Land, in dem alle Leidenschaften
schwinden, in das Reich des ewigen Lebens. Ausgezeichnet mit den Tugenden,
die eine jüdische Frau zieren, bewunderungswürdig durch die Geduld und die
liebevolle Ergebung in Gottes Willen und Verhängnisse, auch der härtesten
Schicksalsschläge, von denen sie ihr redlich Teil zugemessen erhielt, hat
sie es verstanden, durch ihre ungeheuchelte Frömmigkeit und ihre
Wohltätigkeit, durch die treue Sorgfalt, die sie aus die Erziehung ihrer
Kinder zu allem Guten und Löblichen, verwendete, sich einen Namen zu
erwerben; der weit über die Grenzen ihres Wohnortes reichte. Und dieser gute
Name zeigte sich in der allgemeinen Teilnahme während der Zeit ihrer
schweren, mit Geduld ertragenen Leiden nicht minder, wie auf ihrem letzten
Gange, ihrer Beerdigung. Sie nahm den Ruf getreuer Pflichterfüllung und
ehrlichen Wandelns und Handelns unter den Menschen mit ins Grab. Möge sie im
Jenseits den Lohn ihres treuen Wirkens und Tuns finden vor dem Ewigen,
unserem Gotte und möge der Allgütige Trost spenden den trauernden Kindern
mit allen Trauernden in Israel." Artikel
in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 3. November 1902: "Wiesenbach in
Württemberg (Unlieb verspätet.) Einen schweren Verlust hat unsere kleine
Gemeinde Wiesenbach erlitten. Frau Babette Stern, die würdige Gattin
ihres schon vor vielen Jahren ihr im Tode vorausgegangenen Gatten Simon
Stern, hat in ihrem, kaum vollendeten 69. Lebensjahre das Zeitliche
gesegnet, um ihrem Gatten zu folgen in ein Land, in dem alle Leidenschaften
schwinden, in das Reich des ewigen Lebens. Ausgezeichnet mit den Tugenden,
die eine jüdische Frau zieren, bewunderungswürdig durch die Geduld und die
liebevolle Ergebung in Gottes Willen und Verhängnisse, auch der härtesten
Schicksalsschläge, von denen sie ihr redlich Teil zugemessen erhielt, hat
sie es verstanden, durch ihre ungeheuchelte Frömmigkeit und ihre
Wohltätigkeit, durch die treue Sorgfalt, die sie aus die Erziehung ihrer
Kinder zu allem Guten und Löblichen, verwendete, sich einen Namen zu
erwerben; der weit über die Grenzen ihres Wohnortes reichte. Und dieser gute
Name zeigte sich in der allgemeinen Teilnahme während der Zeit ihrer
schweren, mit Geduld ertragenen Leiden nicht minder, wie auf ihrem letzten
Gange, ihrer Beerdigung. Sie nahm den Ruf getreuer Pflichterfüllung und
ehrlichen Wandelns und Handelns unter den Menschen mit ins Grab. Möge sie im
Jenseits den Lohn ihres treuen Wirkens und Tuns finden vor dem Ewigen,
unserem Gotte und möge der Allgütige Trost spenden den trauernden Kindern
mit allen Trauernden in Israel." |
Zum Tod von Aron Neumann (1927)
 Artikel
in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. September 1927: "Wiesenbach. Äußerst schwer wurde die hiesige, jetzt nur noch drei Familien zählende Gemeinde heimgesucht. Im besten Mannesalter starb plötzlich im Krankenhaus zu Würzburg das Gemeindemitglied
Aron Neumann infolge einer rasch aufgetretenen schweren Nierenerkrankung. Eine
für ländliche Verhältnisse überaus zahlreiche Beteiligung an der in Michelbach stattgefundenen Beerdigung zeugte von der Beliebtheit und Wertschätzung dieses bescheidenen, wackeren
Mannes". Artikel
in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. September 1927: "Wiesenbach. Äußerst schwer wurde die hiesige, jetzt nur noch drei Familien zählende Gemeinde heimgesucht. Im besten Mannesalter starb plötzlich im Krankenhaus zu Würzburg das Gemeindemitglied
Aron Neumann infolge einer rasch aufgetretenen schweren Nierenerkrankung. Eine
für ländliche Verhältnisse überaus zahlreiche Beteiligung an der in Michelbach stattgefundenen Beerdigung zeugte von der Beliebtheit und Wertschätzung dieses bescheidenen, wackeren
Mannes". |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige der Frau von M. Rosenthal (1903)
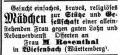 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 19. November 1903: "Gesucht einfaches,
braves, religiöses Mädchen zur Stütze und Gesellschaft
einer alleinstehenden Frau gegen guten Lohn und Nebenverdienst Offerten an Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 19. November 1903: "Gesucht einfaches,
braves, religiöses Mädchen zur Stütze und Gesellschaft
einer alleinstehenden Frau gegen guten Lohn und Nebenverdienst Offerten an
Frau M. Rosenthal in Wiesenbach (Württemberg)." |
Sonstiges
Erinnerungen an die Auswanderungen im 19. Jahrhundert:
Grabstein in New York für Lena Sachs
aus Wiesenbach (gest. 1904)
Anmerkung: das Grab befindet sich in einem jüdischen Friedhof in NY-Brooklyn;
der Geburtsname von Lena Sachs wird nicht mitgeteilt. Hebräisch steht auf dem
Grabstein als ihr Name: "Lea Bat Abraham". Nach Ulrich Hornsteiner
(Mitteilung vom 9.10.2020) dürfte es sich eventuell um Lea geb. Stern
(Tochter von Abraham Stern) handeln (geb. 22. März 1823 in Wiesenbach).
 |
 Grabstein
für "Lena Sachs Grabstein
für "Lena Sachs
Born in Wiesenbach / Württemberg
Died May 29 1904
Aged 80 Years". |
Zur Geschichte des Betsaals/der Synagoge
Das Wohngebiet
konzentrierte sich vermutlich zunächst auf die ehemalige "Judengasse" (heute
Engelhardshauser Straße, im Volksmund "Gäßle"). Hier konnten die jüdischen
Familien 1790 einen bescheidenen Betsaal bauen (auf dem heutigen Grundstück
Engelhardshauser Straße 42). Unter dem Vorsänger Aron Bär wurde 1824 der
Betsaal zu einer Synagoge erweitert. Sie blieb aber ein bescheidender einstöckiger
Raum mit Riegelwänden, nicht unterkellert und nicht tief gegründet. In ihrem
Hofraum standen eine Mikwe und ein jüdisches Schlachthaus. Nach der Neuordnung
der jüdischen Gemeindeverhältnisse in Württembergs und dem Anschluss von
Wiesenbach und Hengstfeld 1828 an die Gemeinde in Michelbach an der Lücke
sollte die Wiesenbacher Synagoge geschlossen werden. Nach energischem Protest
der Gemeindeglieder durfte sie weiterhin als Filiale genutzt werden. 1865
kam es zu Bau- oder Renovierungsmaßnahmen (der Synagoge und/oder des
Schulhauses in der Hirtengasse?), zu denen es einen Zuschuss aus staatlichen
Mitteln in Höhe von 200 Gulden gab.
Zuschuss zu Baumaßnahmen an der Synagoge oder
des Schulhauses (1865)
 Aus einem (längeren) Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 9. August 1865: "Aus Württemberg. Der israelitischen
Kirchengemeinde Archshofen hat unser
König Karl drei Kronleuchter für die neu restaurierte Synagoge als
Geschenk huldreichst zu verwilligen geruht, und die Filialgemeinde Wiesenbach
erhielt zu den Kosten der Erwerbung und baulichen Einrichtung ihres Schul-
und Gotteshauses einen Staatsbeitrag von 200
Gulden." Aus einem (längeren) Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 9. August 1865: "Aus Württemberg. Der israelitischen
Kirchengemeinde Archshofen hat unser
König Karl drei Kronleuchter für die neu restaurierte Synagoge als
Geschenk huldreichst zu verwilligen geruht, und die Filialgemeinde Wiesenbach
erhielt zu den Kosten der Erwerbung und baulichen Einrichtung ihres Schul-
und Gotteshauses einen Staatsbeitrag von 200
Gulden." |
Trotz der
gering gewordenen Zahl von Gemeindegliedern wurde die Synagoge erst 1928
geschlossen und 1933 auf Abbruch verkauft. Das ehemalige jüdische Schlachthaus
im Hofraum der Synagoge ist bereits 1877 verkauft und 1923 abgebrochen worden.
Heute ist das ehemalige Synagogengrundstück ein Garten
gegenüber dem früheren "Jägerstüble" (Engelhardshauser Straße 15
[früher: Gässle 42]; der Gaststättenbetrieb ist eingestellt, das Haus wird
als Wohnhaus verwendet). 1986 wurde eine
kurze Steinsäule hier aufgestellt, die vermutlich vom Almemor der Synagoge
stammt. Eine Hinweistafel ist angebracht. Die Gedenksäule steht zwischen
den Gebäuden Engelhardshauser Straße 15 und 17 an der Außenwand eines
Nebengebäudes.
Fotos
Historische Fotos:
(Quelle: links: Jüdische Gotteshäuser und Friedhöfe in Württemberg. 1932 S.
131; die beiden anderen Dokumente aus Privatbesitz)
 |
 |
 |
Die Synagoge in
Wiesenbach |
Foto von Kindern im
Nachbargarten der Synagoge,
(rechts im
Hintergrund)
|
Quittung vom 7. Februar 1933 über
den Verkauf des Synagogengrundstücks
an
Hugo Kett (Synagoge war vermutlich
war abgebrochen) |
| |
Fotos nach 1945/Gegenwart:
Fotos um 1985:
(Fotos: Hahn) |
|
|
 |
 |
 |
Grundstück der ehemaligen Synagoge in Wiesenbach
|
Steinsäule, vermutlich vom Almemor
der Synagoge, 1986 am
Synagogenstandort aufgestellt |
| |
Neuere Fotos vom Synagogenstandort werden
noch erstellt; über Zusendungen
freut sich der Webmaster von Alemannia
Judaica; Adresse siehe Eingangsseite |
|
| |
|
Weitere Erinnerung an
die
jüdische Geschichte
(Foto: Bernhard Ritter) |
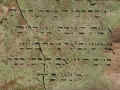 |
Das Foto zeigt
ein Grabsteinfragment, das aus dem
jüdischen Friedhof in Michelbach stammt (Begräbnisplatz der Wiesenbacher
Juden). Die Übersetzung der Inschrift lautet:
"1) ...auf all ihren Wegen. (Es ist) Frau Rachel
2) Gattin des ehrenwerten Josef Strauss
3) von Wiesenbach. Sie starb in gutem Namen
4) am 4. Tag (Mittwoch), 13. Aw 623 nach der kleinen Zählung
5) Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des ewigen Lebens."
Bei der Verstorbenen handelt es sich um Rachel Strauß, geb. 17. Oktober
1790, gest. 29. Juli 1863, die mit dem Handelsmann Joseph Moses Strauß (geb.
5. Juli 1796, gest. 15. Januar 1879) in Wiesenbach verheiratet war.
Informationen nach dem Familienregister Wiesenbach, zugänglich über die Website
des Landesarchiv Baden-Württemberg (die Seite
zur Familie Joseph Strauß: eingestellt als pdf-Datei)
Nach unbestätigten Informationen wurde das Grabsteinfragment im Sommer 2011
auf einem Privatgrundstück in Michelbach beim Hausbau entdeckt. Welches
Grundstück das war, und wo der Stein sich heute befindet, ist unbekannt.
Recherchen bei Michelbacher Bürgern im Jahr 2021 blieben erfolglos
(Information von Uli Hornsteiner vom 20.3.2022). |
Links und Literatur
Links:
Quellen:
Literatur:
 | Paul Sauer: Die jüdischen Gemeinden in Württemberg und
Hohenzollern. 1966. S. 191-192. |
 | Robert Walter u.a.: Wiesenbach – eine kleine Chronik. 1983². S.
162ff. |
 | Gerhard Taddey: Kein kleines Jerusalem. Geschichte der Juden im
Landkreis Schwäbisch Hall. 1992. |
 |  Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007. Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007. |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|