|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Mittelfranken"
Lehrberg (Marktgemeinde,
Kreis Ansbach)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In
Lehrberg bestand eine
jüdische Gemeinde bis um 1900. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 16./17.
Jahrhunderts zurück. Nach 1573 haben sich die ersten vier jüdischen
Familien am Ort niedergelassen, die vermutlich aus der Mark Brandenburg 1573
vertrieben worden waren.
1714 waren elf jüdische Familien am Ort. Bis 1803 nahm ihre Zahl
weiter zu auf damals 26 Familien mit zusammen 91 Personen.
Seit Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Zahl der jüdischen
Einwohner wie folgt: 1809 92 jüdische Einwohner (von insgesamt 902), 1837
140 (12,8 % von insgesamt 1.090), 1867 31 (2,6 % von 1.176), 1890 8 (0,7 %
von 1.142), 1900 7 (0,6 % von 1.153).
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde ein Gemeindezentrum mit
Synagoge (s.u.), einer Schule, einer Wohnung für den Lehrer und ein rituelles
Bad. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Religionslehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schächter tätig war. Unter den
Lehrern ist u.a. Marx Gotthelf bekannt, der im Alter von 60 Jahren 1851
in Lehrberg gestorben ist (siehe Bericht unten); ein Nachfolger von ihm war der
später in Windsbach
tätige Lehrer Josef Mayer.
Nach Auflösung der jüdischen Gemeinde gehörten die in Lehrberg noch lebenden
jüdischen Einwohner zur Gemeinde in Ansbach.
Dabei handelte es sich 1924 um 12, 1932 um 11 Personen.
1933 wurden noch zehn jüdische Einwohner gezählt. Bis Januar 1939
verließen auf Grund der zunehmenden Repressalien und der Folgen des
wirtschaftlichen Boykotts alle den Ort. Sie verzogen in andere Ort oder konnten
noch emigrieren.
Von den in Lehrberg geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Gitta Selling geb. Braun (geb. 1896) und ihr Sohn
Bernhard Selling (geb. 1922 in Lehrberg); beide am 1. Dezember 1941 nach Riga /
KZ Jungfernhof deportiert, für tot erklärt.
Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Allgemeine Berichte
Die Entstehung der Gemeinde nach dem Forschungsstand um
1840
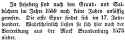 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. September
1842: "In Lehrberg sind nach den Grund- und Salbüchern im Jahre 1559
noch keine Juden ansässig gewesen. Die erste Spur findet sich im 17.
Jahrhundert. Wahrscheinlich ließen sie sich hier nach der Vertreibung aus
der Mark Brandenburg 1573 nieder". Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. September
1842: "In Lehrberg sind nach den Grund- und Salbüchern im Jahre 1559
noch keine Juden ansässig gewesen. Die erste Spur findet sich im 17.
Jahrhundert. Wahrscheinlich ließen sie sich hier nach der Vertreibung aus
der Mark Brandenburg 1573 nieder". |
| |
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. September
1842: "Über die Gemeinde Lehrberg gibt die Tradition folgende
Nachricht: 'Die erste Ansiedlung der Juden erfolgte durch vier Familien,
und war in dem Teile Lehrbergs, welcher der markgräflichen
Gerichtsbarkeit unterworfen war. Sie kauften vier Häuser, dem Pfarrhofe
gegenüber und jede Familie musste 36 Kreuzer dem Pfarrer für entgangene
Stolgebühren leisten. Diese vier werden gegenwärtig noch von
Judenfamilien bewohnt und die Abgabe besteht noch von Seite der
Judenschaft". Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. September
1842: "Über die Gemeinde Lehrberg gibt die Tradition folgende
Nachricht: 'Die erste Ansiedlung der Juden erfolgte durch vier Familien,
und war in dem Teile Lehrbergs, welcher der markgräflichen
Gerichtsbarkeit unterworfen war. Sie kauften vier Häuser, dem Pfarrhofe
gegenüber und jede Familie musste 36 Kreuzer dem Pfarrer für entgangene
Stolgebühren leisten. Diese vier werden gegenwärtig noch von
Judenfamilien bewohnt und die Abgabe besteht noch von Seite der
Judenschaft". |
Aus der Geschichte jüdischer
Lehrer
Zum Tod von Lehrer Marx Gotthelf
(1851)
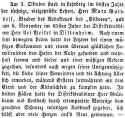 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Dezember
1851: "Am 3. Oktober starb in Lehrberg im 60ten Jahre der tüchtige,
vielgeprüfte Lehrer, Herr Marx Gotthelf, Bruder des Redakteurs des
'Eilboten', und am 8. November im 65ten Jahre der Distriktsrabbiner Herr
Uri Veitel in Dittenheim. Nach einem sehr bewegten Leben hatte der
Letztere bei einem mäßigen Einkommen und einem überaus glücklichen
Familienleben den Hafen der Ruhe gefunden und wahrhaft fromm und bieder
und einer mäßigen Reform zugetan, besonders auch wegen seiner
Uneigennützigkeit, die Liebe seiner Gemeinden und die Achtung Aller sich
erworben, während Ersterer fortwährend mit dem Elend und der
Kleinlichkeit zu kämpfen hatte. In beiden Fällen hatte der Distriktsrabbiner
Herr Grünbaum aus Ansbach durch extemporierte Vorträge dem gerechten
Schmerz würdigen Ausdruck gegeben, sich selbst aber viele Herzen aufs
Neue gewonnen." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Dezember
1851: "Am 3. Oktober starb in Lehrberg im 60ten Jahre der tüchtige,
vielgeprüfte Lehrer, Herr Marx Gotthelf, Bruder des Redakteurs des
'Eilboten', und am 8. November im 65ten Jahre der Distriktsrabbiner Herr
Uri Veitel in Dittenheim. Nach einem sehr bewegten Leben hatte der
Letztere bei einem mäßigen Einkommen und einem überaus glücklichen
Familienleben den Hafen der Ruhe gefunden und wahrhaft fromm und bieder
und einer mäßigen Reform zugetan, besonders auch wegen seiner
Uneigennützigkeit, die Liebe seiner Gemeinden und die Achtung Aller sich
erworben, während Ersterer fortwährend mit dem Elend und der
Kleinlichkeit zu kämpfen hatte. In beiden Fällen hatte der Distriktsrabbiner
Herr Grünbaum aus Ansbach durch extemporierte Vorträge dem gerechten
Schmerz würdigen Ausdruck gegeben, sich selbst aber viele Herzen aufs
Neue gewonnen." |
Zum Tod von Lehrer Josef Mayer (1895, war bis 1862 Lehrer in
Lehrberg)
 Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Februar 1895:
"Windsbach. Dahier starb unlängst Josef Mayer, 33 Jahre lang
Religionslehrer der Kultusgemeinde Windsbach, im Alter von 69 Jahren. Zu
Sickershausen in Unterfranken geboren, war er zuerst in Lehrberg und kam dann
hierher; vor 2 Jahren zog er sich ins Privatleben zurück. Stets der streng
orthodoxen Richtung angehörend, tat er sich besonders hervor durch seine
Mithilfe bei Kranken und bei Sterbefällen. An seinem Sarge widmete ihm Lehrer
Hubert im Namen der Gemeinde ehrende Worte des Nachrufs. Möge die Erde ihm
leicht sein!" Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Februar 1895:
"Windsbach. Dahier starb unlängst Josef Mayer, 33 Jahre lang
Religionslehrer der Kultusgemeinde Windsbach, im Alter von 69 Jahren. Zu
Sickershausen in Unterfranken geboren, war er zuerst in Lehrberg und kam dann
hierher; vor 2 Jahren zog er sich ins Privatleben zurück. Stets der streng
orthodoxen Richtung angehörend, tat er sich besonders hervor durch seine
Mithilfe bei Kranken und bei Sterbefällen. An seinem Sarge widmete ihm Lehrer
Hubert im Namen der Gemeinde ehrende Worte des Nachrufs. Möge die Erde ihm
leicht sein!" |
Berichte zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
Über den aus Lehrberg stammenden jüdischen Hofmaler Levi
Pinhas (Juda Pinhas / Löw Pinhas, geb. 1727 in Lehrberg, gest. 1793 in Ansbach)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1924: "Ein vergessener jüdischer
Hofmaler. Von L. Horwitz in Kassel. Dem Sammler jüdischer Altertümer
begegnen oft Haggadas für die Sederabende, Keßubot (Heiratsverträge)
mit mehr oder weniger schönen Bildern. Aus der Blütezeit der Malerei in
Italien sind noch eine ganze Reihe solcher Kunstwerke erhalten, die das
Entzücken aller Kenner erregen. Es ist selbstverständlich, dass dieses künstlerische
Streben auf deutschem Boden vielfach Nachahmung fand für alle Gegenstände
des Kultus und häuslichen religiösen Brauches. Mit Bewunderung blicken
wir auf den Toraschmuck in Gold und Silber, Becher und Gewürzhäuschen,
Vorhänge und Mäntelchen, Esrogbüchsen, Chanukkaleuchter und Sederschüsseln,
durch welche unsere Altvorderen, dem Geschmack der Zeit huldigend, der Erfüllung
heiliger Pflichten mit künstlichem Geschmack genügen wollten. – Es ist
schwer zu erraten, warum man auch die Megillas Esther mit Bildern
verzierte, war ja doch die Pergamentrolle dann für den Gebrauch nicht
erlaubt. Freilich konnte der Inhalt mit seiner dramatischen Handlung dem
Maler Stoff geben, und so war es eine Megilloh, die einem
Sofer-Torarollenschreiber den Weg als Künstler ebnete, ihm die Türen der
Großen der Zeit eröffnete und ihm Ansehen wie reichlichen Lohn
verschaffte. Sein Erdenwallen der Gegenwart wieder bekannt zu machen, sei
der Zweck dieser Zeilen, die wiederum beweisen sollen, welche Talente
unter uns zu allen Zeiten lebten. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1924: "Ein vergessener jüdischer
Hofmaler. Von L. Horwitz in Kassel. Dem Sammler jüdischer Altertümer
begegnen oft Haggadas für die Sederabende, Keßubot (Heiratsverträge)
mit mehr oder weniger schönen Bildern. Aus der Blütezeit der Malerei in
Italien sind noch eine ganze Reihe solcher Kunstwerke erhalten, die das
Entzücken aller Kenner erregen. Es ist selbstverständlich, dass dieses künstlerische
Streben auf deutschem Boden vielfach Nachahmung fand für alle Gegenstände
des Kultus und häuslichen religiösen Brauches. Mit Bewunderung blicken
wir auf den Toraschmuck in Gold und Silber, Becher und Gewürzhäuschen,
Vorhänge und Mäntelchen, Esrogbüchsen, Chanukkaleuchter und Sederschüsseln,
durch welche unsere Altvorderen, dem Geschmack der Zeit huldigend, der Erfüllung
heiliger Pflichten mit künstlichem Geschmack genügen wollten. – Es ist
schwer zu erraten, warum man auch die Megillas Esther mit Bildern
verzierte, war ja doch die Pergamentrolle dann für den Gebrauch nicht
erlaubt. Freilich konnte der Inhalt mit seiner dramatischen Handlung dem
Maler Stoff geben, und so war es eine Megilloh, die einem
Sofer-Torarollenschreiber den Weg als Künstler ebnete, ihm die Türen der
Großen der Zeit eröffnete und ihm Ansehen wie reichlichen Lohn
verschaffte. Sein Erdenwallen der Gegenwart wieder bekannt zu machen, sei
der Zweck dieser Zeilen, die wiederum beweisen sollen, welche Talente
unter uns zu allen Zeiten lebten.
Einer Sofer-Toraschreiberfamilie gehörte Levi Pinhas an, der 1727 in Lehrberg
bei Ansbach geboren wurde. Sein Vater Samuel ernährte sich recht und
schlecht von seiner Hände Werk, und hatte auch noch die Aufgabe, in
regelmäßigen Abschnitten die Tefillin und Mesusaus in den umliegenden
Ortschaften auf ihre einwandfreie Beschaffenheit zu untersuchen. Schon als
Knabe zeigte Levi viel Interesse für den Beruf seines Vaters. Es schien
ihm aber wenig interessant, die gleichförmigen Buchstaben
nachzuschreiben. Mit Bildern versehene Naturgeschichtsbücher boten ihm
mehr Anregung; er zeichnete alles nach und so bildete sich das Talent in
der Stille. Im 13. Jahre verfertigte er eine Abschrift des Buches Esther
und verschönerte sie mit bildlichen Darstellungen der Hauptbegebenheiten;
diese Arbeit fand bei vielen Kunstkennern reichen Beifall. Hierdurch
ermuntert, verdoppelte er seinen Fleiß, und die Kunstwerke des jungen
Malers fanden schnellen Absatz. Sein Landesherr, der Markgraf von Ansbach,
würdigte ihn eines Auftrages zur Anfertigung einer kolorierten Haggada für
die Pessachabende. Die Arbeit gefiel und brachte dem Künstler außer der
Anerkennung noch 150 Gulden Honorar ein. Fast aller materiellen Sorgen
enthoben, ging Pinhas jetzt auf Reisen, um sich in seiner Kunst zu
vervollkommnen. Er suchte die bekanntesten Maler auf |
 und
fand bei den Hofmalern in Schwerin vielfache Anregung. Nach seiner Rückkehr
in die Heimat ernannte ihn der Markgraf zum Hofmaler mit 200 Talern
Jahresgehalt. Ein Umstand bewog ihn jedoch, auf seine Stelle zu
verzichten. Pinhas war Augenzeuge, wie zwei im Dienste des Markgrafen
stehende Israeliten die grausamste Behandlung erfuhren. Ein gleiches
Schicksal befürchtend, verließ er heimlich den Ansbacher Hof und fand in
Bayreuth beim Hofmaler Hin Unterkommen; auf Hins Fürsprache wurde er zum
2. Hofmaler mit einem Jahresgehalt von 400 Talern ernannt. Nun konnte er
sich einen eigenen Hausstand gründen und es ist für die feinere
Denkungsart des Markgrafen von Bayreuth bezeichnend, dass er ihm zur
Hochzeit ein völlig eingerichtetes Haus schenkte und eine Gehaltserhöhung
gewährte. Die verwandtschaftlichen Beziehungen des Bayreuther Hofes eröffneten
Pinhas neue Aufträge. Die Herzogin von Württemberg, eine Tochter der
Bayreuther, beschäftigte ihn lange Zeit und versprach ihm als besonderen
Lohn, das Los seiner Glaubensbrüder zu verbessern. Durch die Herzogin
wurde auch ihr Onkel Friedrich der Große auf Pinhas gelenkt. Bald folgte
er einer Berufung nach Berlin und malte dort den König, die Prinzen
Heinrich und Ferdinand, den Kronprinzen und den Statthalter von Holland.
Die Arbeiten fanden riechen Beifall. Über 11 Monate weilte Pinhas in
Berlin und war auf des Königs Veranlassung Gast des Bankiers Abraham
Markuse. Sein Aufenthalt in Berlin wäre ein dauernder gewesen, aber
Pinhas lehnte mit den Worten ab: ‚Mein Fürst hat mir zu viele Wohltaten
erwiesen, dass ich ihn verlassen könnte.* Bei seiner Ankunft in Bayreuth
wurde er mit vieler Freude empfangen. Auf eine von dem Prinzen Heinrich
von Preußen an ihn ergangene Einladung reiste er mit ihm nach Karlsbad,
und meine Quelle berichtet, dass auf ausdrücklichen Befehl des Prinzen
die nötigen Maßregeln und
fand bei den Hofmalern in Schwerin vielfache Anregung. Nach seiner Rückkehr
in die Heimat ernannte ihn der Markgraf zum Hofmaler mit 200 Talern
Jahresgehalt. Ein Umstand bewog ihn jedoch, auf seine Stelle zu
verzichten. Pinhas war Augenzeuge, wie zwei im Dienste des Markgrafen
stehende Israeliten die grausamste Behandlung erfuhren. Ein gleiches
Schicksal befürchtend, verließ er heimlich den Ansbacher Hof und fand in
Bayreuth beim Hofmaler Hin Unterkommen; auf Hins Fürsprache wurde er zum
2. Hofmaler mit einem Jahresgehalt von 400 Talern ernannt. Nun konnte er
sich einen eigenen Hausstand gründen und es ist für die feinere
Denkungsart des Markgrafen von Bayreuth bezeichnend, dass er ihm zur
Hochzeit ein völlig eingerichtetes Haus schenkte und eine Gehaltserhöhung
gewährte. Die verwandtschaftlichen Beziehungen des Bayreuther Hofes eröffneten
Pinhas neue Aufträge. Die Herzogin von Württemberg, eine Tochter der
Bayreuther, beschäftigte ihn lange Zeit und versprach ihm als besonderen
Lohn, das Los seiner Glaubensbrüder zu verbessern. Durch die Herzogin
wurde auch ihr Onkel Friedrich der Große auf Pinhas gelenkt. Bald folgte
er einer Berufung nach Berlin und malte dort den König, die Prinzen
Heinrich und Ferdinand, den Kronprinzen und den Statthalter von Holland.
Die Arbeiten fanden riechen Beifall. Über 11 Monate weilte Pinhas in
Berlin und war auf des Königs Veranlassung Gast des Bankiers Abraham
Markuse. Sein Aufenthalt in Berlin wäre ein dauernder gewesen, aber
Pinhas lehnte mit den Worten ab: ‚Mein Fürst hat mir zu viele Wohltaten
erwiesen, dass ich ihn verlassen könnte.* Bei seiner Ankunft in Bayreuth
wurde er mit vieler Freude empfangen. Auf eine von dem Prinzen Heinrich
von Preußen an ihn ergangene Einladung reiste er mit ihm nach Karlsbad,
und meine Quelle berichtet, dass auf ausdrücklichen Befehl des Prinzen
die nötigen Maßregeln |
 getroffen
wurden, dass Pinhas alle nur erdenklichen Bequemlichkeiten in jeder
Hinsicht fand. Pinhas gehörte bald zu den geschätztesten Künstlern
seiner Zeit. Mit nie ermüdendem Eifer lebte er seiner Kunst und benutzte
seine Stellung bei allen Fürstenhöfen, für seine in Unfreiheit lebenden
Glaubensgenossen zu sorgen, so beim Prinzen Christian von Dänemark, bei
den Fürsten von Thurn und Taxis, Fürsten von Wallerstein und anderen.
Die späteren Lebensschicksale des Pinhas sind nicht bekannt. Von seinen
vielen Gemälden ist nach Anfrage an zuständiger und verlässlicher
Stelle in Potsdam und Berlin keines inventarisiert. Ob in Ansbach und
Bayreuth noch solche vorhanden sind. muss noch erforscht werden.
getroffen
wurden, dass Pinhas alle nur erdenklichen Bequemlichkeiten in jeder
Hinsicht fand. Pinhas gehörte bald zu den geschätztesten Künstlern
seiner Zeit. Mit nie ermüdendem Eifer lebte er seiner Kunst und benutzte
seine Stellung bei allen Fürstenhöfen, für seine in Unfreiheit lebenden
Glaubensgenossen zu sorgen, so beim Prinzen Christian von Dänemark, bei
den Fürsten von Thurn und Taxis, Fürsten von Wallerstein und anderen.
Die späteren Lebensschicksale des Pinhas sind nicht bekannt. Von seinen
vielen Gemälden ist nach Anfrage an zuständiger und verlässlicher
Stelle in Potsdam und Berlin keines inventarisiert. Ob in Ansbach und
Bayreuth noch solche vorhanden sind. muss noch erforscht werden.
In fast gleicher Weise wie der Vater entwickelte sich sein ältester Sohn
Salomon Pinhas, der nach langem Wanderleben in Kassel eine bleibende Stätte
fand. Vom Landgrafen Friedrich mit Schutz versehen, ernannte ihn Kurfürst
Wilhelm zum Hofmaler. In Kassel fand Pinhas ein reiches Feld. In vielen
adeligen und Beamtenfamilien hängen heute noch seine Miniaturen, die von
hohem künstlerischem Wert sind. Auch viele jüdische Familien bewahren
noch Bilder von seiner Hand. Im hohen Alter – am 14. Adar 1 5597 –
nahm der Tod ihm den Pinsel aus der Hand; auf dem Friedhof zu Kassel fand
er neben seiner Frau Bella Hirsch seine letzte Ruhestätte. Die Aufschrift
seines Grabsteins rühmt seine Kunst und seine innige Frömmigkeit. Seinem
Sohn Dr. Jakob Pinhas bewahren die Israeliten Kurhessens ein dauerndes
Gedenken, denn er verschaffte ihnen die bürgerliche Gleichstellung und
setzte seine ganze Kraft und seinen ganzen Einfluss für das Wohls einer
Glaubensbrüder ein. – Sein jüngerer Bruder Hermann Hirsch Pinhas, geb.
März 1794, gest. 17. Februar 1844 machte als freiwilliger Jäger zu Fuß
die Freiheitskriege mit und erwarb sich als Kupferstecher einen Namen;
auch von ihm sind viele Bilder erhalten, namentlich von Freiburger
Professoren. – So zeigten uns die Genannten, wie Kräfte sich
entwickeln, wenn man ihnen Raum gibt." |
Zum Tod von Bernhard Mahler (geb. 1828 in Lehrberg, gest. 1908 in Ansbach)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1908: "Ansbach, 20.
Dezember. Am 18. Dezember starb Herr Privatier Bernhard Mahler dahier im
nahezu vollendeten 80. Lebensjahre. Er war aus Lehrberg gebürtig,
einer ehemals respektablen jüdischen Gemeinde, die längst zu bestehen
aufgehört hat und nun das Schicksal vieler anderen teilt. Im Hause des
Dahingeschiedenen hatten Einfachheit, Bescheidenheit und Zufriedenheit,
gepaart mit reinster Gottesfurcht dauernde Stätte. Beliebt und geehrt von
allen, ohne Unterschied des Ranges und Standes. Repräsentierte Herr
Mahler so echt und recht den wackeren Vertreter des alten Kehillolebens,
war Vorstand der Chewra Kadischo, viele Jahre Mitglied der
Kultusverwaltung, ein eifriger, unermüdlicher Besucher der Synagoge,
geschmückt mit dem Diadem eines unbefleckten guten Namens. Durch den Tod
seiner Gattin, das frühzeitige Sterben einer Tochter, sowie zweier
Schwiegersöhne in der Blüte der Jahre hat er vieles Leid erduldet und in
Ergebung wie ein Held ertragen. Kein Wunder daher, dass sein Tod eine
gewaltige Lücke bei Familie und Gemeinde verursacht. Herr Rabbiner Dr.
Kohn schilderte die edlen Tugenden dieses Mannes und zeichnete das
herrliche Charakterbild des Verstorbenen. Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1908: "Ansbach, 20.
Dezember. Am 18. Dezember starb Herr Privatier Bernhard Mahler dahier im
nahezu vollendeten 80. Lebensjahre. Er war aus Lehrberg gebürtig,
einer ehemals respektablen jüdischen Gemeinde, die längst zu bestehen
aufgehört hat und nun das Schicksal vieler anderen teilt. Im Hause des
Dahingeschiedenen hatten Einfachheit, Bescheidenheit und Zufriedenheit,
gepaart mit reinster Gottesfurcht dauernde Stätte. Beliebt und geehrt von
allen, ohne Unterschied des Ranges und Standes. Repräsentierte Herr
Mahler so echt und recht den wackeren Vertreter des alten Kehillolebens,
war Vorstand der Chewra Kadischo, viele Jahre Mitglied der
Kultusverwaltung, ein eifriger, unermüdlicher Besucher der Synagoge,
geschmückt mit dem Diadem eines unbefleckten guten Namens. Durch den Tod
seiner Gattin, das frühzeitige Sterben einer Tochter, sowie zweier
Schwiegersöhne in der Blüte der Jahre hat er vieles Leid erduldet und in
Ergebung wie ein Held ertragen. Kein Wunder daher, dass sein Tod eine
gewaltige Lücke bei Familie und Gemeinde verursacht. Herr Rabbiner Dr.
Kohn schilderte die edlen Tugenden dieses Mannes und zeichnete das
herrliche Charakterbild des Verstorbenen. Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige des Manufakturwarengeschäftes Leopold Selling
(1925)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. September 1925: "Detailreisender Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. September 1925: "Detailreisender
für eingeführte (? Kunden?) zu baldigem Eintritt gesucht.
Offerten mit Lichtbild und Zeugnisabschriften an
Leopold Selling, Manufakturwaren, Lehrberg,
Mittelfranken." |
Zur Geschichte der Synagoge
Über die Geschichte der Synagoge liegen keine Informationen
vor. Sie wurde vermutlich um 1900 geschlossen, verkauft und zu einem
Wohnhaus umgebaut.
Adresse/Standort der Synagoge: Obere
Hindenburgstr. 10
Fotos
Das Gebäude der ehemaligen
Synagoge 2005
Fotos: U. Metzner,
Feuchtwangen von 2005
(Quelle: www.synagogen.info) |
 |
 |
| |
Blick von der
Hindenburgstraße |
Die Rundbogenfenster
erinnern an die
besondere Vergangenheit des Gebäudes |
| |
|
|
Das Gebäude der ehemaligen
Synagoge 2007
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 9.7.2007) |
 |
 |
| |
Blick über die
Hindenburgstraße |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
| |
Blick auf den
Gebäudeteil, in dem sich
die Synagoge befand |
Im linken Gebäudeteil war die
Synagoge,
im rechten die Schule und Lehrerwohnung |
| |
|
|
| |
 |
|
| |
Ehemaliges jüdisches Wohnhaus
Hindenburgstraße 20 |
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 194. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 165-166. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 274-275.
|
 | Martin Krieger: Die Ansbacher Hofmaler des 17. und
18. Jahrhunderts. Jahrbuch des Historischen Vereins für Mittelfranken 83.
1966. S. 239-257. |
 | Kurze Lebensgeschichte von Leo Pinhas auch in: Claus Stephani:
Der Mensch im Menschen ist ewig. Marginalien zum Bildnis des Juden in der
modernen Kunst.
Online zugänglich.
|


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Lehrberg Middle Franconia.
The community was founded in the late 16th century and numbered 140 in 1837
(total 1.090). Ten remained in 1933, attached to the Ansbach community. All left
by January 1939.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|