|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der
Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"
zur
Übersicht "Synagogen im Landkreis Alzey-Worms
Eppelsheim (VG
Alzey-Land, Kreis
Alzey-Worms)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Eppelsheim lebten jüdische Personen spätestens seit der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts: 1722 wird eine Familie am Ort genannt
(Familie von Mendels Witwe). 1743 sind es zwei (Familie des Moses Mendel und
Familie von Callmanns Witwe),
1806 sechs und 1808 sieben jüdische Familien am Ort. Um 1800 dürfte eine Gemeinde gegründet
worden sein. Aus anderen Orten sind in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
noch einzelne jüdische Personen/Familien nach Eppelsheim zugezogen wie Isaak Schloss aus
Ingenheim (1800), Abraham Schafner aus Heßloch
(1812), Jacob Grünebaum aus Reipoltskirchen (1817). Die ältesten in den
Ortsbürgerregistern ab 1823 genannten und in Eppelsheim geborenen Personen
waren: Michael Herz (Handelsmann, geb. 1762), Lazarus Levis (Handelsmann,
geb. 1768, gest. 1844), Emanuel Levis (Handelsmann, geb. 1775), Johannes Hahn
(Makler, geb. 1778, gest. 1843)
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1824 58 jüdische Einwohner, 1828 70 (5 % der Gesamteinwohnerschaft),
1861 55 (5,9 % von insgesamt 932 Einwohnern), 1880 38 (4,4 % von 866), um 1890
33 (in acht Familien), um 1896 23 (in sechs Familien), 1900 20
(2,2 % von 909), 1910 22 (2,2 % von 993). Die jüdischen Familiennamen
waren im 19. Jahrhundert: Busch, Grünebaum, Hahn, Herz, Levis, Schaffner,
Schloss, Süs. Mehrere Familien sind - vor allem um 1850 - nach Amerika
ausgewandert, darunter Jacob Grünebaum mit Familie (1852; seine Söhne waren
schon in den Jahren zuvor ausgewandert, s.u. bei Henry und Elias Greenebaum), Isaac Levis (1853), Isaac
Schloss II (1853), Johannes Hahn II (1849), Jacob Hertz (1858), Nathan Schaffner
(1864), Jacob Hahn (1860). Von großer Bedeutung waren mehrere aus Eppelsheim stammende
jüdische Auswanderer für die Entwicklung der jüdischen Gemeinschaft in Chicago.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge
(s.u.), eine jüdische Schule (Religionsschule), ein rituelles Bad und einen Friedhof.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war - zumindest im 19.
Jahrhundert - ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet
tätig war (vgl. die - vermutlich letzte - Ausschreibung der Stelle 1890 unten).
Von den Lehrern werden genannt: um 1890 E. Agulnik (unterrichtete damals
7 Kinder, dazu unterrichtete er die Kinder in Gundersheim). Um 1894
unterrichtete Lehrer Katzenstein in Monsheim
die noch vier jüdischen Kinder aus Eppelsheim. Um 1897 unterrichtete Lehrer J.
Rothenberg aus Heßloch die noch vier
schulpflichtigen Kinder der Gemeinde in Religion. Um 1899 unterrichtete Lehrer
Silberstein aus Monsheim die noch drei
schulpflichtigen Kinder in Eppelsheim. 1904 wurde ein gemeinsamer Unterrichtsbezirk der Gemeinden Hessloch,
Monzernheim, Eppelsheim, Gundersheim
und Westhofen mit Sitz in Hessloch
gebildet. Die Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk Worms.
Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1890/1896 L. Schloß, B.
Levis, L. Heymann.
Um 1924, als zur Gemeinde 22 Personen (2,2 % von insgesamt 980
Einwohnern) gehörten, war Gemeindevorsteher Max Levis. Ein eigener Lehrer war
schon längere Zeit nicht mehr in der Gemeinde angestellt. Die vier
schulpflichtigen jüdischen Kinder erhielten ihren Religionsunterricht in Alzey.
1930 gab es noch vier jüdische Familien am Ort. Die jüdischen
Haushaltsvorsteher verdienten den Lebensunterhalt als Händler mit
Futtermitteln, Frucht und Vieh, als Metzer und Lebensmittelkaufmann. Albert
Strass war als Schrotthändler tätig.
1933 wurden 17 jüdische Einwohner gezählt (1,7 % von insgesamt 983
Einwohnern). Diese sind auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Die diskriminierenden
Maßnahmen hatten 1933 damit begonnen, dass bei den Wahlen im November 1933 die
zwölf jüdischen Stimmberechtigten in Eppelsheim von der Wahlliste gestrichen
wurden, sodass sie ihr Wahlrecht nicht ausüben konnten.
1935 wurde die Gemeinde aufgelöst. 1934 bis 1937 konnten fünf jüdische
Personen in die USA emigrieren, drei sind innerhalb von Deutschland verzogen. Aus
der Familie des Schrotthändlers Strass konnte eine Person nach Palästina
emigrieren, zwei nach Argentinien, fünf Personen der Familie wurden später
deportiert, drei sind umgekommen. Die letzten jüdischen Einwohner verließen
bis zum Sommer 1939 auf Grund der Ereignisse beim Novemberpogrom 1938 den
Ort.
Von den in Eppelsheim geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Else Lessler geb. Levis
(1908), Moritz Levis (1888), Wilhelmine Mannheimer geb. Strass (1901), Ernestine
(Ernestina) Meyer geb. Schloss (1890), Anna Strass
(1910), Albert Strass (1911), Anna Süs geb. Strauss (1871).
Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet
1872 / 1890
sowie Ausschreibungen der Vorbeterstellen für die hohen Feiertage 1903 / 1907 /
1908 / 1909 / 1911
 Anzeige in der "Wochenschrift für die religiösen und socialen Interessen des
Judentums" vom März 1872 S. 290: "Vakanz. Anzeige in der "Wochenschrift für die religiösen und socialen Interessen des
Judentums" vom März 1872 S. 290: "Vakanz.
In der israelitischen Gemeinde Eppelsheim bei Worms ist die Stelle
eines Lehrers, Cantors und Schächters, mit der ein jährlicher Gehalt von 300
Gulden nebst freier Wohnung verbunden ist, vakant. Konkurrenzfähige Bewerber
wollen sich unter Vorlage ihrer Zeugnisse bei unterzeichneter Behörde
melden.
Worms, den 15. August 1872. Großherzogliches Kreisamt Worms."
|
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1890: Die
hiesige Kantor-, Schächter- und Lehrerstelle soll sofort besetzt werden.
Gehalt 400 Mark nebst freier Wohnung und Heizung und bedeutendem
Nebenverdienst. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1890: Die
hiesige Kantor-, Schächter- und Lehrerstelle soll sofort besetzt werden.
Gehalt 400 Mark nebst freier Wohnung und Heizung und bedeutendem
Nebenverdienst.
Offerten mit Zeugnisabschriften wolle man senden an
Leopold Schloss, Vorstand, Eppelsheim
(Rheinhessen)." |
| |
 Ausschreibung
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 24. Juli 1903:
"Eppelsheim (Hessen). Vorbeter für die hohen Feiertage. Mark 50 bis
Mark 60 und freie Station." Ausschreibung
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 24. Juli 1903:
"Eppelsheim (Hessen). Vorbeter für die hohen Feiertage. Mark 50 bis
Mark 60 und freie Station." |
| |
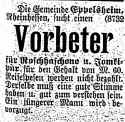 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. August 1907:
"Die Gemeinde Eppelsheim, Rheinhessen, sucht einen Vorbeter
für Roschhaschono und Jomkippur für den Gehalt von Mark 60.
Reisespesen werden nicht bezahlt. Derselbe muss eine gute Stimme haben und
gut zum verstehen sein. Ein jüngerer Mann wird
bevorzugt." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. August 1907:
"Die Gemeinde Eppelsheim, Rheinhessen, sucht einen Vorbeter
für Roschhaschono und Jomkippur für den Gehalt von Mark 60.
Reisespesen werden nicht bezahlt. Derselbe muss eine gute Stimme haben und
gut zum verstehen sein. Ein jüngerer Mann wird
bevorzugt." |
| |
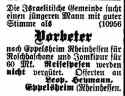 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. August 1908:
"Die Israelitische Gemeinde sucht einen jüngeren Mann mit guter
Stimme als Vorbeter nach Eppelsheim Rheinhessen für Roschhaschone
und Jomkippur für 60 Mark. Reisespesen werden nicht
vergütet. Offerten an Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. August 1908:
"Die Israelitische Gemeinde sucht einen jüngeren Mann mit guter
Stimme als Vorbeter nach Eppelsheim Rheinhessen für Roschhaschone
und Jomkippur für 60 Mark. Reisespesen werden nicht
vergütet. Offerten an
Leopold Heymann, Eppelsheim (Rheinhessen)." |
| |
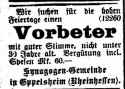 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. August 1909:
"Wir suchen für die hohen Feiertage einen Vorbeter mit guter
Stimme, nicht unter 30 Jahre alt. Vergütung inklusive Spesen Mark
60.- Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. August 1909:
"Wir suchen für die hohen Feiertage einen Vorbeter mit guter
Stimme, nicht unter 30 Jahre alt. Vergütung inklusive Spesen Mark
60.-
Synagogen-Gemeinde in Eppelsheim (Rheinhessen). |
| |
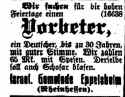 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1911:
"Wir suchen für die hohen Feiertage einen Vorbeter, ein
Deutscher, bis zu 30 Jahren, mit guter Stimme. Wir zahlen 65 Mark mit
Spesen. Derselbe soll auch Schofar blasen. Israelitische Gemeinde
Eppelsheim (Rheinhessen)". Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1911:
"Wir suchen für die hohen Feiertage einen Vorbeter, ein
Deutscher, bis zu 30 Jahren, mit guter Stimme. Wir zahlen 65 Mark mit
Spesen. Derselbe soll auch Schofar blasen. Israelitische Gemeinde
Eppelsheim (Rheinhessen)". |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Bei jüdischen Beerdigungen in
Eppelsheim läuten die Kirchenglocken (1857)
Anmerkung: der genannte Rabbiner Dr. Ludwig Lewysohn war als Rabbiner ausgebildet, aber in
Worms als "Prediger" neben Rabbiner Jakob (Koppel) Bamberger angestellt. Zu Dr.
Ludwig Lewysohn (geb. 1819 in Schwersenz, gest. 1901 in Stockholm) siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Lewysohn.
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 23. März 1857: "Bei
einem Leichenbegängnis (sc. Beerdigung) in der Gemeinde Eppelsheim,
bei welchem Levysohn von hier (sc. Worms) die geistliche Funktion
versagt, hatte derselbe Gelegenheit zu bemerken, dass unaufgefordert mit den
Glocken der Kirche geläutet wurde; es soll dies in allen den Gemeinden
Rheinhessens der Fall sein, in welchen die jüdische Bevölkerung zur
Anschaffung der Glocken mit beisteuerte." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 23. März 1857: "Bei
einem Leichenbegängnis (sc. Beerdigung) in der Gemeinde Eppelsheim,
bei welchem Levysohn von hier (sc. Worms) die geistliche Funktion
versagt, hatte derselbe Gelegenheit zu bemerken, dass unaufgefordert mit den
Glocken der Kirche geläutet wurde; es soll dies in allen den Gemeinden
Rheinhessens der Fall sein, in welchen die jüdische Bevölkerung zur
Anschaffung der Glocken mit beisteuerte." |
Zu einzelnen
Personen aus der jüdischen Gemeinde
(Grundlage der Informationen bereits bei Arnsberg s.Lit. Bd. I S. 163)
Henry Greenebaum (Grünebaum) ist am 18. Juni 1833 in Eppelsheim
als Sohn von Jacob Elias Grünebaum (geb. 1797 in Reipoltskirchen,
gest. 1870 in Chicago) und der Sara Esther geb. Herz (geb. 25. Juli 1796 in Eppelsheim,
gest. 18. September 1894 in Chicago) geboren.
Er wanderte 1848 nach Chicago aus, wo bereits seine Brüder Michael und Elias
waren. Zunächst war er als Verkäufer und vier Jahre in einer Bank tätig.
Danach gründete er mit seinem Bruder Elias (siehe unten) die German National
Bank, dann auch die German Savings Bank. 1877 geriet die Bank allerdings in
Schwierigkeiten, worauf er sich ins Versicherungsgeschäft verlegte. Er starb im
Alter von 80 Jahren im Februar 1914. Zeitlebens hat er sich für die Interessen
der jüdischen Gemeinschaft in Chicago eingesetzt. Er war mit Abraham Lincoln
befreundet und unterstützte General Grant im Jahre 1868. U.a. war er Gründer
der City Library of Chicago, der United Hebrew Charities und von Bnai Berth in
Chicago. Er war lebenslängliches Mitglied der Chicago Historical Society und
gehörte vielen weiteren Institutionen und Organisationen an.
Elias Greenebaum (Grünebaum) ist 1822 in Eppelsheim
geboren (älterer Bruder von Henry). Er
wanderte 1847
nach Chicago aus. Nachdem die mit seinem Bruder Henry gegründete Bank 1877 in
Schwierigkeit geraten war, gründete er 1878 mit seinen beiden Söhnen das
Bankhaus Greenebaum Sons, das noch bis mindestens 1914 bestand. Elias
Greenebaum starb im hohen Alter von 96 Jahren 1919 in Chicago.
Michael Greenebaum (Grünebaum) ist 1824 in
Eppelsheim geboren. Er wanderte 1846 nach Chicago aus. 1851 gründete er die
"Hebrew Benevolent Society" und wurde ihr erster Präsident. Er hat
mehrere andere für die jüdische Gemeinschaft wichtige Organisationen
gegründet oder mitbegründet (u.a. die Zion Literary Society). Er starb
1894 in Chicago.
Abraham Hart (Herz) ist 1831 in Eppelsheim geboren. Er wanderte 1854
nach Chicago aus und gründete mit seinem jüngeren Bruder Henry
N. Hart das Möbel-Engros-Geschäft Hart Brothers. Abe Hart (wie er
genannt wurde) war von Bedeutung für die jüdische Gemeinschaft Chicagos. Er
gründete das jüdische Waisenhaus in Cleveland und unternahm viel für Waisen
und Wohltätigkeit, sodass er auch als "Montefiore of Chicago"
bezeichnet wurde. Lange Jahre war er Direktor der Sinai Congregation in Chicago.
| Kennkarte
aus der NS-Zeit |
| |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |
| |
Kennkarten
für Albert Strass,
geboren in Eppelsheim |
 |
|
| |
Kennkarte (Mainz 1939)
für Albert Strass (geb. 26. November 1911 in Eppelsheim),
landwirtschaftlicher Arbeiter, wohnhaft in Alzey, Worms und Mainz;
am 30. September 1942
ab Darmstadt in das Vernichtungslager Treblinka deportiert und vermutlich
ermordet. |
|
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war vermutlich ein Betraum in einem der
jüdischen Häuser vorhanden. 1841/42 wurde der Bau einer Synagoge
geplant. Alternativ wurden der Kauf eines Wohnhauses zum Umbau in eine Synagoge
oder der Kauf eines Grundstückes zum Neubau erwogen. Behördlicherseits wurde
die Durchführung einer Kollekte in Worms sowie die Sammlung bei reicheren
jüdischen Familien in Frankfurt genehmigt. Doch führten diese Bemühungen
zunächst nicht zu einem Erfolg. Bis 1848 wurden die Baupläne zurückgestellt.
Erst 1849 wurde mit dem Bau begonnen, 1850 wurde die Synagoge eingeweiht.
Über 80 Jahre war die Synagoge Zentrum des jüdischen Gemeindelebens am Ort.
Auf Grund der seit Ende des 19. Jahrhunderts zurückgegangenen Zahl der
Gemeindeglieder wurde das Abhalten von Gottesdiensten jedoch wegen der dazu
nötigen Zahl von zehn jüdischen Männern (Minjan) vermutlich immer
schwieriger. Doch wurde die Synagoge an Festtagen und zu besonderen
Gottesdiensten weiterhin verwendet, wie die Durchführung einer Bar Mizwah-Feier
in der Synagoge 1931 zeigt (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bar_Mitzwa):
Bar Mizwa-Feier in der Synagoge (1931)
 Artikel im "Mitteilungsblatt des Landesverbandes der israelitischen
Gemeinden in Hessen" vom September 1931 S. 9: "Eppelsheim.
Am 22. August dieses Jahres wurde Rudi Levis, Sohn des Herrn Max
Levis, Barmizwoh. Das war für unsere kleine, nur aus vier Familien
bestehende Gemeinde ein erhebender Tag, fand doch diese Veranlassung nach
langer Pause wieder einmal in unserer, für diesen Zweck festlich
geschmückten Synagoge Gottesdienst am Freitag abend und am Sabbat morgen
statt. Geleitet wurde dieser durch Herrn A. Salomon, Oberreallehrer
i.R., aus Worms, der im Auftrage des Landesverbandes den Barmizwoh
für diesen religiösen Akt vorbereitet hatte. Dieser trug seinen
Toraabschnitt in einer Weise vor, die ihm den Beifall aller Zuhörer
Eindruck. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand eine Ansprache des Herrn
Salomon, gerichtet an die Gemeinde und an den Barmizwoh, die auch auf
die gegenwärtige ernste Lage unseres Vaterlandes einging, aber auch der
zuversichtlichen Hoffnung auf kommende bessere Zeiten Ausdruck gab. Sie galt
allen Parteien und Bekenntnissen; sie forderte auf zur Einfachheit,
Mäßigkeit und Bescheidenheit, zur Tapferkeit im ertragen. Dieser Appell galt
insbesondere den Frauen. Auch dem Söhnchen des Herrn Otto Süs, Karl
Ludwig Süs, das in diesem Sabbat zum ersten Mal mit seiner Wimpel (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mappa) zum Gotteshause ging, widmete
Herr Salomon von Herzen kommenden Wünsche. Möge es Herrn Salomon noch
vergönnt sein seine Worte in Erfüllung gehen zu sehen!" Artikel im "Mitteilungsblatt des Landesverbandes der israelitischen
Gemeinden in Hessen" vom September 1931 S. 9: "Eppelsheim.
Am 22. August dieses Jahres wurde Rudi Levis, Sohn des Herrn Max
Levis, Barmizwoh. Das war für unsere kleine, nur aus vier Familien
bestehende Gemeinde ein erhebender Tag, fand doch diese Veranlassung nach
langer Pause wieder einmal in unserer, für diesen Zweck festlich
geschmückten Synagoge Gottesdienst am Freitag abend und am Sabbat morgen
statt. Geleitet wurde dieser durch Herrn A. Salomon, Oberreallehrer
i.R., aus Worms, der im Auftrage des Landesverbandes den Barmizwoh
für diesen religiösen Akt vorbereitet hatte. Dieser trug seinen
Toraabschnitt in einer Weise vor, die ihm den Beifall aller Zuhörer
Eindruck. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand eine Ansprache des Herrn
Salomon, gerichtet an die Gemeinde und an den Barmizwoh, die auch auf
die gegenwärtige ernste Lage unseres Vaterlandes einging, aber auch der
zuversichtlichen Hoffnung auf kommende bessere Zeiten Ausdruck gab. Sie galt
allen Parteien und Bekenntnissen; sie forderte auf zur Einfachheit,
Mäßigkeit und Bescheidenheit, zur Tapferkeit im ertragen. Dieser Appell galt
insbesondere den Frauen. Auch dem Söhnchen des Herrn Otto Süs, Karl
Ludwig Süs, das in diesem Sabbat zum ersten Mal mit seiner Wimpel (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mappa) zum Gotteshause ging, widmete
Herr Salomon von Herzen kommenden Wünsche. Möge es Herrn Salomon noch
vergönnt sein seine Worte in Erfüllung gehen zu sehen!" |
Spätestens seit der Auflösung der Gemeinde 1935 wird die Synagoge nicht
mehr zu Gottesdiensten verwendet worden sein. Dennoch ist das Gebäude beim Novemberpogrom
1938 verwüstet worden. Danach wurde es 1939 gekauft, vom neuen Eigentümer als Geräteschuppen
verwendet und 1973 abgebrochen. Der Eigentümer hatte sich 1972 an
die staatliche Denkmalpflege gewandt, da er das Grundstück besser nutzen
wollte. Zunächst wurde erwogen, nur noch das Erdgeschoss zum Unterstellen von
Geräten zu verwenden und in das Obergeschoss eine Wohnung einzubauen. Auch ein
Anbau wurde genehmigt. Die Pläne konnten nicht realisiert
werden. 1974 wurde an Stelle der ehemaligen Synagoge eine Gerätehalle
errichtet (Auskünfte Bürgermeisteramt Eppelsheim vom 14. und 15.9.2010).
Adresse/Standort der Synagoge:
Grundstück Blaugasse 21
(Hinweis: die Synagoge stand nicht, wie in
manchen Publikationen genannt, in der Blaugasse 7; das hier stehende Haus hat nichts mit der ehemaligen Synagoge zu tun).
Fotos
Gedenktafel an der
Außenmauer zur
evangelischen Kirche in Eppelsheim
(Foto von Michael Ohmsen,
Sommer 2010) |
 |
 |
| |
Inschrift
der Tafel: "Zur Erinnerung an alle Opfer nationalsozialistischer
Gewaltherrschaft aus unserer Gemeinde. Stellvertretend für viele nennen
wir die Namen ehemaliger jüdischer Mitbürger: Anna Strass * 4.6.10, in
Auschwitz verschollen - Else Lessler geb. Levis * 26.1.08, in Auschwitz
schollen - Moritz Levis * 5.2.1888, in Eppelsheim für tot erklärt -
Wilhelmine Mannheimer geb. Strass * 17.9.01, in Polen verschollen -
Ernestine Mayer geb. Schloß * 3.2.1890, in Auschwitz für tot erklärt,
Albert Strass * 26.11.11, in Polen verschollen." |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 162-163. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 78. |
 | Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt
des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies
ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. Mainz 2005. S. 146 (mit weiteren Literaturangaben).
|
 | Die Juden im Ortsbürgerregister von Eppelsheim Liste
1823-1836 und Liste
1837-1881 (Online einsehbar). |
 | Monika Richarz / Reinhard Rürup: Jüdisches
Leben auf dem Lande. 1997. S. 378 (zu Eppelsheim 1933). |
 | Tobias Brinkmann: Von der Gemeinde zur 'Community'.
Jüdische Einwanderer in Chicago 1840-1900. Universitätsverlag Rasch
Osnabrück 2002.
Darin ein Abschnitt 2.5: "Von Eppelsheim nach Chicago: Kettenwanderung
nach Chicago" S. 65-71. |
 | Hart, Schaffner & Marx: Reprint des Style Book
Herbst/Winter 1909-1910. Mit einem Nachwort von Martina Graf und einer
englischen Übersetzung von Lisa Hannah. Hamm am Rhein 2012. (Im Nachwort
auch eine Beschreibung der deutschen Herkunft).
vgl. Presse-Artikel Hammer Verlag gestaltet Reprint des „Style Book“ von „Hart, Schaffner & Marx“ (Allgemeine Zeitung, 04.07.2012) |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Eppelsheim, Hesse. The community,
numbering 70 (5 % of the total) in 1828, disbanded in 1935 and by August 1939 no
Jews remained.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|