|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zu den "Synagogen
im Kreis Offenbach"
Urberach mit
Ober-Roden (Stadt Rödermark, Kreis Offenbach)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In dem bis 1816 zur Ysenburgischen Herrschaft gehörenden
Urberach bestand eine kleine jüdische
Gemeinde bis um 1935/38. Ihre Entstehung geht in die Zeit Ende des 18.
Jahrhunderts zurück, als 1797 erstmals ein "Schutzjude" Jonas
Abraham genannt wird.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1828 40 jüdische Einwohner, 1861 43 (2,8 % von
insgesamt 1.518 Einwohnern), 1880 44 (2,8 % von 1.564), 1887 61 (nach dem
"Statistischen Jahrbuch des Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes"), um 1893 57
(in 10 Familien), 1894 (9 Familien), 1895/1897 40 (in 9 Familien), 1899 (mit
Ober-Roden) 55 (in 13 Haushaltungen). Bis 1905 ging die Zahl auf
28 zurück, 1910 auf 24 (1,1 % von 2.112).
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), vermutlich auch ein
Unterrichtsraum für die jüdischen Kinder. Ob ein rituelles Bad vorhanden war,
ist nicht bekannt. Gleichfalls ist nicht bekannt, ob zeitweise ein eigener
jüdischer Religionslehrer (zugleich Vorsänger und Schächter) angestellt war.
Um 1892 unterrichtete die damals 10 schulpflichtigen jüdischen Kinder der
Gemeinde Lehrer Mosessohn aus Messel. 1899
wird Lehrer Heilmann genannt.
Die Toten der jüdischen Gemeinde wurden in Dieburg
beigesetzt. Die Gemeinde gehörte zunächst zum orthodoxen Bezirksrabbinat
Darmstadt II, 1928 erfolgte der Übertritt zum liberalen Bezirksrabbinat
Darmstadt I.
Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1876/1879 Löser Strauß, um
1887/1892 die Herren L. Adler, J. Straus und H. Straus, um 1894/1897 H. Adler,
um 1899 Leser Adler (bis zu seinem Tod 1908), A. Strauß, H. Strauß.
Um 1924, als noch vier jüdische Familien mit zusammen 18 Personen am Ort
waren (0,7 % von 2.449), gehörten zur jüdischen
Gemeinde auch die im benachbarten Ober-Roden lebenden 18 jüdischen
Einwohner (hier war mindestens schon seit den 1880er-Jahren eine Familie
Hirschmann anwesend; 1899 lautet die Gemeindebezeichnung: Urberach - Ober-Roden).
Den Religionsunterricht der Kinder der Gemeinde erteilte Lehrer Kaufmann aus Sprendlingen. Gemeindevorsteher bis um 1933 war Max Strauß.
Nach 1933 sind die
meisten bis dahin am Ort wohnhaften jüdischen Gemeindeglieder (1933: 11 Personen) auf Grund der
Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Die Gemeinde löste sich
bereits vor oder spätestens um 1938 vor. Beim Novemberpogrom 1938
wurden
die Kaufleute Julius Adler (1883), Artur Katz (1901) und der Metzger Max Strauß
(1878) verhaftet und in das KZ Buchenwald verschleppt. In Ober-Roden wurde in
der Frankfurter Straße 17 das Schuhgeschäft der Händlerin Frieda Kahn (gest.
1940 in Ober-Roden) und ihrer Tochter Berta Hecht von 60
Nationalsozialisten überfallen und völlig demoliert.
Von den in Urberach geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Emilie Adler (1914),
Hermann Adler (1870), Julius Adler (1883), Johanna Bacharach geb. Adler (1889),
Arthur Katz (1901), Klara Katz geb. Strauß (1903), Herrmann Kulp (1870), Mina
Marx geb. Adler (1874), Aron Strauss (1863), Herz Max Strauss (1870), Moritz
Strauss (1863).
Von den in Ober-Roden geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Berta Hecht geb. Kahn
(1899), Rosa Hecht (1925), Salomon Hecht (Schicksal unbekannt), Ella Emma Tobias geb. Hirschmann
(1884).
Am 21. November 2013 wurden zur Erinnerung an Familie Kahn-Hecht in der
Frankfurter Straße 17 in Ober-Roden sechs "Stolpersteine"
verlegt.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Berichte aus dem jüdischen
Gemeindeleben
Ergebnis einer Kollekte in der
Gemeinde (1901)
Anmerkung: In den jüdischen Gemeinden wurden regelmäßig für die
unterschiedlichsten Zwecke Kollekten durchgeführt; die Ergebnisse wurden in
jüdischen Periodika veröffentlicht
 Mitteilung
in "Der Israelit" vom 28. Februar 1901: "Urberach bei Offenbach
(Main). Durch Vorstand Leser Adler: Von sich 5, Moses Adler I. 3, Moses
Adler II. 1, Aron Straus 1, Hermann Straus 1, Abraham Straus in
Ober-Roden 1, zusammen abzüglich Porto 11.80 M." Mitteilung
in "Der Israelit" vom 28. Februar 1901: "Urberach bei Offenbach
(Main). Durch Vorstand Leser Adler: Von sich 5, Moses Adler I. 3, Moses
Adler II. 1, Aron Straus 1, Hermann Straus 1, Abraham Straus in
Ober-Roden 1, zusammen abzüglich Porto 11.80 M." |
Unterstützung der Gemeinde für den
Religionsunterricht (1905)
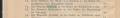 Mitteilung
in "Mitteilungen an die Vereinsmitglieder /herausgegeben von dem Vorstande
der Vereinigung | Freie Vereinigung für die Interessen des Orthodoxen Judens"
von 1905 Heft 18: "... 14. Der Gemeinde Urberach zu den Kosten des
Religionsunterrichts 40.-" Mitteilung
in "Mitteilungen an die Vereinsmitglieder /herausgegeben von dem Vorstande
der Vereinigung | Freie Vereinigung für die Interessen des Orthodoxen Judens"
von 1905 Heft 18: "... 14. Der Gemeinde Urberach zu den Kosten des
Religionsunterrichts 40.-" |
Berichte
zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
Versuchter Mord an Handelsmann J. Hirschmann in
Ober-Roden aus antisemitischen Gründen (1890)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. September
1890: "Man meldet aus Ober-Roden (Hessen): Ein Arbeiter,
namens Grimm, beschimpfte den Handelsmann J. Hirschmann
seiner Religion wegen, und als dieser sich die Rohheiten in ruhigem Tone
verbat, zog Grimm ein Messer und stach auf Hirschmann los. Ein Stich drang
in die Brust und verursachte eine schwere Verletzung; der Blutverlust war
bedeutend; glücklicherweise war rasch ärztliche Hilfe zur Hand. Der
Attentäter hätte vielleicht sein Opfer getötet, wenn nicht ein
kräftiger Mann schleunigst zur Hilfe geeilt wäre. Nach heftiger
Gegenwehr wurde der Wüterich durch die Gendarmen in das Ortsgefängnis
gebracht. Obgleich die Verwundung des Herrn Hirschmann sehr gefährlich
ist, hofft man denselben doch am Leben zu
erhalten." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. September
1890: "Man meldet aus Ober-Roden (Hessen): Ein Arbeiter,
namens Grimm, beschimpfte den Handelsmann J. Hirschmann
seiner Religion wegen, und als dieser sich die Rohheiten in ruhigem Tone
verbat, zog Grimm ein Messer und stach auf Hirschmann los. Ein Stich drang
in die Brust und verursachte eine schwere Verletzung; der Blutverlust war
bedeutend; glücklicherweise war rasch ärztliche Hilfe zur Hand. Der
Attentäter hätte vielleicht sein Opfer getötet, wenn nicht ein
kräftiger Mann schleunigst zur Hilfe geeilt wäre. Nach heftiger
Gegenwehr wurde der Wüterich durch die Gendarmen in das Ortsgefängnis
gebracht. Obgleich die Verwundung des Herrn Hirschmann sehr gefährlich
ist, hofft man denselben doch am Leben zu
erhalten." |
Zum Tod des Vorstehers der Gemeinde Leser Adler
(1908)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 10. Januar
1908: "Urberach bei Darmstadt. Herr Leser Adler, seit Jahrzehnten
verdienstvoller Vorsteher unserer Gemeinde und seit 40 Jahren ehrenamtlich
unser Vertreter, ist uns entrissen worden. Seine Ehrwürden Herr Rabbiner
Dr. Marx - Darmstadt gab am Grab ein anschauliches Bild des Verstorbenen
und betonte den unersetzlichen Verlust, den unsere Gemeinde mit seinem
Hinscheiden erlitten hat." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 10. Januar
1908: "Urberach bei Darmstadt. Herr Leser Adler, seit Jahrzehnten
verdienstvoller Vorsteher unserer Gemeinde und seit 40 Jahren ehrenamtlich
unser Vertreter, ist uns entrissen worden. Seine Ehrwürden Herr Rabbiner
Dr. Marx - Darmstadt gab am Grab ein anschauliches Bild des Verstorbenen
und betonte den unersetzlichen Verlust, den unsere Gemeinde mit seinem
Hinscheiden erlitten hat." |
Familienanzeigen
Neujahrsgrüße von Leser Adler &
Familie (1904)
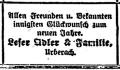 Anzeige
in "Der Israelit" vom 8. September 1904: Anzeige
in "Der Israelit" vom 8. September 1904:
"Allen Freunden und Bekannten innigsten Glückwunsch zum neuen Jahre.
Leser Adler & Familie, Urberach." |
Hochzeitsanzeige von Hermann Adler und Johanna geb.
Schuster (1922)
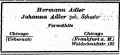 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. November 1922: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. November 1922:
"Hermann Adler - Johanna Adler geb. Schuster. Vermählte.
Chicago (Urberach) - Chicago (Frankfurt a.M.) Waldschmidtstr.
123". |
| Kennkarten
aus der NS-Zeit |
| |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |
| |
Kennkarten
zu Personen,
die in Urberach geboren sind |
 |
 |
 |
| |
KK (Frankfurt 1939) für
Emilie Adler (geb.
9. August 1914 in Urberach), wohnhaft in
Frankfurt, am 22. November 1941 deportiert
ab Frankfurt nach Kowno (Kauen), Fort IX,
umgekommen |
KK (Frankfurt 1939) für
Hermann Adler (geb.
11. Oktober 1870 in Urberach), Vertreter, wohnhaft
in Frankfurt, am 1. September 1942 deportiert
ab Frankfurt in das Ghetto Theresienstadt, wo er
am 17. November 1943 umgekommen ist |
KK (Frankfurt 1939) für
Julius Adler (geb.
3. Februar 1883 in Urberach), Kaufmann, wohnhaft
in Urberach, Dieburg und Frankfurt, am
22. November 1941 deportiert ab Frankfurt
nach Kowno (Kauen), Fort IX, umgekommen |
| |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
KK (Frankfurt 1939) für
Ludwig Adler
(geb. 9. September 1913 in Urberach),
kfm. Angestellter
|
KK (Offenbach 1940) für
Johanna Bacharach
geb. Adler (geb. 28. Januar 1889 in Urberach), wohnhaft in
Seligenstadt und Wiesbaden, am 27. September 1943 deportiert in das Ghetto
Theresienstadt, am 29. Januar 1943 in das Vernichtungslager Auschwitz,
ermordet |
KK (Frankfurt 1939)
für
Jonas Bendheimer
(geb. 21. Dezember 1870 in Urbach)
|
KK (Heidelberg 1939)
für
Ferdinand Frohmann
(geb. 10. Mai 1867 in Urberach),
Kaufmann
|
| |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
KK (Darmstadt-Stadt
1939) für Clara Katz geb.
Strauß (geb. 12. September 1903 in Urberach),
wohnhaft in Urberach und Darmstadt, am 26.
März 1942 deportiert ab Mainz - Darmstadt
in das Ghetto Piaski, umgekommen
|
KK (Wiesbaden 1939) für
Mina Marx geb. Adler (geb.
1. Mai 1874 in Urberach), wohnhaft in Wiesbaden,
am 1. September 1942 deportiert ab Frankfurt in
das Ghetto Theresienstadt, am 15. Mai 1944 in
das Vernichtungslager Auschwitz, ermordet
|
KK (Frankfurt 1939) für Hermann
Kulp (geb.
27. März 1870 in Urberach), Kaufmann, wohnhaft
in Frankfurt, am 15. September 1942 deportiert
ab Frankfurt in das Ghetto Theresienstadt, wo
er am 18. November 1942 umgekommen ist
|
KK (Darmstadt-Stadt
1939) für Aron Strauß
(geb. 7. Dezember 1873 in Urberach), Kaufmann,
wohnhaft in Urberach und Darmstadt, am
27. September 1942 deportiert ab Darmstadt in
das Ghetto Theresienstadt, wo er am
21. Oktober 1942 umgekommen ist |
| |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
KK (Mannheim 1939) für Herz
Max Strauß (geb. 25.
Mai 1870 in Urberach), Kaufmann, wohnhaft in
Mannheim, am 22. Oktober 1940 deportiert in
das Internierungslager Gurs, später Noé, wo er
am 28. November 1942 umgekommen ist
|
KK (Berlin 1939) für Ludwig
Strauß (geb.
23. Oktober 1905 in Urberach)
|
KK (Frankfurt 1940) für
Max Strauß
(geb. 2. September 1878 in Urberach),
Metzger
|
KK (Bad Nauheim 1939) für Moritz
Strauß (geb.
22. März 1888 in Urberach, Kaufmann), wohnhaft
in Bad Nauheim, am 27. September 1942
deportiert ab Darmstadt in das Ghetto
Theresienstadt, am 28. Januar 1943 in das
Vernichtungslager Auschwitz, ermordet |
Kennkarten
zu Personen,
die in Ober-Roden geboren sind |
 |
 |
|
| |
Kennkarte (Frankfurt 1939)
für
Maria Hirsch geb. Weber
(geb. 29. Juli 1892 in Ober-Roden)
|
Kennkarte (Altenkirchen 1939)
für Emma Tobias geb. Hirschmann
(geb. 6. Juli 1884 in Ober-Roden), Hausangestellt, wohnhaft in
Altenkirchen
und Frankfurt, am 15. September 1942 deportiert ab Frankfurt in das Ghetto
Theresienstadt, am 23. Januar 1943 in das Vernichtungslager
Auschwitz, ermordet |
|
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war eine ältere Synagoge vorhanden, in
der bis zur Einweihung einer neuen Synagoge am 18. August 1882
Gottesdienste gefeierte wurden. Bei dieser Einweihung der neuen Synagoge durch
Bezirksrabbiner Dr. Marx aus Darmstadt wurden die Torarollen aus der alten
Synagoge in einer festlichen Prozession durch den Ort zur neuen Synagoge
gebracht. Über die Feierlichkeiten liegt der folgende Bericht vor:
Einweihung der Synagoge (1882)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. September 1882: "Urberach.
Am 18. und 19. August, Erew Schabbat Kodesch, Paraschat Schofetim
(Schabbat mit der Toralesung Schofetim, d.h. 5. Mose 16,18-21,9) feierte
die hiesige israelitische Gemeinde die Einweihung ihrer neuen Synagoge.
Die ungeheure Menschenmenge, die von allen Seiten aus der Umgegend herbeigeströmt
war, das herrliche Wetter, das diese religiöse Weihe begünstigte und die
Kräfte, welche bei der Feier mitwirkten, das Alles trug dazu bei, dem
Ganzen einen glänzenden Verlauf zu geben. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. September 1882: "Urberach.
Am 18. und 19. August, Erew Schabbat Kodesch, Paraschat Schofetim
(Schabbat mit der Toralesung Schofetim, d.h. 5. Mose 16,18-21,9) feierte
die hiesige israelitische Gemeinde die Einweihung ihrer neuen Synagoge.
Die ungeheure Menschenmenge, die von allen Seiten aus der Umgegend herbeigeströmt
war, das herrliche Wetter, das diese religiöse Weihe begünstigte und die
Kräfte, welche bei der Feier mitwirkten, das Alles trug dazu bei, dem
Ganzen einen glänzenden Verlauf zu geben.
Nachdem Freitag Nachmittag in der seitherigen Synagoge der
Schlussgottesdienst durch das Minchagebet abgehalten worden war,
sprach Herr Rabbiner Dr. Marx aus Darmstadt einige Abschiedsworte in so
rührender Weise, dass sich die Anwesenden der Tränen nicht enthalten
konnten. Mit der Aufmunterung, mit demselben frommen Geiste wie seither
auch fernerhin das neue Gotteshaus zu betreten und in ebenso innige Weise
das Gebet zu Gott zu senden, schloss der Herr Rabbiner seine Rede, worauf
bei Herausnahme der heiligen Gesetzesrollen aus dem Aron HaKodesch
(Toraschrein) der Chorverein der israelitischen Religionsgesellschaft aus
Darmstadt das "Wajehi..." anstimmte. Gerührt verließ
man das Gotteshaus und nun begann der wohlgeordnete Zug von der alten
Synagoge durch die beflaggten Straßen unseres Dorfes nach dem neuen
Gotteshause unter Begleitung der Musik. Der Zug bot einen prächtigen und
zugleich ergreifenden Anblick, der dadurch, dass auch die christliche
Gemeinde an demselben sich beteiligte, ein allgemeiner Festzug wurde. Nach
den üblichen Umzügen in der neuen Synagoge hielt Herr Dr. Marx die
Festpredigt. Er suchte in einstündiger Rede unter Zugrundelegung des
Verses "Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit..." den
Zweck des jüdischen Gotteshauses dazulegen. Er wusste die Gefühle aller
Anwesenden zu erregen, die in lautloser Stille mit Begeisterung dem
Vortrage lauschten. Am Schabbat-Morgen ward uns nochmals das Vergnügen
zuteil, eine tiefernste Predigt über "Schofetim uSoterim..."
(Beginn des Toraabschnittes "Richter und Beamte...") von Herrn
Dr. Marx zu vernehmen, in welcher er die Aufgabe der jüdischen Gemeinde auseinander setzte.
Belehrt und ermahnt wurde die zahlreiche Zuhörerschaft, festzustehen und
in der Zeit religiösen Zerfalls mit besonderer Innigkeit dem Gottesgesetz
anzuhängen und zu wachen, dass nicht das Wort der falschen Propheten
Eingang finde.
Möge unser Gotteshaus stets solch eine andächtige Schar begeisterter
Gottesverehrer in sich fassen, wie es an diesen Tagen der Fall war. - Eine
gemütliche, gesellige Vereinigung hielt die Festgenossen am
Schabbatausgang bis zur früheren Stunde in heiterster, ungetrübtester
Stimmung beisammen." |
Bei der 1882 eingeweihten Synagoge
handelte es sich um einen Massivbau mit Satteldach. Der Zugang war unmittelbar
von der Straße am westlichen Giebel. Die Fenster waren als Rundbogenfenster
(West- und Nordseite) beziehungsweise als Rundbogenfenster (zwei am Ostgiebel)
gestaltet.
1927 erhielt die Gemeinde einen Zuschuss zur Renovierung der Synagoge.
Welche Renovierungsarbeiten durchgeführt wurden, ist nicht bekannt.
Unterstützung zur Renovierung der
Synagoge (1927)
 Mitteilung
in "Mitteilungen des Landesverbandes der israelitischen Religionsgemeinden
Hessens" 1927 Heft 5: "Es werden bewilligt: ... b) zur Renovierung der
Synagoge in Urberach RM. 100, ..." Mitteilung
in "Mitteilungen des Landesverbandes der israelitischen Religionsgemeinden
Hessens" 1927 Heft 5: "Es werden bewilligt: ... b) zur Renovierung der
Synagoge in Urberach RM. 100, ..." |
Der letzte Gottesdienst in der Synagoge fand vermutlich
1935 statt. Bei der Auflösung der jüdischen Gemeinde - vor den Ereignissen in der
Pogromnacht - wurde die Synagoge verkauft und später zu einem Wohnhaus
umgebaut. Beim Umbau wurden die Fensterbogen begradigt, die Öffnungen
verkleinert, eine Zwischendecke eingezogen und im Osten eine Terrasse im
Obergeschoss ausgebaut.
Eine Gedenktafel zur Erinnerung an die Synagoge wurde im Oktober 2017
installiert und eingeweiht.
Adresse/Standort der Synagoge: Bahnhofstraße 39
Fotos
(Quelle: Thea Altaras: Synagogen in Hessen S. 175; neuere
Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 3.8.2008)
 |
 |
 |
Die ehemalige Synagoge - als
Wohnhaus (1982) |
Die ehemalige
Synagoge im Sommer 2008 |
| |
| |
|
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| Oktober/November
2013: In Ober-Roden werden
"Stolpersteine" verlegt |
Artikel in der "Offenbach-Post"
vom 25. Oktober 2013 (Link
zum Artikel): "Mahnmale in der Frankfurter Straße. Sechs Stolpersteine für Ober-Röder Juden.
Ober-Roden - Ober-Roden wird am 21. November Teil des größten dezentralen Mahnmals der Welt. Der Kölner Künstler Gunter Demnig verlegt in der Frankfurter Straße sechs Stolpersteine, die an die jüdische Familie Kahn/Hecht erinnern.
Am 9. November jährt sich die Reichspogromnacht zum 75. Mal. In ganz Deutschland brannten damals auf Anordnung des NSDAP-Regimes Synagogen und Geschäfte jüdischer Bürger. In Ober-Roden schlug der Mob in der Nacht vom 10. auf den 11. November 1938 zu. Sein Opfer war das alteingesessene Schuhgeschäft der jüdischen Händlerin Frieda Kahn und ihrer Tochter Berta Hecht.
Christiane Murmann hatte die Stolperstein-Aktion in Sommer ins Rollen gebracht. Unterstützt vom Urberacher Theatermacher Oliver Nedelmann sammelte sie Geld für sechs Stolpersteine. Ihre Eltern waren mit Jaky Hecht, dem letzten Überlebenden der kleinen jüdischen Gemeinde Ober-Rodens, befreundet. Er konnte rechtzeitig vor dem Nazi-Terror nach Palästina flüchten und kehrte schon bald nach dem Krieg nach Ober-Roden zurück. Obwohl seine Familie unendliches Leid ertragen musste, kam er bis in die neunziger Jahre regelmäßig in den Ort, den er immer noch als seine Heimat bezeichnete.
Ihm ist einer der sechs Stolpersteine gewidmet. Die anderen erinnern an Frieda Kahn, die am 7. November 1940 in Ober-Roden starb, an Berta und Rosa Hecht, die 1941 nach Minsk deportiert und wahrscheinlich dort ermordet wurden, an Bertas Mann Salomon Hecht, dessen Schicksal unbekannt ist. Ludwig Kahn flüchtete 1935 nach Palästina und überlebte.
Christiane Murmann und Oliver Nedelmann haben bei ihren Stolperstein-Recherchen viele Fotos und Dokumente zusammengetragen, die bisher im Verborgenen schlummerten. Als wahres Schatzkästlein erwies sich ein Umschlag, den Elisabeth Wilhelm über die Jahrzehnte hinweg gehütet hatte. Ihre Vorfahren gehörten zu den Ober-Röder Familien, die den verfolgten Juden nach der Zerstörung des Geschäfts Essen und Kleidung zusteckten.
Elisabeth Wilhelm zahlt übrigens heute noch knappe zehn Euro Grundsteuer für eine 1.000 Quadratmeter große Wiese der Familie Kahn/Hecht, ergänzte Bürgermeister Roland Kern. Die hatte die NSDAP-Bürokratie bei der Enteignung der Ober-Röder Juden übersehen." |
| |
- Bericht über die Verlegung der
"Stolpersteine" in der Website der Stadt Rödermark vom 29.
November 2013: "Sechs
Stolpersteine fügen die Familie Hecht / Kahn symbolisch wieder
zueinander..." und in
der Website familien-blickpunkt.de
- Artikel von Christoph Manus in der "Frankfurter Rundschau" vom
22. November 2013: "Rödermark
- Stolpersteine - Gegen die Barbarei..."
- Artikel von chz in der "Offenbacher Post" vom 22.
November 2013: "Rödermark
- Nachdenkliche Aktion - Steine gegen das Vergessen..." |
| |
|
Fotos von der Verlegung der
"Stolpersteine" vor dem Haus Frankfurter Straße 17 in
Ober-Roden
(zur Veröffentlichung erhalten von der Pressestelle der Stadt
Rödermark) |
 |
 |
 |
 |
| Vorbereitung
der Verlegung |
Die
Stolpersteine zur Erinnerung
an die Familie Kahn/Hecht |
Musikalische
Umrahmung; links
Bürgermeister Roland Kern |
| |
| |
|
|
|
 |

 |
 |
 |
Musikalische
Umrahmung
durch Britta Sauer |
Verlegung
der Steine durch Gunter Demnig und
Verlesung der Biographien durch Oliver Nedelmann |
Gedenken
mit weißen Kerzen |
| |
|
|
|
 |
 |
 |
|
| Nach
der Verlegung der Stolpersteine wurde auf dem Grüngelände in der
Rilkestraße ein Mandelbaum gepflanzt |
|
| |
|
Oktober 2017:
Gedenktafel für die ehemalige
Synagoge installiert |
Artikel
von Christine Ziesecke in op-online.de vom 4. Oktober 2017: "Gedenktafel
im Bürgersteig an der Bahnhofstraße. Erinnerung an ehemalige Synagoge wird
nun greifbar
Urberach - Shalom – Salem Aleikum – Friede sei mit euch: Diesen Gruß
entboten jüdische, islamische und christliche Geistliche am Dienstag an der
Gedenkstätte für die jüdischen Mitbürger in der Bahnhofstraße. Der
Friedensgruß, der auch zum Gebet ruft, stand wohl über der gesamten
Gedenkveranstaltung in Erinnerung an die beiden früheren Synagogen in
Urberach. Gemeinsam mit Bürgermeister Roland Kern und den Organisatoren der
neuen Gedenkplatte gingen Rabbiner Andrew Steiman, Imam Kocz, Pfarrerin
Sonja Mattes, Pfarrer Klaus Gaebler sowie weitere religiöse Vertreter vom
Dalles zum ersten Standort der Urberacher Synagoge und dann zum zweiten. An
der Ecke Bahnhofstraße/Bachgasse erinnerte Horst-Peter Knapp an die
Geschichte der ersten als Betraum genutzten Urberacher Synagoge in der
Metzgerei Strauss an eben dieser Stelle, die wohl ab etwa 1770 genutzt
wurde. Vor 135 Jahren, im August 1882, wurde im Haus Bahnhofstraße 39 eine
neue Synagoge eingeweiht. Die kleine jüdische Gemeinde feierte ihr erstes
eigenes Gebäude mit einem Festzug und einem Gottesdienst. Der letzte
Gottesdienst in der 'neuen Synagoge Urberach' fand wahrscheinlich 1935
statt. Der Verkauf des Bethauses durch die verarmte jüdische Gemeinde über
Max Strauß an einen Privatmann erfolgte noch vor der sogenannten
Reichskristallnacht 1938, weshalb das Haus auch nahezu unversehrt blieb.
Zurzeit wird es von einem Privatmann umgebaut, der sich der Tradition dieses
Hauses bewusst ist und es auch für Interessierte öffnen will. Die
Gedenktafel zeigt den von Horst-Peter Knapp gestalteten Umriss der einstigen
Synagoge und die Inschrift 'Synagoge Urberach 1882 – 1935'. Die Gestaltung
orientiert sich an den bereits verlegten Stolpersteinen. Den 3. Oktober als
Termin für das Erinnern und die Enthüllung der Gedenktafel hatte Rabbiner
Andrew Steiman vorgeschlagen. Der Tag hat nicht nur für die deutsche
Bevölkerung einen hohen Stellenwert, sondern auch für die jüdischen
Mitbürger, liegt er doch genau zwischen Versöhnungstag und Laubhüttenfest.
Mit dem Widderhorn, einem Symbol fürs Herbeirufen der Gläubigen wie auch
einem Gebetsruf, erinnerte der Rabbi an die Ursprünge jüdischen Glaubens und
erläuterte einige Begriffe, die Christen eher fremd sind. Umrahmt von
Klezmermusik, gespielt von Britta Sauer, und vorbereitet unter anderem von
der 'Initiative Stolpersteine in Urberach und Ober-Roden', allen voran
Oliver Nedelmann, machte der Zug einen Weg durch rund 250 Jahre jüdischer
Geschichte in Urberach. Mehr über die Geschichte der Synagoge findet sich in
einem Heft, das der Aktionskreis der Stadt und der Initiative Stolpersteine
herausgegeben hat. Es ist unter anderem in den Rathäusern und bei Theater &
Nedelmann erhältlich."
Link zum Artikel |
| |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. II, S. 316-317. |
 | Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 S. 175. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 284. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 60-61. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Urberach
Hesse. Numbering 44 (3 % of the total) in 1880, the small community disbanded
before Kristallnacht (9-10 November 1938). No Jews remained in
1939.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|