|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht
"Synagogen im Kreis Groß-Gerau"
 Nauheim (Kreis Groß-Gerau)
Nauheim (Kreis Groß-Gerau)
mit
Königstädten (Stadt Rüsselsheim am Main, Kreis Groß-Gerau)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Nauheim bestand eine kleine jüdische
Gemeinde bis 1938. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts
zurück. Erstmals werden 1730 jüdische Familien am Ort genannt, 1770 und
1815 jeweils drei Familien.
1828
wurden 16 jüdische Einwohner gezählt. Die damaligen Familiennamen waren
Marxsohn, Goldschmidt und Oppenheimer. Die höchste Zahl jüdischer Einwohner
wurde 1861 mit 34 Personen (4,3 % von insgesamt 789 Einwohnern) erreicht.
Danach ging die Zahl der jüdischen Einwohner zurück: 1880 26 (2,4 % von
1.087), 1900 20 (1,4 % von 1.446), 1910 20 (1,1 % von 1.729). Die jüdischen Familien lebten vom Handel
mit Vieh, Getreide und Textilien. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
gehörten ihnen einige Handlungen und Gewerbebetriebe am Ort.
An Einrichtungen waren ein Betsaal (s.u.) und eine Religionsschule
vorhanden. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts zeitweise ein Religionslehrer vorhanden, der
zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. 1871 waren drei jüdische Kinder
zu unterrichten. Die Stelle wurde immer wieder neu ausgeschrieben (siehe
Ausschreibungstexte unten). Die
Toten der Gemeinde wurden auf dem jüdischen Friedhof
in Groß-Gerau beigesetzt. Die Gemeinde
gehörte zum orthodoxen Rabbinat Darmstadt II.
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Jakob Meyer
(geb. 6.2.1880 in Reichenbach, gef. 20.6.1918).
Um 1925, als noch 22
Personen zur jüdischen Gemeinde gehörten (1,1 % der Gesamteinwohnerschaft von
ca. 2.000 Personen), waren die Vorsteher der jüdischen Gemeinde Abraham
Strauß und Moses Mayer (Neustädten) sowie Siegfried Marx. Den
Religionsunterricht für die noch vier schulpflichtigen jüdischen Kinder hielt
Lehrer Jakob Strauß aus Griesheim.
Zur jüdischen Gemeinde Nauheim gehörten spätestens in den 1920er-Jahren auch
die im benachbarten Königstädten lebenden jüdischen Einwohner (1830:
40 Personen, 1905: 12, 1925: 7). In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
gehörten die in Königsstädten lebenden Juden noch zur Gemeinde in Rüsselsheim.
Um 1845 wurde ein Bauplatz für den Bau einer Synagoge in Königstädten
erworben. 1856 wurde eine eigene jüdische Gemeinde in Königstädten
gegründet. 1862/63 konnte eine Synagoge am Ort erstellt werden, die
jedoch auf Grund der Ab- und Auswanderung der Juden aus Königstädten nur
wenige Jahrzehnte verwendet wurde. Anfang der 1930er-Jahre lebte nur noch eine
jüdische Familie in Königstädten.
1933 lebten noch 19
jüdische Einwohner in Nauheim: dies waren Mitglieder der Familien Neumann (Hintergasse 2), Ludwig Strauß (letzter Vorsitzender der jüdischen Gemeinde;
Hintergasse 13), Siegfried Marx (Waldstraße 10)
und Bernhard Marx (Vorderstraße 30). Ein Teil von ihnen konnte in den folgenden
Jahren auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien wegziehen beziehungsweise auswandern (vier in die USA, zwei nach
Spanien), drei verstarben vor den Deportationen in Nauheim, der Textilkaufmann
Siegfried Marx starb 1933 an Suizid. Im Zusammenhang mit dem Novemberpogrom 1938
kam es zu Misshandlungen der noch am Ort lebenden jüdischen Personen. Walter
Strauß, Sohn des letzten Gemeindevorstehers Ludwig Strauß berichtete darüber
1947: "Am 10. November 1938 drangen Schulkinder in unser Haus ein, holten
meine Mutter heraus und haben sie auf der Straße misshandelt und auf ihr
herumgetreten". Sieben Personen wurden 1941 oder 1942 nach Mainz
"abgeschoben" und sind von dort aus in Vernichtungslager deportiert
worden.
Von den in Nauheim geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Bernhard Marx (1882,
vgl. Kennkarte unten),
Bertha Marx geb. Berney (1889), Erika Marx (1921, vgl. Kennkarte unten), Friedrich Marx (1882), Margot Marx
(1923, vgl. Kennkarte unten), Mathilde
(Mathilda, Miriam) Marx geb. Haas (1875), Siegfried Marx
(1884), Sophie Marx geb. Stern (1882), Fanny May geb. Haas (1864), Hugo Neumann
(1883), Johanna Neumann geb. Marx (1885), Schenni (Jenny) Strauß (1880).
Aus Königstädten sind umgekommen: Jenny Löwenstein geb. Marxsohn
(1876), Amalie Marx geb. Marxsohn (1881), Hedwig Oppenheimer (1870), Marx
Oppenheimer (1861), Louis (Ludwig) Rosenthal (1867).
Im November 2008 wurde an der Hofmauer des Historischen Rathauses in der
Hintergasse eine bronzene Gedenktafel mit den Namen der jüdischen Nauheimer
enthüllt, die während der NS-Zeit deportiert und ermordet wurden. Der Text der
Tafel: "Zum Gedenken an jüdische Nauheimer Bürger, die im Holocaust
der Nationalsozialisten in den Jahren von 1933 bis 1945 ums Leben kamen:
Bernhard Marx, Bertha Marx, Erika Marx, Margot Marx, Friedrich Marx, Mathilde
Marx, Siegfried Marx, Sophie Marx, Fanny May, Hugo Neumann, Johanna Neumann,
Schenni Strauss. Den Lebenden zur Mahnung. Gemeinde Neuheim 2008". Auch
an den Gebäuden Hintergasse 2 und Hintergasse 25 wurden Gedenktafeln
angebracht.
Im November 2014 wurden vor dem Haus Hintergasse 2 "Stolpersteine"
verlegt für die Mitglieder der Familie Neumann: Hugo Neumann, Johanna Neumann,
Else Mayer und Kurt Siegfried Neumann. Vor dem Haus Vorderstraße 30 wurden
"Stolpersteine" verlegt für Bernhard Marx (1882), Bertha Marx geb. Berney
(1921), Erika Marx (1921), Margot Marx (1923). Ein Jahre später erfolgte am 9.
November 2015 eine zweite Verlegung von "Stolpersteinen" in Nauheim vor
dem Gebäude Waldstraße 10 für Siegfried Marx (1884), Sophie Marx geb. Stern
(1882), Herbert-Leopold Marx (1911), Ella-Rosi Marx (1912), Otto Marx (1923);
vor dem Haus Heinrich-Kaul-Platz 12 für Schenni Strauss (1900). Am 11.
November 2017 wurden "Stolpersteine" verlegt vor dem Haus Hintergasse 13 für
Ludwig Strauss (1879), Auguste Strauss geb. Marx (1885), Erna-Betty Strauss
(1910), Walter Strauss (1911). Siehe (mit Fotos) der Stolpersteine und der
Häuser:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Nauheim
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorsängers / Schochet 1864 /
1871 / 1872 / 1878
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. April 1864:
"Lehrer gesucht! In der israelitischen Gemeinde zu Nauheim,
Kreis Groß-Gerau, Großherzogtum Hessen, ist die Stelle eines Lehrers und
Vorsängers vakant. Nebst freier Kost und Wohnung beträgt der Gehalt 77
Gulden; Nebenakzidenzien circa 25 Gulden; sollte der Betreffende auch
Schochet sein, so erhöhen sich diese um noch einmal 25 Gulden. Meldungen
sind zu richten an den Vorstand."
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. April 1864:
"Lehrer gesucht! In der israelitischen Gemeinde zu Nauheim,
Kreis Groß-Gerau, Großherzogtum Hessen, ist die Stelle eines Lehrers und
Vorsängers vakant. Nebst freier Kost und Wohnung beträgt der Gehalt 77
Gulden; Nebenakzidenzien circa 25 Gulden; sollte der Betreffende auch
Schochet sein, so erhöhen sich diese um noch einmal 25 Gulden. Meldungen
sind zu richten an den Vorstand." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. April 1871:
"In der Israelitischen Gemeinde zu Nauheim, Kreis Groß-Gerau, ist
die Stelle eines Religionslehrers und Vorsängers vakant; es sind nur drei
Kinder zu unterrichten. Kost und Logis frei. Fixer Gehalt 100 Gulden.
Meldungen an den Vorstand Levy Haas." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. April 1871:
"In der Israelitischen Gemeinde zu Nauheim, Kreis Groß-Gerau, ist
die Stelle eines Religionslehrers und Vorsängers vakant; es sind nur drei
Kinder zu unterrichten. Kost und Logis frei. Fixer Gehalt 100 Gulden.
Meldungen an den Vorstand Levy Haas." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. April 1872:
"In der israelitischen Gemeinde Nauheim, Kreis Groß-Gerau,
Großherzogtum Hessen, ist die Stelle eines Religionslehrers, der
womöglich auch als Vorsänger fungieren kann, vakant; es sind nur vier
Kinder zu unterrichten. Gehalt, bei völlig freier Station, 125 Gulden.
Nebeneinkünfte. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. April 1872:
"In der israelitischen Gemeinde Nauheim, Kreis Groß-Gerau,
Großherzogtum Hessen, ist die Stelle eines Religionslehrers, der
womöglich auch als Vorsänger fungieren kann, vakant; es sind nur vier
Kinder zu unterrichten. Gehalt, bei völlig freier Station, 125 Gulden.
Nebeneinkünfte.
Bewerber wollen sich an den unterzeichneten Vorsteher wenden. Levi Haas." |
| |
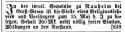 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. März 1878:
"In der israelitischen Gemeinde zu Nauheim bei Groß-Gerau ist die
Stelle eines Religionslehrers und Vorsängers zum 15. Mai dien Jahres zu
besetzen. Gehalt 250 Mark nebst völlig freier Station. Meldungen an den
Vorstand."
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. März 1878:
"In der israelitischen Gemeinde zu Nauheim bei Groß-Gerau ist die
Stelle eines Religionslehrers und Vorsängers zum 15. Mai dien Jahres zu
besetzen. Gehalt 250 Mark nebst völlig freier Station. Meldungen an den
Vorstand." |
Aus dem jüdischen
Gemeindeleben
Spendenaufruf für eine in schwere Not geratene jüdische
Familie
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Oktober 1884:
"Dingende Bitte! Der Unterzeichnete fühlt sich veranlasst, für
einen sehr hart betroffenen Mann die Hilfe seiner edlen Glaubensgenossen
in Anspruch zu nehmen. Herr Leopold Marx ist durch einen sehr harten Schlag
heimgesucht worden; durch 2malige Operation des Beines ist derselbe nicht
mehr imstande, seine Frau nebst zwei kleinen Kindern zu ernähren. Hilfe
tut Not! Und wenn auch unsere Glaubensgenossen von vielen Seiten in
Anspruch genommen werden, so verdient doch der Obengenannte die
Unterstützung von Seiten unserer Glaubensbrüder. Milde Spenden
entgegenzunehmen, ist der Unterzeichnete gern bereit. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Oktober 1884:
"Dingende Bitte! Der Unterzeichnete fühlt sich veranlasst, für
einen sehr hart betroffenen Mann die Hilfe seiner edlen Glaubensgenossen
in Anspruch zu nehmen. Herr Leopold Marx ist durch einen sehr harten Schlag
heimgesucht worden; durch 2malige Operation des Beines ist derselbe nicht
mehr imstande, seine Frau nebst zwei kleinen Kindern zu ernähren. Hilfe
tut Not! Und wenn auch unsere Glaubensgenossen von vielen Seiten in
Anspruch genommen werden, so verdient doch der Obengenannte die
Unterstützung von Seiten unserer Glaubensbrüder. Milde Spenden
entgegenzunehmen, ist der Unterzeichnete gern bereit.
Nauheim bei Groß-Gerau, den 9. Oktober 1884.
Der israelitische Gemeindevorstand Levi Haas. Auch wir sind bereit, Gaben
entgegenzunehmen und weiterzubefördern.
Die Expedition des 'Israelit'." |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der Gemeinde
Zum Tod von Lewi Haas (1908)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Juni 1908:
"Nauheim bei Groß-Gerau, 15. Juni (1908). Einen der Edelsten aus
unserer Mitte haben wir gestern, 14. Juni, zur ewigen Ruhe getragen. Herr
Lewi Haas - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - besaß
alle Tugenden eines treuen Jehudi, die Herr Rabbiner Dr. Marx aus
Darmstadt in seiner Trauerrede auch schilderte, indem er an Hand
derselben ein Lebensbild des Verstorbenen entwarf. Der Dahingeschiedene
erreichte ein Alter von 79 Jahren; sein Tod wird von allen gleich betrauert.
Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Juni 1908:
"Nauheim bei Groß-Gerau, 15. Juni (1908). Einen der Edelsten aus
unserer Mitte haben wir gestern, 14. Juni, zur ewigen Ruhe getragen. Herr
Lewi Haas - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - besaß
alle Tugenden eines treuen Jehudi, die Herr Rabbiner Dr. Marx aus
Darmstadt in seiner Trauerrede auch schilderte, indem er an Hand
derselben ein Lebensbild des Verstorbenen entwarf. Der Dahingeschiedene
erreichte ein Alter von 79 Jahren; sein Tod wird von allen gleich betrauert.
Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
| Kennkarten
aus der NS-Zeit |
| |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |
| |
Kennkarten
zu Personen,
die in Nauheim geboren sind |
 |
 |
|
| |
KK (Groß-Gerau 1939)
für Bernhard Marx (geb. 8. Mai 1882
in Nauheim), Händler, wohnhaft in Nauheim, am 25. März 1942
deportiert ab Mainz - Darmstadt in das Ghetto Piaski,
umgekommen |
KK (Groß-Gerau 1939)
für Erika Marx (geb. 12. Juni 1921 in Nauheim),
kaufmännisches Lehrmädchen, wohnhaft in Nauheim, am 25. März
1942
deportiert ab Mainz - Darmstadt in das Ghetto Piaski,
umgekommen |
|
| |
|
|
|
| |
 |
 |
|
| |
KK (Groß-Gerau 1939) für Margot
Marx (geb. 18. August 1923 in
Nauheim), wohnhaft in Nauheim, am 25. März 1942 deportiert ab
Mainz - Darmstadt in das Ghetto Piaski, umgekommen |
KK (Dieburg 1939) für Sara
Oppenheimer geb. Haas
(geb. 26. Dezember 1874 in Nauheim)
|
|
| |
|
|
|
| Weitere
Kennkarte |
 |
|
|
| |
KK (Groß-Gerau 1939) für
Berta Marx geb. Berney (geb. 2. Juli 1889
in Obergimpern, wohnhaft in
Nauheim, am 25. März 1942 deportiert
ab Mainz - Darmstadt in das Ghetto Piaski, umgekommen |
|
|
Zur
Geschichte der Synagoge / der Beträume
Bis zur 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts besuchten die Nauheimer Juden die
Synagoge in Groß-Gerau, da sie selbst nicht über die notwendige Zehnzahl
jüdischer Männer zum Gottesdienst verfügten. Als die Zahl der jüdischen
Gemeindeglieder zugenommen hatte, kam man in der Wohnstube des Hauses der
Familie Elias Marx (Hintergasse 2, Gebäude von 1776) zu Gebet und
Gottesdienst zusammen. Im Oktober 1906 meldete die Witwe des 1898 verstorbenen
Elias Marx allerdings Eigenbedarf an. Daraufhin wurde der Betsaal 1907 in das
Gebäude Hintergasse 25 (erbaut 1782, Flurstück 291) verlegt. Dieses
gehörte dem Vieh- und Getreidehändler Levi Haas. Im ersten Stock seines Hauses
konnte die Synagoge eingerichtet werden. Den Umbau in Höhe von 225 Mark
bezahlte die jüdische Gemeinde aus dem vorhandenen Barvermögen, was im
November 1906 vom Kreisamt Groß Gerau genehmigt worden war. Wie lange der
Betsaal in der Hintergasse 25 auf Grund der zurückgehenden Zahlen der
jüdischen Einwohner genützt wurde, ist nicht bekannt.
Nach 1933 wurden
die Kultgegenstände zur Aufbewahrung in die Synagoge in Groß-Gerau
gebracht, wo sie vermutlich beim Brand dieser Synagoge am 10. November 1938
vernichtet wurden.
Beide Häuser mit den ehemaligen Beträumen sind erhalten und werden als
Wohnhaus genutzt. An beiden Gebäuden wurden im November 2008
Gedenk-/Hinweistafeln angebracht.
Zusätzlicher Hinweis zu den Spuren der
jüdischen Geschichte: Bei der Sanierung des Wohnhauses Vorderstraße 30 (Haus
von 1740; hier wohnte Familie Bernhard Marx) fanden sich Anfang der 1990er-Jahre
in der heutigen Waschküche hinter dem Haus Reste einer einstigen
Laubhütte.
Adresse/Standort der Synagogen: Bis 1907 Hintergasse 2, ab 1907
Hintergasse 25.
Zur Synagoge in Königstädten: Die Synagoge
in Königstädten befand sich in der dortigen "Kleinen Gasse". Von ihr
sind keinerlei Spuren erhalten, zumal die Gebäude der "Kleinen Gasse"
bei einem Bombenangriff am 12. August 1944 völlig zerstört worden ist. Sie
wurde zuletzt als Scheune genutzt, nachdem das Gebäude vermutlich bereits
Anfang des 19. Jahrhunderts auf Grund der in Königstädten stark
zurückgegangenen Zahl der jüdischen Einwohner verkauft worden
war.
Fotos
(Quelle: Heimat- und Museumsverein Nauheim, Fotos: Hans
Joachim Brugger, Nauheimer
Denkmaltopografie bzw. Seite
Jüdische Mitbürger in Nauheim)
 |
 |
 |
Gebäude Hintergasse 2: Betsaal bis 1907
Haus der Familie Neumann (siehe Presseartikel unten) |
Gebäude Hintergasse 25:
Betsaal im ersten Stock seit 1907 |
Gedenktafel
an der Hofmauer des
Historischen Rathauses in der Hintergasse |
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| November 2014 /
Januar 2015: In Nauheim wurden
"Stolpersteine" verlegt |
Artikel von Detlef Volk in der
"Main-Spitze" vom 15. Januar 2015: "Stolpersteine: Jüdische Ladenbesitzer müssen im Dritten Reich Nauheim verlassen
NAUHEIM - Seit November vergangenen Jahres erinnern insgesamt acht 'Stolpersteine' an ehemalige jüdische Bewohner der Gemeinde. Sie wurden von den Nationalsozialisten deportiert und ermordet. Die Steine vor dem Haus
Hintergasse 2 erinnern an Hugo und Johanna Neumann, an Else Mayer und Kurt-Siegfried
Neumann.
Das Fachwerkhaus wurde 1776 erbaut und gegen 1900 um einen Anbau erweitert. Es diente vorübergehend auch der jüdischen Gemeinde als Bethaus. Hier wohnten
Hugo und Johanna Neumann mit ihren Kindern Else Mayer und Kurt-Siegfried
Neumann. Hugo Neumann betrieb ab 1907 ein anfangs sehr gut laufendes Manufakturwarengeschäft mit einem großen Warenlager. Im Laden arbeiteten neben seiner Frau Johanna auch deren Tochter aus erster Ehe, Else, und der Sohn Kurt-Siegfried.
Der Sohn wollte Rabbiner werden, was die Nazis aber verboten. Das ist in einer Dokumentation der Gemeinde über die jüdischen Mitbürger nachzulesen. Über England wanderte er schließlich nach Amerika aus und kam zum Kriegsende mit der amerikanischen Armee als Sergeant und Dolmetscher nach Deutschland zurück. Er erzählte später, dass sein Vater nicht nur das Ladengeschäft in Nauheim betrieb, sondern auch als Hausierer in Mainz unterwegs war. Denn die Nauheimer Bauern benötigten nicht viel, vielleicht ein Hemd oder eine Hose im Jahr, erzählte er. Davon konnte die Familie Neumann nicht leben. Also packte Hugo Neumann seine schweren Koffer und versuchte, in Mainz-Kostheim Waren an die Industriearbeiter zu verkaufen.
Unterstützung vom Nachbarn. Als die Nazis an die Macht kamen, sagten sie, die Juden würden die Maul- und Klauenseuche übertragen, erzählte Kurt-Siegfried Neumann. Zuerst schrieben sie die Namen der Kunden auf und etwas später wurde den Menschen ganz verboten, bei Juden zu kaufen. In der Kristallnacht 1938 wurden auch seine Eltern aus dem Haus geholt und durch die Hitlerjugend (HJ) misshandelt. Der Nachbar Philipp Dammel aus der Hintergasse 5 gebot Einhalt und schlug mit der Peitsche auf die Übeltäter ein, ohne sich über die Konsequenzen klar zu sein, die hätten folgen können, heißt es weiter. Die Geschäfte gingen ab 1933 immer schlechter, schildert auch Else Mayer. Am Haus musste ein Schild
'Jüdisches Geschäft' angebracht werden. Obwohl die Neumanns beliebt waren, fürchtete sich die Kundschaft zunehmend, bei ihnen zu kaufen. Zumal das Geschäft direkt neben der Bürgermeisterei lag und genau beobachtet wurde, wer ein- und ausging. Die Umsätze gingen rapide zurück und das Geschäft kam 1935 ganz zum Erliegen. Else Mayer zog 1935 nach Darmstadt und konnte noch nach Amerika auswandern.
Hugo Neumann und seine Frau Johanna hatten ein schlechteres Los zu tragen. Am 12. Juli 1939 wurde ihr Haus in der Hintergasse 2 verkauft, und auf Veranlassung der Gestapo und Anraten des Nauheimer Bürgermeisters, der seinen Ort
'judenrein' haben wollte, musste das Ehepaar Neumann nach Darmstadt umziehen. Dort wurden sie von Dammel mit Lebensmitteln versorgt. Am 18. März 1942 wurden sie nach Polen deportiert und dort ermordet."
Link
zum Artikel vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Nauheim |
| |
| Artikel von Detlef Volk zur Geschichte
der Familie Marx
(früher: Vorderstraße 30) in
der "Main-Spitze" vom 29. Januar 2015: |
|
Stolpersteine in Nauheim: das Schicksal der Familie Marx (Main-Spitze, 29.01.2015) |
| |
|
November 2015:
Zweite Verlegung von
"Stolpersteinen" in Nauheim |
Artikel von Rainer Beutel in der
"Frankfurter Neuen Presse" vom 11. November 2015: "Stolpersteine. Nicht
vergessen, nicht verdrängen
Weitere Stolpersteine erinnern an die ehemaligen jüdischen Mitbürger in
Nauheim. Sie waren von den Nationalsozialisten verschleppt und ermordet
worden.
Rund 80 Bürger haben am Montagmittag an der zweiten Verlegung von
Stolpersteinen in Nauheim teilgenommen, mit der die Gemeinde an das
Schicksal jüdischer Bürger erinnert, die unter den Nazis drangsaliert und
ermordet wurden. Die Gedenkfeier wurde bewusst auf den 9. November gelegt,
einen 'Schicksalstag der Deutschen', wie es Hans Joachim Brugger als
Organisator und Vorstandsmitglied des Heimat- und Museumsverein ausdrückte.
Denn es war der 77. Jahrestag der Reichspogromnacht. Bereits vor einem Jahr
waren Stolpersteine in alten Ortsteil verlegt worden. Diesmal ging es um
Siegfried und Sophie Marx, Herbert Leopold Marx und Ella-Rosi und Otto Marx,
die in der Waldstraße 10 lebten, sowie Schenni Strauss vom
Heinrich-Kaul-Platz 12. Die 19 Jahre alte Daniela Fresu, Olivia Gabriel (16)
und Tim Niesik (18), allesamt Messdiener in der katholischen
Kirchengemeinde, trugen die Lebensläufe der Menschen vor und schilderten,
was den Bürgern jüdischen Glaubens Schreckliches widerfahren war. Die
Zuhörer, darunter Landrat Thomas Will (SPD), Landtagsabgeordnete aus dem
Kreisgebiet, die evangelische Pfarrerin Sabine Bischof und ihr katholischer
Kollege Christof Mulach, Mitglieder des Gemeindevorstands und nur wenig
Gemeindevertreter, wirkten ergriffen, als sie hörten, wie die früheren
Einwohner Nauheims ums Leben gekommen waren. Die Angaben beruhen auf den
Recherchen von Ortschronist Karl-Heinz Pilz. Der Höhepunkt der Gedenkstunde
war der Moment, als gelbe Rosen an den Stolpersteinen nieder gelegt wurden.
Das war den Paten vorbehalten, welche die Kosten für die Stolpersteine
übernommen hatten. Die Steine waren von Bauhofmitarbeitern unmittelbar vor
der Gedenkstunde verlegt worden, weil der 'Erfinder' der Stolpersteine,
Günther Demnig, nicht anwesend sein konnte. Zu den Paten gehörten Peter
Pfundstein, Stefanie Bischof, die evangelische Kirchengemeinde, Vera und
Wolfgang Lindner, Margret Brugger, der Landfrauenverein und Ursula Ackley.
Kurz zuvor stimmte Dieter Schindel mit einem Trompetensolo auf den
besonderen Moment ein. Das Szenario in der Waldstraße 10, dem Wohnhaus der
Familie Marx, wiederholte sich am Heinrich-Kaul-Platz 12, wo Schenni Strauss
lebte. Bürgermeister Jan Fischer (CDU) machte auf den Bezug zwischen der
Ermordung von Juden durch die Nazis und dem Schicksal von tausenden
Flüchtlinge in der Gegenwart aufmerksam. 'Die Religionsfreiheit ist einer
der Grundwerte in unserem Land', betonte Bürgermeister Jan Fischer . Er
forderte die Bürger dazu auf, Stolpersteine 'auch im Kopf und Herz zu
tragen', um Lehren für die Gegenwart zu ziehen. Landrat Will kam auf das
Unfassbare zu sprechen, das damals geschah und die Menschen heute bewegen
sollte, sich gegen das Vergessen und Verdrängen der Geschichte zu wehren. Er
betonte mit Blick auf die sechs Bürger, deren die Versammelten gedachten,
dass 'jeder einzelne wichtig ist, sich zu erinnern'. Im gleichen Atemzug
rief er dazu auf, 'Menschenrechtsverletzungen nicht zu dulden' und jenen zu
helfen, die unter Terror und Verfolgung leiden. Vor einem jüdischen Gebet,
das von der Museumsvereinsvorsitzenden Ute Ansahl-Reissig gesprochen wurde,
appellierte Pfarrer i.R. Walter Ullrich an seine Zuhörer, immer wieder Neues
aufzudecken, was damals geschehen sei. Mit der Recherche ergäben sich neue
Erkenntnisse und Chancen, miteinander zu kommunizieren. Dadurch entstünden
'Verbindungen, die bleiben', auch zu jenen, welche die Schrecken von damals
erlebten. Ulrich rief dazu auf, den Versuchungen zu widerstehen, die seiner
Meinung nach noch stärker würden. In diesem Kontext nannte er explizit die
Pegida-Bewegung."
Link zum Artikel vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Nauheim
|
| |
| Oktober 2017:
Erinnerung an die Synagoge in Königstädten in
der dortigen "Kleinen Gasse" |
Artikel in der "Main-Spitze" vom
17. Oktober 2017: "Die 'Kleine Gasse' macht ihrem Namen alle Ehre
RÜSSELSHEIM - Die 'Kleine Gasse' in Königstädten macht ihrem Namen alle Ehre. Zwei Autos nebeneinander passen kaum hindurch. Mindestens in Königstädten, vielleicht sogar in ganz Rüsselsheim ist die Verbindung zwischen Hinter- und Obergasse die schmalste noch mit dem Auto befahrbare Gasse. Doch die Mini-Straße ist nicht nur wegen ihrer Maße bemerkenswert. Auch ihr geschichtlicher Hintergrund ist beeindruckend. So wurde sie im Zweiten Weltkrieg während der Bombennacht von Königstädten komplett zerstört, wie Königstädten-Experte Wolfgang Einsiedel weiß.
Damals hätten nicht viele Menschen in der Gasse gewohnt, erzählt Einsiedel. In der Straße sei nur die Postadresse von ein paar Bauern und einer Synagoge gewesen. Heute wohnt sogar überhaupt niemand mehr in der Gasse. Lediglich die Rückwände von Wohnhäusern, Scheunen und Gärten säumen den Straßenrand. Verwunderlich ist dies nicht. Die kerzengerade Gasse ist nur etwa 130 Meter lang und besitzt nicht mal einen Bürgersteig. Bei so wenig Platz ist ein Hausausgang zu einer der anderen, breiteren Straße hin natürlich viel praktischer.
Auch die Lage der Straße sei besonders, erklärt der Ortshistoriker. So sei sie nicht nur eine der ältesten, sondern auch die zentralste Straße Königstädtens. Die Gasse liege genau in der Mitte des alten Ortskerns. Früher sei sie mit Kopfstein gepflastert gewesen, nach der Zerstörung der Gasse sei es jedoch einfacher gewesen, sie zu asphaltieren. Königstädten wurde in der Nacht des 12. August 1944 von 297 englischen Kriegsflugzeugen bombardiert. Eigentlich wollten die Bomber das Opelwerk treffen, erzählt Einsiedel, der ein Buch über die Königstädter Bombennacht geschrieben hat. Im Dunkel der Nacht hätten sie das Ziel jedoch verfehlt. Stattdessen wurde Königstädten getroffen.
Einsiedel sprach mit 50 Augenzeugen der Bombennacht. Unter ihnen waren auch damalige Anwohner der
'Kleinen Gasse'. Sie erzählten, dass alles lichterloh gebrannt habe. Gerade die Scheunen mit dem vielen Stroh hätten zu dem vernichtenden Großbrand beigetragen. Brennende Tiere und Menschen hätten versucht, vor den Flammen zu flüchten. Die Hitze sei so enorm gewesen, dass sich die große Kastanie, die damals noch in der Gasse stand, ohne selbst getroffen worden zu sein in einen Feuerball verwandelt habe. Selbst am nächsten Tag habe man noch nicht über das Pflaster der Straße laufen können, da es noch geglüht habe.
Bei den Gesprächen mit den Augenzeugen habe er von vielen traurigen Einzelschicksalen erfahren, sagt Einsiedel:
'Das hat mich wirklich sehr mitgenommen. Man erfährt von sehr schlimmen Schicksalen. Das traumatisiert einen fast schon
selbst.' Da ihre Häuser zerstört waren, seien die überlebenden Bauern, die zuvor noch in der
'Kleinen Gasse' gelebt hatten, an den Stadtrand gezogen. Dort hatten sie mehr Platz für ihr Gehöft. Die Häuser und Grundstücke in der
'Kleinen Gasse' hingegen seien vergleichsweise klein gewesen.
Auch die Synagoge, die sich damals in der 'Kleinen Gasse' befand, wurde in der Bombennacht zerstört. Da sie schon vor dem Beginn der Judenverfolgung an einen Bauern verkauft worden war und lediglich als Scheune diente, war sie nicht der Reichspogromnacht zum Opfer gefallen. Die Synagoge war zu Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet worden, da es in Königstädten eine relativ große jüdische Gemeinde gegeben hatte. Die jüdischen Kinder wurden dann in der Synagoge unterrichtet. Da die Gemeinde mit der Zeit jedoch immer kleiner wurde, hatte sich die Unterhaltung der Synagoge nicht mehr gelohnt." |
| |
| November 2017:
Dritte Verlegung
von "Stolpersteinen" in Nauheim |
Artikel von Silke Drescher in der
"Main-Spitze" vom November 2017: "Nauheim. In Nauheim werden Stolpersteine für die Familie Strauss verlegt
NAUHEIM - Zum dritten und damit voraussichtlich letzten Mal wurden am Samstag in Nauheim Stolpersteine verlegt. Bei strömendem Regen kamen interessierte Bürger, Vertreter der Gemeinde, der Kirche und des Heimat- und Museumsvereins in der
Hintergasse 13 zusammen, um der Zeremonie zur Verlegung der Steine zu folgen. Die Steine erinnern an die jüdische
Familie Ludwig und Auguste Strauss mit ihren Kindern Walter und
Erna-Betty. Gunter Demnig, Initiator der Stolpersteinverlegungen in ganz Deutschland, hatte die Steine vor der Zeremonie persönlich eingelassen.
In Erinnerung an Familie Strauss wurden die Lebensgeschichten jedes Familienmitglieds von Mitgliedern des Kinder- und Jugendparlaments vorgetragen.
Ludwig Strauss, geboren 1879, zog nach seiner Ausbildung 1920 nach Nauheim und eröffnete in der Rathausstraße 12 ein Viehhandels- und Landesproduktgeschäft. Er war der letzte Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Nauheim. Durch die nationalsozialistischen Boykottmaßnahmen ging sein Geschäft ab 1933 aber immer mehr zurück. Sein Haus in der Hintergasse 13 wurde von einem nichtjüdischen Käufer übernommen. Im Dezember 1938 flohen er und seine Frau in die USA, wo er für ein geringes Gehalt in St. Louis auf dem Sinai-Friedhof arbeitete und 1947 verstarb.
Auguste Strauss wurde am 10. November 1938 Opfer der Pogromnacht. Schulkinder drangen in das Haus der Familie ein, zerrten sie auf die Straße und misshandelten sie. Zusammen mit ihrem Mann wanderte sie in die USA aus. 1953 verstarb sie dort.
Tochter Erna-Betty, geboren 1910, zog zunächst nach Bad Kreuznach und wanderte 1935 von dort in die USA aus. 1964 wohnte sie in Detroit, Michigan. Von ihr ist nicht viel bekannt.
Walter Strauss, geboren 1911, machte sich nach einer Ausbildung zum kaufmännischen Angestellten in der Papierbranche selbstständig. Er hatte Kontakt zu Wendel Voltz, einem Nauheimer, der den Juden immer wieder half und daraufhin als
'Judenknecht' angeprangert wurde. 1936 folgte Walter seiner Schwester in die USA. Als kaufmännischer Angestellter fand er jedoch keine Stelle mehr und musste einen Job als Fabrikarbeiter annehmen. 2002 verstarb er in
St. Louis.
Bürgermeister Jan Fischer (CDU) dankte zunächst Hans Joachim Brugger stellvertretend für den Heimat- und Museumsverein, der die Verlegungen organisiert und sich mit Kontinuität dafür eingesetzt habe. Zudem sprach er den Anwohnern und auch Karl-Heinz Pilz seinen Dank aus. Dieser hatte die Geschichten der Nauheimer Juden recherchiert und dabei die drei betroffenen Familien gefunden. In seiner Ansprache machte Fischer darauf aufmerksam, dass sich die Geschichte nicht wiederholen dürfe. Besonders in Zeiten, in denen Parteien erstarkten, die die Geschichte verharmlosten, müsse daran erinnert werden.
Landrat Thomas Will (SPD) betonte ebenfalls die Wichtigkeit der Stolpersteine.
'Die Steine geben den Menschen ihre Namen zurück, denn ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist', meinte er. Es werde deutlich, dass die Vergangenheit immer noch mitten unter den Menschen sei.
'Die Steine bringen uns gedanklich zum Stolpern und aus dem Tritt des Alltags heraus', erklärte er. Man müsse von Anfang an für Demokratie kämpfen, forderte er.
Ute Ansahl-Reissig trug anschließend ein jüdisches Gedächtnisgebet vor. Die Pfarrer Christof Mulach und Wolfgang Fenske beteten mit allen Gästen gemeinsam zum Gedenken. Eingerahmt wurde die Veranstaltung von Trompetensoli von Hans-Dieter Schindel vom Nauheimer Musikverein."
Link zum Artikel
vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Nauheim |
Links und Literatur
Links:
Quellen:
| |
Zu Nauheim sind vorhanden (auf der jeweiligen Unterseite zur
Einsichtnahme weiter über "Digitalisate anzeigen"):
HHStAW 365,598 Geburts-, Trau- und Sterberegister der Juden von
Nauheim: enthält Geburtsregister 1764 - 1808, 'Trauregister 1801,
Sterberegister 1801 - 1808 https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v2590336
|
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. 2 S. 111-112. |
 | Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 S. 139-140. Korrektur der hier gemachten Angaben in: |
 | dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 117-118. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 168-169. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 261-262. |
 | 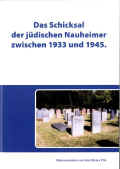 Karl-Heinz Pilz: Das Schicksal der jüdischen
Nauheimer zwischen 1933 und 1945. Die 50seitige bebilderte Broschüre ist im
Nauheimer Bürgerbüro, Weingartenstraße 46-50, 64569 Nauheim, Tel.
06152-639262-4 für 4,50 € erhältlich.
Karl-Heinz Pilz: Das Schicksal der jüdischen
Nauheimer zwischen 1933 und 1945. Die 50seitige bebilderte Broschüre ist im
Nauheimer Bürgerbüro, Weingartenstraße 46-50, 64569 Nauheim, Tel.
06152-639262-4 für 4,50 € erhältlich.
Leseprobe auf einer Seite des Heimat- und Museumsvereins Nauheim e.V.
Weitere
Leseprobe (Familie Strauss, Hintergasse 13) |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Nauheim Hesse.
In 1861 the community numbered 34 (4 % of the total). Eight Jews emigrated after
1933; the remaining 11 mostly perished in the Holocaust.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|