|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge
in Eisenach
Eisenach (Kreisstadt,
Thüringen)
Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte des Ortes
Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit
Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Eisenach wurden in jüdischen Periodika
gefunden.
Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.
Übersicht:
Allgemeine
Berichte zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
Zur
jüdischen Geschichte in Eisenach (Bericht von 1877)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Januar
1877: "Aus Thüringen. Aus Thüringen dringt von den
israelitischen Gemeinde- und Kultuszuständen selten etwas in die
Öffentlichkeit. Wenn man, gestützt auf den Ausspruch Schillers, dass der
Staat und die Frauen die besten seien, welche am wenigsten von sich reden
machen, jene Zustände dieserhalb für vollkommen und in jeder Beziehung
mustergültig halten wollte, so dürfte das doch nicht ganz zutreffend
sein. Der Hauptgrund liegt wohl darin, dass Thüringen bis jetzt nur wenig
jüdische Gemeinden zählt. Das Wohnrecht der Juden war dort bis vor dem
Eintritte der Freizügigkeit auf nur wenige Orte beschränkt. Das
Freizügigkeitsgesetz hat diesen Wall durchbrochen. Seitdem haben sich
Juden auch in solchen Ortschaften niedergelassen, welche früher keine
hatten, aber nur vereinzelt, sodass neue Gemeindebildungen daraus noch
nicht hervorgehen konnten. Dass solche Vereinzelung dem religiösen Leben
nicht förderlich ist, dasselbe vielmehr erschwert und schädigt, ist
begreiflich. Nur einige größere Städte, welche bereits bestehende
Gemeinden hatten, haben diese durch Zuzug schnell anwachsen sehen. Zu
diesen gehört auch Eisenach, mit welchem wir heute unsere
Thüringer Umschau eröffnen wollen. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Januar
1877: "Aus Thüringen. Aus Thüringen dringt von den
israelitischen Gemeinde- und Kultuszuständen selten etwas in die
Öffentlichkeit. Wenn man, gestützt auf den Ausspruch Schillers, dass der
Staat und die Frauen die besten seien, welche am wenigsten von sich reden
machen, jene Zustände dieserhalb für vollkommen und in jeder Beziehung
mustergültig halten wollte, so dürfte das doch nicht ganz zutreffend
sein. Der Hauptgrund liegt wohl darin, dass Thüringen bis jetzt nur wenig
jüdische Gemeinden zählt. Das Wohnrecht der Juden war dort bis vor dem
Eintritte der Freizügigkeit auf nur wenige Orte beschränkt. Das
Freizügigkeitsgesetz hat diesen Wall durchbrochen. Seitdem haben sich
Juden auch in solchen Ortschaften niedergelassen, welche früher keine
hatten, aber nur vereinzelt, sodass neue Gemeindebildungen daraus noch
nicht hervorgehen konnten. Dass solche Vereinzelung dem religiösen Leben
nicht förderlich ist, dasselbe vielmehr erschwert und schädigt, ist
begreiflich. Nur einige größere Städte, welche bereits bestehende
Gemeinden hatten, haben diese durch Zuzug schnell anwachsen sehen. Zu
diesen gehört auch Eisenach, mit welchem wir heute unsere
Thüringer Umschau eröffnen wollen.
Vor ca. 25 Jahren wohnten in Eisenach nur zwei jüdische Familien, deren
Wohnberechtigung daselbst noch viel weiter zurückdatiert. Vor 60 Jahren
durfte außer diesen kein Jude in der Stadt übernachten. Im Jahre 1864
war die Zahl der hier ansässigen Familien bereits auf 12-14 angewachsen,
da von Seiten der Stadt dem Zuzuge keine großen Schwierigkeiten
entgegengesetzt wurden. Diese konstituierten sich um diese Zeit als
selbstständige Gemeinde. Der jetzt hier noch amtierende Lehrer und
Vorbeter, Herr Heidungsfeld, ein Schüler des hiesigen
Schullehrerseminars, war vor der Konstituierung der Gemeinde hier schon
wohnhaft und hat daher bei derselben mit zu Gevatter gestanden. Für den Aufbau
und die friedliche Weitergestaltung der jetzt bis zu 60 Familien
angewachsenen Gemeinde war es sicher ein Glück, dass dieser in
religiöser Beziehung der konservativen Richtung angehört. Er bildete
dadurch für einen großen Teil der Zugezogenen, welche, im Gegensatze zu
den ursprünglichen Mitgliedern, der orthodoxen Richtung angehören, einen
konservativen Mittelpunkt und das Bindemittel, den friedlichen
Zusammenhang der Gemeinde zu ermöglichen, da er durch friedliches Wesen
und richtigen Takt jede Kollision zu vermeiden und den Ansprüchen aller,
die unser den obwaltenden Umständen möglichste Befriedigung zu
verschaffen weiß. Die Gemeinde hat seine Leistungen auch bereits durch
mehrmalige, ihrer jeweiligen Mitgliederzahl entsprechende
Gehaltssteigerung anerkannt.
Die Gemeinde hat kurz nach ihrer Konstituierung ein eigenes Haus erworben,
in welchem sich die Lehrerwohnung, sowie auch das Betlokal, ein
geräumiger Saal, befinden. Eine eigentliche Synagoge besitzt sie noch
nicht. Das Bedürfnis zum Bau einer solchen ist in höchst dringender
Weise vorhanden, da der jetzige Betsaal an den Festtagen die Besucher
nicht mehr zu fassen vermag und an Jom Kippur und bei Neujahrsfest
ein Teil der Gemeinde ausquartiert werden muss. Die Mehrzahl der Gemeinde
dürfte auch wohl für den Synagogenbau gestimmt sein; aber man hat diese
Frage bis jetzt noch nicht vor die Gemeindeversammlung gebracht. Man
scheint diesen Punkt gern so lange als möglich unberührt lassen zu
wollen, weil es eben ein - Geldpunkt ist. Wir halten diesen Punkt nicht
für so unwesentlich, dass man ihn nciht sehr reiflich zu erwägen hätte;
aber eine Gemeinde von 60 fast lauter wohlhabenden, ja sogar einigen sehr
reichen Mitgliedern hat wahrlich nicht Ursache, vor demselben so sehr
zurückzuschrecken, dass sie nicht einmal an die gemeinsame Erörterung
desselben gehen dürfen. Wie beschämend ist diesem gegenüber das
Beispiel so mancher kleinen Landgemeinde! Als David zur Ruhe gelangt war
und sich ein prächtiges Haus gebaut hatte, führte er sich innerlich beruhigt
durch den Gedanken: 'Siehe doch! Ich wohne in einem Hause von Zedern
und die Lade Gottes wohnt unter dem Teppich' (2. Samuel 7,2). Möchten
die reichen Mitglieder der Eisenacher Gemeinde, wenn sie in ihren
Prunkzimmern sich bewegen und behaglich fühlen, auch zuweilen eine
ähnliche Beunruhigung empfinden! Der Gottesdienst findet noch
ziemlich in althergebrachter Weise statt, sodass auch der orthodoxen
Richtung Angehörige in demselben Befriedigung suchen und finden könnten.
Die Pijutim (Melodien) und Jozrot (Zusatzgebete) für die
Samstage sind indessen völlig, die |
 für
die Festtage teilweise abgeschafft. Eine durchaus durch nichts zu
rechtfertigende, mit der Schrift in geradem Widerspruche stehende Reform
besteht darin, dass am Sukkotfeste nicht einmal der Vorbeter Esrog und
Lulaw beim Gottesdienste in die Synagoge bringen darf. In dieser Hinsicht
ist die Eisenacher Synagoge sicher ein Unicum. Und dabei betet man das
Jozer, welches auf diese Handlung Bezug hat, und liest die betreffende
Vorschrift aus der Tora vor! Sieht das nicht wie Spott aus? Der
Landesrabbiner hat es bis jetzt noch nicht vermochte, eine Änderung
herbeizuführen. für
die Festtage teilweise abgeschafft. Eine durchaus durch nichts zu
rechtfertigende, mit der Schrift in geradem Widerspruche stehende Reform
besteht darin, dass am Sukkotfeste nicht einmal der Vorbeter Esrog und
Lulaw beim Gottesdienste in die Synagoge bringen darf. In dieser Hinsicht
ist die Eisenacher Synagoge sicher ein Unicum. Und dabei betet man das
Jozer, welches auf diese Handlung Bezug hat, und liest die betreffende
Vorschrift aus der Tora vor! Sieht das nicht wie Spott aus? Der
Landesrabbiner hat es bis jetzt noch nicht vermochte, eine Änderung
herbeizuführen.
Als eine erfreuliche Tatsache ist zu berichten, dass sich hier schon vor
etwa sechs Jahren zwei Chebro's (religiöse Vereine) gebildet haben, eine
Männer-Chebro, deren Zweck sich auf allsabbatliches 'Lernen' beschränkt,
und eine Frauenchebro, welche wohltätige Ziele verfolgt.
Der vor mehreren Jahren als Landrabbiner ins Großherzogtum Weimar
berufene und in Stadtlengsfeld
wohnhafte Herr Dr. Kroner, früher Seminardirektor in Münster, gehört
der orthodoxen Richtung an. In Folge dessen hat er mit den auf der
entgegengesetzten Seite Stehenden schon manchen Kampf zu bestehen gehabt.
Dieselben verhalten sich zum Teile ihm gegenüber immer noch abwehrend;
doch hat die in der Tat sehr bedeutende Rednergabe dieses noch jungen
Mannes ihn schon viel Boden innerhalb seiner Gemeinden gewinnen lassen und
ebnet ihm die Herzen der seiner Seelsorge Unterstellten mehr und mehr,
sodass sich mit der Zeit auch von dieser Seite ein freundliches
Entgegenkommen hoffen lässt. In Stadtlengsfeld
selbst hat sich seit dem Dortsein des jetzigen Landrabbiners wieder ein
echtes K'hillaleben (Gemeindeleben) zu entwickeln begonnen.
Über die äußeren Verhältnisse der Israeliten in Eisenach und im
Großherzogtum überhaupt im nächsten
Artikel." |
Zum
obigen Bericht über die jüdische Gemeinde (1877)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Januar
1877: "Vom Harz, 22. Januar (1877). Die Korrespondenz
'aus Thüringen' in Nr. 3 dieses Blattes wird wohl nicht verfehlen, in
jüdischen kreisen freudigen Widerhall zu finden. Konstatiert dieselbe
doch religiösen Sinn und religiöses Streben aus einer Gemeinde, die
früher der Sitz des reformsüchtigsten Reformers war. Zudem haben
namentlich die religiösen Verhältnisse Eisenachs noch dadurch
allgemeines Interesse, weil in Folge dessen Bedeutung für die
Geschäftswelt, dessen zahlreichen Bahnverbindungen viele Glaubensgenossen
zu längerem oder kürzerem Aufenthalt dahin fahren. Auch die Hoffnungen
für die Zukunft, so namentlich der Bau einer würdigen, den
Verhältnissen entsprechenden Synagoge, werden sicherlich sich nach und
nach realisieren, und Eisenach immer mehr eine jüdische Gemeinde werden.
- Eines jedoch miss in erwähnter Korrespondenz befremden, und hier
öffentlich besprochen werden: Man nannte die dortige Synagoge ein Unikum,
weil die von den vier Pflanzenarten (zu Sukkot) Handelnden Jozrot
(Zusatzgebete) gebetet wurden, diese selbst aber nicht einmal vom Vorbeter
mit in die Synagoge gebracht werden durften. Uns erscheint das aber nicht
ein Unikum - denn es gibt leider mehr dergleichen - doch was soll man dazu
sagen, wenn man von 'orthodoxer Richtung vieler Mitglieder', von einem 'konservativen
Mittelpunkt' und dergleichen schönen Dingen mehr, spricht 'und sich
dennoch in dieser Gemeinde nicht einmal eine Mikwe befindet!'
Wahrlich der Mangel an dieser sollte mehr empfunden werden, als der einer
Synagoge, und erst wenn diesem wahrhaft jüdischen Bedürfnisse Genüge
geschehen, dann mag ein Hinweis auf den frommen König David und seine
Begeisterung für den Bau eines Tempels am Platze sein. Aber auch dann
erst, wenn diesem oder ähnlichen Religionsgesetzen geeignete Stelle
erworben, wird es dem wirklich gesetzestreuen Israeliten möglich sein,
sich in Eisenach niederzulassen, oder eine Tochter dahin zu verheiraten.
B." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Januar
1877: "Vom Harz, 22. Januar (1877). Die Korrespondenz
'aus Thüringen' in Nr. 3 dieses Blattes wird wohl nicht verfehlen, in
jüdischen kreisen freudigen Widerhall zu finden. Konstatiert dieselbe
doch religiösen Sinn und religiöses Streben aus einer Gemeinde, die
früher der Sitz des reformsüchtigsten Reformers war. Zudem haben
namentlich die religiösen Verhältnisse Eisenachs noch dadurch
allgemeines Interesse, weil in Folge dessen Bedeutung für die
Geschäftswelt, dessen zahlreichen Bahnverbindungen viele Glaubensgenossen
zu längerem oder kürzerem Aufenthalt dahin fahren. Auch die Hoffnungen
für die Zukunft, so namentlich der Bau einer würdigen, den
Verhältnissen entsprechenden Synagoge, werden sicherlich sich nach und
nach realisieren, und Eisenach immer mehr eine jüdische Gemeinde werden.
- Eines jedoch miss in erwähnter Korrespondenz befremden, und hier
öffentlich besprochen werden: Man nannte die dortige Synagoge ein Unikum,
weil die von den vier Pflanzenarten (zu Sukkot) Handelnden Jozrot
(Zusatzgebete) gebetet wurden, diese selbst aber nicht einmal vom Vorbeter
mit in die Synagoge gebracht werden durften. Uns erscheint das aber nicht
ein Unikum - denn es gibt leider mehr dergleichen - doch was soll man dazu
sagen, wenn man von 'orthodoxer Richtung vieler Mitglieder', von einem 'konservativen
Mittelpunkt' und dergleichen schönen Dingen mehr, spricht 'und sich
dennoch in dieser Gemeinde nicht einmal eine Mikwe befindet!'
Wahrlich der Mangel an dieser sollte mehr empfunden werden, als der einer
Synagoge, und erst wenn diesem wahrhaft jüdischen Bedürfnisse Genüge
geschehen, dann mag ein Hinweis auf den frommen König David und seine
Begeisterung für den Bau eines Tempels am Platze sein. Aber auch dann
erst, wenn diesem oder ähnlichen Religionsgesetzen geeignete Stelle
erworben, wird es dem wirklich gesetzestreuen Israeliten möglich sein,
sich in Eisenach niederzulassen, oder eine Tochter dahin zu verheiraten.
B." |
Zur
jüdischen Geschichte in Eisenach (Bericht von 1884)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. September
1884: "Aus Thüringen. Die Neuzeit hat sich in den
Wohnsitzverhältnissen der großen und kleinen israelitischen Gemeinden
Deutschlands merkwürdige Veränderungen bewirkt. Große Gemeinden in
volkreichen Städten haben in einem Vierteljahrhundert ihre Mitgliederzahl
verdrei-, vervier-, ja zum Teil verzehnfacht, während die kleineren
Gemeinden in kleinen Städten und Dörfern immer mehr zusammenschrumpfen
oder ganz zu existieren aufhören. Synagogen, welche sich seit
undenklicher Zeit tagtäglich mit andächtigen Betern füllten, stehen
verlassen, weil die Gemeinde sich nach allen Richtungen hin zerstreut hat,
und in Städten, welche seit dem Mittelalter den Juden den Einsitz
wehrten, erheben sich prachtvolle Synagogen. Zu diesen Letztern gehört
auch Eisenach. Die Synagoge, welche hier erbaut wird, ist in
ihrem äußeren Aufbau bereits vollendet; an dem innern Ausbau wird
fleißig gearbeitet; derselbe kann jedoch vor den bevorstehenden hohen Festtagen
nicht mehr fertig gestellt werden. Es ist ein stattliches Gebäude, in
Backsteinrohbau mit Verzierungen und Gesimsen aus rotem Sandsteine
ausgeführt und mit einem Rundturme versehen, das einen imponierenden
Eindruck macht. Es ist schade, dass sie sich nicht inmitten der Stadt
befindet. Sie ist in der Wörthstraße, einer neuen, erst noch im
Entstehen begriffenen Straße gelegen. Die Heizung der Synagoge wird durch
Öfen stattfinden. Man hat zwar einen Raum zur Anschaffung einer Orgel
reserviert; von der Anschaffung einer solchen ist aber vor der Hand
abgesehen worden, wird vielleicht auch ganz unterbleiben, da nach der
bestehenden Synagogenordnung in dieser Beziehung auch das Landrabbinat ein
Wort mitzusprechen hat. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. September
1884: "Aus Thüringen. Die Neuzeit hat sich in den
Wohnsitzverhältnissen der großen und kleinen israelitischen Gemeinden
Deutschlands merkwürdige Veränderungen bewirkt. Große Gemeinden in
volkreichen Städten haben in einem Vierteljahrhundert ihre Mitgliederzahl
verdrei-, vervier-, ja zum Teil verzehnfacht, während die kleineren
Gemeinden in kleinen Städten und Dörfern immer mehr zusammenschrumpfen
oder ganz zu existieren aufhören. Synagogen, welche sich seit
undenklicher Zeit tagtäglich mit andächtigen Betern füllten, stehen
verlassen, weil die Gemeinde sich nach allen Richtungen hin zerstreut hat,
und in Städten, welche seit dem Mittelalter den Juden den Einsitz
wehrten, erheben sich prachtvolle Synagogen. Zu diesen Letztern gehört
auch Eisenach. Die Synagoge, welche hier erbaut wird, ist in
ihrem äußeren Aufbau bereits vollendet; an dem innern Ausbau wird
fleißig gearbeitet; derselbe kann jedoch vor den bevorstehenden hohen Festtagen
nicht mehr fertig gestellt werden. Es ist ein stattliches Gebäude, in
Backsteinrohbau mit Verzierungen und Gesimsen aus rotem Sandsteine
ausgeführt und mit einem Rundturme versehen, das einen imponierenden
Eindruck macht. Es ist schade, dass sie sich nicht inmitten der Stadt
befindet. Sie ist in der Wörthstraße, einer neuen, erst noch im
Entstehen begriffenen Straße gelegen. Die Heizung der Synagoge wird durch
Öfen stattfinden. Man hat zwar einen Raum zur Anschaffung einer Orgel
reserviert; von der Anschaffung einer solchen ist aber vor der Hand
abgesehen worden, wird vielleicht auch ganz unterbleiben, da nach der
bestehenden Synagogenordnung in dieser Beziehung auch das Landrabbinat ein
Wort mitzusprechen hat.
Bei Gelegenheit der Grundsteinlegung, welche ohne Sang und Klang
stattgefunden hat, wurde auch Umschau in der Chronik Eisenachs gehalten,
um das, was sich aus alter Zeit auf die Juden Eisenachs Bezügliches hier
vorfindet, zugleich mit dem, was sich aus späterer und der neuesten Zeit
über die jüdische Bevölkerung dieser Stadt berichten lässt, in einem
eigenen Gedenkblatte zum Andenken für spätere Geschlechter in dem
Grundsteine zur Aufbewahrung niederzulegen. Schreiber dieses hat, hierdurch
angeregt, später Einsicht von der Eisenacher Chronik genommen und teilt
hiermit das uns Interessierende aus derselben mit. Die Daten gehören
größtenteils dem nachbenannten chronikalischen Werke an, dem sie
entlehnt ist: 'Topographisch-historische Beschreibung der Stadt Eisenach
von Johann Wilhelm Storch, Eisenach, bei Johann Friedrich Bärecke
1837.' Das alte Eisenach befand sich nicht auf derselben Stelle,
wo die jetzige Stadt steht. Der Ursprung des alten Eisenach verliert sich
in das graue Altertum; es muss schon früher ein ansehnlicher Ort gewesen
sein, da im Jahre 451 sich der Hunnenkönig Attila daselbst aufgehalten
und hier seine Vermählung mit Grimhilde, der Tochter des damaligen
thüringischen Königs Günther vollzogen haben soll. Es wird vermutet,
dass auch in dem alten Eisenach schon Juden gewohnt haben. Zwischen dem
Wege und der Hauptstraße, die nach Gotha führt, diesseits des
Siechenbaches, in der Gegend, wo jetzt die Wegegeldeinnahme steht, befand
sich der jüdische Totenhof. Ob derselbe schon zur Zeit des alten
Eisenach existiert oder seine Anlage der jetzigen Stadt zu verdanken hat,
lässt sich nicht mehr bestimmen. Die Erbauung der jetzigen Stadt soll
Graf Ludwig II. der Salier genannt, im Jahre 1070 begonnen und im Jahre
1073 vollendet haben.
Entweder haben die Juden bei dieser Gelegenheit erst Aufnahme in Eisenach
gefunden, oder, was das Wahrscheinlichste ist, sind sie aus der alten,
zugleich mit den übrigen Einwohnern, in die neue Stadt übergesiedelt.
Sicher ist, dass die die Karlstraße gebaut und bewohnt haben. Diese Straße
führte deshalb auch früher den Namen 'Judenstraße', wie man sie hin und
wieder von alten Leuten jetzt noch benennen hört. Hier hatten sie ach
eine Synagoge gebaut, welche merkwürdiger Weise jetzt noch vorhanden ist.
Sie befindet sich in der Karlsstraße im Hohe des Hauses Nr. 24 und
gehört zu den Hintergebäuden dieses Hauses. Es ist ein äußerlich noch
ziemlich gut erhaltenes, massiv aus Steinen erbautes Gebäude mit kleinen
Fenstern. Den innern Raum, welcher zur Aufbewahrung von Waren |
 und
sonstigen Utensilien des dermaligen Besitzers dient, konnte Schreiber
dieses nicht beaugenscheinigen, derselbe soll jedoch, wie mir von
glaubwürdiger Seite versichert wird, seine synagogale Bestimmung noch
sehr gut erkennen lassen. Inschriften sind nicht mehr vorhanden. Es
dürfte dieses wohl eine der ältesten Synagogen Deutschlands sein. Wenn
diese Mauern reden könnten, von welchem Jammer wüssten sie zu erzählen,
den sie unter denen oft wahrgenommen, die täglich die von ihnen
umschlossenen Hallen mit Ehrfurcht betreten haben! Wie viel Tränen haben
sie fließen sehen, wie viel Seufzer zu Gott emporsteigen gehört! Es
waren wohl der niedergedrückten, kummergebeugten und angsterfüllten
Gestalten gar viele, welche in diesen Hallen sich oft zusammenfanden; aber
diese äußerlich niedergebeugten, so furchtsam aussenden Gestalten waren
innerliche Helden! Sie wussten nicht bloß für das idealste und heiligste
Gut des Menschen, für die angestammte, gottoffenbarte Religion, zu leben,
sondern sie hatten auch den Mut, für dieselbe zu sterben! Wie klein
erscheinen doch so viele der Unsrigen in der Jetztzeit, wenn sie bei jeder
kleinen Entbehrung, bei jedem Opfer, welche die Religion ihnen auflegt,
das Judentum als eine Last betrachten, die sie gern von sich werden
möchten, wie klein erscheinen sie, trotz ihres aufrechten, selbstbewussten
Daherschreitens, gegen diese gebückt und furchtsam einherwandelnden
Glaubenshelden der Vorzeit, welche gern Alles aufgaben, Alles opferten,
selbst das Leben, wenn es sein musste, nur - die Religion nicht! Solche
altertümliche Stätten sollte man eigentlich zu erhalten suchen! Sie
reden eine eigentümliche, tiefergreifende Sprache! Sie schaffen uns
wehmütige Erinnerungen, auch auch heilsame Lehren! und
sonstigen Utensilien des dermaligen Besitzers dient, konnte Schreiber
dieses nicht beaugenscheinigen, derselbe soll jedoch, wie mir von
glaubwürdiger Seite versichert wird, seine synagogale Bestimmung noch
sehr gut erkennen lassen. Inschriften sind nicht mehr vorhanden. Es
dürfte dieses wohl eine der ältesten Synagogen Deutschlands sein. Wenn
diese Mauern reden könnten, von welchem Jammer wüssten sie zu erzählen,
den sie unter denen oft wahrgenommen, die täglich die von ihnen
umschlossenen Hallen mit Ehrfurcht betreten haben! Wie viel Tränen haben
sie fließen sehen, wie viel Seufzer zu Gott emporsteigen gehört! Es
waren wohl der niedergedrückten, kummergebeugten und angsterfüllten
Gestalten gar viele, welche in diesen Hallen sich oft zusammenfanden; aber
diese äußerlich niedergebeugten, so furchtsam aussenden Gestalten waren
innerliche Helden! Sie wussten nicht bloß für das idealste und heiligste
Gut des Menschen, für die angestammte, gottoffenbarte Religion, zu leben,
sondern sie hatten auch den Mut, für dieselbe zu sterben! Wie klein
erscheinen doch so viele der Unsrigen in der Jetztzeit, wenn sie bei jeder
kleinen Entbehrung, bei jedem Opfer, welche die Religion ihnen auflegt,
das Judentum als eine Last betrachten, die sie gern von sich werden
möchten, wie klein erscheinen sie, trotz ihres aufrechten, selbstbewussten
Daherschreitens, gegen diese gebückt und furchtsam einherwandelnden
Glaubenshelden der Vorzeit, welche gern Alles aufgaben, Alles opferten,
selbst das Leben, wenn es sein musste, nur - die Religion nicht! Solche
altertümliche Stätten sollte man eigentlich zu erhalten suchen! Sie
reden eine eigentümliche, tiefergreifende Sprache! Sie schaffen uns
wehmütige Erinnerungen, auch auch heilsame Lehren!
Später mussten die Juden die Karlsstraße, damals 'Judenstraße',
verlassen und mussten in die 'Löbersgasse' übersiedeln, einer Gasse,
welche bis vor einigen Jahren durch die Ausdünstungen der hier
befindlichen Lohgerbereien die am wenigsten einladende aller Gassen und
Gässchen Eisenachs war. Auch hier soll eine Synagoge gestanden und im
Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts noch vorhanden gewesen
sein.
Was die Ursache dieser Ausweisung der Juden aus der Karlsstraße gewesen ist,
berichtet die Chronik nicht. Man hat übrigens nicht nötig, seiner
Phantasie viel Anstrengung zuzumuten, wenn man diese Ursache auffinden
will. Man braucht nur die Geschichte des Mittelalters zu kennen, wie man
damals mit den Juden umgesprungen ist, um darüber bald im Klaren zu sein.
Die Straße mochte sich damals schon durch die Juden bald zu dem
entwickelt haben, was sie jetzt auch nicht ist, nämlich zu der
lebhaftesten und bedeutendsten Geschäftsstraße Eisenachs. Nachdem sie
das geworden war, schien sie für die Juden viel zu gut zu sein. Der Mohr
hatte seine Schuldigkeit getan und konnte gehen, oder vielmehr er musste
gehen. Es ist stets und überall dasselbe Spiel, in der Vergangenheit, wie
in der Jetztzeit. Die Vorteile, welche die Juden einem Orte bringen, das
was sie zum Aufblühen desselben beitragen, lässt man sich gern gefallen;
aber die Früchte alles dessen gönnte man ihnen nicht, die sucht man
ihnen möglichst zu schmälern oder sie ganz zu entreißen. So auch hier!
Die von üblen Gerüchen angefüllte enge Löbersgasse wurde ihnen als der
Arbeit Lohn zugewiesen.
Die Chronik erzählt auch von dem 'schwarzen Tode', jener furchtbaren
Pest, welche wie ein Würgengel Europa im Mittelalter durchzog und die
Bevölkerung Deutschlands dezimierte. Sie berichtet in Betreff der Juden:
'Mit diesem Schrecken der Natur vereinbarte sich noch ein Übel, von
fanatischen Priestern angefacht. Den Juden wurde die Schuld der
Sterblichkeit vorzüglich beigemessen, weil solche die Brunnen vergiftet
haben sollten. Eine unzählige Menge wurde in Deutschland qualvoll
getötet, ihre Wohnungen gingen in Flammen auf und sie stürzten sich
selbst mit ihren Weibern und Kindern verzweiflungsvoll in die angefachte
Glut. Der Kaiser und mehrere weltliche und geistliche Fürsten, denen die
Juden ein schweres Schutzgeld jährlich zu entrichten hatten, vermochten
sie nicht gegen die Wut zu schirmen. Durch die vielfältigen Morde waren
deren Einkünfte beträchtlich geschmälert worden. Die Stadt Erfurt
musste daher Einhundert Mark Silber als eine jährliche Entschädigung an
den Erzbischof von Mainz erlegen'. In einigen jüdischen
Geschichtsbüchern wird berichtet, dass auch die Juden Eisenachs damals
von dem tollwütigen Volke dem Feuertode überliefert worden seien. Die
Chronik erzählt dieses zwar von anderen thüringischen Städten,
übergeht aber Eisenach mit Stillschweigen, vielleicht aus Lokalpatriotismus,
vielleicht auch, weil dem Verfasser keine verbürgten Urkunden hierüber
zu Gebote gestanden haben. Oder sollte Eisenbach wirklich eine Ausnahme
gemacht haben?*
*Anmerkung der Redaktion: Im alten Mainzer Memorialbuch wird auch der
Märtyrer von Eisenach gedacht. Daselbst werden die Märtyrer der
nachstehenden Thüringischen Städte erwähnt: Erfurt, Mühlhausen,
Nordhausen, Meißen, Arnstadt, Ilmenau, Eisenach und Gotha.
|
 Dagegen
berichtet die Chronik, dass die Juden im Jahre 1401 aus der Stadt
vertrieben worden seien. Dagegen
berichtet die Chronik, dass die Juden im Jahre 1401 aus der Stadt
vertrieben worden seien.
Von jener Zeit an bis zu den letzten Jahrzehnten des achtzehnten
Jahrhunderts scheinen sich in Eisenach keine Juden wieder ansässig
gemacht zu haben. Zwischen 1770 und 1780 ließ sich der Hoffaktor Herr
Michael Rothschild aus Stadtlengsfeld
hier nieder und gründete hier ein Geschäftshaus, das sich jetzt noch im
Besitze seines Sohnes befindet. Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts
gesellten sich diesem noch drei Familien zu. Nachdem im Jahre 1848 die
Gleichstellung der Juden mit den Bekennern anderer Konfessionen im
Großherzogtum Sachsen-Weimar erfolgt war, vermehrte sich die jüdische
Einwohnerschaft Eisenachs durch Zuzug aus benachbarten Ortschaften, sodass
am 10. Dezember 1863 achtzehn stimmberechtigte Mitglieder hier wohnten. An
dem genannten Tage konstituierten sich dieselben zu einer
Religionsgemeinde und wählten Herrn Salomon Backhaus zu ihrem
Vorsteher, nachdem sie kurze Zeit vorher Herrn Jakob Heidungsfeld
zu ihrem Lehrer und Vorsänger bestellt hatten. Beide walten noch heute
ihres Amtes.
Kurz nach der Konstituierung der Gemeinde, im Jahre 1864, kaufte
dieselben ein Haus und richtete im demselben einen Betsaal und eine
Wohnung für den Lehrer und Vorsänger ein. Der Betsaal musste, um
dem Bedürfnisse der anwachsenden Gemeinde zu entsprechen, mehrere Male
vergrößert werden. Nach der Proklamierung der Freizügigkeit in
Deutschland erhielt die Gemeinde durch Zuzug von außen allmählich einen
solchen Zuwachs, dass sie jetzt aus 350 Seelen besteht. Der vorhandene
Betsaal konnte, trotz der stattgefundenen Vergrößerung, schon seit
Jahren an den hohen Festtagen die Zahl der Beter nicht mehr fassen und
musste deshalb jedes Mal noch ein Nebensaal in Miete genommen werden. Die hieraus
entstehenden Missstände und Unannehmlichkeiten wurden in der Gemeinde
schon lange unangenehm empfunden, und bildete darum der Plan eines Synagogenbaues
schon seit sehr geraumer Zeit ein Gegenstand lebhaftester Erörterung,
welche endlich im Jahre 1883 einen definitiven Entschluss
herbeiführte, dem auch die rasche Tat auf dem Fuße folgte. Möge diese
Tat eine Quelle des Segens für die Gemeinde werden und bleiben für alle
Zeiten, und möge es dem schönen Gotteshause zu jeder gottesdienstlichen
Stunde nie an andächtigen Betern fehlen!" |
"Thüringer
Brief" mit Informationen zur jüdischen Gemeinde in Eisenach (1895)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. September
1895: "Thüringer Brief. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. September
1895: "Thüringer Brief.
Eisenach, im September (1895). Der Sommer neigt sich allmählich
seinem Ende zu, die Blätter beginnen bunt zu werden, und alle Anzeichen
sind vorhanden, dass der Herbst vor der Tür steht. Ich glaube, da ist so
ein Rückblick auf die Frühlings- und Sommerzeit, soweit es die Juden
betrifft, nicht unangebracht. Dass ich speziell Thüringen im Auge
habe, der ich doch da zu Hause bin, liegt wohl auch auf der
Hand.
Thüringen ist von jeher das Land gewesen, das von der jüdischen Presse
am stiefmütterlichsten behandelt worden ist. Nur selten verirrte sich
einmal eine kurze thüringischen Notiz in die Blätter. Das hat aber auch
seinen guten Grund. Die Judengemeinden sind hier fast alle nur sehr klein.
Kaum vier oder fünf Städte besitzen größere Ansammlungen. Früher war
das ganz anders; da zählte Thüringen zu den Ländern, die die meisten
Juden besaßen, und erst seit den Zeiten des schwarzen Todes gehörten
thüringische Juden zu den Seltenheiten. Seit dem vorigen Jahrhundert
begannen die Städte, mit Ausnahme von Erfurt, das immer eine große
Gemeinde besaß, sich wieder mit Juden zu bevölkern, und nur allmählich
bildeten sich größere Gemeinden, wie zum Beispiel Eisenach.
Eisenach zählt heute schon ungefähr 90 jüdische Familien, trotzdem die
Gemeinde sehr jung ist. Erst in den sechziger Jahren hatte sie sich
konstituiert. Das politische Getriebe hat auch hier in diesem Jahre
nachhaltige Spuren zurückgelassen. Der Wahlkampf, der im Frühjahr getobt
hatte, hatte auch den Antisemiten wieder ein reiches Feld eröffnet.
Höher denn jemals brandeten die Wogen des Kampfes. Fünf Parteien hatten
ihre Kandidaten aufgestellt, und alle fünf hofften auf Sieg. Uns
interessieren hier nur die Antisemiten und der Bund der Landwirte. Der
Bund der Landwirte, der in dem Reichstagskandidaten Dr. Rösicke vertreten
war, hatte eine solch antisemitische Färbung angenommen, dass man
zweifelhaft sein konnte, wer eigentlich von beiden Parteien am meisten
gegen die Juden hetzte. Denn eine Hetze war es, die der Bund der Landwirte
gegen die Juden veranstaltete. In Flugblättern und Zeitungen flog es nur
so hinüber und herüber mit antisemitischen Floskeln und Kraftwörtern.
Und dank seiner Agitation hatte der Bund der Landwirte einen Erfolg zu
verzeichnen, der indes 'ohne Erfolg' blieb. Rösicke kam nämlich in die
Stichwahl und - fiel durch. Die Reformparteiler und ihre sauberen
Confratres lagen sich nun deshalb in den Haaren. Entgegen den Beschlüssen
der Berliner |
 Parteileitung
hatten sich nämlich die reinen (?) Antisemiten entweder der Wahl
enthalten, oder sie hatten den Gegenkandidaten gewählt. Deshalb wühlten
die beiden Parteien gegenseitig ihren Schmutz auf. Parteileitung
hatten sich nämlich die reinen (?) Antisemiten entweder der Wahl
enthalten, oder sie hatten den Gegenkandidaten gewählt. Deshalb wühlten
die beiden Parteien gegenseitig ihren Schmutz auf.
Überhaupt scheint das Wühlen der Lebenszweck der Antisemiten zu sein.
Sogar in den Kurorten könnten sie ihre Hetzereien nciht lassen. So
stößt man jetzt oft in den Badeplätzen Friedrichroda und Tabarz auf
antisemitische Flugblätter. Die Wirkungen fehlen denn natürlich auch
nicht. Anzeigen, wie 'Zimmer für christliche Herrschaften sind zu
vermieten', gehören zwar noch zu den Seltenheiten, doch liegt Gefahr
vorhanden, dass dies immer häufiger wird. Dass so etwas den Badeplätzen
nur schaden kann, sehen oder wollen die Antisemiten nicht einsehen.
Wozu auch? Mit einer leider zu bekannten Redensart können diese Herren
sich ja so leicht über Unannehmlichkeiten hinwegsetzen. Wozu gäbe es den
Ausspruch: 'Der Zweck heiligt die Mittel', wenn er nicht seine Anwendung
finden sollte! Und was sind das erst für Zwecke? Aber woraus erklärt
sich das Überhandnehmen der Intoleranz und Humanitätslosigkeit? Zum
großen Teil aus der geradezu verblüffenden Gleichgültigkeit vieler
unserer Glaubensgenossen. Allenthalben hört man von jüdischen
Literaturvereinen, die gegründet worden sind, um den Indifferentismus der
Juden zu brechen. Ja, in Thüringen hört man von derartigem nichts!
Nur Eisenach besitzt einen Verein, der aber nur in bescheidenem
Maße wirken kann. Derselbe besteht zwar schon über zwei Jahre, ist
jedoch erst seit diesem Winter mehr in die Öffentlichkeit getreten. da
ich nun doch einmal von den jüdischen Geschichts- und Literaturvereinen
spreche, so möchte ich bei dieser Gelegenheit den Vorschlägen, über die
sich Herr Prediger Ellguther in Nr. 278 dieses Blattes verbreitet hat,
etwas näher treten. Dieselben finden meinen Beifall in vollem Maße, und
ich glaube, wenn der 'Allgemeine Verband' die Sache in die Hand nimmer, so
wird die Angelegenheit gewiss realen Boden gewinnen. Nur möchte ich
vorschlagen, die Abhandlungen zum Jahresbericht nicht jedes Jahr, sondern
alle zwei Jahre erscheinen zu lassen, da doch viele kleinere Vereine über
ihre Barschaften in nicht so ausgedehntem Maße verfügen können wie
größere. |
 Wegen
der beizudruckenden Vorträge selbst wird man wohl nicht sehr in
Verlegenheit geraten, da dabei doch wahrscheinlich Auswahl vorhanden ist.
Denn die jüdisch-wissenschaftliche Literatur ist, wie man mit
Freuden konstatieren kann, auf dem Büchermarkte ziemlich stark vertreten.
Wie verhält es sich aber mit der jüdischen Belletristik? Da ist
es nun freilich anders bestellt. Bedeutende Werke werden jetzt nur in sehr
bescheidenem Maße verfasst. Umso eifriger liest man aber dafür die
wenigen Werke, die herausgegeben werden. Da ist jüngst - und ich glaube,
ich habe als Eisenacher doppeltes Interesse, darauf näher einzugehen -
von dem bekannten Schriftsteller . Hause ein Band erschienen, betitelt 'Drei
Erzählungen'. Diese Erzählungen heben sich von seiner vorjährigen Arbeit
'Aus dem jüdischen Leben' sehr vorteilhaft ab. 'Aus dem jüdischen Leben'
sind zwei Novellen, in denen Hause den Lehrer zu sehr durchblicken
lässt und darüber fast ganz den Erzähler vergisst. Er geht
meiner Meinung nach von einer ganz irrigen Voraussetzung aus. Er lässt in
seinen Erzählungen eine ganz bestimmte Tendenz zutage treten, die er in
mehr oder weniger ungeschickter Weise zum Ausdruck bringt. Ganz recht!
Tendenz muss jeder tiefer angelegte Roman haben. Aber darf das in solcher
Weise hervortreten, wie hier! Hause lässt nämlich einige Personen lange
erbauliche Diskurse über die jüdische Erziehung pflegen, die, ohne viel
zu sagen, mindestens den dritten Teil des Werkes ausmachen. Ja, heißt
denn das den Leser in Spannung halten? Das jetzige übernervöse
Lesepublikum hat eben keinen Sinn und keine Ausdauer für solche Exkurse.
Da lässt man sich Hauses 'Drei Erzählungen' gefallen! Die sind in einem
frischen, volkstümlichen Ton geschrieben und wirken packend bis an den Schluss.
Den besten Eindruck hat auch mich 'Die silbernen T'fillah' gemacht. Etwas
schwächer ist die zweite Erzählung 'Ein Waisenknabe'. Der Schluss, der
zu unwahrscheinlich klingt, beeinträchtigt die Totalwirkung etwas,
während wieder 'Eine wunderbare Errettung' bis ans Ende
fesselt. Wegen
der beizudruckenden Vorträge selbst wird man wohl nicht sehr in
Verlegenheit geraten, da dabei doch wahrscheinlich Auswahl vorhanden ist.
Denn die jüdisch-wissenschaftliche Literatur ist, wie man mit
Freuden konstatieren kann, auf dem Büchermarkte ziemlich stark vertreten.
Wie verhält es sich aber mit der jüdischen Belletristik? Da ist
es nun freilich anders bestellt. Bedeutende Werke werden jetzt nur in sehr
bescheidenem Maße verfasst. Umso eifriger liest man aber dafür die
wenigen Werke, die herausgegeben werden. Da ist jüngst - und ich glaube,
ich habe als Eisenacher doppeltes Interesse, darauf näher einzugehen -
von dem bekannten Schriftsteller . Hause ein Band erschienen, betitelt 'Drei
Erzählungen'. Diese Erzählungen heben sich von seiner vorjährigen Arbeit
'Aus dem jüdischen Leben' sehr vorteilhaft ab. 'Aus dem jüdischen Leben'
sind zwei Novellen, in denen Hause den Lehrer zu sehr durchblicken
lässt und darüber fast ganz den Erzähler vergisst. Er geht
meiner Meinung nach von einer ganz irrigen Voraussetzung aus. Er lässt in
seinen Erzählungen eine ganz bestimmte Tendenz zutage treten, die er in
mehr oder weniger ungeschickter Weise zum Ausdruck bringt. Ganz recht!
Tendenz muss jeder tiefer angelegte Roman haben. Aber darf das in solcher
Weise hervortreten, wie hier! Hause lässt nämlich einige Personen lange
erbauliche Diskurse über die jüdische Erziehung pflegen, die, ohne viel
zu sagen, mindestens den dritten Teil des Werkes ausmachen. Ja, heißt
denn das den Leser in Spannung halten? Das jetzige übernervöse
Lesepublikum hat eben keinen Sinn und keine Ausdauer für solche Exkurse.
Da lässt man sich Hauses 'Drei Erzählungen' gefallen! Die sind in einem
frischen, volkstümlichen Ton geschrieben und wirken packend bis an den Schluss.
Den besten Eindruck hat auch mich 'Die silbernen T'fillah' gemacht. Etwas
schwächer ist die zweite Erzählung 'Ein Waisenknabe'. Der Schluss, der
zu unwahrscheinlich klingt, beeinträchtigt die Totalwirkung etwas,
während wieder 'Eine wunderbare Errettung' bis ans Ende
fesselt.
Ich hätte zwar noch mehreres auf dem Herzen, will aber den Leser nicht
ermüden. Sollte ich ja zu oft und zu sehr vom Thema abgeschweift sein, so
möge mir das zur Entschuldigung dienen, dass ja ein Brief nicht für
trockene Berichte geeignet ist, sondern mehr dazu, ein wenig zu plaudern
und seine Gedanken auf dem Papier spazieren zu führen. P-s
A.." |
Aus der
Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet
1895 / 1896
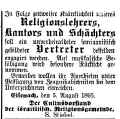 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. August 1895: Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. August 1895:
"In Folge zeitweiser Kränklichkeit unseres Religionslehrers,
Kantors und Schächters
soll ein unverheirateter seminaristisch gebildeter Vertreter
desselben engagiert werden. Auf musikalische Befähigung wird besondere
Rücksicht genommen.
Bewerber wollen ihr Anerbieten unter Beifügung von Zeugnisabschriften bei
dem Unterzeichneten einreichen.
Eisenach, den 5. August 1895.
Der Kultusvorstand der israelitischen Religionsgemeinde. S.
Stiebel." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Dezember 1896: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Dezember 1896:
"Die Stelle eines Religionslehrers und Kantors der hiesigen
israelitischen Gemeinde ist zu besetzen. Staatlich geprüfte und
musikalisch gebildete Bewerber, welche zur Leitung des Synagogenchors
befähigt und in der Lage sind, einen freien Vortrag zu halten, wollen
ihre Meldungsgesuche unter Einreichung ihrer Zeugnisse sowie Angabe ihrer
persönlichen und familiären Verhältnisse an den Unterzeichneten
richten. Das feste Gehalt beträgt 2000 Mark, außer einigem
Nebeneinkommen.
Der Kultusvorstand der israelitischen Religionsgemeinde zu Eisenach:
S. Stiebel." |
Lehrer
Jakob Heidungsfeld wirbt für seine Pensions-Anstalt (1862 / 1864)
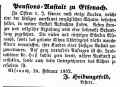 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. März
1862: "Pensions-Anstalt zu Eisenach. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. März
1862: "Pensions-Anstalt zu Eisenach.
Zu Ostern dieses Jahres können noch einige Knaben, welche eine der
hiesigen anerkannt vorzüglichen Schulen besuchen sollen, in meiner
Anstalt Aufnahme finden. Neben strenger und religiöser Erziehung wird
eine liebvolle Behandlung zugesichert. Die vielen und tüchtigen Schulen
Eisenachs, sowie das gesunde Klima Thüringens dürfte manche Eltern
veranlassen, ihre Knaben einer hiesigen Anstalt anzuvertrauen. Auf ganz
portofreie Anfragen ist Herr Landrabbiner Dr. Heß dahier gern bereit,
nähere Auskunft zu erteilen, sowie auch beim Unterzeichneten das Nähere
zu erfahren ist.
Eisenach, 24. Februar 1862. J. Heidungsfeld,
Lehrer." |
| |
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 15. November 1864: "Pensions-Anstalt zu Eisenach. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 15. November 1864: "Pensions-Anstalt zu Eisenach.
Zu Weihnachten oder Ostern können noch 2 Knaben, welche das Gymnasium
oder das Realgymnasium dahier besuchen sollen, in meinem Hause Aufnahme
finden. Das Nähere ist zu erfahren bei den Herren Bankier Callmann in
Weimar, Kaufmann S. Grünbaum in Rotenburg, Landrabbiner Dr. Heß dahier
sowie beim Unterzeichneten.
J. Heidungsfeld, Lehrer." |
Anzeige
von Lehrer Jakob Heidungsfeld (1873)
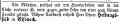 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. März 1873:
"Ein Mädchen, welches mit den Hausarbeiten und in der Küche
vertraut ist, wird gegen guten Lohn von einer ganz kleinen Familie
gesucht. Nähere Auskunft erteilt Herr Lehrer Heidungsfeld in Eisenach". Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. März 1873:
"Ein Mädchen, welches mit den Hausarbeiten und in der Küche
vertraut ist, wird gegen guten Lohn von einer ganz kleinen Familie
gesucht. Nähere Auskunft erteilt Herr Lehrer Heidungsfeld in Eisenach". |
Die
Bildung einer Simultanschule wurde beschlossen (1875)
Anmerkung: es wird nicht gesagt, in welcher Gemeinde im "Oberland"
die Bildung einer Simultanschule beschlossen wurde.
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 10. August 1875: "Eisenach, 21. Juli (Frankfurter
Journal). In unserem Oberlande hat kürzlich eine aus Protestanten und
Juden bestehende Gemeinde die Errichtung einer Simultanschule
beschlossen; die Regierung hat aber wohl die Vereinigung der
Schulgemeinden, nciht aber die der Schulen genehmigt, es sollte vielmehr
der jüdische Lehrer nur die jüdischen Kinder unterrichten dürfen. Dabei
hat sich jedoch der Schulvorstand des Ortes nicht beruhigt und Berufung
eingewendet, von der man sich umso eher einen Erfolg versprechen darf, als
jene auffällige Entscheidung in die Zeit fällt, da der Kultusminister
Stichling noch nicht wieder in die Leitung der Geschäfte eingetreten war.
Das wird aber in der nächsten Zeit schon geschehen, und dann kann man
darauf rechnen, dass die auf Grund des Schulgesetzes zulässige und
berechtigte Vereinigung nicht weiteren Schwierigkeiten
begegnet."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 10. August 1875: "Eisenach, 21. Juli (Frankfurter
Journal). In unserem Oberlande hat kürzlich eine aus Protestanten und
Juden bestehende Gemeinde die Errichtung einer Simultanschule
beschlossen; die Regierung hat aber wohl die Vereinigung der
Schulgemeinden, nciht aber die der Schulen genehmigt, es sollte vielmehr
der jüdische Lehrer nur die jüdischen Kinder unterrichten dürfen. Dabei
hat sich jedoch der Schulvorstand des Ortes nicht beruhigt und Berufung
eingewendet, von der man sich umso eher einen Erfolg versprechen darf, als
jene auffällige Entscheidung in die Zeit fällt, da der Kultusminister
Stichling noch nicht wieder in die Leitung der Geschäfte eingetreten war.
Das wird aber in der nächsten Zeit schon geschehen, und dann kann man
darauf rechnen, dass die auf Grund des Schulgesetzes zulässige und
berechtigte Vereinigung nicht weiteren Schwierigkeiten
begegnet." |
25-jähriges
Dienstjubiläum von Lehrer Heidungsfeld (1889)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Dezember
1889: "Aus Thüringen. Herr Heidungsfeld, israelitischer
Lehrer und Kantor in Eisenach, feierte am 21. November sein
25-jähriges Dienstjubiläum. Die 'Eisenacher Zeitung' berichtet hierüber
Folgendes: Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Dezember
1889: "Aus Thüringen. Herr Heidungsfeld, israelitischer
Lehrer und Kantor in Eisenach, feierte am 21. November sein
25-jähriges Dienstjubiläum. Die 'Eisenacher Zeitung' berichtet hierüber
Folgendes:
'Am 21. dieses Monats feierte Herr Lehrer Heidungsfeld hier sein
25-jähriges Dienstjubiläum. Er hat an der Wiege der hiesigen
Synagogengemeinde gestanden, als dieselbe, aus nur wenigen Mitgliedern
bestehend, im Jahre 1863 ihre Gründung vollzog. Im Jahre 1864 als Lehrer
und Kantor der jungen Gemeinde bestellt, ist er derselben unentwegt treu
geblieben und waltet bereits ein Vierteljahrhundert seines Amtes mit
lobenswertem Fleiße und Eifer. Der durch die rasch angewachsene
Mitgliederzahl der Gemeinde vermehrten Arbeitslast gegenüber hat er sich
stets mit voll ausreichender Tüchtigkeit bewährt, was die Gemeinde auch
durch mehrmalige, den Zeitverhältnissen entsprechende ansehnliche
Gehaltserhöhung dankbar anerkannt hat. Sein friedfertiges Wesen und eine
gegen Jedermann stets bereite Dienstfertigkeit haben ihm allgemeine
Beliebtheit über den Kreis seiner Gemeinde hinaus verschafft. Von Seiten
der israelitischen Gemeinde wurden dem Jubilar durch den Gesamtvorstand
Glückwünsche und ein Geschenk überbracht, was auch später von Seiten
vieler Familien geschah. Der hiesige Synagogenchor brachte Mittwoch Abend
und die Lauterbach'sche Kapelle Donnerstag Morgen dem geehrten Jubilar ein
Ständchen. Möge der wackere Mann seines Amtes noch lange
walten!'
Ich füge dem noch hinzu, dass an dem betreffenden Tage der Landrabbiner,
Herr Dr. Salzer aus Stadtlengsfeld,
sowie auch Herr Lehrer Fackenheim aus Mühlhausen,
letzterer in seiner Eigenschaft als Vorsitzender und Vertreter des
'Vereins jüdischer Kultusbeamten Mitteldeutschlands' hier eintrafen, um
dem Jubilar ihre Glückwünsche zu
überbringen." |
Chanukkafeier
mit den Schülern der Gemeinde und Lehrer Heidungsfeld (1893)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Januar
1893: "Aus Eisenach. Unser wirkungsfreudiger Herr Lehrer
Heidungsfeld hat in diesem Jahre am achten Chanukkaabend der hiesiegn
israelitischen Schuljugend und damit auch der hiesigen israelitischen
Gemeinde, ein so schönes Chanukkafest bereitet, dass dasselbe innerhalb
der Gemeinde mehrere Tage die Unterhaltung beherrschte und überall nur
Äußerungen freudiger Anerkennung und Dankbarkeit laut wurden. Auf
erfolgte Einladung hatte sich abends 1/2 8 Uhr die gesamte Schuljugend und
der größte Teil der Gemeindemitglieder - die Damenwelt war vollständig
vertreten - in dem großen Saale der Tivolirestauration versammelt. Hier
hielt der Herr Heidungsfeld erst eine passende Ansprache über die
Bedeutung des Chanukkafestes. Dann trat ein Knabe vor und zündete die
Chanukkalichter an, nachdem er vorher die üblichen Benedeiungen
gesprochen hatte, worauf dann die sämtlichen Schüler da Maos zur
jeschuati sangen. Es wurden dann noch einige deutsche Gesänge
vorgetragen, an welchen sich auch erwachsene Damen und Herren beteiligten.
Nach diesen trugen die Schüler Deklamationen vor. Die sämtlichen Klassen
der Schule waren vollständig vertreten, und jeder Schüler kam zum
Vortrage. Die durchgängig gut gewählten Deklamationsstücke wurden mit
Verständnis und schöner Betonung zum Ausdrucke gebracht. Die hierauf
folgende Verlosung der für die Schüler bestimmten Geschenke erregte
unter der Jugend ein bunt bewegtes Durcheinander und heiteres Wesen. Ein
kleines Schülerbankett beschloss das Fest, das, wie sich hoffen lässt,
bei Jung und Alt auch für die häusliche Chanukkafeier für die
künftigen Jahre Stimmung gemacht haben wird. Zu wünschen wäre darum,
dass eine solche Feier sich alljährlich wiederhole, und zwar nicht am Schlusse,
sondern beim Beginne, am ersten Abend des Chanukkafestes,
damit der Eindruck derselben der häuslichen Chanukkafeier mehr zugute
komme. Dem Herrn Lehrer Heidungsfeld sei hier noch für die viele auf die
Veranstaltung dieser schönen Chanukkafeier verwendete Mühe unser Dank
ausgesprochen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Januar
1893: "Aus Eisenach. Unser wirkungsfreudiger Herr Lehrer
Heidungsfeld hat in diesem Jahre am achten Chanukkaabend der hiesiegn
israelitischen Schuljugend und damit auch der hiesigen israelitischen
Gemeinde, ein so schönes Chanukkafest bereitet, dass dasselbe innerhalb
der Gemeinde mehrere Tage die Unterhaltung beherrschte und überall nur
Äußerungen freudiger Anerkennung und Dankbarkeit laut wurden. Auf
erfolgte Einladung hatte sich abends 1/2 8 Uhr die gesamte Schuljugend und
der größte Teil der Gemeindemitglieder - die Damenwelt war vollständig
vertreten - in dem großen Saale der Tivolirestauration versammelt. Hier
hielt der Herr Heidungsfeld erst eine passende Ansprache über die
Bedeutung des Chanukkafestes. Dann trat ein Knabe vor und zündete die
Chanukkalichter an, nachdem er vorher die üblichen Benedeiungen
gesprochen hatte, worauf dann die sämtlichen Schüler da Maos zur
jeschuati sangen. Es wurden dann noch einige deutsche Gesänge
vorgetragen, an welchen sich auch erwachsene Damen und Herren beteiligten.
Nach diesen trugen die Schüler Deklamationen vor. Die sämtlichen Klassen
der Schule waren vollständig vertreten, und jeder Schüler kam zum
Vortrage. Die durchgängig gut gewählten Deklamationsstücke wurden mit
Verständnis und schöner Betonung zum Ausdrucke gebracht. Die hierauf
folgende Verlosung der für die Schüler bestimmten Geschenke erregte
unter der Jugend ein bunt bewegtes Durcheinander und heiteres Wesen. Ein
kleines Schülerbankett beschloss das Fest, das, wie sich hoffen lässt,
bei Jung und Alt auch für die häusliche Chanukkafeier für die
künftigen Jahre Stimmung gemacht haben wird. Zu wünschen wäre darum,
dass eine solche Feier sich alljährlich wiederhole, und zwar nicht am Schlusse,
sondern beim Beginne, am ersten Abend des Chanukkafestes,
damit der Eindruck derselben der häuslichen Chanukkafeier mehr zugute
komme. Dem Herrn Lehrer Heidungsfeld sei hier noch für die viele auf die
Veranstaltung dieser schönen Chanukkafeier verwendete Mühe unser Dank
ausgesprochen." |
Chanukkafeier
mit den Schülern der Gemeinde und Lehrer Heidungsfeld (1895)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Januar
1895: "Eisenach. Herr Lehrer Heidungsfeld hielt
vorige Woche mit einen sämtlichen Schülern eine erhebende Chanukkafeier
ab. Vorträge, lebende Bilder und sonstige entsprechende Aufführungen
würzten dieselbe." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Januar
1895: "Eisenach. Herr Lehrer Heidungsfeld hielt
vorige Woche mit einen sämtlichen Schülern eine erhebende Chanukkafeier
ab. Vorträge, lebende Bilder und sonstige entsprechende Aufführungen
würzten dieselbe." |
| |
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Januar
1895: "Eisenach, 31. Dezember (1895). Wie schon in den beiden
vorhergehenden Jahren, so hat auch in diesem Jahre wieder unser Lehrer
Heidungsfeld seinen Schülern und seiner Gemeinde eine schöne Chanukkafeier
veranstaltet. Sie fand in dem großen Tivolisaale, dem größten Saale
hier, statt. Die sämtlichen Mitglieder der hiesigen Gemeinde waren
geladen, sodass der Saal vollständig gefüllt war. Herr Heidungsfeld
hielt darauf einen Vortrag über die Bedeutung des Chanukkafestes. Nach
diesem zündeten die Knaben unter den vorgeschriebenen Lobgebetssprüchen
die Chanukkalichter an, worauf von der Gesamtheit der Kinderschar das Maos
Zur gesungen wurde. Darauf zog sich da Schülerkorps hinter die Kulissen
zurück, von wo sie einzeln hervortraten, ein jeder, um die ihm zugewiesene
Rolle abzuspielen. Diese bestand in dem Vortrag je eines kleineren oder
größeren Gedichts, teils religiösen, teils humoristischen Inhalts. Sie
kamen alle einzeln an die Reihe. Man musste wirklich das Exakte der ganzen
Ausführung, die Unbefangenheit und Sicherheit des Auftretens der Kinder
und das freudestrahlende Gesicht, mit welchem ein jedes derselben an die
Rampe trat, um das ihm zugeteilte Pensum vorzutragen, bewundern, Den
Schluss dieses ersten Teiles der Feier bildete, nachdem ein Knabe den
Prolog hierzu vorgetragen hatte, ein lebendes Bild, welches den Traum
unseres Erzvaters Jakob darstellte. Der zweite Teil der Feier, obgleich anderer
Art, war doch ganz dazu angetan, die gute Stimmung aufrecht zu erhalten.
Er brachte den Kindern eine Bewirtung mit Schokolade und Brezeln, welcher
ein Kinderball folgte. Die ganze Gemeinde ist begeistert von dem schönen
Verlauf dieser Chanukkafeier. Es wird diese Feier auch hoffentlich nicht
wieder aus dem Chanukkafest-Programm der hiesigen Gemeinde schwinden,
sondern eine bleibende Stätte in demselben behalten. Sie ist ganz allein
aus der Initiative des Herrn Heidungsfeld hervorgegangen, und die ganze
Arbeit lag in seiner Hand. Die hiesige Gemeinde hat in Herrn Heidungsfeld
einen Kultusbeamten, der mit einer fast unverwüstlichen Arbeitskraft
begabt ist, sobald es gilt, der Weckung des religiösen Sinnes innerhalb
seiner Gemeinde neuen Sporn und Anlass zu verschaffen." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Januar
1895: "Eisenach, 31. Dezember (1895). Wie schon in den beiden
vorhergehenden Jahren, so hat auch in diesem Jahre wieder unser Lehrer
Heidungsfeld seinen Schülern und seiner Gemeinde eine schöne Chanukkafeier
veranstaltet. Sie fand in dem großen Tivolisaale, dem größten Saale
hier, statt. Die sämtlichen Mitglieder der hiesigen Gemeinde waren
geladen, sodass der Saal vollständig gefüllt war. Herr Heidungsfeld
hielt darauf einen Vortrag über die Bedeutung des Chanukkafestes. Nach
diesem zündeten die Knaben unter den vorgeschriebenen Lobgebetssprüchen
die Chanukkalichter an, worauf von der Gesamtheit der Kinderschar das Maos
Zur gesungen wurde. Darauf zog sich da Schülerkorps hinter die Kulissen
zurück, von wo sie einzeln hervortraten, ein jeder, um die ihm zugewiesene
Rolle abzuspielen. Diese bestand in dem Vortrag je eines kleineren oder
größeren Gedichts, teils religiösen, teils humoristischen Inhalts. Sie
kamen alle einzeln an die Reihe. Man musste wirklich das Exakte der ganzen
Ausführung, die Unbefangenheit und Sicherheit des Auftretens der Kinder
und das freudestrahlende Gesicht, mit welchem ein jedes derselben an die
Rampe trat, um das ihm zugeteilte Pensum vorzutragen, bewundern, Den
Schluss dieses ersten Teiles der Feier bildete, nachdem ein Knabe den
Prolog hierzu vorgetragen hatte, ein lebendes Bild, welches den Traum
unseres Erzvaters Jakob darstellte. Der zweite Teil der Feier, obgleich anderer
Art, war doch ganz dazu angetan, die gute Stimmung aufrecht zu erhalten.
Er brachte den Kindern eine Bewirtung mit Schokolade und Brezeln, welcher
ein Kinderball folgte. Die ganze Gemeinde ist begeistert von dem schönen
Verlauf dieser Chanukkafeier. Es wird diese Feier auch hoffentlich nicht
wieder aus dem Chanukkafest-Programm der hiesigen Gemeinde schwinden,
sondern eine bleibende Stätte in demselben behalten. Sie ist ganz allein
aus der Initiative des Herrn Heidungsfeld hervorgegangen, und die ganze
Arbeit lag in seiner Hand. Die hiesige Gemeinde hat in Herrn Heidungsfeld
einen Kultusbeamten, der mit einer fast unverwüstlichen Arbeitskraft
begabt ist, sobald es gilt, der Weckung des religiösen Sinnes innerhalb
seiner Gemeinde neuen Sporn und Anlass zu verschaffen." |
Anzeige
des Hotels Waldhaus mit Referenz von Prediger und Lehrer E. Meyer (1901)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 11. Januar 1901: Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 11. Januar 1901:
"Hotel Waldhaus, Eisenach.
Zur Abhaltung von Hochzeiten, streng rituell unter Aufsicht des
Predigers und Lehrers Herrn E. Meyer, empfiehlt sein gut renommiertes
Etablissement I. Ranges, in hervorragend schöner Lage.
P. Menzel, Besitzer.
Referenz erteilt E. Meyer, Prediger der israelitischen
Religionsgemeinde." |
Aus der Geschichte des
Landrabbinates (seit 1912 in Eisenach)
Sitz des Landrabbinates war von 1824 bis 1912 in Stadtlengsfeld, danach in
Eisenach (Landrabbinat Sachsen-Weimar-Eisenach). Es umfasste zuletzt die
Gemeinden Apolda, Aschenhausen, Eisenach, Gehaus, Geisa, Jena, Ilmenau,
Stadtlengsfeld, Vacha und Weimar. Landrabbiner Dr. Wiesen verlegte 1912 den
Rabbinatssitz von Stadtlengsfeld nach Eisenach.
Anzeigen
von Landrabbiner Dr. Mendel Heß (1847 / 1848)
Anmerkung: Rabbiner Mendel Heß war von 1829 bis 1871 Landrabbiner
des Landrabbinates Sachsen-Weimar-Eisenach (geb. 1807 in
Stadtlengsfeld als Sohn von Rabbiner Isaac Kugelmann Heß, gest. 1871 in
Eisenach), studierte in Würzburg; 1827 Rückkehr nach Stadtlengsfeld; seit 1829
Landrabbiner für Sachsen-Weimar-Eisenach; verlegte seinen Wohnsitz und
Rabbinatssitz 1846 nach Eisenach; war seit März 1863 gelähmt und wurde von dem
Lehrer Löwenstein jun. vertreten.
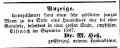 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 11. Oktober 1847: "Anzeige. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 11. Oktober 1847: "Anzeige.
Unterzeichneter kann einen sehr gebildeten jungen Mann zu der Stelle eines
Hauslehrers oder bei einer Gemeinde, insonders in einer großen Stadt, empfehlen.
Eisenach im September 1847.
Dr. M. Heß, großherzoglich weimarischer
Landrabbiner". |
| |
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 18. September 1848: "Anzeige. Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 18. September 1848: "Anzeige.
Einer israelitischen Familie, die einen aufgeklärten, methodisch
gebildeten Hauslehrer sucht, kann ich einen solchen empfehlen.
Eisenach, den 4. September 1848. Dr. M. Heß, großherzoglich
weimarischer Landesrabbiner." |
Zum
Tod von Landrabbiner Dr. Mendel Heß (1871, zuletzt in Eisenach wohnhaft)
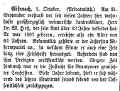 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Oktober
1871: "Eisenach, 1. Oktober (1871). Am 21. September verstarb
der seit vielen Jahren hier wohnhafte großherzoglich weimarische
Landrabbiner, Herr Dr. M. Heß, der sein Amt über 43 Jahre
bekleidet. Er war 1807 geboren, erreichte also ein Alter von 64 Jahren.
Bekanntlich gehörte er der äußersten Reformpartei an, in welchem Sinne
er auch eine Zeit lang eine Zeitschrift herausgab. Außerdem sind von ihm
Predigten veröffentlicht worden. Längere Zeit hindurch war er die
Zuflucht für Brautpaare gemischter Konfession. Viele Jahre leidend, hielt
er sich während des letzten Stadiums seines Lebens von der
Öffentlichkeit zurückgezogen." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Oktober
1871: "Eisenach, 1. Oktober (1871). Am 21. September verstarb
der seit vielen Jahren hier wohnhafte großherzoglich weimarische
Landrabbiner, Herr Dr. M. Heß, der sein Amt über 43 Jahre
bekleidet. Er war 1807 geboren, erreichte also ein Alter von 64 Jahren.
Bekanntlich gehörte er der äußersten Reformpartei an, in welchem Sinne
er auch eine Zeit lang eine Zeitschrift herausgab. Außerdem sind von ihm
Predigten veröffentlicht worden. Längere Zeit hindurch war er die
Zuflucht für Brautpaare gemischter Konfession. Viele Jahre leidend, hielt
er sich während des letzten Stadiums seines Lebens von der
Öffentlichkeit zurückgezogen." |
Dr.
Josef Wiesen wird neuer Landrabbiner (1902, damals noch Rabbinatssitz in
Stadtlengsfeld)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. September
1902: "Eisenach, 28. August (1902). Zum Landrabbiner des
Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach wurde an Stelle des verstorbenen
Dr. Salzer - Stadtlengsfeld Herr Dr. Wiesen - Böhmisch Leipa
gewählt. Die ministerielle Bestätigung dieser Wahl ist bereits erfolgt.
Der Landesrabbiner wird künftig seinen Wohnsitz in Eisenach nehmen. Herr
Dr. Wiesen ist ein Sohn des verstorbenen Lehrers Wiesen in Osterode, der
sich durch die Herausgabe des hebräischen Lesebuches mit
gegenüberstehendem hebräischen Text sowie durch seinen Verlag von
Bildern großer jüdischer Männer rühmlichst bekannt gemacht
hat." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. September
1902: "Eisenach, 28. August (1902). Zum Landrabbiner des
Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach wurde an Stelle des verstorbenen
Dr. Salzer - Stadtlengsfeld Herr Dr. Wiesen - Böhmisch Leipa
gewählt. Die ministerielle Bestätigung dieser Wahl ist bereits erfolgt.
Der Landesrabbiner wird künftig seinen Wohnsitz in Eisenach nehmen. Herr
Dr. Wiesen ist ein Sohn des verstorbenen Lehrers Wiesen in Osterode, der
sich durch die Herausgabe des hebräischen Lesebuches mit
gegenüberstehendem hebräischen Text sowie durch seinen Verlag von
Bildern großer jüdischer Männer rühmlichst bekannt gemacht
hat." |
Einführung
des neuen Landrabbiners in Stadtlengsfeld mit einer Feier in Eisenach (1902)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. November
1902: "Eisenach, 1. November (1902). Die Einführung des neuen
Landrabbiners unseres Großherzogtums fand am 14. vorigen Monats in
feierlicher Weise in Stadtlengsfeld statt. Die würdige Feier, zu der die
verschiedenen Staats- und städtischen Beamten sowie die
Gemeindevertretungen und Lehrer aus allen Kultusgemeinden eingeladen und
erschienen waren, machte auf alle Anwesenden einen tiefen Eindruck. Unter
Führung des großherzoglichen Bezirksdirektors Herrn Geheimen
Regierungsrat Schmidt aus Dermbach und des Kultusvorstehers Herrn Jakob
Huhn aus Stadtlengsfeld bewegte sich der Zug von der Wohnung des Herrn
Landrabbiners Dr. J. Wiesen in die festlich geschmückte Synagoge, wo der
festliche Akt vollzogen wurde. - Nach vorausgegangenem Minchagebet hielt
Herr Dr. Wiesen eine treffliche Antrittspredigt. Er entwickelte in zu
Herzen gehender Rede sein Programm und legte zum Schlusse das Gelöbnis
ab, sein Amt nciht nur als eine Würde, sondern auch als einen Dienst
aufzufassen, dem er alle seine Kräfte widmen wolle. - Nun ergriff der
Herr Bezirksdirektor das Wort, um unter Vorlesung der Bestellungsurkunde
Herrn Dr. Wiesen in sein neues Amt einzuführen. Besonders anerkennende
und ehrende Worte widmete der Herr Bezirksdirektor dem verewigten
Landrabbiner Dr. Salzer, den er als einen Mann von seltener Herzensgüte,
von reinem und makellosem Charakter in mehr denn 20-jähriger gemeinsamer
Arbeit schätzen und lieben gelernt habe. Nachdem Herr Landrabbiner Dr.
Wiesen den Segen für das Fürstenhaus, für Kaiser und Reich gesprochen
hatte, schloss die Feier mit dem Gesange: Lobe den Herren. - Im Anschluss
an obigen Bericht referiere ich gleichzeitig über die am Freitag, den 31.
Oktober und Sonnabend, den 1. November stattgehabte Feier in der
Gemeinde Eisenach. Am Freitag, nach vollzogenem Minchagebet, wurde der
Herr Landrabbiner von dem Vorsteher der hiesigen Gemeinde, Herrn Leopold
Kuh, und den Deputierten vom Sitzungszimmer aus nach seinem Platze in der
Synagoge geleitet. Der Synagogenchor begrüßte den Herrn Landrabbiner mit
dem 'Boruch habo'. Alsdann ergriff Herr Leopold Kuh das Wort, um als
erster Vorsteher namens der Gemeinde Herrn Dr. Wiesen als neuen
Landrabbiner herzlich zu begrüßen. Dr. Wiesen dankte in bewegten Worten
für die ihm erwiesenen Aufmerksamkeiten und Ehrungen. In besonders
herzlicher Weise betonte der Redner, dass er mit vollem Herzen den
Gemeinden entgegenkomme; dass er Vertrauen und Liebe mitbringe und solches
auch wieder zu finden hoffe. - Der Abendgottesdienst gestaltete sich unter
Mitwirkung des Synagogenchores besonders feierlich. Am Sabbath hielt dann
der Herr Landrabbiner seine Antrittspredigt, die nach Form und Inhalt
vorzüglich war und tiefen Eindruck bei allen Zuhörern machte. Der
neuernannte Landrabbiner hat sich im Fluge die Herzen der Israeliten im
Großherzogtum erobert. Man sieht in ihm den wahren und berufenen
Nachfolger des unvergesslichen Landrabbiners Dr. Salzer, einen echten Schüler
Ahrons, der den Frieden liebt und ein treuer, friedlicher Seelenhirte
allen Gemeinden des Großherzogtums sein
wird." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. November
1902: "Eisenach, 1. November (1902). Die Einführung des neuen
Landrabbiners unseres Großherzogtums fand am 14. vorigen Monats in
feierlicher Weise in Stadtlengsfeld statt. Die würdige Feier, zu der die
verschiedenen Staats- und städtischen Beamten sowie die
Gemeindevertretungen und Lehrer aus allen Kultusgemeinden eingeladen und
erschienen waren, machte auf alle Anwesenden einen tiefen Eindruck. Unter
Führung des großherzoglichen Bezirksdirektors Herrn Geheimen
Regierungsrat Schmidt aus Dermbach und des Kultusvorstehers Herrn Jakob
Huhn aus Stadtlengsfeld bewegte sich der Zug von der Wohnung des Herrn
Landrabbiners Dr. J. Wiesen in die festlich geschmückte Synagoge, wo der
festliche Akt vollzogen wurde. - Nach vorausgegangenem Minchagebet hielt
Herr Dr. Wiesen eine treffliche Antrittspredigt. Er entwickelte in zu
Herzen gehender Rede sein Programm und legte zum Schlusse das Gelöbnis
ab, sein Amt nciht nur als eine Würde, sondern auch als einen Dienst
aufzufassen, dem er alle seine Kräfte widmen wolle. - Nun ergriff der
Herr Bezirksdirektor das Wort, um unter Vorlesung der Bestellungsurkunde
Herrn Dr. Wiesen in sein neues Amt einzuführen. Besonders anerkennende
und ehrende Worte widmete der Herr Bezirksdirektor dem verewigten
Landrabbiner Dr. Salzer, den er als einen Mann von seltener Herzensgüte,
von reinem und makellosem Charakter in mehr denn 20-jähriger gemeinsamer
Arbeit schätzen und lieben gelernt habe. Nachdem Herr Landrabbiner Dr.
Wiesen den Segen für das Fürstenhaus, für Kaiser und Reich gesprochen
hatte, schloss die Feier mit dem Gesange: Lobe den Herren. - Im Anschluss
an obigen Bericht referiere ich gleichzeitig über die am Freitag, den 31.
Oktober und Sonnabend, den 1. November stattgehabte Feier in der
Gemeinde Eisenach. Am Freitag, nach vollzogenem Minchagebet, wurde der
Herr Landrabbiner von dem Vorsteher der hiesigen Gemeinde, Herrn Leopold
Kuh, und den Deputierten vom Sitzungszimmer aus nach seinem Platze in der
Synagoge geleitet. Der Synagogenchor begrüßte den Herrn Landrabbiner mit
dem 'Boruch habo'. Alsdann ergriff Herr Leopold Kuh das Wort, um als
erster Vorsteher namens der Gemeinde Herrn Dr. Wiesen als neuen
Landrabbiner herzlich zu begrüßen. Dr. Wiesen dankte in bewegten Worten
für die ihm erwiesenen Aufmerksamkeiten und Ehrungen. In besonders
herzlicher Weise betonte der Redner, dass er mit vollem Herzen den
Gemeinden entgegenkomme; dass er Vertrauen und Liebe mitbringe und solches
auch wieder zu finden hoffe. - Der Abendgottesdienst gestaltete sich unter
Mitwirkung des Synagogenchores besonders feierlich. Am Sabbath hielt dann
der Herr Landrabbiner seine Antrittspredigt, die nach Form und Inhalt
vorzüglich war und tiefen Eindruck bei allen Zuhörern machte. Der
neuernannte Landrabbiner hat sich im Fluge die Herzen der Israeliten im
Großherzogtum erobert. Man sieht in ihm den wahren und berufenen
Nachfolger des unvergesslichen Landrabbiners Dr. Salzer, einen echten Schüler
Ahrons, der den Frieden liebt und ein treuer, friedlicher Seelenhirte
allen Gemeinden des Großherzogtums sein
wird." |
Auszeichnung
für Landrabbiner Dr. Wiesen (1912)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 1. November 1912: "Eisenach. Landrabbiner Dr.
Wiesen hat das Ritterkreuz 2. Klasse des Großherzoglichen
Sächsischen Hausordens erhalten." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 1. November 1912: "Eisenach. Landrabbiner Dr.
Wiesen hat das Ritterkreuz 2. Klasse des Großherzoglichen
Sächsischen Hausordens erhalten." |
Aus dem jüdischen
Gemeinde- und Vereinsleben
Über
die Wiedereinführung des deutschen Gottesdienstes bei den jüdischen Gemeinden
des Großherzogtums Weimar (Artikel von Landesrabbiner Dr. M. Heß, 1850)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 2. September 1850: "Eisenach, 21. August (1850).
Durch Zufall kömmt mir erst jetzt Nr. 30 der Allgemeinen Zeitung des
Judentums zu, in welche sich ein der Vossischen Zeitung entlehnter Artikel
über die Wiedereinführung des deutschen Gottesdienstes bei den
jüdischen Gemeinden des Großherzogtums Weimar befindet, der einer
wesentlichen Berichtigung bedarf. - Das Sachverhältnis ist nämlich
Folgendes:
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 2. September 1850: "Eisenach, 21. August (1850).
Durch Zufall kömmt mir erst jetzt Nr. 30 der Allgemeinen Zeitung des
Judentums zu, in welche sich ein der Vossischen Zeitung entlehnter Artikel
über die Wiedereinführung des deutschen Gottesdienstes bei den
jüdischen Gemeinden des Großherzogtums Weimar befindet, der einer
wesentlichen Berichtigung bedarf. - Das Sachverhältnis ist nämlich
Folgendes:
Bereits im Jahre 1823, noch vor meiner Anstellung, erschien im
Großherzogtum Weimar das Gesetz, wonach der Gottesdienst der Juden in
deutscher Sprache abgehalten werden solle; später ward jedoch denjenigen
Israeliten, welchen hebräische Andachtübungen noch Bedürfnis, diese in
einem gewissen Umfange nachgelassen. Allein nach Promulgation der
Grundrechte führten die Orthodoxen den ganz alten hebräischen
Gottesdienst wieder ein, ohne auch nur der Regierung eine Notiz davon zu
geben, oder sich mit dem Landrabbinate zu benehmen. Inzwischen war des
Gesetz über die bürgerliche und politische Gleichstellung der Juden
erschienen, welches jedoch hinsichtlich des Kirchen- und Schulwesens es
bei der bisherigen Gesetzgebung belässt. Auf dem Grund dieser Bestimmung
ward nun die Einschärfung jenes seit 1823 bestehenden Gesetzes kürzlich
dem Landrabbinate vom Ministerium aufgegeben. - Indes haben sich nun beide
Parteien in den Gemeinden dem von dem Landrabbiante bereits im Februar
1848 hinsichtlich der Anwendung des hebräischen und deutschen Elements
beim Gottesdienste der Regierung gemachten Vorschlage angeschlossen, und ist
auch alle Hoffnung vorhanden, dass diese nunmehr denselben genehmigen
werde.
Dr. M. Heß, großherzoglich weimarscher Landrabbiner." |
Kritik
an einer "Mischehe" durch Rabbiner Dr. Heß (1867)
Anmerkung: in Nr. 20 des "Ben Chananja" von 1867 konnte - nach
Einsehen in www.compactmemory.de kein
Bericht gefunden werden, daher wird nur dieser zitiert.
 Artikel
in der Zeitschrift "Ben Chananja" vom 1. Dezember
1867: "Die in unserm Berichte Nr. 20 dieses Blattes beregte
Mischehe fand zu Eisenach am 20. vorigen Monats, d.i. Hoschana Rabba
statt, und verdient sie schon des Festtages wegen dem Namen 'Mischehe'
(hebräisch: 'man soll nicht eine Freude mit der anderen vermischen'*).
Da wir von dem Trauungsakte einer solchen Ehe keinen Begriff hatten, haben
wir uns Auskunft von dem christlichen Bräutigam erbeten, welche
vielleicht auch unsere Leser interessiert. Artikel
in der Zeitschrift "Ben Chananja" vom 1. Dezember
1867: "Die in unserm Berichte Nr. 20 dieses Blattes beregte
Mischehe fand zu Eisenach am 20. vorigen Monats, d.i. Hoschana Rabba
statt, und verdient sie schon des Festtages wegen dem Namen 'Mischehe'
(hebräisch: 'man soll nicht eine Freude mit der anderen vermischen'*).
Da wir von dem Trauungsakte einer solchen Ehe keinen Begriff hatten, haben
wir uns Auskunft von dem christlichen Bräutigam erbeten, welche
vielleicht auch unsere Leser interessiert.
Das Landesgesetz zu Weimar stellt es dem Brautpaar anheim, sich nach einer
der beiden Kulten gültig trauen zu lassen, und die Gäste bestimmten sich
für die jüdische. Das zu trauende Brautpaar wurde von der beiderseitigen
Verwandtschaft in die Synagoge und unter den Trauhimmel geleitet, wo sie
Rabbiner Dr. Heß mit zwei Zeugen erwartete. Der Bräutigam bedeckte sich
das Haupt (!!). Nachdem Herr Rabbiner das Brautpaar zu gegenseitigem
Vertrauen, zu den Pflichten, welche es sich gegenseitig durch den Mund
auferlegte, in ergreifender Weise ermahnte, sprach er einen längeren
hebräischen Spruch (wahrscheinlich die üblichen Eulogien) über den
Becher, den er früher der Braut und dann dem Bräutigam zum Trunke
reichte. Das Brautpaar wechselte Ringe, während Herr Rabbiner einen
kurzen hebräischen Satz sprach, den er mit den Worten übersetzte: Sei
mir getraut N.N. und welche er von dem Bräutigam zur Braut gekehrt,
nachsprechen ließ. Herr Rabbiner sprach hierauf wieder die üblichen
Eulogien und trank aus dem Becher.
Das Brautpaar legte Hand in Hand, welche der Herr Rabbiner ergriff und
sprach: Kraft der mosaischen Religion und Kraft des großherzoglich
weimarischen Staatsgesetzes ist die Ehe geschlossen! Hierauf folgte der
Segen, die Zeremonie war zu Ende, welche Herr Rabbiner Dr. Heß als die
33. von ihm vollzogene Mischehe zählt.
Löwy." |
| *) Jacob Levy Wörterbuch über die Talmudim
und Midraschim 1924 Bd. 3 S. 690. |
Ergänzung
zum Gemeindestatut und Mitteilung des Todes der Witwe von Landrabbiner Dr. Heß
(1878)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Oktober
1878: "In Eisenach hat das Gemeindestatut, das langjährige
Streitobjekt zwischen Synagogenvorstand und Landrabbinat, endlich die
landesherrliche Genehmigung erhalten, jedoch mit dem wohlweißlichen
Zusatze: 'Bis auf Weiteres und unter dem allgemeinen Vorbehalt der dem
Großherzoglichen Landrabbiner über die jüdischen Schulen, Synagogen,
milden Stiftungen und Armenanstalten gesetzlich zustehenden Aufsicht, wie
des Aufsichtsrechts der Großherzoglichen Aufsichtsbehörde und des
Großherzoglichen Staatsministeriums.' Hoffentlich werden sich auf Grund
dieses Zusatzes die dem Statute noch anhaftenden Mängel weniger fühlbar
machen lassen. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Oktober
1878: "In Eisenach hat das Gemeindestatut, das langjährige
Streitobjekt zwischen Synagogenvorstand und Landrabbinat, endlich die
landesherrliche Genehmigung erhalten, jedoch mit dem wohlweißlichen
Zusatze: 'Bis auf Weiteres und unter dem allgemeinen Vorbehalt der dem
Großherzoglichen Landrabbiner über die jüdischen Schulen, Synagogen,
milden Stiftungen und Armenanstalten gesetzlich zustehenden Aufsicht, wie
des Aufsichtsrechts der Großherzoglichen Aufsichtsbehörde und des
Großherzoglichen Staatsministeriums.' Hoffentlich werden sich auf Grund
dieses Zusatzes die dem Statute noch anhaftenden Mängel weniger fühlbar
machen lassen.
Am zweiten Tage von Rosch Haschana (Neujahresfest) wurde hier Frau
Dr. Heß, Witwe des verstorbenen Landrabbinern Dr. Heß begraben. Sie war
in Halle an der Saale gestorben, ihre Leiche wurde aber, vermutlich vorher
geäußerten Wunsche gemäß, per Bahn hierher gebracht." |
Antisemitischer
Prozess vor der Strafkammer in Eisenach (1884)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juni
1884: "Aus Thüringen. Am 12. dieses Monats (12. Juni
1884) spielte, wie bereits kurz berichtet, vor der Strafkammer in Eisenach
ein antisemitischer Pressprozess, dessen Ausgang es wohl verdient, Notiz
von ihm zu nehmen. Der Redakteur der in Kaltennordheim erscheinenden 'Feldazeitung',
eines wenig verbreiteten Blättchens, Herr Unglaube, hat schon seit
einiger Zeit in demselben Stilübungen in antisemitischen Hetzartikeln zu
Tage gefordert. So brachte er auch vor Kurzem eine Blumenlese aus dem
Talmud, durch welche nachgewiesen werden sollte, dass es den Juden erlaubt
sei, die Christen zu belügen und zu betrügen usw. Diesen Unglaublichkeiten
fügte er die Bemerkung hinzu, dass der Talmud das Gesetzbuch der Juden
sei, dessen Vorschriften, also auch die von ihm angeführten, alle Juden
befolgen. Der Landrabbiner, Herr Dr. Salzer in Stadtlengsfeld,
machte ihn brieflich darauf aufmerksam, dass seine Blumenlese lauter
Unwahrheit enthalte und ersuchte ihn, dieselben zu widerrufen,
widrigenfalls er genötigt sein würde, der Staatanwaltschaft Anzeige zu
machen. Anstatt des Widerrufes ließ Herr Unglaube einen neuen, nciht
minder gehässigen Artikel vom Stapel. Herr Dr. Salzer legte hierauf diese
Angelegenheit in die Hände des Großherzoglichen Staatsanwaltes. Am 12.
dieses Monats fand die strafgerichtliche Verhandlung und die Vernehmung
des vom Gerichte erwählten Sachverständigen, des Redakteurs der
'Eisenacher Zeitung', Herrn Löwenheim, statt. da derselbe zwar die
Behauptungen des Herrn Unglaube verneinte, aber doch erklärte den Talmud
nicht genau zu kennen, so trug der Anwalt des Herrn Unglaube auf Vorladung
eines andern Sachverständigen an und schlug zu diesem Zwecke einen
Professor in Münster, der in einem ähnlichen Prozesse vernommen wurde,
vor. Der Staatsanwalt widersprach diesem Ansuchen überhaupt und
namentlich noch in Bezug auf den genannten Herrn. Die Akten des
Münster'schen Prozesses in ähnlicher Angelegenheit lagen dem Gerichte
vor, in diesem aber fände sich die Erklärung des erwähnten
Sachverständigen, dass ihm eine genauere Kenntnis des Talmuds, sowie des
talmudischen Idioms abgehe. Es sei die bei den Akten liegende
Erklärung des Herrn Landrabbinen, dass die betreffenden Behauptungen sich
im Talmud durchaus nicht vorfinden und vollständig aus der Luft gegriffen
seien, als ein autoratives und genügendes Sachverständigenurteil
anzusehen; sollte aber das Gericht dennoch einen Sachverständigen hören
wollen, so schlage er Herrn Professor Dr. Delitzsch in Leipzig
vor, der auf diesem Gebiete eine anerkannte Autorität sei. Der
Gerichtshof erklärte die Vernehmung noch eines Sachverständigen für
unnötig. Herr Staatsanwalt Siefert führte ferner aus: Da der sehr
beschränkte Leserkreis des in Rede stehenden Blättchens die nachteilige
Wirkung seines Inhaltes mindere, und da Herr Unglaube selbst erklärt
habe, seine Anführungen aus einer antisemitischen Zeitung entnommen zu
haben, und diese sich, wie der Herr Staatsanwalt sich mit Recht
ausdrückte, sonderbarer Weise 'Die Wahrheit' nenne, so sei anzunehmen,
dass er in gutem Glauben gehandelt habe und sei daher von einer Bestrafung
anzusehen. Die Behauptung des Herrn Unglaube aber, dass alle Juden nach
diesen Talmudgesetzen handeln, sei eine strafbare Beleidigung der Juden
und er beantrage deshalb gegen den Redakteur, Herrn Unglaube, die
Zuerkennung einer vierwöchentlichen Gefängnisstrafe. Der Gerichtshof
entschied diesem Antrage gemäß. Herr Unglaube musste noch die Bemerkung
des Herrn Staatsanwaltes hinnehmen, dass sein Antisemitismus wohl seinen
Grund in dem Umstande habe, dass ein Jude in Kaltennordheim die für ihn
beim Vorschussvereine eingegangene Bürgschaft zurückgezogen
habe." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juni
1884: "Aus Thüringen. Am 12. dieses Monats (12. Juni
1884) spielte, wie bereits kurz berichtet, vor der Strafkammer in Eisenach
ein antisemitischer Pressprozess, dessen Ausgang es wohl verdient, Notiz
von ihm zu nehmen. Der Redakteur der in Kaltennordheim erscheinenden 'Feldazeitung',
eines wenig verbreiteten Blättchens, Herr Unglaube, hat schon seit
einiger Zeit in demselben Stilübungen in antisemitischen Hetzartikeln zu
Tage gefordert. So brachte er auch vor Kurzem eine Blumenlese aus dem
Talmud, durch welche nachgewiesen werden sollte, dass es den Juden erlaubt
sei, die Christen zu belügen und zu betrügen usw. Diesen Unglaublichkeiten
fügte er die Bemerkung hinzu, dass der Talmud das Gesetzbuch der Juden
sei, dessen Vorschriften, also auch die von ihm angeführten, alle Juden
befolgen. Der Landrabbiner, Herr Dr. Salzer in Stadtlengsfeld,
machte ihn brieflich darauf aufmerksam, dass seine Blumenlese lauter
Unwahrheit enthalte und ersuchte ihn, dieselben zu widerrufen,
widrigenfalls er genötigt sein würde, der Staatanwaltschaft Anzeige zu
machen. Anstatt des Widerrufes ließ Herr Unglaube einen neuen, nciht
minder gehässigen Artikel vom Stapel. Herr Dr. Salzer legte hierauf diese
Angelegenheit in die Hände des Großherzoglichen Staatsanwaltes. Am 12.
dieses Monats fand die strafgerichtliche Verhandlung und die Vernehmung
des vom Gerichte erwählten Sachverständigen, des Redakteurs der
'Eisenacher Zeitung', Herrn Löwenheim, statt. da derselbe zwar die
Behauptungen des Herrn Unglaube verneinte, aber doch erklärte den Talmud
nicht genau zu kennen, so trug der Anwalt des Herrn Unglaube auf Vorladung
eines andern Sachverständigen an und schlug zu diesem Zwecke einen
Professor in Münster, der in einem ähnlichen Prozesse vernommen wurde,
vor. Der Staatsanwalt widersprach diesem Ansuchen überhaupt und
namentlich noch in Bezug auf den genannten Herrn. Die Akten des
Münster'schen Prozesses in ähnlicher Angelegenheit lagen dem Gerichte
vor, in diesem aber fände sich die Erklärung des erwähnten
Sachverständigen, dass ihm eine genauere Kenntnis des Talmuds, sowie des
talmudischen Idioms abgehe. Es sei die bei den Akten liegende
Erklärung des Herrn Landrabbinen, dass die betreffenden Behauptungen sich
im Talmud durchaus nicht vorfinden und vollständig aus der Luft gegriffen
seien, als ein autoratives und genügendes Sachverständigenurteil
anzusehen; sollte aber das Gericht dennoch einen Sachverständigen hören
wollen, so schlage er Herrn Professor Dr. Delitzsch in Leipzig
vor, der auf diesem Gebiete eine anerkannte Autorität sei. Der
Gerichtshof erklärte die Vernehmung noch eines Sachverständigen für
unnötig. Herr Staatsanwalt Siefert führte ferner aus: Da der sehr
beschränkte Leserkreis des in Rede stehenden Blättchens die nachteilige
Wirkung seines Inhaltes mindere, und da Herr Unglaube selbst erklärt
habe, seine Anführungen aus einer antisemitischen Zeitung entnommen zu
haben, und diese sich, wie der Herr Staatsanwalt sich mit Recht
ausdrückte, sonderbarer Weise 'Die Wahrheit' nenne, so sei anzunehmen,
dass er in gutem Glauben gehandelt habe und sei daher von einer Bestrafung
anzusehen. Die Behauptung des Herrn Unglaube aber, dass alle Juden nach
diesen Talmudgesetzen handeln, sei eine strafbare Beleidigung der Juden
und er beantrage deshalb gegen den Redakteur, Herrn Unglaube, die
Zuerkennung einer vierwöchentlichen Gefängnisstrafe. Der Gerichtshof
entschied diesem Antrage gemäß. Herr Unglaube musste noch die Bemerkung
des Herrn Staatsanwaltes hinnehmen, dass sein Antisemitismus wohl seinen
Grund in dem Umstande habe, dass ein Jude in Kaltennordheim die für ihn
beim Vorschussvereine eingegangene Bürgschaft zurückgezogen
habe." |
Gründung
eines Männervereins "Chebra-Gemilut-Chassadim" (Wohltätigkeits- und
Bestattungsverein, 1885)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juli
1885: "Aus Thüringen. Die israelitische Gemeinde in Eisenach,
die erst seit ungefähr 20 Jahren zu einer solchen herangewachsen ist,
ermangelte bis jetzt noch mancher Institution, wie sie eben im Leben einer
größeren jüdischen Gemeinschaft unentbehrlich sind, und die darum auch
in keiner solchen älteren Datums fehlen. Seit der Erbauung der neuen
Synagoge ist in dieser Beziehung hier bereits einige Besserung
eingetreten. Es fängt ein gewisser Kehilasinn (Gemeindesinn) an, sich zu
regen und geltend zu machen. Zeugnis hiervor gibt die jüngst
stattgefundene Errichtung eines Männervereins 'Chebra-Gemilut-Chassadim',
an welchem der weitaus größte Teil der Gemeindeglieder sich beteiligt
haben. Zweck desselben ist gegenseitige Beihilfe in Krankheits- und
Sterbefällen, sowohl durch geldliche Unterstützung der von solchen
Fällen betroffenen bedürftigen Vereinsmitglieder, als auch durch
selbsttätige Mitwirkung bei den bei Totenbestattungen üblichen
Observanzen. Ich will nicht behaupten, dass alle Beigetretenen im Voraus
schon entschossen seien, dieser letzteren Verpflichtung auch wirklich
nachzukommen, glaube vielmehr, dass mancher, wenn die Reihenfolge ihn
trifft, lieber den für den Fall festgesetzten Strafbetrag erlegen werde.
Unter unserer jetzigen Generation sind es ja leider viele, welche sich der
Übung solcher Liebespflichten entziehen, weil sie glauben, den Horror vor
der Berührung einer Leiche nicht überwinden zu können, oder weil sie
sich für so etwas für zu gut oder gar für 'zu gebildet' halten; aber es
will doch jeder gern die beruhigende Gewissheit haben, wenn für ihn
einmal die Stunde zur großen Reise ins Jenseits schlägt,
vorschriftsmäßig behandelt zu werden. Dem sei indessen wie ihm wolle; es
ist immer etwas Gemeinsames, was mit diesem Vereine geschaffen worden ist,
und bei richtiger Leitung, wie solche zu erwarten steht, lässt sich auf
dieser Grundlage weiter bauen. An willigem Entgegenkommen fehlt es
keinerseits. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juli
1885: "Aus Thüringen. Die israelitische Gemeinde in Eisenach,
die erst seit ungefähr 20 Jahren zu einer solchen herangewachsen ist,
ermangelte bis jetzt noch mancher Institution, wie sie eben im Leben einer
größeren jüdischen Gemeinschaft unentbehrlich sind, und die darum auch
in keiner solchen älteren Datums fehlen. Seit der Erbauung der neuen
Synagoge ist in dieser Beziehung hier bereits einige Besserung
eingetreten. Es fängt ein gewisser Kehilasinn (Gemeindesinn) an, sich zu
regen und geltend zu machen. Zeugnis hiervor gibt die jüngst
stattgefundene Errichtung eines Männervereins 'Chebra-Gemilut-Chassadim',
an welchem der weitaus größte Teil der Gemeindeglieder sich beteiligt
haben. Zweck desselben ist gegenseitige Beihilfe in Krankheits- und
Sterbefällen, sowohl durch geldliche Unterstützung der von solchen
Fällen betroffenen bedürftigen Vereinsmitglieder, als auch durch
selbsttätige Mitwirkung bei den bei Totenbestattungen üblichen
Observanzen. Ich will nicht behaupten, dass alle Beigetretenen im Voraus
schon entschossen seien, dieser letzteren Verpflichtung auch wirklich
nachzukommen, glaube vielmehr, dass mancher, wenn die Reihenfolge ihn
trifft, lieber den für den Fall festgesetzten Strafbetrag erlegen werde.
Unter unserer jetzigen Generation sind es ja leider viele, welche sich der
Übung solcher Liebespflichten entziehen, weil sie glauben, den Horror vor
der Berührung einer Leiche nicht überwinden zu können, oder weil sie
sich für so etwas für zu gut oder gar für 'zu gebildet' halten; aber es
will doch jeder gern die beruhigende Gewissheit haben, wenn für ihn
einmal die Stunde zur großen Reise ins Jenseits schlägt,
vorschriftsmäßig behandelt zu werden. Dem sei indessen wie ihm wolle; es
ist immer etwas Gemeinsames, was mit diesem Vereine geschaffen worden ist,
und bei richtiger Leitung, wie solche zu erwarten steht, lässt sich auf
dieser Grundlage weiter bauen. An willigem Entgegenkommen fehlt es
keinerseits.
Ein jüdischer Frauenverein, dem fast die sämtlichen Frauen der
hiesigen Gemeinde angehören, besteht übrigens hier schon seit einer
ziemlichen Reihe von Jahren und entwickelt derselbe eine recht wohltätige
Wirksamkeit." |
Ein
Antisemitenverein ("Reformverein") wird gegründet (1891)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Mai
1891: "Eisenach, 1. Mai (1891). Am 17. vorigen Monats ist
nach langen Geburtswehen auch hier in Eisenach ein Antisemitenverein unter
der Firma 'Reformverein' ins Leben getreten. Er hielt am 17. April
im 'Wartburghof' eine öffentliche Versammlung ab, zu welcher sich ca. 120
Personen eingefunden hatten. Von diesen waren wohl die gute Hälfte aus
Neugierde gekommen, während ein übriger beträchtlicher Teil aus nicht
wahlberechtigten jungen Leutchen bestand. Den Vorsitz in der Versammlung
führte der bisher als eifriger Nationalliberaler bekannte Herr
Schäffer, in dessen Equipage noch bei der letzten Reichstagswahl der
nationalliberale Kandidat, respektive dessen Begleiter, das Land
bereisten". Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Mai
1891: "Eisenach, 1. Mai (1891). Am 17. vorigen Monats ist
nach langen Geburtswehen auch hier in Eisenach ein Antisemitenverein unter
der Firma 'Reformverein' ins Leben getreten. Er hielt am 17. April
im 'Wartburghof' eine öffentliche Versammlung ab, zu welcher sich ca. 120
Personen eingefunden hatten. Von diesen waren wohl die gute Hälfte aus
Neugierde gekommen, während ein übriger beträchtlicher Teil aus nicht
wahlberechtigten jungen Leutchen bestand. Den Vorsitz in der Versammlung
führte der bisher als eifriger Nationalliberaler bekannte Herr
Schäffer, in dessen Equipage noch bei der letzten Reichstagswahl der
nationalliberale Kandidat, respektive dessen Begleiter, das Land
bereisten". |
Die
Goldene Hochzeit des Großherzoglichen Ehepaares wird gefeiert (1892)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Januar
1892: "Aus Eisenach. Die Bewohner des Großherzogtums
Sachsen-Weimar haben am 5., 6., 7., 8. und 9. dieses Monats wahre
Jubeltage erlebt. Eine hochfreudige Strömung war es, von welcher die
sämtlichen Landesangehörigen erfüllt waren. Wurde ja dem erlauchten
Großherzoglichen Ehepaare von Gott das seltene Glücke gewährt,
Höchstihr goldenes Ehejubiläum feiern zu können. Und das ganze
Völkchen feierte dieses Fest in der freudigsten Teilnahme mit und in den
Gotteshäusern aller Konfessionen stiegen tiefempfundene Dankgebete zu
Gott empor für die dem geliebten Herrscherhause erzeigte Wohltat. Warum
sollte das auch nicht so sein! Die erhabenen Herrschertugenden Seiner
Königlichen Hoheit des Großherzogs und seiner erlauchten Gemahlin haben
während der langen Regierungsdauer Höchstderselben sich durch eine milde
und gerechte Regierung und durch unzählige Wohltätigkeitshandlungen
gegen Einzelne sowohl, als auch durch Stiftung und Beförderung von
Wohltätigkeitsanstalten, sowie überhaupt durch ihre Teilnahme an allem,
was das Wohl und Wehe der Landesangehörigen betrifft, so glänzend
bewährt, dass sich dadurch wischen dem hohen Herrscherhause und seinen
Untertanen ein Liebesband gebildet hat, das den Charakter eines zwischen
Eltern und Kindern bestehenden Verhältnisses an sich
trägt. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Januar
1892: "Aus Eisenach. Die Bewohner des Großherzogtums
Sachsen-Weimar haben am 5., 6., 7., 8. und 9. dieses Monats wahre
Jubeltage erlebt. Eine hochfreudige Strömung war es, von welcher die
sämtlichen Landesangehörigen erfüllt waren. Wurde ja dem erlauchten
Großherzoglichen Ehepaare von Gott das seltene Glücke gewährt,
Höchstihr goldenes Ehejubiläum feiern zu können. Und das ganze
Völkchen feierte dieses Fest in der freudigsten Teilnahme mit und in den
Gotteshäusern aller Konfessionen stiegen tiefempfundene Dankgebete zu
Gott empor für die dem geliebten Herrscherhause erzeigte Wohltat. Warum
sollte das auch nicht so sein! Die erhabenen Herrschertugenden Seiner
Königlichen Hoheit des Großherzogs und seiner erlauchten Gemahlin haben
während der langen Regierungsdauer Höchstderselben sich durch eine milde
und gerechte Regierung und durch unzählige Wohltätigkeitshandlungen
gegen Einzelne sowohl, als auch durch Stiftung und Beförderung von
Wohltätigkeitsanstalten, sowie überhaupt durch ihre Teilnahme an allem,
was das Wohl und Wehe der Landesangehörigen betrifft, so glänzend
bewährt, dass sich dadurch wischen dem hohen Herrscherhause und seinen
Untertanen ein Liebesband gebildet hat, das den Charakter eines zwischen
Eltern und Kindern bestehenden Verhältnisses an sich
trägt.
Dass in dieser Beziehung die israelitischen Bewohner des Landes keine
Ausnahme machen und diese, so oft sich Gelegenheit darbietet, die Liebe
zum Großherzoglichen Hause auf irgendeine Weise zu betätigen, nicht
zurückstehen, versteht sich umso mehr von selbst, als der hohe Sinn
Seiner Königlichen Hoheit der Frau Großherzogin, ihnen auch stets eine
gleichmäßige Behandlung mit den übrigen Bewohnern des Landes zuteil
werden lässt.
Dieses war auch während der in Rede stehenden Feier der Fall. Der
Großherzoglich Sächsische Landrabbiner, Herr Dr. Salzer in Stadtlengsfeld
war gleich den Spitzen der Geistlichkeit der übrigen Konfessionen des
Landes offiziell zur Feier geladen worden und hatte sich auch bei seiner
Ankunft in Weimar sowohl, als auch während der ganzen Dauer der Festlichkeit
einer vollständig paritätischen Behandlung mit den übrigen Geistlichen
zu erfreuen.
Der Landrabbiner hatte die Ehre, am 6. dieses Monats vom Großherzoglichen
Ehepaare zur Audienz empfangen zu werden und seine persönlichen
Glückwünsche zum goldenen Ehejubiläum aussprechen, sowie auch seitens
der israelitischen Gemeinde eine prachtvoll ausgestattete
Glückwunschadresse überreichen zu dürfen. Seine Königliche Hoheit der
Großherzog, sowie |
 auch
dessen erlauchte Gemahlin geruhten beides huldvollst entgegenzunehmen und
bei dieser Gelegenheit die Versicherung zu erteilen, dass Höchstdieselben
bei ihren Untertanen in Betreff des Glaubens durchaus keinen Unterschied
kennen, dass alle ihnen gleich nahe stehen und daher auch die
israelitischen Bewohner des Landes sich des landesherrlichen Schutzes und
der landesherrlichen Fürsorge stets in derselben Weise versichert halten
können, wie die Bekenner der übrigen im Lande vertretenen Konfessionen.
Das sind sicherlich hocherfreuliche Äußerungen aus hohem Fürstenmunde,
namentlich in einer so von Glaubens- und Rassenhass durchwühlten Zeit,
wie die unsrige leider ist. auch
dessen erlauchte Gemahlin geruhten beides huldvollst entgegenzunehmen und
bei dieser Gelegenheit die Versicherung zu erteilen, dass Höchstdieselben
bei ihren Untertanen in Betreff des Glaubens durchaus keinen Unterschied
kennen, dass alle ihnen gleich nahe stehen und daher auch die
israelitischen Bewohner des Landes sich des landesherrlichen Schutzes und
der landesherrlichen Fürsorge stets in derselben Weise versichert halten
können, wie die Bekenner der übrigen im Lande vertretenen Konfessionen.
Das sind sicherlich hocherfreuliche Äußerungen aus hohem Fürstenmunde,
namentlich in einer so von Glaubens- und Rassenhass durchwühlten Zeit,
wie die unsrige leider ist.
Das edle Großherzogliche Ehepaar hat stets auf der Höhe der Bildung und
der Humanität gestanden und ist noch erfüllt von dem Odem einer
klassischen Zeit, deren Geburts- und Pflegestätte Weimar war. Als der Dichter
Leopold Kompert (vgl. Wikipedia-Artikel)
gestorben war, drückte der Großherzog in einem eigenhändigen Schreiben
der Witwe desselben sein Beileid aus, und der Dichter Ludwig August
Frankl (vgl. Wikipedia-Artikel)
erhielt vor nicht langer Zeit einen hohen Orden von ihm. Auch hat er vor
einiger Zeit persönlich Einkäufe in israelitischen Geschäften in Eisenach
gemacht. Ihre Königliche Hoheit die Frau Großherzogin, deren
Wohltätigkeit unbegrenzt ist, lässt dem Landrabbiner oft
Unterstützungsgelder zur Übermitteilung an arme Israeliten zukommen und
hat erst vor Kurzem einer kleinen israelitischen Gemeinde eine ansehnliche
Unterstützung zur Reparatur ihrer Synagoge zugesagt. Als vor einigen
Monaten die erlauchte Frau Erbgroßherzogin einen Teil des Landes bereist
und auch nach Stadtlengsfeld
kam, wurde neben anderen Beamten auch der Landrabbiner zur Tafel geladen.
Der Landrabbiner erhält auch den größten Teil seiner Besoldung aus der
Staatskasse und außerdem eine Pauschalsumme für seine Dienstreisen und
seinen Bureau-Aufwand.
Möchte es doch in unserem deutschen Vaterlande überall so bestellt
sein!
Gott segne unser erhabenes, großherzogliches Haus und erhalte das
erlauchte Ehejubelpaar noch lange in frischer, froher Gesundheit!". |
Konferenzen
des Vereins israelitischer Lehrer Mitteldeutschlands in Eisenach (1892 / 1894)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 24. Juni 1892:
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 24. Juni 1892:
Der Text ist noch nicht abgeschrieben, zum Lesen bitte Textabbildung
anklicken. |
| |
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 15. Juni 1894:
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 15. Juni 1894:
Genannt werden bei der Konferenz die Herren:
Dr. Dessauer,
Dr. Salzberger (Erfurt),
Rothschild (Erfurt),
Oppenheimer (Barchfeld),
H. Katz (Aschenhausen),
Heilbrunn (Gehaus),
Popper (Mühlhausen),
Wertheim (Gera),
Baumgart (Stadtlengsfeld).
Zum Lesen des Artikels bitte Textabbildung anklicken. |
Lehrerkonferenz des "Vereins israelitischer Lehrer Mitteldeutschlands"
in Eisenach (1894)
Vortragsabend
des "Vereins für jüdische Geschichte und Literatur" (1895)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Februar
1895: "Eisenach, 27. Januar (1895). Am 23. dieses Monats fand
im Sitzungszimmer der hiesigen Synagoge ein zahlreich besuchter
Vortragsabend des neuen Vereins für jüdische Geschichte und Literatur
statt. Zuerst hielt der Vorsitzende, Herr Heilbronn, einen Vortrag.
Derselbe sprach über die Geschichte der Makkabäer und den Talmud in
interessanter Weise. Der Vortrag war für die Anwesenden sehr belehrend,
und wurde nach Schluss desselben dem Vortragenden allgemeiner Beifall
gespendet. Nach einer kleinen Pause wurde sodann Herrn Ginzberg das
Wort erteilt. Derselbe sprach über den 'Kaufmann von Venedig'. Auch
dieser Vortrag war sehr belehrend und fand lebhaften Beifall. Herr
Ginzberg las nach Beendigung seines Vortrags noch einige Briefe von
Heinrich Heine über sein Verhältnis zum Judentum vor. Hierauf teilte der
Vorsitzende noch mit, dass der nächste Vereinsabend am 2. Februar
stattfindet, und damit schloss die Sitzung. der Verein, welcher ja noch im
Entstehen begriffen ist, jedoch durch fleißiges Wirken schon ziemlich
sich emporgeschwungen hat, wird sich nunmehr ebenfalls dem Verband
anschließen, um hervorragende Redner zu gewinnen. Wir wollen demselben
auch für die Zukunft das Beste wünschen." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Februar
1895: "Eisenach, 27. Januar (1895). Am 23. dieses Monats fand
im Sitzungszimmer der hiesigen Synagoge ein zahlreich besuchter
Vortragsabend des neuen Vereins für jüdische Geschichte und Literatur
statt. Zuerst hielt der Vorsitzende, Herr Heilbronn, einen Vortrag.
Derselbe sprach über die Geschichte der Makkabäer und den Talmud in
interessanter Weise. Der Vortrag war für die Anwesenden sehr belehrend,
und wurde nach Schluss desselben dem Vortragenden allgemeiner Beifall
gespendet. Nach einer kleinen Pause wurde sodann Herrn Ginzberg das
Wort erteilt. Derselbe sprach über den 'Kaufmann von Venedig'. Auch
dieser Vortrag war sehr belehrend und fand lebhaften Beifall. Herr
Ginzberg las nach Beendigung seines Vortrags noch einige Briefe von
Heinrich Heine über sein Verhältnis zum Judentum vor. Hierauf teilte der
Vorsitzende noch mit, dass der nächste Vereinsabend am 2. Februar
stattfindet, und damit schloss die Sitzung. der Verein, welcher ja noch im
Entstehen begriffen ist, jedoch durch fleißiges Wirken schon ziemlich
sich emporgeschwungen hat, wird sich nunmehr ebenfalls dem Verband
anschließen, um hervorragende Redner zu gewinnen. Wir wollen demselben
auch für die Zukunft das Beste wünschen." |
Generalversammlung
des "Armenvereins zur Bekämpfung der Wanderbettelei" (1900)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 9. September 1900: "Eisenach, 4. Februar (1900). Der
hiesige 'Armenverein zur Bekämpfung der Wanderbettelei" hielt
am 23. vorigen Monats seine Generalversammlung ab. Der Vorsitzende des
Vereins, Prediger Meyer, erstattete den Jahresbericht und legte klar, wie
segensreich der Verein auch im verflossenen Jahre gewirkt habe. Das
Interesse für die Sache sei größer geworden und die Zahl der Mitglieder
bedeutend gewachsen. - Als ganz besonders wichtig hob der Vorsitzende
hervor, dass nach Beschluss der vorjährigen Generalversammlung, die
Auszahlung der Unterstützungen von der Ortspolizei vornehmen zu lassen,
seit dem 1. April 1899 gehandelt sei. Die Erfahrungen, die der Verein seit
Übergabe der Kasse an die Polizei-Verwaltung gemacht, seien die
allerbesten gewesen. Die Hausbettelei hat fast ganz aufgehört; die
Unterstützungsbedürftigen konnten infolge Abnahme der
Unterstützungsgesuche weit wirksamer unterstützt werden. Leuten, die
arbeitswillig waren, ist von der Polizei in vielen Fällen Arbeit
nachgewiesen und verschafft worden. Die Abnahme der
Unterstützungsbedürftigen betrug 380 Personen. (Die Einrichtung der
hiesigen Gemeinde, die Kasse durch die Polizei verwalten zu lassen, kann
auch anderen 'Armenvereinen gegen Wanderbettelei' warm empfohlen werden).
Die Revisoren, Herren M. Troplowitz und S. Katz haben die Kasse geprüft
und für richtig befunden. Die Einnahme betrug an Mitgliederbeiträgen
1.084,56 Mark; die Ausgaben an 598 Unterstützungsbedürftige 964,05 Mark,
sodass ein Kassenbestand von 110,51 Mark verbleibt. Der Polizeiverwaltung
wurde für die Verwaltung der Kasse eine Gratifikation von 50 Mark zur
Verteilung an die beteiligten Beamten überwiesen und der Vorsitzende
außerdem beauftragt, der Polizeiverwaltung den Dank des Vereins
auszudrücken. Als Vorsitzender wurde Herr Meyer, der die Leitung des
Vereins seit drei Jahren hat, einstimmig wiedergewählt; als Stellvertreter
Herr H. Grünstein. - In der daran anschließenden Generalversammlung
des Männervereins (Chebra Kadischa) wurde der seitherige Vorstand,
Herr Prediger Meyer, Vorsitzender, Herr Blüth, Stellvertreter, Herr S.
Goldschmidt, Rendant einstimmt wiedergewählt." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 9. September 1900: "Eisenach, 4. Februar (1900). Der
hiesige 'Armenverein zur Bekämpfung der Wanderbettelei" hielt
am 23. vorigen Monats seine Generalversammlung ab. Der Vorsitzende des
Vereins, Prediger Meyer, erstattete den Jahresbericht und legte klar, wie
segensreich der Verein auch im verflossenen Jahre gewirkt habe. Das
Interesse für die Sache sei größer geworden und die Zahl der Mitglieder
bedeutend gewachsen. - Als ganz besonders wichtig hob der Vorsitzende
hervor, dass nach Beschluss der vorjährigen Generalversammlung, die
Auszahlung der Unterstützungen von der Ortspolizei vornehmen zu lassen,
seit dem 1. April 1899 gehandelt sei. Die Erfahrungen, die der Verein seit
Übergabe der Kasse an die Polizei-Verwaltung gemacht, seien die
allerbesten gewesen. Die Hausbettelei hat fast ganz aufgehört; die
Unterstützungsbedürftigen konnten infolge Abnahme der
Unterstützungsgesuche weit wirksamer unterstützt werden. Leuten, die
arbeitswillig waren, ist von der Polizei in vielen Fällen Arbeit
nachgewiesen und verschafft worden. Die Abnahme der
Unterstützungsbedürftigen betrug 380 Personen. (Die Einrichtung der
hiesigen Gemeinde, die Kasse durch die Polizei verwalten zu lassen, kann
auch anderen 'Armenvereinen gegen Wanderbettelei' warm empfohlen werden).
Die Revisoren, Herren M. Troplowitz und S. Katz haben die Kasse geprüft
und für richtig befunden. Die Einnahme betrug an Mitgliederbeiträgen
1.084,56 Mark; die Ausgaben an 598 Unterstützungsbedürftige 964,05 Mark,
sodass ein Kassenbestand von 110,51 Mark verbleibt. Der Polizeiverwaltung
wurde für die Verwaltung der Kasse eine Gratifikation von 50 Mark zur
Verteilung an die beteiligten Beamten überwiesen und der Vorsitzende
außerdem beauftragt, der Polizeiverwaltung den Dank des Vereins
auszudrücken. Als Vorsitzender wurde Herr Meyer, der die Leitung des
Vereins seit drei Jahren hat, einstimmig wiedergewählt; als Stellvertreter
Herr H. Grünstein. - In der daran anschließenden Generalversammlung
des Männervereins (Chebra Kadischa) wurde der seitherige Vorstand,
Herr Prediger Meyer, Vorsitzender, Herr Blüth, Stellvertreter, Herr S.
Goldschmidt, Rendant einstimmt wiedergewählt."
|
Wechsel
im Vorsitz des Israelitischen Frauenvereins von Lydia Stiebel zu Marta Weinstein
(1914)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 31. Juli
1914: "Eisenach, 24. Juli (1914). Nach mehr als
dreißigjähriger Wirksamkeit legte Frau Lydia Stiebel ihr Amt als
'Vorsitzende des hiesigen israelitischen Frauenvereins' aus
Gesundheitsrücksichten nieder. An ihre Stelle tritt die seitherige
stellvertretende Vorsitzende, Frau Marta Weinstein, hier. Frau Lydia
Stiebel, eine hochgebildete, geistreiche Dame, hat den Verein aus geringen
Anfängen zu seiner heutigen Blüte gebracht, sodass er jetzt fast alle
Frauen der hiesigen Gemeinde umfasst. Sie hat es verstanden, dem Vereine
immer neue Anregungen zu geben und Interesse für alle gemeinnützigen
Bestrebungen zu erwecken. Ihr Scheiden aus dem Amte wird lebhaft bedauert.
Als Anerkennung für die langjährigen Dienste, die Frau Stiebel dem
Vereine geleistet hat, wurde ihr ein wertvolles Buch von dem
Gesamtvorstand des Frauenvereins überreicht und zugleich der Dank des
Vereins ausgesprochen. Auch im hiesigen allgemeinen Frauenbildungsverein,
der sich aus Mitgliedern aller Konfessionen zusammensetzt, hat Frau
Stiebel viele Jahre den Vorsitz geführt. Aus dem oben genannten Grunde
legte Frau Stiebel auch hier das Amt als Vorsitzende nieder, was
allgemeines und lebhaftes Bedauern erweckt, da Frau Stiebel sich auch in
diesem Vereine sehr betätigt hat." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 31. Juli
1914: "Eisenach, 24. Juli (1914). Nach mehr als
dreißigjähriger Wirksamkeit legte Frau Lydia Stiebel ihr Amt als
'Vorsitzende des hiesigen israelitischen Frauenvereins' aus
Gesundheitsrücksichten nieder. An ihre Stelle tritt die seitherige
stellvertretende Vorsitzende, Frau Marta Weinstein, hier. Frau Lydia
Stiebel, eine hochgebildete, geistreiche Dame, hat den Verein aus geringen
Anfängen zu seiner heutigen Blüte gebracht, sodass er jetzt fast alle
Frauen der hiesigen Gemeinde umfasst. Sie hat es verstanden, dem Vereine
immer neue Anregungen zu geben und Interesse für alle gemeinnützigen
Bestrebungen zu erwecken. Ihr Scheiden aus dem Amte wird lebhaft bedauert.
Als Anerkennung für die langjährigen Dienste, die Frau Stiebel dem
Vereine geleistet hat, wurde ihr ein wertvolles Buch von dem
Gesamtvorstand des Frauenvereins überreicht und zugleich der Dank des
Vereins ausgesprochen. Auch im hiesigen allgemeinen Frauenbildungsverein,
der sich aus Mitgliedern aller Konfessionen zusammensetzt, hat Frau
Stiebel viele Jahre den Vorsitz geführt. Aus dem oben genannten Grunde
legte Frau Stiebel auch hier das Amt als Vorsitzende nieder, was
allgemeines und lebhaftes Bedauern erweckt, da Frau Stiebel sich auch in
diesem Vereine sehr betätigt hat." |
Der Stadtrat von Eisenach ist gegen die Judenhetze
(1930)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli
1930: "Der Stadtrat von Eisenach gegen die Judenhetze. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli
1930: "Der Stadtrat von Eisenach gegen die Judenhetze.
Berlin, 30. Juni (1930). Aus Eisenach wird mitgeteilt: Der Eisenacher
Stadtrat nahm eine von den Sozialdemokraten und den Demokraten
eingebrachte Entschließung gegen die in Thüringen betriebene Judenhetze
der Nationalsozialisten an. In der gleichen Sitzung wurde beschlossen,
angesichts der Befreiung der Rheinlande zwei Straßen und einen Platz nach
Ebert, Stresemann und Rathenau zu benennen. Der antirepublikanisch
gesinnte Oberbürgermeister Janson beanstandete diesen Beschluss, obwohl
nach dem thüringischen Wegegesetz die Straßenbenennung dem Stadtrat
zusteht. Inzwischen hat Minister Frick eine Verordnung erlassen, nach der
ab 1. Juli nur noch dem Stadtvorstand die Benennung von Straßen
zusteht." |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der Gemeinde
Advokat
Katzenstein kandidiert als Landtagsabgeordneter (1867)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. November 1867: "Aus Thüringen, im November (1867). (Privatmitteilung). Dieser Tage wurde im Großherzogtum Sachsen-Weimar der erste Jude in des Person des
Kommerzienrates Rosenblatt aus Stadtlengsfeld als Landtagsabgeordneter gewählt; auch sein Gegenkandidat
Advokat Katzenstein aus Eisenach war Jude. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. November 1867: "Aus Thüringen, im November (1867). (Privatmitteilung). Dieser Tage wurde im Großherzogtum Sachsen-Weimar der erste Jude in des Person des
Kommerzienrates Rosenblatt aus Stadtlengsfeld als Landtagsabgeordneter gewählt; auch sein Gegenkandidat
Advokat Katzenstein aus Eisenach war Jude.
Wie weit die Hyperorthodoxie sich auch in unseren Tagen noch versteigt, das beweisen die Maßnahmen des gelehrten
Rabbiner Dr. Enoch zu Fulda, früherer Redakteur des Zionswächter seligen Andenkens. Derselbe verirrt sich in seinem frommen Eifer sogar in die Tanzsalons seiner ihm anvertrauten Gemeinden, indem er mit aller Strenge das talmudische Verbot des Tanzens an den Feiertagen aufrecht zu erhalten sucht, was in vielen Orten seines Bezirkes zu sehr ärgerlichen Auftritten führte und nicht geeignet ist, dessen Ansehen zu erhöhen. Die Welt lässt sich einmal in der Jetztzeit nicht mehr mit solchem rabbinischen Spuk bannen. – Wenn übrigens der genannte fromme Herr seine Aufmerksamkeit anstatt dem harmlosen Tanzvergnügen dem synagogalen Leben seines Distrikts zuwenden würde, so könnte er sich wahrlich größere Verdienste um sein geistliches Amt erwerben. Auf diesem Felde sieht es noch traurig aus; von einer Andacht, einer Würde, einer Ordnung ist an vielen Orten wenig Spur. Hier öfters zeitgemäße Anordnungen zu treffen, wäre heilsamer als die Revisionen der Schächtmesser, der Mazzmaschinen, die Untersuchungen der Mikwahs, der Erubim (Sabbatweggrenzen), was der fromme Mann zu seiner Lebensaufgabe gemacht zu haben scheint". |
Salomon
Backhaus feiert das 25-jährige Amtsjubiläum als Vorsteher der Gemeinde
(1889)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Januar
1889: "Eisenach, 11. Januar (1889). Am 23. Dezember feierte Herr
Salomon Backhauß hier sein 25-jähriges Jubiläum als Vorsteher der
hiesigen israelitischen Gemeinde. Der Herr Landrabbiner Dr. Salzer
war hierher gekommen, um dem Herrn Jubilar persönlich zu beglückwünschen.
Am Vorabend des Jubeltages überbrachte der Synagogenchor dem Herrn
Backhauß ein Ständchen. Am Jubeltage erschienen Deputierte und Lehrer
und überbrachten Namens der Gemeinde einen Pokal als Zeichen der
Verehrung. Auch der Herr Bezirksdirektor, Freiherr von Beust, als
Vertreter der Aufsichtsbehörde, beglückwünschte den Herrn Jubilar
Namens der Regierung. Möge unserm geliebten Herrn Vorsteher, welcher
augenblicklich krank ist, eine recht bald völlige Genesung und noch viele
Jahre der Freude und des Glückes beschieden sein. J.H." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Januar
1889: "Eisenach, 11. Januar (1889). Am 23. Dezember feierte Herr
Salomon Backhauß hier sein 25-jähriges Jubiläum als Vorsteher der
hiesigen israelitischen Gemeinde. Der Herr Landrabbiner Dr. Salzer
war hierher gekommen, um dem Herrn Jubilar persönlich zu beglückwünschen.
Am Vorabend des Jubeltages überbrachte der Synagogenchor dem Herrn
Backhauß ein Ständchen. Am Jubeltage erschienen Deputierte und Lehrer
und überbrachten Namens der Gemeinde einen Pokal als Zeichen der
Verehrung. Auch der Herr Bezirksdirektor, Freiherr von Beust, als
Vertreter der Aufsichtsbehörde, beglückwünschte den Herrn Jubilar
Namens der Regierung. Möge unserm geliebten Herrn Vorsteher, welcher
augenblicklich krank ist, eine recht bald völlige Genesung und noch viele
Jahre der Freude und des Glückes beschieden sein. J.H." |
Zum Tod von
Aaron Neuhaus (1891)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. November
1891: "Aus Eisenach. Am 16. Oktober (1891), nachmittags 1
1/2 Uhr bewegte sich ein feierlicher Leichenzug durch die Straßen der
hiesigen Stadt. Der Teilhaber der hiesigen israelitischen Firma C.
Neuhaus Söhne, Großherzoglich Sächsische Hoflieferanten, Herr
Aaron Neuhaus, der im 46. Lebensjahre, nach langer Krankheit
verstorben ist, wurde zu Grabe getragen. Die Firma hat sich um die hiesige
Gegend dadurch verdient gemacht, dass sie hier und in der Umgegend
altdeutsche Stickereien und Webereien anfertigen lässt, was ihr einige
Beliebtheit verschafft hat. Der Verstorbene hat den französischen Krieg
im Jahre 1870 als Unteroffizier mitgemacht und sich da wohl den Keim
seiner langwierigen Krankheit geholt, da er auch schon während des
Krieges vier Wochen am Typhus in Frankreich schwer krank darniedergelegen
hatte. Während seines Hierwohnens verkehrte er viel mit seinen
Kriegskameraden und in den betreffenden Vereinen. Das hatte ihn bei diesen
besonders beliebt gemacht. Bei seinem Begräbnisse erschienen denn auch
der hiesige Landwehrverein und der hiesige Kriegerverein vollzählig und
begleiteten den Leichenzug mit ihren Fahnen unter voranschreitender
Trauermusik. Bei der jetzt überall herrschenden antisemitischen Strömung,
die auch hier ihre Vertreter hat und von denen auch mehrere im Zuge
bemerklich waren, kann das immerhin als eine erfreuliche Erscheinung
gelten, die an dieser Stelle vorgemerkt zu werden
verdient." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. November
1891: "Aus Eisenach. Am 16. Oktober (1891), nachmittags 1
1/2 Uhr bewegte sich ein feierlicher Leichenzug durch die Straßen der
hiesigen Stadt. Der Teilhaber der hiesigen israelitischen Firma C.
Neuhaus Söhne, Großherzoglich Sächsische Hoflieferanten, Herr
Aaron Neuhaus, der im 46. Lebensjahre, nach langer Krankheit
verstorben ist, wurde zu Grabe getragen. Die Firma hat sich um die hiesige
Gegend dadurch verdient gemacht, dass sie hier und in der Umgegend
altdeutsche Stickereien und Webereien anfertigen lässt, was ihr einige
Beliebtheit verschafft hat. Der Verstorbene hat den französischen Krieg
im Jahre 1870 als Unteroffizier mitgemacht und sich da wohl den Keim
seiner langwierigen Krankheit geholt, da er auch schon während des
Krieges vier Wochen am Typhus in Frankreich schwer krank darniedergelegen
hatte. Während seines Hierwohnens verkehrte er viel mit seinen
Kriegskameraden und in den betreffenden Vereinen. Das hatte ihn bei diesen
besonders beliebt gemacht. Bei seinem Begräbnisse erschienen denn auch
der hiesige Landwehrverein und der hiesige Kriegerverein vollzählig und
begleiteten den Leichenzug mit ihren Fahnen unter voranschreitender
Trauermusik. Bei der jetzt überall herrschenden antisemitischen Strömung,
die auch hier ihre Vertreter hat und von denen auch mehrere im Zuge
bemerklich waren, kann das immerhin als eine erfreuliche Erscheinung
gelten, die an dieser Stelle vorgemerkt zu werden
verdient." |
80.
Geburtstag von Lehrer und Schriftsteller B. Hause (1894)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März
1894: "Eisenach. Am 20. März (1894) hat unser
allverehrtes Gemeindemitglied, der frühere Lehrer und jetzige
Schriftsteller, Herr B. Hause hier sein 80. Lebensjahr vollendet.
Hatte der Herr Landrabbiner Dr. Salzer schon am jüngst verflossenen
Sabbat in seiner Predigt dieses Tages gedacht, so hatten auch andererseits
viele Vereine und Private es nicht versäumt, ihre Gratulationen
rechtzeitig zum Ausdruck zu bringen. So waren u.a. Depeschen und Adressen
eingelaufen vom Deutsch-Israelitischen Gemeindebunde, vom israelitischen
Lehrer-Kollegium in München, vom Hessischen Lehrerverein, vom Vereine
israelitischer Lehrer Mitteldeutschlands etc. etc. Um 11 Uhr vormittags
begab sich eine Deputation unter Anführung unseres Herrn Vorstehers S.
Stiebel in die Wohnung des Geburtstagskindes, überbrachte die
Glückwünsche der hiesigen israelitischen Gemeinde und überreichte Herrn
Hause eine Ehrengabe, welche von der hiesigen und von auswärtigen
Gemeinden und Vereinen zu diesem, Zwecke bestimmt wurde. Herr Hause dankte
tiefbewegt für die ihm erwiesene Aufmerksamkeit, die er nicht verdient zu
haben glaubt. Die Zensur über das, was er in der Schule des Lebens
geleistet hat, werde ihm wie jedem anderen Menschen doch erst im Jenseits
erteilt werden. Möge der himmlische Vater unserem Herrn Hause in seiner
fast jugendlichen Frische des Körpers und des Geistes noch recht lange am
Leben erhalten. Heidungsfeld." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März
1894: "Eisenach. Am 20. März (1894) hat unser
allverehrtes Gemeindemitglied, der frühere Lehrer und jetzige
Schriftsteller, Herr B. Hause hier sein 80. Lebensjahr vollendet.
Hatte der Herr Landrabbiner Dr. Salzer schon am jüngst verflossenen
Sabbat in seiner Predigt dieses Tages gedacht, so hatten auch andererseits
viele Vereine und Private es nicht versäumt, ihre Gratulationen
rechtzeitig zum Ausdruck zu bringen. So waren u.a. Depeschen und Adressen
eingelaufen vom Deutsch-Israelitischen Gemeindebunde, vom israelitischen
Lehrer-Kollegium in München, vom Hessischen Lehrerverein, vom Vereine
israelitischer Lehrer Mitteldeutschlands etc. etc. Um 11 Uhr vormittags
begab sich eine Deputation unter Anführung unseres Herrn Vorstehers S.
Stiebel in die Wohnung des Geburtstagskindes, überbrachte die
Glückwünsche der hiesigen israelitischen Gemeinde und überreichte Herrn
Hause eine Ehrengabe, welche von der hiesigen und von auswärtigen
Gemeinden und Vereinen zu diesem, Zwecke bestimmt wurde. Herr Hause dankte
tiefbewegt für die ihm erwiesene Aufmerksamkeit, die er nicht verdient zu
haben glaubt. Die Zensur über das, was er in der Schule des Lebens
geleistet hat, werde ihm wie jedem anderen Menschen doch erst im Jenseits
erteilt werden. Möge der himmlische Vater unserem Herrn Hause in seiner
fast jugendlichen Frische des Körpers und des Geistes noch recht lange am
Leben erhalten. Heidungsfeld." |
| |
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 30. März 1894:
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 30. März 1894:
Ein ähnlicher Bericht wie im "Israelit" erschien in der
"Allgemeinen Zeitung des Judentums" |
Zum Tod
von Salomon Stiebel (1897)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 12. November 1897: "Eisenach, 5. November
(1897), Einen schweren Verlust hat die hiesige Religionsgemeinde durch den
Tod des Herrn Salomon Stiebel erlitten. Seit mehr als 20 Jahren
gehörte der Verstorbene der Gemeindevertretung an. Den Vorsitz, den er
seit den letzten 6 Jahren geführt hatte, legte er im verflossenen Jahre
aus Gesundheitsrücksichten nieder. Aber auch dann blieb er noch Mitglied
der Kultusdeputation. Sein plötzlich erfolgter Tod hat die ganze Gemeinde
erschüttert. Herr Landrabbiner Dr. Salzer entwarf in sehr
eindrucksvoller Rede ein Lebensbild des Entschlafenen. Die
Trauerfeierlichkeiten, die im Hause des Verstorbenen stattfanden, wurden
durch ergreifende Gesänge des hiesigen Synagogen-Chores eingeleitet und
beschlossen. Fast die ganze Gemeinde beteiligte sich am Leichenzug, in dem
man auch eine große Anzahl der besten christlichen Mitbürger erblickte.
Der Herr Reichstagsabgeordnete Casselmann befand sich unter den
Goldenden. Auf dem Friedhofe angelangt, hielt der Lehrer unserer
Gemeinde, Herr Meyer, dem Entschlafenen einen warmen Nachruf, in dem
er besonders die Friedensliebe, die Uneigennützigkeit und die wahre
Menschenliebe des Verstorbenen hervorhob, dessen Andenken in der Gemeinde
immer fortleben werde. Die Ersatzwahl in der Kultusdeputation für den
Verstorbenen fand in der vergangenen Woche statt. Gewählt wurde mit großer
Majorität Herr Kaufmann Joseph Löwenstein zum Deputierten. - Zum Schluss
meines Berichtes möchte ich noch auf die Tätigkeit
des hiesigen Armenvereins hinweisen. Die Einnahme inklusive
Kassenbestand betrugen vom 1. Juli 1896 bis heute 1313,20 Mark, die
Ausgaben 1146,35 Mark, sodass ein Kassenbestand von 166,85 verblieb. Diese
Unterstützungen wurden an etwa 700-720 durchreisende Bettler verteilt. -
Zum Vorsitzenden des Vereins wurde Herr Lehrer Meyer
gewählt." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 12. November 1897: "Eisenach, 5. November
(1897), Einen schweren Verlust hat die hiesige Religionsgemeinde durch den
Tod des Herrn Salomon Stiebel erlitten. Seit mehr als 20 Jahren
gehörte der Verstorbene der Gemeindevertretung an. Den Vorsitz, den er
seit den letzten 6 Jahren geführt hatte, legte er im verflossenen Jahre
aus Gesundheitsrücksichten nieder. Aber auch dann blieb er noch Mitglied
der Kultusdeputation. Sein plötzlich erfolgter Tod hat die ganze Gemeinde
erschüttert. Herr Landrabbiner Dr. Salzer entwarf in sehr
eindrucksvoller Rede ein Lebensbild des Entschlafenen. Die
Trauerfeierlichkeiten, die im Hause des Verstorbenen stattfanden, wurden
durch ergreifende Gesänge des hiesigen Synagogen-Chores eingeleitet und
beschlossen. Fast die ganze Gemeinde beteiligte sich am Leichenzug, in dem
man auch eine große Anzahl der besten christlichen Mitbürger erblickte.
Der Herr Reichstagsabgeordnete Casselmann befand sich unter den
Goldenden. Auf dem Friedhofe angelangt, hielt der Lehrer unserer
Gemeinde, Herr Meyer, dem Entschlafenen einen warmen Nachruf, in dem
er besonders die Friedensliebe, die Uneigennützigkeit und die wahre
Menschenliebe des Verstorbenen hervorhob, dessen Andenken in der Gemeinde
immer fortleben werde. Die Ersatzwahl in der Kultusdeputation für den
Verstorbenen fand in der vergangenen Woche statt. Gewählt wurde mit großer
Majorität Herr Kaufmann Joseph Löwenstein zum Deputierten. - Zum Schluss
meines Berichtes möchte ich noch auf die Tätigkeit
des hiesigen Armenvereins hinweisen. Die Einnahme inklusive
Kassenbestand betrugen vom 1. Juli 1896 bis heute 1313,20 Mark, die
Ausgaben 1146,35 Mark, sodass ein Kassenbestand von 166,85 verblieb. Diese
Unterstützungen wurden an etwa 700-720 durchreisende Bettler verteilt. -
Zum Vorsitzenden des Vereins wurde Herr Lehrer Meyer
gewählt." |
Zum
Tod des Kultusdeputierten und stellvertretenden Gemeindevorsitzenden Gustav
Steinberger (1899)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. Januar 1899: "Eisenach, 2. Januar (1899). Einen
schweren Verlust hat die hiesige Religionsgemeinde durch den Tod des hier
allseits geachteten und beliebten Gustav Steinberger
(großherzoglich sächsischer Hoflieferant) erlitten. Seit mehr denn 15
Jahren gehörte er der Gemeindevertretung als Kultusdeputierter an; in den
letzten Jahren war er stellvertretender Vorsitzender der hiesigen
Gemeinde. Die ganze Gemeinde betrauert den frühzeitigen Tod dieses braven
Mannes. Sein reicher Geist, sein edles, jederzeit zur Hilfe bereites Herz
machten ihn zu einem Anwalt der Armen und Bedürftigen. Aber nicht allein
die hiesige Religionsgemeinde, sondern auch unsere Vaterstadt hat durch
seinen Tod einen herben Verlust erlitten. Herr Prediger Meyer
entwarf in seiner rief empfundenen Gedächtnisrede ein Bild des
Entschlafenen, dem er die Worte der Anerkennung und des Dankes der
Gemeinde, seiner vielen Freunde und all derer, die ihn kannten nachrief.
Nach einem Gesang des Synagogenchores sprach der erste Vorsitzende,
Herr Kuh, namens der Gemeinde und dann Herr S. Weinstein als
Freund Worte des Dankes und des Abschiedes. Viel verliert namentlich unser
'Verein für jüdische Geschichte und Literatur', dessen 1.
Vorsitzender der Entschlafene war. Seine Verdienste um den Verein hob der
II. Vorsitzende, Prediger Meyer, in der nächsten Vereinssitzung
rühmend hervor. Sein Andenken wird in unserer Gemeinde, vor allem aber im
Literaturverein, ein gesegnetes bleiben". Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. Januar 1899: "Eisenach, 2. Januar (1899). Einen
schweren Verlust hat die hiesige Religionsgemeinde durch den Tod des hier
allseits geachteten und beliebten Gustav Steinberger
(großherzoglich sächsischer Hoflieferant) erlitten. Seit mehr denn 15
Jahren gehörte er der Gemeindevertretung als Kultusdeputierter an; in den
letzten Jahren war er stellvertretender Vorsitzender der hiesigen
Gemeinde. Die ganze Gemeinde betrauert den frühzeitigen Tod dieses braven
Mannes. Sein reicher Geist, sein edles, jederzeit zur Hilfe bereites Herz
machten ihn zu einem Anwalt der Armen und Bedürftigen. Aber nicht allein
die hiesige Religionsgemeinde, sondern auch unsere Vaterstadt hat durch
seinen Tod einen herben Verlust erlitten. Herr Prediger Meyer
entwarf in seiner rief empfundenen Gedächtnisrede ein Bild des
Entschlafenen, dem er die Worte der Anerkennung und des Dankes der
Gemeinde, seiner vielen Freunde und all derer, die ihn kannten nachrief.
Nach einem Gesang des Synagogenchores sprach der erste Vorsitzende,
Herr Kuh, namens der Gemeinde und dann Herr S. Weinstein als
Freund Worte des Dankes und des Abschiedes. Viel verliert namentlich unser
'Verein für jüdische Geschichte und Literatur', dessen 1.
Vorsitzender der Entschlafene war. Seine Verdienste um den Verein hob der
II. Vorsitzende, Prediger Meyer, in der nächsten Vereinssitzung
rühmend hervor. Sein Andenken wird in unserer Gemeinde, vor allem aber im
Literaturverein, ein gesegnetes bleiben". |
Zum
Tod des großherzoglich sächsischen Hofbierbrauers Salomon Backhaus,
langjähriger erster Vorsteher der jüdischen Gemeinde (1901)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 1. Februar 1901: "Eisenach, 24. Januar (1901). Nach
kurzem Leiden verstarb hier am 11. dieses Monats der großherzoglich
sächsische Hofbierbrauer S. Backhauß im vollendeten 83.
Lebensjahre. Der Entschlafene war der Begründer der hiesigen
israelitischen Gemeinde, in der der über 27 Jahre das Amt des ersten
Vorstehers bekleidete. Auch in seinem Geburtsort Stadtlengsfeld
bekleidete er bis zu seinem Fortzuge nach hier das Amt eines Vorstehers.
Mit der hiesigen Gemeinde ist sein Name eng verwachsen, und sein Andenken
wird hier fortleben. Mit Eifer und Hingebung hat es seines Amtes stets
gewaltet, und auch nachdem sein Alter ihn zwang, sein Ehrenamt niederzulegen,
regen Anteil an der Entwicklung unserer Gemeinde genommen. Aber auch an
der Entwicklung unserer städtischen Gemeinde nahm der Verstorbene regen
Anteil. Bis in sein hohes Alter gehörte er dem Gemeinderate der hiesigen
Stadt an. Vor allem aber ist sein Name mit der hiesigen Aktienbierbrauerei
eng verknüpft, die ihm die heutige hohe Blüte in erster Reihe verdankte.
Bis zu seinem Tode war er Direktor der Aktienbrauerei. Zu seinem
25-jährigen Jubiläum als Vorsteher der hiesigen israelitischen
Religionsgemeinde wurde er seitens der großherzoglich sächsischen
Aufsichtsbehörde und der hiesigen Religionsgemeinde hoch geehrt; ferner
an seinem 80-jährigen Geburtstag von Nah und Fern. An der Bestattung nahm
nicht nur die hiesige israelitische Gemeinde, sondern auch die christliche
Bevölkerung regen Anteil. Nach einleitendem Gesang des Synagogenchores
entwarf Herr Prediger und Lehrer Meyer in zu Herzen gehender Weise
ein Lebensbild des Verblichenen, das auf alle Zuhörer einen tiefen
Eindruck machte. Namens der Gemeinde rief der jetzige Vorsteher, Herr
Leopold Kuh, dem Entschlafenen herzliche Worte der Anerkennung, des
Dankes und Abschieds nach. Mit einem Gesange schloss die erhebende Feier,
die von der Achtung und Liebe, die der Entschlafene in allen Schichten der
Bevölkerung besaß, beredtes Zeugnis ablegte". Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 1. Februar 1901: "Eisenach, 24. Januar (1901). Nach
kurzem Leiden verstarb hier am 11. dieses Monats der großherzoglich
sächsische Hofbierbrauer S. Backhauß im vollendeten 83.
Lebensjahre. Der Entschlafene war der Begründer der hiesigen
israelitischen Gemeinde, in der der über 27 Jahre das Amt des ersten
Vorstehers bekleidete. Auch in seinem Geburtsort Stadtlengsfeld
bekleidete er bis zu seinem Fortzuge nach hier das Amt eines Vorstehers.
Mit der hiesigen Gemeinde ist sein Name eng verwachsen, und sein Andenken
wird hier fortleben. Mit Eifer und Hingebung hat es seines Amtes stets
gewaltet, und auch nachdem sein Alter ihn zwang, sein Ehrenamt niederzulegen,
regen Anteil an der Entwicklung unserer Gemeinde genommen. Aber auch an
der Entwicklung unserer städtischen Gemeinde nahm der Verstorbene regen
Anteil. Bis in sein hohes Alter gehörte er dem Gemeinderate der hiesigen
Stadt an. Vor allem aber ist sein Name mit der hiesigen Aktienbierbrauerei
eng verknüpft, die ihm die heutige hohe Blüte in erster Reihe verdankte.
Bis zu seinem Tode war er Direktor der Aktienbrauerei. Zu seinem
25-jährigen Jubiläum als Vorsteher der hiesigen israelitischen
Religionsgemeinde wurde er seitens der großherzoglich sächsischen
Aufsichtsbehörde und der hiesigen Religionsgemeinde hoch geehrt; ferner
an seinem 80-jährigen Geburtstag von Nah und Fern. An der Bestattung nahm
nicht nur die hiesige israelitische Gemeinde, sondern auch die christliche
Bevölkerung regen Anteil. Nach einleitendem Gesang des Synagogenchores
entwarf Herr Prediger und Lehrer Meyer in zu Herzen gehender Weise
ein Lebensbild des Verblichenen, das auf alle Zuhörer einen tiefen
Eindruck machte. Namens der Gemeinde rief der jetzige Vorsteher, Herr
Leopold Kuh, dem Entschlafenen herzliche Worte der Anerkennung, des
Dankes und Abschieds nach. Mit einem Gesange schloss die erhebende Feier,
die von der Achtung und Liebe, die der Entschlafene in allen Schichten der
Bevölkerung besaß, beredtes Zeugnis ablegte". |
Konsul
Adolf Weinstein erhält das Exequatur (1908)
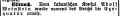 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 4. Dezember
1908: "Eisenach. Dem kubanischen Konsul Adolf Weinstein
wurden namens des Reichs die Exequatur erteilt." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 4. Dezember
1908: "Eisenach. Dem kubanischen Konsul Adolf Weinstein
wurden namens des Reichs die Exequatur erteilt." |
Goldene
Hochzeit von Richard Rothschild und Henriette geb. Friedmann (1934)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. August
1934: "Eisenach, 27. August (1934). Herr Richard
Rothschild und Frau Henriette geb. Friedmann, begehen am 10.
September (erster Tag Roschhaschono) das seltene Fest der goldenen
Hochzeit. Herr Rothschild ist eine in weiten jüdischen Kreisen
bekannte und geachtete Persönlichkeiten. Die Familie stammt aus Völkershausen
bei Vacha und ist seit dem Jahre 1897 hier in Eisenach ansässig. Seit
dieser Zeit ist der Jubilar Beamter der Israelitischen Kultusgemeinde. Von
seinen Funktionen als Schochet, Rechnungsführer und Hilfsvorbeter ist ihm
heute nur noch das letztere Amt verblieben. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. August
1934: "Eisenach, 27. August (1934). Herr Richard
Rothschild und Frau Henriette geb. Friedmann, begehen am 10.
September (erster Tag Roschhaschono) das seltene Fest der goldenen
Hochzeit. Herr Rothschild ist eine in weiten jüdischen Kreisen
bekannte und geachtete Persönlichkeiten. Die Familie stammt aus Völkershausen
bei Vacha und ist seit dem Jahre 1897 hier in Eisenach ansässig. Seit
dieser Zeit ist der Jubilar Beamter der Israelitischen Kultusgemeinde. Von
seinen Funktionen als Schochet, Rechnungsführer und Hilfsvorbeter ist ihm
heute nur noch das letztere Amt verblieben.
Trotz seines hohen Alters von 81 Jahren versäumt er fast keinen
Gottesdienst, und die Ausübung des Hilfsvorbeteramtes ist ihm, der von
tiefster Religiosität erfüllt ist, eine Herzenspflicht." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige
des Papier-Engros-Geschäftes Rud. Heinemann (1863)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 10. November 1863: "Einen Lehrling Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 10. November 1863: "Einen Lehrling
suche ich für mein Papier-Engros-Geschäft, zum Komptoir- und
Versandposten unter 150 Thaler Vergütung für 3-jährige Kost und
Logis.
Rud. Heinemann in Eisenach."
|
Anzeige
der Viehhandlung A. Wolf (1900)
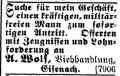 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. November
1900: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. November
1900:
"Suche für mein Geschäft, einen kräftigen, militärfreien Mann zum
sofortigen Antritt. Offerten mit Zeugnissen und Lohnforderung
an
A. Wolf, Viehhandlung,
Eisenach." |
Anzeige
der Ochsenschlachterei und Wurstfabrik Berthold Linz (1901)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Oktober
1901:
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Oktober
1901:
"Suche
für meine Ochsenschlachterei und Wurstfabrik, welche Samstag streng
geschlossen, einen jüdischen Gesellen und einen Lehrling.
Berthold Linz, Eisenach." |
Anzeige
der Wollweberei L. Fey (1901)
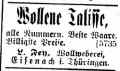 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. August
1901: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. August
1901:
"Wollene Talisse (Gebetsschale)
alle Nummern. Beste Ware. Billigste Preise.
L. Fey, Wollweberei, Eisenach in Thüringen." |
Verlobungsanzeige von Ruth Heilberg und Rudolf Grünewald (1935)
Anmerkung: Rudolf Grünewald ist 1892 in Eisenach
geboren, 1939 konnten er und seine Frau Ruth sowie der Sohn Klaus nach London,
1940 in die USA emigrieren. Rudolf Grünewald (Grunewald) starb am 10. November
1971 in New York, Vgl. Informationen in der Website von Horst Jung zur Familie
https://hjung.home.ktk.de/J%C3%BCdische%20Familien%20in%20Westerburg/ab_896E7A0F10BC405A9BD1C979EF8EF102.htm.
Der am 21. Juli 1937 in Eisenach geborene Sohn Klaus Grunewald ist am 7. Oktober
2025 gestorben, Grab siehe
https://de.findagrave.com/memorial/287807351/klaus-grunewald
 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 21. März 1935: Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 21. März 1935:
"Ruth Heilberg - Rudolf Grünewald
Verlobte
Westerburg (Westerwald) -
Eisenach (Thüringen)" |
Sonstige Dokumente
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries; weitere Angaben auf
Grund der Recherchen von P.K. Müller)
|