|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Oberfranken"
Egloffstein (Marktgemeinde,
Kreis
Forchheim)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In dem ehemals rein ritterschaftlichen Ort Egloffstein
bestand im 18./19. Jahrhundert eine kleine jüdische Gemeinde. Ihr
Entstehung geht in die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg zurück. 1728
lebten bereits mehrere jüdische Familien am Ort - auf sechs Anwesen verteilt. In den 1790er-Jahren hatten
vier jüdische Familien einen Schutzbrief der Freiherren von und zu Egloffstein.
1810 lebten fünf
jüdische Familien am Ort, 1813 waren es acht Familien. Die höchste Zahl
jüdischer Einwohner wurde 1834 mit 30 Personen erreicht (16 männliche,
14 weibliche). 1840 wurden 27 jüdische Einwohner gezählt, 1852 noch 17. 1865
waren noch drei Familien am Ort, 1875 neun jüdische Personen, 1890 nur noch
zwei.
An jüdischen Familien bzw. gewerbetreibenden Einzelpersonen werden 1822
genannt: Loeb Isaak Teufel (Handel mit Altkleidern, Not- und Schacherhandel),
Loeb Salomon Kohnfelder (Schnittwarenhandel) Moses Salomon Kohnfelder (Spezerei-
und Schnittwarenhandel), Moses Joseph Mühlhauser (Kram-/Spezereiladen), Lea
Rauh (lebte von Handarbeiten, Stricken und Nähen), Abraham Selig Rauh (Handel
mit Geißen), Charlotte Steinberger (Handel mit Schnittwaren und alten
Kleidern), Moses Abraham Steinberger (Schmusen auf Viehmärkten, Handel mit
alten Kleidern und Schnittwaren), Jette Tregner (Handel mit Schnittwaren),
Moritz Kohnfelder (Handel mit Landesprodukten), Moses Abraham Steinhard (Vieh-
und Schnittwarenhausierhandel). Die jüdischen Familien lebten
überwiegend in armseligen Verhältnissen.
An Einrichtungen hatte die kleine Gemeinde eine "Judenschule"
(Synagoge, s.u.) in einem der jüdischen Häuser, in dem auch der Unterricht der
jüdischen Kinder abgehalten wurde.
Ein rituelles Bad (Mikwe) befand sich auf dem Grundstück mit der Flur-Nr.
63 1/2 und ist im Grundsteuerkataster von 1848 als 'Judenduckplatz' eingetragen
(Groiss-Lau S. 186). Die Toten der jüdischen Gemeinde wurden in Pretzfeld,
später auch in Hagenbach beigesetzt. Spätestens
seit 1838 gehörte die Gemeinde zum Distriktrabbinat Hagenbach.
1865 gab es Bemühungen von Seiten des Distriktrabbinates Hagenbach, die
Gemeinde Egloffstein mit der Gemeinde in Wannbach
zusammenzulegen. Trotz des Einspruches der noch am Ort lebenden jüdischen
Familien, da der Weg nach Wannbach "über zwei Poststunden" betrage,
wurde am 2. Februar 1866 die Zusammenlegung mit Wannbach
beschlossen.
Auch nach dem Wegzug der jüdischen Familien blieben sie im Ort noch jahrzehntelang
in guter Erinnerung, da die inzwischen in Fürth lebende Frau Jeanette Kohnfelder aus Egloffstein mit ihrem
Testament vom 4. September 1888 der Gemeinde Egloffstein eine beträchtliche
Kapitalstiftung zur Armenpflege machte. Bis zur Inflationszeit fielen bedeutende
Erträge aus der Stiftung den (christlichen) Ortsarmen zu.
Von den in Egloffstein geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen ist in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Mathilde Ochs geb.
Kohnfelder (geb. 1875 in Egloffstein, später wohnhaft in Eisenach, deportiert
über Leipzig am 20. September 1942 in das Ghetto Theresienstadt, dort
umgekommen am 5. Mai 1943).
Zur Geschichte der Synagoge
Ein Betsaal (Synagoge) wie auch ein Unterrichtssaal war
in einem der jüdischen Häuser vorhanden. Die jüdische Gemeinde hatte nach
einem Bericht von 1808 die Erlaubnis, in "Männlein Juden Wittibs
Haus Schule zu halten", d.h. die Synagoge war im Haus der Witwe des Juden
Männlein. Im Pfarrbuch der Gemeinde Egloffstein wird für 1845 berichtet:
""4 Juden in Egloffstein haben eine Synagoge". Der Betsaal befand
sich im Erdgeschoss des Hauses, das aus einem Raum bestand.
1866 war die Synagoge nach Angaben der jüdischen Gemeindevertreter
inzwischen in einem "ruinös gewordenen Zustand". 300 Gulden wurden
für eine Reparatur veranschlagt. Da allerdings noch eine Schuldenlast von 150
Gulden auf dem Gebäude lag, konnten sich die drei jüdischen Familien nicht
mehr zu einer Reparatur entschließen. Das Gebäude wurde wenig später an Privatpersonen verkauft und seitdem
überwiegend als Wohnhaus
genutzt. Zeitweise (1900-1914 war ein privater Kindergarten im Raum der
ehemaligen Synagoge). Bis 1939/40 war die Toranische noch erkennbar. Damals erfolgte ein erneuter Besitzerwechsel und ein Umbau des bis dahin einräumigen Erdgeschosses.
Adresse/Standort der Synagoge: Malerwinkel
89.
Fotos
Historische Aufnahmen
(Quelle: K. Guth s.Lit. S. 150) |
 |
 |
| |
Das Gebäude der ehemaligen
Synagoge, die sich im
Erdgeschoss befand (Toranische noch leicht
zwischen
den Fenstern erkennbar) - Foto von 1939 |
Das Gebäude der ehemaligen
Synagoge (rechts unter der
Burg Egloffstein) - Foto von 1955 |
| |
|
| |
|
|
|
Aktuelle Fotos und
Bericht von der Eröffnung des "Kulturweges Egloffstein" am 15.
Juni 2008
(Fotos, Bericht und Informationsblatt erhalten von Michael Wirth,
Vorstand des Fremdenverkehrsvereins Egloffstein)
Die Universität Erlangen/Nürnberg hat im Auftrag der Gemeinde Egloffstein im Jahr 2003/04 unter der Leitung von
Prof. Dr. Werner Bätzing und Dr. Andreas Otto Weber einen sogenannten "Kulturweg Egloffstein" erarbeitet. In den folgenden
Jahren wurden im Ort Egloffstein und den eingemeindeten Ortsteilen etwa 60 Tafeln mit Informationen zur Geschichte der Gemeinde
aufgestellt. Unter anderem auch eine Tafel an der ehemaligen Synagoge. Am
15. Juni 2008 wurde dieser aus 5 Teilwegen bestehende Kulturweg offiziell eröffnet. Im Rahmen dieses Tages hat der
Fremdenverkehrsverein Egloffstein u.U. e.V. ein buntes Straßenfest inszeniert.
An 34 Stationen im Ort wurden Aktionen angeboten (Bogenschießen, Wäschewaschen wie früher am Waschbrunnen, Führungen durch die
historischen Felsenkeller, die Burg, das Mühlenmuseum usw.) Eine Station war auch die Synagoge. Hier wurden Fragen zum Judentum
beantwortet, und Ausstellungsstücke aus dem jüdischen Leben gezeigt. |
| |
 |
 |
 |
Blick zum Gebäude der
ehemaligen Synagoge
|
Beim Gebäude der
ehemaligen Synagoge wurden Ausstellungsstücke aus dem
jüdischen Leben
gezeigt, u.a. Menora (siebenarmiger Leuchter), Kippa,
Tallit
(Gebetsschal), Modell einer Synagoge |
| |
|
|
|
 Text
der Hinweistafel an der Synagoge: "Die ehemalige Synagoge.
Seit dem frühen Mittelalter lebten Juden auch in Franken. Erstmals 1298
kommt es in Ostfranken zu Verfolgungen, (Pogrome) besonders in den
Städten. Die Juden beginnen sich von Städten abzuwenden und in Dörfern
und Märkten anzusiedeln. Nachdem 1349 in Nürnberg eine blutige
Judenverfolgung auch das jüdische Stadtviertel (heutiger Hauptmarkt)
zerstört hatte, boten die Herren von Schlüsselberg (Burg Neideck) den
Überlebenden Schutz in ihren Orten. Damit wird erstmals die Funktion des
Adels als Schutzmacht über die Juden in der Region sichtbar. Text
der Hinweistafel an der Synagoge: "Die ehemalige Synagoge.
Seit dem frühen Mittelalter lebten Juden auch in Franken. Erstmals 1298
kommt es in Ostfranken zu Verfolgungen, (Pogrome) besonders in den
Städten. Die Juden beginnen sich von Städten abzuwenden und in Dörfern
und Märkten anzusiedeln. Nachdem 1349 in Nürnberg eine blutige
Judenverfolgung auch das jüdische Stadtviertel (heutiger Hauptmarkt)
zerstört hatte, boten die Herren von Schlüsselberg (Burg Neideck) den
Überlebenden Schutz in ihren Orten. Damit wird erstmals die Funktion des
Adels als Schutzmacht über die Juden in der Region sichtbar.
1548 übertrug Kaiser Karl V. in der sogenannten 'Reichspoliceyordnung'
der Reichsritterschaft das Judenschutzrecht. Dieses bot den Rittern die
Möglichkeit, Juden aufzunehmen und von ihnen Steuern und andere Abgaben
zu erheben. Diese bald beträchtlichen Einnahmemöglichkeiten führten
auch dazu, dass es in vielen reichsritterschaftlichen Siedlungen zu einer
Politik der Judenansiedlung kam. So findet man noch heute in vielen
ehemals reichsritterschaftlichen Orten Spuren von vergangenem jüdischen
Leben.
In Egloffstein sind jüdische Einwohner erst nach dem Dreißigjährigen
Krieg nachweisbar, während in anderen Egloffstein'schen Orten schon
früher Juden lebten. Im Urbar des Rittergutes Egloffstein von 1728 sind
sechs Anwesen mit Juden genannt. Sie lebten in erster Linie von Vieh- und
Hausierhandel. Auch in Egloffstein finden wir eine starke Abwanderung der
Juden in die aufblühenden Industriestädte wie Fürth oder nach Amerika,
bis im Jahr 1890 die letzten Juden Egloffstein verließen.
Bis 1798 fand der Gottesdienst in Privathäusern statt, dann in der
schlichten, baulich unauffälligen Synagoge. Das auch 'Judenschul'
genannte Gotteshaus war gleichzeitig Wohnung des Rabbiners und
Religionsschule. Bis 1940 konnte man an der Giebelseite noch die
Thoranische erkennen. Angesichts der Abwanderung der Juden aus Egloffstein
wurde die Synagoge bereits 1866 wieder verkauft. Das rituelle jüdische
Bad, die 'Mikwe', lag weiter oben im Markt unter Haus Nr. 44 und ist heute
verfallen. Einen eigenen Judenfriedhof besaß Egloffstein nie. Bis 1737
wurden die Egloffsteiner Juden in Pretzfeld und danach in
Hagenbach
begraben."
|
| |
|
|
|
 Text
der Hinweistafel am Eingang der ehemaligen "Judengasse" (Aufgang
Burgsteig) - (Foto: Jürgen Hanke, Kronach, Aufnahme vo 4.7.2009:
"Tropfhäuser. Die sogenannten 'Tropfhäuser' sind in
Egloffstein besonders häufig anzutreffen. Sie sind typisch für die
reichsritterschaftliche Dorfentwicklung, die besonders nach dem
Dreißigjährigen Krieg darauf abzielte, möglichst viele Handwerker und
Gewerbetreibende in den Rittergütern anzusiedeln. Es handelt sich um
Klein- bzw. Kleinstanwesen mit einem verschwindend geringen Grundbesitz.
Der Begriff 'Tropfhaus' leitet sich davon ab, dass die Eigentümer eines
Grundstück nur so viel Land haben, wie unter den Tropf, also die
Regenrinne passt. Die Redensart vom 'armen Tropf' lässt sich ebenfalls so
erklären. Text
der Hinweistafel am Eingang der ehemaligen "Judengasse" (Aufgang
Burgsteig) - (Foto: Jürgen Hanke, Kronach, Aufnahme vo 4.7.2009:
"Tropfhäuser. Die sogenannten 'Tropfhäuser' sind in
Egloffstein besonders häufig anzutreffen. Sie sind typisch für die
reichsritterschaftliche Dorfentwicklung, die besonders nach dem
Dreißigjährigen Krieg darauf abzielte, möglichst viele Handwerker und
Gewerbetreibende in den Rittergütern anzusiedeln. Es handelt sich um
Klein- bzw. Kleinstanwesen mit einem verschwindend geringen Grundbesitz.
Der Begriff 'Tropfhaus' leitet sich davon ab, dass die Eigentümer eines
Grundstück nur so viel Land haben, wie unter den Tropf, also die
Regenrinne passt. Die Redensart vom 'armen Tropf' lässt sich ebenfalls so
erklären.
Alleine vier dieser kleinen Tropfhäuser liegen in der Gasse vor uns
nebeneinander. Die Gasse wurde früher Judengasse genannt, da hier
- v.a. im 19. Jahrhundert - jüdische Einwohner Egloffsteins wohnten. Aber
diese wohnten nicht für sich, sondern neben den anderen Einwohnern
Egloffsteins, die auch nur Tropfhäuser hatten. Typisch für die
Tropfhäuser war zudem, dass die Bewohner sehr oft
wechselten.
1848 finden wir in den vier nebeneinanderliegenden Tropfhäusern der vor
uns in dieser Gasse die Witwe des Jakob Tuchner (geborene Kohnfelder),
daneben Johann Albert, daneben Löw Salomon Kohnfelder und daneben Johann
Hübschmann. Die Namen lassen also deutlich die gemischten
Wohnverhältnisse zwischen Juden und Christen
erkennen..."
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
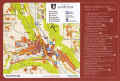 |
 |
| Flyer mit
Informationen und Karte zum Tag der Eröffnung des "Kulturweges
Egloffstein" am 15. Juni 2008 |
| |
|
|
Das Gebäude der ehemaligen
Mikwe
(Haus Nr. 44)
(Foto: Jürgen Hanke, Kronach) |
 |
|
|
Die noch in dem Gebäude
befindliche Mikwe ist in einem verfallenen Zustand |
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 203. |
 | Klaus Guth (Hg.) u.a.: Jüdische Landgemeinden in Oberfranken
(1800-1942). Ein historisch-topographisches Handbuch. Bamberg 1988. zu
Egloffstein S. 144-152. (mit weiteren Quellenangaben). |
 | Eva Groiss-Lau: Jüdisches Kulturgut auf dem Land.
München / Berlin 1995 (zur Mikwe S. 186). |
 | 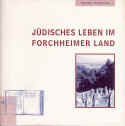 Georg
Knörlein: Jüdisches Leben im Forchheimer Land. Verlag Medien
und Dialog. Haigerloch 1998. S. 7. Georg
Knörlein: Jüdisches Leben im Forchheimer Land. Verlag Medien
und Dialog. Haigerloch 1998. S. 7. |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|