|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Thüringen"
Sondershausen (Kyffhäuserkreis)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Sondershausen lebten
Juden bereits im Mittelalter. 1320 wird Jud Joseph von Sondershausen in
Nordhausen genannt. 1323 verstarb in Sondershausen die Jüdin Sara, die an das
Kloster Volkerode Geld verliehen hatte. 1341 werden Gutkind aus Sondershausen
und sein Schwiegersohn in Mühlhausen aufgenommen. Bei der Judenverfolgung in
der Pestzeit 1348/49 wurde das jüdische Leben in der Stadt vernichtet. Eine
wichtige Erinnerung an die jüdische Geschichte ist die erhaltene Mikwe aus der
Zeit um 1300.
Die Entstehung der neuzeitlichen Gemeinde geht in das 17. Jahrhundert zurück.
1695 erhielten erstmals Juden in der Stadt sogenannte
"Schutzbriefe" unter Graf Christian Wilhelm von
Schwarzburg-Sondershausen. 1698 bestand eine Betstube und eine jüdische Schule
in einem vermutlich an der Hauptstraße gelegenen jüdischen Wohnhaus. 1699
wurde der Friedhof am Spatenberg angelegt.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1825/26 26 jüdische Familien, 1871 149 jüdische Einwohner 1880 130.
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule,
ein rituelles Bad und ein Friedhof.
Die ursprünglich vorhandene jüdische Elementarschule (aus den 1820er-Jahren)
wurde bereits 1840 den städtischen Schulanstalten angegliedert. Danach bestand
nur noch eine jüdische Religionsschule am Ort. Lehrer und Prediger der Gemeinde
war zur Zeit der Synagogeneinweihung 1826 und bis zu seiner Berufung nach
Breslau J. Wolfsohn. Ab 1842 gab es ein privates jüdisches
Knabenpensionat ("Pensionsanstalt für israelitische Knaben und Jünglinge"),
das der israelitische Religionslehrer und Prediger (ab 1845 Rabbiner) Philipp
Heidenheim (1814-1906), der zugleich als Lehrer an der Realschule tätig
war, unterhielt (siehe Anzeigen und Berichte unten). Die israelitische
Religionsschule und das Pensionat befanden sich zunächst im Vorderhaus der
Synagoge (Bebrastraße 6). 1847 wurde der Unterricht in die städtischen
Schulgebäude in der Pfarrstraße, ab 1903 in das Staatsschulgebäude in der Güntherstraße
verlegt.
Im Ersten Weltkrieg waren aus Sondershausen keine jüdischen Gefallenen zu
beklagen.
Um 1924, als zur jüdischen Gemeinde 75 Personen gehörten, waren die
Gemeindevorsteher Rudolf David, Julius Mayer und Max Kaufmann. Vorsteher der
Repräsentanz waren Louis Lindau und M. Berl. Die damals acht schulpflichtigen
Kinder der Gemeinde erhielten ihren Religionsunterricht durch Lehrer Seelig aus
Nordhausen. 1932 waren die Gemeindevorsteher Max Kaufmann (Bebrastraße 27, 1.
Vors.), Rechtsanwalt Dr. David (Göldnerstraße 4, 2. Vors.) und Curt
Heilbrun (Hauptstraße 56, Schatzmeister). Vorsteher der Repräsentanz waren Max
Kaufmann, Max Redelheimer (Hauptstraße 55) und Julius Meyer
(Richard-Wagner-Straße 11). Als Religionslehrer der im Schuljahr 1931/32 14
schulpflichtigen Kinder der Gemeinde kam Lehrer Frühauf aus Bleicherode regelmäßig
nach Sondershausen. An jüdischen Vereinen bestanden insbesondere der
Frauenverein (1932 unter Vorsitz von Frau Redelmeier, Hauptstraße 55; Zweck und
Arbeitsgebiet: Unterstützung Hilfsbedürftiger) und der Humanitätsverein (1932
unter Vorsitz von Max Redelmeier, Hauptstraße 55; Zweck und Arbeitsgebiet:
Unterstützung Hilfsbedürftiger).
1933 lebten noch etwa 75 jüdische Personen in Sondershausen. In
den folgenden Jahren ist ein Teil der
jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,
der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Folgende jüdische
Geschäftsleute mussten ihre Gewerbebetriebe in der Folgezeit aufgeben:
Stickerei Rudolf David (Aufgabe 1936), Kaufmann Siegmund Spunt-Seemann (1937),
Max und Meta Redelmeier (1938), Kaufmann Leopold Reichardt (1939), Sophie Brown
(1939), Julie Mayer geb. Rosenberg (1939), Dr. Erich Heilbrun (1939), Kurt und
Julie Leser (1939), Familie Artur Simon (1939), Dr. Ludwig David (1939),
Kaufhaus Cohn-Heilbrunn (1939) und Wollwarenfabrik Egon Leser (1940). Beim Novemberpogrom
1938 wurde die Synagoge geschändet; die noch bestehenden jüdische
Geschäfte wurden geplündert und jüdische Familien in ihren Wohnungen
überfallen. Betroffen waren vor allem die in der Hauptstraße und in der
Lohstraße lebenden jüdischen Familien und Geschäfte. Die jüdischen Männer,
unter ihnen Rechtsanwalt Dr. Ludwig David, wurden für einige Wochen in das KZ
Buchenwald verschleppt. Ab 1942 erfolgten die Deportationen der jüdischen
Personen, die in Sondershausen bis dahin noch gelebt hatten.
Von den in Sondershausen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Erna Bähr geb. Leser
(1891), Jenny Blumenreich geb. Heilbrun (1870), Siegmund Cohn (), Siegfried David (1884), Helene
Magdalena Eisenberg geb. Wahl (1863), Johanna Fischel geb. Heilbrun (1887),
Ludwig Groß (1900), Harry Hecht (1887), Moritz Hecht (1876), Dorothea (Doro)
Hirsch geb. Schwabach (1877), Selma Horwitz geb. Katz (1866), Walter Katz
(1909), Irmgard Kaufmann (1922), Margarete Koopmann geb. Liebert (1895), Herta
Lehrhaupt geb. Groß (1901), Max Leser (1870), Frieda Lindau geb. Simon (1876),
Louis Lindau (1874), Hildegard (Hilde) Schacher geb. Steinberg (1905),
Fanny Schlesinger geb. Redelmaier (1854), Janny Schönfeld geb. Cahn (1869),
Margarete Schönlank (1894), Heinz Simon (1931), Rosa Simon geb. Edelmuth
(1897), Siegfried Simon (1892), Gertrude Steinberg geb. Heilbrun (1884), Hugo
Weiler (1886), Paula Weiler geb. Horwitz (1891).
Nach Kriegsende kamen wenige Überlebende zurück, vor allem einzelne in
sogenannter "Mischehe" lebende Personen, die 1944 von den
Deportationen erfasst worden waren und die Zwangsarbeit in Arbeitslagern
überlebt hatten.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Publikation von Predigten des Predigers J. Wolfsohn
(1837/1838)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Juni
1837: "Literatur. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Juni
1837: "Literatur.
Der Prediger J. Wolfsohn in Sondershausen (der übrigens von dort
nach Breslau abgeht), gibt zwölf Predigten einzeln heraus, von
denen die erste bereits erschienen ist (5 Gr.). Dies ist eine Neujahrspredigt,
wo in der Einleitung über die Bedeutsamkeit des Tages, und dann nach dem
Texte Psalm 122,6-10, über die Wünsche und Segnungen, die das
Neujahrsfest enthält, 1) über zeitliches Wohl, indem man das
Beste des Vaterlandes sucht, 2) ewiges Heil im Frieden, gesprochen
ist. Es sind zwar nicht tiefe, aber besonders herzliche Worte in
prunkloser, fließender Sprache." |
| |
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. April
1838: "Religions- und Schulreden für Israeliten. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. April
1838: "Religions- und Schulreden für Israeliten.
Nebst einer Sammlung biblischer Texte und Ideen für Sabbat-, Fest-
und Gelegenheitsreden. Von Mehren bearbeitet. Herausgegeben von Dr. J.
Heinemann in Berlin.
Zwölf Reden, gehalten in der israelitischen Gemeinde zu Sondershausen
von J. Wolfsohn (Inspektor und Religionslehrer in Breslau).
8. Auf schönem weißen Druckpapier, elegant broch. 1 Thlr. (1 Fl. 48
Kr.).
Diese Reden schließen sich ähnlichen im Bedürfnisse der Zeit
begründeten Erscheinungen an, und können mit vollem Rechte frommen
Gemütern als ein den religiösen Sinn belebendes Erbauungsmittel
empfohlen werden." |
Lehrer Philipp Heidenheim ist als "wirklicher
Lehrer" und als "Ordinarius" an der Realschule angestellt (1841)
Anmerkung: Philipp Heidenheim
(geb. 1814 in Bleicherode, gest. 1906 in Sondershausen) schloss eine
Ausbildung zum Lehrer mit dem Lehrerexamen 1835 in Erfurt ab. Seit 1837
war er als Prediger und Schuldirektor in Sondershausen tätig.
Seine privaten rabbinischen Studien konnte er 1845 mit einer
rabbinischen Prüfung und Ordination in Schönlanke (Trzcianka)
abschließen. Darauf wurde er zum Landesrabbiner in
Schwarzburg-Sondershausen und Schwarzburg Rudolstadt mit Sitz in Sondershausen
ernannt. Er unterrichtete - bereits seit 1841 als "Ordinarius" an der Realschule in Sondershausen; 1881 wurde
er zum Professor ernannt.
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. März
1841: "Sondershausen, 8. März (1841). Seit Ostern vorigen
Jahres ist der Prediger und Religionslehrer der hiesigen Israeliten-Gemeinde,
Heidenheim, zugleich als wirklicher Lehrer, und seit Juli als Ordinarius
der zweiten Klasse an der fürstlichen Realschule angestellt worden. Die
Elementarschule der Gemeinde, ungenügend aus Mangel an Mitteln, ward
aufgelöst, und dafür regelmäßige3r Religionsunterricht eingerichtet.
An Sabbaten und Festtagen ist der Gedachte von jedem Unterrichte
dispensiert. Mit seinen sämtlichen Kollegen steht derselbe im
freundlichsten Vernehmen, und von seinen Vorgesetzten, ja selbst vom
durchlauchtigsten Fürsten hat er bereits mehrere Äußerungen der
Zufriedenheit mit seinen Leistungen erhalten." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. März
1841: "Sondershausen, 8. März (1841). Seit Ostern vorigen
Jahres ist der Prediger und Religionslehrer der hiesigen Israeliten-Gemeinde,
Heidenheim, zugleich als wirklicher Lehrer, und seit Juli als Ordinarius
der zweiten Klasse an der fürstlichen Realschule angestellt worden. Die
Elementarschule der Gemeinde, ungenügend aus Mangel an Mitteln, ward
aufgelöst, und dafür regelmäßige3r Religionsunterricht eingerichtet.
An Sabbaten und Festtagen ist der Gedachte von jedem Unterrichte
dispensiert. Mit seinen sämtlichen Kollegen steht derselbe im
freundlichsten Vernehmen, und von seinen Vorgesetzten, ja selbst vom
durchlauchtigsten Fürsten hat er bereits mehrere Äußerungen der
Zufriedenheit mit seinen Leistungen erhalten." |
Gründung einer Pensionsanstalt für israelitische
Knaben und Jünglinge in Sondershausen durch Prediger und Lehrer Philipp
Heidenheim (1842)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Januar
1842: "Errichtung einer größeren Pensionsanstalt für
israelitische Knaben und Jünglinge. Mit Gott und für Gott. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Januar
1842: "Errichtung einer größeren Pensionsanstalt für
israelitische Knaben und Jünglinge. Mit Gott und für Gott.
Seit einer Reihe von Jahren habe ich mich dem Lehr- und Erziehungsfache
mit Liebe und Erfolg gewidmet und mein höchstes Lebensglück in der
Erfüllung meines Berufes gefunden. Der Herr hat mich auch Gunst finden
lassen in den Augen der Menschen und mir eine Stellung verliehen, wie
selten einem meiner Brüder in Israel. Dadurch bewogen, übergaben mit
seit einiger Zeit selbst fernwohnende Eltern ihre Kinder zur Erziehung.
Die Anträge haben sich nun gemehrt, nachdem das Vertrauen, das man in
mich gesetzt, gerechtfertigt wurde. Ich habe mich daher bestimmen lassen,
unter Mitwirkung einiger biederer, wissenschaftlich gebildeter Männer, sämtlich
Lehrer an den hiesigen höheren Schulanstalten und vornehmlich unter
Beihilfe eines religiösen, tüchtigen Talmudisten eine größere
Erziehungsanstalt für israelitische Knaben und Jünglinge zu gründen,
und glaube sogar, damit einem fühlbaren Bedürfnisse abzuhelfen, da
meines Wissens in Deutschland noch wenig derartige, umfangreiche, so viel
Annehmbares darbietende Anstalten bestehen. Eltern, die mich mit ihrem
Vertrauen beehren, werden es nicht bereuen, mir ihr Teuerstes übergeben
zu haben; ich bin selbst Familienvater und weiß, was und wie Eltern
fühlen und wünschen. Mein nächster und höchster Zweck ist, meine Zöglinge
in der Furcht des Herrn zu erziehen, dass sie ihren heiligen Glauben
unmittelbar aus jenen ewig frischen Quellen geschöpft, wahrhaft erfassen
und innig lieben lernen, dass das Feuer unserer göttlichen Religion ihre
Herzen erwärme und ihr ganzes Sein durchdringe; denn in unserer
glaubensarmen, gleichgültigen Zeit müssen alle Bessergesinnten ihr Augenmerk,
ihre Hoffnung auf die heranwachsende Jugend gerichtet haben; nur wenn sie
begeistert und erwärmt wurde für das himmlische Erbe ihrer Väter, kann
Israel in Wahrheit wiedergeboren werden. Dann will ich sie aber auch für
das Leben und seine Anforderungen, die sich mit jedem Tage mehren,
tüchtig befähigen: dass sie in derselben Weise in Talmud- und
Torawissen wie auch in profanem Wissen kundig werden (frei
übersetzt). Zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken.
Sondershausen, im Januar 1842. Philipp Heidenheim. Prediger
und Religionslehrer der hiesigen israelitischen Gemeinde und ordentlicher
Lehrer an der fürstlichen Realschule, Ordinarius der zweiten
Klasse." |
 Es
folgen Empfehlungen für Philipp Heidenheim. Zum Lesen bitte Textabbildung
anklicken. Es
folgen Empfehlungen für Philipp Heidenheim. Zum Lesen bitte Textabbildung
anklicken. |
Feierliche Vereidigung und "förmliche
Installation" des Rabbiners Philipp Heidenheim (1846)
|
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Januar
1846: "Sondershausen, 30. Dezember (1846). Am 12. vorigen
Monats fand die feierliche Vereidigung und förmliche Installation des
Rabbiners hiesiger Stadt, Ph. Heidenheim, vor dem in pleno versammelten
Regierungskollegio, dem löblichen Vorstande hiesiger israelitischer
Gemeinde, einigen anderweitigen Mitgliedern derselben und den
Synagogenbeamten auf eine wahrhaft erhebende Weise statt. Der Herr
Regierungspräsident hielt vor der Verteidigung eine ergreifende Rede,
worin er namentlich hervorhob, wie in unserer Zeit allerdings ein ruhiger,
besonnener Fortschritt gar sehr Not tue, dass man aber keineswegs
vorschnell das bewährte Alte aus Hang zur Neuerungssucht stürzen solle.
Hierauf wurde die Dienstinstruktion von einem Regierungsbeamten vorgelesen
und der Rabbiner darauf vereidigt, wobei kein weiteres Zeremoniell vorkam.
Die Synagogenbeamten mussten ihm alsdann den Handschlag geben, seinen
Anordnungen pünktlich Folge leisten zu wollen. Unterm 22. ward dessen Bestallung
und Vereidigung im hiesigen Regierungsblatte N. 47 publiziert und unterm
29. hielt er vor einem zahlreichen Auditorio seine Antrittsrede als
Rabbiner, nachdem er schon seit 12 Jahren als Religionslehrer und Prediger
in hiesiger Gemeinde mit Segen und Eifer gewirkt. Er hatte zum Text:
Maleachi 2,6.7 und sprach über den hohen Beruf des Geistlichen; er
bestehe darin: 1) dass er seine Gemeinde leite zu innerer lauterer
Gotteserkenntnis, 2) dass er seine Gemeinde erfülle mit immer wärmerer
Menschenliebe, 3) dass er seiner Gemeinde vorangehe mit seinem eigenen
Beispiele. Er hat schon seit längerer Zeit die Einrichtung getroffen, an
jedem Sabbat, an welchem nicht gepredigt wird, vor dem EInheben einen
extemporierten Vortrag über die Sedra oder Haphtora (sc. Tora- oder
Prophetenabschnitt zu diesem Sabbat) in der Synagoge zu halten, was
sich als recht zweckmäßig herausgestellt hat. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Januar
1846: "Sondershausen, 30. Dezember (1846). Am 12. vorigen
Monats fand die feierliche Vereidigung und förmliche Installation des
Rabbiners hiesiger Stadt, Ph. Heidenheim, vor dem in pleno versammelten
Regierungskollegio, dem löblichen Vorstande hiesiger israelitischer
Gemeinde, einigen anderweitigen Mitgliedern derselben und den
Synagogenbeamten auf eine wahrhaft erhebende Weise statt. Der Herr
Regierungspräsident hielt vor der Verteidigung eine ergreifende Rede,
worin er namentlich hervorhob, wie in unserer Zeit allerdings ein ruhiger,
besonnener Fortschritt gar sehr Not tue, dass man aber keineswegs
vorschnell das bewährte Alte aus Hang zur Neuerungssucht stürzen solle.
Hierauf wurde die Dienstinstruktion von einem Regierungsbeamten vorgelesen
und der Rabbiner darauf vereidigt, wobei kein weiteres Zeremoniell vorkam.
Die Synagogenbeamten mussten ihm alsdann den Handschlag geben, seinen
Anordnungen pünktlich Folge leisten zu wollen. Unterm 22. ward dessen Bestallung
und Vereidigung im hiesigen Regierungsblatte N. 47 publiziert und unterm
29. hielt er vor einem zahlreichen Auditorio seine Antrittsrede als
Rabbiner, nachdem er schon seit 12 Jahren als Religionslehrer und Prediger
in hiesiger Gemeinde mit Segen und Eifer gewirkt. Er hatte zum Text:
Maleachi 2,6.7 und sprach über den hohen Beruf des Geistlichen; er
bestehe darin: 1) dass er seine Gemeinde leite zu innerer lauterer
Gotteserkenntnis, 2) dass er seine Gemeinde erfülle mit immer wärmerer
Menschenliebe, 3) dass er seiner Gemeinde vorangehe mit seinem eigenen
Beispiele. Er hat schon seit längerer Zeit die Einrichtung getroffen, an
jedem Sabbat, an welchem nicht gepredigt wird, vor dem EInheben einen
extemporierten Vortrag über die Sedra oder Haphtora (sc. Tora- oder
Prophetenabschnitt zu diesem Sabbat) in der Synagoge zu halten, was
sich als recht zweckmäßig herausgestellt hat.
Da die Instruktion für den Rabbiner höchst human abgefasst, und
dergleichen Dokumente wenige noch veröffentlicht sind, so folgt sie
hierbei in ihren Hauptbestimmungen: zum weiteren Lesen bitte
Textabbildungen anklicken.
|
 Die
Instruktion endet mit den Sätzen: Die
Instruktion endet mit den Sätzen:
"Wir versehen uns von dem Rabbiner Heidenheim, dass er alle ihm
hiernach obliegenden Pflichten mit Treue und Eifer erfüllen, sich als
rechtlicher und gewissenhafter Beamter bewähren, der ihm anvertrauten
Gemeinde ein Vorbild in allem Guten sein und so dem in ihn gesetzten
Vertrauen vollkommen entsprechen werde, und sichern ihm in dieser
Voraussetzung kraft höchster Ermächtigung nicht nur kräftigen
obrigkeitlichen Schutz bei Ausübung seiner amtlichen Funktionen, sondern
auch den Genuss der mit seinem Amte verbundenen Einkünfte und Emolumente
und der herkömmlichen von demselben abhängigen Prärogativen an Ehre und
Rang zu.
Zu Urkunde dessen haben wir diese Bestallung ausgefertigt und dieselbe mit
unserem Dienstsiegel und gewöhnlicher Unterschrift versehen.
Sondershausen am 1. November 1845. Fürstlich schwarzburgische Regierung.
F. W. Leopold. A. Hesse." |
Amtseinführung von Rabbiner Dr. Philipp
Heidenheim (1855)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Januar 1855:
"Frankenhausen (Thüringen), im Dezember (1855). Unsere
Staatsregierung hat unsere Gemeindestatuten bestätigt und uns demgemäss
in der Person des Herrn Rabbiner Ph. Heidenheim - Oberlehrer der
fürstlichen Realschule zu Sondershausen - einen würdigen und wackeren
Geistlichen eingesetzt. Der von uns allen hochgeschätzte Herr Rabbiner
hielt demnach am 9. Dezember dieses Jahres, nachdem er am Tage zuvor
amtlich verpflichtet worden, im Beisein vieler respektiven Zuhörer,
namentlich auch evangelischer Konfession, in unserer Synagoge seine
Antrittspredigt, in welcher er den beruf des jüdischen Geistlichen im
Judentum, verbinden mit den Hauptprinzipien des Mosaismus, trefflich
entwickelte (1. Mose 35,10). Der Eindruck, den die ganze Feier überhaupt,
verbunden mit Choralgesang und neuer Einrichtung des Gottesdienstes, auf
Herz und Gemüt der Zuhörer hinterlassen, ist nicht zu schildern, und
lange noch wird uns diese erhebende Feier im Geiste vorschweben. Möge der
Allmächtige seinen reichen Segen dem neugeschlossenen Bunde spenden! -
Frieden den Nahen und den Fernen! - S.W." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Januar 1855:
"Frankenhausen (Thüringen), im Dezember (1855). Unsere
Staatsregierung hat unsere Gemeindestatuten bestätigt und uns demgemäss
in der Person des Herrn Rabbiner Ph. Heidenheim - Oberlehrer der
fürstlichen Realschule zu Sondershausen - einen würdigen und wackeren
Geistlichen eingesetzt. Der von uns allen hochgeschätzte Herr Rabbiner
hielt demnach am 9. Dezember dieses Jahres, nachdem er am Tage zuvor
amtlich verpflichtet worden, im Beisein vieler respektiven Zuhörer,
namentlich auch evangelischer Konfession, in unserer Synagoge seine
Antrittspredigt, in welcher er den beruf des jüdischen Geistlichen im
Judentum, verbinden mit den Hauptprinzipien des Mosaismus, trefflich
entwickelte (1. Mose 35,10). Der Eindruck, den die ganze Feier überhaupt,
verbunden mit Choralgesang und neuer Einrichtung des Gottesdienstes, auf
Herz und Gemüt der Zuhörer hinterlassen, ist nicht zu schildern, und
lange noch wird uns diese erhebende Feier im Geiste vorschweben. Möge der
Allmächtige seinen reichen Segen dem neugeschlossenen Bunde spenden! -
Frieden den Nahen und den Fernen! - S.W." |
Ausschreibung der Stelle des Schächters in der
israelitischen Gemeinde (1858)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
5. April 1858: "Offene Stelle. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
5. April 1858: "Offene Stelle.
Bei der hiesigen israelitischen Gemeinde ist die Stelle eines
'Schächters' mit einem jährlichen Einkommen von '200 Thalern' vakant.
Darauf Reflektierende wollen sich gefälligst franco an den
unterzeichneten Vorstand wenden.
Sondershausen, den 19. März 1858. Der Vorstand der israelitischen
Gemeinde. Hofagent M. Czarnikow." |
Rückblick auf 25 Jahre seines Wirkens in Sondershausen
von Philipp Heidenheim (1859)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 13. Juni 1859: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 13. Juni 1859:
Zum Lesen bitte Textabbildungen anklicken. |
 |
 |
Goldene Hochzeit von Prof. Heidenheim und seiner Frau
Lina geb. Leser (1889)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 8. August 1889: "Wie wir hören, wird am 28. August dieses
Jahres der Rabbiner Prof. Heidenheim in Sondershausen seine
goldene Hochzeit feiern. Den vielen Freunden und Schülern des
verdienstvollen Seelsorgers und Lehrers wird es angenehm sein, diese
Mitteilung zu empfangen". Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 8. August 1889: "Wie wir hören, wird am 28. August dieses
Jahres der Rabbiner Prof. Heidenheim in Sondershausen seine
goldene Hochzeit feiern. Den vielen Freunden und Schülern des
verdienstvollen Seelsorgers und Lehrers wird es angenehm sein, diese
Mitteilung zu empfangen". |
| |
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12.
September 1889: "(Man) schreibt uns aus Sondershausen:
Mittwoch den 28. August feierte Herr Rabbiner Professor Philipp
Heidenheim und seine Gattin Lina geb. Leser das seltene Fest
der goldenen Hochzeit, umgeben von 36 Familienmitgliedern, Kindern,
Enkeln und Urenkeln, unter Beteiligung zahlreicher Freunde. Der Jubilar,
der als Rabbiner 56 Jahre wirkt, war bis vor Kurzem Lehrer der höheren
Staatschule, Ordinarius in Prima und Sekunda und gewann sich das Vertrauen
des Fürsten und seiner christlichen Kollegen in seltenem Maße. Vor
Jahren zum Professor ernannt und mit einem Orden geschmückt, erwies
anlässlich dieses Familienfestes das Fürstenhaus dem Jubelpaare wieder
seltene Ehren. Der alte Fürst sandte einen prachtvollen Pokal mit
Inschrift, der regierende Fürst Karl Günther eine Philippson-Dore'sche Prachtbibel
mit Widmung. Die Stadt ließ den Weg von der Wohnung des verehrten Paares
bis zur Synagoge, wo die feierliche Einsegnung 1 1/2 Uhr Nachmittags
stattfand, mit Bäumen bepflanzen. Es erschienen die
protestantischen Geistlichen, Militär- und Zivilbehörden, Deputationen
von Gewerbe- und Humanitätsvereine, die israelitische Gemeinde, und zahlreiche
andere Gratulanten mit reichen Geschenken und Blumenspenden. Von allen
Gegenden liefen nahezu 350 Depeschen ein, und die Glückwünsche von 300
Zöglingen, die Heidenheim in seinem trefflichen Pensionate früher
erzogen hatte, zu dem auch Professor Lazarus und Direktor Wahl
zählten. Auch der Deutsch-Israelitische Gemeindebund und die Alliance
sandten schriftlichen Ehrenbezeugungen. In der Synagoge, wohin sich der
stattliche Festzug begab, hielt der langjährige Freund und Kollege, Prediger
Dr. Leimdörfer aus Hamburg, die Festrede über Psalm 118,15, die
sowohl das seltene, innige Familienleben, als auch das Gottgesegnete
Wirken des Patriarchenpaares in ergreifenden Worten feierte. Die Rede
schloss mit einer feierlichen Einsegnung der Ehegatten. Diesem Festakte
folgte ein Bankett, gewürzt von genussreichen Toasten und Tischliedern
und ein Festspiel 'Der Erntesegen', verfasst von der als Dichterin
bekannten Tochter des Hauses Heidenheim, Frau Bier aus Köln, das
mit Überreichung eines riesigen, kunstvoll gestickten Goldkranzes endete.
Möge dem Jubelpaare ein heiterer Lebensabend beschieden
sein!" Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12.
September 1889: "(Man) schreibt uns aus Sondershausen:
Mittwoch den 28. August feierte Herr Rabbiner Professor Philipp
Heidenheim und seine Gattin Lina geb. Leser das seltene Fest
der goldenen Hochzeit, umgeben von 36 Familienmitgliedern, Kindern,
Enkeln und Urenkeln, unter Beteiligung zahlreicher Freunde. Der Jubilar,
der als Rabbiner 56 Jahre wirkt, war bis vor Kurzem Lehrer der höheren
Staatschule, Ordinarius in Prima und Sekunda und gewann sich das Vertrauen
des Fürsten und seiner christlichen Kollegen in seltenem Maße. Vor
Jahren zum Professor ernannt und mit einem Orden geschmückt, erwies
anlässlich dieses Familienfestes das Fürstenhaus dem Jubelpaare wieder
seltene Ehren. Der alte Fürst sandte einen prachtvollen Pokal mit
Inschrift, der regierende Fürst Karl Günther eine Philippson-Dore'sche Prachtbibel
mit Widmung. Die Stadt ließ den Weg von der Wohnung des verehrten Paares
bis zur Synagoge, wo die feierliche Einsegnung 1 1/2 Uhr Nachmittags
stattfand, mit Bäumen bepflanzen. Es erschienen die
protestantischen Geistlichen, Militär- und Zivilbehörden, Deputationen
von Gewerbe- und Humanitätsvereine, die israelitische Gemeinde, und zahlreiche
andere Gratulanten mit reichen Geschenken und Blumenspenden. Von allen
Gegenden liefen nahezu 350 Depeschen ein, und die Glückwünsche von 300
Zöglingen, die Heidenheim in seinem trefflichen Pensionate früher
erzogen hatte, zu dem auch Professor Lazarus und Direktor Wahl
zählten. Auch der Deutsch-Israelitische Gemeindebund und die Alliance
sandten schriftlichen Ehrenbezeugungen. In der Synagoge, wohin sich der
stattliche Festzug begab, hielt der langjährige Freund und Kollege, Prediger
Dr. Leimdörfer aus Hamburg, die Festrede über Psalm 118,15, die
sowohl das seltene, innige Familienleben, als auch das Gottgesegnete
Wirken des Patriarchenpaares in ergreifenden Worten feierte. Die Rede
schloss mit einer feierlichen Einsegnung der Ehegatten. Diesem Festakte
folgte ein Bankett, gewürzt von genussreichen Toasten und Tischliedern
und ein Festspiel 'Der Erntesegen', verfasst von der als Dichterin
bekannten Tochter des Hauses Heidenheim, Frau Bier aus Köln, das
mit Überreichung eines riesigen, kunstvoll gestickten Goldkranzes endete.
Möge dem Jubelpaare ein heiterer Lebensabend beschieden
sein!" |
Zum Tod von Lina Heidenheim, Frau von Professor Dr.
Philipp Heidenheim (1897)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. November 1897: "Sondershausen, 9. November
(1897). Am 22. vorigen Monats verschied in fast vollendetem 86.
Lebensjahre die Gattin des ehrwürdigen Rabbiners Professor Heidenheim.
Der Tod endete das glücklichste, reich gesegnete Bündnis zweiter
Menschen, die über 58 Jahre in Treue und Liebe den Kampf des Daseins
mitsammen trugen. Die edle Entschlafene war das Urbild eines echt
jüdischen Weibes, ihr Haus war gegründet auf Frömmigkeit, Fleiß und
Frieden. Sie sorgte als unermüdliche Hausfrau vom dämmernden Morgen bis
zum späten Abend mit weiser Sparsamkeit für die große Wirtschaft; aber
sie war auch die geistige Genossin ihres Mannes, seines Helferin im Wohl tun,
seine Trösterin und Pflegerin in kummervollen Zeiten. Nicht nur sechs
eigene Kinder lenkte ihre sorgende Mutterliebe zu dem Pfad der Pflicht,
auf dem sie als brave, tüchtige Menschen den Eltern zur Freude wandelten,
sondern gegen dreihundert Knaben erzog sie vereint mit ihrem Gatten voll
Aufopferung und Liebe. Manches Zögling in fernen Landen wird den Heimgang
der verehrten Pflegemutter durch diese Notiz erfahren und ihrem Andenken
eine Träne der Erinnerung weihen, des Lehrers gedenkend, der seine treue
Gefährtin verloren. Und wenn es einen Trost gibt, so ist es der, dass
nicht nur Kinder, Enkel und Urenkel mit ihm trauern, sondern alle Heimatgenossen,
alle Freunde in der Ferne. Die Teilnahme der Gemeinde, der Kollegen der
fürstlichen Schule, aller christlichen Mitbürger zeigte am
Begräbnistage die Wertschätzung, die das rastlose Wirken ihm erworben.
Über 63 Jahre ist Rabbiner Heidenheim ja der Seelsorger der Gemeinde, und
noch jetzt waltet er in ungetrübter geistiger Frische seines Amtes als
Prediger. Sechsundvierzig Jahre unterrichtete er in den höheren Klassen
der Realschule. Welch eine Welt von Arbeit und Mühen, aber auch von
Genugtuung und segensreichen Erfolgen. Nun, da er sein bestes Erdengut dem
Schoße der Erde vertraute, musste der beredte Mund schweigen, der so oft
ein Tröster der Trauernden geworden an der letzten Ruhestätte. Am Grabe
der Frau Lina Heidenheim sprach der Kantor Schönlank in ergreifender
Weise den Scheidegruß. Er schilderte die Tugenden der Heimgegangenen und
betete für die, die sie auf Erden verlassen. Ihr Lebenslicht ist
verglüht, aber das Werk ihres Lebens wird bleiben! Die Verblichene ward
die Stammmutter einer weit verzweigten Familie, und ihre Unsterblichkeit
ist, dass sie das Vorbild ihrer Nachkommen bleiben wird in allen
Eigenschaften einer wahrhaft frommen, edlen jüdischen
Frau."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. November 1897: "Sondershausen, 9. November
(1897). Am 22. vorigen Monats verschied in fast vollendetem 86.
Lebensjahre die Gattin des ehrwürdigen Rabbiners Professor Heidenheim.
Der Tod endete das glücklichste, reich gesegnete Bündnis zweiter
Menschen, die über 58 Jahre in Treue und Liebe den Kampf des Daseins
mitsammen trugen. Die edle Entschlafene war das Urbild eines echt
jüdischen Weibes, ihr Haus war gegründet auf Frömmigkeit, Fleiß und
Frieden. Sie sorgte als unermüdliche Hausfrau vom dämmernden Morgen bis
zum späten Abend mit weiser Sparsamkeit für die große Wirtschaft; aber
sie war auch die geistige Genossin ihres Mannes, seines Helferin im Wohl tun,
seine Trösterin und Pflegerin in kummervollen Zeiten. Nicht nur sechs
eigene Kinder lenkte ihre sorgende Mutterliebe zu dem Pfad der Pflicht,
auf dem sie als brave, tüchtige Menschen den Eltern zur Freude wandelten,
sondern gegen dreihundert Knaben erzog sie vereint mit ihrem Gatten voll
Aufopferung und Liebe. Manches Zögling in fernen Landen wird den Heimgang
der verehrten Pflegemutter durch diese Notiz erfahren und ihrem Andenken
eine Träne der Erinnerung weihen, des Lehrers gedenkend, der seine treue
Gefährtin verloren. Und wenn es einen Trost gibt, so ist es der, dass
nicht nur Kinder, Enkel und Urenkel mit ihm trauern, sondern alle Heimatgenossen,
alle Freunde in der Ferne. Die Teilnahme der Gemeinde, der Kollegen der
fürstlichen Schule, aller christlichen Mitbürger zeigte am
Begräbnistage die Wertschätzung, die das rastlose Wirken ihm erworben.
Über 63 Jahre ist Rabbiner Heidenheim ja der Seelsorger der Gemeinde, und
noch jetzt waltet er in ungetrübter geistiger Frische seines Amtes als
Prediger. Sechsundvierzig Jahre unterrichtete er in den höheren Klassen
der Realschule. Welch eine Welt von Arbeit und Mühen, aber auch von
Genugtuung und segensreichen Erfolgen. Nun, da er sein bestes Erdengut dem
Schoße der Erde vertraute, musste der beredte Mund schweigen, der so oft
ein Tröster der Trauernden geworden an der letzten Ruhestätte. Am Grabe
der Frau Lina Heidenheim sprach der Kantor Schönlank in ergreifender
Weise den Scheidegruß. Er schilderte die Tugenden der Heimgegangenen und
betete für die, die sie auf Erden verlassen. Ihr Lebenslicht ist
verglüht, aber das Werk ihres Lebens wird bleiben! Die Verblichene ward
die Stammmutter einer weit verzweigten Familie, und ihre Unsterblichkeit
ist, dass sie das Vorbild ihrer Nachkommen bleiben wird in allen
Eigenschaften einer wahrhaft frommen, edlen jüdischen
Frau." |
90. Geburtstag von Rabbiner Professor Philipp
Heidenheim (1904)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13.
Juni 1904: "Sondershausen, 7. Juni (1904). Am 14. Juni feiert
der Rabbiner Professor Heidenheim seinen 90-jährigen Geburtstag,
nachdem er am 4. April dieses Jahres sein 70-jähriges Amtsjubiläum in
der hiesigen jüdischen Gemeinde hatte begehen können. Dieser überaus
seltene Jubeltag soll mit dem Geburtstag besonders gefeiert werden. Der
alte Herr erfreut sich noch körperlicher Frische und eines überaus regen
Geistes; er versteht es noch, seinen Gedanken mit logischer Schärfe und
Klarheit von der Kanzel aus beredten Ausdruck zu geben. Seiner Gemeinde,
die mit Liebe an ihm hängt, ist er nicht allein Seelsorger, sondern auch
Freund und väterlicher Berater in allen Lebenslagen
gewesen." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13.
Juni 1904: "Sondershausen, 7. Juni (1904). Am 14. Juni feiert
der Rabbiner Professor Heidenheim seinen 90-jährigen Geburtstag,
nachdem er am 4. April dieses Jahres sein 70-jähriges Amtsjubiläum in
der hiesigen jüdischen Gemeinde hatte begehen können. Dieser überaus
seltene Jubeltag soll mit dem Geburtstag besonders gefeiert werden. Der
alte Herr erfreut sich noch körperlicher Frische und eines überaus regen
Geistes; er versteht es noch, seinen Gedanken mit logischer Schärfe und
Klarheit von der Kanzel aus beredten Ausdruck zu geben. Seiner Gemeinde,
die mit Liebe an ihm hängt, ist er nicht allein Seelsorger, sondern auch
Freund und väterlicher Berater in allen Lebenslagen
gewesen." |
Zum Tod des
Sohnes von Rabbiner Philipp Heidenheim: Geheimer Sanitätsrat Dr. Richard
Heidenheim (1910 in Wiesbaden)
Anmerkung: Richard Heidenheim ist 1840/41 sehr wahrscheinlich in
Sondershausen geboren. Er war später 30 Jahre erfolgreicher Arzt in Münster
(Westfalen) und lebte seit ca. 1895 im Ruhestand in Wiesbaden.
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Februar
1910: "Wiesbaden, 28. Januar (1910). In der Nacht vom 19.
zum 20. Januar verschied hier im Alter von fast 70 Jahren der Geheime
Sanitätsrat Dr. Richard Heidenheim, ein Sohn des vor einigen Jahren
verstorbenen Rabbiners von Sondershausen, des rühmlichst bekannten
Professors Philipp Heidenheim. Er war in gleicher Weise als Arzt
und Mensch ausgezeichnet und bekundete für das Judentum stets das
lebhafteste Interesse. Unter großer Anteilnahme weiter Kreise fand darum
am 23. Januar die Beisetzung auf dem hiesigen israelitischen Friedhof
statt, bei der der Bezirksrabbiner Dr. Kober und Vertreter des hiesigen
Ärztevereins, der Nassauloge U.O.B.B., des Zentralvereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens und des Kuratoriums der israelitischen
Kinderheilstätte in Bad Kissingen dem Verewigten Worte der
Anerkennung und des Dankes nachriefen. Der Münsterische Anzeiger vom 21.
Januar widmet ihm folgenden Nachruf: '30 Jahre lang hat er mit
unermüdlichem Eifer in unserer Stadt gewirkt, und als er vor 15 Jahren
nach Wiesbaden übersiedelte, weil er sich nicht mehr imstande fühlte,
seine übergroße Praxis zu bewältigen, hat sein Fortzug allgemein
großes Bedauern verursacht. Er war nicht nur ein berufsfreudiger,
allezeit hilfsbereiter Arzt, er war auch ein edler, guter Mensch, mit
weichem, mitfühlendem Herzen, ein treu wirkender Helfer der Armen, denen
er freudig seine ärztliche Tätigkeit ohne Entlohnung widmete, denen er
Arzneien und Stärkungsmittel zutrug und mit reichen Geldspenden aushalf,
jeden Dank ablehnend. Gar manche Träne hat er getrocknet, und in stiller
Verborgenheit unendlich viel Gutes gewirkt. Möge es ihm im Jenseits
entlohnt werden.'" Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Februar
1910: "Wiesbaden, 28. Januar (1910). In der Nacht vom 19.
zum 20. Januar verschied hier im Alter von fast 70 Jahren der Geheime
Sanitätsrat Dr. Richard Heidenheim, ein Sohn des vor einigen Jahren
verstorbenen Rabbiners von Sondershausen, des rühmlichst bekannten
Professors Philipp Heidenheim. Er war in gleicher Weise als Arzt
und Mensch ausgezeichnet und bekundete für das Judentum stets das
lebhafteste Interesse. Unter großer Anteilnahme weiter Kreise fand darum
am 23. Januar die Beisetzung auf dem hiesigen israelitischen Friedhof
statt, bei der der Bezirksrabbiner Dr. Kober und Vertreter des hiesigen
Ärztevereins, der Nassauloge U.O.B.B., des Zentralvereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens und des Kuratoriums der israelitischen
Kinderheilstätte in Bad Kissingen dem Verewigten Worte der
Anerkennung und des Dankes nachriefen. Der Münsterische Anzeiger vom 21.
Januar widmet ihm folgenden Nachruf: '30 Jahre lang hat er mit
unermüdlichem Eifer in unserer Stadt gewirkt, und als er vor 15 Jahren
nach Wiesbaden übersiedelte, weil er sich nicht mehr imstande fühlte,
seine übergroße Praxis zu bewältigen, hat sein Fortzug allgemein
großes Bedauern verursacht. Er war nicht nur ein berufsfreudiger,
allezeit hilfsbereiter Arzt, er war auch ein edler, guter Mensch, mit
weichem, mitfühlendem Herzen, ein treu wirkender Helfer der Armen, denen
er freudig seine ärztliche Tätigkeit ohne Entlohnung widmete, denen er
Arzneien und Stärkungsmittel zutrug und mit reichen Geldspenden aushalf,
jeden Dank ablehnend. Gar manche Träne hat er getrocknet, und in stiller
Verborgenheit unendlich viel Gutes gewirkt. Möge es ihm im Jenseits
entlohnt werden.'" |
70. Geburtstag des Kultusbeamten Schönlank - über
Rabbiner Prof. Heidenheim - zurückgehende Zahl der Gemeindemitglieder (1901)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 18. Januar 1901: "Sondershausen, 7. Januar (1901). Am 30.
vorigen Monats feierte unser verehrter Kultusbeamter Schönlank in
leiblicher und geistiger Frische seinen 70. Geburtstag. Unser Rabbiner
Professor Heidenheim brachte ihm mit den Gemeindevorstehern Bedelmeier und
Hoflieferanten Leser die herzlichsten Glückwünsche dar und überreichten
ihm im Namen der Gemeinde Ehrengaben, wie dies auch von vielen
Gemeindemitgliedern erfreuend und teilnehmend der Fall war. Am darauf
folgenden Sabbat sprach beim Gottesdienste unser Rabbiner in warmen Worten
über die pflichtgetreue Wirksamkeit des Jubilars - Schönlank ist seit 36
1/4 Jahren als Kantor, Schochet und Religionslehrer in lobenswerter und
anerkannter Weise im Dienste unserer Gemeinde - und betete für sein
ferneres Wohlergehen und die Verlängerung seines Lebens mit der
gewürdigten Berufsfreudigkeit. - Unser Rabbiner Prof. Heidenheim,
der im 87. Lebensjahre steht, wirkt in unserer Gemeinde fast 67 Jahre
ununterbrochen, hat sich der allgemeinen Achtung und Liebe zu erfreuen,
wird auch als Rabbiner zu allen größeren Hoffestlichkeiten geladen,
musste aber als Professor der fürstlichen Realschule sich wegen
Augenschwäche nach 46-jähriger Dienstzeit pensionieren lassen. Er
unterrichtete in Prima und Sekunda, deren Ordinarius er war, in der
Mathematik, Geographie und im Deutschen, zeitweilig auch in der Geschichte
und im Lateinischen, war ehemals auch Vertreter des Direktors. - Da unsere
fürstliche Residenz nicht auch Industriestadt ist, so ist leider die
Zahl der Mitglieder unserer Gemeinde im Abnehmen begriffen, und es
wäre sehr zu wünschen, dass auch jüdische Rentiers, wie das von
christlicher Seite vielfach der Fall ist, ihren Aufenthalt hier nehmen.
Das Klima ist vorzüglich, für Kunst und Wissenschaft reichlich gesorgt.
Wir haben vorzügliche Lehranstalten: Gymnasium, Realschule, höhere
Töchterschule, Lehrer- und Lehrerinnenseminar, Konservatorium für Musik
usw. Gute Wohnung, nicht zu teuer, sind zu haben, die Steuern nicht zu
hoch und die Lebensbedürfnisse billig."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 18. Januar 1901: "Sondershausen, 7. Januar (1901). Am 30.
vorigen Monats feierte unser verehrter Kultusbeamter Schönlank in
leiblicher und geistiger Frische seinen 70. Geburtstag. Unser Rabbiner
Professor Heidenheim brachte ihm mit den Gemeindevorstehern Bedelmeier und
Hoflieferanten Leser die herzlichsten Glückwünsche dar und überreichten
ihm im Namen der Gemeinde Ehrengaben, wie dies auch von vielen
Gemeindemitgliedern erfreuend und teilnehmend der Fall war. Am darauf
folgenden Sabbat sprach beim Gottesdienste unser Rabbiner in warmen Worten
über die pflichtgetreue Wirksamkeit des Jubilars - Schönlank ist seit 36
1/4 Jahren als Kantor, Schochet und Religionslehrer in lobenswerter und
anerkannter Weise im Dienste unserer Gemeinde - und betete für sein
ferneres Wohlergehen und die Verlängerung seines Lebens mit der
gewürdigten Berufsfreudigkeit. - Unser Rabbiner Prof. Heidenheim,
der im 87. Lebensjahre steht, wirkt in unserer Gemeinde fast 67 Jahre
ununterbrochen, hat sich der allgemeinen Achtung und Liebe zu erfreuen,
wird auch als Rabbiner zu allen größeren Hoffestlichkeiten geladen,
musste aber als Professor der fürstlichen Realschule sich wegen
Augenschwäche nach 46-jähriger Dienstzeit pensionieren lassen. Er
unterrichtete in Prima und Sekunda, deren Ordinarius er war, in der
Mathematik, Geographie und im Deutschen, zeitweilig auch in der Geschichte
und im Lateinischen, war ehemals auch Vertreter des Direktors. - Da unsere
fürstliche Residenz nicht auch Industriestadt ist, so ist leider die
Zahl der Mitglieder unserer Gemeinde im Abnehmen begriffen, und es
wäre sehr zu wünschen, dass auch jüdische Rentiers, wie das von
christlicher Seite vielfach der Fall ist, ihren Aufenthalt hier nehmen.
Das Klima ist vorzüglich, für Kunst und Wissenschaft reichlich gesorgt.
Wir haben vorzügliche Lehranstalten: Gymnasium, Realschule, höhere
Töchterschule, Lehrer- und Lehrerinnenseminar, Konservatorium für Musik
usw. Gute Wohnung, nicht zu teuer, sind zu haben, die Steuern nicht zu
hoch und die Lebensbedürfnisse billig." |
Zum Tod von Lehrer und Kantor a.D. Schönlank (1921)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. Januar
1921: "In Sondershausen starb im hohen Alter von 90 Jahren
der Lehrer und Kantor a.D. Schönlank. Mit ihm ist einer der
ältesten jüdischen Lehrer dahingegangen, der sich noch durch große
jüdische Kenntnisse ausgezeichnet hat." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. Januar
1921: "In Sondershausen starb im hohen Alter von 90 Jahren
der Lehrer und Kantor a.D. Schönlank. Mit ihm ist einer der
ältesten jüdischen Lehrer dahingegangen, der sich noch durch große
jüdische Kenntnisse ausgezeichnet hat." |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Ausschreibung der Stelle eines Schochet (1860)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 8. Mai 1860: "Bekanntmachung. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 8. Mai 1860: "Bekanntmachung.
Die Stelle eines Schochet in hiesiger Gemeinde ist sofort oder spätestens
bis zum 15. Juli dieses Jahres wieder zu besetzen; das Einkommen beläuft
sich auf circa 200 Thaler jährlich. - Zeit und Gelegenheit zur Fortbildung
oder auch zur Erteilung von Privatunterricht ist vielfach gegeben.
Reflektanten wollen sich mit der erforderlichen Zeugnissen in portofreien
Briefen baldigst an uns wenden.
Sondershausen, den 26. April 1860. Der Vorstand der hiesigen
Synagogen-Gemeinde." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 29. Oktober 1861: "Für unser Tuch- und Modewaren-Geschäft
suchen wir zum sofortigen Antritt einen tüchtigen Commis israelitischer
Konfession, der mit dem Verkauf und der Korrespondenz vertraut ist. -
Gleichzeitig kann ein Sohn rechtlicher Eltern sofort als Lehrling bei uns
eintreten. Offerten werden franko erbeten. D. & M. Wahl in Sondershausen
in Thüringen." Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 29. Oktober 1861: "Für unser Tuch- und Modewaren-Geschäft
suchen wir zum sofortigen Antritt einen tüchtigen Commis israelitischer
Konfession, der mit dem Verkauf und der Korrespondenz vertraut ist. -
Gleichzeitig kann ein Sohn rechtlicher Eltern sofort als Lehrling bei uns
eintreten. Offerten werden franko erbeten. D. & M. Wahl in Sondershausen
in Thüringen." |
Anzeigen von Metzgermeister M. Leser (1872 / 1873)
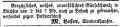 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 30. Januar 1872: "Vorzügliches, weißes, unverfälschtes
Gänseschmalz in Büchsen von 2 bis 7 Pfund auch zu Pessach zu gebrauchen,
versendet gegen Postvorschuss Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 30. Januar 1872: "Vorzügliches, weißes, unverfälschtes
Gänseschmalz in Büchsen von 2 bis 7 Pfund auch zu Pessach zu gebrauchen,
versendet gegen Postvorschuss
M. Leser, Sondershausen". |
| |
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar
1873: "Koscher.
Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar
1873: "Koscher.
Gute Rindswurst à Pfd. 12 1/2 Sgr., Gänsewurst 17 1/2 Sgr.,
Gänsebrüste sehr schön à Pfd. 17 1/2 Sgd., Gänsekeulen à St. 7 1/2
bis 10 Sgr., Gänseschmalz reines und weißes unverfälschtes à Pfd. 20
Sgr., Rauchbrust à Pfd. 12 1/2 Sgr. ohne Knochen bei
M. Leser, Sondershausen (Thüringen)." |
Anzeige des Mädchenpensionates von Frau Oberlehrer
Goldschmidt (1885)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 10. Februar 1885: "Pensionat in Sondershausen. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 10. Februar 1885: "Pensionat in Sondershausen.
Zu Ostern finden junge Mädchen freundliche Aufnahme. Höhere
Töchterschule, Lehrerinnen-Seminar und Konservatorium der Musik a Platze,
gründliche Erlernung des Haushalts und aller weiblichen Handarbeiten,
sowie Gelegenheit zur gesellschaftlichen Ausbildung im Hause. Gute
Referenzen durch den Herrn Realschul-Direktor Schmidt.
Frau Oberlehrer Goldschmidt." |
Todesanzeige für Regine Schönland geb. Rosenbaum
(1928)
 Anzeige
in der "CV-Zeitung" (Zeitung des Central-Vereins) vom 5. Oktober
1928: "Am 24. September verschied plötzlich und unerwartet am
Herzschlag unsere geliebte Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, liebe
Schwester, Schwägerin und Tante Anzeige
in der "CV-Zeitung" (Zeitung des Central-Vereins) vom 5. Oktober
1928: "Am 24. September verschied plötzlich und unerwartet am
Herzschlag unsere geliebte Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, liebe
Schwester, Schwägerin und Tante
Frau Regine Schönland geb. Rosenbaum im 53. Lebensjahr.
Im Namen der trauernden Hinterbliebenen:
Max Redelmaier und Frau Henny geb. Schönland. Leo Stern und Frau
Erna geb. Schönland.
Frankenhausen (Kyffh.), 26.
September 1928. Sondershausen in Thüringen, Geseke in
Westfalen." |
Zur Geschichte der Synagoge
Bereits im Mittelalter gab es eine
vermutlich Synagoge. Bei Ausgrabungen 1998/99 zum Bau der "Galerie am
Schlossberg" wurden wenige Meter nördlich der damals wiederentdeckten
Grundmauern der Synagoge aus dem 19. Jahrhundert (siehe unten) die Reste eines rund 700 Jahre
alten rituellen jüdischen
Bades (Mikwe) entdeckt. 2001 wurde das Bad bei weiteren Grabungen offen gelegt.
Dieses Bad an der Außenseite alten Stadtmauer ist vermutlich im Mittelalter nach
den Pestpogromen in der Mitte des 14. Jahrhunderts zugeschüttet
und dann vergessen worden. Das 1975 abgerissene Altstadt-Areal gehörte zum
einstigen jüdischen Viertel. Das Bad ist nun als Denkmal in den Neubau der
"Galerie am Schlossberg" integriert und erinnert an die in der NS-Zeit
ausgelöschte jüdische Gemeinde der Stadt.
Ende des 17. Jahrhunderts lässt sich wiederum ein Betsaal nachweisen. Er
befand sich 1698 in einem - vermutlich an der Hauptstraße gelegenen -
jüdischen Wohnhaus. Vom Anfang des 18. Jahrhunderts bis
1826 befand sich ein ein Betsaal im Hinterhaus des Gebäudes Bebrastraße 31.
1825/26
erbaute die jüdische Gemeinde eine Synagoge im Hinterhaus des Gebäudes Bebrastraße. Sie wurde am 1. September 1826 mit einem großen Fest der
Gemeinde eingeweiht:
Einweihung der Synagoge in Sondershausen (1826)
 Artikel
in der Zeitschrift "Sulamith" Jahrgang 1826: "Am 1. September
1826 wurde zu Sondershausen die neu erbaute Israelitische Synagoge
feierlichst eingeweiht. So gering auch die Anzahl der Gemeindeglieder ist, und
so unbemittelt die meisten sind, so gelang es ihnen doch durch den vereinten
Willen und die allgemeinen Aufopferungen, das Gotteshaus zu erbauen, und mit den
gehörigen heiligen Geräten zu versehen. Am meisten wirksam zeigten sich die
zeitigen Vorsteher der Gemeinden, der Herr Hofagent Leser und Herr A. Levy, die
durch Wort und Tat die Gemeinde zur Ausführung des Werks aufmunterten und
unterstützten. Das Einweihungsfest war ganz geeignet, die Herzen der Bewohner
Sondershausens zu rühren, und der Würde des Gegenstandes angemessen. Die von
den Vorstehern der Gemeinde dem Durchlauchtigsten Fürsten überreichten
Schlüssel des Tempels wurden von Seiner Excellenz dem allgemeinen verehrten
Herrn Geheimrat von Ziegeler denselben feierlichst wiedergegeben, worauf Seine
Exzellenz, von den Vorstehern der Gemeinde begleitet, den Zug zum Gotteshause
eröffnete, der aus den sämtlichen Gemeindemitgliedern, aus den Honoratioren
und der Geistlichkeit der Stadt bestand. Im Tempel selbst hielt der gedacht Herr
Geheimrat eine kleine, jeden der Anwesenden ergreifende Rede, und las zugleich
ein gnädigstes Reskript Seiner Durchlaucht vor, worin der Gemeinde die
Zufriedenheit und der ferne Schutz des Durchlauchtigsten Landesvaters gnädigst
versichert wurde und das, auf diese Art, die Gemeinde für alle überstandenen Schwierigkeiten,
die sich bei dem, ohne alle Unterstützung von andern Gemeinden, unternommenen
Bau in den Weg stellten, überschwänglich belohnten. - Von einem Chor wurden
alsdann Psalmen und Danklieder gesungen, die vom Herrn Organisten Kindscher, in
Dessau, komponiert, und deren Solopartien vom Herrn Kantor Hirsch Königsberger
aus Dessau vorgetragen wurden, Auch eine deutsche Predigt, die der Feierlichkeit
angemessen war, fand statt. Gewiss wird dieser Tag noch lange in dem Gemüte
jedes der erwähnten Gemeindemitglieder leben und die segensreichsten Folgen
haben!" Artikel
in der Zeitschrift "Sulamith" Jahrgang 1826: "Am 1. September
1826 wurde zu Sondershausen die neu erbaute Israelitische Synagoge
feierlichst eingeweiht. So gering auch die Anzahl der Gemeindeglieder ist, und
so unbemittelt die meisten sind, so gelang es ihnen doch durch den vereinten
Willen und die allgemeinen Aufopferungen, das Gotteshaus zu erbauen, und mit den
gehörigen heiligen Geräten zu versehen. Am meisten wirksam zeigten sich die
zeitigen Vorsteher der Gemeinden, der Herr Hofagent Leser und Herr A. Levy, die
durch Wort und Tat die Gemeinde zur Ausführung des Werks aufmunterten und
unterstützten. Das Einweihungsfest war ganz geeignet, die Herzen der Bewohner
Sondershausens zu rühren, und der Würde des Gegenstandes angemessen. Die von
den Vorstehern der Gemeinde dem Durchlauchtigsten Fürsten überreichten
Schlüssel des Tempels wurden von Seiner Excellenz dem allgemeinen verehrten
Herrn Geheimrat von Ziegeler denselben feierlichst wiedergegeben, worauf Seine
Exzellenz, von den Vorstehern der Gemeinde begleitet, den Zug zum Gotteshause
eröffnete, der aus den sämtlichen Gemeindemitgliedern, aus den Honoratioren
und der Geistlichkeit der Stadt bestand. Im Tempel selbst hielt der gedacht Herr
Geheimrat eine kleine, jeden der Anwesenden ergreifende Rede, und las zugleich
ein gnädigstes Reskript Seiner Durchlaucht vor, worin der Gemeinde die
Zufriedenheit und der ferne Schutz des Durchlauchtigsten Landesvaters gnädigst
versichert wurde und das, auf diese Art, die Gemeinde für alle überstandenen Schwierigkeiten,
die sich bei dem, ohne alle Unterstützung von andern Gemeinden, unternommenen
Bau in den Weg stellten, überschwänglich belohnten. - Von einem Chor wurden
alsdann Psalmen und Danklieder gesungen, die vom Herrn Organisten Kindscher, in
Dessau, komponiert, und deren Solopartien vom Herrn Kantor Hirsch Königsberger
aus Dessau vorgetragen wurden, Auch eine deutsche Predigt, die der Feierlichkeit
angemessen war, fand statt. Gewiss wird dieser Tag noch lange in dem Gemüte
jedes der erwähnten Gemeindemitglieder leben und die segensreichsten Folgen
haben!" |
Hoher Besuch in der Synagoge (1838)
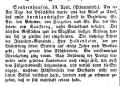 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Mai
1838: "Sondershausen, 13. April (1838). Am ersten Tage
des Pessachfestes wurde uns das Glück zuteil, dass unser
durchlauchtigster Fürst in Begleitung Seiner Excellenz des
Geheimrates von Ziegeler und Seiner Excelenz des Geheimrates von Kaufberg,
unser Gotteshaus besuchte. Die höchsten Geistlichen und der Magistrat
hiesiger Residenz hatten sich zu gleicher Zeit eingefunden. Der bisherige
Lehrer der Israeliten-Gemeinde, Herr Heidenheim, der zur Vollendung
seiner Studien auf einige Jahre nach Breslau geht, hielt gerade seine
Abschiedsrede. Ein vierstimmiger Choralgesang ging voran. Nach Anhörung
der Predigt verweilte unser geliebter Landesvater noch einige Zeit, um
auch dem Festgottesdienste beizuwohnen, und verließ dann die Synagoge,
nachdem Höchstderselbe dem Vorstande nicht nur seinen Beifall versichert
hatte, sondern auch zu erkennen geben, dass er sich wahrhaft erbaut
habe." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Mai
1838: "Sondershausen, 13. April (1838). Am ersten Tage
des Pessachfestes wurde uns das Glück zuteil, dass unser
durchlauchtigster Fürst in Begleitung Seiner Excellenz des
Geheimrates von Ziegeler und Seiner Excelenz des Geheimrates von Kaufberg,
unser Gotteshaus besuchte. Die höchsten Geistlichen und der Magistrat
hiesiger Residenz hatten sich zu gleicher Zeit eingefunden. Der bisherige
Lehrer der Israeliten-Gemeinde, Herr Heidenheim, der zur Vollendung
seiner Studien auf einige Jahre nach Breslau geht, hielt gerade seine
Abschiedsrede. Ein vierstimmiger Choralgesang ging voran. Nach Anhörung
der Predigt verweilte unser geliebter Landesvater noch einige Zeit, um
auch dem Festgottesdienste beizuwohnen, und verließ dann die Synagoge,
nachdem Höchstderselbe dem Vorstande nicht nur seinen Beifall versichert
hatte, sondern auch zu erkennen geben, dass er sich wahrhaft erbaut
habe." |
Die 1826 erbaute Synagoge diente - im Laufe
der Jahrzehnte mehrfach renoviert - bis 1938 als Mittelpunkt des jüdischen
Gemeindelebens in Sondershausen. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die
Synagoge durch Nationalsozialisten geschändet. Mit Rücksicht auf die
Nachbarhäuser wurde das Gebäude nicht angezündet. Allerdings ist es bei einem Bombenangriff
Anfang April 1945 niedergebrannt; die Brandruine stand noch bis 1960.
1960 wurde im Zuge von "Sanierungsmaßnahmen" in
der nordöstlichen Bebrastraße das Gebäude der ehemaligen Synagoge
abgebrochen. 1999 wurde das Grundstück mit einem neuen Einkaufszentrum
überbaut ("Galerie am Schlossberg").
An die Synagoge erinnert eine Gedenktafel an der Westseite des
Einkaufszentrums mit der Inschrift: "Hier
stand die Synagoge - nicht vergessen (15 mal wiederholt). 1826 geweiht -
1938 geschändet".
Adresse/Standort der Synagoge:
Bebrastraße 6
Foto
(Quelle: Historische Innenansicht: Wikipedia-Artikel
"Jüdisches Leben in Sondershausen" s.u. Links)
Innenansicht der
ehemaligen Synagoge |
 |
|
| |
Rechts des Toraschreines
findet sich
eine Erinnerungstafel an
Rabbiner Philipp Heidenheim |
|
| |
|
|
| |
|
|
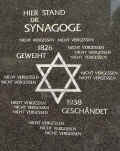 |
 |
 |
Gedenktafel für die
ehemalige Synagoge
an ihrem Standort in der Bebrastraße |
Standort der
Synagoge - die Gedenktafel ist jeweils in der
Mitte des Fotos erkennbar |
| |
|
|
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
| Juni 2012:
Auch in Sondershausen sollen
"Stolpersteine" verlegt werden |
Artikel in den "Kyffhäuser
Nachrichten" vom 21. Juni 2012: "Bald auch in Sondershausen.
Arnstadt hat sie, Nordhausen, Weimar und viele weitere Städte in Thüringen und ganz Deutschland.
'Stolpersteine' sind das wohl größte dezentrale Denkmal in Europa...".
Link
zum Artikel
Anmerkung auf Grund der Informationen des Artikels: Im Hauptausschuss der Stadt Sondershausen stellte die Mitarbeiterin des Schlossmuseums Sondershausen Bettina Bärninghausen das Projekt
vor. Als Initial sollen die ersten sechs Stolperstein im Herbst eingebracht werden. Die Stadt wird fünf der Stolpersteine übernehmen. Der sechste kommt
von Bürgermeister Joachim Kreyer (CDU) persönlich. Sprecher aller Fraktionen befürworteten die Teilnahme am Projekt.
Bettina Bärninghausen hat bereits umfangreich recherchiert und die Familie Simon aus Sondershausen für das Projekt ausgewählt. Hier gibt es auch noch Kontakt zu Familienmitgliedern die über verschiene Wege aus Deutschland in den USA Zuflucht gefunden
hat. Stammvater der Familie war Samuel Simon, der 1903 in der Lohstraße ein Konfektionsgeschäft eröffnete. Durch Familienmitglieder wurde weitere Geschäfte eröffnet. Ungefähr in Höhe der jetzigen Flachläden werden die
'Stolpersteine' in etwa in der Höhe verlegt. wo mal die Geschäfte waren, zu beiden Seiten der jetzigen Lohstraße. Von den früheren Häusern in der Lohstraße ist nach der Bombardierung vom 8. April 1945 nichts mehr übrig geblieben. |
| |
| November 2012:
In Sondershausen werden "Stolpersteine" verlegt |
Mitteilung in den "Kyffhäuser
Nachrichten" vom 27. Oktober 2012: "Erstmals Stolpersteine in
Sondershausen ... Am Montag, dem 5. November 2012, werden durch Gunter Demnig erstmalig Stolpersteine in Sondershausen verlegt. Die Verlegung und die Übergabe der Gedenksteine an die Stadt finden um 17.00 Uhr in der Lohstraße statt.
Um 19.00 Uhr hält Gunter Demnig im Schloss Sondershausen, Rosa Salon, einen Vortrag über das europaweite Projekt: "Stolpersteine - Spuren und Wege". Zu beiden Veranstaltungen lädt die Stadt Sondershausen herzlich ein."
|
| |
| September 2013:
Weitere Verlegung von "Stolpersteinen"
in Sondershausen |
Mitteilung in den "Kyffhäuser
Nachrichten" vom 25. September 2013 (Link):
"Stolpersteine für Familie Schoenlank
Am kommenden Freitag werden in Sondershausen wieder Stolpersteine verlegt, diesmal für die aus Sondershausen vertriebenen Familien Kaufmann und Schoenlank, so die Meldung die
kn von der SPD-Kyffhäuserkreis erhielt. Die Verlegung der Steine für Dina und Margarete Schoenlank erfolgt auf Anregung des SPD-Kreisverbandes. Beide Frauen gehörten der jüdischen Familie Schoenlank an. Familie Schoenlank lebte lange in Sondershausen und zwar auf dem Gelände der damaligen Synagoge in der Bebrastraße. Sie prägte über sieben Jahrzehnte das öffentliche Leben in der Stadt. Bruno Schoenlank (sen.), ein prägender Kopf der damaligen Sozialdemokratie, verlebte in Sondershausen seine Kinder- und Jugendjahre..." |
| Anmerkung: die beiden
"Stolpersteine" für Familie Schoenlank wurden in der Bebrastraße 6
verlegt. |
| |
Berichte in den "Kyffhäuser
Nachrichten" vom 27. September 2013 (Link):
"Stolpersteine gegen das Vergessen
Am Vormittag wurden in Sondershausen in der Bebrastraße weitere Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig verlegt.
Gedacht werden soll der Familien KAUFMANN und SCHOENLANK... Begonnen wurde am ehemaligen Wohnort
Bebrastraße 27. Hier wurden die Stolpersteine für Max Kaufmann (13.03.1878 Hecklingen - 14.01.1943 Auschwitz), Frieda
Kaufmann geb. Appel (11.04.1881 Mansbach - 15.04.1943 Westerbork), Herta Kaufmann verh. Neuhaus (15.11.1905 Ebeleben - 31.08.1994 Orange,
Californien), Liselotte "Liolo" Kaufmann verh. Broido (28.8.1913 Sondershausen - 22.05.2006 Lakewood, Los Angeles, Californien) und Irmgard Kaufmann (15.10.1922 Sondershausen -
20.03.1943 Sobibor) verlegt... Die Verlegung weiterer Stolpersteine fand am Standort des ehemaligen Wohnhauses der Familie Schoenlank, wo sich auch die Sondershäuser Synagoge befand, in der
Bebrastraße 6 statt. Verlegt wurden die Stolpersteine für Bernhardine (genannt Dina) Schoenlank geb. Silberberg (10.11.1860 Erder -
13. November 1935 Berlin) und Margarethe (Greta) Schoenlank (08.04.1894 - 19..01.1942 Riga)." |
| |
| Juni 2014:
Kolloquium aus Anlass des 200. Geburtstages Prof.
Philipp Heidenheims (1814-1906) |
 Anlässlich des 200. Geburtstages von Prof. Philipp Heidenheim findet vom
13. bis 15. Juni 2014 ein Kolloquium statt:
Anlässlich des 200. Geburtstages von Prof. Philipp Heidenheim findet vom
13. bis 15. Juni 2014 ein Kolloquium statt:
Programm
der Veranstaltung (pdf-Datei).
Informationen
in der Website der Stadt Sondershausen (von hier das Foto
links).
|
| |
| Oktober 2014:
Weitere Verlegung von "Stolpersteinen"
in Sondershausen |
Artikel in den "Kyffhäuser
Nachrichten" vom 29. September 2014: "Wieder
Stolpersteine in Sondershausen".
Anmerkung: "Stolpersteine" wurden verlegt in der Güntherstraße
57 für Dr. Kurt Boer; in der August-Bebel-Straße 75 für Meta Redelmeier;
in der Lohstraße 22 für Frieda und Louis Lindau sowie in der Hauptstraße
36 für Max, Henny, Ilse und Ruth Redelmeier. |
| |
Januar 2015:
Weitere "Stolpersteine" werden noch in
2015 oder in 2016 verlegt
Artikel in der "Thüringer Allgemeinen" vom 6. Januar 2015:
"Sondershausen: Verlegung neuer Stolpersteine..."
Link
zum Artikel |
| |
|
September 2024:
Weitere "Stolpersteine" werden
verlegt |
Artikel in den "Kyffhäuser Nachrichten" vom
19. September 2024: "SCHÜLERGEDENKPROJEKT UND NEUE STOLPERSTEINVERLEGUNG.
Zwölf neue Erinnerungssteine für Sondershausen
Am Dienstag kommender Woche stellen die Schüler des
Gesellschaftswissenschaftskurses Klasse 10 des 'Geschwister Scholl'
Gymnasiums ihre Ergebnisse des Projekts 'Die Ofenbauer von Auschwitz an
unserer Schule' vor. Zudem soll die Stadt neue Stolpersteine erhalten...
21 Stolpersteine sind in den vergangenen Jahren bereits in der Sondershäuser
Innenstadt verlegt worden. Nun sollen 12 weitere Stolpersteine verlegt
werden. Ab 14 Uhr werden sie in der Aula des Gymnasiums in der Güntherstraße
58 die weitgehend unbekannte Verbindung zwischen ihrer Schule und der
Erfurter Unternehmerfamilie 'J. A. Topf & Söhne' darlegen, die mit ihren
Verbrennungsöfen, die sich in zahlreichen Konzentrations- und
Vernichtungslagern der SS befanden, eine Schlüsselfunktion bei der
industriellen Vernichtung von Juden, Sinti und Roma hatte. Die Präsentation
wird ca. eine halbe Stunde dauern. Der Aufzug der Schule kann für Gäste
genutzt werden. Im Anschluss daran findet die Verlegung von zwölf
Stolpersteinen für Angehörige der ehemals in Sondershausen beheimateten
jüdischen Familie Leser im Stadtgebiet statt. Die Veranstaltung beginnt 15
Uhr vor dem Gebäude in der August-Bebel-Straße 43 (heute Sitz des
Kreisjugendrings) und wird zu drei weiteren Verlegeorten (Ulrich-von-Hutten-Straße
11, Edmund-König-Straße 1 und Hauptstraße 29) führen. Gemeinsam mit Schülern
des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Sondershausen wird an das Leben der
Mitglieder der weitverzweigten, jüdischen Familie Leser in Sondershausen und
ihre Verfolgung während des Nationalsozialismus erinnert. Die Veranstaltung
ist öffentlich – Interessierte sind sehr herzlich zur Teilnahme eingeladen!
Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Für den Transfer zwischen den
Verlegeorten steht ein (begrenztes) Kontingent an Fahrzeugen bereit. Die
Realisierung beider Projekte war dank zahlreicher privater Spender, der
Partnerschaft für Demokratie des Kyffhäuserkreises, dem Förderkreis Schloss
und Museum Sondershausen e.V. und dem Staatlichen
Geschwister-Scholl-Gymnasium Sondershausen möglich.
Stolpersteine in Sondershausen. Zwischen 2012 und 2014 konnten in
Sondershausen bereits 21 Stolpersteine verlegt werden. Inzwischen erfolgten
Recherchen zu weiteren jüdischen Familien in Sondershausen, wobei
insbesondere die weitverzweigte Familie Leser in den Fokus geraten ist. Die
Mitte des 19. Jahrhunderts aus Immenrode
in die Residenzstadt Sondershausen eingewanderte Familie war im
gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Leben unserer Stadt präsent und
anerkannt. Die Lesers übten angesehene Berufe aus, waren Kaufleute,
Ladeninhaber und Fabrikanten. Ihre Stellung im städtischen Bürgertum konnte
sie jedoch während der NS-Diktatur nicht vor Repressalien und Verfolgung
bewahren. So kam es zur Flucht zahlreicher Familienmitglieder ins
amerikanische, englische, neuseeländische und australische Exil, aber auch
zur Deportation und Ermordung von Ricka Leser.
Am 24. September sollen für die folgenden 12 Mitglieder der Familie Leser an
fünf Adressen Stolpersteine in Sondershausen verlegt werden:
Julie Leser (1868−1956), die 1939 zu ihrer Tochter nach England floh
und hier verstarb.
Martin Baruch (1884−1968), Kaufmann und Schwiegersohn Julie Lesers,
der mit seinen Töchtern Lieselotte (1920−2009) und Ilse (1922−2006) 1939
nach Amerika floh.
Sophie Brown (1859−1942), Witwe des Konsuls Hermann Brown, die mit
ihrer Nichte und Adoptivtochter Alma Leser-Heinrich (1892−1984) und deren
Sohn Gerhard Heinrich (1923−1995) 1939 nach Neuseeland floh.
Der Wollwarenfabrikant Kurt Leser (1895−1969) floh 1938 nach England,
von wo aus er die Flucht seines Sohnes Bernard Leser (1925−2015) und seiner
Angestellten und späteren Ehefrau Erna Cheikowsky (1895−1970) vorbereitete.
Zusammen mit Sophie Brown, Alma Leser-Heinrich und ihrem Sohn Gerhard gingen
sie ins neuseeländische Exil.
Der Fabrikant Egon Leser (1876−1954), dem das Grundstück und ein Teil
der Wollwarenfabrik E. Gers gehörten, beides wurde 1941 als dem Reich
verfallenes Kapital erklärt. Egon ging 1939 ins englische Exil.
Ricka Leser (1878−1942), die 1942 nach Bełżyce deportiert und hier
ermordet wurde." |
| |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Germania Judaica II,2 S. 771-772. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Band 8 Thüringen. Frankfurt am Main 2003. S.
176-178. |
 | Falk Nicol: Juden im mittelalterlichen Sondershausen - archäologische
Untersuchung einer Mikwe aus der Zeit um 1300. - in: Alt-Thüringen
Jahresschrift des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens / des Thüringischen
Landesamtes für Archäologische Denkmalpflege bzw. Landesamtes für Archäologie
mit Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens (ab Band 37) Weimar: Böhlau
Stuttgart: Theiss (ab Bd. 27) |
 | Zeugnisse jüdischer Kultur. Erinnerungsstätten in
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen und
Thüringen. Berlin 1992. S. 286-287. |
 | Israel Schwierz: Zeugnisse jüdischer Vergangenheit
in Thüringen. Eine Dokumentation - erstellt unter Mitarbeit von Johannes
Mötsch. Hg. von der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen ( www.lzt.thueringen.de)
2007. Zum Download
der Dokumentation (interner Link). S. 233-238. |
 | Bettina Bärnighausen (Red.): Juden in Schwarzburg
Bd.1. Hrsg. vom Schlossmuseum Sondershausen (Sondershäuser Kataloge IV).
Dresden 2006. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Sondershausen
Thuringia. Jews lived there in the early 14th century and in the first half of
the 15th century, suffering persecution during the Black Death disturbances of
1348-49. In the late 17th century, a Jewish community with a prayer hall is
mentioned. In the 18th century, the community acquired a cemetery. In 1826, a
new synagogue was dedicated. The Jewish population numbered 40 Jewish families
in 1835 and 130 Jews in 1884. Most of the 67 Jews who lived in Sondershausen in
1933 left the town before the outbreak of war, emigrating to the United States,
Australia, New Zealand, England and Palestine. On Kristallnacht (9-10
November 1938), the synagogue was destroyed. Those Jews who remained (19 in
1939) were deported to the Riga and Theresienstadt ghettoes.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|