|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
zur
Übersicht "Synagogen im Kreis Darmstadt-Dieburg"
Rossdorf mit
Gundernhausen (Kreis
Darmstadt-Dieburg)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Rossdorf bestand eine jüdische
Gemeinde bis 1938. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts
zurück. 1770 gab es drei jüdische Familien am Ort.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1828 40 jüdische Einwohner, 1861 49 (2,6 % von insgesamt 1.908
Einwohnern), 1880 48 (2,1 % von 2.313), 1900 62, 1910 61 (1,9 % von 3.199). Die
jüdischen Familienvorsteher verdienten den Lebensunterhalt als Kleinkaufleute,
Viehhändler und Metzger. Auch in Gundernhausen
lebte - zumindest im 19. Jahrhundert - zeitweise eine jüdische Familie (1830
mit fünf Personen).
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule
und ein rituelles Bad (vermutlich in einem Badhäuschen neben der Synagoge).
Die Toten der Gemeinde wurden auf dem jüdischen Friedhof in Dieburg
beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war
ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (vgl.
die vorübergehende Einstellung eines polnischen Lehrers 1885 s.u., letzter
Lehrer war Raphael Scher). Die Gemeinde
gehörte zum orthodoxen Bezirksrabbinat Darmstadt II.
Um 1924, als noch 49 Personen der jüdischen Gemeinde angehörten (1,5
% von insgesamt 3.289 Einwohnern),
waren die Vorsteher der Gemeinde Hermann Simon, Hermann Mai I und Hermann Mai
II. Als Lehrer der Gemeinde war der bereits genannte Raphael Scher angestellt. Er unterrichtete auch
die jüdischen Kinder in Ober-Ramstadt. 1932
war Vorsteher der Gemeinde weiterhin Hermann Simon. Raphael Scher wird weiterhin
als Lehrer, Kantor und Schochet genannt.
1933 lebten noch 45 jüdische Personen (in 15 Familien) in Roßdorf
(1,3 % von insgesamt 3.521 Einwohnern). In
den folgenden Jahren ist ein Großteil von ihnen auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,
der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Im Mai 1939 lebten noch
zwei jüdische Personen am Ort.
Von den in Rossdorf geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Rosa Bamberger geb.
May (1901), Anita Flora Ehrlich
(1929), Frieda Ehrlich (1893), Hermann Ehrlich (1891), Kathinka Ehrlich (1888),
Nathan Ehrlich (1896), Werner Fleischhacker (1936), Rosalie Höxter geb.
Ehrlich (1853), Fanny Junker geb. Strauß (1868), Jenny Löwenstein geb. Marx
(1888), Ida Marx (1885), Recha Marx (1899), Flory May (1910), Hermann May
(1869), Hermann May (1871), Moses May (1864), Regina May geb. May (1873), Ernst
Hermann Mayer (1928), Johanna Mayer geb. Simon (1899), Ida Meyer geb. Strauss
(1871), Charlotte Moses geb. Marx (1891), Hermann Simon (1865), Hermann Simon
(1872), Selma Simon geb. Ehrlich (1899), Rosa Sternfeld geb. Simon (1871),
Gertrude Wolf geb. Simon (1874), Nathan Wolf (1886).
Hinweis: es gab auch in Roßdorf (heute Ortsteil von Amöneburg, Kreis
Marburg-Biedenkopf) wenige jüdische Familien, die zur jüdischen Gemeinde in
Mardorf gehörten. In der Liste des "Gedenkbuches" werden viele der
unter Roßdorf aufgeführten Personen dem oberfränkischen Ort "Roßdorf am
Forst" zugewiesen. Dort gab es jedoch keine jüdische
Gemeinde.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet
1885
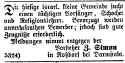 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. November
1885: "Die hiesige israelitische kleine Gemeinde sucht einen
tüchtigen Vorsänger, Schochet und Religionslehrer. Bevorzugt werden unverheiratete
Bewerber; jedoch sind gute Zeugnisse
erforderlich. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. November
1885: "Die hiesige israelitische kleine Gemeinde sucht einen
tüchtigen Vorsänger, Schochet und Religionslehrer. Bevorzugt werden unverheiratete
Bewerber; jedoch sind gute Zeugnisse
erforderlich.
Meldungen nimmt entgegen der Vorsteher Z. Simon in Roßdorf bei
Darmstadt."
|
Der polnische Lehrer muss ausgewiesen werden (1885)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Dezember
1885: "Darmstadt, 14. Dezember (1885). Über die von uns in
der Beilage zu dieser Nummer gebrachte Meldung, nach welcher ein Pole aus
Hessen ausgewiesen worden sei, erhalten die 'N.H.B.' seitens des hiesigen
Kreisamtes eine Berichtigung, die auch wir zur Kenntnis unserer Leser
bringen wollen. Sie lautet: Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Dezember
1885: "Darmstadt, 14. Dezember (1885). Über die von uns in
der Beilage zu dieser Nummer gebrachte Meldung, nach welcher ein Pole aus
Hessen ausgewiesen worden sei, erhalten die 'N.H.B.' seitens des hiesigen
Kreisamtes eine Berichtigung, die auch wir zur Kenntnis unserer Leser
bringen wollen. Sie lautet:
'Der betreffende Lehrer wirkte nicht seit etwa sechs Monaten in der Nähe
von Darmstadt, sondern war erst im Monat November dieses Jahres von der
israelitischen Religionsgemeinde Roßdorf, vorbehaltlich unserer
Genehmigung, zum Religionslehrer bestellt worden. Derselbe ist nicht von
uns ausgewiesen worden, vielmehr wurde ihm, weil er nicht im Besitz von
genügenden Papieren war, aufgegeben, einen Reisepass oder eine sonstige,
seine Person legitimierende und seine Staatsangehörigkeit nachweisende
Urkunde von seiner russisch-polnischen Heimatbehörde beizubringen, und
ihm hierzu am 2. laufenden Monats eine Frist von 8 Wochen gewährt. Dieser
Nachweis musste, abgesehen davon, dass wir eine nicht gehörig
legitimierte Persönlichkeit nicht als Religionslehrer einer
israelitischen Religionsgemeinde bestätigen können, deshalb verlangt
werden, weil der Betreffende bei seiner möglicherweise demnächst
eintretenden Hilfsbedürftigkeit, Mangels eines Nachweises über seine
Zuständigkeit, unserem Landarmenverband dauernd zur Last gefallen sein
würde. Großherzogliches Kreisamt Darmstadt. v.
Marquard." |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Die jüdischen Familien sind von Einquartierungen an Jom
Kippur befreit (1884)
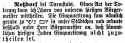 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Oktober
1884: "Roßdorf bei Darmstadt. Einen Akt der Toleranz kann ich
Ihnen von unserem hiesigen Bürgermeister mitteilen. Die Einquartierung
kam nämlich gerade zu Jom Kippur in unser Städtchen und ordnete
deshalb unser Herr Bürgermeister an, dass sämtliche hiesigen Juden
Einquartierung nicht zuzuteilen sein." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Oktober
1884: "Roßdorf bei Darmstadt. Einen Akt der Toleranz kann ich
Ihnen von unserem hiesigen Bürgermeister mitteilen. Die Einquartierung
kam nämlich gerade zu Jom Kippur in unser Städtchen und ordnete
deshalb unser Herr Bürgermeister an, dass sämtliche hiesigen Juden
Einquartierung nicht zuzuteilen sein." |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Goldene Hochzeit von Mordechai May und Jettchen geb.
Lippmann (1902)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember 1902:
"Aus Hessen. In Roßdorf feierten am Mittwoch, 17.
Dezember (1902), Herr Mordechai May und dessen Ehefrau Jettchen
geb. Lippmann aus Bauschheim,
im engsten Familienkreise das seltene Fest der goldenen Hochzeit, eine
Feier, welche in hundert Jahren hier nicht vorgekommen ist. Möge es dem
Jubelpaare, das sich noch bester Gesundheit und Rüstigkeit erfreut,
beschieden sein, auch das diamantene Jubiläum zu feiern. - N. -" Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember 1902:
"Aus Hessen. In Roßdorf feierten am Mittwoch, 17.
Dezember (1902), Herr Mordechai May und dessen Ehefrau Jettchen
geb. Lippmann aus Bauschheim,
im engsten Familienkreise das seltene Fest der goldenen Hochzeit, eine
Feier, welche in hundert Jahren hier nicht vorgekommen ist. Möge es dem
Jubelpaare, das sich noch bester Gesundheit und Rüstigkeit erfreut,
beschieden sein, auch das diamantene Jubiläum zu feiern. - N. -" |
70. Geburtstag von Gemeindevorsteher Hermann May (1928)
 Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"
vom 3. Februar 1928: "Darmstadt. (70. Geburtstag). Im
benachbarten Roßdorf beging der erste Vorsteher Hermann May (für
verschrieben: Marx) seinen 70. Geburtstag. Seit etwa 32 Jahren hat der
Jubilar die Interessen der Gemeinde mit Eifer und Umsicht vertreten; mancherlei
Aufmerksamkeiten aus Freundes- und Bekanntenkreisen legten Zeugnis von der
allgemeinen Wertschätzung ab, deren er sich überall erfreut.
Bemerkenswert ist, dass ihm anlässlich seines 25-jährigen
Dienstjubiläums vom damaligen Großherzog von Hessen eine Ehrenurkunde
für treue Dienste nebst Medaille verliehen
wurde." Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"
vom 3. Februar 1928: "Darmstadt. (70. Geburtstag). Im
benachbarten Roßdorf beging der erste Vorsteher Hermann May (für
verschrieben: Marx) seinen 70. Geburtstag. Seit etwa 32 Jahren hat der
Jubilar die Interessen der Gemeinde mit Eifer und Umsicht vertreten; mancherlei
Aufmerksamkeiten aus Freundes- und Bekanntenkreisen legten Zeugnis von der
allgemeinen Wertschätzung ab, deren er sich überall erfreut.
Bemerkenswert ist, dass ihm anlässlich seines 25-jährigen
Dienstjubiläums vom damaligen Großherzog von Hessen eine Ehrenurkunde
für treue Dienste nebst Medaille verliehen
wurde." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige der Witwe von Marx May II. (1901)
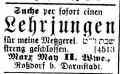 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Juni 1901: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Juni 1901:
"Suche per sofort einen Lehrjungen für meine Metzgerei. Schabbat
und Feiertag streng geschlossen.
Marx May II. Witwe,
Roßdorf bei Darmstadt." |
Anzeige des Metzgermeisters W. Flehinger (1921)
 Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 19. Mai 1921: "Kräftiger Lehrjunge Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 19. Mai 1921: "Kräftiger Lehrjunge
für meine Metzgerei (Samstags und israelitische Feiertage geschlossen) gesucht.
W. Flehinger, Rossdorf bei Darmstadt." |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst (Mitte des 18. Jahrhunderts) war vermutlich ein Betraum in einem der jüdischen
Häuser vorhanden. Eine Synagoge wurde 1874 (oder 1877) erbaut, möglicherweise an
Stelle des bisherigen Hauses mit dem Betraum. 1920 wurde die Synagoge gründlich
renoviert. Das Gebäude war etwa 7 mal 10 m groß. Über
das Aussehen der ehemaligen Synagoge liegen jedoch keine genauen Informationen
vor. Ein historisches Foto wurde noch nicht gefunden (Rekonstruktionszeichnung
siehe unten).
Nach 1933 ging die Zahl der jüdischen Gemeindeglieder stark zurück, wodurch
kein Minjan mehr zustande gekommen ist (notwendige Zehnzahl der jüdischen
Männer zum Gottesdienst). 1937 wurde die Synagoge an eine nichtjüdische Familie
verkauft. Der Verkauf war erforderlich, da die Evangelische Kirchengemeinde
ihren Kredit kündigte, den sie der Gemeinde 1879 gewährt hatte.
Beim Novemberpogrom 1938 wollten ortsansässige Nationalsozialisten
das Gebäude dennoch in Brand setzen; schließlich beschränkten sie sich auf
das Einwerfen der Fensterscheiben und Zerstörung von Teilen des Daches. Auch
die am First befindlichen Gebotstafeln wurden heruntergerissen und in Stücke
geschlagen. Das Gebäude wurde später zu einem Wohnhaus umgebaut. Durch den Umbau wurde das rechteckige
Gebäude zum einem fast quadratförmigen umgebaut (vgl. Plan unten). Auch das
Grundstück das Badhäuschens ist überbaut worden.
Am 11. Mai 2011 wurde bei einer Gedenkstunde mit Schülern aus der
Rehberg-Grundschule und aus der Justin-Wagner-Gesamtschule sowie Mitgliedern des
Kulturhistorischen
Vereins R0ßdorf e.V. und weiteren Interessierten eine Informationstafel
zur Erinnerung an die Synagoge am Haus der ehemaligen Synagoge an der
Darmstädter Straße angebracht.
Im Januar 2019 wurde am sogenannten "Jurregässje" (Bereich
Darmstädter Straße 1,3,5 und 7, Sackgasse gegenüber dem Rathaus) eine
Hinweistafel angebracht, die die Erinnerung an das "Jurregässje" wachhält (siehe
Pressebericht unten).
Adresse/Standort der Synagoge: Grundstück
Darmstädter Straße 1
Fotos
(Quelle: Plan und Foto von 1987: Altaras 1988 und 2007²
s.Lit.; Rekonstruktionszeichnung in einem Gemeindebrief der Evangelischen
Kirchengemeinde in Rossdorf zum Gedenken an die Pogromnacht im November 2008, pdf-Datei)
| |
Historische Fotos sind noch nicht vorhanden; über Hinweise oder Zusendungen
freut sich
der Webmaster der "Alemannia Judaica"; Adresse siehe Eingangsseite. |
| |
|
|
Plan des
Synagogengrundstückes
und seiner Umgebung und Rekonstruktionszeichnung |
 |
 |
| |
Der Plan zeigt
(dunkel schraffiert) die
Gebäude der israelitischen Gemeinde 1888
sowie
die Bebauung
nach Stand 1986 |
Rekonstruktionszeichnung der
ehemaligen
Synagoge in Rossdorf; beim Novemberpogrom
1938 wurden die
Gebotstafeln am First
heruntergerissen und zerschlagen |
| |
|
|
Die ehemalige Synagoge
(Gebäude 1987) |
 |
| |
Das
ehemalige Synagogengebäude wurde zu einem Wohnhaus umgebaut und
dabei
vergrößert (vgl. Plan oben) |
| |
|
|
Geschichtstafel
zur Geschichte von Rossdorf
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum: 17.3.2009) |
|
 |
 |
 |
Blick auf das Rathaus
der
Gemeinde |
Die Geschichtstafel |
Auf der Tafel zum 20.
Jahrhundert wird an
"24 Opfer der Judenverfolgung" erinnert |
| |
| |
|
|
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| Mai 2011:
Eine Informationstafel zur Erinnerung an die
Synagoge wird angebracht |
Artikel in echo-online.de vom 10. Mai 2011:
Roßdorf rückt Synagoge in den Fokus (veröffentlicht am 10.05.2011 00:05 auf echo-online.de) " |
| |
|
Januar 2019:
Erinnerung an das "Jurregässje"
|
Artikel von Klaus Holdefehr in echo-online
vom 29. Januar 2019: "Roßdorf hat ein 'Jurregässje'
Ein neues Straßenschild sorgt in Roßdorf für Aufsehen, denn die
Landkreis-Gemeinde hat jetzt ein 'Jurregässje'. Bei der Enthüllung des
Zusatzschilds für die kurze Sackgasse kommt auch die Sache mit dem 'Anstoß'
zur Sprache.
ROSSDORF - Die Vergangenheit endlich ruhen lassen? Dieser in
Deutschland seit einigen Jahren immer offener und häufiger ausgesprochene
Satz ist für rund 60 Roßdörfer am Tag des Holocaust-Gedenkens, an dem sich
die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz zum 74. Mal jährt, Anlass,
das Gegenteil zu tun. Sie haben sich in einer kleinen Sackgasse gegenüber
dem Rathaus versammelt, um der Enthüllung einer informativen Ergänzung des
Straßenschilds beizuwohnen. Es geht um das 'Jurregässje', das amtlich nie so
hieß, aber im Volksmund allgemein so genannt wurde, weil sich in der Gasse
einst die Synagoge jüdischen Gemeinde in Roßdorf befand. Das in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtete Gebäude steht im Grundsatz heute
noch, ist dem Pogrom von 1938 weitgehend entgangen, weil es zu diesem
Zeitpunkt schon entwidmet und von der jüdischen Gemeinde verkauft worden
war. An dem heutigen Wohnhaus erinnert seit rund acht Jahren eine
Gedenktafel an die Vergangenheit des Gebäudes.
Es bedurfte - daran erinnerte Engelbert Jennewein vom kulturhistorischen
Verein Roßdorf - damals bereits der Intervention von Bürgermeisterin
Christel Sprößler, das Einverständnis des Hausbesitzers zur Anbringung
dieser Tafel einzuwerben. Dem pensionierten Lehrer war die vom öffentlichen
Raum vor Rathaus und Kirche nicht sichtbare Tafel aber zu wenig. Er gab
daher den Anstoß, das Namensschild 'Darmstädter Straße' mit den wenigen
Hausnummern der Sackgasse vorne an der Einmündung auf die Hauptstraße um
eine zusätzliche Informationstafel zu ergänzen.
Weg 'von der Erinnerung zur Erkenntnis'. In guter demokratischer
Übung sollte dies aber nicht ohne das Einverständnis der betroffenen
Anwohner geschehen, und zu seinem eigenen Erstaunen musste Jennewein
feststellen, dass manche an dieser Idee Anstoß nahmen. 'Auch 2019 gibt es
noch Antisemitismus und Engstirnigkeit', sagte er am Sonntag in seiner
Ansprache. Das 'noch' drückt freilich optimistisch die Hoffnung auf ein
allmähliches Schwinden solcher Haltungen aus. Dass aber im Gegenteil solche
Haltung seit Jahren wieder mehr und mehr in der Öffentlichkeit sichtbar
wird, erwähnte Karlheinz Rück, der als 1. Beigeordneter die familiär
verhinderte Bürgermeisterin vertrat. Der Gemeindevorstand habe daher im
November des vergangenen Jahres den Beschluss gefasst, das
Straßennamensschild um eine Informationstafel zu ergänzen. Er
charakterisierte dies als Antithese zu der Aussage 'Man muss mal einen
Schlussstrich ziehen'. Rück erinnerte an eine lebendige jüdische Gemeinde in
Roßdorf mit rund 50 Mitgliedern zu Beginn der Nazi-Zeit 1933 und wies auf
einen Weg 'von der Erinnerung zur Erkenntnis'. Und er versicherte, dass mit
der Informationstafel keinerlei Schuldzuweisung verbunden sei. Auch die
evangelische Kirchengemeinde, vertreten durch Pfarrer Wolfram Seeger,
beteiligte sich am Gedenken. Seeger erinnerte daran, dass der Bau der
Synagoge einst auch durch einen Kredit der evangelischen Kirche ermöglicht
wurde. Diese Enthüllung nahm, kurzfristig von ihrem ehemaligen Lehrer
Jennewein dazu aufgefordert, um die junge Generation in die
Erinnerungsarbeit einzubinden, die 20-jährige Roßdörferin Leah Stroh vor.
Auf dem Schild steht: 'Volksmund: Jurregässje Ehem. Standort der jüdischen
Synagoge Von 1874 bis zum Verkauf 1938.'"
Link zum Presseartikel |
| |
|
Januar 2019:
Die Hinweistafel für die Synagoge
ist nicht bei allen am Ort erwünscht |
Artikel von Silke Sutter in hessenschau.de
vom 1. Februar 2019: "'Irgendwann muss doch mal Schluss sein' - Erinnerung
an Roßdorfer Synagoge nicht von allen erwünscht.
In Roßdorf bei Darmstadt stand einmal eine Synagoge. Daran erinnert seit
Kurzem ein kleiner Hinweis am Straßenschild, der bei einigen Anwohnern auf
massiven Widerstand traf: Antisemitismus oder nur ein Kommunikationsproblem?
Engelbert Jennewein freut sich über das kleine blaue Schild, das nun
unterhalb des Straßennamens der Darmstädter Straße im Ortskern in Roßdorf
hängt. 'Wenn die Leute hier an der roten Ampel halten müssen, dann können
alle gut sehen, dass hier mal eine Synagoge gestanden hat. Das gehört
einfach zur Roßdorfer Geschichte.'
Früher Synagoge, heute Mehrfamilienhaus. Das Gotteshaus selbst gibt
es allerdings schon lange nicht mehr. 1938, noch vor der Pogromnacht, war
die Synagoge verkauft und entwidmet worden. Die jüdische Gemeinde hatte
damals bereits nur noch sieben Mitglieder. Eine kleine Gedenktafel an der
Fassade des Wohnhauses erinnert an seine Geschichte - und nun zusätzlich der
Hinweis am Eingang der schmalen Sackgasse. Darüber hatte auch das
'Darmstädter Echo' berichtet.
'Würden Sie in einer Judengasse wohnen wollen?' Jennewein beschäftigt
sich viel mit Heimatgeschichte, ist aktiv im Kulturhistorischen Verein in
Roßdorf. Die Idee, auf die ehemalige Synagoge hinzuweisen, hatte der
Kulturverein schon länger. Jennewein nahm Kontakt zu den Anwohnern der
Darmstädter Straße auf, sammelte Spenden. 'Ich habe gefragt, ob die Leute
damit einverstanden sind, dass wir den Hinweis 'Jurregässje' ('Judengasse'
im Roßdorfer Dialekt) anbringen. Die Reaktion der Anwohner hat mich tief
getroffen.' Womit Jennewein nämlich nicht gerechnet hatte: Einige sprachen
sich dagegen aus. 'Eine Frau mittleren Alters hat zu mir gesagt: 'Ich will
das nicht. Ich kann Juden nicht leiden. Die haben mich betrogen.' Ein
anderer meinte: 'Würden Sie in einer Judengasse wohnen wollen?' Und hat dann
die Tür zugemacht.'
Nur ein Kommunikationsproblem? Auf die antisemitischen Ausfälle
reagierte der Kulturhistorische Verein, indem er das Projekt erst einmal auf
Eis legte. 'Gegen den Willen der Anwohner wollten wir das nicht weiter
verfolgen', so die Vorsitzende Ursula Bathon. Die Gemeinde Roßdorf sollte
darüber entscheiden. Und die handelte. Der Gemeindevorstand beschloss
einstimmig, auf die jüdische Geschichte aufmerksam zu machen. 'Gerade in
Zeiten von Populismus ist es wichtig, sich mit der Geschichte
auseinanderzusetzen. So etwas wie damals darf nicht noch einmal passieren',
findet Karlheinz Rück, stellvertretender Bürgermeister von Roßdorf.
Verständnis für die Reaktion der Anwohner versucht der parteilose
Kommunalpolitiker trotzdem aufzubringen: 'Ich denke, das war ein
Kommunikationsproblem. Die Leute haben vielleicht gedacht, die Straße soll
komplett umbenannt werden." Diese Meinung teilt auch Ursula Bathon:
'Judengasse beschreibt ja eigentlich eine Straße, in der früher Juden
gewohnt haben. Das war ja hier nicht so, hier stand lediglich die Synagoge.'
Mit der jetzigen Lösung ist sie zufrieden.
Kein Schlussstrich unter die Vergangenheit. Rund 60 Menschen kamen
schließlich zur Enthüllung des Hinweisschildes, passend am Tag des
Shoah-Gedenkens. Für Engelbert Jennewein ist das ein voller Erfolg: 'Ja, wir
können einen Schlussstrich ziehen - darunter, dass schlimme Dinge passiert
sind, und zwar auch hier in Roßdorf. Worunter wir keinen Schlussstrich
ziehen sollten, sind die Lehren daraus.'"
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Quellen:
| |
Zu Roßdorf sind vorhanden (auf der jeweiligen Unterseite zur
Einsichtnahme weiter über "Digitalisate anzeigen"):
HHStAW 365,752 Geburts-, Trau- und Sterberegister der
Juden von Roßdorf: Jüdisches Geburtsregister 1789 - 1808, jüdisches
Trauregister 1804, jüdisches Sterberegister 1790 - 1808
https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v131329
|
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. 233-234. |
 | Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 S. 133-137 und dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 115 (keine weiteren
Informationen) sowie dies., Neubearbeitung der beiden Bände 2007² S.
197-198. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 47. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 298-299. |
 | Horst Wilhelm: Roßdorf - Die Opfer der
nationalsozialistischen Judenverfolgung - Ein Gedenkbuch. Hg. vom
Historischen Verein Rossdorf und Gunrdernhausen e.V. Roßdorf 1988. |
 | Armin Hepp: Roßdorf vor der Rhön - Häuser und
Geschlechter. Achern 1994. |
 | Thomas Lange: 'L'chajim' - Die Geschichte der Juden
im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Hg. Landkreis Darmstadt-Dieburg. Reinheim
1997. S. 100-101 und S. 227. |
 | Johann Heinrich Kumpf: Wohl die älteste Person des
Deutschen Reichs stammte aus Momart. Zur Geschichte der jüdischen Familien
Bergfeld in Momart und Michelstadt, May in Roßdorf sowie Aschenbrand
in Niederaula, Rimbach und Frankfurt am Mein. In: "gelurt". Odenwälder
Jahrbuch für Kultur und Geschichte 2022. Hrsg. vom Kreisarchiv des
Odenwaldkreises. Erbach/Odw. 2022. S. 99-116.
Online zugänglich (pdf-Datei). |
Hinweis auf ein familiengeschichtliches Werk
Nathan M. Reiss
Some Jewish Families
of Hesse and Galicia
Second edition 2005
http://mysite.verizon.net/vzeskyb6/ |
 |
 |
|
In diesem Werk
eine Darstellung zur Geschichte der jüdischen Familien May in Roßdorf,
Gräfenhausen und Ober-Ramstadt
("The MAY Families of Roßdorf, Gräfenhausen and Ober-Ramstadt", S.
269-282) (Nachkommen bis ca. 2000) mit Abbildungen
u.a.m. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Rossdorf Hesse. The
community numbered 62 (2 % of the total) in 1900 and 47 in 1933 but dispersed in
1938. Most Jews emigrated to the United States before Kristallnacht (9-10
November 1938).



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|