|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht
"Synagogen im Kreis Groß-Gerau"
Kelsterbach (Kreis
Groß-Gerau)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Kelsterbach bestand eine jüdische
Gemeinde bis 1938. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts
zurück. Nach dem Auszug der Hugenottenfamilien 1712 aus dem 1699 von ihnen
gegründeten Neu-Kelsterbach konnten in die frei gewordenen Häuser jüdische
Familien einziehen (lange hieß die Neu-Kelsterbacher Straße daher auch
"Judengasse"). 1789 werden an jüdischen Familienvätern genannt:
Levi, Afram, Jacob Seligman und Schimmer.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie
folgt: 1815 sechs jüdische Familien, 1827 46 jüdische Einwohner (5,0 %
von insgesamt 930 Einwohnern), 1838 36 (3,7 % von 962), 1861 82 (6,9 % von 1.186), 1880 78
(4,6 % von
1.693), 1890 83 (4,3 % von 1.921), 1900 64 (2,1 % von 2.964), 1910 74 (1,8 % von
4.012). Mitte des 19. Jahrhunderts erwarben die jüdischen Familienväter ihren
Lebensunterhalt insbesondere als Fruchthändler, Schuhmacher, Spezereikrämer,
Metzger, Schneider. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eröffneten
sie mehrere Läden am Ort (u.a. Manufakturwarenhandlungen,
Kolonialwarengeschäfte, Metzgerei, Schuhmacherei).
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine Religionsschule,
ein rituelles Bad und seit 1889 ein eigener Friedhof (zuvor Beisetzungen in
Groß-Gerau). Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (siehe
Ausschreibungen der Stelle unten). Die Gemeinde gehörte zum orthodoxen
Bezirksrabbinat Darmstadt II.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Max Adler (geb.
25.7.1890 in Kelsterbach, gef. 18.5.1915) und
Julius Levi (geb. 31.5.1896 in Kelsterbach, gef. 27.9.1916).
Um 1924, als zur Gemeinde noch 46 Personen gehörten (0,76 % von insgesamt
etwa 6.000 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde Willy Adler I., Daniel
Hirsch, H. Herzfeld. Als Schochet war Bernhard Kahn tätig. Den
Religionsunterricht der schulpflichtigen jüdischen Kinder der Gemeinde erteilte
Lehrer Julius Rothschild aus Groß-Gerau.
1932 waren die Gemeindevorsteher Willy Adler (1. Vors.), Daniel Hirsch (2.
Vors.) und Moritz Adler (3. Vors.). An jüdischen Vereinen bestanden insbesondere
die Männerchewro (Wohltätigkeitsverein). Im Schuljahr 1931/32 gab es
noch fünf jüdische schulpflichtige Kinder, die Religionsunterricht
erhielten.
1933 lebten noch 47 jüdische Personen in Kelsterbach (0,9 % von insgesamt
5.253 Einwohnern). Es handelte sich um die Angehörigen der Familien Daniel
Adler (Schuhmacher, Neukelsterbacher Str. 39), Moritz Adler (Textilgeschäft,
Schlossweg 5), Ferdinand Adler (Neukelsterbacher Straße 15), Leopold Marx /
Moses Fleischmann (Posterwarengeschäft Bergstraße 1), Wilhelm Adler / Moritz
Strumpf (Handelsvertretung Neukelsterbacher Straße 21), Leopold Adler / Beretz
(Schuhmacherei, Bergstraße 9 und Kleine Mainstraße 2), Hermann Adler
(Sportartikelgeschäft, Rüsselsheimer Straße 25), Hugo Herzfeld
(Futtermittelhandel, Mainstraße 68), Daniel Hirsch (Metzger, Untergasse 4),
Jakob Moritz (Möbelgeschäft, Mainstraße 81), Speier / Blumenthal
(Neukelsterbacher Straße 1 und 13), Wolf Paw (Bergstraße 23).
In
den Jahren nach 1933 sind alle jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der zunehmenden Entrechtung,
der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert (sieben in die USA, zwei
nach Brasilien; viele verzogen nach Frankfurt am Main). Nach dem Februar 1939 wurde kein jüdischer
Einwohner mehr am Ort gezählt.
Von den in Kelsterbach geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Emanuel Adler (1882),
Eugen Ernst Adler (1885), Friedrich Adler (1910), Herrmann Adler (1866), Isaak
Julius Adler (1865), Julius Friedrich Adler (1883), Rosa Adler geb. Wallerstein
(1872), Recha de Beer geb. Adler (1862), Katharina Beretz (1870), Emma Berger geb. Sonnenberg
(1880), Bernhard Blumenthal (1882), Meta Blumenthal
geb. Speier (1888), Edmund Eskeles (1876), Hermann Eskeles (1865), Else
Fleischmann geb. Marx (1902), Herbert Fleischmann (1929), Moses Fleischmann
(1898), Bertha Herzfeld geb. Adler (1875), Hugo Herzfeld (1877), Frieda van Hessen geb. Adler (1871), Daniel Hirsch (1877),
Lea Hirsch geb. Beretz (1883), Nannchen Lipschitz
geb. Hirsch (1878), Emma Marx geb. Adler (1875), Jakob Moritz (1889), Martha
Moritz geb. Levi (1894), Emma Nassauer geb. Adler (1876), Jenny Neustädter geb.
Adler (1893), Ruth Neustädter (1923), Johanna Schwarz geb. Eskeles (1879),
Ferdinand Sonnenberg (1886), Babette Speier geb.
Eskeles (1857), Mina Weiß geb. Sonnenberg (1888).
Zur Erinnerung an 25 Opfer der NS-Zeit wurden am 17. Februar 2014 an acht
verschiedenen Stellen in
Kelsterbach insgesamt 25 "Stolpersteine" verlegt. Am 21.
März 2016 wurden weitere 27 "Stolpersteine" verlegt (vgl.
Pressebericht unten).
Für die 1880 in Kelsterbach geborene Emma Berger geb. Sonnenberg (und ihre vier
Kinder) liegen "Stolpersteine" in Stuttgart-Heslach (Neugereutstr.
15).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrer / Vorbeters / Schochet 1867 /
1876 / 1886 / 1890 / 1891 / 1893
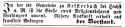 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1867:
"In der israelitischen Gemeinde zu Kelsterbach bei Höchst am Main
ist die Stelle eines Religionslehrers und Vorsängers vakant. Nähere
Auskunft erteilt auf frankierte Anfragen Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1867:
"In der israelitischen Gemeinde zu Kelsterbach bei Höchst am Main
ist die Stelle eines Religionslehrers und Vorsängers vakant. Nähere
Auskunft erteilt auf frankierte Anfragen
der Vorstand." |
| |
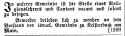 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Mai 1876:
"In unserer Gemeinde ist die Stelle eines Religionslehrers und
Kantors vakant und sofort zu besetzen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Mai 1876:
"In unserer Gemeinde ist die Stelle eines Religionslehrers und
Kantors vakant und sofort zu besetzen.
Bewerber belieben sich zu wenden an den Vorstand der israelitischen
Gemeinde zu Kelsterbach am Main." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. November 1886:
"In der israelitischen Gemeinde Kelsterbach am Main ist die Stelle
eines Lehrers, Vorbeters und Schächters in Erledigung gekommen und soll
bis zum 15. Dezember dieses Jahres wieder besetzt werden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. November 1886:
"In der israelitischen Gemeinde Kelsterbach am Main ist die Stelle
eines Lehrers, Vorbeters und Schächters in Erledigung gekommen und soll
bis zum 15. Dezember dieses Jahres wieder besetzt werden.
Einkommen ca. Mark 800.
Bewerber wollen sich an den Unterzeichneten wenden.
Der Vorstand A. Adler I." |
| |
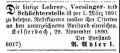 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Dezember 1890:
"Die hiesige Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle ist per 1.
März 1891 zu besetzen. Reflektanten wollen ihre Offerten an den
unterzeichneten Vorstand einreichen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Dezember 1890:
"Die hiesige Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle ist per 1.
März 1891 zu besetzen. Reflektanten wollen ihre Offerten an den
unterzeichneten Vorstand einreichen.
Kelsterbach, 29. November 1890. Der Vorstand A. Adler I." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Januar 1891:
"Die hiesige Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle ist per
1. März 1891 zu besetzen. Einkommen ca. 800 Mark. Reflektanten wollen
ihre Offerten an den unterzeichneten Vorstand einreichen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Januar 1891:
"Die hiesige Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle ist per
1. März 1891 zu besetzen. Einkommen ca. 800 Mark. Reflektanten wollen
ihre Offerten an den unterzeichneten Vorstand einreichen.
Kelsterbach, 18. Januar 1891. Der Vorstand A. Adler I." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Mai 1891:
"Die hiesige Religionslehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle
ist per 1. Juli dieses Jahres zu besetzen. Einkommen ca. 800 Mark. -
Reflektanten wollen ihre Offerten an den unterzeichneten Vorstand
einreichen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Mai 1891:
"Die hiesige Religionslehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle
ist per 1. Juli dieses Jahres zu besetzen. Einkommen ca. 800 Mark. -
Reflektanten wollen ihre Offerten an den unterzeichneten Vorstand
einreichen.
Kelsterbach. Der Vorstand: A. Adler I." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Dezember 1893:
"Die Stelle eines Religionslehrers, Kantors und Schochets ist per
sofort zu besetzen. Gehalt 500 Mark und ca. 250 Mark Nebenverdienst.
Offerten nebst Zeugnisabschriften beliebe man baldigst einzusenden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Dezember 1893:
"Die Stelle eines Religionslehrers, Kantors und Schochets ist per
sofort zu besetzen. Gehalt 500 Mark und ca. 250 Mark Nebenverdienst.
Offerten nebst Zeugnisabschriften beliebe man baldigst einzusenden.
Kelsterbach, 18. Dezember 1893. Der Vorstand: A. Adler II." |
Berichte zu einzelnen
Personen aus der Gemeinde
Zur Goldenen Hochzeit von Abraham Adler I. und
Fanny geb. Straus (1909)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. September 1909:
"Kelsterbach, 15. September (1909). Ein seltenes Fest wurde hier
gefeiert. Das Ehepaar Abraham Adler I. und Frau Fanny geb. Straus,
feierten gestern das Fest der Goldenen Hochzeit. Mit einer Schar von
Kindern und Enkeln gesegnet und beliebt bei der ganzen jüdischen Gemeinde
wurde das Jubelpaar auch in der Synagoge gefeiert. Herr Lehrer Stern aus
Rüsselsheim (hielt) eine ergreifende Ansprache, welche mit großer
Begeisterung aufgenommen wurde." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. September 1909:
"Kelsterbach, 15. September (1909). Ein seltenes Fest wurde hier
gefeiert. Das Ehepaar Abraham Adler I. und Frau Fanny geb. Straus,
feierten gestern das Fest der Goldenen Hochzeit. Mit einer Schar von
Kindern und Enkeln gesegnet und beliebt bei der ganzen jüdischen Gemeinde
wurde das Jubelpaar auch in der Synagoge gefeiert. Herr Lehrer Stern aus
Rüsselsheim (hielt) eine ergreifende Ansprache, welche mit großer
Begeisterung aufgenommen wurde." |
Zum Tod von Abraham Adler I. (1911)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Oktober 1911: "Kelsterbach
am Main, 3. Oktober (1911). Am 27. September verschied hier Herr
Abraham Adler I. im 78. Lebensjahr, tief betrauert von den Seinen und von
allen, die dem trefflichen, wahrhaft frommen und gottesfürchtigen Manne
nahe standen. Sein Lebensziel war treue Pflichterfüllung. Beseelt von Gottesfurcht
und Menschenliebe mit offenem Herzen und offener Hand, dabei schlicht und
bescheiden im Wesen, so lebte und wirkte er in seinem Kreise, vorbildlich
und anspornend. Sein Heimgang bedeutet einen schweren Verlust für seine
Familie wie für seine zahlreichen Freunde, nah und fern. Seine Seele
sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Oktober 1911: "Kelsterbach
am Main, 3. Oktober (1911). Am 27. September verschied hier Herr
Abraham Adler I. im 78. Lebensjahr, tief betrauert von den Seinen und von
allen, die dem trefflichen, wahrhaft frommen und gottesfürchtigen Manne
nahe standen. Sein Lebensziel war treue Pflichterfüllung. Beseelt von Gottesfurcht
und Menschenliebe mit offenem Herzen und offener Hand, dabei schlicht und
bescheiden im Wesen, so lebte und wirkte er in seinem Kreise, vorbildlich
und anspornend. Sein Heimgang bedeutet einen schweren Verlust für seine
Familie wie für seine zahlreichen Freunde, nah und fern. Seine Seele
sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Daniel Hirsch erhält die Hessische Tapferkeitsmedaille
(1918)
 Mitteilung
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. März 1918:
"Der Krieg und die Juden. Frankfurt am Main. Hermann Rothschild,
Musikantenweg 21, erhielt die Hessische Kriegsdenkmünze und Daniel Hirsch
- Kelsterbach die Hessische Tapferkeitsmedaille." Mitteilung
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. März 1918:
"Der Krieg und die Juden. Frankfurt am Main. Hermann Rothschild,
Musikantenweg 21, erhielt die Hessische Kriegsdenkmünze und Daniel Hirsch
- Kelsterbach die Hessische Tapferkeitsmedaille." |
Zum Tod von Abraham Adler II, langjähriger Gemeindeältester und
Vorstand (1920)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Januar 1920: "Kelsterbach
am Main, 25. Januar (1920). Am 27. Tewet (= 18. Januar 1920)
verstarb hier plötzlich und unerwartet Abraham Adler II. im Alter von 75
Jahren. Mit ihm ist ein wahrhaft religiöser Jehudi dahingegangen, noch so
recht von altem Schlag. Seit einer Reihe von Jahren Gemeindeältester und
Vorstand, verstand er es in seiner Person alle edlen Vorzüge zu
vereinigen, und seiner Kehilloh in allem ein Vorbild zu seine. Herr
Rabbiner Dr. Marx, Darmstadt widmete dem Verstorbenen warme Worte des
Dankes im Namen seiner Gemeinde und Klall Jsroel ("Gesamtheit
Israel"). Die Familie, wie die Gemeinde verloren ihr Haupt. Möge er,
der so viel Gutes getan, in Frieden ruhen! Seine Seele sei eingebunden in
den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Januar 1920: "Kelsterbach
am Main, 25. Januar (1920). Am 27. Tewet (= 18. Januar 1920)
verstarb hier plötzlich und unerwartet Abraham Adler II. im Alter von 75
Jahren. Mit ihm ist ein wahrhaft religiöser Jehudi dahingegangen, noch so
recht von altem Schlag. Seit einer Reihe von Jahren Gemeindeältester und
Vorstand, verstand er es in seiner Person alle edlen Vorzüge zu
vereinigen, und seiner Kehilloh in allem ein Vorbild zu seine. Herr
Rabbiner Dr. Marx, Darmstadt widmete dem Verstorbenen warme Worte des
Dankes im Namen seiner Gemeinde und Klall Jsroel ("Gesamtheit
Israel"). Die Familie, wie die Gemeinde verloren ihr Haupt. Möge er,
der so viel Gutes getan, in Frieden ruhen! Seine Seele sei eingebunden in
den Bund des Lebens." |
| |
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 30. Januar 1920: "Kelsterbach. Im Alter von 75 Jahren
verschied Abraham Adler II., seit 40 Jahren Vorsteher unserer
Gemeinde, ein frommer, sehr geachteter Mann."
Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 30. Januar 1920: "Kelsterbach. Im Alter von 75 Jahren
verschied Abraham Adler II., seit 40 Jahren Vorsteher unserer
Gemeinde, ein frommer, sehr geachteter Mann." |
Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige von A. Adler IV (1900)
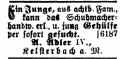 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. August 1900: "Ein
Junge, aus achtbarer Familie, kann das Schuhmacherhandwerk erlernen
und junger Gehilfe per sofort gesucht. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. August 1900: "Ein
Junge, aus achtbarer Familie, kann das Schuhmacherhandwerk erlernen
und junger Gehilfe per sofort gesucht.
A. Adler IV., Kelsterbach am Main." |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war ein Betraum in einem der jüdischen Häuser
vorhanden. Im 19. Jahrhunderts befand sich die Synagoge seit 1827 in
einem Fachwerkhaus an der Neukelsterbacher Straße. Der Betraum befand sich im
1. Obergeschoss über einer darunter befindlichen Wohnung. Die Frauenempore lag
im Dachgeschoss. 1862 wurde diese Synagoge erneuert beziehungsweise
gründlich "ausgebessert". Nach 1890 stand eine erneute Renovierung
an. Wegen des schlechten Bauzustandes riet Kreisbautechniker Wagner in seinem
Gutachten dringend, einen Neubau vorzunehmen, da auch eine Reparatur des alten
Gebäudes ziemlich teuer wäre.
Nach längeren Überlegungen beschloss die jüdische Gemeinde, einen
Synagogenneubau an Stelle der alten Synagoge vorzunehmen, auch wen die
Finanzierung für die relativ wenigen Familien ein schwieriges Unternehmen war.
Am 21. August 1896 konnte die neue Synagoge durch Rabbiner Dr. David
Selver aus Darmstadt eingeweiht werden:
Die Einweihung der Synagoge am 21. August 1896
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. September 1896:
"Kelsterbach am Main. Am 21. August (1896) fand unter Beteiligung
sämtlicher Konfessionen des Ortes die Einweihung unserer neu erbauten
Synagoge statt. Zur Abhaltung der Feier war Rabbiner Herr Dr. Selver,
Darmstadt erschienen, zur Abhaltung des Festgottesdienstes Herr Lehrer
Vooß aus Rüsselsheim. Um 5 Uhr
nachmittags wurden die heiligen Torarollen aus dem alten Bethause
abgeholt, dann zog man unter Gesang in das neue Gotteshaus ein. Hierauf
wurden die üblichen Gesänge intoniert, wonach Herr Dr. Selber die
Weiherede hielt. Auch Lehrer Vooß entledigte sich seines Amtes zur
größten Zufriedenheit. Bemerkenswert ist es, dass auch alle Nichtjuden
sich an diesem Feste sehr stark beteiligen, da der Ort nicht nur aufs
schönste geschmückt war, sondern auch alle Honoratioren beim Zuge sowohl
wie auch beim Gottesdienste vertreten waren, ein Beweis, dass an unserem
Orte das schönste Einverständnis unter den verschiedenen Konfessionen
herrscht." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. September 1896:
"Kelsterbach am Main. Am 21. August (1896) fand unter Beteiligung
sämtlicher Konfessionen des Ortes die Einweihung unserer neu erbauten
Synagoge statt. Zur Abhaltung der Feier war Rabbiner Herr Dr. Selver,
Darmstadt erschienen, zur Abhaltung des Festgottesdienstes Herr Lehrer
Vooß aus Rüsselsheim. Um 5 Uhr
nachmittags wurden die heiligen Torarollen aus dem alten Bethause
abgeholt, dann zog man unter Gesang in das neue Gotteshaus ein. Hierauf
wurden die üblichen Gesänge intoniert, wonach Herr Dr. Selber die
Weiherede hielt. Auch Lehrer Vooß entledigte sich seines Amtes zur
größten Zufriedenheit. Bemerkenswert ist es, dass auch alle Nichtjuden
sich an diesem Feste sehr stark beteiligen, da der Ort nicht nur aufs
schönste geschmückt war, sondern auch alle Honoratioren beim Zuge sowohl
wie auch beim Gottesdienste vertreten waren, ein Beweis, dass an unserem
Orte das schönste Einverständnis unter den verschiedenen Konfessionen
herrscht." |
Der mit einem Rundbogen versehene
Eingang zum Synagogengebäude war von der Straßenseite. Hoch über dem Eingang
war eine hebräische Inschrift angebracht. Auf dem Dachgesims waren Gebotstafeln
angebracht. Vom Synagogenvorraum ging der Treppenaufgang zu einer zweiseitig
angebrachten Frauenempore. Altaras s.Lit. S. 139: "Es bleibt
bewundernswert, mit welchem Können man diesen Gebäudestreifen (4 x 8 Meter)
funktionsgerecht eingerichtet und dieser Ausstattung auch einen festlichen
Rahmen verliehen hat". Es gab je 35 Plätze für Männer und Frauen in der
Synagoge.
Nachdem in den Jahren nach 1933 die Zahl der jüdischen Gemeindeglieder schnell
zurückging, sodass auch an regelmäßige Gottesdienste nicht mehr zu denken
war, wurde das Synagogengebäude am 27. Oktober 1938 für 1.800 RM an eine
christliche Familie verkauft, die es zu einem Wohnhaus umbaute. Dadurch entging
die ehemalige Synagoge beim Novemberpogrom 1938 einer Zerstörung.
Ortsansässige und auswärtige Nationalsozialisten waren bereits vor dem
Gebäude aufgezogen und randalierten, als der neue Besitzer herbeieilte und sie
von weiteren Zerstörungen abhalten konnte.
Das Gebäude blieb bis zur Gegenwart als Wohnhaus erhalten .
Adresse/Standort der Synagoge:
Neukelsterbacher Straße 17
Anmerkung: 1989 wurde am Anfang der Neukelsterbacher Straße ein großes
Schild angebracht, das auf die Bedeutung dieser ältesten Straße und auf die
Häuser der Hugenotten-Familien wie auch auf die jüdischen Bürger und ihre
Synagoge in dieser Straße hinweist.
Fotos / Pläne
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| Juli 2010:
In einem Presseartikel wird an die jüdische
Geschichte in Kelsterbach erinnert |
Artikel in der "Frankfurter Neuen Presse" vom 28. Juli 2010 (Artikel):
"Wo einst die Synagoge stand
Die Dokumentation spart die Willkür zur Nazizeit nicht aus. Die Synagoge entging der Zerstörung, weil sie ein Christ gekauft und zum Wohnhaus umgebaut hatte.
Kelsterbach. Die Untermainstadt hat eine lange jüdische Geschichte, die bis in die Gründungszeit reicht. Im Stadtarchiv gibt es dazu noch interessante Dokumente..." |
| Hinweis: der Artikel, in dem weitgehend
Informationen aus dieser Seite von "Alemannia Judaica"
aufgenommen wurden, ist auch als pdf-Datei
eingestellt. |
| |
| Februar 2014:
"Stolpersteine" werden in Kelsterbach
verlegt |
Mit 16 Stolpersteinen, verlegt von dem Künstler Gunter Demnig, wird am Montag, 17. Februar 2014,
der jüdischen Einwohner, die Opfer in der NS-Zeit wurden gedacht. Es sollen weitere Stolpersteine folgen. Die
Initiativgruppe Stolpersteine, angesiedelt an der Evangelischen Friedensgemeinde, hat für ihre Arbeit bisher gute Unterstützung erfahren. Eine Patenschaft für einen Stein kostet 120 Euro. Informationen erteilt die Friedensgemeinde unter Telefon 06107 4138 oder per Mail unter
friedensgemeinde@web.de. Vgl.
Seite
in der Website der Friedensgemeinde
Dazu auch eine Seite
in der Website der Integrierten Ganztagsschule der Stadt Kelsterbach |
| |
Artikel vom 28. Januar 2014 in der
"Frankfurter Neuen Presse / Neu-Isenburger Neuen Presse": "Stolpersteine werden verlegt
Kelsterbach. In Kelsterbach wird in einem ersten Schritt der Juden gedacht, die einst bis 1939 in der Gemeinde lebten und die später in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten umgebracht wurden oder die sich mit einem Selbstmord ihren Häschern und Peinigern entzogen haben.
Die Aktion gemeinsam mit dem Schöpfer der 'Stolpersteine', Gunter Demnig, wird am Montag, 17. Februar, vollzogen. Beginn der Aktion, an der 25 Steine an acht verschiedenen Stellen in der Mitte des Gehweges verlegt werden, ist um 13 Uhr. Treffpunkt für alle Interessierten ist der Parkplatz im Kelstergrund, der erste Verlegeort ist die gegenüberliegende Hausnummer 1 der Bergstraße.
Weitere Anlaufstellen werden dann die Mainstraße, die Untergasse, die Neukelsterbacher Straße, der Schlossweg (ehemals Kleine Mainstraße) und
die Rüsselsheimer Straße sein. Interessierte Bürger sind eingeladen, die Verlegeaktion zu begleiten. Eine Broschüre mit Informationen über die Menschen, derer gedacht wird, hat die Initiativgruppe Stolpersteine erstellt." |
| |
Artikel von Karlheinz Niess in der
"Frankfurter Neuen Presse / Neu-Isenburger Neuen Presse" vom 18.
Februar 2014: "Ein Zeichen gegen Rassismus
16 Stolpersteine in Kelsterbach verlegt
Künstler Gunter Demnig verlegte gestern in Kelsterbach 16 Stolpersteine. Sie sollen an das Schicksal jüdischer Familien aus der Untermainstadt
erinnern..."
Link
zum Artikel |
| |
| Februar / März 2016:
Weitere Verlegung von "Stolpersteinen"
in Kelsterbach |
Artikel in der "Neu-Isenburger Neuen
Presse" vom 9. Januar 2016: "Verlegung neuer Stolpersteine.
Die Initiative Stolpersteine für Kelsterbach gedenkt den Opfern der Nationalsozialisten. Im März nennt sie dazu Haus und Namen ermordeter jüdischer Bürger der Stadt.
Kelsterbach. Im Februar 2014 wurden in Kelsterbach 25 Stolpersteine für jüdische Menschen verlegt, die 1933 in Kelsterbach lebten und danach in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten ermordet wurden. Manche konnten ihr Leben auch durch Flucht ins Ausland retten.
Am Montag, 21. März, wird der Kölner Künstler Gunter Demnig in Kelsterbach weitere 27 Stolpersteine verlegen. Bei einer öffentlichen Veranstaltung wird die Initiative
'Stolpersteine für Kelsterbach' über die Menschen berichten, für welche die neuen Stolpersteine im Frühjahr verlegt werden sollen.
Gedenken an Opfer. Mitinitiator Harald Freiling, bis 2012 Lehrer in den Fächern Deutsch, Geschichte, Gesellschafts- und Arbeitslehre der Integrierten Gesamtschule Kelsterbach, wird in einem Vortrag die jüdischen Familien aus Kelsterbach vorstellen, vor deren Wohnhäusern bisher noch keine Stolpersteine verlegt wurden: Das sind die Familien Adler und Beretz in der Bergstraße 9, Familie Paw in der Bergstraße 23, die Familien Adler und Strumpfin der Neukelsterbacher Straße 21 und die Familie Adler in der Hausnummer 39 sowie das
'Textilhaus Adler' im Schlossweg 5.
Neue Informationen über das Schicksal der jüdischen Familien stammen aus dem Nachlass von Leo Hirsch, der mit seinen Eltern in der Untergasse 4 lebte. Die Briefe, die der Initiative in den vergangenen Monaten von seinem Sohn Richard Hirsch zur Verfügung gestellt wurden, zeichnen nach den Worten von Harald Freiling
'ein berührendes Bild von der Vertreibung der Juden, der Flucht der Jüngeren und der verzweifelten Hoffnung, die Eltern noch einmal wieder zu
sehen'.
Erstmals greift die Initiative auch das lange verschwiegene Verbrechen der Ermordung von über 200 000 behinderten und kranken Menschen von den Nazis auf. Am 21. März wird für Kurt Bauer aus Kelsterbach ein Stolperstein verlegt, der 1941 im Alter von 21 Jahren von den Nazis in der Landesheilanstalt Hadamar ermordet wurde. Harald Freiling wird über den Hintergrund und den Ablauf der
'Mordaktion T4' berichten.
Forschungen, die der Kreis Groß-Gerau in Auftrag gegeben hat, belegen, dass mindestens sechs Einwohner Kelsterbachs und weitere in Kelsterbach untergebrachte Zwangsarbeiter ermordet wurden, weil die Nazis kranken und behinderten Menschen das Lebensrecht nahmen. Nach dem Krieg haben viele Familien über das Schicksal ihrer von den Nazis getöteten behinderten Angehörigen geschwiegen. Familie Bauer aus Kelsterbach stellte der Initiative ihre Erinnerungen an den ermordeten Bruder und Onkel zur Verfügung. Mit der Verlegung des Stolpersteins will die Initiative an Kurt Bauer und seinen 1942 gefallenen Bruder Heinz erinnern.
Patenschaft übernehmen. Die Veranstaltung ist am Holocaust-Gedenktag, am Mittwoch, 27. Januar, um 19 Uhr im
Fritz-Treutel-Haus, Bergstraße 20. Der Eintritt ist frei. Wer bei der Finanzierung der Stolpersteine helfen möchte, kann dies durch eine Spende oder durch eine Patenschaft für einen bestimmten Stein im Wert von 120 Euro tun. Interessierte Bürger wenden sich an die Friedensgemeinde via E-Mail an
friedensgemeinde@web.de
oder überweisen die Spende auf das Konto der evangelischen Regionalverwaltung bei der Kreissparkasse Groß-Gerau, BIC HELADEF1GRG, IBAN DE36
50 85 25 53 00 03 00 65 09, Verwendungszweck 4822/031001/482200 Stolpersteine Kelsterbach."
Link
zum Artikel |
Artikel von Uwe Grünheid in der "Frankfurter
Neuen Presse" vom 30. Januar 2016: "Juden in Kelsterbach. Von der
verzweifelten Hoffnung, die Eltern wiederzusehen
26 Juden in Kelsterbach entgingen der Ermordung von den Nazis, weil sie
flüchteten. Harald Freiling zeigte während eines Rundgangs durch die
Untermainstadt, wo sie gelebt haben.
Bereits im Februar 2014 waren in der Untermainstadt 24 Stolpersteine verlegt
worden. Sie galten dem Gedächtnis der Juden, die 1933 in Kelsterbach lebten
und später in den Vernichtungslagern der Nazis ermordet wurden. 'Das war der
Einstieg in die Stolpersteinaktion', sagte Harald Freiling, Mitbegründer der
Initiative 'Stolpersteine für Kelsterbach' im Hessensaal des
Fritz-Treutel-Hauses. Diese Aktion soll nun mit der Verlegung von 27
weiteren Stolpersteinen fortgesetzt werden, darunter einen für Kurt Bauer,
der in der 'Aktion T4' von den Nazis ermordet wurde (wir berichteten), und
weitere 26 für jüdische Bürger der Stadt, die überlebt haben. Die Anregung
dazu sei von dem Kölner Künstler Gunter Demnig, dem Initiator der
Stolpersteinaktion, gekommen, so Freiling. Er habe gefragt: 'Wollen Sie die
jüdischen Familien auseinanderreißen?' Damals nämlich, fuhr Freiling fort,
verließen viele junge Juden Deutschland, während die älteren zurückblieben.
Diese wähnten sich in der Hoffnung, dass es wohl nicht so schlimm werden
würde, zumal etliche der Männer im Ersten Weltkrieg 'für Reich und Kaiser'
gekämpft hatten. Das stellte sich als Irrtum heraus. Während die Eltern in
Deutschland ermordet wurden, überlebten die Kinder in den USA. 'Die positive
Resonanz, die wir auf Demnigs Anregung hin erfuhren, hat uns ermutigt,
weiterzumachen', so Freiling. 'Wir haben das Leben von 26 Juden, die
aufgrund ihrer Flucht der Ermordung entgangen sind, gründlich und
vollständig recherchiert', sagte er und lud die Besucher der Veranstaltung
zu einem Stadtrundgang ein, der in der Bergstraße 23 begann. In dem Haus, in
dem sich einst auch das 'Gasthaus zum gemütlichen Frankfurter' befand, lebte
die Familie Paw, die Eltern Wolf und Susa mit ihren Kindern Rosa, Jakob,
Maria und David. Sie betrieben ein Geschäft für Kurz-, Weiß- und
Strumpfwaren. Die Familie sei gut in Kelsterbach integriert gewesen. So sei
Rosa beispielsweise Mitglied im Turnverein gewesen, wie alte Fotografien
belegen. Und sie ist auch die Jüdin, die in der antisemitischen
Hetzzeitschrift 'Der Stürmer' gemeint ist, mit der 'Heinrich Treutel im
Stillen verlobt' sei. Dort heißt es dann weiter: 'Mit Verrätern hat man
schon immer kurzen Prozess gemacht.'
Hier hielt Freiling für einen kurzen Exkurs über die Behandlung der Juden in
Kelsterbach inne. Er erwähnte eine Bekanntmachung aus der Kelsterbacher
Bürgermeisterei vom 20. August 1936, in der es hieß, dass es eine Schande
und Schmach sei, dass Deutsche immer noch bei Juden kaufen. Der Referent
schilderte die Repressalien, denen diese Deutschen ausgesetzt waren, etwa
den Verlust einer Gemeindewohnung und die Schmähung im 'Stürmer'. Auf diese
Weise wurde die Existenzgrundlage der Juden zerstört. Weitere Stationen des
Rundgangs: die Bergstraße 9, dort lebten die Familien Adler und Beretz, die
Neukelsterbacher Straße 21 und 39, Familien Adler und Strumpf, und
Schlossweg 5, in dem sich das Textilhaus Adler befand.
Zahlreiche Informationen habe die Initiative 'Stolpersteine für Kelsterbach'
beispielsweise aus dem Nachlass von Leo Hirsch erhalten, der mit seinen
Eltern in der Untergasse 4 lebte. Deren Sohn Richard habe der Initiative aus
den USA zahlreiche Briefe geschickt, die 'ein berührendes Bild von der
Vertreibung der Juden, der Flucht der Jüngeren und der verzweifelten
Hoffnung, die Eltern noch einmal wiederzusehen', zeigen. Die Verlegung der
27 neuen Stolpersteine erfolgt am Montag, 21. März, in Anwesenheit von
Gunter Demnig. Beginn ist um 9 Uhr in der Feldbergstraße 3, dem Wohnhaus der
Familie Bauer."
Link zum Artikel |
Artikel von Uwe Grünheid in der "Frankfurter
Neuen Presse" vom 22. März 2016: "Neue Stolpersteine. Stolpersteine für
27 Opfer des Nazi-Regimes
Die Verlegung von 27 Stolpersteinen in Kelsterbach am gestrigen Montag war
eine zweigeteilte Aktion. Vormittags kamen rund 60 Bürger in der
Feldbergstraße zusammen. Dort wurde symbolisch der erste der neuen
Stolpersteine verlegt.
Die im Februar 2014 und später verlegten Stolpersteine galten jüdischen
Opfern des Nazi-Regimes. Doch dieser eine in der Feldbergstraße wurde zum
Gedenken eines Opfers der 'Mordaktion T4', also der Tötung von kranken und
behinderten Menschen, in den Bürgersteig eingelassen: Er war Kurt Bauer
gewidmet. In Anwesenheit seines Bruders Horst Bauer und mehrerer
Familienangehöriger ging Harald Freiling, Mitbegründer der Initiative
'Stolpersteine für Kelsterbach' und Lehrer an der Gesamtschule Kelsterbach,
auf die Lebensumstände des mit einer Kiefergaumenspalte geborenen Kurt Bauer
ein und erläuterte die Hintergründe der 'Aktion T4', die nach der Adresse
des Sitzes der dafür verantwortlichen Nazi-Organisation in der
Tiergartenstraße 4 in Berlin benannt worden war. Kurt Bauer war am 18. März
1941 in Hadamar in einem eigens für diesen Zweck eingerichteten
Tötungszentrum ermordet worden. Als Todesursache sei auf der Sterbeurkunde
'Lungentuberkulose, Lungenblutung' vermerkt worden. Zur frühen Morgenstunde
waren auch Bürgermeister Manfred Ockel, Georg Germann vom Deutschen
Gewerkschaftsbund und Hans-Jürgen Vorndran vom Förderverein für jüdische
Geschichte und Kultur im Kreis Groß-Gerau gekommen, die kurze Ansprachen
hielten. Freiling verteilte Urkunden an diejenigen, die Patenschaften für
die neuen Stolpersteine übernommen haben, darunter die zehnten Klassen der
IGS, die Karl-Treutel-Schule, die St. Martinsgemeinde und die Frauen der
Christuskirchengemeinde, aber auch zahlreiche Privatpersonen und der
Förderverein für jüdische Geschichte im Kreis Groß-Gerau. Zugleich hielt
Freiling für die Teilnehmer eine Broschüre der Initiative 'Stolpersteine für
Kelsterbach' bereit. Anschließend zogen alle zu den weiteren Stationen, an
denen Stolpersteine verlegt werden sollten: in die Bergstraße 9 und 23, in
die Neukelsterbacher Straße 21 und 39 sowie in den Schlossweg 5. Nachmittags
folgte die eigentliche Verlegung der Stolpersteine, die der Künstler Gunter
Demnig vornahm. Horst Bauer bedankte sich bei dieser Gelegenheit in bewegten
Worten bei Harald Freiling für die genaue Darstellung der Umstände der
Ermordung seines Bruders."
Link zum Artikel |
| |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 440-441. |
 | Harald Freiling: Juden in Kelsterbach: jüdische
Familien und jüdische Gemeinde in Kelsterbach zwischen 1774 und 1945.
Kelsterbach 1988. 121 S. |
 | ders.: Juden in Kelsterbach: jüdische Familien und
jüdische Gemeinde in Kelsterbach zwischen 1774 und 1945. Kelsterbach 1990.
44 S. |
 | Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 S. 138-139. |
 | dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 117. |
 | Angelika Schleindl: Verschwundene Nachbarn.
Jüdische Gemeinden und Synagogen im Kreis Groß-Gerau. Hg. Kreisausschuss
des Kreises Groß-Gerau und Kreisvolkshochschule. Groß-Gerau 1990.
Insbesondere S. 192-205. 344-345. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 294-295. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Kelsterbach
Hesse. Affiliated with the Orthodox rabbinate of Darmstadt, the community
numbered 82 (7 % of the total) in 1861, but economic factors led to its decline
and by Kristallnacht (9-10 November 1938) it had ceased to exist. Of the
47 Jews living there in 1933, 20 emigrated and 27 perished in the
Holocaust.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|