|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Oberfranken"
Viereth (Gemeinde
Viereth-Trunstadt, Kreis Bamberg)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Viereth bestand eine kleine jüdische Gemeinde bis
1904. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 16./17. Jahrhunderts zurück.
Bereits 1586 lebten Juden auf dem an die Herren Zollner von Brand
verliehenen Lehen des Kloster Michelsberg. Gegen Ende des Dreißigjährigen
Krieges (1640) lebten keine Juden mehr am Ort. Um 1672 hatte
der Abt vom Kloster Michelsberg selbst Juden in Viereth aufgenommen. Der erste
namentlich bekannte Jude in Viereth war Wolf Nathan (1702). 1760
waren vier jüdische Familien am Ort.
Die Blütezeit der (aber weiterhin kleinen) Gemeinde war in der 1. Hälfte
des 19. Jahrhunderts. 1809 werden sechs jüdische Familien genannt (neben 41
christlichen Familien). 1824/25 waren es 40 jüdische Einwohner (5,3 % von
insgesamt 757), 1835 45, 1840 52 (9,4 % von 554), 1852 57 (9,2 % von 617).
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ging die Zahl der jüdischen Einwohner durch
Aus- und Abwanderung zurück: 1875 waren es noch 25 jüdische Einwohner (3,8 %
von 659), 1890 17 (2,6 % von 657), 1895 acht (1,3 % von 612) und 1900 sieben (1,2 % von
600).
Die jüdische Gemeinde hatte eine Synagoge (s.u.),
eine Religionsschule und ein rituelles Bad. Ein jüdischer Friedhof
war zu keiner Zeit vorhanden; die Toten der Gemeinde wurden auf dem jüdischen Friedhof
in Walsdorf
beigesetzt.
Zur Besorgung der religiösen Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer
angestellt, der meist gleichzeitig als Vorbeter und Schächter tätig war. 1822
wird Salomon Wiesenfelder als Vorsänger genannt, Maier Rindskopf als
Schächter. Seitdem von Seiten des Staates geprüfte Lehrer für den Unterricht
der jüdischen Schulkinder verlangt waren, werden genannt: nach 1829
Hirsch Frank aus Buttenheim. Frank war auch bereits für Trunstadt zuständig.
1835
wurde die gemeinsame Lehrer- und Vorbeterstelle für Trunstadt
und Viereth vertraglich geregelt: seitdem wechselte der Sitz der Religionsschule
zwischen beiden Orten vierteljährlich, der Gottesdienst wöchentlich. Seit 1857
war Lehrer und Vorsänger an beiden Orten Nathan Stern, ab 1875 Pfunfud Pfunfud
(auch Pfunfut Pfunfut), 1885 Leopold Röthler, 1885-1887 Adolf Löwenstein, 1891
Hermann Rose, 1893-1897 Alexander Gutmann. 1891 schloss sich Bischberg
den vereinigten Gemeinden Viereth und Trunstadt an. Seitdem wurde gemeinsam
ein jüdischer Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig
war (siehe Anzeigen von 1886 und 1892 unten).
Die Gemeinde gehörte bis zu ihrer Auflösung 1905 beziehungsweise Vereinigung
mit der Israelitischen Kultusgemeinde in Bamberg (s.u.) zum Rabbinatsbezirk Burgebrach.
Nach der Abwanderung des letzten jüdischen Einwohners von Viereth 1907
nach Bamberg erhielt die jüdische Gemeinde Bamberg die noch verbliebenen
Gemeindebesitzungen.
Von den in Viereth geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): in den beiden Listen
werden keine Personen aus Viereth genannt.
Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet gemeinsam
mit Trunstadt und Bischberg 1886 / 1892
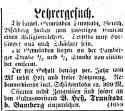 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. September 1886:
"Lehrergesuch. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. September 1886:
"Lehrergesuch.
Die israelitischen Gemeinden Trunstadt, Viereth,
Bischberg suchen zum sofortigen Eintritt einen Religionslehrer. Derselbe
muss Vorsänger und auch Schächter sein.
Die Gemeinden liegen an der
Bamberger Straße 1/2 und 1/4 Stunde voneinander entfernt.
Der fixe Gehalt
beträgt per Jahr 600 Mark nebst Holz und freier Wohnung. Nebenverdienste
inklusiv Schächterlohn ca. 300 Mark.
Offerten nebst Zeugnissen sind
sofort an den Kultusvorstand B. Heß, Trunstadt bei Bamberg
einzureichen". |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April 1892: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April 1892:
"Die erledigte Religionslehrer-, Vorbeter und Schächterstelle der
vereinigten Kultusgemeinden Trunstadt, Viereth und
Bischberg ist mit einem Fixum
von 600 Mark sofort neu zu besetzen. Nebeneinkommen 200 bis 250 Mark. Meldungen
mit Zeugnissen versehen sind zu richten an
B. Heß, Kultusvorstand in
Trunstadt."
|
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Schwierigkeiten im christlich-jüdischen Miteinander in Viereth (1886)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Januar 1886: "Aus
Oberfranken, 20. Januar 1886: Ein in Viereth am Main bei Bamberg ansässiger
israelitischer Handelsmann wurde letzten Samstag eingeladen, sich zu dem
katholischen Pfarrer nach Trunstadt zu begeben. Dortselbst wurde dem
verblüfften Israeliten die überraschende Eröffnung gemacht, dass seine 22-jährige Tochter bereits seit zwei Jahren zum Christentums übergetreten sei;
die Taufe soll der jugendliche Kaplan von Viereth vollzogen haben. Der
Handelsmann hat auf dieses hin seine Tochter aus dem elterlichen Hause
verstoßen. - Gestern rotteten sich in Viereth die Bewohner zusammen; es hatte
sich das Gerücht verbreitet, die getaufte Jüdin sei von ihrem Vater
fortgebracht worden, der sie heimlich töten (!) wolle. Ein Israelit, welcher
die aufgeregte Menge beruhigen wollte, wurde misshandelt, halb totgeschlagen,
dann wurde den Juden die Fenster eingeworfen und der Eine faktisch gezwungen,
seine Tochter, die sich in Erlangen bei Verwandten befand, telegraphisch zur
Rückkehr aufzufordern. - So berichtet der 'Nürnberger Anzeiger', dem wir die
Verantwortung für die Mitteilung überlassen müssen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Januar 1886: "Aus
Oberfranken, 20. Januar 1886: Ein in Viereth am Main bei Bamberg ansässiger
israelitischer Handelsmann wurde letzten Samstag eingeladen, sich zu dem
katholischen Pfarrer nach Trunstadt zu begeben. Dortselbst wurde dem
verblüfften Israeliten die überraschende Eröffnung gemacht, dass seine 22-jährige Tochter bereits seit zwei Jahren zum Christentums übergetreten sei;
die Taufe soll der jugendliche Kaplan von Viereth vollzogen haben. Der
Handelsmann hat auf dieses hin seine Tochter aus dem elterlichen Hause
verstoßen. - Gestern rotteten sich in Viereth die Bewohner zusammen; es hatte
sich das Gerücht verbreitet, die getaufte Jüdin sei von ihrem Vater
fortgebracht worden, der sie heimlich töten (!) wolle. Ein Israelit, welcher
die aufgeregte Menge beruhigen wollte, wurde misshandelt, halb totgeschlagen,
dann wurde den Juden die Fenster eingeworfen und der Eine faktisch gezwungen,
seine Tochter, die sich in Erlangen bei Verwandten befand, telegraphisch zur
Rückkehr aufzufordern. - So berichtet der 'Nürnberger Anzeiger', dem wir die
Verantwortung für die Mitteilung überlassen müssen."
|
Die Auflösung der jüdischen Gemeinde Viereth - Verkauf der Ritualien
(1904)
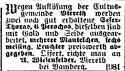 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Januar 1904:
"Wegen Auflösung der Kultusgemeinde Viereth werden zwei noch gut
erhaltene Sefer-Thoras, 6 Perochos, dieselbe sind mit Gold und Seide
ausgearbeitet, mehrere Mäntelchen, sechs messinge Leuchter preiswert
abgegeben. Offerten richte man an A. Wiesenfelder, Viereth bei
Bamberg." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Januar 1904:
"Wegen Auflösung der Kultusgemeinde Viereth werden zwei noch gut
erhaltene Sefer-Thoras, 6 Perochos, dieselbe sind mit Gold und Seide
ausgearbeitet, mehrere Mäntelchen, sechs messinge Leuchter preiswert
abgegeben. Offerten richte man an A. Wiesenfelder, Viereth bei
Bamberg." |
Vereinigung der israelitischen Kultusgemeinde Viereth mit der Israelitischen
Kultusgemeinde Bamberg (1905)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 17. März
1905: "Bamberg. Die Regierung von Oberfranken hat die
Vereinigung der israelitischen Kultusgemeinde Viereth (2 Stunden von hier
mainabwärts) mit der israelitischen Kultusgemeinde Bamberg genehmigt. die
durch einen Beteiligten in Viereth eingelegte Beschwerde gegen diese
Vereinigung ist vom Ministerium des Innern abgewiesen worden. Wegen der
künftigen Verwaltung des Vermögens der israelitischen Kultusgemeinde
Viereth durch jene in Bamberg steht die Entscheidung des hierfür
zuständigen Verwaltungsgerichtshofes noch
aus." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 17. März
1905: "Bamberg. Die Regierung von Oberfranken hat die
Vereinigung der israelitischen Kultusgemeinde Viereth (2 Stunden von hier
mainabwärts) mit der israelitischen Kultusgemeinde Bamberg genehmigt. die
durch einen Beteiligten in Viereth eingelegte Beschwerde gegen diese
Vereinigung ist vom Ministerium des Innern abgewiesen worden. Wegen der
künftigen Verwaltung des Vermögens der israelitischen Kultusgemeinde
Viereth durch jene in Bamberg steht die Entscheidung des hierfür
zuständigen Verwaltungsgerichtshofes noch
aus." |
Berichte zu einzelnen
Personen aus der Gemeinde
Suche nach Erben eines verstorbenen Ehepaares (1876)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Februar 1876:
"Aufforderung! Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Februar 1876:
"Aufforderung!
Da ich als Testaments-Exekutor gerichtlich nach dem
Testament, welches die beiden verlebten Eheleute Bärlein und Rückel
Rosenblüth zu Viereth bei Bamberg in Bayern hinterlassen haben, bestellt bin,
und die abwesenden und unbekannten Erben hierüber auffordere, ihre Erbansprüche
durch Nachweis bei mir anzumelden, besonders dass sich ein Bruder unter dem
Namen Sanwel oder Samuel Rosenblüth, welcher schon vor langen Jahren in ledigem
Stande von Viereth sich entfernt soll haben und der Aufenthaltsort, so ledig
oder verehelicht, ob derselbe noch lebt oder gestorben ist, ob derselbe Kinder
hinterlassen hat, dieses ist alles unbekannt in hiesiger Gegend. Derselbe hat
auch außer seinem treffenden Erbteil noch besonders ein Legat von achtzig
Gilden aus dem Nachlass seines Bruders Bärlein Rosenblüth zu erhalten.
Daher bitte ich jeden Mann in Ungarn, gefälligst diese Aufforderung an diesen
Sanvel oder Samuel Rosenblüth, oder an dessen hinterlassene Kinder bekannt zu
geben, oder auch den genannten Sanwel und dessen Nachkommen, mir selbst Notiz
über ihre Erbansprüche und Legat genau Namen, Wohnort und Bezirk des Gerichtes
in Ungarn innerhalb 6 Monate, von heute an pr. Post, unter meiner Adresse
bekannt zu geben, widrigen Fall nach sechs Monaten die Auseinandersetzung und Ausgleichung
dieses Nachlasses ohne Berücksichtigung erfolgt und Weitere ausgeschlossen werden
mit allen Ansprüchen.
Hochachtungsvoll Salomon Schlenker, Testaments-Exekutor in Werneck (Bayern) in
Unterfranken". |
Zur Geschichte der Synagoge
Eine Synagoge wurde kurz vor 1760 eingerichtet, da sie
in diesem Jahr als "schola (judaica) neodenominata" ("neu dazu
bestimmte Judenschule" = Synagoge) in einer Urkunde genannt wird. Im
Obergeschoss der Synagoge befanden sich auch die Lehrerwohnung und ein
"Schullokal". Neben der Synagoge war ein rituelles Bad (Mikwe), die
allerdings erst seit 1808 nachgewiesen werden kann. 1787 konnte auf Grund einer
Stiftung des Schlamm Wolf die Beleuchtung in der Synagoge durch zwei neue
Leuchter verbessert werden.
Seit 1835 hatten sich Viereth und Trunstadt auf einen gemeinsamen Lehrer
und Vorsänger geeinigt. Seitdem wurden wöchentlich abwechslungsweise die
Gottesdienste in Viereth und Trunstadt gefeiert. Als sich auch 1891 Bischberg
dem Gemeindebund zwischen Viereth und Trunstadt anschloss, sollte der
Gottesdienst abwechselnd in den drei Synagogen abgehalten werden.
Bis 1862 war die Synagoge in dem Gebäude Blumenstraße 11. In diesem
Jahr wurde das Gebäude für 400 Gulden an Marx Hellmann verkauft, der es als
Wohnhaus nützte. Dafür richtete die jüdische Gemeinde eine neue Synagoge
im Haus Blumenstraße 17 (damalige Haus-Nr. 25) ein, das von Jakob Hellmann für
900 Gulden gekauft wurde.
1904 wurde die Gemeinde aufgelöst, das Synagogeninventar, darunter zwei
Torarollen und sechs Toraschreinvorhänge u.a.m. zum Kauf angeboten (siehe
Anzeige oben). Das Gebäude der Synagoge wurde vermutlich noch in diesem Jahr zu
einem Wohnhaus umgebaut, das 1906 dem Viehhändler Josef Wiesenfelder gehörte , der inzwischen in Bamberg
lebte. 1909 verkaufte er das Anwesen an einen nichtjüdischen Bewohner in
Viereth. 1910 wurden weitere Umbaumaßnahmen vorgenommen. Am Gebäude erinnert
heute nur noch ein großes Rundfenster im Giebel an die Geschichte als jüdischen
Gotteshaus.
Adresse/Standort der Synagoge: Bis 1862
Blumenstraße 11, nach 1862 Blumenstraße 17.
Fotos
(Fotos: alle aus der Sammlung Nüßlein, Viereth; die Aufnahme
von 2007 von Hahn, Aufnahmedatum: 9. April 2007)
 |
 |
 |
1930: Das
Synagogengebäude wird bereits
als Wohngebäude verwendet. |
Nach 1945: Durch weitere
Umbauten verliert das Gebäude
sein Aussehen als ehemalige Synagoge. |
| |
|
|
|
 |
 |
 |
2007: Bis zur Gegenwart erinnert
äußerlich
nur das kleine
Rundfenster im Giebel an die ehemalige Synagoge. |
Der Zugang zur Mikwe (rituelles Bad)
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Erinnerungen an
die jüdische Geschichte / Gebäude mit Hinweistafeln 2022
(Fotos: Jürgen Hanke, Kronach, Fotos vom Juni 2022) |
|
 |
 |
 |

|
Gebäude
Blumenstraße 11 mit Hinweistafel: "Ehem. Mikwe (rituelles Bad) entstanden
1808. Von 1760 - 1862 stand hier die Judenschule (Synagoge) und seit 1808
ein rituelles Tauchbad (Mikwe) für die jüdische Gemeinde in Viereth. Die
genannte Mikwe ist der noch letzte bestehende Rest aus dem jüdischen
Gemeindeleben in Viereth".
|
Gebäude
Blumenstraße 17 mit Hinweistafel: "Ehem. Synagoge entstanden 1862. Von 1862
- 1904 Synagoge (jüdisches Gotteshaus) und Judenschule der jüdischen
Gemeinde in Viereth. Im Jahre 1904 nach Auflösung der jüdischen Gemeinde
kaufte Josef Wiesenfelder das Gebäude und baute es zum Wohnhaus um. 1909
erwarb Georg Wachter (Nichtjude) aus Viereth das Anwesen mit Hofraum. Es
dient bis heute den nachfolgenden Generationen als Wohnstätte. Heute
erinnert nur das große Rundfenster im Giebel an die Geschichte als jüdisches
Gotteshaus." |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 223. |
 | Klaus Guth (Hg.) u.a.: Jüdische Landgemeinden in Oberfranken
(1800-1942). Ein historisch-topographisches Handbuch. Bamberg 1988. zu
Viereth S. 324-332 (mit weiteren Quellenangaben). |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|