|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg
Riedlingen
(Kreis Biberach)
Jüdische Geschichte
Die Seite wurde erstellt unter Mitarbeit von Christoph Knueppel (mail:
ch.knueppel[at]t-online.de)
Übersicht:
Zur jüdischen Geschichte
in Riedlingen
In Riedlingen waren vermutlich bereits im Mittelalter Juden ansässig
(einzige Nennung 1384).
Erst nach 1867 konnten nach jahrhundertelangem Niederlassungsverbot
wieder einige Familien in der
Stadt zuziehen, die zur Synagogengemeinde in Buchau gehörten.
1878 waren es inzwischen zwei angesehene Kaufmannsfamilien in der Stadt, über die anlässlich
von antijüdischen Äußerungen des katholischen Vikars der Stadt ein
Bericht in der überregionalen jüdischen Presse erschien:
 Artikel
aus der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Dezember
1878: Artikel
aus der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Dezember
1878:
"Aus Württemberg. 17. November (1878)....
In Riedlingen wohnen seit ca. 6 Jahren zwei israelitische Familien,
sehr angesehene Kaufleute und bei den dortigen Katholiken sehr geachtet.
Die Tochter eines derselben besucht die dortige obere Mädchenschulklasse
und hat sich ihrer Talente und guten Sitten wegen viele Freundinnen unter
ihren Mitschülerinnen erworben, besonders unter den Kindern der dortigen
Beamten. Deshalb brachte es auch eine große Aufregung unter der
Bevölkerung hervor, als vor einigen Wochen der katholische Vikar beim
Religionsunterricht in Abwesenheit des jüdischen Mädchens seine
Katechumenen ermahnte: 'Ihr solltet Euch schämen, mit einem Judenmädchen
Euch zu befreunden, man muss stets wissen, dass man Christ ist und seine
Würde als solcher wahren. Diese Wucherjuden sollen froh sein, dass man
sie bei uns leben lässt usw.'. Diese und noch weitere intolerante
Äußerungen des jungen fanatischen Geistlichen bewirkten gerade das
Gegenteil von Dem, was derselbe damit beabsichtigte. Alle Eltern, die
durch ihre Kinder von diesen 'religiösen Belehrungen' Kenntnis erhielten,
besonders die Beamten, bezeugten dem Vater ihre Sympathien und
veranlassten ihn, die Angelegenheit der kirchlichen Behörde zur
Entscheidung vorzulegen, welche wahrscheinlich die Versetzung des Vikars
dekretieren wird." |
Ausführlich mit der jüdische Geschichte
Riedlingens beschäftigt hat sich der katholische Theologe Christoph Knüppel
(Herford). Über einen Vortrag im Oktober 2005 in Riedlingen liegt folgender
Bericht vor:
 Artikel
im "Alb-Boten" (Lokalteil der Südwest-Presse Ulm) vom 15.
Oktober 2005: "Geschichte / Vortrag von Christoph Knüppel zu
'Riedlinger Juden': Geschäftsleute aus Buttenhausen. Artikel von
Waltraud Wolf. Artikel
im "Alb-Boten" (Lokalteil der Südwest-Presse Ulm) vom 15.
Oktober 2005: "Geschichte / Vortrag von Christoph Knüppel zu
'Riedlinger Juden': Geschäftsleute aus Buttenhausen. Artikel von
Waltraud Wolf.
Der katholische Theologe Christoph Knüppel hatte die lange Reise von
Herford nach Riedlingen gemacht, um auf Einladung des Altertumsvereins
über jüdische Familien und ihr Schicksal zu berichten, die einst in der
Donaustadt lebten. Einige von ihnen waren aus Buttenhausen zugezogen.
RIEDLINGEN. Eine größere jüdische Gemeinde bestand in Riedlingen zu
keiner Zeit, informierte Christoph Knüppel. Es waren nie mehr als zehn
bis 20, die in der Stadt lebten. Vermutlich gab es einzelne, die im Spätmittelalter
in Riedlingen ansässig waren. In der Neuzeit tauchten jüdische
Wanderhändler auf. Festen Wohnsitz hätten Juden in der Donaustadt jedoch
erst wieder 1871 genommen. Es waren die Familien Abraham und Moritz
Landauer, die beide aus Buttenhausen stammten und davor in
Buchau ein Textilgeschäft
betrieben haben.
Bis auf das Ehepaar Simon und Klara Adler seien alle im Textilhandel
gewesen, die meisten von ihnen sehr erfolgreich. Dazu kam eine Filiale des
Ulmer Lebensmittelgeschäftes Gaissmaier, die mit Herbert Oettinger einen
jüdischen Geschäftsführer beschäftigte. Die Geschäftsgründer und
ihre Ehefrauen kamen fast alle aus Buttenhausen. An den hohen jüdischen
Feiertagen schlossen sie ihre Läden, um die Synagoge zu besuchen. Auch
verbrachten die Kinder ihre Ferien häufig bei den Großeltern in Buttenhausen.
Vor allem die Söhne der Juden absolvierten die Lateinschule und knüpften
Freundschaften mit nichtjüdischen Kindern. Nach 1933 gab es auch hier
antisemitische Anfeinden.
'Nach allem was wir wissen, verlief das Zusammenleben von Juden und
Christen in Riedlingen bis 1933 weitgehend friedlich', klärte Knüppel
auf. Die Verfolgung der Juden in der Donaustadt setzte am 1. April 1933
mit einem Boykott jüdischer Geschäft ein. Längerfristig, so Knüppel,
habe er wohl keinen Erfolg gehabt, denn bald erschienen wieder Anzeigen
der Geschäfte in den Zeitungen. 1935 wurde erneut zum Boykott aufgerufen
und gegen jene gehetzt, die dennoch dort einkauften.
Ende 1935 wurde Herbst Oettinger als Geschäftsführer der Riedlinger
Gaissmaier-Filiale entlassen. Die Familie zog nach Stuttgart und konnte
1941 nach New York ausreisen. Immer stärker wurde auch der Druck auf die
Unternehmer, ihre Geschäfte abzugeben: 1937 verkauften Isak Strauss und
sein Schwiegersohn David Weil das Textilgeschäft Julius Weil & Co..
Die Familie Weil wanderte im August 1940 nach Kalifornien aus. Isak
Strauss starb in Theresienstadt. Die zweite Firma, die 'arisiert' wurde,
war das Textilgeschäft Landauer. Ihre Besitzer Herbert Siegfried und
Karoline Oettinger fanden in Auschwitz den Tod. Ihr Sohn, der promovierte
Jurist Ernst Oettinger, war bereits im September 1937 in die USA
emigriert. Er nahm 1946 als amtlicher Beobachter an den Nürnberger Prozessen
teil. Seine Schwester Eva soll nach Schweden ausgewandert sein.
Das Textilgeschäft Ernst Oettinger, das seit 1919 ihrem Schwiegersohn
Albert Bernheim gehörte, ging 1938 in 'arischen' Besitz über. Bernheim
und seine Frau wurden 1941 nach Riga deportiert und dort vermutlich
erschossen. Ihre drei Kinder hatten sie zuvor in England in Sicherheit
gebracht.
Hatten Riedlinger Geschäftsleute gehofft, mit der Vertreibung der
jüdischen Händler unliebsame Konkurrenz auszuschalten, so stellten sie
jetzt fest, dass sie durch die Übernahme einmal durch Ludwig Biber und
zum anderen durch den Fabrikanten Alexander Riempp nur die alte gegen eine
neue, vielleicht sogar bedrohlichere eingetauscht hatten.
Im Jahresrückblick wurde die 'Ausmerzung sämtlicher drei Judengeschäfte
und ihre Überführung in arischen Besitz' als wirtschaftlicher
Fortschritt gefeiert, zitierte Knüppel aus dem 'Riedlinger Tagblatt' von
damals. Die noch in Riedlingen lebenden erwachsenen Juden mussten ihren
Vornamen Sara beziehungsweise Israel hinzufügen.
Zuletzt beleuchtete Knüppel die Bedeutung jüdischer Vieh- und
Pferdehändler für die damals bedeutenden Riedlinger Viehmärkte für
ganz Oberschwaben. Sie kamen aus Buchau,
Buttenhausen und Haigerloch.
Bestrebungen, für die jüdischen Händler ein Marktverbot auszusprechen,
hatte sich Bürgermeister Fischer bis zum November 1937 entzogen, weil er
fürchtete, die Märkte könnten an Attraktivität einbüßen. Danach fügte
auch er sich. Doch konnte er nicht verhindern, dass einzelne jüdische
Viehhändler in privaten Stallungen Handel trieben.
Die meisten jüdischen Kinder, die 1933 noch in Riedlingen lebten, konnten
Deutschland rechtzeitig verlassen, informierte Knüppel zum Schluss. Der
geistig behinderte Ludwig Oettinger jedoch viel in Grafeneck dem
Euthanasieprogramm der Nazis zum Opfer. Ermordet wurden außerdem der
20-jährige Walter Oettinger und der 30-jährige Ernst Weil.
Bei seinen Recherchen zur jüdischen Familie Landauer haben Christoph
Knüppel Erinnerungen von Siegfried Landauer, der seine Ferien in
Riedlingen verbracht und darüber ein Tagebuch verfasst hatte, in die
Donaustadt geführt. Motivation, sich mit dem Thema zu beschäftigen, war
für ihn auch, dass man sich bislang bei der Geschichte der Juden auf ihre
Opferrolle fixiert habe, wobei sehr viel von dem Reichtum ihrer Kultur und
Menschlichkeit verloren gegangen sei." |
Von den in Riedlingen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem): Albert Bernheim (1885), Elisabeth Bernheim
(1920), Irma Irena Bernheim geb.
Oettinger (1893), Selma Holzinger geb. Oettinger (1884), Herbert Siegfried Oettinger (1883), Karoline (Carolina, Carry) Oettinger
geb. Mayer (1881), Ludwig Oettinger (1888), Nelly Oettinger geb. Mayer (1883), Walter Oettinger
(1922), Ernst Weil (1912).
Berichte aus der
jüdischen Geschichte in Riedlingen
| Außer dem oben zitierten Bericht aus der
"Allgemeinen Zeitung des Judentums" von 1878 wurden in
jüdischen Periodika des 19./20. Jahrhunderts noch keine Berichte zur
jüdischen Geschichte in Riedlingen gefunden. |
Sonstiges
Karte an Abraham Hofheimer in
Buttenhausen aus Riedlingen (1878)
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller,
Kirchheim/Ries) |
 |
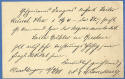
|
|
Die Postkarte der Brüder Abraham und Moses
(Moritz) Landauer von Riedlingen wurde an Abraham Hofheimer in
Buttenhausen verschickt am 11.
September 1878. Die Familien Abraham Landauer und Moses Landauer waren im
Jahr 1856/1871 von Buttenhausen nach Riedlingen übergesiedelt und eröffneten
dort ein Geschäft für Baumwollwaren, Stoffe, Damen– und Kinderbekleidung, ab
1919 auch Haushaltswaren. Inhaber des Geschäfts waren: 1871 Abraham und
Moritz Landauer, 1897 Abraham Landauer, 1902 Abraham und Karl Landauer (Sohn
von Abraham Landauer), 1906 Herbert Siegfried Oettinger (Enkel von Abraham
Landauer). Im Rahmen der Zwangsenteignung während der NS-Zeit ("Arisierung")
wurde das Geschäft im September 1938 verkauft und im November 1938
geschlossen. Die letzten Inhaber - Herbert Siegfried Oettinger und seine
Frau Karoline, verließen am 21. November 1938 Riedlingen und zogen nach
Stuttgart. Am 22. August 1942 wurden Sie nach Theresienstadt deportiert. Am
16. Mai 1944 erfolgte der Weitertransport nach Auschwitz in den Tod.
Abraham Landauer (geb. 26. Dezember 1828 in Münsingen als Sohn von
Salomon Landauer von Buttenhausen und Sara geb. Kahn von Münsingen) war
verheiratet mit Flora geb. Adler (geb. 5. Dezember 1831 in Münsingen
als Tochter von Lazarus Adler von Buttenhausen und Helene geb. Adler).
Abraham und Flora Landauer hatten 12 Kinder: Salomon (geb. 6. März
1857), Louis (geb. 4.Mai 1858), Emma verheiratete Oettinger (geb. 8.
Mai 1859), Fanny verheiratete Kaufmann (geb. 17. Oktober 1860),
Emil (geb. 28. Februar 1862), Sophie verheiratete Lazarus (geb.
22. August 1863), Gustav (geb. 25. Juli 1865), Karl (geb. 22.
August 1866), Hugo (geb. 10. Juli 1868), Siegfried (geb. 12.
Februar 1870), Rosa (geb. 1871), Max (geb. 24. April 1874).
Abraham Landauer starb am 23. August 1807 in Kandern. Flora Landauer starb
am 1. Juni 1894 in Riedlingen.
Moritz (Moses) Landauer (geb. 11. April 1839 in Münsingen als Sohn
von Salomon Landauer von Buttenhausen und Sara geb. Kahn von Münsingen) war
verheiratet mit Hedwig geb. Neuburger (geb. 10. April 1847 in
Buchau als Tochter von David Neuburger und
Judith geb. Einstein von Buchau). Die beiden hatten eine Tochter Rosa
(Rose) später verheiratete Fränkel (geb. 29. Mai 1867 in Buchau). Moritz
starb am 2. Juni 1902 in Frankfurt.
Quellen: Christoph Knüppel, Zur Geschichte der Juden in Riedlingen.
https://www.geni.com/people/Abraham-Landauer/6000000025955015056?through=6000000025954899197
https://www.geni.com/people/Moses-Moritz-Landauer/6000000021051040387?through=6000000025955015056. |
Fotos
Zur jüdischen
Geschichte in Riedlingen liegen noch keine Fotos vor
(vgl. jedoch die Beiträge von Christoph Knüppel, siehe
Literatur) |
|
| |
|
|
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
| Juni
2015:
Verlegung von "Stolpersteinen" in
Riedlingen ist geplant
|
Artikel
in der "Schwäbischen Zeitung" vom 8. Juni 2015: "Stolpersteine
werden im Mai 2016 verlegt.
Auch Riedlingen erhält 'Stolpersteine'. Es sind genügend Spenden
zusammengekommen, um 20 dieser Steine in Riedlingen zu verlegen..."
Link zum Artikel (gebührenpflichtig) |
| |
|
Mai 2016:
Verlegung von "Stolpersteinen" in
Riedlingen |
Artikel von Waltraud Wolf in der
"Südwestpresse" vom 24. Mai 2016: "'Stolpersteine' zur Erinnerung. Heute
verlegt Gunter Demning in Riedlingen 'Stolpersteine'. Sie erinnern an Juden,
die während des Dritten Reiches deportiert und ermordet wurden.
Auf die Initiative von Stadtrat Jörg Boßler geht die Würdigung von Menschen
zurück, die lange in gutem Miteinander mit ihren Nachbarn lebten, bis ihnen
im Nationalsozialismus nach dem Leben getrachtet wurde. 20 Steine werden
heute, Dienstag, von dem Künstler Gunter Demning, der die Idee dazu
entwickelt hat, in Riedlingen vor den Häusern in den Straßenbelag eingelegt,
in dem die Juden lebten oder arbeiteten. So wird an Herbert Oettinger
zweimal gedacht, am Haus Marktplatz 14, wo er arbeitete und in der
Zollhauser Straße 20, wo er lebte. Ihm und seiner Familie gelang die Flucht
in die USA, beziehungsweise für Sohn Lothar Larry mit einem Kindertransport
nach England. David, Rosa und Frida Weil konnten sich ebenfalls nach Amerika
retten, doch Isak Strauss, Rosa Weils Vater, wurde 1942 im Alter von 70
Jahren deportiert und in Theresienstadt ermordet. Sie wohnten am Marktplatz
9, wo heute die Volksbank-Raiffeisenbank ihre Dienste anbietet. Auch
Karoline Carry und Herbert S. Oettinger wurden 1942 nach Theresienstadt
deportiert und 1944 in Auschwitz ermordet, wie die von Hand eingeschlagenen
Lettern auf den beiden Messingtafeln vor dem Haus Lange Straße 8 verkünden
werden. Stolpersteine vor dem Geschäftshaus gibt es auch für ihre Kinder
Ernst Walter und Eva Irene, die 1937, beziehungsweise 1939 in die USA
flohen. Der Verlegung der Stolpersteine für Albert und Irma Bernheim vor dem
Gebäude Marktplatz 15, in dem sich heute eine Apotheke befindet, werden
Verwandte aus Frankreich beiwohnen. Die Eltern wurden ermordet, die Kinder
retteten sich nach England. Unter der Überschrift 'Stolpersteine - Spuren
und Wege' skizziert Gunter Demning danach im Lichtspielhaus seinen
künstlerischen Werdegang von 1968 an, einschließlich des Projektes, das ihn
auch nach Riedlingen führte. Beginn ist um 18 Uhr. Mehr als 56 000
Stolpersteine hat er inzwischen europaweit verlegt. Unterstützt wurde die
Aktion außer von der Stadt Riedlingen, welche die Kosten für die
vorbereitenden Arbeiten durch den Bauhof trägt, auch von der Katholischen
Kirchengemeinde, die ein Spendenkonto eingerichtet hatte. Alle 20
Stolpersteine konnten so finanziert werden."
Link zum Artikel |
| |
Juli 2020:
Hinweis auf eine "Stolperstein"-Verlegung
in Winterlingen
In Winterlingen wurde Anfang Juli 2020 zwei "Stolpersteine" verlegt für den
aus Riedlingen stammenden (katholischen) Arzt Dr. Emil Burkart und
seine (jüdische) Frau Selma Burkart geb. Muschel. Weitere
Informationen auf der Seite zu
Winterlingen. |
| |
|
Juli 2019:
Bildübergabe im Rathaus Riedlingen
zur Erinnerung an Ludwig Walz |
 Artikel von Waltraud Wolf in der "Schwäbischen Zeitung" vom 27. Juli 2019: "Bild
eines 'Gerechten unter den Völkern'.
Artikel von Waltraud Wolf in der "Schwäbischen Zeitung" vom 27. Juli 2019: "Bild
eines 'Gerechten unter den Völkern'.
Malerin Marlis Glaser und Sponsor Veit Feger wollen Erinnerung an Ludwig
Walz wach halten.
Riedlingen. Sehr berührend war die Bildübergabe im Riedlinger
Rathaus, die am 30. Todestag zur Gedenkstunde für Ludwig Walz wurde. Nicht
die Entstehung der Eichenau, die seiner Initiative und seinem Einsatz als
Riedlinger Bürgermeister von 1947 bis 1954 zu verdanken ist und 150
Flüchtlingen Heimat bot, stand dabei im Mittelpunkt. Gewürdigt wurde sein
Einsatz für jüdische Mitbürger und hier insbesondere für die jüdische
Gemeinde in Buttenhausen während des
Dritten Reiches.
Zwischen 1934 und 1942 brachte er einmal wöchentlich bei Nacht Lebensmittel
auf die Alb. Und er scheute sich trotz der Gefahr für sich und seine Familie
auch nicht, Juden noch während ihrer Deportation mit Essen zu versorgen.
Eine davon war die Familie des Rabbiners Naphtalie Berlinger. Er selber
starb im Konzentrationslager in Theresienstadt an Auszehrung. Seine Tochter
Jette Gut-Berlinger war es, die Ludwig Walz zur Ehrung als 'Gerechter unter
den Völkern' in Israel vorschlug, dem Ehrentitel für nichtjüdische Personen,
die während der nationalsozialistischen Diktatur ihr Leben für verfolgten
Juden einsetzten.
Und hier kommt Marlis Glaser ins Spiel, die Malerin aus Attenweiler, die es
sich in ihrem Abraham-Projekt zur Aufgabe gemacht hat, Portraits von
jüdischen Verfolgten und Überlebenden zu malen und sie so dem Vergessen zu
entreißen. Sponsoren, wie der einstige Verleger und Redaktionsleiter der
schwäbischen Zeitung in Ehingen, Veit Feger sorgen dafür, dass diese Bilder
im öffentlichen Raum gezeigt werden können. So auch in Riedlingen, wo jetzt
das Portrait von Ludwig Walz im Sitzungssaal seinen Platz gefunden hat. Dazu
das Werk 'Und Ludwig pflanzte einen Baum', gehört durch das Pflanzen eines
Baumes mit zu der Auszeichnung als 'Gerechter unter den Völkern'.
Eine Video-Botschaft von Aaron Berlinger aus New York machte den Anwesenden
im Sitzungssaal auf eindrucksvoller Weise deutlich, welche Wertschätzung
Ludwig Walz ob seines Einsatzes genoss. Begegnungen mit der Familie Berliner
gab es nach dem Krieg in Israel und Deutschland..."
Zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken.
Link zum Artikel (für Abonnenten der "Schwäbischen Zeitung" |
Rechts die
Bilder von Marlis Glaser:
Portrait Ludwig Walz und zu
"Und Ludwig pflanzte einen Baum"
(Foto: Veit Feger) |
 |
Rechts bei
der Video-Botschaft
von Aaron Berlinger,
im Vordergrund Marlis Glaser
(Foto: Veit Feger) |
 |
| Informationen zu
Ludwig Walz vgl. Wikipedia-Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Walz |
Links
und Literatur
Links:
Literatur:
 | Ausführliche Darstellung:
Christoph Knüppel: Zur Geschichte der Juden in Riedlingen. Erschienen in
"Heimatkundliche Blätter für den Kreis Biberach. Jahrgang 29. Nr. 2
November 2006. S. 38-65. Online
als doc-Datei zugänglich |
 | Dazu: Briefe von Rosa
Landauer an Gustav Landauer (Anhang) Online
als doc-Datei zugänglich |
 | Erich Bernheim: Mein Leben bis zum Ende des Zweiten
Weltkriegs. Hg. und übersetzt von Christoph Knüppel (Erinnerungen, die
Erich Bernheim aus Riedlingen im Dezember 1982, kurz vor seinem Tod für
seine Angehörigen niederschrieb). Online
als htm-Datei zugänglich. |
 | dazu Anhang: "Alles geht weg, nur wir sehen keinen
Ausweg". Briefe aus den Jahren 1939 und 1943. Online
als htm-Datei zugänglich. |
 | Christoph Knüppel:
"Denn deine Kraft ist in den Schwachen mächtig". Leben und Briefe
der jüdischen Christin Nelly Oettinger. In: BC - Heimatkundliche Blätter
für den Kreis Biberach Jg. 31 Heft 2 (November 2008). S. 42-53. Online
als pdf-Datei zugänglich. |
 | Erich Bernheim: Mein Leben bis zum Ende des
Zweiten Weltkriegs. Hrsg. und übersetzt von Christoph Knüppel. Mit
einem Anhang: "Alles geht weg, nur wir sehen keinen Ausweg." Briefe aus den
Jahren 1939 bis 1943. In: BC - Heimatkundliche Blätter für den Kreis
Biberach Jg. 30 Heft 1 (Juni 2007). S. 20-35. |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|