|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zu den "Synagogen im
Kreis Gießen"
Obbornhofen mit
Bellersheim
(Stadt
Hungen, Kreis Gießen)
und Wohnbach
(Gemeinde Wölfersheim, Wetteraukreis)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In den Gemeinden Obbornhofen, Bellersheim und Wohnbach bestand eine jüdische
Gemeinde bis 1938/42. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab
es möglicherweise zumindest in Obbornhofen und Bellersheim zwei separate
Gemeinden, was aus den separaten Ausschreibungen der Lehrer- und Vorbeterstellen
um 1876/1881 an beiden Orten mit Nennungen unterschiedlicher Gemeindevorsteher
(1876/77 in Bellersheim: Heinemann Stern; 1881 in Obbornhofen: Adolph Löb;
siehe unten) geschlossen werden kann. Auch die jüdischen Familien in Wohnbach
hatten einen eigenen Gemeindevorstand: 1908 werden Gerson Wallenstein und Eduard
Baer als Gemeindevorsteher der zusammen 9 Mitglieder der Gemeinde genannt (siehe
Anzeige unten).
Der Sitz der gemeinsamen jüdischen Gemeinde war zuletzt (1932) in Bellersheim, jedoch
wurde damals von den jüdischen Familien der drei Orte gemeinsam die
Synagoge in Obbornhofen besucht.
Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte sich im 19. Jahrhundert wie
folgt: in Bellersheim: 1828 22 jüdische Einwohner, 1861 27 (4,3 % von
insgesamt 627), 1880 18 (3,1 % von 586), 1900 14 (2,2 % von 642), 1910 12 (1,9 %
von 621); in Obbornhofen 1830: 26, 1905 10 jüdische Einwohner; in Wohnbach:
1830 40, 1905 38 jüdische Einwohner. Nach dieser Übersicht lebten in Wohnbach
die meisten jüdischen Einwohner der drei Orte. Es waren dort um 1900 sieben
jüdische Familien. Die Haushaltsvorsteher waren zwei Fruchthändler, drei
Spezereiwarenhändler, ein Pferdehändler. In Obbornhofen gab es zwei jüdische
Familien (ein Viehhändler, ein Spezereiwarenhändler).
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine
Religionsschule, ein rituelles Bad und ein Friedhof.
Die Gemeinde gehörte 1932 zum liberalen Provinzialrabbinat in Gießen.
Im Ersten Weltkrieg gab es nach den vorliegenden Informationen keine
jüdischen Gefallenen aus den drei Orten Bellersheim, Obbornhofen und Wohnbach,
mehrere der jüdischen Männer waren jedoch zum Militärdienst eingezogen.
Um 1924 wurden in Bellersheim 7, in Obbornhofen 6 und in Wohnbach 19
jüdische Einwohner gezählt. Die Vorsteher der Gemeinde waren Julius Kuttner
(1. Vors.) und Theodor Löb (2. Vors.) in Bellersheim sowie Siegfried Bär in
Wohnbach. An jüdischen Vereinen bestand ein Wohltätigkeitsverein
(Ziel: Unterstützung armer Durchreisender und Bestattungswesen, 1932 unter
Leitung von Julius Kuttner). Im Schuljahr 1931/32 erhielten zwei jüdische
Kinder Religionsunterricht.
1933 lebten noch 7 jüdische Personen in Bellersheim, 6 in Obbernhofen und
19 in Wohnbach. In
den folgenden Jahren sind mehrere der
jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert (aus Obbornhofen ist ein
jüdischer Einwohner nach Südafrika ausgewandert). 1939/40 wurden noch drei
jüdische Einwohner in Bellersheim gezählt. Sie mussten 1941 ein
"Judenhaus" nach Inheiden ziehen. Von dort wurden das Ehepaar Emma und
Julius Kuttner sowie Marta Kuttner in das KZ Theresienstadt deportiert.
Von den in Obbornhofen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Karoline Hellmann geb.
Freund(1862), Julius Kuttner (1876), Cessi Meier geb. Scheuer (1886), Katinka
Scheuer (1886), Mathilde Scheuer (1887), Samuel Wallenstein.
Von den in Bellersheim geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Mathilde Jonas geb.
Wetterhahn (1871), Kathinka Katz (1882), Emma Kuttner geb. Gutmann (1874),
Julius Kuttner (1876), Marta Kuttner (1912), Moritz Kuttner (1878).
Von den in Wohnbach geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Leopold Bär (1858), Levi
Bär (1863), Rudolf Bär (1893), Siegfried Bär (1899), Jenny Bamberger geb.
Majer (1877), Irene Falk geb. Bär (1896), Rosalie Joseph geb. Wallenstein
(1881), Irma Kapenberg (1884), Fanny (Franziska) Kaufmann geb. Bär (1860), Selma
Marx geb. Wallenstein (1884), Jenny
Mildenberg geb. Löb (1886), Sophie Schönfeld (1888), Helene Schott geb.
Schönfeld (1891), Ludwig Schott (1890), Isidor Wallenstein (1877), Regina Wiesenfelder
geb. Löb (1878).
Am 26. August 1990 wurde am jüdischen
Friedhof in Hungen auf Initiative einer "Arbeitsgemeinschaft
Spurensuche" ein Mahnmal zur Erinnerung an die ehemaligen jüdischen
Einwohner von Hungen, Bellersheim, Obbornhofen und Utphe eingeweiht. Auf dem Denkmal stehen die Namen der "in der Zeit der Gewaltherrschaft 1933
bis 1945 ermordeten, vertriebenen und gedemütigten jüdischen Bürger".
Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stellen des Lehrers und Vorbeters in Bellersheim und
Obbornhofen 1876 / 1877 / 1881
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1876: "In
hiesiger israelitischer Religionsgemeinde ist die Stelle eines
Religionslehrers, Vorsängers und Schächters vakant geworden, mit einem
Gehalt von Mark 700 und ca. Mark 200 Akzidenzien. Qualifizierte Bewerber
wollen sich baldigst an den unterzeichneten Vorstand wenden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1876: "In
hiesiger israelitischer Religionsgemeinde ist die Stelle eines
Religionslehrers, Vorsängers und Schächters vakant geworden, mit einem
Gehalt von Mark 700 und ca. Mark 200 Akzidenzien. Qualifizierte Bewerber
wollen sich baldigst an den unterzeichneten Vorstand wenden.
Bellersheim in der Wetterau (Post Hungen), den 28. Juli 1876.
Heinemann Stern". |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Oktober 1877:
"Wir suchen zum sofortigen Eintritt für unsere Gemeinde einen
Religionslehrer und Vorbeter, womöglich auch Schochet mit einem fixen
Jahresgehalt von 700 Mark und circa 200 Mark Nebenakzidenzien.
Reflektanten belieben ihre Anmeldungen an unterzeichneten Vorstand
einzusenden. Gesuche von Polen bleiben unberücksichtigt. Unverheiratete
werden bevorzugt.
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Oktober 1877:
"Wir suchen zum sofortigen Eintritt für unsere Gemeinde einen
Religionslehrer und Vorbeter, womöglich auch Schochet mit einem fixen
Jahresgehalt von 700 Mark und circa 200 Mark Nebenakzidenzien.
Reflektanten belieben ihre Anmeldungen an unterzeichneten Vorstand
einzusenden. Gesuche von Polen bleiben unberücksichtigt. Unverheiratete
werden bevorzugt.
Bellersheim in der Wetterau, 16. Oktober 1877. H. Stern,
Vorstand." |
| |
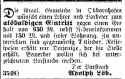 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Juli 1881: "Die
israelitische Gemeinde in Obbornhofen wünscht einen Lehrer und
Vorbeter zum alsbaldigen Eintritt gegen einen Gehalt von 650 Mark nebst
Nebeneinkommen mit 150 Mark und freier Wohnung. Zu unterrichten sind
gegenwärtig 7 Kinder. Reisespesen erhält nur Derjenige, der die Stelle
erhält. Bewerber wollen sich bei unterzeichnetem Vorstande melden. Der
Vorstand. Adolph Löb." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Juli 1881: "Die
israelitische Gemeinde in Obbornhofen wünscht einen Lehrer und
Vorbeter zum alsbaldigen Eintritt gegen einen Gehalt von 650 Mark nebst
Nebeneinkommen mit 150 Mark und freier Wohnung. Zu unterrichten sind
gegenwärtig 7 Kinder. Reisespesen erhält nur Derjenige, der die Stelle
erhält. Bewerber wollen sich bei unterzeichnetem Vorstande melden. Der
Vorstand. Adolph Löb." |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der Gemeinde
Zur Goldenen und Diamantenen Hochzeit des Ehepaares Benjamin
Stern und Frau in Bellersheim 1876 und 1886
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Dezember 1876:
"Bellersheim in der Wetterau, 1. Dezember. Am vergangenen Schabbat
Paraschat Toledot (Schabbat mit der Toralesung Toledot) feierte in
hiesiger Gemeinde Herr Benjamin Stern mit dessen Ehehälfte seinen
fünfzigsten Hochzeitstag; es verdient diese Feier umso mehr der
Erwähnung, als die ältesten Mitglieder dieser Gemeinde eines solchen
Ereignisses dahier sich nicht erinnern können. Der Jubilar ist noch ein
sehr rüstiger Mann; denn er arbeitet heute noch mit eisernem Fleiße,
trotzdem er schon ein Alter von 72 Jahren erreicht hat; seine Frau kann
sich ebenfalls der besten Gesundheit erfreuen, sie ist 70 Jahre alt. Die
Kinder dieser Ehe, deren es 12 waren, von denen aber nur 8 mehr am Leben,
sind alle verheiratet, und hat das Jubelpaar das Glück, eine Menge Enkel
und Urenkel zu sehen. Herr B. Stern erzog seine Kinder in jüdischem Sinn,
trotz der vielen Schicksalswellen, die gegen seinen Lebenskahn anprallten.
Gar oft waren die Verhältnisse dieses Mannes so gestaltet, dass nach
menschlicher Berechnung sein Lebensschiffchen verloren zu sein schien,
aber Gott der Allgütige halt ihm stets aus solchem Unwetter, wodurch
dieser Mann im Gottvertrauen gestärkt wurde. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Dezember 1876:
"Bellersheim in der Wetterau, 1. Dezember. Am vergangenen Schabbat
Paraschat Toledot (Schabbat mit der Toralesung Toledot) feierte in
hiesiger Gemeinde Herr Benjamin Stern mit dessen Ehehälfte seinen
fünfzigsten Hochzeitstag; es verdient diese Feier umso mehr der
Erwähnung, als die ältesten Mitglieder dieser Gemeinde eines solchen
Ereignisses dahier sich nicht erinnern können. Der Jubilar ist noch ein
sehr rüstiger Mann; denn er arbeitet heute noch mit eisernem Fleiße,
trotzdem er schon ein Alter von 72 Jahren erreicht hat; seine Frau kann
sich ebenfalls der besten Gesundheit erfreuen, sie ist 70 Jahre alt. Die
Kinder dieser Ehe, deren es 12 waren, von denen aber nur 8 mehr am Leben,
sind alle verheiratet, und hat das Jubelpaar das Glück, eine Menge Enkel
und Urenkel zu sehen. Herr B. Stern erzog seine Kinder in jüdischem Sinn,
trotz der vielen Schicksalswellen, die gegen seinen Lebenskahn anprallten.
Gar oft waren die Verhältnisse dieses Mannes so gestaltet, dass nach
menschlicher Berechnung sein Lebensschiffchen verloren zu sein schien,
aber Gott der Allgütige halt ihm stets aus solchem Unwetter, wodurch
dieser Mann im Gottvertrauen gestärkt wurde.
Möge Gott ihn noch lange mit seiner Gattin gesund erhalten! ..ch.." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1886:
"Aus Oberhessen, 1. Dezember. In dem Dorfe Bellersheim (Kreis
Gießen) feierte in verflossener Woche ein israelitisches Ehepaar die
'diamantene Hochzeit'. Seite Ehe war mit 12 Kindern gesegnet, von welchen
8 und gegen 50 Enkel und Urenkel noch am Leben sind. Das Fest wurde von
dem noch rüstigen Jubelpaare im Kreise der Familie und vieler Bekannten
recht fröhlich begangen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1886:
"Aus Oberhessen, 1. Dezember. In dem Dorfe Bellersheim (Kreis
Gießen) feierte in verflossener Woche ein israelitisches Ehepaar die
'diamantene Hochzeit'. Seite Ehe war mit 12 Kindern gesegnet, von welchen
8 und gegen 50 Enkel und Urenkel noch am Leben sind. Das Fest wurde von
dem noch rüstigen Jubelpaare im Kreise der Familie und vieler Bekannten
recht fröhlich begangen." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeigen des Schneidermeisters Kuttner in Bellersheim (1906 / 1912)
 Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. November
1906: Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. November
1906:
"Suche sofort einen tüchtigen jungen Schneider.
Samstags und Feiertage wird nicht gearbeitet.
Julius Kuttner, Schneidermeister, Bellersheim bei Friedberg
(Oberhessen)." |
| |
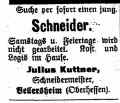 Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 26. April
1912: Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 26. April
1912:
"Suche per sofort einen jungen Schneider.
Samstags und
Feiertage wird nicht gearbeitet. Kost und Logis im Hause.
Julius
Kuttner, Schneidermeister, Bellersheim (Oberhessen)." |
Spendenaufruf für die Witwe Schönfeld in Wohnbach
(1908)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Mai 1908: "Aufruf!
Edle wohltätige Glaubensgenossen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Mai 1908: "Aufruf!
Edle wohltätige Glaubensgenossen.
Es fällt uns in der Tat schwere Eure edle Menschenfreundlichkeit zu
einer Zeit in Anspruch zu nehmen, in welcher allerseits so viele
Ansprüche an Euch gemacht werden; doch als Söhne Israels - Söhne des
Erbarmens seid ihr - werdet (ihr) uns auch jetzt Herz und Hand
nicht verschließen, wo es gilt, eine von schweren Schicksalen
heimgesuchte arme Witwe mit drei Waisen aus bitterer Not zu retten helfen.
Es betrifft dies die Witwe Schönfeld hier, die vollständig
mittel- und erwerbslos dasteht. Ihr 27-jähriger Sohn befindet sich schon
seit 9 Wochen in der Klinik in Gießen, wo er an einer unheilbaren
Krankheit langsam dahinsiecht. Auch von ihren anderen Kindern (2 Mädchen)
hat die Frau keine Hilfe zu erwarten, da die beiden selbst auf die
Gutherzigkeit edler Menschen angewiesen sind. Die Kosten, die der
Aufenthalt des Kranken in der Klinik verursacht, sind bis jetzt schon sehr
hoch und ist die hiesige israelitische Gemeinde, die nur aus 9 Mitgliedern
besteht, für die Dauer nicht im Stande, Alles für die bedrängte Familie
aufzubringen, was sie allerdings bis jetzt in opferwilliger Weise getan
hat. Die ergebenst Unterzeichneten bitten gütigst um recht baldige,
zahlreiche Unterstützung und nehmen auch die kleinste Gabe dankend
an.
Wohnbach in der Wetterau, den 8. Mai 1908.
Der Lehrer: Hermann Berg.
Der Vorstand: Gerson Wallenstein, Eduard Baer.
Dass Vorstehendes voll und ganz auf Wahrheit beruht bescheinigt.
Wohnbach, am 8. Mai 1908. Großherzogliche Bürgermeisterei
Patum." |
| Anmerkung: bei den beiden Töchtern der
Witwe Schönfeld dürfte es sich um die in der NS-Zeit umgekommenen Frauen Sophie Schönfeld
(1888) und Helene Schott geb.
Schönfeld (1891) handeln. |
| Kennkarten
aus der NS-Zeit |
| |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |
| |
Kennkarten
zu Personen,
die in Wohnbach geboren sind |
 |
 |
|
| |
Kennkarte (Friedberg 1939)
für Levi Bär (geb. 10. Oktober 1863 in
Wohnbach), Fruchthändler, wohnhaft in Mainz, am 27. September 1942
deportiert ab Darmstadt in das Ghetto Theresienstadt, wo er am
14. Februar 1943 umgekommen ist |
Kennkarte (Dieburg 1939)
für Regina Wiesenfelder geb. Löb (geb.
19. Juni 1879 in Wohnbach), wohnhaft in Dieburg und Frankfurt, am
22. November 1941 deportiert ab Frankfurt nach Kowno (Kauen),
Fort IX, umgekommen |
|
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war ein Betsaal
vorhanden. Nach Arnsberg bestand um 1834 ein Plan zur Errichtung
einer Synagoge aus Holz. Ob er ausgeführt wurde, ist noch nicht geklärt.
Manches spricht darauf hin, dass die 1879 als Fachwerkbau errichtete
Synagoge auf dem Grundstück eines Vorgängerbaus erstellt wurde.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde das Innere der Synagoge zerstört.
Eine große Gruppe zehn- bis zwölfjähriger Kinder trug auf Anweisung des
NSDAP-Ortsgruppenleiters die Ritualien und weitere Einrichtungsgegenstände auf
eine Wiese, wo sie verbrannt wurden.
Das Synagogengebäude kam in Privatbesitz, wurde zu einem Wohnhaus umgebaut und
erlebte nach 1945 mehrere Besitzerwechsel. Seit 1988 befindet sich
eine Gedenktafel am Gebäude. Die neuen Besitzer bemühten sich, durch
das Entfernen von Veränderungen die ursprüngliche Baukonzeption erkennbar
werden zu lassen.
Adresse/Standort der Synagoge: Kommenturgasse
9
Fotos
Skizze der Synagoge
(Quelle: Altaras 1994 S. 71 und
Heimatgeschichtlicher Wegweiser S. 40) |
 |
| |
Gezeichnet nach
der Erinnerung von Joachim Herrler (1988) |
| |
|
Grundrisse
(Quelle: Altaras 1994 S. 71) |
 |
 |
| |
Grundriss des
Erdgeschosses |
Grundriss auf Höhe der
Frauenempore |
| |
|
|
Die ehemalige Synagoge als
Wohnhaus
(Quelle: Altaras 1988 S. 87) |
 |
| |
Die ehemalige
Synagoge |
| |
|
|
Das
Gebäude der ehemaligen Synagoge im März 2008
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 28. März 2008) |
|
| |
 |
 |
| |
Die zu einem
Wohnhaus umgebaute ehemalige Synagoge in Obbornhofen |
| |
|
| |
 |
 |
| |
Hinweis-/ Gedenktafel
|
Hinweistafel (wie an vielen
Häusern des Ortes)
auf den alten Hausnamen. |
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
|
Mai 2018:
Zum Besuch des 95-jährigen Hans
Bär in Wohnbach
Video auf arte.tv: Der Jude und sein Dorf - Besuch in Deutschland:
https://www.arte.tv/de/videos/079472-002-A/re-der-jude-und-sein-dorf/ Video
verfügbar bis 10. November 2018
Zu diesem Film: Was passiert in einem kleinen Ort, wenn jemand
zurückkehrt, der an jene Zeit erinnert, in der Juden vertrieben und ermordet
wurden? Nach 80 Jahren Exil in Argentinien besucht Hans Bär zum ersten Mal
sein Heimatdorf. Mit 14 floh er mit der Mutter vor den Nazis. Nun reist er
mit seinen Enkelinnen nach Wohnbach. Was ist aus dem Dorf geworden? Gibt es
Menschen, die er noch kennt?
Vgl. die Seite
https://hansinwohnbach.wordpress.com/wer-ist-hans-bar/
Artikel von Sabrina Dämon in der "Gießener Allgemeinen" vom 4. April 2018:
"Nach 80 Jahren. Hans Bär besucht seine Heimat Wohnbach..."
Link zum Artikel
Artikel von Kathrin Hedtke in der "Frankfurter Rundschau" vom 8. Mai 2018: "Hans
Bär. Nach 80 Jahren zurück in der Heimat..."
Link zum Artikel |
| |
|
November 2019:
Erinnerung an das Schicksal der
jüdischen Einwohner aus Bellersheim |
Artikel von Patrick
Dehnhardt in der "Gießener Allgemeinen" vom 11. November 2019: "Unvergessene
Lebens- und Leidenswege
Hungen. Es ist eine Veranstaltung, die man zunächst nicht unbedingt im
Programm eines Dorfjubiläums erwartet. Umso positiver fällt Bellersheim auf,
dass man dort im Rahmen des 1250-jährigen Ortsjubiläums auch ein dunkles
Kapitel der Dorfgeschichte thematisiert. Mit einer besonderen Feier wurde am
Sonntag in der Kirche des jüdischen Lebens im Dorf gedacht, welches von den
Nazis zerstört wurde. Die Kirche als Ort dieser Gedenkfeier - dies wirkt
zunächst ungewöhnlich. 'Jahrhundertelang haben Menschen in der Kirche dem
Antisemitismus Argumente geliefert', erklärte Pfarrerin Beate Fritzsche.
'Unsere Kirche bekennt sich dazu schuldig.' Mittlerweile pflege man einen
intensiven Dialog mit dem jüdischen Glauben.
Intensiv hat sich eine Gruppe von drei Jugendlichen und vier Erwachsenen mit
dem jüdischen Leben in Bellersheim beschäftigt. Sie kontaktieren Nachfahren
jüdischer Familien, die einst im Dorf wohnten, und interviewten diese. Sie
recherchierten aber auch Lebenswege, die in den Konzentrationslagern
endeten. Die jüdischen Mitbürger gehörten zum Dorfleben dazu.
'Im Ersten Weltkrieg zogen auch die jüdischen Männer für Deutschland ins
Feld', berichtete Beate Fritzsche. Die Bellersheimer Kinder spielten
gemeinsam auf der Straße, die jüdischen Geschäfte waren Teil der
Infrastruktur. 1861 waren 4,3 Prozent der Bevölkerung jüdisch. Doch bereits
damals zogen viele Juden in die Städte. Zum einen wuchs der Antisemitismus,
dem man in der Anonymität der Großstädte zu entgehen versuchte, zum anderen
hofften sich dort auf bessere berufliche und wirtschaftliche Perspektiven.
Die Familie von Julius Kuttner lebte in einem Haus in der
Münzenberger Straße/Ecke Münchgasse. Zusammen mit seiner Frau Emma hatte er
drei Töchter. Seit 1900 betrieb er eine Schneiderei, in der viele
Bellersheimer ihre Kleidung anfertigen ließen. Tochter Berta heiratete 1931
Friedrich Hurwitz, mit dem sie 1933 nach New York zog. Die zweite Tochter,
Elsa, war sehr musikalisch. Sie wirkte auch bei den Theateraufführungen in
der Angermühle mit. In den 1920ern ging sie als Kindermädchen nach Amerika,
wo sie ihren Ehemann kennenlernte und heiratete. 2005 starb sie im Alter von
99 Jahren.
Kunden kamen nur noch bei Nacht. Als die Nazis zum Boykott der
jüdischen Geschäfte aufriefen, traf dies die Familie Kuttner hart. Nachbarn
versorgten sie heimlich mit Lebensmitteln, Kunden kamen nur noch bei Nacht.
Gerne wäre das Ehepaar in die USA ausgewandert. Doch die USA verweigerten
der dritten Tochter die Einreise: Martha war geistig behindert. Am 9.
November 1938 wurde die Familie überfallen und geschlagen, die Fenster und
Möbel wurden zertrümmert, die Lebensmittelvorräte auf die Straße geworfen.
Ob es sich bei der Horde nur um Jugendliche aus den Rieddörfern handelte
oder ob auch Bellersheimer dabei waren, lässt sich heute aus den
Zeitzeugenberichten nicht mehr endgültig ermitteln. Im August 1941 wurde
Familie Kuttner gezwungen, nach Inheiden in ein 'Judenhaus' zu ziehen. Im
September 1942 wurden sie deportiert. Emma starb am 14. Januar 1943 in
Theresienstadt, ihr Mann Julius am 23. März 1944. Tochter Martha wurde in
Treblinka kurz nach ihrer Ankunft ermordet. Auch weitere Mitglieder der
Familie Kuttner starben in den Konzentrationslagern.
Die Familie Wetterhahn wohnte in einem Haus in der Münchgasse, das
vor langer Zeit abgerissen wurde. Samuel Wetterhahn war Viehhändler, seine
Frau hieß Hannchen. Beide starben vor Beginn des Nazi-Regimes. Sie hatten
acht Kinder. Sohn David heiratete nach Utphe, wo er 1930 starb. Seine
Familie floh 1933/1934 in die USA. Ferdinand starb bereits 1903, Tochter
Bertha 1920, die drei weiteren Söhne - Louis, Julius und Sally - flüchteten
rechtzeitig aus Deutschland. Tochter Mathilde heiratete nach Gladenbach, zog
dann als Witwe nach Frankfurt. Sie wurde 1942 deportiert und schließlich in
Treblinka ermordet. Kathinka Wetterhahn heiratete den Münzenberger Metzger
Karl Katz. Drei ihrer vier Kinder entkamen der Vernichtung. Karl und
Kathinka Katz sowie ihre Tochter Erna, der Mann Arthur und die achtjährige
Enkelin Ruth wurden von Bad Nauheim aus nach Theresienstadt deportiert und
ermordet.
Die Familie Löb wohnte im Hillebrand-Haus. Theodor Löb war Metzger
und Viehhändler, seine Mutter Sanchen betrieb den angrenzenden
Kolonialwarenladen. Sie starb 1931. Den Laden führte Ida Löb weiter. Der
einzige Sohn, Siegfried Löb, flüchtete bereits 1933 nach Palästina. Er holte
seine Eltern nach. 'In Erinnerung an die Bellersheimer Opfer des Holocaust
sollen im Februar Stolpersteine gesetzt werden', kündigte Beate Fritzsche
an. Der Chor 'A-Chor-Do' umrahmte die Gedenkfeier ebenso wie Deborah Spiegel
(Violine) und Marie-Kristin Schäfer-Fichtner (Gesang). Im Anschluss an die
Gedenkfeier konnten sich die vielen Besucher an Stellwänden über die
Geschichte der Familien informieren."
Link zum Artikel |
Artikel von Patrick
Dehnhardt in der "Gießener Allgemeinen" vom 28. Dezember 2019: "Juden in
Bellersheim: Das Schicksal der Familie Kuttner..."
Link zum Artikel |
| |
|
Januar 2020:
In Bellersheim und
Utphe werden weitere Stolpersteine verlegt
|
Artikel in der "Gießener Allgemeinen" vom
10. Januar 2020: "Stolpersteine für Utphe
Hungen. Mit Stolpersteinen erinnert der Künstler Gunter Demnig an Menschen,
die von 1933 bis 1945 Opfer des Nazi-Regimes wurden. Mittlerweile hat er 75
000 der Gedenkplaketten gesetzt, jeweils vor dem letzten frei gewählten
Zuhause der Betroffenen. Auch in Bellersheim und Utphe sollen nun
Stolpersteine gesetzt werden.
Die 'Arbeitsgruppe Spurensuche Hungen' erforscht seit 30 Jahren die
Familiengeschichte ehemaliger jüdischer Mitbürger. Die Gruppe initiierte und
begleitete in den vergangenen Jahren die Verlegung von inzwischen 37
Stolpersteinen in Hungen. Im Zuge des Ortsjubiläums '1250 Jahre Bellersheim'
hatte sich im Dorf eine eigene Arbeitsgruppe gegründet, welche die
Geschichte jüdischer Familien aus Bellersheim recherchierte. Für zwei dieser
Familien sollen nun Stolpersteine verlegt werden: Für Julius Kuttner,
seine Frau Emma und die Tochter Martha werden Steine vor der ehemaligen
Schneiderwerkstatt in der Münzenberger Str. 22 gesetzt. Martha Kuttner wurde
nach Treblinka gebracht und ermordet. Das Ehepaar Kuttner starb im KZ in
Theresienstadt. Vor der Münzenberger Straße 10/12 sollen Gedenkplaketten für
die Familie Löb in den Gehweg eingelassen werden.
Gleichzeitig wurde von Seiten des TSV Utphe angeregt, anlässlich des
bevorstehenden 90. Vereinsjubiläums des jüdischen Mitbegründers und Ersten
Vorsitzenden sowie seiner Familie mit Stolpersteinen zu gedenken. Die
Recherche zur Familiengeschichte übernahm hier die 'Arbeitsgruppe
Spurensuche Hungen'. Zunächst werden ab 9.30 Uhr die Steine in Bellersheim
gesetzt. Im Anschluss wird Demnig in Erinnerung an die Familie Wetterhahn in
der Utpher Weedstraße 12 Stolpersteine setzen.
Herstellung und Verlegung eines Steines kosten 120 Euro. Die 'Arbeitsgruppe
Spurensuche' freut sich über Spenden. Das Konto der Stadtkasse ist bei der
Sparkasse Laubach-Hungen eingerichtet, IBAN DE71 5135 2227 0001 0004 39,
Stichwort 'Stolpersteine', gegebenenfalls den Stadtteil angeben. Für
Spendenquittungen sollte auf der Überweisung die vollständige Adresse des
Spenders angegeben sein."
Link zum Artikel |
| |
Artikel von Christina Jung in der "Gießener
Allgemeinen" vom 3. Februar 2020: "Elf neue Stolpersteine.
Wetterhahn, Kuttner, Löb. Drei Namen, drei jüdische Familien. Gelebt haben
sie in Utphe und Bellersheim, die
einen sind vor den Nazis geflohen, die anderen wurden deportiert. Seit
gestern erinnern in den beiden Dörfern elf Stolpersteine an ihre Schicksale.
Eine fremde Melodie erklingt in der Bellersheimer Ortsmitte, gespielt wird
sie von einem Klarinettisten. Um ihn haben sich rund 50 Menschen versammelt,
die der Hatikvah lauschen. Die Nationalhymne des Staates Israel bedeutet
Hoffnung, und die ist an diesem Morgen verbunden mit der Erinnerung. Die
Erinnerung an drei Hungener Familien, die Opfer der Nationalsozialisten
wurden. Dass sie einmal im Raum Hungen gelebt haben, ist seit gestern für
jeden sichtbar. Elf Stolpersteine erinnern an ihre Schicksale - sechs in
Bellersheim, fünf in Utphe. Der Künstler Gunter Demnig hat sie verlegt.
[...].
Erinnern, niemals vergessen - das war auch das Thema von Bürgermeister
Rainer Wengorsch. 37 Stolpersteine wurden in den vergangenen Jahren in
Hungen verlegt. Seit gestern sind es elf mehr. "Die AG Spurensuche kommt
Haus für Haus voran", erklärte Wengorsch und gab angesichts des zunehmenden
Populismus und Anschlägen wie den auf die Synagoge in Halle seiner Hoffnung
Ausdruck, dass man auch "von Kopf zu Kopf" vorankomme. Die Steine holten die
Geschichte in den Alltag zurück, seien ein stetiges Zeichen der Erinnerung.
Diese Arbeit werde vor allem deshalb immer wichtiger, weil es kaum noch
Zeitzeugen gebe, die an die "historische Schuld" erinnerten. Wengorsch
betonte: "Die Wetterhahns waren Bürger von Utphe." So wie die Kuttners und
Löbs Bürger von Bellersheim waren. Hier hatte sich während des
Dorfjubiläums im vergangenen Jahr eine eigene Arbeitsgruppe gegründet, die
sich auf Spurensuche begeben, eine Broschüre zusammengestellt und im
November eine Gedenkveranstaltung abgehalten hatte (die GAZ berichtete
ausführlich). Während die Familie Kuttner 1941 zunächst ins Judenhaus nach
Inheiden umziehen musste und später nach Treblinka beziehungsweise
Theresienstadt deportiert wurde, hatte Familie Löb - ebenso wie die
Wetterhahns - die Zeichen der Zeit frühzeitig erkannt. Siegfried Löb
wanderte 1933 nach Palästina aus und konnte später seine Eltern nachholen.".
Link zum Artikel
Vgl. Artikel von Rose-Rita Schäfer im "Gießener Anzeiger" vom 3. Februar
2020: "Stolpersteine in Bellersheim und Utphe verlegt.
Elf Stolpersteine wurden zum Gedenken an ermordete beziehungsweise geflohene
jüdische Familien von Gunter Demnig in Bellersheim und Utphe verlegt..."
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Quellen:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 62 (unter Bellersheim) |
 | Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 S. 87-88. |
 | dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 71-72. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel. 1995 S. 334-335 (Artikel
zu Wölfersheim). Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel 1995 S.
40-41 (Artikel zu Hungen). |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 110 (unter Bellersheim). |
 |  Hanno Müller, Dieter Bertram, Friedrich Damrath:
Judenfamilien in Hungen und in Inheiden, Utphe, Villingen, Obbornhofen,
Bellersheim und Wohnbach. ISBN 978-3-940856-16-6 Hungen
2009. Hanno Müller, Dieter Bertram, Friedrich Damrath:
Judenfamilien in Hungen und in Inheiden, Utphe, Villingen, Obbornhofen,
Bellersheim und Wohnbach. ISBN 978-3-940856-16-6 Hungen
2009.
Zu beziehen über den Magistrat der Stadt Hungen - Stadtarchiv -
Kaiserstraße 7 35410 Hungen E-Mail |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Bellersheim
Hesse. The Jews of Wohnbach, Obbornhofen and Bellersheim formed one
community, numbering several dozen in the 19th century. On Kristallnacht
(9-10 November 1938) the synagogue was desecrated. The last few Jews were
probably deported in 1941-42.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|