|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg
Durlach (Stadt Karlsruhe)
Jüdische Geschichte / Betsaal
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Durlach lebten Juden bereits im Mittelalter (1340 Jüdin
von Durlach in Speyer genannt; 1349 Judenverfolgung), dann wieder im 16.
Jahrhundert (1547 Baruch und Gottschalk mit ihren Familien), vermehrt erst seit
dem Ende des 17. Jahrhunderts.
Nach Überlieferungen am Ort gab es in der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg
möglicherweise einen jüdischen Friedhof im Bereich der noch vorhanden Flur
"Judenbusch" (Stadtwiki Karlsruhe: Artikel
"Im Judenbusch")
Im 18. Jahrhundert bestand eine kleine Gemeinde
mit eigenen Einrichtungen; seit 1894 war Durlach Filialgemeinde von Grötzingen.
Die höchste Zahl jüdischer Einwohner wurde vermutlich 1714 mit über 100
Personen erreicht. Nach der Gründung Karlsruhes 1715 ging die Zahl der Juden in
Durlach stark zurück. 1797 lebten hier noch fünf jüdische Erwachsene und neun
Kinder.
Zwischen 1825 und 1875 wurden bei den Volkszählungen nie mehr als sechs
Juden am Ort registriert. Dann nahm ihre Zahl wieder zu.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Berthold Falk
(geb. 6.5.1899 in Malsch, vor 1914 in Durlach wohnhaft, gef. 21.7.1918) und
Unteroffizier Hermann Schmalz (geb. 8.5.1897 in Durlach, vor 1914 in Grötzingen
wohnhaft, gef. 24.4.1918).
1925 wurden 60 jüdische Einwohner in Durlach
gezählt.
Nach 1933 ist ein Teil der jüdischen Einwohner auf Grund der Folgen des
wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Repressalien und der Entrechtung aus
Durlach weggezogen oder emigriert. Beim Novemberpogrom 1938 kam es zu
Übergriffen gegen jüdische Geschäfte und Einwohner. Am 22. Oktober 1940
wurden die letzten jüdischen Einwohner in das Konzentrationslager Gurs in
Südfrankreich deportiert.
Aus der
Geschichte der jüdischen Gemeinde
Zu einzelnen Personen aus
der Gemeinde
Aus dem 17./18. Jahrhundert: Grabstein der Hinle bat Jizchak mi-Turlach
Dazu ein Beitrag von Günter Boll: als pdf-Datei
eingestellt
Rechts: Grabstein im jüdischen
Friedhof in Mackenheim der am
11. September 1707 gestorbenen Hinle, Tochter des Jizchak - seligen
Andenkens - von Turlach (= Durlach), [erste] Ehefrau des parnass
u-manhig (Gemeindevorstehers) Marx Günzburger
von
Breisach; auffallend ist die Schlichtheit des
(zerbrochenen) Grabsteines |
 |
|
| |
|
|
Anzeigen jüdischer
Gewerbebetriebe
Anzeige der Badischen Bürsten-Fabrik Süß Weil &
Cie. (1901)
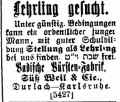 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juli 1901: "Lehrling
gesucht. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juli 1901: "Lehrling
gesucht.
Unter günstigen Bedingungen kann ein ordentlicher junger Mann, mit
guter Schulbildung Stellung als Lehrling bei uns finden. Schabbat
und Feiertag frei.
Badische Bürsten-Fabrik, Süß Weil & Cie.,
Durlach - Karlsruhe." |
Zur Geschichte des Betsaales / der Synagoge
Aus dem Mittelalter und bis zum
17. Jahrhundert sind keine Einrichtungen bekannt. Vermutlich war die Zahl der
Juden dafür jeweils zu gering.
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| Juni 2012:
In Durlach werden die "Stolpersteine"
gereinigt |
Artikel in den ka-news.de vom 16. Juni 2012:
"Stolpersteine in Durlach: Putzaktion gegen das Vergessen..."
Link
zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.
1968. S. 149-150. |
 | Germania Judaica II,1 S. 181. |
 | Heinz Schmitt (Hg.) unter Mitwirkung von Ernst Otto Bräunche
und Manfred Koch: Juden in Karlsruhe. Beiträge zu ihrer Geschichte
bis zur nationalsozialistischen Machtergreifung. Karlsruhe 1988. 1990² (=
Veröffentlichungen des Karlsruher Stadtarchivs Band 8). Zu Durlach darin die
Beiträge von Susanne Asche S. 21-41 und 189-218. |
 | Susanne Asche: Durlach - Staufergründung, Fürstenresidenz,
Bürgerstadt. (= Veröffentlichungen des Karlsruher Stadtarchivs Band 17).
Karlsruhe 1996. |
 | Sigmund Metzger: Festschrift zum Hundertjährigen Jubiläum der
Erbauung der Synagoge in Grötzingen. Grötzingen 1899. Reprint:
Evangelische Kirchengemeinde Karlsruhe-Grötzingen (Hg. Ulrich Schadt).
Karlsruhe-Grötzingen 2002. |
 |  Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007. Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007. |
 |  Thomas
Schnitzler: "Das Leben ist ein Kampf". Marianne Elikan -
Verfolgte des Nazi-Regimes. Tagebuch, Briefe und Gedichte aus Trier und
Theresienstadt. Wissenschaftler Verlag Trier 2008. ISBN 10:
3868211004 ISBN 13: 978-3868211009. Thomas
Schnitzler: "Das Leben ist ein Kampf". Marianne Elikan -
Verfolgte des Nazi-Regimes. Tagebuch, Briefe und Gedichte aus Trier und
Theresienstadt. Wissenschaftler Verlag Trier 2008. ISBN 10:
3868211004 ISBN 13: 978-3868211009.
Zu diesem Buch: Marianne Elikan, 1928 als sogenanntes 'Mischlingskind' im badischen
Durlach geboren, kam 1932 als Pflegekind zu dem jüdischen Ehepaar Wolf nach
Wawern. Während des Novemberpogroms wurde das Wohnhaus der Familie von einem Nazi-Schlägertrupp verwüstet. Im Juni 1939 wurden die Wolfs nach Trier zwangsevakuiert. Die Juden lebten dort nun in speziellen
'Judenhäusern', während ihnen im täglichen Leben immer mehr Beschränkungen auferlegt wurden.
1940 meldete sich bei der Familie unerwartet Mariannes leiblicher Vater. Der
'arische' Vater bot an, seine Tochter bei sich aufzunehmen. Doch einen Besuch bei ihm in Frankfurt empfand Marianne als bedrohlich und sie entschloss sich, trotz des ungewissen Schicksals zu ihren Pflegeeltern zurückzukehren.
Die Trennung der Familie erfolgte zwei Jahre später gewaltsam: 1942 wurde Marianne Elikan alleine in das tschechische Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. In ihrem Tagebuch beschreibt
Marianne Elikan eindringlich den alltäglichen Schrecken von Theresienstadt. Am Ende gehörte sie zu den wenigen Tausend Überlebenden. Weniger Glück hatten ihre Angehörigen, die in den Vernichtungslagern ermordet wurden. Trotzdem kehrte Marianne Elikan nach ihrer Befreiung nach Trier zurück, wo sie bis 2002 lebte. Allerdings wurde ihr das Erbe ihrer ermordeten Pflegeeltern verweigert.
(Quelle).
|



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|