|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen im Saarland"
Beaumarais
(Stadt Saarlouis)
Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Beaumarais bestand eine kleine jüdische Gemeinde bis
1936/40. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück,
wenngleich eine selbständige jüdische Gemeinde in Beaumarais nur einige
Jahrzehnte nach 1863 bestand. Zuvor bildeten die in Beaumarais und Wallerfangen
lebenden Juden eine gemeinsame Gemeinde. 1783 lebten in beiden Orten zwölf jüdische Familien.
1817 kam es zu einem Streit zwischen den Familien beider Orte, in
den der Oberrabbiner von Trier eingeschaltet war und der offenbar zur
(vorübergehenden?) Trennung der beiden Gemeinden geführt hat. Beim Streit
dürfte es um die Frage nach dem Hauptort der Gemeinde gegangen sein, da nicht
an beiden Orten eine Synagoge betrieben werden konnte. Damals besuchten in
Beaumarais lebenden Juden den Betsaal in Wallerfangen. Auch in den folgenden
Jahrzehnten blieb Wallerfangen Hauptort: 1838 wurde hier eine neue Synagoge gebaut. In den
Verzeichnissen bis nach der Mitte des 19. Jahrhunderts erscheint Beaumarais immer als Filialort
von Wallerfangen, z.B. in einem Verzeichnis über die jüdischen
Gemeindeglieder im Kreis Saarlouis von 1855: "Wallerfangen mit
Beaumarais".
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1824 36 jüdische Einwohner, 1887 63, 1892 61 (in elf Familien), 1895 50,
1868 58 (in 11 Haushaltungen), 1903 57 (in 12 Haushaltungen).
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde seit der Mitte des 19.
Jahrhunderts eine Synagoge (s.u.) und eine Religionsschule. Die Toten
der Gemeinde wurden auf dem jüdischen Friedhof in Dillingen, nach 1905 auch
auf dem Friedhof in
Saarlouis
beigesetzt. Ob ein rituelles Bad vorhanden war, ist nicht bekannt.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war Ende des 19. Jahrhunderts
zeitweise ein eigener Religionslehrer angestellt, der zugleich als
Vorbeter und Schochet tätig war (vgl. Ausschreibungen der Stelle unten). An
Namen der Lehrer sind bekannt: um 1887 M. Schaiesohn, um 1889 D.N. Zajac (s.u.),
1892 L. Levy (unter ihm 15 Kinder in der Religionsschule der Gemeinde), um 1893 Lehrer Wahremberg,
1894 B. Lyon (unter ihm 13 Kinder in der Religionsschule der Gemeinde). um 1895 bis 1897 A.D. Richard
(unter ihm 1895/96 13 Kinder in der Religionsschule der Gemeinde), 1898 E. Caln
(unter ihm noch elf schulpflichtige jüdische Kinder). 1903 gab es nur noch vier
jüdische schulpflichtige Kinder, die Religionsunterricht erhielten.
Als Gemeindevorsteher werden genannt: 1887/89 H. Hanau, J. Bernhardt oder
Borchardt und M. Hanau II, 1892 H. Hanau, N. Marx und H. Hanau II, 1894 N.
Hanau, M. Hanau II und M. Hanau I., 1895 M. Hanau und B. Hanau, 1905 A. Hanau
und E. Cahn.
Um 1924, als 33
jüdische Gemeindeglieder am Ort gezählt wurden (2,75 % von insgesamt etwa
1.200 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde Bernhard Hanau II, Leo Hanau
und Robert Hanau. Damals wurde der Religionsunterricht der noch fünf
schulpflichtigen jüdischen Kinder durch den jüdischen Lehrer Rudolf Loewy aus
Saarlouis erteilt.
Zur Zeit der Eingliederung der Saar in das Deutsche Reich lebten 1935
noch 24 jüdische Personen in Beaumarais. Die meisten von ihnen sind
in den folgenden Jahren vom Ort verzogen beziehungsweise konnten emigrieren.
Von den in Beaumarais geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Maurice Bernard (1889),
Marx Hanau (1875), Simon Hanau (1878), Caroline
Israel geb. Bernard (1855), Bruno Neumann (1913).
Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1892 und
1893 sowie Lehrerstellegesuch 1897
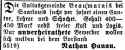 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. September 1892:
"Die Kultusgemeinde Beaumarais bei Saarlouis sucht per sofort einen
Kantor, Lehrer und Schochet. Gehalt 400-450 Mark nebst freier Kost und
Logis. Nur unverheiratete Bewerber wollen sich melden bei dem
Vorstand Nathan Hanau." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. September 1892:
"Die Kultusgemeinde Beaumarais bei Saarlouis sucht per sofort einen
Kantor, Lehrer und Schochet. Gehalt 400-450 Mark nebst freier Kost und
Logis. Nur unverheiratete Bewerber wollen sich melden bei dem
Vorstand Nathan Hanau." |
| |
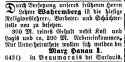 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Oktober 1893:
"Durch Versetzung unseres früheren Herrn Lehrer Wahremberg
ist die hiesige Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle neu zu
besetzen. 300 Mark reines Gehalt nebst Kost und Logis und ca. 200 Mark
Nebeneinkommen. Nur unverheiratete wollen sich melden bei Marx Hanau I.
in Beaumarais bei Saarlouis." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Oktober 1893:
"Durch Versetzung unseres früheren Herrn Lehrer Wahremberg
ist die hiesige Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle neu zu
besetzen. 300 Mark reines Gehalt nebst Kost und Logis und ca. 200 Mark
Nebeneinkommen. Nur unverheiratete wollen sich melden bei Marx Hanau I.
in Beaumarais bei Saarlouis." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Januar 1897:
"Lehrerstellegesuch. Suche zu Purim anderweitige Stellung.
A.D. Richard, Religionslehrer und Kantor (nicht Schochet). Beaumarais
bei Saarlouis." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Januar 1897:
"Lehrerstellegesuch. Suche zu Purim anderweitige Stellung.
A.D. Richard, Religionslehrer und Kantor (nicht Schochet). Beaumarais
bei Saarlouis." |
Aufruf zur Unterstützung des in Beaumarais vorübergehend tätigen Lehrer D. M.
Zajac (1889)
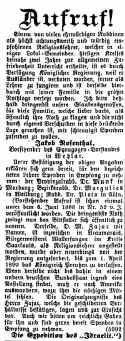 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. November 1889:
"Aufruf! Einem von vielen ehrwürdigen Rabbinen als höchst
achtungswert und würdig empfohlenen Religionslehrer, welcher in einigen
Lokal-Gemeinden hiesigen Kreises beinahe zwei Jahre zur allgemeinen
Zufriedenheit Unterricht erteilte, ist es durch Verfügung Königlicher
Regierung, weil er Ausländer ist, verboten worden, ferner als Lehrer zu
fungieren und ist derselbe hierdurch mit seiner Familie in die größte
Notlage versetzt worden. ich bitte deshalb dringendst unsere
Glaubensgenossen, für diese Familie, welche lieber darbt, als öffentlich
ihre Not zu klagen und die nicht durch eigenes Verschulden in diese
drückende Lage geraten ist, mir schleunigst Spenden zusenden zu
wollen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. November 1889:
"Aufruf! Einem von vielen ehrwürdigen Rabbinen als höchst
achtungswert und würdig empfohlenen Religionslehrer, welcher in einigen
Lokal-Gemeinden hiesigen Kreises beinahe zwei Jahre zur allgemeinen
Zufriedenheit Unterricht erteilte, ist es durch Verfügung Königlicher
Regierung, weil er Ausländer ist, verboten worden, ferner als Lehrer zu
fungieren und ist derselbe hierdurch mit seiner Familie in die größte
Notlage versetzt worden. ich bitte deshalb dringendst unsere
Glaubensgenossen, für diese Familie, welche lieber darbt, als öffentlich
ihre Not zu klagen und die nicht durch eigenes Verschulden in diese
drückende Lage geraten ist, mir schleunigst Spenden zusenden zu
wollen.
Jakob Rosenthal, Vorsitzender des Synagogen-Vorstandes in
Wetzlar.
Unter Bestätigung der obigen Angaben erklären sich gern bereit, für den
bezeichneten Lehrer Spenden in Empfang zu nehmen: der Provinzialrabbiner
Dr. Munk in Marburg; Bezirksrabbiner Dr. Margulies in Weilburg; Rabbiner
Dr. Plato in Köln.
(Vorstehender Aufruf ist schon einmal unter dem 6. Juni 1888 in nr. 52
vorigen Jahres veröffentlicht worden. Die dringendste Not zwingt nun den
Bittsteller sich öffentlich zu nennen. Derselbe, D.M. Zajac mit
Namen, inzwischen in Beaumarais, Bürgermeisterei Wallerfangen im
Kreise Saarlouis, als Religionslehrer angestellt worden, wurde aber
neuerdings von der Regierung aufgefordert, bis zum 1. April 1890 das
Königreich Preußen zu verlassen. Wenn derselbe nicht bis dahin in einem
anderen deutschen Bundesstaat irgendeine Anstellung findet, muss er nach
Amerika auswandern, wozu ihm die nötigen Mittel fehlen. Die
Originalzeugnisse des Herrn Zajac, welche die geschilderten Verhältnisse
bestätigen, lagen uns zur Einsicht vor. Auch wir bitten um reichliche
Gaben für ihn und sind gerne bereit, Spenden in Empfang zu nehmen. Die
Expedition des 'Israelit'." |
Dokument zu dem jüdischen Lehrer D. Laieg (= D.M. Zajac?) (1890)
(Quelle: Postgeschichtliche Heimatsammlung Wallerfangen R.
Frantz)
 Briefumschlag
mit Adresse: "Herrn D. Laieg. Israhelitscher Lehrer in Beaumaris
bei Walerfangen bei Saarlouis". Briefumschlag
mit Adresse: "Herrn D. Laieg. Israhelitscher Lehrer in Beaumaris
bei Walerfangen bei Saarlouis".
Der Brief wurde am 18. März 1890 in Metz nach Beaumarais geschickt. Der
Wallerfanger Eingangsstempel vom 19. März 1890 auf der Briefrückseite
(nicht abgebildet) belegt dies.
Nähere Informationen zu diesem Lehrer liegen leider nicht vor. Über
Hinweise ist der Webmaster dankbar - Mailadresse siehe Eingangsseite.
Möglicherweise handelt es sich um eine völlige Verschreibung des
Namens des Lehrers D.M. Zajac (vgl. Aufruf oben), der bis 1. April
1890 das Königreich Preußen verlassen sollte. |
Zur Geschichte der Synagoge
Nach einem Bericht von 1817 besuchten die in
Beaumarais lebenden Juden die Synagoge in Wallerfangen, was
offenbar nicht unproblematisch
war, da es in diesem Jahr zu einem Streit zwischen den in Beaumarais und
Wallerfangen lebenden Juden kam. Vermutlich wollten die jüdischen Familien in
Beaumarais sich damals schon von Wallerfangen lösen und einen eigenen Betsaal
haben. Dazu kam es jedoch erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Zwischen 1844 und
1850 konnte an der Muhlenstraße eine Synagoge erstellt werden. Zwar war
Beaumarais damals immer noch Filiale zur Gemeinde in Wallerfangen, allerdings
war dort auf Grund der gestiegenen Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder nicht
mehr ausreichend Platz in der dortigen Synagoge.
Bei der in Beaumarais erbauten Synagoge handelte es sich um einen einfachen
Längssaalbau mit Satteldach. Straßenseitig hatte er drei hohe
Rundbogenfenster, an der südöstlichen Giebelwand ein Rundfenster.
1891 wollte die Gemeinde einen Neubau erstellen, doch wurde eine Bitte um
finanzielle Unterstützung durch das Innenministerium abgelehnt, wodurch ein
Neubau nicht möglich war. Es blieb bei der bisherigen Synagoge, die durch die seit Anfang des 20. Jahrhunderts zurückgehende Zahl von Gemeindeglieder
ausreichte und vermutlich bereits 1936 aufgegeben wurde. Beim Novemberpogrom
1938 kam es offenbar dadurch zu keinen Aktionen gegen das Gebäude.
Die ehemalige Synagoge blieb nach 1945 zunächst lange leerstehend, bis
1962 ein Lagerhaus eingerichtet wurde. 1967 ist das Gebäude bis auf die Höhe
der Fensterbänke abgebrochen wurden, wurde aufgestockt und zu einem Wohnhaus
umgebaut.
Standort der Synagoge: In der
Muhl 3
Fotos
/ Darstellungen:
(Quelle: Fotos von Hans Nicola, erhalten von Thomas
Laurent / Vermittlung durch Günter Zenner, Haifa)
| Historische Aufnahmen
der Synagoge |
|
|
 |
 |
 |
| Aufnahmen der
Synagoge in der Muldenstraße (Foto Mitte mit Hakenkreuzfahne; Foto rechts
Ausschnittvergrößerung des Fotos in der Mitte) |
| |
|
|
Historische Aufnahmen
im
Ort |
 |
 |
|
Rechts: die jüdische
Metzgerei
in der Hauptstraße (1937) |
Links (angekreuzt): ehemaliges
jüdisches Wohnhaus (Foto von 1939) |
| |
|
|
Bauakte von 1962 bei
Einrichtung eines
Lagerhauses in der ehemaligen Synagoge |
 |
|
| |
|
|
| |
|
|
Das Gebäude der
ehemaligen Synagoge in der Gegenwart
(Foto von Jürgen Baus, Saarlouis;
Aufnahme vom August 2013) |
 |
|
| |
|
|
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| Februar
2013: Gedenktafeln für Synagoge und
Opfer der NS-Zeit werden angebracht |
Artikel vom 22. Februar 2013 von
Sascha Schmidt - aus der Website der Stadt Saarlouis (Link
zum Artikel): "Ein Ort des Erinnerns: Synagogen-Gedenktafel in Beaumarais enthüllt.
'Acht in Beaumarais geborene Mitbürger wurden in Ausschwitz ermordet', sagte Walter Löffler bei seinem Rückblick auf die Geschichte der Juden im Ortsteil. An sie und die örtliche Synagoge erinnern nun zwei Gedenktafeln auf dem Friedhof in Beaumarais.
In einer gemeinsamen Gedenkfeier vom Verein für Mundart und Geschichte (VMuG) und der Stadt Saarlouis enthüllten Oberbürgermeister Roland Henz, Bürgermeister Klaus Pecina und Beigeordneter Manfred Heyer gemeinsam mit Heinrich und Peter Pütz vom VMuG die Tafeln im Innenbereich der Friedhofsmauer.
Die Vergangenheit vor Augen halten. 'Es ist geschehen und folglich kann es wieder
geschehen', zitierte Henz die Inschrift am Holocaust-Mahnmal in Berlin.
'Das wollen wir verhindern. Deshalb müssen wir uns die Vergangenheit immer wieder vor Augen
halten.' Den Anwesenden dankte er, 'dass sie die Chance des Erinnerns nutzen, denn es ist wichtig, die Erinnerung weiterzutragen. Es ist gut, dass es uns und viele weitere gibt, die sagen: Nie
wieder!'
Die Gedenktafel aus Sandstein zeigt ein Relief der ehemaligen Synagoge, die 1850 in Beaumarais erbaut wurde. Nachdem die jüdischen Bewohner 1936 aus dem Ort flüchteten, stand die Synagoge leer.
'Bei der Reichspogromnacht wurde sie nicht zerstört, weil die Nazis fürchteten, dass die Nachbarhäuser mit abbrennen würden', erklärte Löffler, Vorsitzender des VMuG. 1962 wurde das Gebäude in ein Wohnhaus umgebaut. Daneben erinnert eine Bronzetafel an die Verfolgten und Ermordeten Beaumaraiser Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland.
Den Opfern ihre Namen zurückgeben. 'Die Ermordeten und Geschundenen haben ihre Namen zurückbekommen an diesem Ort der Erinnerung – sie sind keine Nummern
mehr', sagte Erika Hügel von der Synagogengemeinde Saar. 'Ein Gedenken wie dieses verhindert, dass das überwundene Terrorregime als wünschenswertes Regierungssystem angepriesen werden
kann.'
Neben der gesamten Verwaltungsspitze kamen Vertreter der Stadtratsfraktionen, der Verwaltung und von benachbarten Heimatvereinen zur Enthüllung der Gedenktafeln. Auch OB
Henz' Amtsvorgänger Hans-Joachim Fontaine und Landrat a.D Dr. Peter Winter waren unter den Gästen ebenso wie Hildegard König-Grewenig, Initiatorin der Synagogengedenkstätte in Saarlouis und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes.
Der Entwurf der Synagogen-Gedenktafel stammt vom Beaumaraiser Steinmetz Stefan Zenner. Die Herstellungskosten übernahm die Stadt Saarlouis." |
| |
| Fotos von der Veranstaltung (Quelle:
Kreisstadt Saarlouis; die von Sascha Schmidt erstellten Fotos wurden
freundlicherweise von der Pressestelle der Stadt Saarlouis zur
Veröffentlichung gestellt) |
 |
 |
 |
 |
Auf Foto links: Beigeordneter Manfred
Heyer, Oberbürgermeister Roland Henz,
Heinrich Pütz vom Verein für Mundart und Geschichte und Bürgermeister
Klaus Pecina (von links) bei der Enthüllung der Gedenktafeln. |
Die Gedenktafel für
die Synagoge
|
Gedenktafel für die aus
Beaumarais
stammenden jüdischen Opfer
der NS-Zeit |
| |
| April
2018: Die neue Dorfchronik von
Beaumarais enthält auch neue Informationen zur jüdischen Geschichte |
Artikel in der
"Saarbrücker Zeitung" vom 22. April 2018: "Heimatgeschichte.
Neue Dorfchronik über Beaumarais wird offiziell vorgestellt.
Beaumarais. Knapp 40 Jahre nach Dora Diemels Buch über Beaumarais ist zwar ein Weg in Beaumarais nach der Heimathistorikerin benannt, aber keine weitere größere Veröffentlichung über diesen Saarlouiser Stadtteil erschienen. Das ändert sich jetzt. Der Verein für Mundart und Geschichte Beaumarais stellt am Freitag, 27. April, eine neue Dorfchronik vor. Anlass ist das zehnjährige Bestehen des Vereins. Das Buch heißt
'Die Geschichte des Saarlouiser Stadtteils Beaumarais', es hat 284 Seiten und viele Illustrationen.
Chronik ist allerdings nicht ganz das richtige Wort. Es sind Beiträge, die einzelne Bereiche aufgreifen. Themen zu finden, sei nicht schwer gewesen, sagt Volker Felten, der die grafische Gestaltung übernommen hat.
'Es gab direkt eine erste Festlegung, da auf bereits Geschriebenes zurückgegriffen werden
konnte.' Dabei kommt durchaus auch Neues ans Tageslicht. Felten, der für das Buch auch recherchiert und geschrieben hat, greift einige interessante Beispiele heraus:
'In meinem Part zu der Geschichte der Beaumaraiser Juden habe ich bereits Erforschtes überarbeitet, teils korrigiert; über die Synagoge konnte ich einiges Neue erfahren. Ich kenne den Sohn des damaligen Besitzers gut. Was anderes: Im Zweiten Weltkrieg wollte eine Beaumaraiser Witwe die Synagoge von der Stadt als Scheune mieten, was mit Originaldokumenten aus meinem Archiv belegt wird. Einige historische Tradierungsfehler konnten auch in anderen Bereichen korrigiert werden. Jürgen Baus‘ Arbeiten haben hohen wissenschaftlichen Wert. Und der Beitrag über die Stollen von Peter Pütz: Toll, was der Mann da alles rausgefunden
hat.'
Und da sind Feltens Ergebnisse, die er aus seinen Forschungen zum französischen Nachkriegs-Stadtplaner Edouard Menkès herausdestilliert hat: In Beaumarais sollte eine Kaserne gebaut werden.
'Zur Kaserne gibt es eine nette Anekdote, an die sich der Beaumaraiser Heinrich Pütz noch bestens erinnern konnte: Ein Mitglied des Beaumaraiser Ortsrats wollte im Rahmen dieses Bauprojektes offensichtlich das Geschäft seines Lebens machen und kaufte weite Teile des Heed-Areals, die wegen der dortigen Verminung zum Spottpreis zu bekommen waren. Als nun aber am Ende der Menkès-Plan doch nicht realisiert wurde, blieb er zu seinem Pech auf seinen verminten Grundstücken
sitzen.'
Auch die Quellenlage für Bilddokumente in Beaumarais sei ganz gut, sagt Feltes.
'Wir konnten auf das Archiv des Vereins für Mundart und Geschichte zurückgreifen. Dort sind viele Fotos des Beaumaraiser Fotografen Hans Nicola, die von seiner Tochter Gerlinde Laurent zur Verfügung gestellt wurden. Esther Reichmann hat das gesamte Archiv der Beaumaraiser digitalisiert und geordnet.
Das Buch kostet 29,80 Euro. Offizielle Vorstellung ist am Freitag, 27. April, um 19 Uhr, im Dorfhaus Nr. 48 (Hauptstraße 48) in
Beaumarais." |
| Link
zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt
des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies
ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. Mainz 2005. S. 435 (Artikel von Rupert Schreiber; mit weiteren Literaturangaben). |
 | Dora Dimel: Die Geschichte des Stadtteils
Beaumarais. 1979. S. 270-274: Die Juden in Beaumarais. |
 | Hans Peter
Klauck: Jüdisches Leben in der Stadt und im Landkreis Saarlouis 1680
- 1940. 956 S. Saarlouis 2016. ISBN 10: 3933926653 ISBN-13:
978-393396654 Preis: 44 € zuzüglich
Porto und Verpackung.
Bestellungen an: Vereinigung für die
Heimatkunde im Landkreis Saarlouis e.V. Kreisarchiv
Saarlouis Postfach 1840 66718 Saarlouis Tel.:
0-6831-444425 E-Mail
(heimatkunde[et]vfh-saarlouis.de)
Hinweis: Der Autor Hans Peter Klauck arbeitet seit Jahren an einer
Dokumentation aller jüdischen Mitbürger von ihrem ersten Auftreten im
Landkreis und der Stadt bis zur letzten Deportation durch die Nazis am 22.
Oktober 1940. Im Buch werden 12.483 jüdische Bewohner des Landeskreises
dokumentiert mit sehr vielen historischen Fotos und Dokumenten. Die
jüdischen Geschäfte und Gewerbe in den einzelnen Orten des Kreises sind
ausführlich beschrieben. |
 | Ortschronik. "Die Geschichte des Saarlouiser
Stadtteils Beaumarais". 2018. 284 S. viele Ill. |

nächste Synagoge
|