|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht
"Synagogen im Kreis Gießen"
Reiskirchen mit
Burkhardsfelden und Ettingshausen (Kreis Gießen)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Reiskirchen bestand eine jüdische
Gemeinde bis 1938/42. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts
zurück. Um 1700 werden erstmals jüdische Familien am Ort genannt (Familie
Löwenberg).
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1828 24 jüdische Einwohner, 1861 33 (4,7 % von insgesamt 706
Einwohnern),1871 39, 1880 25 (3,7 % von 675), 1900 22 (2,9 % on 768), 1910 40
(4,5 % von 889). Zur jüdischen Gemeinde gehörten auch die in Burkhardsfelden
und Ettingshausen
lebenden jüdischen Personen (in Ettinghausen u.a. Familien Chambre, Hirsch, Korn, Löwenberg;
1924 13 Personen).
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine
Religionsschule und ein rituelles Bad. Die Toten der Gemeinde wurden auf
dem jüdischen Friedhof in Großen Buseck
beigesetzt. Die Gemeinde gehörte zum (liberalen) Provinzialrabbinat Oberhessen
in Gießen.
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Julius Löwenberg
(1917 in Frankreich vermisst). Sein Name steht auf dem Gefallenendenkmal im jüdischen
Friedhof in Großen Buseck.
Die Berufe der jüdischen Haushaltsvorsteher waren: Kaufleute und Händler, u.a.
ein Drogist, zwei Textil- und Manufakturwarenhändler, drei Viehhändler, zwei
Häutehändler (die außerdem noch Nähmaschinen und Polsterwaren verkauften)
und ein Metzger. Die Familien lebten alle in bescheidenen Verhältnissen.
Um 1924, als zur Gemeinde 43 Personen gehörten (Höchstzahl; 4,3 % von
975), waren die Vorsteher L. Stiefel, B. Edelmuth und V. Katz. Abraham Edelmuth
war als Vorbeter in der Synagoge tätig und
Albert Löwenberg als Schächter. Den damals acht
schulpflichtigen jüdischen Kindern erteilte Lehrer Max Goldschmidt aus Nieder-Weisel den Religionsunterricht. 1932 waren die Gemeindevorsteher Levi
Selig (1. Vors.), Simon Sternberg (2. Vors.) und Viktor Katz (s. Vors.).
Weiterhin kam Lehrer Goldschmidt aus Nieder-Weisel zum Unterricht nach
Reiskirchen.
1933 gab es noch 36 jüdische Personen in acht Familien in Reiskirchen
(3,5 % von 1.034 Einwohnern). Nach den Erinnerungen von Katharine Alexander (s.Lit.)
waren es die folgenden Familien: Victor Katz (Viehhändler, Grünbergerstraße
76), Levi Selig (Manufakturwarengeschläft, Burkhardsfelder Str. 24), Berthold
Edelmuth (Viehhändler, Grünbergerstraße 52, später Gartenstraße 11),
Leopold Stiefel (Manufakturwarengeschäft, Grünbergerstraße 46; Bruder
Berthold Stiefel handelte mit Hasenfell und dergleichen; nach der Pogromnacht
1938 wohnten die Familie im Hinterzimmer von Frau Elisabeth Pfeiffer in der
Grünbergerstraße 63), Simon Sternberg (Viehhändler, Grünbergerstraße 25),
Gustav Löwenberg (Manufakturwarengeschäft, Grünbergerstraße 37), Joel
Löwenberg (Schächter der Gemeinde, Oberdorfstraße 24), Emma Löwenberg (Witwe
des im Ersten Weltkrieg gefallenen Julius Löwenberg, Stoffhandel,
Grünbergerstraße 81).
In
den Jahren nach 1933 ist ein Teil der jüdischen Familien auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,
der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Bereits im März 1933 kam
es zu Einschüchterungen der jüdischen Familien durch SA-Leute, die vor
jüdischen Häusern Schreckschüsse abgaben. Drei Personen sind noch in
Reiskirchen verstorben. Emigrieren konnten drei Personen in die USA, vier nach
Südafrika, drei nach Holland. 14 Personen verzogen zwischen 1933 und 1939 in
andere Orte Deutschlands. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge zerstört
(s.u.), jüdische Häuser wurden überfallen und verwüstet. 1939 wurden noch elf jüdische Einwohner gezählt. Die
letzten acht wurden im Februar 1942 aus Reiskirchen deportiert (Berthold
Edelmuth mit Frau und Tochter, Emma und Ilse Löwenberg, Selma Marx sowie
Leopold und Klara Stiefel).
Von den in Reiskirchen geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Karoline Bär geb.
Löwenberg (1873), Berthold Edelmuth (1884), Hedwig Edelmuth geb. Siesel (1892),
Rosa (Rosel) Edelmuth (1925), Henny Hecht geb. Stiefel (1891), Selma Hofmann
geb. Löwenberg (1908), Emma Löwenberg geb. Marx (1880), Gustav Löwenberg
(1885), Ilse (Else) Löwenberg (1909), Paula Löwenberg geb. Katz (1890), Sabine
Löwenberg (1870), Selma Marx (1900), Berthold Stiefel (1886), Klara Mina
Stiefel geb. Adler (1888), Leopold Stiefel (1883), Sannchen Wertheim geb.
Edelmuth (1860).
Aus Ettingshausen sind umgekommen: Albert Chambre (1888), Klara Chembre
(1884), Alfred Hirsch (1923), Julchen Jettchen Korn geb. Katz (1870), Hermann
Löwenberg (1879), Siegmund Löwenberg (1882), Sofie Löwenberg (1887), Pauline
(Paula) Wolff geb. Korn (1912).
Aus Burkhardsfelden sind umgekommen: Klara (Clara) Bauer geb. Stern
(1877), Jettchen Simon geb. Stern (1858), Bettchen Stein geb. Stern (1863),
Sigmon (Siegmund) Stern (1878).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Antisemitische Regungen in Ettingshausen (1891)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Mai 1891: "Die Frau
des Polizeidieners in Ettingshausen, Oberhessen, erteilte eine Reihe
von Jahren den hiesigen Kindern aller Konfessionen Industrieunterricht. In
letzter Zeit gab sie den Kindern antisemitische Rätsel zum Raten auf und
gab auch schließlich die Auflösung zum Besten. Ein Kind israelitischer
Konfession erzählte diese Vorgänge zu Haus seinen Eltern, worauf der
Vater den Sachverhalt an das Kreisamt Gießen berichtete. Kurze Zeit
darauf erschien Herr Kreisrat von Gagern plötzlich zur Überraschung der
Lehrerin in der Schule. Herr von Gagern stellte sie über die Vorgänge
zur Rede, sie aber leugnete, bis die Kinder die Wahrheit sagten und sie
beschämt da stand. Der Prozess war nun ein sehr kurzer, die Schule wurde
geschlossen und die Lehrerin ihres Amtes gänzlich
enthoben." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Mai 1891: "Die Frau
des Polizeidieners in Ettingshausen, Oberhessen, erteilte eine Reihe
von Jahren den hiesigen Kindern aller Konfessionen Industrieunterricht. In
letzter Zeit gab sie den Kindern antisemitische Rätsel zum Raten auf und
gab auch schließlich die Auflösung zum Besten. Ein Kind israelitischer
Konfession erzählte diese Vorgänge zu Haus seinen Eltern, worauf der
Vater den Sachverhalt an das Kreisamt Gießen berichtete. Kurze Zeit
darauf erschien Herr Kreisrat von Gagern plötzlich zur Überraschung der
Lehrerin in der Schule. Herr von Gagern stellte sie über die Vorgänge
zur Rede, sie aber leugnete, bis die Kinder die Wahrheit sagten und sie
beschämt da stand. Der Prozess war nun ein sehr kurzer, die Schule wurde
geschlossen und die Lehrerin ihres Amtes gänzlich
enthoben." |
| Kennkarte
aus der NS-Zeit |
| |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |
| |
Kennkarte
des in Ettingshausen
geborenen Moritz Löwenberg |
 |
|
| |
Kennkarte (ausgestellt in
Mainz 1939) für Moritz Löwenberg
(geb. 4. Februar 1878 in Ettingshausen), Weinhändler. |
|
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war vermutlich ein Betsaal vorhanden. Um 1886
konnte eine Synagoge erbaut und eingeweiht werden.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde am 10.
November um die Mittagszeit die Synagoge
durch Mitglieder der SA völlig niedergebrannt.
Auf dem Grundstück der ehemaligen Synagoge wurde ein Parkplatz angelegt.
Adresse/Standort der Synagoge: Schulgasse
9
Fotos
Fotos der
ehemaligen Synagoge sind noch nicht vorhanden;
über Hinweise oder
Zusendungen freut sich der Webmaster der "Alemannia Judaica";
Adresse siehe Eingangsseite. |
|
| |
|
|
Die Toten der jüdischen
Gemeinde
Reiskirchen wurden in
Friedhof
in Großen Buseck beigesetzt |
 |
|
| |
Der hohe Grabstein für Samuel
Löwenberg
aus Reiskirchen (1844-1933) |
|
| |
|
|
Links und Literatur
Links:
Quellen:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. II S. 219-220. |
 | Keine Artikel bei Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 und dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel. 1995 S.
47-48. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 304-305. |
 | Gustav Ernst Köhler: Die Judengemeinde von
Reiskirchen. Schriftenreihe der Heimatgeschichtlichen Vereinigung
Reiskirchen e.V. Nr. 22. |
 | Katharine Alexander: Judenfamilien von Reiskirchen.
In: Heimatbrief (Hg. vom der Heimatgeschichtlichen Vereinigung Reiskirchen e.V.) Nr. 2 - 2008.
S. 3-6. Online lesbar (pdf-Datei). |
 | |
 |
 |
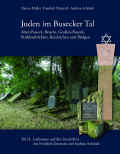 |
Hanno Müller, Friedrich Damrath,
Andreas Schmidt:
Juden im Busecker Tal.
Alten-Buseck, Beuern, Großen-Buseck, Burkhardsfelden, Reiskirchen und
Rödgen.
Teil I: Hanno Müller: Familien
Teil II: Friedrich Damrath, Andreas Schmidt:
Grabsteine und ihre Inschriften.
Insgesamt 525 S., 557 Abbildungen. Beide Bände
zusammen € 15,00.
Erhältlich: Kauflädchen, Kaiserstraße 14 in
Großen-Buseck und in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Buseck im
Schloss, beim Heimatkundlichen Arbeitskreis
Buseck e.V. und bei Hanno Müller
(Tel. 06404/5768; E-Mail:
hanno.mueller[et]fambu-oberhessen.de). |
Zur Buchvorstellung siehe
Pressebericht:
Artikel in der "Gießener Allgemeinen" vom 26. September
2013: "250 Jahre jüdisches Leben im Busecker Tal
dokumentiert..."
Link
zum Artikel |
|
 |
 Hanno
Müller: Fotos Gießener Juden. Hanno
Müller: Fotos Gießener Juden.
Hrsg. vom Magistrat der Universitätsstadt Gießen, Stadtarchiv Gießen. ISBN:
978-3-930489-67-1. 252 S. Gießen 2019.
Zu beziehen über: Stadtarchiv Gießen. Berliner Platz 1 Postfach 110820
D-35390 Gießen Website
mit Kontaktformular E-Mail.
Kontakt zum Autor:
hanno.mueller@fambu-oberhessen.de. |
Hinweis auf familiengeschichtliches Werk
Nathan M. Reiss
Some Jewish Families
of Hesse and Galicia
Second edition 2005
http://mysite.verizon.net/vzeskyb6/ |
 |
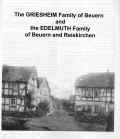 |
| |
In diesem Werk
eine Darstellung zur Geschichte der jüdischen Familie Griesheim von
Beuern und der Familie Edelmuth von Beuern
und Reiskirchen ("The GRIESHEIM Family of Neuern and the
EDELMUTH Family of Beuern and Reiskirchen", S. 187-232) (
Nachkommen bis ca. 2000) mit zahlreichen Abbildungen
u.a.m. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Reiskirchen
Hesse. Numbering 42 (4 % of the total) at its height in 1925, the community lost
its synagogue in Kristallnacht (9-10 November 1938) and dwindled to 12 by 1939.
The last nine Jews were deported in 1942.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|