|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
Zurück zur Seite über die Synagoge der
Israelitischen Cultusgemeinde
Zurück zur Seite über die Synagoge der
orthodoxen Israelitischen Religionsgesellschaft
Zürich (Schweiz)
Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte der Stadt
in den ersten Jahrzehnten des Bestehens der Gemeinde(n)
von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1930er-Jahre
Hier: Aus der Geschichte der
Rabbiner und Lehrer der Israelitischen Kultusgemeinde Zürich (ICZ)
Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit
Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Zürich wurden in jüdischen Periodika
gefunden.
Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt. Neueste Einstellung am
29.5.2014.
Übersicht:
Aus der Geschichte der Rabbiner in Zürich
Übersicht - Rabbiner in Zürich waren
In der Israelitischen Cultusgemeinde:
- 1868 - 1874: Rabbiner Dr. Moritz Lewin (geb. 1843 in Wągrowiec
Provinz Posen, gest. 1914 in Berlin): studierte in Berlin; 1868 - 1874 Rabbiner
in Zürich; 1874 erster Rabbiner der neugegründeten jüdischen Gemeinde in
Nürnberg; 1884 Prediger und Religionslehrer der Jüdischen Reformgemeinde in
Berlin.
- 1877 - 1881: Rabbiner Dr. Alexander Kisch (geb. 1848 in Prag,
gest. 1917 in Prag): studierte am jüdisch-theologischen Seminar in Breslau und
an der Universität in Breslau; 1874 Rabbiner in Brüx/Böhmen; 1877 Rabbiner in
Zürich; 1881 bis 1887 Rabbiner in Jungbunzlau/Böhmen, 1886 Rabbiner der
Maisel-Synagoge in Prag.
- 1882 - 1893: Rabbiner Dr. Emil Elias (Elisaeus) Landau (geb. 1842
in Klasno-Wielitzka, Galizien, gest. 1924 in Weilburg):
studierte in Berlin, seit 1884 an der Universität Zurück (Promotion 1887),
1882 bis 1892 Schulrektor und Rabbiner in Zürich, 1893 bis 1924 an Stadt- und
Bezirksrabbiner in Weilburg an der Lahn.
- 1893 - 1936: Rabbiner Dr. Martin Littmann (geb. 1864 in
Bischofswerder (Biskupiec), Westpreußen, gest. 1946 in Zürich): studierte in
Königsberg und Breslau; 1887 Rabbiner und Religionslehrer in Elbing (Elbląg);
1893 bis 1936 Rabbiner in Zürich, 1937 Ruhestand.
- 1936 - 1964: Rabbiner Dr. Zwi Taubes (bzw. Hayim Tsevi Taubes)
(geb. 1900 in Czarnelica/Galizien, heute Polen, gest. 1966 in Jerusalem),
studierte an der Wiener Israelitisch-Theologischen Lehranstalt (ITLA) und an der
Universität in Wien (Promotion 1926); zunächst Religionslehrer in Baden bei
Wien, dann Rabbiner in Oderberg (heute Bohumín in Tschechien), seit 1930
Rabbiner des Pazmanitentempels in Wien und seit 1931 Lehrer am Wiener Beth
Hamidrasch sowie ab 1933 am Hebräischen Pädagogium, Gründer eines
"Institutes für Talmud und jüdische Wissenschaften für Studenten aus
Osteuropa; seit 1936 Oberrabbiner in Zürich; Leiter der Misrachi-Bewegung in
der Schweiz, 1964 pensioniert und nach Jerusalem ausgewandert.
- 1960 - 1980: Rabbiner Dr. Jakob Teichman (geb. 1915 in
Tallya, Ungarn, gest. 2001 in Zürich und im Israelitischen Friedhof Oberer
Friesenberg beigesetzt), studierte am Rabbinerseminar in Budapest und an der
Universität von Budapest (Promotion 1940), Gemeinde- und Jugendrabbiner sowie
Religionslehrer in Budapest; auf Grund eines Schutzpasses der Schweiz konnte er
1944/45 in Budapest im Schweizer Konsulat überleben; 1950 bis 1956
Gemeinderabbiner in Ujpest (Stadtteil von Budapest), 1956 über Wien nach Israel
ausgewandert; in Jerusalem und Tel Aviv an verschiedenen Stellen tätig
(Universitätslehrer, Bibliothekswissenschaftler, Bibliothekar), 1959 nach
Zürich berufen, zunächst zusammen mit Oberrabbiner Dr. Taubes tätig, seit
1965 allein, seit 1967 gemeinsam mit Rabbiner Dr. Jacob Posen in Zürich tätig,
ab 1980 Rabbiner Emeritus, 1987 Rücktritt von seinem Amt, noch jahrelang als
"Surbtaler Rabbiner" im Altersheim Lengnau tätig.
- 1967 - 1981: Rabbiner Dr. Jacob Posen (geb. 1909 in
Frankfurt am Main, gest. 1995 in London), studierte zunächst Jura in Frankfurt,
1933 bis 1938 Rabbinerausbildung am Rabbinerseminar in Berlin, 1939 nach England
emigriert; 1941 bis 1945 Rabbiner an der Hemel-Hampstead-Synagoge in London,
1945 bis 1950 an der Upton-Park-Synagoge, 1950 bis 1967 Rabbiner in Nottingham;
von 1967 bis 1981 gemeinsam mit Rabbiner Dr. Jakob Teichman Rabbiner in
Zürich.
- 1981 - 1992: Rabbiner Mordechai Piron (geb. 1921 in Wien,
gest. 2014 in Jerusalem, Artikel
vom 28.5.2014 in der "Jüdischen Allgemeinen"),
aufgewachsen in der Leopoldstadt, 1938 mit der Jugend-Aliyah nach Palästina
ausgewandert; studierte an Rabbi Kook-Zentrum in Jerusalem sowie an der
Hebräischen Universität und an einer Hochschule in London, 1952 zum Rabbiner
ordiniert; tätig als Rabbiner in der israelitischen Armee; von 1969 bis 1980 in
der Nachfolge von Rabbi Schlomo Goren Oberrabbiner der israelischen Armee im
Rang eines Generalmajors; 1980 pensioniert; von 1981 bis 1992 Oberrabbiner in
Zürich; 2013 erschien in Jerusalem eine Festschrift zu seinem 90. Geburtstag (Artikel
vom 20.2.2014 in der "Jüdischen Allgemeinen").
- 1987 - 1990: Rabbiner David Bollag (geb. 1958 in Basel),
studierte in Jerusalem, Basel und New York (Yeshiva-University) Judaistik und
Philosophie, zugleich Ausbildung zum Rabbiner; 1987 bis 1990 Rabbiner in Zürich,
1991 nach Israel ausgewandert (Promotion 2005 an der Hebräischen Universität
in Jerusalem), 1992 bis 1994 Gastrabbiner in Köln, 1994 bis 1999 Rabbiner in
Köln und Dozent am Martin Buber-Institut für Judaistik, 1999 bis 2008 Dozent
an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg, seit 2008 Rabbiner der
Gemeinde "Semer haSajit" in einem Vorort von Jerusalem; tätig als
Lehrbeauftragter der Theologischen Fakultät der Universität Zürich und an
anderen Hochschulen und Universitäten.
- 1991 - 2007: Rabbiner Zalman Kossowsky (geb. 1940 in
Teheran); wuchs in Johannesburg, Südafrika auf, seit 1956 in Israel, wo er sich
zum Rabbiner ausbilden ließ; seit 1962 in den USA an verschiedenen Stellen
tätig, danach Tätigkeiten in Johannesburg, Südafrika und in London (Beschreibung
der einzelnen Stationen in der Website rabbis.org); 1991 bis 2008 Gemeinderabbiner
in Zürich, 2007 in die USA zurückgekehrt.
- seit 2006: Rabbiner Marcel Yair Ebel, Ausbildung zum
Rabbiner in den USA mit Zusatzausbildung zum Gemeinderabbiner, seit 1992 für
die Israelitische Cultusgemeinde Zürich in verschiedenen Funktionen tätig,
seit 2006 als Gemeinderabbiner.
- 2011 bis 2012: Rabbiner Michael Goldberger (geb. 1961 in
Basel, gest. 2012 in Zürich, beigesetzt in Israel), Ausbildung zum Rabbiner und
Diplom-Psychologen in Israel und den USA, war ab 1988 als Jugendleiter (Madrich)
in Basel und von 1993 bis 2003 als Gemeinderabbiner der jüdischen Gemeinde
Düsseldorf tätig, von 2001 bis 2012 Rektor der jüdischen Schule Noam in
Zürich, 2011 bis 2012 als Assistenzrabbiner in der Israelitischen
Cultusgemeinde in Zürich; Artikel
in Jewiki.
- seit 2013: Rabbiner Jehoschua (Joshua, Josh) Ahrens: Assistenzrabbiner
in der Israelitischen Cultusgemeinde in Zürich.
In der Israelitischen Religionsgesellschaft:
Siehe Seite
zur Israelitischen Religionsgesellschaft Zürich (IRGZ)
In der ostjüdischen Gemeinde:
- 1935 - 1976: Rabbiner Markus (Mordechai Jakob) Bereisch (geb. 1895 in Sokal' in
Galizien, gest. 1976): 1929 bis 1933 Rabbiner / Dajan des ostjüdischen
Gemeindevereins Machsike Hadas und Leiter einer Talmud-Tora-Schule in Duisburg;
nach Misshandlungen auf offener Straße im Mai 1933 Emigration über Belgien
nach Zürich, wo er seit Mai 1935 für über 40 Jahre als Rabbiner der
ostjüdischen Gemeinde wirkte.
- Rabbiner Schaul Bereisch
- Ergänzungen bitte an den Webmaster der "Alemannia Judaica"; Adresse
siehe Eingangsseite
In der liberalen Gemeinde Or
Chadasch:
- 1981 bis 1982 war erster Rabbiner Dr. Werner van der Zyl
(geb. 1902 in Schwerte, gest. 1984 auf Mallorca, beigesetzt in London):
studierte bis 1933 in Berlin, danach Prediger und Religionslehrer in
Berlin-Weisensee, 1935 bis 1938 Rabbiner an der Neuen Synagoge Berlin; 1938 nach
England emigriert, dort Rabbiner im Durchgangslager Richborough; 1943 bis 1958
Rabbiner der North Western Reform Synagogue in London; 1958 bis 1968 Senior
Rabbi der West London Synagogue; zog nach der Pensionierung 1968 mit seiner Frau
nach Mallorca, wo er Gründer und ehrenhalber Rabbiner der jüdischen Gemeinde
auf Mallorca wurde; 1981 bis 1982 erster Rabbiner der liberalen Gemeinde Or
Chadasch in Zürich.
- Ergänzungen bitte an den Webmaster der "Alemannia
Judaica"; Adresse siehe Eingangsseite
Texte
zur Geschichte der Rabbiner von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die
1930er-Jahre
Rabbiner Dr. Moritz Levin (Zürich) wurde zum Rabbiner in Nürnberg gewählt
(1872)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 5. Juni 1872: "Fürth, den 29. Mai (1872). Bei der
gestrigen in Nürnberg vorgenommenen Rabbinatswahl wurde von den
Gemeinde-Repräsentanten Herr Dr. Levin, derzeit Rabbiner in Zürich,
mit 11 gegen 7 Stimmen gewählt; letztere fielen auf Herrn Dr. Stein in
Frankfurt. Die Wahl entspricht dem Wunsche des größten Teils der
Gemeinde. Hoffen wir, dass Herr Dr. Levin die in seinem neuen
Wirkungskreise sich findenden Schäden nur nicht weiter um sich greifen
lasse! Alsdann wird sicher eine Wendung zum Bessern eintreten und das Wort
unserer Weisen 'delo mosif jasif' ('wer nicht vermehrt wird
verschwinden') in gutem Sinne anzuwenden sein..." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 5. Juni 1872: "Fürth, den 29. Mai (1872). Bei der
gestrigen in Nürnberg vorgenommenen Rabbinatswahl wurde von den
Gemeinde-Repräsentanten Herr Dr. Levin, derzeit Rabbiner in Zürich,
mit 11 gegen 7 Stimmen gewählt; letztere fielen auf Herrn Dr. Stein in
Frankfurt. Die Wahl entspricht dem Wunsche des größten Teils der
Gemeinde. Hoffen wir, dass Herr Dr. Levin die in seinem neuen
Wirkungskreise sich findenden Schäden nur nicht weiter um sich greifen
lasse! Alsdann wird sicher eine Wendung zum Bessern eintreten und das Wort
unserer Weisen 'delo mosif jasif' ('wer nicht vermehrt wird
verschwinden') in gutem Sinne anzuwenden sein..." |
Ausschreibung der Rabbinerstelle (1876)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 25. Oktober 1876 (untere Anzeige): Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 25. Oktober 1876 (untere Anzeige):
"Die israelitische Gemeinde Zürich (Schweiz)
beabsichtigt auf dem 1. Mai 1877 einen Rabbiner oder Prediger, welcher
auch der Schuljugend Religionsunterricht zu beurteilen hat, gegen
angemessenes Salair zu engagieren.
Reflektanten belieben ihre Befähigungszeugnisse an den Präsidenten der
Gemeinde, Herrn Gd. Nordmann, beförderlichst einzusenden.
Zürich, im im Oktober 1876. Im Namen des Vorstandes M. Dreifus."
|
Rabbiner
Dr. Alexander Kisch hat sein Amt angetreten (1877)
Anmerkung: Zu Rabbiner Alexander Kisch siehe auch Wikipedia-Artikel
Alexander Kisch
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 7. August 1877: "In Zürich hat Herr Rabbiner
Dr. Kisch sein Amt bereits angetreten und soll seine Antrittspredigt sich
eines allgemeinen Beifalls zu erfreuen gehabt haben. Möge es ihm
gelingen, beide Parteien einander zu nähern und zu einem einheitlichen
harmonischen Zusammenwirken zu bewegen behufs innerer Konsolidierung und
Erstarkung der Gemeinde um ihnen eine Zukunft und Hoffnung zu geben
(Jeremia 29,11)" Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 7. August 1877: "In Zürich hat Herr Rabbiner
Dr. Kisch sein Amt bereits angetreten und soll seine Antrittspredigt sich
eines allgemeinen Beifalls zu erfreuen gehabt haben. Möge es ihm
gelingen, beide Parteien einander zu nähern und zu einem einheitlichen
harmonischen Zusammenwirken zu bewegen behufs innerer Konsolidierung und
Erstarkung der Gemeinde um ihnen eine Zukunft und Hoffnung zu geben
(Jeremia 29,11)" |
Rabbiner
Dr. Elias Landau (Zürich) wurde zum Rabbiner in Weilburg gewählt (1893)
 Mitteilung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Januar 1893: "Weilburg.
Herr Dr. E. Landau aus Zürich wurde zum Stadt- und Bezirks-Rabbiner
dahier (Weilburg) erwählt." Mitteilung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Januar 1893: "Weilburg.
Herr Dr. E. Landau aus Zürich wurde zum Stadt- und Bezirks-Rabbiner
dahier (Weilburg) erwählt." |
Ausschreibung der Rabbinerstelle der Israelitischen
Cultusgemeinde (1893)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 12. Mai 1892: "Rabbiner-Stelle. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 12. Mai 1892: "Rabbiner-Stelle.
In der Cultusgemeinde Zürich ist auf 1. Januar 1893 die
Stelle eines Rabbiners zu besetzen, welcher gleichzeitig Religions-Unterricht
zu erteilen hat. Gehalt Fr. 5000.
Bewerber wollen sich mit Einsendung von Zeugnis-Abschriften, welche nicht returniert
werden, an den Unterzeichneten wenden.
Zürich, den 6. Mai 1892. Leopold Bollag-Meyer, Präsident der
israelitischen Cultusgemeinde Zürich." |
Rabbiner Dr.
Martin Littmann aus Elbing tritt
seine Stelle
in Zürich an (1893)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. April
1893: "Zürich, 16. April (1893). Am Samstag, den 25. vorigen
Monats hat Herr Rabbiner Dr. Littmann aus Elbing sein Amt hier
angetreten, zu welchem er durch glänzende Wahl berufen worden ist.
Gottlob, dass die rabbinerlose Zeit hiermit vorbei ist! Denn diese hat
manche Erscheinungen zutage gefördert, welche denjenigen, welcher die
jüdische Religion nach ihrem göttlichen Geiste aufzufassen und zu
erhalten bestrebt ist, betrüben mussten. Der Eine suchte seinen 'frommen'
Sinn durch einen Sturmlauf gegen das Harmoniumspiel in der Synagoge zu
zeigen. Andere, welche seinerzeit mit Freuden die Gründung des gemischten
Synagogenchores begrüßt und in dessen Vereinigung 'Liedertafel' in
begeisterter Würdigung des Verdienstes den (aktiven) Damen die gleichen
Rechte wie den männlichen Mitgliedern statuarisch zuerkannt hatten,
fanden auf einmal, in dem reichen Schatze ihres religiösen Wissens aus
ihrer idyllischen Dorfjugendzeit stöbernd, den vergessenen Ausspruch des
frommen Leibele seligen Andenkens wieder: 'es sei unjüdisch, dass
Männer und Weibsleut' in der Schul' zusammen singen.' Sie legten demgemäss
der Gemeindeversammlung das Initiativbegehren vor: Die Mitwirkung des
weiblichen Geschlechtes (nicht auch des Harmoniums) beim - übrigens im
Ganzen noch altmodischen - Gottesdienste aufzuheben. Wills Gott, ist die
auf Herrn Dr. Littmann gefallene Wahl eine glückliche für unsere des
Friedens dringend bedürftige Gemeinde und eine segensreiche für die
ganze schweizerische, durch die Schächtfrage bedrängte Judenheit!
- Dem Beispiele anderer Hochschulen folgend, bildete sich auch hier ein Verein
der jüdischen Studierenden, der sich zum Ziel gesetzt hat, den
geselligen Verkehr der jüdischen Studierenden; Erleichterung in der
Ausbildung der Mitglieder in allen Zweigen der Wissenschaft mit besonderer
Berücksichtigung der jüdischen Geschichte und Literatur, sowie der
sozialen Lage der Juden in allen Ländern; Erteilung materieller Hilfe den
sich in Not befindenden Kameraden. Es ist viel, was der junge Verein alles
will. Wir wünschen es von Herzen, dass derselbe die sich gesteckte
Aufgabe erfüllt. Vielleicht wäre es nicht unzweckmäßig, aus nicht
studentischen gebildeten jüdischen Kreisen 'außerordentliche' Mitglieder
aufzunehmen. Einerseits wäre diesen eine anregende Gelegenheit zu ihrer Weiterbildung
gegeben, andererseits böte sich so dem Verein eine finanzielle
Hilfsquelle." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. April
1893: "Zürich, 16. April (1893). Am Samstag, den 25. vorigen
Monats hat Herr Rabbiner Dr. Littmann aus Elbing sein Amt hier
angetreten, zu welchem er durch glänzende Wahl berufen worden ist.
Gottlob, dass die rabbinerlose Zeit hiermit vorbei ist! Denn diese hat
manche Erscheinungen zutage gefördert, welche denjenigen, welcher die
jüdische Religion nach ihrem göttlichen Geiste aufzufassen und zu
erhalten bestrebt ist, betrüben mussten. Der Eine suchte seinen 'frommen'
Sinn durch einen Sturmlauf gegen das Harmoniumspiel in der Synagoge zu
zeigen. Andere, welche seinerzeit mit Freuden die Gründung des gemischten
Synagogenchores begrüßt und in dessen Vereinigung 'Liedertafel' in
begeisterter Würdigung des Verdienstes den (aktiven) Damen die gleichen
Rechte wie den männlichen Mitgliedern statuarisch zuerkannt hatten,
fanden auf einmal, in dem reichen Schatze ihres religiösen Wissens aus
ihrer idyllischen Dorfjugendzeit stöbernd, den vergessenen Ausspruch des
frommen Leibele seligen Andenkens wieder: 'es sei unjüdisch, dass
Männer und Weibsleut' in der Schul' zusammen singen.' Sie legten demgemäss
der Gemeindeversammlung das Initiativbegehren vor: Die Mitwirkung des
weiblichen Geschlechtes (nicht auch des Harmoniums) beim - übrigens im
Ganzen noch altmodischen - Gottesdienste aufzuheben. Wills Gott, ist die
auf Herrn Dr. Littmann gefallene Wahl eine glückliche für unsere des
Friedens dringend bedürftige Gemeinde und eine segensreiche für die
ganze schweizerische, durch die Schächtfrage bedrängte Judenheit!
- Dem Beispiele anderer Hochschulen folgend, bildete sich auch hier ein Verein
der jüdischen Studierenden, der sich zum Ziel gesetzt hat, den
geselligen Verkehr der jüdischen Studierenden; Erleichterung in der
Ausbildung der Mitglieder in allen Zweigen der Wissenschaft mit besonderer
Berücksichtigung der jüdischen Geschichte und Literatur, sowie der
sozialen Lage der Juden in allen Ländern; Erteilung materieller Hilfe den
sich in Not befindenden Kameraden. Es ist viel, was der junge Verein alles
will. Wir wünschen es von Herzen, dass derselbe die sich gesteckte
Aufgabe erfüllt. Vielleicht wäre es nicht unzweckmäßig, aus nicht
studentischen gebildeten jüdischen Kreisen 'außerordentliche' Mitglieder
aufzunehmen. Einerseits wäre diesen eine anregende Gelegenheit zu ihrer Weiterbildung
gegeben, andererseits böte sich so dem Verein eine finanzielle
Hilfsquelle." |
Ausschreibung der II. Rabbinerstelle der ICZ
(1928)
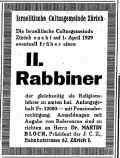 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Dezember
1928:
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Dezember
1928:
"Israelitische Cultusgemeinde Zürich.
Die Israelitische Cultusgemeinde Zürich sucht auf 1. April 1929 eventuell
früher einen
II. Rabbiner,
der gleichzeitig als Religionslehrer zu amten hat. Anfangsgehalt Fr.
12.000.- mit Pensionsberechtigung. Anmeldungen mit Angabe von Referenzen
sind zu richten an Herrn Dr. Martin Bloch, Präsident der
Israelitischen Cultusgemeinde Zürich, Bahnhofstraße 82, Zürich I."
|
Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer und weiterer Kultusbeamten der Gemeinde
Ausschreibungen der Stelle(n) des Religionslehrers / Predigers / Vorbeters / Schochet
1862 / 1863 / 1867 / 1869 / 1876
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. August 1862: "Der
israelitische Cultusverein in Zürich Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. August 1862: "Der
israelitische Cultusverein in Zürich
ist im Falle, die Stelle eines Schächters und Vorbeters mit einem
Gehalt von Frcs. 800 p.a. neu zu besetzen.
Allfällige Bewerber werden ersucht, ihre Zeugnisse bis zum 31. August
dieses Jahres an den Präsidenten der Vereins, Herrn M. Dreifus in
Zürich, franco einzusenden, wobei bemerkt wird, dass demjenigen, der
gleichzeitig befähigt ist, den jüdischen Religionsunterricht zu
erteilen, der Vorzug gegeben wird." |
| |
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. Oktober 1863: "Der israelitische
Kultus-Verein in Zürich ist im Falle, die Stelle eines Schächters
und Vorbeters mit einem Gehalte von Frc. 800 p.a. neu zu besetzen.
Allfällige Bewerber werden ersucht, ihre Zeugnisse bis zum 31. Oktober
dieses Jahres an den Präsidenten des Vereins, Herr Louis Bernays in
Zürich franko einzusenden, wobei bemerkt wird, dass demjenigen, der gleichzeitig
befähigt ist, jüdischen Religionsunterricht zu erteilen, der Vorzug
gegeben wird." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. Oktober 1863: "Der israelitische
Kultus-Verein in Zürich ist im Falle, die Stelle eines Schächters
und Vorbeters mit einem Gehalte von Frc. 800 p.a. neu zu besetzen.
Allfällige Bewerber werden ersucht, ihre Zeugnisse bis zum 31. Oktober
dieses Jahres an den Präsidenten des Vereins, Herr Louis Bernays in
Zürich franko einzusenden, wobei bemerkt wird, dass demjenigen, der gleichzeitig
befähigt ist, jüdischen Religionsunterricht zu erteilen, der Vorzug
gegeben wird." |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 14. August 1867: "Bei dem israelitischen Cultusverein
in Zürich wird auf Ende Dezember a.c. die Stelle eines Religionslehrers,
Kantors und Schochet offen; Bewerber um dieselbe belieben sich
mit Zeugnissen versehen bei dem Präsidenten des Vorstandes
anzumelden." Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 14. August 1867: "Bei dem israelitischen Cultusverein
in Zürich wird auf Ende Dezember a.c. die Stelle eines Religionslehrers,
Kantors und Schochet offen; Bewerber um dieselbe belieben sich
mit Zeugnissen versehen bei dem Präsidenten des Vorstandes
anzumelden." |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 13. Oktober 1869: "Bei dem Israelitischen Cultus-Verein in
Zürich ist die Stelle eines Predigers und Religionslehrers zu besetzen,
dessen Gehalt ca. Frcs. 2500 betragen wird. Akademisch gebildete und
befähigte Bewerber belieben ihre Anmeldungen beförderlichst an den
unterzeichneten Präsidenten des Vorstandes zugehen zu lassen mit
ausführlicher Angabe ihres bisherigen Wirkens. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 13. Oktober 1869: "Bei dem Israelitischen Cultus-Verein in
Zürich ist die Stelle eines Predigers und Religionslehrers zu besetzen,
dessen Gehalt ca. Frcs. 2500 betragen wird. Akademisch gebildete und
befähigte Bewerber belieben ihre Anmeldungen beförderlichst an den
unterzeichneten Präsidenten des Vorstandes zugehen zu lassen mit
ausführlicher Angabe ihres bisherigen Wirkens.
Zürich (Schweiz), 1. Oktober 1869 sig. Jaques Ris." |
| |
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. April 1876:
"In der israelitischen Gemeinde Zürich ist die Stelle eines
Predigers zu besetzen. Bewerber um diese Stelle wollen ihre Anträge mit Kopie
der Zeugnisse über ihre Befähigung an den Präsidenten Herrn David
Bernheim im Laufe dieses Monats einsehen. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. April 1876:
"In der israelitischen Gemeinde Zürich ist die Stelle eines
Predigers zu besetzen. Bewerber um diese Stelle wollen ihre Anträge mit Kopie
der Zeugnisse über ihre Befähigung an den Präsidenten Herrn David
Bernheim im Laufe dieses Monats einsehen.
Zürich, 19. März 1876. Der Vorstand der israelitischen Gemeinde". |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 25. Oktober 1876 (obere Anzeige): Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 25. Oktober 1876 (obere Anzeige):
"Offene Stelle. Die hiesige Kantor- und Schächterstelle,
verbunden mit täglich 2 Stunden Elementar-Unterricht, soll mit dem 1.
Januar 1877 neu besetzt werden, wofür die Gemeinde je nach
Leistungsfähigkeit angemessenes Salair aussetzt.
Bewerber (am liebsten Unverheiratete), welche in diesen Branchen
Tüchtigkeit besitzen und mit angenehmer, wohlklingender Stimme begabt
sind, belieben unter Beifügung ihrer Zeugnisse ihre Anmeldung an den
Präsidenten der Gemeinde, Herrn Gd. Nordmann baldigst
einzusenden.
Zürich, im im Oktober 1876. Im Namen des Vorstandes M. Dreifus." |
Zum Tod von Lehrer Markus G. Dreifus (1877)
Anmerkung: Lehrer Markus G. Dreifus war bis 1870 als Lehrer in Endingen
tätig, danach noch einige Jahre als Religionslehrer in Zürich.
Siehe auch den Wikipedia-Artikel
Markus G. Dreyfus.
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. Juni
1877: "Zürich, 1. Juni (1877). Heute Nachmittag wurde
hier ein Mann zu Grabe getragen, dessen Name auch über die Grenzen der
Schweiz gekannt und mit Achtung genannt wird; es ist dies der Lehrer Markus
G. Dreifus. Das Leben dieses trefflichen Mannes ist mit der
Kultusentwicklung der schweizerischen Israeliten eng verflochten. In Endingen
geboren, wurde er, nachdem er die Talmudschule und das Seminar in
Karlsruhe und auch kurze Zeit die Hochschule in Basel besucht hatte, an
der von der aargauischen Regierung neu organisierten israelitischen
Gemeindeschule seiner Heimatgemeinde als Lehrer angestellt, und wirkte an
derselben mit kurzen Unterbrechungen mit voller Hingebung bis zum Herbste
des Jahres 1870. Einige Jahre war er in der aufblühenden Gemeinde Genf
als Lehrer tätig und kurze Zeit als Redakteur des 'Bote' in Winterthur.
Dreifus war ein eifriger Verfechter der Rechte seiner Glaubensgenossen,
für deren bürgerliche und soziale Hebung er mit Mut und Ausdauer wirkte.
Schon im Jahre 1848 richtete er eine 'ehrerbietige Vorstellung an den
hohen Vorort in Bern' mit dem Gesuche, in der neuen Bundesverfassung
keine, die Emanzipation hindernde Beschränkung aufzunehmen. Sowohl durch
seine Artikel in den verschiedensten Journalen der Schweiz, als durch
seine Schriften 'Zur Würdigung des Judentums unter seinen
Nichtbekennern', 'Die bürgerliche Gleichstellung der Juden im Aargau'
u.a. hat er die Emanzipation der schweizerischen Juden mit zu fördern
gesucht. Dass einem Manne, wie Dreifus, dem Kultur und Fortschritt Herzensangelegenheiten
waren, auch die Kämpfe mit den jeder Kultur feindlich gesinnten
Orthodoxen nciht erspart waren, versteht sich wohl von selbst, und diese
Kämpfe, welche ihm manche bittere Stunde bereiteten, trafen ihn umso
empfindlicher, als er, Vater einer zahlreichen Familie, viele Jahre mit
der bittersten Not zu kämpfen hatte. Seit dem Erscheinen der 'Allgemeinen
Zeitung des Judentums' war er einer ihrer fleißigsten Mitarbeiter, auch
lieferte er mehrere Beiträge in Stein's Volkslehrer. Seine Arbeiten sind
Bausteine zu einer 'Geschichte der Juden in der Schweiz', die zu schreiben
er sich vorgenommen hatte. Die letzten Jahre seines Lebens verlebte er im
Kreise seiner hiesigen Kinder und war er bis zu dem kurz vor seinem 65.
Lebensjahre erfolgten Tode als Religionslehrer der hiesigen Gemeinde
tätig. Möge sein Andenken ein gesegnetes sein!" Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. Juni
1877: "Zürich, 1. Juni (1877). Heute Nachmittag wurde
hier ein Mann zu Grabe getragen, dessen Name auch über die Grenzen der
Schweiz gekannt und mit Achtung genannt wird; es ist dies der Lehrer Markus
G. Dreifus. Das Leben dieses trefflichen Mannes ist mit der
Kultusentwicklung der schweizerischen Israeliten eng verflochten. In Endingen
geboren, wurde er, nachdem er die Talmudschule und das Seminar in
Karlsruhe und auch kurze Zeit die Hochschule in Basel besucht hatte, an
der von der aargauischen Regierung neu organisierten israelitischen
Gemeindeschule seiner Heimatgemeinde als Lehrer angestellt, und wirkte an
derselben mit kurzen Unterbrechungen mit voller Hingebung bis zum Herbste
des Jahres 1870. Einige Jahre war er in der aufblühenden Gemeinde Genf
als Lehrer tätig und kurze Zeit als Redakteur des 'Bote' in Winterthur.
Dreifus war ein eifriger Verfechter der Rechte seiner Glaubensgenossen,
für deren bürgerliche und soziale Hebung er mit Mut und Ausdauer wirkte.
Schon im Jahre 1848 richtete er eine 'ehrerbietige Vorstellung an den
hohen Vorort in Bern' mit dem Gesuche, in der neuen Bundesverfassung
keine, die Emanzipation hindernde Beschränkung aufzunehmen. Sowohl durch
seine Artikel in den verschiedensten Journalen der Schweiz, als durch
seine Schriften 'Zur Würdigung des Judentums unter seinen
Nichtbekennern', 'Die bürgerliche Gleichstellung der Juden im Aargau'
u.a. hat er die Emanzipation der schweizerischen Juden mit zu fördern
gesucht. Dass einem Manne, wie Dreifus, dem Kultur und Fortschritt Herzensangelegenheiten
waren, auch die Kämpfe mit den jeder Kultur feindlich gesinnten
Orthodoxen nciht erspart waren, versteht sich wohl von selbst, und diese
Kämpfe, welche ihm manche bittere Stunde bereiteten, trafen ihn umso
empfindlicher, als er, Vater einer zahlreichen Familie, viele Jahre mit
der bittersten Not zu kämpfen hatte. Seit dem Erscheinen der 'Allgemeinen
Zeitung des Judentums' war er einer ihrer fleißigsten Mitarbeiter, auch
lieferte er mehrere Beiträge in Stein's Volkslehrer. Seine Arbeiten sind
Bausteine zu einer 'Geschichte der Juden in der Schweiz', die zu schreiben
er sich vorgenommen hatte. Die letzten Jahre seines Lebens verlebte er im
Kreise seiner hiesigen Kinder und war er bis zu dem kurz vor seinem 65.
Lebensjahre erfolgten Tode als Religionslehrer der hiesigen Gemeinde
tätig. Möge sein Andenken ein gesegnetes sein!" |
Nekrolog eines protestantischen Pfarrers für Lehrer
Markus Dreifuß (1877)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Juni
1877: "Eine Rede eines protestantischen Pastors. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Juni
1877: "Eine Rede eines protestantischen Pastors.
Wir können es uns nicht versagen, an dieser Stelle die Rede eines
protestantischen Pfarrers wiederzugeben, so gediegen an Inhalt und Form so
wahrhaftig und warm, dass sie auch uns tief bewegte. Wir geben sie wieder
als ein Zeugnis, dass der Geist der Liebe und der Erleuchtung doch noch
noch nicht ganz vor der konfessionellen Zwietracht und Verdunkelung
geschwunden ist, und zugleich als ein Zeugnis, mit welcher Freude wir jede
Kundgebung eines edlen und humanen Geistes aufnehmen. Die 'Schweizer
Grenzpost', die zu Basel erscheint, enthält in ihrer Nummer vom 11. Juni
einen Nekrolog des jüdischen Lehrers Markus G. Dreifuß, über
dessen Hinscheiden wir in voriger Nummer berichtet haben. Er
beginnt:
'Bei dem orkanartigen Sturm, der in entfesselter Macht, Freitag
Nachmittags, über die Stadt Zürich zog, wurde auf dem dortigen israelitischen
Friedhofe die irdische Hülle eines Mannes in die Erde gesenkt, der es
wohl verdient, dass seiner erwähnt werde.
Markus Dreifuß, bis vor kurzer Zeit Religionslehrer an der israelitischen
Kultusgemeinde Zürich, früher Lehrer in Endingen
(Aargau), |
 war
von Jugend an ein begeisterter Pionier für Licht, Recht und Wahrheit und
mit jugendlichem Feuer kämpft er unentwegt für die Ideale des Schönen
und Guten. Einziger Sohn wohlhabender Eltern, wählte er materielle
Vorteile verschmähend, den dornenreichen Beruf eines Lehrers. Ein
eifriger Freund der Wissenschaft, hatte er sich den Weg zur Hochschule in
Basel, wo er unter de Wette, Wackernagel, Fischer, Brünner, Lindner und
Stählin studierte, großenteils durch Selbstunterricht gebahnt und
später bei Fellenberg in Hofwyl lehrend und lernend sein Wissen
erweitert, das mehr in die Tiefe als in die Breite ging. war
von Jugend an ein begeisterter Pionier für Licht, Recht und Wahrheit und
mit jugendlichem Feuer kämpft er unentwegt für die Ideale des Schönen
und Guten. Einziger Sohn wohlhabender Eltern, wählte er materielle
Vorteile verschmähend, den dornenreichen Beruf eines Lehrers. Ein
eifriger Freund der Wissenschaft, hatte er sich den Weg zur Hochschule in
Basel, wo er unter de Wette, Wackernagel, Fischer, Brünner, Lindner und
Stählin studierte, großenteils durch Selbstunterricht gebahnt und
später bei Fellenberg in Hofwyl lehrend und lernend sein Wissen
erweitert, das mehr in die Tiefe als in die Breite ging.
Als Lehrer einer israelitischen Gemeinde war sein Hauptwirken darauf
gerichtet, seinen Glaubensgenossen in moralischer und politischer Hinsicht
ein menschenwürdiges Dasein zu bereiten'.
Nachdem dann Einiges über das Lehen des Verstorbenen gesagt worden,
was bereits in Nr. 25 mitgeteilt ist, heißt es weiter:
'Am offenen Grabe rief einer der Söhne in ergreifenden Worten dem
geliebten Vater das letzte Lebewohl zu. Dann trat Herr Furrer, Pfarrer
zu St. Peter, an den Sarg. Als ein besonders schönes Zeichen der Zeit
verdient es hervorgehoben zu werden, dass ein protestantischer Geistlicher
am Sarge eines Juden steht und spricht, wie dies der hochbegabte Redner
von St. Peter getan. Wie Prophetenstimmen drang es durch Sturm und Wetter
in die Herzen der von Nah und Fern herbeigeeilten Verehrer des Verstorbenen.
Die Worte, sie sind nicht verhallt im Brausen des Sturmes; sie werden
fortleben wie das Wirken des Verblichenen. Wir können es uns nicht
versagen, diese Worte hier wiederzugeben.
'Leidtragendende Freunde!' so sprach Herr Furrer, 'wir stehen am Grabe
eines Mannes, dem der allgütige Gott verliehen, bis in die letzten
Stunden seines Erdentages für die Ideale seines geistigen Lebens die
unverminderte Kraft und Frische des Gemütes bewahren zu können. Als
schönsten Ehrenkranz dürfen wir auf sein Grab das Zeugnis legen, dass er
die Grundsätze, die er einst mit jugendlicher Wärme erfasst hatte, für
die er mit der besten Kraft seiner Mannesjahre eingestanden, auch sterbend
noch festgehalten hat und dass er der Mahnung des großen deutschen
Dichters eingedenk war: 'Saget ihm, dass, wenn er Mann sein wird, er nicht
verachten soll die Träume seiner Jugend, dass er nicht soll irre werden,
wenn des Staubes Weisheit Begeisterung, die Himmelstochter,
lästert.' (sc. Zitat von Friedrich Schiller in: Don Karlos,
Infant von Spanien).
Wenn aber ich, freundlichem Wunsche folgend, an seinem Grabe rede, so tue
ich dies nicht bloß in dankbarer Erinnerung an das Wohlwollen, das unser
entschlafener Freund meiner geistigen Arbeit schenkte, sondern noch mehr
auf Grund zweier großen Prinzipien, zu denen wir uns gemeinsam bekannt
haben. Er wirkte in seinem Kreise mit aller Begeisterung, dass Freiheit
des Gewissens und Glaubens zu den unveräußerlichen Menschenrechten
gehöre, dass alles, was die Menschheit wahrhaft groß und gut macht, nur
in der Himmelsluft der Freiheit gedeihen und sich mehren könne. Ja, ihm
war es zweifellose Gewissheit, gerade in unserer Zeit müsse ein Jeder in freier
eigener Geistesarbeit sich eine feste Überzeugung gewinnen, wenn anders
er einen Halt haben wolle für Leben und Sterben, jeder müsse durch
eigene Anstrengung die uralte heilige Wahrheit sich zum persönlichen
Eigentum machen. Daher sei im Interesse der allgemeinen höchsten
Lebensgüter uns im festen Vertrauen auf die schließliche Allgewalt
dessen, was Gottes ist, die volle Freiheit geistigen Lebens und Strebens
zu gewähren.
Aber Freiheit und Freisinnigkeit soll nicht Gleichgültigkeit gegen die
Heiligtümer der Seele bedeuten, soll nicht leichtfertige Beneinung alles
dessen sein, wofür einst die Väter geglüht, gekämpft und geblutet
haben. Nein, es soll unvergänglich das Menschenherz eine heilige Stätte
in sich bewahren. Tugend ist kein leerer Wahn, der Glaube an eine ewige
Weisheit, Macht und Güte kein bloßer Traum, sondern innerste Gewissheit.
Und die hohen himmlischen Güter des Geistes erst geben dem Menschenleben
seinen heiligen Wert, wie seine unsterbliche Bedeutung.
So suchte der Entschlafene nach seiner Weise mit frischem, furchtlosem
Vorwärtsstreben pietätvolles Festhalten zu vereinen, nicht am Buchstaben
der Väter, aber an dem, was von Gottes Geist getrieben sie geglaubt und
verkündet hatten.
In dunkler Gewitterstunde stehen wir am Grabe dieses Mannes. Wie oft,
meine Freunde, hat es um Israel trüb und dunkel ausgesehen, wie oft
schien sternenlos seine Nacht zu sein und grenzenlos sein Leid! Aber immer
wieder ist Israel gerettet worden, gerettet durch den Idealismus seiner
besten Söhne, durch den kühnen Glauben, die hochherzige Gottesliebe
seiner Sänger und Propheten zum weltgeschichtlichen Beweis dafür, dass
eine große, tiefgewurzelte religiöse Überzeugung vereint mit tiefem
sittlichem Ernst, die stärkste Macht auch für die Völker ist in allem
Sturm und Schmerz der Zeiten. Gegen das Volk aber, aus dessen Reihen die
größten Wohltäter des menschlichen Geschlechtes hervorgegangen sind und
welches die Züge seines Genius in ihrem unsterblichen Bilde verklärt
hat, erfüllt mich ein Gefühl reiner und freier Dankbarkeit. Israel hat
zu allen Zeiten das Gebot hochgehalten: 'Ehre deinen Vater und deine
Mutter', und fern vom alten Heimatland in dankbarer, ehrfurchtsvoller
Liebe gegen die Eltern für Kinder und Kindeskinder die beste Stütze der Erhaltung
der engsten Heimat gesucht und gefunden. Möge dankbare Kindertreue
bleiben Israels unvergänglicher Ruhm. Möge an Gattin und Kindern unseres
entschlafenen Freundes all' die Liebe gesegnet sein, welche als hellster
Sonnenschein sein Leben durchleuchtet hat, möge gesegnet sein die Liebe,
die eines treuen Vaters über Tod und Grab hinaus nicht vergessen will,
und möge gesegnet sein Alles, was unser Freund mit Gottes Gnade
ausgestreut hat als Samenkörner ewigen geistigen Lebens. Das walte
Gott!'" |
Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers und
Schochet (1884)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. November
1884: "In der israelitischen Kultusgemeinde Zürich ist
die Stelle eines tüchtigen Religionslehrers und Schochet
per Dezember dieses Jahres zu besetzen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. November
1884: "In der israelitischen Kultusgemeinde Zürich ist
die Stelle eines tüchtigen Religionslehrers und Schochet
per Dezember dieses Jahres zu besetzen.
Gehalt Frcs. 2.000 - 2.500.
Bewerber, die zugleich im Stande sind, religiöse Vorträge abzuhalten und
eventuell Kantordienste zu leisten, belieben mit den nötigen Referenzen
deren Offerte einzureichen an
Leopold Weil, Präsident. Bahnhofstraße 77 Zürich."
|
Über die Religionsschule der Gemeinde
(1886)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 18. Mai 1886: "Zürich, im Mai. Die
Religionsschule. Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 18. Mai 1886: "Zürich, im Mai. Die
Religionsschule.
(Anmerkung: Wir kommen dem Wunsche des Vorstandes der israelitischen
Schulpflege in Zürich nach, diesem Berichte in dieser Zeitung Abdruck zu
gewähren, auch schon um die Leistungen einer Religionsschule in einer
nicht allzu großen Gemeinde in Erwägung zu stellen. Redaktion.)
Wie schon seit einigen Jahren, haben wir auch an diesem Pessachfest
Gelegenheit gehabt, durch die öffentliche Prüfung die Leistungen unserer
Religionsschule kennen zu lernen und zu würdigen.
Wie jede andere Religionsschule, hat auch die unsrige zu leiden,
einerseits durch die Gleichgültigkeit vieler Eltern gegen diese Anstalt,
andererseits dadurch, dass den Kindern die freie Zeit, die ihnen die
städtischen Schulen übrig lassen, mit Beschlag belegt wird, sodass sie
von vornherein unwillig in die Religionsschule kommen und die gestellten
Aufgaben erledigen.
Diese Übelstände hat unsere Religionsschule mit
anderen gemein, hier kömmt noch der Umstand hinzu, dass die Schulverhältnisse
in der eigentlichen Stadt und in den Vorstädten oder Außengemeinden
differieren, die Stundenpläne nicht übereinstimmen. So zum Beispiel ist
in der Stadt der Mittwoch Nachmittag nur für die Primar-Schüler (d.h.
für die Knaben und Mädchen bis zum 12. Schuljahr) frei, während die
älteren, die Sekundarschüler bis 5 Uhr Unterricht haben; und in den
Außengemeinden wiederum ist statt des Mittwoch, etwa der
Donnerstag-Nachmittag oder irgendein Vormittag frei. dadurch sind die
Schüler unserer Schule, die in den verschiedenen Gemeinden wohnen,
vielfach verhindert, dem Hauptunterricht, der auf Mittwoch Nachmittag
fällt, beizuwohnen. Für diese bleibt nur der Schulbesuch am Samstag
Nachmittag und Sonntag Vormittag. Selbstverständlich muss dadurch der
Unterricht der ganzen Schule leiden, indem kein einheitliches
Vorwärtsgehen möglich ist.
Trotz alledem berechtigen die Leistungen, die unsere Schule aufgewiesen,
zu dem Urteil, dass sie sich mit jeder anderen messen kann. |
 Mittwoch
den 21. und am 2. Tage Pessach wurden uns die unteren drei Abteilungen
vorgeführt, deren Prüfung von 2-6 Uhr Nachmittag in der Synagoge
stattfand. Mittwoch
den 21. und am 2. Tage Pessach wurden uns die unteren drei Abteilungen
vorgeführt, deren Prüfung von 2-6 Uhr Nachmittag in der Synagoge
stattfand.
Die unterste, hier I. Klasse genannt, also die Anfänger, haben schon nach
einjährigem Schulbesuch eine Fertigkeit im Lesen des Hebräischen
erlangt. Aus der biblischen Geschichte wussten sie die Schöpfungstage,
die Zehngebote, die Namen der Feste, außerdem einige Lehren der
Sittlichkeit und Menschenliebe.
Die Zöglinge der nächsthöheren II. Klasse lasen sehr gut nach den
Akzenten, übersetzten geläufig die meisten Gebete aus der Horwitz'schen
Fibel und erzählten zusammenhängend biblische Geschichte. Außerdem
konnten sie schon die einfachsten grammatischen Formen bilden. Die
Knaben und Mädchen der III. Klasse zeigten ordentliche Fertigkeit im
Lesen, waren sehr gut bewandert in der biblischen Geschichte bis zum Tode
Moses und wussten die wesentliche Bedeutung aller Feste, wie alle
sittlich-religiösen Gebote der Tora anzugeben. Die Konjugation durch die
drei Hauptzeiten war allen geläufig.
Samstag den 24. April wurde die oberste, die IV. Klasse von 2-6 Uhr in der
Synagoge geprüft. Die Schüler, Knaben und Mädchen von 13-14 Jahren
zeigten, dass sie mit der Gebetordnung für das ganze Jahr wohl vertraut
sind, dass die Bibelkunde ihnen nicht fremd, da die Knaben wussten sogar
die einzelnen Abschnitte des Talmud mit dem Inhalte anzugeben. In der Pflichtenlehre,
namentlich in dem Abschnitt, der von den Pflichten gegen die Nebenmenschen
handelt, waren sie gut bewandert. Sie konnten die Hauptgebete geläufig
übersetzen und die Knaben hatten im Pentateuch nicht nur die
durchgenommenen Pensa inne, sondern konnten jedes Wort grammatikalisch
analysieren.
Jeder, der ein warmes Herz fürs Judentum hat, musste sich innig freuen,
dass die Jugend mit so reichem Wissen ausgestattet wird, und so mancher
gestand sich wohl: In meiner Jugend wurde gar Vieles, was ich heute
gehört, nicht gelernt. Und in der Tat nicht nur diejenigen mussten
befriedigt sein, die von der Religionsschule nicht mehr verlangen, als
dass sie die Kinder mechanisches Beten und Hersagen des 'Benschen' lehre -
was übrigens schon die jüngern im Stande waren - auch diejenigen, die
einsehen, dass die Religionsschule die Pflicht hat, außer dem 'Was und
Wie', auch das 'Warum' zu lehren, sahen ihre Wünsche in vollem Maße
erfüllt." |
Die
Cultusgemeinde engagiert einen Schochet
(1887)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juni
1887: "Zürich, 3. Juni (1887). Eine Mitteilung, welche
auch für weitere Kreise Interesse haben dürfte, beeile mich, Ihrem
großen Leserkreise mitzuteilen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juni
1887: "Zürich, 3. Juni (1887). Eine Mitteilung, welche
auch für weitere Kreise Interesse haben dürfte, beeile mich, Ihrem
großen Leserkreise mitzuteilen.
Die hiesige Gemeinde hat einen Schochet engagiert, welcher bereits
von Russland zum Schächten autorisiert war und vergangene Woche vom
Rabbiner der Basler Gemeinde, Herrn Dr. Kohn, Autorisation (Kabbala)
erhalten hat." |
Antrag an die Schulbehörde im Blick auf die Befreiung
jüdischer Schuler von manuellen Tätigkeiten am Sabbat
(1901)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 20. Juni 1901: "Zürich, 18. Juni (1901). Die
hiesige israelitische Kultusgemeinde hatte im Verein mit der
israelitischen Religionsgesellschaft an die Zentralschulpflege das Gesuch
gerichtet, es möchte denjenigen Schülern, welche darum nachsuchen
würden, an Samstagen Dispens von manuellen Tätigkeiten (Schreiben,
Zeichnen, Handarbeiten) erteilt werden. Die Schulbehörde hat dieses
Gesuch nun abgewiesen wegen der Konsequenzen, die sich aus einer
Gewährung derselben ergeben könnten". Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 20. Juni 1901: "Zürich, 18. Juni (1901). Die
hiesige israelitische Kultusgemeinde hatte im Verein mit der
israelitischen Religionsgesellschaft an die Zentralschulpflege das Gesuch
gerichtet, es möchte denjenigen Schülern, welche darum nachsuchen
würden, an Samstagen Dispens von manuellen Tätigkeiten (Schreiben,
Zeichnen, Handarbeiten) erteilt werden. Die Schulbehörde hat dieses
Gesuch nun abgewiesen wegen der Konsequenzen, die sich aus einer
Gewährung derselben ergeben könnten". |
Zum Tod von Hermann Weill, Gründer der Israelitischen
Religionsschule
(1918)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 25. Januar 1918: "Zürich. Hermann Weill, Gründer
und Führer der Israelitischen Religionsschule, ist plötzlich verschieden.
Er kam 1875 von Karlsruhe nach Zürich und gründete hier 1878 die erste
Herrenkleiderfabrik in der Schweiz.
Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 25. Januar 1918: "Zürich. Hermann Weill, Gründer
und Führer der Israelitischen Religionsschule, ist plötzlich verschieden.
Er kam 1875 von Karlsruhe nach Zürich und gründete hier 1878 die erste
Herrenkleiderfabrik in der Schweiz.
In der Agudas Jisroel-Ortsgruppe sprach Josef Wormser über
das Thema 'Sollen unsere Gesinnungsgenossen nicht auch unsere
Standesgenossen sein?' Nach dem Vortrag wurden von den Anwesenden 5.000
Fr. für die Errichtung eines jüdischen Volksspeisehauses
gezeichnet" |
Ausschreibung der Lehrerstelle der Israelitischen
Cultusgemeinde (1920)
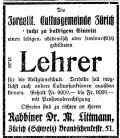 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Juni
1920: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Juni
1920:
"Die Israelitische Cultusgemeinde Zürich
sucht zu baldigem Eintritt
einen ledigen, akademisch oder seminaristisch gebildeten
Lehrer
für die Religionsschule. Derselbe soll möglichst auch andere Kultusfunktionen
ausüben können. Gehalt Fr. 6.000.- bis Fr. 9.000.- mit
Pensionsberechtigung.
Offerten sind zu richten an Herrn
Rabbiner Dr. M. Littmann, Zürich (Schweiz) Brandschenkestr. 51."
|
Zum Tod von Lehrer Dr. David Strauß (1921)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juli
1921: "Dr. David Strauß - er ruhe in Frieden. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juli
1921: "Dr. David Strauß - er ruhe in Frieden.
Zürich, 1. Juli (1921). Im Alter von 50 Jahren verstarb in Frankfurt
am Main, wo er sich auf dem Wege zu den Heilquellen in Nauheim befand, Dr.
David Strauß, der langjährige Religionslehrer und Vorbeter der
israelitischen Kultusgemeinde in Zürich. Eine Persönlichkeit war Dr.
David Strauß, die weit über die Grenzen der Schweiz hinaus allgeachtet
war. Einem frommen Hause in Hessen entstammend und Zögling des
Würzburger Lehrerseminars, blieb er im Ganzen den Traditionen der Schule
treu und galt als Vertreter des konservativen Judentums innerhalb der
links gerichteten Züricher Kultusgemeinde. Von diesem Geiste war sein
Religionsunterricht geleitet, und als Vorbeter des konservativen
Gottesdienstes übte er sein Amt mit Weihe und Würde und inniger Andacht
aus. So stand er fast ein Vierteljahrhundert seinem Amte bevor. Aber sein
reger Sinn strebte über den engeren Amtskreis hinaus und suchte
Betätigung in der jüdischen Welt, in der jüdischen Öffentlichkeit. Vor
21 Jahren gründete er zusammen mit Herrn Rabbiner Dr. Littmann das
'Israelitische Wochenblatt für die Schweiz', das er 18 Jahre lang
leitete und redigierte. In der Armenpflege, wie in anderen Institutionen
der Gemeinde nahm er eine hervorragende Stellung ein. In aufrichtiger
Liebe und Kollegialität war er den Amtsgenossen zugetan. Sein
Lieblingsgedanke war von jeher, alle jüdischen Lehrer und Kantoren in der
Schweiz in einem Verbande zusammenzufassen und er war auch sonst immer
bemüht, die Interessen seiner Kollegen kräftig wahrzunehmen. Ein guter
Mensch, ein goldreiner Charakter und ein erfolgreicher Arbeiter, der keine
Ruhe noch Rast kannte bei der Erfüllung der ihm gestellten und
selbstgewählten Aufgaben, ist von uns gegangen. Die Entwicklung des
jüdischen Lebens in der Schweiz hat ihm manches zu verdanken und die
schweizerische Judenheit wird ihm wie seine Gemeinde ein ehrendes Gedenken
bewahren.
Die Beerdigung fand am Montag Nachmittag auf dem Züricher Friedhof unter
großer Beteiligung statt. Herr Rabbiner Dr. Littmann feierte in
seiner Abschiedsrede die Verdienste des Verstorbenen und schilderte seinen
Werdegang und sein Wirken. Darauf widmete der Präsident der Gemeinde,
Dr. Ch. Bollag dem treuen Gemeindebeamten Worte der Anerkennung und
des Dankes. Herr Gabriel Ortlieb sprach im Namen der Besucher des
Betsaales Worte herzlichsten Dankes. Zuletzt sprach Herr Prediger und Kantor
Messinger aus Bern als Freund und
Kollege sehr warm empfundene Worte. Seine Seele sei eingeb unden in den
Bund des Lebens." |
Ausschreibung der Stellen des Hilfspredigers und
Hilfsvorbeters der Cultusgemeinde (1923)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juli
1923: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juli
1923:
"Israelitische Cultusgemeinde Zürich.
Wir suchen für die bevorstehenden Hauptfeiertage einen
Hilfsprediger,
der in unserem Nebengottesdienst die Funktionen des Rabbiners und
Predigers zu vollziehen hätte, sowie einen
Hilfsvorbeter
für unsere Synagoge. Meldungen mit guten Zeugnissen und Empfehlungen
erbeten an den Präsidenten der Synagogenkommission, Herrn J.
Dreifuß-Nordmann, Büro der Israelitischen Cultusgemeinde,
Löwenstraße 10, Zürich (Schweiz)." |
Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers der
Cultusgemeinde (1924 / 1934)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. September 1924: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. September 1924:
"Wir haben in unserer Gemeinde die Stelle eines seminaristisch
gebildeten
Religionslehrers
offen. Der Bewerber hat außerdem im Nebenamt Rabbiner- und
Vorbeter-Funktionen zu erfüllen. Wir reflektieren auf eine junge,
tüchtige Kraft. Gehalt Fs. 6000-9000 (Pensionsberechtigung).
Ausführliche Anmeldungen mit Lebenslauf und Zeugnis-Abschriften sind zu
richten an den
Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Zürich (Schweiz)."
|
| |
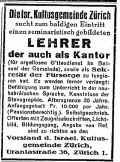 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Januar 1934: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Januar 1934:
"Die israelitische Kultusgemeinde Zürich
sucht zu baldigen Eintritt einen seminaristisch gebildeten
Lehrer, der
auch als Kantor
(für orgellosen Gottesdienst im Betsaal der
Gemeinde), sowie als Sekretär der Fürsorge zu fungieren hat. Es
werden ferner verlangt. Befähigung zum Unterricht in der neuhebräischen
Sprache, Kenntnisse der Stenographie. Altersgrenze 35 Jahre. Anfangsgehalt
Fr. 10.000 per Jahr (pensionsberechtigt). Selbstgeschriebene Offerten mit
Zeugnisabschriften, Lichtbild, Bildungsgang, Angabe von Referenzen sind zu
richten an den
Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Zürich, Uraniastraße 36,
Zürich 1."
|
|